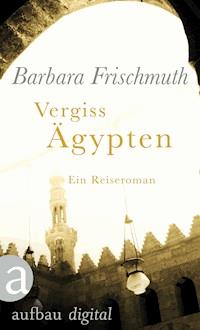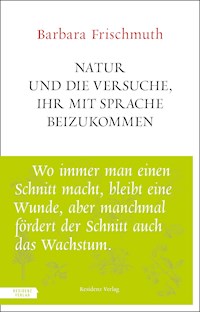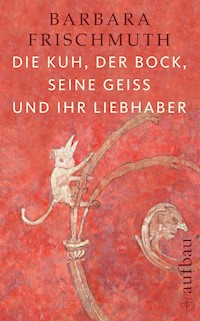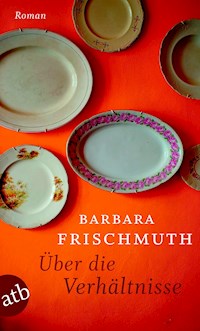8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Von der Magie, dem Unerklärlichen und der Verlorenheit einer Kindheit.
Dieser Roman entfaltet einen großen Zauber. In dem arglosen Blick eines Mädchens wird die Kindheit an einem Ort lebendig, an dem Heil und Unheil Tisch an Tisch zur Sommerfrische saßen. Als es die Klosterschule verließ, endete auch die Kindheit. Aber Fotos und Erzählungen locken die Zeitstimmung und eine besondere Familiengeschichte hervor.
»Es lag wohl an der vielen vergangenen Zeit, dass sie sich wesentlich entspannter über die verschüttete Milch von damals auslassen konnten.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 344
Ähnliche
Über Barbara Frischmuth
Barbara Frischmuth, 1941 in Altaussee (Steiermark) geboren, studierte Türkisch, Ungarisch und Orientalistik und ist seitdem freie Schriftstellerin. Seit einigen Jahren lebt sie wieder in Altaussee.
Nach ihrem von der Kritik hochgelobten Debüt »Die Klosterschule« und dem Roman »Das Verschwinden des Schattens in der Sonne« wurde sie vor allem mit der zauberhaften und verspielten Sternwieser-Trilogie bekannt, der die Demeter-Trilogie folgte.
Neben weiteren Romanen wie »Die Schrift des Freundes«, »Die Entschlüsselung«, »Der Sommer, in dem Anna verschwunden war«, »Vergiss Ägypten« und »Woher wir kommen« veröffentlichte sie u. a. Erzählungen und Essays. Zuletzt erschien »Der unwiderstehliche Garten«, das vierte ihrer literarischen Gartenbücher.
Informationen zum Buch
Von der Magie, dem Unerklärlichen und der Verlorenheit einer Kindheit.
Dieser Roman entfaltet einen großen Zauber. In dem arglosen Blick eines Mädchens wird die Kindheit an einem Ort lebendig, an dem Heil und Unheil Tisch an Tisch zur Sommerfrische saßen. Als es die Klosterschule verließ, endete auch die Kindheit. Aber Fotos und Erzählungen locken die Zeitstimmung und eine besondere Familiengeschichte hervor.
»Es lag wohl an der vielen vergangenen Zeit, dass sie sich wesentlich entspannter über die verschüttete Milch von damals auslassen konnten.«
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Barbara Frischmuth
Verschüttete Milch
Roman
Inhaltsübersicht
Über Barbara Frischmuth
Informationen zum Buch
Newsletter
Teil I Die Kleine
Teil II Juli
Teil III Juliane
Impressum
Teil I Die Kleine
Das Dorf im Gebirge lebte nicht von seinen Agrarprodukten, dafür war das Klima zu rau, sondern vom Salz, das abgebaut, und vom Tourismus, der in den letzten eineinhalb Jahrhunderten aufgebaut worden war. Es gab zunehmend mehr Zweithaus- und Zweitwohnungsbesitzer als seit Generationen im Familienbesitz befindliche Bauern- und Bergarbeiterhäuser und wesentlich mehr Gäste, die jahrelang im selben Privatquartier anstatt im Hotel wohnten. Mit der Zeit trugen auch weitaus mehr Sommerfrischler ihre Zweitkleidung als die Einheimischen, die sich wenigstens auf diese ihre Kleidung als angestammte Tracht berufen konnten.
Sei’s drum, alles fließt, und nichts bleibt, wie es ist, nicht einmal das Wetter. Dem allgemeinen Klimawandel folgend, verzichtete das Dorf auf die langen sommerlichen Regenperioden, die mit ihren unwirtlichen Kälteeinbrüchen samt unberechenbaren Überschwemmungen die saisonmäßige Zuwanderung einigermaßen im Zaum gehalten hatten.
Die Chancen für einen absichtlich herbeigeführten Sonnenbrand stiegen, wodurch er an Attraktivität verlor, während er noch Jahre zuvor den raren Tagen mit sommerlicher Hitze als Trophäe abgetrotzt worden war.
Inzwischen bedurfte es sogar mehrerer Schichten schützender Cremes, so dass die Oberfläche des Sees, aber auch der umliegenden größeren und der höher gelegenen kleineren Seen so gut geölt war, dass sogar Kleinkinder mit empfindlicher Haut gefahrlos, ohne mit unliebsamen Verbrennungen rechnen zu müssen, darin plantschen konnten.
Was die Hygiene betrifft, war der See mittlerweile durch effiziente Kanalisierung so perfekt von Abwässern gereinigt, dass man ihm Trinkwasserqualität nachsagte.
Wovon aber sollten nun die landesweit bekannten Fische leben, die sich nicht kannibalisch ernähren, sondern von Exkrementen, die, von Algen weiterverdaut, zu Fischfutter werden? Kein Wunder, dass die Bestände zum Nachteil der Gastronomie schrumpften, wobei die fortschreitende Erwärmung der Seen, auf denen auch im tiefsten Winter kaum noch Eis wuchs, ihren Teil dazu beitrug.
Womit wir wieder bei den Sonnenbränden wären. Juliane konnte sich noch an Gäste im Hotel ihrer Mutter erinnern, die abends in die Küche geschlichen kamen und um Topfen baten, um die Fahnenröte ihrer Haut an den Stellen, die am meisten schmerzten, mit dem weißen Frischkäse zu bestreichen, und so undanks einem Patriotismus zuarbeiteten (Rotweißrot), mit dem sie kaum was am Hut hatten (Tu felix Austria nube).
Juliane war der Einfluss des Orts auf die Entwicklung ihres Bewusstseins bewusst, jenes Orts, an dem Heil und Unheil Tisch an Tisch zur Sommerfrische saßen (und wohl noch immer sitzen). Mit ein Grund, warum die Gerüchte jeweils bis zur Baumgrenze emporkochten (reale Beispiele von Jungfernzeugung), Gerüchte, aus denen Geschichten mit angepasster Wahrheitsfindung entstanden und Teil einer breit aufgestellten chronistischen Geschichtsschreibung wurden, bei welcher es vor allem auf das Augenpaar hinter der Linse ankäme, wie Hermann Broch in seinem Essay zu Hugo von Hofmannsthal anmerkte. (Oder war es doch der Essay zu James Joyce?)
Mnemosyne, die Göttin des Gedächtnisses, der Erinnerung, wenn man so will, ist keine zuverlässige Gefährtin. Sie, die Mutter der Musen, ließ nicht von ungefähr ihre Töchter Hesiod, damals noch Schafhirte, ausrichten, sie wüssten wohl zu lügen, aber mehr noch dem Wirklichen Ähnliches und, wenn ihnen der Sinn danach stehe, Wahres zu verkünden.
Das kam Juliane in den Sinn, als sie ein bestimmtes Foto aus ihren jüngsten Jahren suchte und es lange nicht finden konnte, obgleich sie die drei größeren und die fünf kleineren Kartons immer wieder durchpflügt hatte. All die Jahrzehnte, die sie nun schon im Besitz ihrer Kindheitsfotos war (Fotos, über die ihre Mutter verfügt hatte und die sie ihr nach und nach überließ), hatte sie sich, trotz guter Vorsätze, nie dazu aufgerafft, sie in Alben zu kleben, ja nicht einmal dazu, sie chronologisch zu ordnen.
Die Fotos lagen, meist mit dem Gesicht nach unten, in den verschiedensten Größen schutzlos übereinander, und Juliane hatte sie im Bedarfsfall schichtweise, so viel sie mit einer Hand gerade fassen konnte, aus dem jeweiligen Karton gehoben und auf dem Schreibtisch ausgebreitet. Meist ging es dabei um einzelne Aufnahmen, an die sie sich aus irgendeinem Grund erinnerte und denen sie mehr Details zu entlocken hoffte als ihr im Gedächtnis geblieben waren. Indes sie die anderen, im Schnellverfahren und gefächert, wieder in die Kartons fallen ließ. Sie musste gar nicht das ganze Foto sehen, um zu wissen, ob es zu denjenigen gehörte, an denen sie ihr Erinnerungsvermögen testen wollte.
Diesmal war die Suche dem Gespräch mit einer Freundin geschuldet, die behauptet hatte, die Erinnerung an die eigene Kindheit reiche nicht weiter als ins vierte Jahr zurück, alles davor sei wissenschaftlich nicht zu sichern und daher unglaubwürdig. Aber da gab es dieses eine Foto, auf dem Juliane wohl höchstens zwei Jahre alt gewesen war und an dessen Tatsächlichkeit sie sich zu erinnern glaubte.
Wann auch immer sie zu einem der Kartons griff, war sie nicht nur ihrer Kindheit auf der Spur, auch der Ort, an dem sie geboren war und die ersten zehn Jahre ihres Lebens verbracht hatte, trat dabei mit eigenem Anspruch in ihr Bewusstsein und forderte Aufmerksamkeit, bildete er doch den Hintergrund all der Erzählungen, die sich aus den einzelnen Fotos ergaben.
Der Ort war nicht bloß Kulisse und Stimmungsvermittler, er war sich seiner landschaftlichen Anziehungskraft ebenso bewusst wie des Eindrucks, den er bei einer Vielzahl von Menschen hinterlassen hatte, die daher auch einiges zu ihm zu sagen, zu singen und zu schreiben gewusst hatten.
Als sie das Foto dann irgendwann doch gefunden und mittlerweile mehr Muße für Recherchen hatte, widmete sie sich auch jenen nicht gesuchten Fotos länger als gewöhnlich und saß plötzlich in einer Zeit fest, die sie wie Alice im Wunderland nicht bloß in einen selbst geweinten See von Tränen fallen, sondern auch ständig kleiner und größer werden ließ. Sie entfremdete sich ihrer selbst, indem sie feststellte, als Kind eben noch nicht die Person gewesen zu sein, zu der sie nach all den Jahren geworden war, und dass sie bei der Einschätzung ihres früheren Ichs auf diffuse Erinnerungen, willkürliche Vermutungen, Aussagen anderer sowie auf die eigene Phantasie angewiesen blieb, die sich immer mehr Spielraum verschaffte, je weniger Zeugen noch am Leben waren, die ihr die eine oder andere Frage hätten beantworten können.
Eigentlich hätte die Kleine ein Kleiner werden sollen. Ihr Vater hatte mit einem seiner Freunde, einem Bäcker aus dem Nachbarort, um eine hundert Jahre alte Flasche Cognac gewettet, die derjenige bekommen sollte, der als Erster einen Sohn gezeugt haben würde. Ihrer beider Ehefrauen waren bereits schwanger, doch beide gebaren Mädchen, so dass die Wette hinfällig wurde und die Flasche Cognac die Chance bekam, in Ruhe weiterzureifen.
Die Kleine wurde auf den Namen Juliane Felizitas Hedwig getauft, war aber bis zu ihrer Einschulung die Kleine geblieben.
Ich! Ich und die Sonnenbrille, sagte das Foto. Eine zu große Sonnenbrille auf einer zu kleinen Nase in einem zu alten Liegestuhl. Vor dem Wohnhaus, diesseits der Buchenhecke, weit genug vom See, damit die Kleine nicht sogleich ins Wasser fiele, und nah genug an der Küche, dass d’Anna ein Auge auf sie haben konnte.
Wem gehörte die Sonnenbrille, und wer hatte die Kleine damit fotografiert?
Sie schaute in eine Welt voller Sonnenbraun, mit gezackten Löwenzähnen, spitzen Storchschnäbeln, gefiederten Hahnenfüßen, alles wie leicht angebrannt, sagte das Foto. Die Sonne selbst hatte einen stahlblauen Kern, und an manchen Stellen des Himmels rüschten sich Schäfchenwolken wie die Ränder eines Pralinenpapiers.
Juliane schüttelte den Kopf. Wo sollte sie, mitten im Krieg, Pralinenpapier kennengelernt haben? Höchstwahrscheinlich wusste die Kleine damals noch gar nichts von Pralinen. Das Hotel wurde weitergeführt. Requiriert, aber von der Mutter weitergeführt. Da kamen ganze Lieferungen mit Delikatessen aus Frankreich, damit die verdienten Offiziere merkten, wofür sie gekämpft hatten.
Wahrscheinlich das Trauerjahr der Mutter, der Vater war kurz vor Weihnachten 43 in Russland gefallen. Die Mutter hatte ihr später erzählt, sie habe sich von ihrer Schwägerin Ricarda ein Paar schwarze Strümpfe geliehen und sich damit auf dem Weg um den See wundgegangen. Die Blasen waren bereits auf halber Strecke geplatzt, am Ende wurde eine Blutvergiftung daraus.
Ich sitze und schaue, sagte das Foto, und halte die Sonnenbrille fest. Wenn ich sie ein bisschen runterziehe, blendet mich die Felswand, und wenn ich sie wieder raufschiebe, schaut der weiße Schmetterling aus, als hätte ihn d’Anna durch den Kakao gezogen.
Juliane glaubte noch immer zu spüren, wie die Sonnenbrille ihre Welt veränderte, dennoch war sie nicht mehr ganz sicher, ob sie sich tatsächlich an diese Sonnenbrillen-Geschichte oder bloß an deren Foto erinnerte, das sie seit vielen Jahren kannte.
Ich liege in der Sonne und schaue über die Hecke hinauf zum Loch in der Felswand, das viel schwärzer ist als sonst. Warum?
Juliane legte weitere Fotos wie Karten beim Rommé-Spielen auf den Tisch.
Wie mag die Zweijährige sich gefühlt haben, als ihr Vater und sein jüngster Bruder sie sich gegenseitig zuwarfen? Zumindest behauptet das Foto es. Hat sie die Luft gespürt, durch die sie geflogen ist? Oder heben sie sie nur in die Höhe, um sie einander in die Arme zu legen? Lacht sie ebenfalls wie Vater und Onkel Laurenz? Der Oberkörper des Kindes, dem das Mäntelchen beim Heben nach oben gerutscht ist und seinen kleinen Hintern preisgibt, ist von der Strenge des Formats gekappt worden. (Entweder Vater als Ganzes oder Kind als Ganzes.)
Angeblich hatte der Vater die Kleine bloß zweimal im Leben gesehen.
Vielleicht stammte dieses nächste Foto aus demselben Jahr wie das mit der Sonnenbrille. Juliane suchte nach Spuren von Erinnerung. Weihnachten 1943 steht auf der Rückseite. Keine Spur von Christkind oder Weihnachtsengeln. Ein paar mühsam zu einer Tolle gekämmte Seidenhaare, links und rechts störrisch abstehende Büschel. Kariertes Barchentkleid (vulgo Baumwollflanell) mit vorne geteiltem Bubikragen in Weiß. In den Händen einen Apfel, der Glanz der polierten Schale spiegelt sich in der Aufnahme. Kein Glanz in den Augen des Kindes, der Mund leicht geöffnet, wahrscheinlich zur Formung eines Lauts, der nicht nach Bekundung von Freude aussieht. Keine sichtbaren Tränen, aber eine erkennbare Andeutung von kurz davor oder gleich danach.
Juliane war im Sommer 41 auf die Welt gekommen. Eine ihrer legendären Großtanten, beide dem Sagen nach Schönheiten, wenn auch, ästhetisch gesehen, zu klein für ihre Zeit, hieß ebenfalls Juliane. Juliane hatte sie als Juli noch erlebt. Tante Schröck mit dem Hund, einer schwarzen Dogge, zweimal so groß wie sie, Juli, und Tante Bittenburg mit dem großen Hut und dem wackelnden Kopf, beide steinalt und befehlsgewohnt. In der Familie sprach man über sie nur mit ihren angeheirateten Namen, die Schröck und die Bittenburg.
Julianes Mutter fürchtete ihre Besuche. Sie hatten, bevor sie heirateten und wegzogen, gemeinsam das Hotel als Dependance des Stammhauses geführt und kamen gelegentlich zur Besichtigung, wobei sie nicht mit Ratschlägen sparten.
Einmal in Gang gesetzt, fingen die wachgerufenen Erinnerungen an, sich weit über die bildlichen Unterlagen hinaus zu verzweigen, aber auch zu verknüpfen, wie diese Kellergeschichte, für die es kein Foto gab. Da war der Keller. Juliane sah das Bogenfenster, das mit seinen Zwischenstreben an die Hälfte eines Tortenschneiders erinnerte, und spürte geradezu die kühle, leicht nach korkelndem Wein und lehmverkrusteten Erdäpfeln riechende Luft in der Nase. Sie wusste nicht mehr, ob die Kleine im Keller unten oder oben vor dem Kellerfenster gestanden war. Aber sie sagte: Nein! Ein Nein, das tief in ihr drin gehockt war und sich endlich aus dem Keller befreien hatte können. Aus dem stummen Keller. Sie sagte: Mama, nein!, Tante, nein!, Robi, nein!, Bigi, nein!, Moni, nein! Sie sagte: Nein und nein und nein! Einen ganzen Tag lang, bis sie dieses Wort auf die Welt gebracht hatte, anstatt zu weinen, wenn sie nicht sagen konnte, was sie sagen wollte. Und doch hatte Juliane das Kellerfenster noch immer vor Augen, so wie diesen ersten Baum, den sie als Baum angesprochen hatte und der als Blutbuche aufblitzte, wann immer sie das Wort Baum aussprach.
Anders Weihnachten 44. Eine Art Schaumrolle aus Haar mitten auf dem Kopf, links und rechts je ein Scheitel, von dem das Resthaar, leicht gelockt, beinah die Schultern erreicht. Ein anders kariertes Kleid. Der weiße Kragen mit leicht gefältelter Spitze gesäumt. Die Finger ineinander verhakt, nicht gefaltet. In den Augen freudige Erwartung, der Mund, als plappere er gerade.
In Julianes Kopf ist nur Dunkelheit, dann ein Glöckchen, Lichter an einem Baum, darunter eine Puppenwiege. Ihre Mutter noch immer in Schwarz und sehr groß. So groß wie der Christbaum und schwarz wie die hinteren Ecken des Zimmers, wo das Licht der Kerzen nicht hinfällt. Keine weiteren Details. Juliane konnte sich auch nicht daran erinnern, ihre Mutter weinen gesehen zu haben. Leise rieselte der Schnee.
Der Sommer davor oder danach, keine Datierung. Die Kleine in kurzen Ärmeln und Spiel-, das heißt Latzhose, im Sportwagerl, in dem Kinder nicht bloß liegen, sondern sitzen und selbst ein- und aussteigen. Sie können bereits einwandfrei gehen, ermüden aber leicht, haben dann keine Lust mehr, die Beine gezielt zu heben, ohne sich an jemandem festzuhalten.
Ich sitze und schwitze, sagt das Foto, und die Kleine kneift die Augen zusammen, diesmal ohne Sonnenbrille.
Das Wagerl hat weißlackierte Seitenteile aus Korbgeflecht, die auch als Armlehnen dienen, eine gepolsterte Rückwand und einen hohen, nach oben geschwungenen Griff aus mit Rattan umwickeltem Metall; »oben« heißt: in Ellbogenhöhe von Erwachsenen.
Hinter dem Wagerl mit der darin sitzenden Kleinen steht eine Bank vor der Wohnhauswand (leicht auszumachen, weil aus Stein, dem sogenannten Fludergrabenmarmor), weiter rechts der Stamm von mehrfach auseinanderlaufenden Ästen des wilden Weins, der bereits einen Großteil der ab dem ersten Stockwerk hölzernen Fassade erobert hat.
Auf der Bank eine alte Pferdedecke, darüber weiße, sichtlich aus dem dahinter liegenden Schlafzimmer von der Anna, Hausfrau mit Nebenpflichten, und Xaver, dem Gärtner, der auch Fuhrknecht war, ins Freie geholte Pölster. Sie wohnten zur ebenen Erde, wohin im Frühjahr manchmal das Wasser kam. Meist nach der Schneeschmelze, wenn der See überlief und man mit der Plätten (einem, ähnlich den Gondeln von Venedig, einrudrigen flachen Holzboot) um Wohnhaus und Hotel herumfahren konnte.
Die Kleine liebte das Wasser, trank viel, badete gerne, trat begeistert in tiefe Pfützen und hüpfte darin herum, hatte schon bald ihre Wertschätzung von Klospülungen bekundet und hielt, wenn ihr heiß war, den Kopf unter den Wasserstrahl des Springbrunnens im französisch angelegten Teil des Hotelparks.
Das alles war Juliane von der Kleinen geblieben, und sie erinnerte sich vage, auch ohne weitere Dokumentation, an den ersten Alleingang Richtung See.
Die Kleine hatte begonnen, das Sportwagerl öfter zu schieben, als bloß in ihm zu sitzen. Der geschwungene Griff war ihr viel zu hoch, und so stützte sie sich mit beiden Armen auf die Seitenlehnen unterhalb des Griffs und schob das Wagerl vor sich her. Anfangs noch nicht zielstrebig, aber irgendwann hatten ihre Arme begriffen, dass sie das Wagerl nicht bloß schieben, sondern auch lenken konnte.
Hänschen klein, ging allein, hatte d’Anna ihr beigebracht, und nachdem alle Zähne da waren, schien es nur eine Frage der Zeit, wann die Kleine auch in die weite Welt hinein trällern konnte.
Was aber ist die Welt?, hatte d’Anna einmal gefragt.
Alles, was der Fall ist, hatte der gebildete Sommergast während eines Gesprächs gemeint, als er sich von ihr etwas Kamillentee erbeten hatte, um seinen Magen wieder auf gleich zu bringen. Er war als Fronturlauber ins Hotel gekommen und hatte angeblich noch den Vater des Kindes gekannt, der jedoch inzwischen von mehreren Granaten zerfetzt worden war.
Was ist denn diese Welt?, hatte d’Anna gefragt und hinzufügen wollen, dass sie ein Irrenhaus sei. Aber der belesene Gast war ihr mit seiner Antwort zuvorgekommen und hatte weitergefragt: Und was ist nun der Fall?
D’Anna, deren einziges Kind kurz nach der Geburt gestorben war, überlegte einen Augenblick, bevor sie sagte: Alles rundum! Wenn es die Welt überhaupt gibt. Sie erschrak sogleich über ihren Zweifel an der Welt, der ihr einfach herausgerutscht war, fuhr aber mit umso größerem Nachdruck fort, dass das Dorf, die Berge, der See, dass das eben alles der Fall sei, je weiter weg, desto mehr im Krieg.
Die Kleine übte sich im Wagerllenken und sang sich in die weite Welt hinein.
Hänschen klein, zwitscherte sie gerade, als ihre Mutter kurz vorbeischaute, bevor sie sich nach dem Mittagsgeschäft ein wenig hinlegte, um dem Abendgeschäft gewachsen zu sein. Sie hatte die Kleine noch nie singen gehört und sich an den hohen Piepstönen entzückt, die sie von sich gab.
Irgendwann machte sich die Kleine auf die Reise. Das Kindermädchen hatte seinen freien Tag, die Mutter fiel immer tiefer in ihren Erholungsschlaf, und d’Anna, die die Kleine noch im Wagen schlafend gesehen haben wollte, war hinters Haus gegangen, um die Wäsche aufzuhängen.
Wahrscheinlich hatte die Kleine auch bereits von der weiten Welt geträumt, denn kaum war sie aufgewacht, stand sie auf, den kleinen Kübel und die kleine Schaufel vom Sandhaufen unter der Außentreppe zu holen, legte beides in den Wagen, man konnte nie wissen, was in der weiten Welt alles vonnöten war, und begann zu lenken.
Sobald sie auf die Schotterstraße kam, entschied sie sich für rechts, ahnend oder vermutend, das wusste Juliane nicht mehr, auch wenn sie sich noch so sehr aufs Erinnern konzentrierte, dass das in Richtung Klause führen würde, wo das Wasser des Sees sich zusammenzog, um Platz im Fluss zu finden, als der das Seewasser jenseits der Klause weiterhastete.
Entweder waren sämtliche Bewohner des Hotels, aber auch die gar nicht so seltenen einheimischen Spaziergänger wie von unbekannter Hand zum Verschwinden gebracht worden oder der Zufall hatte gerade wieder einen seiner unwahrscheinlichsten Auftritte, jedenfalls begegnete der Kleinen auf ihrem Weg zum Abenteuer niemand. Niemand fragte sie, wo sie denn hinwolle oder wem sie gehöre (lokale Redewendung zur genealogischen Herkunft), oder erkannte sie, was bei Einheimischen sehr wahrscheinlich gewesen wäre.
Die Kleine hörte das Wasser immer deutlicher rauschen, roch die Fische, die in ihm standen und sich mit leichtem Schwänzeln gegen die Strömung stabil hielten. Sie kannte die Fische vom Fischbehälter des Hotels, aber darin hatten sie kaum Platz zum Schwimmen, stiegen wie benommen auf und ab, und aus ihren Mäulern perlten winzige Blasen nach oben.
Hier aber, die Kleine stieß einen Schrei der Begeisterung aus, standen sie zwar auch eine Weile, doch immer wieder stob einer von ihnen gedankenschnell nach vor ins Dunkel des tiefer werdenden Sees, während andere sich bis zur Klause treiben ließen, um abrupt anzuhalten und leicht fächelnd stillzustehen.
Die Kleine klatschte in die Hände und beugte sich weit über die mittlere Geländerstange hinaus, um besser sehen zu können. Auf einmal erblickte sie im Wasser ein Kind, das ebenfalls in die Hände geklatscht und vor Freude seine Zähne gezeigt hatte. Die Kleine strampelte jetzt geradezu vor Freude. Sie winkte dem Kind zu, sang Hänschen klein und beugte sich noch ein wenig weiter über die Stange.
Das Wasser war so stark und so schnell, doch das Kind im Wasser streckte nur seinen Kopf vor, winkte und wurde nicht von der Strömung mitgerissen. Warum sollte sie nicht auch ins Wasser kommen zu diesem Kind, das winkte und sich ebenfalls zu freuen schien?
Die Kleine begann zu überlegen, ob sie nicht einfach ins Wasser springen sollte. Das andere Kind würde sie vielleicht auffangen oder ihr zeigen, wie sie sich selbst in der Strömung halten konnte. Sie winkten einander noch immer zu.
Da fiel ihr ein, dass sie am besten das Wagerl mitnahm. Dann könnten sie beide es schieben oder sich wenigstens hineinsetzen, wenn sie müde waren. Platz darin würden sie sicher beide haben, das wusste sie, hatte sich doch Robi, ihr Cousin, schon öfter zu ihr ins Wagerl gesetzt, allerdings ohne dass sie es wollte. Jetzt wollte sie, dass das andere Kind sich zu ihr setzte und sie beide vor der Klause hin und her fuhren oder weiter in den See hinaus.
Sie zog den Kopf zurück und versuchte, das Wagerl unter der mittleren Geländerstange hindurchzuschieben. Und als das nicht funktionierte, begann sie das Wagerl zu treten.
Das Kind im Wasser schien schon zur Seite gerückt zu sein, damit das Wagerl nicht auf es drauf fiel, aber wann immer sie den Kopf über die Geländerstange streckte, war das Kind wieder da.
Wart nur, sagte sie: Ich komme gleich. Das andere Kind schien auch etwas gesagt zu haben, aber das Wasser schäumte zu sehr unter der Brücke, als dass man es hätte verstehen können. Plötzlich gab die Griffstange des Wagerls nach, als sie mit beiden Händen danach griff, und es bäumte sich ein wenig auf.
In die weite Welt hinein, sang sie vor Glück darüber, dass sie nun wusste, wie es gehen könnte. Sie musste bloß die Griffstange noch mehr nach unten drücken. Sie hatte zu schwitzen begonnen vor lauter Sichplagen, und ihre Spielhose fühlte sich heiß und nass an.
Aber da war ja das Wasser, kühl und weich, nicht so kratzig wie die Strümpfe, die man ihr neulich an einem kalten Regentag angezogen hatte, zusammen mit einem gestrickten Kleid.
Ins Wasser rein, ins Wasser rein, summte sie anstatt in die weite Welt hinein und schickte ihre ganze Kraft in die Arme, um die Griffstange ein kleines bisschen weiter nach unten zu drücken.
Die Kleine war so erschrocken, dass sie noch im letzten Moment beinah unter dem Geländer durchgerutscht und in die Strömung gefallen wäre. Sie hatte den Xaver nicht kommen gehört. Der sie, wie er später erzählte, gerade noch an den Trägern der Latzhose erwischt, sie sich über die Knie gelegt und ihr den Hintern ausgehaut hatte.
Juliane konnte sich nicht an Schläge (Dresch vergeht, Arsch besteht), wohl aber an Xavers Fluchen erinnern. Sie bezweifelte, dass er sie überhaupt je geschlagen hatte. Aber damals hätte niemand es verstanden, wenn ihm die Hand nicht ausgerutscht wäre.
Woran sie sich erinnern konnte, war, dass er sie, noch immer heftig fluchend, mit festem Griff in das Sportwagerl gesetzt hatte.
Und da bleibst jetzt sitzen, ein für alle Mal! Dann hatte er die Griffstange mit einem Pferdestrick am Gepäcksträger seines Fahrrads festgezurrt und ihr unter Androhungen aller Art befohlen, sich weder zu rühren, noch auch nur einen Mucks zu machen.
Die Kleine hatte sich noch nicht von dem Schrecken erholt, den Xaver verursacht hatte, und rührte sich weder, noch machte sie einen Mucks. Ihre Hose fühlte sich jetzt kühl und nass an, und sie musste an das andere Kind denken. Ob es noch immer unter der Klause wartete, dass sie zu ihm ins Wasser springen würde?
Und wieder die Bank vor dem Wohnhaus. Diesmal bloß der Fludergrabenmarmor im Hintergrund und auf der Bank, im Schatten der Außentreppe, weder Decke noch Kissen.
Die Kleine mit einem anderen Kind. Cousin Robi, ein paar Monate älter als sie, mit Hut (schwarz) samt Hutschnur (höchstwahrscheinlich grün). Auf dem Spenzer-Revers je einen silbernen Knopf, auf dem Mittelstück zwischen den beiden Hosenträgern ein hirschhornernes Edelweiß, an den Nahtseiten der Lederhose ebenfalls Knöpfe zur Zierde, alles en miniature. Datiert 1944.
Die Kleine erstmals mit weißer Masche beziehungsweise Schleife im Haar und großkariertem Minimantel. Farben? Nicht eruierbar, da in Schwarzweiß. Darunter der Zipfl eines Kleides und die schon erwähnten Strümpfe in der Nicht-Farbe Taupe.
Cousin Robi erklärt ihr mit erhobenem Zeigefinger und weggestrecktem kleinen Finger etwas. Aus seinen Schuhen, die über die Knöchel reichen, schauen die weißen Socken hervor. Jahreszeit? Eher Mai mit Regen denn April mit Sonne. Vor Ostern waren nackte Knie undenkbar. Zu Pfingsten schon, aber fröstelnd bis frierend, je nach Niederschlag.
Die Welt, sagte die Kleine, ist weit, und man kann in sie hinein.
Die Welt, sagte Robi, ist ein Affenzirkus. Er bog sich vor Lachen, bis er pupsen musste (klingt präziser als die autochthone Version, nämlich einen Buh lassen).
Woher weißt du das? Die Kleine weiß, was ein Affe ist, nur im Zirkus war sie noch nie.
Das sagt der Papa, wenn die Mama sich über die Gendarmen ärgert.
Warst du schon im Zirkus?
Klar, in Wien. Da gibts auch Löwen.
Du lügst. Du hast noch nie einen Löwen gesehen. Der hätte dich sofort gefressen. Dabei fauchte sie wie eine Katze, wenn ihr einer der Hunde zu nahe kommt.
Nie! Nie hätten mich die Löwen fressen dürfen. Da steht immer einer in roter Uniform mit goldenen Quasten daneben und schlägt die Löwen fest mit der Peitsche, wenn sie jemand fressen wollen.
Und wenn der Löwe die Peitsche frisst? Was passiert dann mit dir?
Gar nichts!
Dann frisst er dich, wirst sehen.
Man merkt, dass du noch nie im Zirkus warst.
Warum?
Weil hinter dem Vorhang der Zirkusdirektor steht und den Löwen erschießt, wenn er mich fressen will.
Mit einer Flinte wie der Hase den Jäger?
Mit einer Pistole, kapiert?
Was ist eine Pistole?
Bist du so dumm, oder tust du nur so?
Dazwischen, das heißt zwischen den albumlos herumgeisternden Fotos, eine Aufnahme der Großeltern, 1953, acht Jahre nach dem Verlust ihres jüngsten Sohnes, Laurenz, der im Nachbarort, nach tagelangen Fieberschüben im aus Kriegsgründen auf einem Nebengleis abgestellten Verwundetentransport, schließlich doch noch im Lazarett landete und dort an Wundbrand starb. Es gab drei weitere von insgesamt sechs Söhnen, die ebenfalls gewaltsam zu Tode gekommen waren. Einer davon bereits während des Juli-Putschs 1934, als er, noch keine neunzehn, von Nazis aus der Region, die er bekämpfen wollte, erschossen wurde. Die anderen beiden, der Vater der Kleinen und sein ältester Bruder Robert, fielen knapp hintereinander in Russland.
Die Großeltern lächelnd, wie es sich am Tag der Hochzeit ihres jüngsten Kindes, der einzigen Tochter, Ricarda, gehört. Beide klein. Was die Stöckelschuhe der Omama samt Goldhaube an Höhe vorgeben, macht der Hut des Opapas mit aufrecht stehendem Gamsbart wett.
Worin sie einander ähneln? In der Farbe vom Schnauz des Opapas und der hervorlugenden Dauerwellen der Omama, ansonsten aber schon in gar nichts.
Hinter ihnen das Stammhaus, das große Hotel mit den hundert Betten, im Gegensatz zum kleinen, der ehemaligen Dependance, in dem Mutter und Vater zeigen hätten sollen, ob sie überhaupt imstande wären, ein Hotel zu führen.
Dabei war der Vater damals kein Anfänger mehr gewesen. Die Berufsbezeichnung Hoteldirektor stand bereits in seinem Pass, den er dazu brauchte, seine Praktika in Brighton, Cannes und im Mena-House in Kairo zu absolvieren. Doch der Opapa glaubte nur den eigenen Augen, und die waren überall.
Wohl aus jahre-, besser gesagt, jahrzehntelanger Vernachlässigung begannen manche der Fotos sich aneinanderzuklammern und ließen sich nur mehr durch vorsichtiges Ziehen voneinander trennen, ohne dass die Bildflächen des einen am Rücken des anderen kleben blieben.
Es war ein ganz kleines Foto mit gezacktem Rand, das sich, Großeltern zu Großeltern, an das andere Großelternbild gepresst hatte und als eines der allerersten Zeugnisse der Existenz der Kleinen zu gelten hat, obgleich sie darauf gar nicht zu sehen ist.
Auf Grund der Umstehenden, Großeltern, der Gedichte schreibenden Tante Ricarda (zwölf Jahre vor ihrer Hochzeit), Onkel Robert (kinderlos), ist davon auszugehen, dass es in dieser Familienaufstellung tatsächlich die Kleine ist, die in dem hohen Kinderwagen mit Faltdach liegt. Die Omama und Tante Ricarda wenden ihr Gesicht wohlwollend dem Inhalt des Korbwagens zu, während sich der Blick der Mutter (in Fohlenfellmantel, hellgrauen Filzstiefeln und seidenem Kopftuch, unterm Kinn verknotet) träumerisch in der Schneelandschaft verliert. Fotografiert wird wohl Onkel Roberts Frau, Tante Seph, haben, die ebenfalls nicht zu sehen ist.
Xaver war als Invalide nicht rekrutiert worden. Er hatte sich beim Bäumefällen im Wald die Zehen abgefroren, und mit abgefrorenen Zehen ließ sich nicht marschieren. An diesem Morgen war er im Haus geblieben, um ein verstopftes Abflussrohr zu reinigen.
Als Gärtner deckte er die Mistbeete, die mit ausrangierten Glasfenstern gegen Kälte und Schnee geschützt waren, auch noch mit Schilfmatten ab, räumte im Winter die Palmen ins Glashaus, wo er im Sommer Salat, Paradeiser, Gurken zog, Gemüse, das dem Hotel in Kriegs- und Nachkriegszeiten zugutekam. Er betreute sein Fuhrpferd im Pferdestall hinter dem Eiskeller mit den meterdicken Wänden, in dem sich die aus dem See gesägten Eisschollen bis in den August hinein hielten, die beiden Schweine im Saustall, die fraßen, was im Hotel übrigblieb, die Kaninchen in ihren mit Sägespänen ausgestreuten Hasenställen, die Hühner, Enten und Gänse im Hühnerstall, und d’Anna streute ihnen Körner, wenn sie sich im kleinen Hühnerhof aufhielten.
Die Kleine begleitete Xaver oft beim Füttern, schwänzelte um ihn herum, wenn er im Garten pflanzte oder jätete, obwohl er gedroht hatte, sie nie mehr in den Garten zu lassen, nachdem sie über die mit Schilf gedeckten Mistbeetfenster gelaufen war und dabei eine Menge Glas zertreten hatte. Zum Glück in Gummistiefeln, sonst hätten ihr die Glasscherben noch die Füße abgeschnitten, wie Xaver brüllte.
Ihre Schritte hatten das brechende Glas nicht nur zum Klirren, sondern auch zum Klingen gebracht und damit Töne erzeugt, die eine verführerische Wirkung auf die Kleine hatten. Sie krochen ihr ins Ohr wie eine herzhafte Musik, die zum Hüpfen und Springen aufforderte, und hätte Xaver die strampelnde Kleine nicht wieder einmal an den Trägern ihrer Latzhose hochgezogen, hätte sie unentwegt weitergetanzt, wahrscheinlich auch noch dazu gesungen.
So schrie und spuckte, heulte und schluchzte sie so heftig, dass sie sich beim Einatmen an den eigenen Tränen verkutzte (das Raushusten von in die Luftröhre Verschlucktem).
Xavers Flüche klangen hart, aber auch stimulierend. Als die Kleine sich beim Hinsetzen auf den Beetrand an einer Glasscherbe in die Hand geschnitten hatte, erkannte sie, dass Glas nicht bloß klingen, sondern auch wehtun konnte. Doch Xavers Drohung, sie nie mehr in den Garten zu lassen, war für sie so etwas wie die Aufforderung, erst recht wieder dorthin zu gehen.
Juliane glaubte sogar, sich an den hellblauen Strickanzug erinnern zu können und an die Blutflecken darauf, die nie mehr ganz herauszukriegen waren. Es musste so gegen Ende Winter oder Anfang Frühling, der meist voller letzter Wintereinbrüche steckte, gewesen sein, als Xaver an diesem sonnigen Tag die Hühner in den Garten ließ, damit sie an den aperen Stellen etwas zum Picken fänden. Und es gab Küken, jede Menge frischgeschlüpfter Küken, die man weithin piepsen hörte.
Xaver hatte der Kleinen eingeschärft, ja nicht alleine zu den Küken zu gehen. Sobald er Zeit hätte, würde er sie ihr zeigen, denn der Hahn sei dermaßen angriffslustig, dass man tatsächlich Angst haben müsse. Es war ein großer Hahn mit schillerndem Gefieder, das in allen Farben glänzte, und er spazierte ebenfalls über das Glas unter den Schilfmatten, die sich unter seinen Tritten duckten, um ihm ja keine Sicht auf die ersten keimenden Pflänzchen zu gewähren, Leckerbissen für seinesgleichen.
Der Hahn drehte ständig den Hals, um die Seinen, Hennen samt Küken, im Blick zu behalten, schüttelte alle paar Minuten sein Gefieder, wahrscheinlich um die Stallparasiten loszuwerden, reckte dabei den Kragen, um auch ein Auge auf den Zaun des Nutzgartens zu werfen, und verschickte krähend die Botschaft von der Reichweite seines Reviers und dessen gut gesicherten Grenzmarkierungen.
Die Kleine hatte sich lautlos der in einem ramponierten Korbsessel mit Pferdekotzen mittagsschlafenden Kinderfrau entzogen und die Maschendrahttür mit Spiralzug zumindest so weit aufgebracht, um hindurchschlüpfen zu können.
Das Tropfen der Dächer, das Wuseln der Küken mit dem andauernden Peilton Ich bin hier, wo bist du?, der Geruch nach frischer, aus dem Schnee gewaschener Erde, die Sonne, die den Hahn als Bewohner des Regenbogens präsentierte, das lautlose Singen des Glases, das alles stachelte die Kleine geradezu an, den gelben Flaumpäckchen, die unentwegt versuchten, ihren ersten Floh aus den dampfenden Krümeln zu picken, näher zu kommen. Dieser Überschwang aus gefundenem Fressen und gerade erlernter Fähigkeit, danach zu suchen, verlangte immer mehr danach, eine dieser gelben Kugeln in die Hand zu nehmen, sie an ihre Wange zu heben, Weiches an Weiches zu drücken und an dem verwandelten Ei zu riechen, das auch noch ununterbrochen Laut gab.
Und während die Kleine sich hinkniete, um nach einem der Küken zu greifen, verfinsterte sich mit einem Mal die Sonne, und der Hahn hüpfte ihr unter Gekreisch und breitem Flügelschlag in den Nacken, die sie noch gar nicht begriffen hatte, woher die Gefahr kam, jedoch bereits den Schmerz spürte, der hinter ihren Ohren zu brennen begann, peck, peck, linkes Ohr, peck, peck, rechtes Ohr, und dazu Krallen, die sich immer tiefer in ihren Rücken bohrten.
Sie schrie vor Angst und in Panik, der Hahn krähte, berauscht von seinem Triumph, die Küken flüchteten mit bloß noch wispernden Piepstönen unter die hysterisch gackernden Hühner, die sich auf ihnen niederließen, um ihnen Unterschlupf zu geben.
Und dann kam Xaver. Er kam mit einem großen Besen, dessen Stiel den Hahn in die Flucht trieb.
Und sie roch ihr eigenes Blut, sah, wie es sich von den Schultern herab in den hellblauen Strickanzug verlief, versuchte danach zu greifen, doch hatte die Wolle es bereits aufgesogen, feucht und warm, als Blut nicht mehr zu erhaschen.
Sie aber geriet immer tiefer in den Taumel eines Staunens hinein, so dass sie den Schmerz vergaß und bloß noch das Blut sah, ihr Blut, das da aus ihrem Körper davonlief, als hätte es nie zu ihm gehört.
Als die Kleine aufwachte, legte die Mutter ihr gerade eine Krenkette (ein Meerrettichgehänge) um den Hals, und die Kinderfrau wickelte in Essig getauchte Windeln um ihre Beine.
Und der Hahn?, fragte sie, die gerade noch geträumt hatte, wie der Hahn, Wettermann heißt mein Hahn, mit gespreizten Federn, leuchtend wie ein Kaleidoskop, in dem sich die farbigen Mosaikglasscherben immer weiterbewegen, zum Rauchfang (anderswo heißen Rauchfangkehrer Schornsteinfeger, was wie ein upgrading klingt) hinaufflog, um zu erkunden, wo sie geblieben war.
Der Xaver, sagte die Mutter, hat den angriffigen Hahn geschlachtet, damit er mein Julerl nie mehr pecken kann.
Am nächsten Tag fingen die Narben hinter den Ohren erst so richtig an wehzutun.
Soll ich dir etwas vorlesen?, fragte die Kinderfrau.
Die Kleine jammerte und fieberte vor sich hin.
Welches Märchen möchtest du denn am liebsten hören?
Die Kleine hustete, und die Narben taten noch mehr weh. Schneeweißchen und Rosenrot, flüsterte sie und dachte dabei an den großen braunen Bären, der am Fußende des Bettes saß und ihr zunickte.
Anderntags kam die Mutter selbst mit dem Mittagessen ins Wohnhaus herauf.
Da, schau, sagte sie, Karotten mit Hühnerfleisch. Das isst du doch so gern.
Und der Hahn?, fragte die Kleine wiederum. Wo ist denn der Hahn?
Da ist der Hahn! Die Mutter spießte ein paar der kleinen weißen Fleischwürfel auf und wollte sie ihr in den Mund schieben. Aber das Fieber hatte ihr den Appetit genommen, sie brachte den Mund einfach nicht auf. Dabei hätte sie nichts lieber getan, als sich einen Teil dieses Hahns einzuverleiben.
Das ebenfalls eine Zeitlang verschollene allererste Foto der Kleinen war gegen alle Selbstbezichtigung der Schlampigkeit doch wieder aufgetaucht. Gefangen in einem blauen Kuvert, das sich viel zu leicht anfühlte, um etwas anderes als das weiße Seidenpapierfutter in sich zu tragen. Aber dann spreizte Juliane es mit den Fingern auseinander, drehte es um, schüttelte es mehr pro forma als in der Hoffnung, es würde noch etwas aus ihm herausfallen, und plötzlich war es da: Eine erschöpfte Mutter auf dicken weißen Pölstern, in frischem weißem Nachthemd, im rechten Arm einen Winzling mit haarigem Kopf, an seinen Fingern lutschend (also schon damals), das Gesicht in den Schatten des Kopfes der Mutter gekehrt, so dass nicht sicher ist, ob mit offenen oder geschlossenen Augen.
Eine Hausgeburt, deren Wehen sich einen Tag und eine Nacht hinzogen, dann ein stummes Kind. Selbst als die Hebamme es an den Füßen packte und mit leichten Schlägen traktierte, gab es keinen Laut von sich.
Die Omama hatte, jeder Hoffnung ledig und mit den Worten: Das wird nichts mehr!, den Raum verlassen. Es war Samstag, und sie musste zurück zum Mittagsgeschäft ins Stammhaus, wo sie an der Küchenkassa zu sitzen und die Bons mit den Bestellungen aufzuspießen und die Bestellungen lauthals an den Küchenchef weiterzugeben hatte. Auch sollte sie noch einen Kontrollblick in die Küche der ehemaligen Dependance werfen und schauen, ob das Personal wohl hielt, was es versprochen hatte.
Dann läuteten die Glocken. Ein heftiges Zwölfeläuten. Wer weiß, welcher von den Ministranten wieder einmal zu fest am Strang zog. Zwischen den Schlägen glaubte sie dann doch noch etwas zu hören. Sie lief die Außentreppe wieder hinauf, so rasch ihre Stöckelschuhe es erlauben wollten.
Die Kleine! Sie hatte doch noch geruht, sich in die Umstände zu fügen.
Die Omama lächelte nachsichtig. So ein widerständiges Trotzkopferl. Wenn sich alle so bitten ließen …
* * *
Ein knappes Jahr darauf wieder die Kleine. Mittlerweile mit hellblondem Haar, leicht gelockt, in weißer Strampelhose und weißem Jäckchen auf den Armen der Mutter sitzend, sich mit einer Hand an ihrem Halstuch festhaltend. Beider Blick direkt auf die Kamera gerichtet. Und beider Schatten sichtbar auf dem Kies, kleiner Kopf an großem Kopf.
Daneben der Schatten eines Mannes, deutlich erkennbar an Schulterbreite und kurzem Haar. Der Fotograf? Wessen Schatten hat er festgehalten?
Die Bäume dahinter, kaum wahrzunehmende Strukturen, fast zur Gänze im Dunkeln. Davor Gebüsch, Gestrüpp. Einzig erkennbar noch die junge Eibe am Fuße der Böschung hinter dem Haus, die die Kleine später ihren Wald nennen wird.
Ein Porträtfoto, im Wiener Fotostudio Dietrich & Co aufgenommen. Die Mutter in schöner Ernsthaftigkeit mit hochgestecktem Schopf und schulterlangen, wahrscheinlich kastanienbraunen Haaren (mit Henna gefärbt?). Dazu ein spitz auslaufender weißer Hemdblusenkragen auf dunklem Pullover, der Blick auf den Fotografen gerichtet, die geschminkten Lippen geschlossen. Offensichtlich gibt es keinen Grund zum Lächeln.
Juliane hatte erst viel später erfahren, dass die Mutter manchmal zu ihrer Schwägerin Hanna auf Besuch nach Wien gefahren war. Wie viele Evakuierte war die Schwägerin mit ihren mittlerweile drei Kindern erst, als in Wien bereits die Bomben fielen, ganz ins Dorf gezogen. Schon viel früher hatte sie der Mutter unter dem Siegel absoluter Verschwiegenheit erzählt und gezeigt, wo sie in Wien Juden versteckt hielt und wie sie einigen von ihnen mit gefälschten Pässen zur Ausreise verhelfen hatte können. Dazu brauchte es Kontakte zu Nationalsozialisten, die ihrer Sache nicht oder nicht mehr sicher und zu Hilfeleistungen bereit waren. Hanna, meinte die Mutter einmal, wollte helfen, und sie traute sich was.
Du musst die schreienden, stiefeltretenden Mannsbilder spüren lassen, sagte Tante Hanna mehrmals zur Mutter, dass sie ohne ihre Uniform nichts sind. Mit den anderen redest du besser, versuchst, ihre Schwächen zu finden, sie an ihre Gefühle zu erinnern und sie auszuhorchen.
Hanna war, als sie noch in Wien lebte, in ihrer Gruppe die, die das am besten konnte, vor allem das mit den gefälschten Papieren. Ab 44 gehörte sie dann auch der regionalen Widerstandsbewegung an.
Im Dorf wohnte sie ab 44 mit den Kindern abwechselnd in einer Villa, die Onkel Leo zeitweise für sie gemietet hatte, oder im Stammhaus, wo die hochrangigen Nazis logierten, um sich zu erholen und die Endphase der Alpenfestung (die es so gar nicht gegeben hat) zu planen. Da hat sie angeblich alles mitgekriegt. Kein Wunder, war sie doch der Meinung, dass sinnvoller Widerstand ohne Spionage nicht möglich sei.
Wie alles?, hatte Juliane gefragt.
Was weiß ich, da war ich fast nur noch im Hotel und hab das meiste gar nicht erfahren. Mehr war aus der Mutter nicht herauszubekommen, so als gelte das Siegel der Verschwiegenheit noch immer.
Tante Hanna wurde erst 1998, sechs Jahre vor ihrem Tod, für ihr Engagement mit der Auszeichnung Gerechte der Völker geehrt.
Die Mutter sprach selten über die Zeiten des Krieges. Juliane konnte sich vor allem an die Geschichte mit dem verfolgten und deshalb versteckten Widerständler erinnern, den die Mutter durch die Dachbodenluke seines Hauses gesehen hatte. Wie er sie übrigens auch. Sie war mit ihrer Schwiegermutter zum Nachbarort unterwegs, der über einen höher gelegenen Weg gut zu Fuß zu erreichen war, und hatte nur zufällig zum Giebel des Hauses aufgeschaut. Der Mann, ein kommunistischer Bauernführer (auch das hat es damals gegeben), legte den Finger auf den Mund, und die Mutter nickte, ohne dass die Omama es bemerkt hatte. Das war wichtig, da die Omama, was Tante Hanna in einem Interview verraten hatte, das sie Jahre später einem jungen Historiker gab, vom Nationalsozialismus überzeugt war, im Gegensatz zum Opapa, der vor allem das Fortbestehen und Florieren seines Hotels im Sinn hatte. Über die Nazis soll er in diesem Zusammenhang einmal gesagt haben, dass sie einfach kein Niveau hätten. Er selbst war Monarchist.
Wochen später fand die Mutter ein in Zeitungspapier gewickeltes Stück Rinderfilet auf dem Fensterbrett oberhalb der Außentreppe. Offenbar hatte jemand heimlich geschlachtet. Auf den Rand der Zeitung war ein Satz in Blockbuchstaben hingekritzelt: Für jemanden, der es zu schätzen weiß.