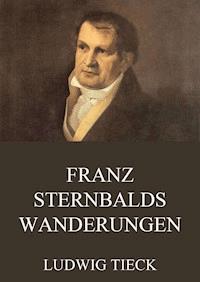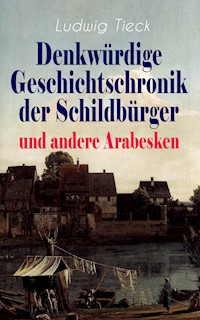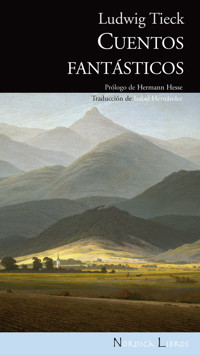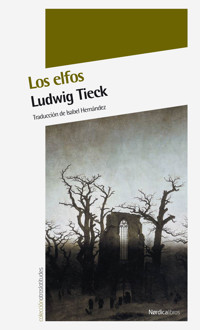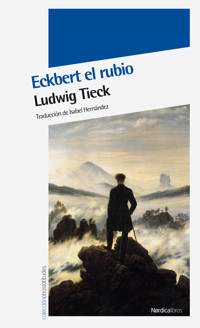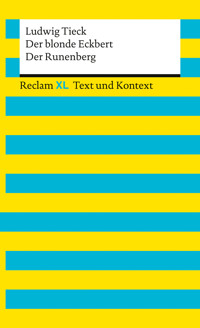Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Europa Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die erste Mordserie der deutschen Literatur! Arno Schmidts Lieblingstieck! Die 1797 erstmals erschienene Erzählung Die sieben Weiber des Blaubart fällt wegen ihrer auf den ersten Blick provozierenden Sinnlosigkeit aus dem Rahmen. Der Literaturkritiker Rudolf Haym sah sich 1870 in ein Kasperletheater versetzt und schloss das Kunstmärchen in seinem Buch Die romantische Schule aus dem Literaturkanon aus. Auch mit den phantastischen und magischen Elementen des Romans konnte er wenig anfangen. Der Roman wurde von Kritik und Publikum ignoriert und verschwand aus Tiecks Werkausgaben. Zu unrecht! Die Darstellunsgparodie entpuppt sich als ein Sammelsurium von genialen Anspielungen auf Goethe, Klopstock und Perrault. Tieck nimmt die Liebeskonzepte seiner Zeit zum Anlass und erzählt so die erste unfreiwillige Mordserie eines Ritters.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 228
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die 1797 erstmals erschienene Erzählung „Die sieben Weiber des Blaubart“ fällt wegen ihrer auf den ersten Blick provozierenden Sinnlosigkeit aus dem Rahmen. Der Roman wurde von Kritik und Publikum ignoriert und verschwand aus Tiecks Werkausgaben. Zu Unrecht! Die „Darstellungsparodie“ entpuppt sich als ein Sammelsurium von genialen Anspielungen auf Goethe, Klopstock und Perrault. Tieck nimmt die Liebeskonzepte seiner Zeit zum Anlass und erzählt die erste Mordserie der deutschen Literatur.
© 2010 by Europa Verlag AG Zürich
Redaktion: Team Europa Verlag
Covergestaltung: Christine Paxmann text • konzept • grafik
Cover: Gustave Doré, 1862
Druck: Druckerei Theiss, Österreich
eISBN: 978-3-905811-44-5
Auch als printausgabe erhältlich: ISBN: 978-3-905811-25-4
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbH
Ludwig Tieck
Die sieben Weiber des Blaubart
Liebe Leser, die Ihnen vorliegende Ausgabe von Ludwig Tiecks Die sieben Weiber des Blaubart ist die Erste, nachdem der Roman 1828 zum letzen Mal im neunten Band in einer Werkausgabe des Autors veröffentlicht wurde.
Wenn Sie in dem Text ungewohnten Schreibeweisen finden oder manche Wörter Ihnen merkwürdig vorkommen, dann liegt das daran, dass Sie in der Erstausgabe von 1797 diese so finden werden.
An dieser Ausgabe haben wir uns editorisch angelehnt, was auch das Fehlen sämtlicher Anführungszeichen erklärt. Lediglich offensichtliche Fehler oder verschiedene Schreibweisen eines Wortes haben wir vereinheitlicht. Wir wollen Sie, lieber Leser, ja nicht vollends verwirren.
Pulp Fiction im achtzehnten Jahrhundert. Ludwig Tiecks Die sieben Weiber des Blaubart (1797)
Klaus Bartels
Rudolf Hayms Blaubart-Verriss und die Kriminalisierung der Arabeske
Obwohl es sich um eine brillante Literatursatire mit hohem Unterhaltungswert handelt, hatte Ludwig Tiecks 1797 erschienene Erzählung Die sieben Weiber des Blaubart keine große Resonanz, weder beim Publikum noch bei der Wissenschaft. Tiecks provozierende Verknüpfung zeitgenössischer Trivialmythen (Liebe, Mord und Ritterfehden) mit frühromantischer Klassikkritik war ihrer Zeit weit voraus, ein genialischer Vorgriff auf das, was gegenwärtig als Pulp Fiction hoch im Kurs steht, aber von der deutschsprachigen literarischen Öffentlichkeit bis in die 1960er Jahre hinein gering geschätzt wurde. Der Literaturkritiker Rudolf Haym etwa bewertete Die sieben Weiber des Blaubarts in seiner lange Zeit maßgeblichen, 1870 erschienenen Studie Die romantische Schule als «das Unsinnigste und Verworrenste, was aus Tiecks Feder geflossen ist».1 Um für diese «verdorbene Geschichte» zu werben und überhaupt Käufer zu finden, habe der Verleger ein «abenteuerliches Titelblatt»2 gedruckt, das Tiecks Erzählung den damals modischen Geschichten aus Arabien, den «Arabesken», zuordnete.
Die Verkaufsbemühungen des Verlegers waren vergebens. Die Zeitgenossen konnten sich für diese Version des Blaubart-Stoffs nicht erwärmen. Und auch später fanden sich nur wenige Leser, obwohl das Interesse an Blaubart-Erzählungen groß war, wie man an der Popularität der Märchenversion von Ludwig Bechstein (Das Märchen vom Ritter Blaubart, 1845) ablesen kann. Rudolf Hayms vernichtende Kritik war offensichtlich ein literarisches Todesurteil. Hinzu kam die Kriminalisierung der Arabeske und des Ornaments um 1870. Als ‹Halbnarren› bezeichnete der italienische Kriminalanthropologe Cesare Lombroso in seinem 1872 erschienenen Buch über Genie und Wahnsinn (Genio e follia) «Graphomane», Vielschreiber (wie Tieck), Autoren oft prophetischer Gedankengebäude, Pseudoliteraten an der Grenze zwischen ‹krankhaftem› und ‹genialem› Schreiben. Es waren Lombroso zufolge formale und inhaltliche Merkmale, die auf Genie oder Irresein des Autors verwiesen. Wunderliche, seltsame, phantastische Stile (Lombroso nannte die Arabeske und das Ornament) verwarf er als ‹krank› ebenso wie jene Literatur und Kunst, die sich inhaltlich mit der Beschreibung des kranken Ichs oder des Verbrechers befassten. Die lombrosianische Formel lautete: Graphische, semiotische und narrative Ordnungslosigkeit, Verstöße gegen Sprach- und Erzählkonventionen geben einen Fingerzeig auf die Neigung des Autors zu Gesetzlosigkeit und schlimmstenfalls zu Delinquenz. Die Morde Blaubarts fielen in dieser vom Lombroso-Schüler Max Nordau zugespitzten und noch in Ernst Kretschmers Unterscheidung zwischen gefährlichen ‹mageren› Romantikern und harmlosen ‹runden› Realisten nachwirkenden Lesart der Romantik auf Ludwig Tieck zurück.3 Die Blaubart-Arabeske verschwand stillschweigend aus Tiecks Œuvre. Wer sie dennoch lesen wollte, musste sich den neunten Band der Schriften aus dem Jahr 1828 besorgen.4 Eine andere Edition gab es lange Zeit nicht. Etwas wohlwollender gingen Leser und Wissenschaft mit Tiecks 1796 geschriebener und ebenfalls 1797 veröffentlichter Dramatisierung des Blaubart-Stoffes Ritter Blaubart. Ein Ammenmärchen in vier Akten um. Die Blaubart-Komödie erschien sowohl separat als auch als erster Band der Volksmährchen unter dem Pseudonym Peter Leberecht. Ein letztes Mal beschäftigte Tieck sich 1817 mit dem Stoff.
Rezeption in aufsteigender Linie
Eine sehr späte positive Würdigung erfuhren Die sieben Weiber des Blaubart in Arno Schmidts Buch über vergessene Kollegen, 1965 unter dem Titel Die Ritter vom Geist erschienen. Den Unsinns-Vorwurf Hayms konterte Schmidt mit einer Hymne auf das «Wunderkind der Sinnlosigkeit»,5 ohne nun damit freilich eine Tieck-Lawine loszutreten. Aber immerhin beschäftigte sich seit Arno Schmidts Wiederentdeckung auch die Wissenschaft gelegentlich mit Tiecks Erzählung, zumeist im Kontext der Rezeption des Blaubart-Stoffes.6 Einen auf die Erzählstruktur der Arabeske fokussierten Kommentar zu den Sieben Weibern des Blaubart legte 1995 Winfried Menninghaus vor. Nur am Rande erwähnte Menninghaus die für die Handlungen des Tieckschen Blaubarts charakteristischen Formen der Wiederholung (immer wieder Ritter-Fehden, immer neue Hochzeiten und Hinrichtungen): «Der Wiederholungstäter (...) wird so zum idealen Vorwurf einer Form, die wesentlich durch das serielle Wuchern, durch Wiederholungen eines rekurrenten Musters definiert ist».7 Den (angedeuteten) Zusammenhang von Serie und Erzählen thematisierte Menninghaus noch einmal, wenn er aus dem seriellen Charakter der Handlungen Blaubarts auf das nahezu völlige Fehlen eines Entwicklungsgedankens schloss.8 Insofern bildete das von Tieck in der Blaubart-Arabeske favorisierte Erzählmodell eine Alternative zum linearen Erzählmodell des Entwicklungs- und Bildungsromans vom Typus des Goetheschen Wilhelm Meister (1795/96). Dass Tieck das Motiv des multiplen Mörders zum Anlass nahm, um über grundlegende Probleme des Erzählens zu reflektieren, führte Menninghaus nicht weiter aus. Dabei liegt es nahe, zwischen Tiecks Mehrfachtäterplot und der von Narratologen vertretenen Auffassung, eine Erzählung sei die Repräsentation einer kausal verknüpften Serie von Ereignissen,9 Verbindungslinien zu ziehen. Aber was ist eine Serie? Wodurch wird ein Ereignis zum Teil einer Serie und damit zum Teil einer Geschichte, anstatt lediglich eine Station im Ablauf eines Geschehens zu sein? In der Auseinandersetzung mit Charles Perraults exakt einhundert Jahre vor den Sieben Weibern des Blaubart 1697 erschienenem Märchen La barbe bleu setzte Tieck sich mit solchen Fragen auseinander und entwickelte in praktischem Vollzug eine Theorie des (seriellen) romantischen Erzählens.
Aber nicht nur die Frage des «Wie» der Erzählung ist zentral, sondern auch die Frage nach dem «Was». «Was» erzählt Tieck überhaupt? Er erzählt eine Liebesgeschichte, eine Geschichte der Liebe, so unplausibel das auf den ersten Blick zu sein scheint, da der Blaubart reihenweise seine Ehefrauen ums Leben bringt, bis er selbst getötet wird, und man eher eine Kriminalgeschichte erwartet. Die «Handlung» der Sieben Weiber des Blaubart besteht im (Nach-) Erzählen von zeitgenössischen Erzählmustern der Liebe. Peter Berner, so heißt Tiecks Ritter Blaubart, liquidiert sechs, durch seine Ehefrauen verkörperte vorromantische Liebessemantiken (unerfüllte Liebe, Schwärmerei, empfindsame Liebe, galante Liebe, tugendhafte Liebe, Lust) und stiftet durch seine tumbe chevalereske Werbung um seine Jugendliebe Adelheid zwischen dieser und seinem Konkurrenten Löwenheim eine ihm unzugängliche, neue Form der Intimität: Liebe als Passion, romantische Liebe. Aber diese romantische Liebe ist nur ein aus Romanen gelernter Kode. Genau das war Tieck von Haym vorgeworfen worden. An-statt selbst erlebte Liebe darzustellen, schreibe er wahllos Liebesgeschichten aus anderen Büchern überwiegend trivialen Charakters ab. Verwirrende Lektüre und Bildung seien das Substrat seiner Sinnlichkeit.10 Das mögen viele «passionierte» Leserinnen und Leser der vergangenen Jahrhunderte ebenfalls so empfunden haben. Heutzutage indes, da unter «romantisch» zumeist Verhaltensmodelle verstanden werden, «die der Roman vorführt»,11 und Pulp Fiction nicht mehr als minderwertige Literatur angesehen wird, scheinen die Bedingungen günstiger, die Feinheiten und den Witz der Blaubart-Erzählung angemessener zu würdigen, als dies durch vorangegangene Generationen geschehen ist.
Die Quelle: Charles Perrault
Perrault fasste die aus unterschiedlichen Quellen stammende Blaubart-Legende, vermutlich unter Rekurs auf eine von seiner Kusine erzählte Variante,12 wie folgt zusammen: Ein reicher französischer Ehrenmann heiratet die jüngere der beiden wunderschönen Töchter seiner Nachbarin «von Stand», obwohl die Braut und ihre Schwester sich zunächst vor seinem blauen Bart gefürchtet hatten und beide auch der Gedanke abstieß, dass er mehrfach verheiratet war und es über den Verbleib seiner verflossenen Gemahlinnen keine Informationen gab. Die Jüngere lässt sich aber auf die Heirat ein, weil sie sich nach einer achttägigen Landpartie in einem der Häuser des Bewerbers bei Jagen und Fischen, Tanzen und Feste-feiern, wenig Schlaf und großen Gelagen dessen hässlichen Bart weggefeiert hat und zum Schluss gekommen ist, es handele sich bei Blaubart um einen ehrenwerten Mann («honnête homme»). Nach Ablauf eines Monats verlässt der Ehemann unter dem Vorwand einer Geschäftsreise seine junge Ehefrau, nicht ohne ihr vorher sämtliche Schlüssel zu sämtlichen Räumen des gemeinsam bewohnten Hauses überreicht zu haben, verbunden mit der Mahnung, den kleinsten Schlüssel nicht zu benutzen und mit ihm eine gewisse Kammer nicht zu öffnen, sie habe widrigenfalls mit seinem vollen Zorn zu rechnen. Trotz des Verbots schließt sie die tabuisierte Kammer auf, sieht zunächst wegen der Dunkelheit nichts und glaubt dann, im Blut auf dem Boden wie in einem Spiegel die an den Wänden aufgehängten Leichen der Ex-Blaubart-Gattinen wahrnehmen zu können. Entsetzt lässt sie den Schlüssel, den sie zuvor aus dem Schloss gezogen hat, auf den blutbesudelten Boden fallen. Da es ein magischer Schlüssel ist, kann sie ihn mit keinem Mittel der Welt reinigen, so dass der urplötzlich vorzeitig zurückgekehrte Gemahl sie aufgrund des anhaftenden Blutes der Neugierde überführt sieht und wegen der Übertretung seines Gebots zu ihrer Hinrichtung schreitet. Seine Frau aber weiß das durch geschicktes Taktieren so lange hinauszuzögern, bis ihre Brüder ins Haus einfallen, den Blaubart töten und ihre Schwester retten, die das gesamte Vermögen des Ermordeten erbt und erneut einen «honnête homme» heiratet.
Die zweimalige Ansprache der Ehemänner als «honnêtes hommes» verweist darauf, dass Perrault die Blaubartfigur (einschließlich des Nachfolgers) bewusst aktualisierte, denn mit dem «honnête homme» führte er ein Persönlichkeitsideal aus dem zeitgenössischen Frankreich in die Märchenwelt ein.13 Der «honnête homme» hatte im siebzehnten Jahrhundert das Ideal des (adligen) Höflings abgelöst und bezeichnete einen nicht nur adligen, sondern auch gebildeten, geschmackssicheren, höflichen Mann, dem es insbesondere darum ging, anderen (seiner Gesellschaftsklasse) zu gefallen. Der «honnête homme» verkörperte kein bürgerliches, großbürgerliches oder nichtadeliges Ideal, wie verschiedentlich zu lesen ist. Die Nähe zum Adel war größer als die Nähe zum Bürger oder Großbürger, die zum Bürger und Großbürger größer als die zum Ritter.14 Vor dem Hintergrund der französischen Salonkultur des siebzehnten Jahrhunderts, die das neue Leitbild kreierte, war Tiecks Ritter Blaubart ein Anachronismus.
Der «honnête homme» pflegte Perücken zu tragen, was ein eigentümliches Verhältnis des Jahrhunderts zum Haar kennzeichnete und auch ein besonderes Licht auf den viel diskutierten blauen Bart des ersten Ehemannes wirft. Es war nicht der Bart, der nach Auffassung der ‹Männlichkeitsforscherin› Monika Szczepaniak damals den Mann zum Manne machte, «Signum der Virilität»15 im siebzehnten Jahrhundert war die Perücke.16 Männer, die sich ohne Perücke auf öffentlichen Plätzen sehen ließen, exponierten sich als exzentrisch, exzeptionell oder deviant. Das nackte Haar, den kahlen Schädel in der Öffentlichkeit zu zeigen, galt als obszön, vergleichbar dem öffentlichen Herunterlassen der Beinkleider. Nur privat nahm der Mann die Perücke ab. Um sie sicher fixieren zu können, war sein Schädel zumeist rasiert. Ohnehin galt das Haar schon in der Antike als Exkrement und Abfall, als nicht eigentlich zum Körper gehörig. Sein wucherndes, dazu noch blaues Haar distanzierte den Blaubart von der hegemonialen Maskulinität der Perückenträger. Auch wenn er selbst wie ein «honnête homme» eine Perücke trug, schloss ihn das Malheur seines Bartes aus der Gemeinschaft der Männer aus. Diese Außenseiterposition markierte Perrault sehr deutlich für ein Publikum, dem die Vokabel des «honnête homme» geläufig war.
Bemerkenswert ist, wie Perrault aus einem trivialen Geschehen (Mann übergibt Frau einen Schlüsselbund, verbietet ihr den Gebrauch eines bestimmten Schlüssels, erwischt sie beim Übertreten dieses Verbots), eine Geschichte machte. Er brauchte hierzu nur einen chronologischen Zusammenhang von Ereignissen in Form der (vermeintlich) an den Kammerwänden aufgehängten, nacheinander ermordeten Ex-Gattinnen, eine kausale Motivierung, die jeweilige Übertretung bzw. die weibliche Neugier, wodurch die Ereignisse nicht nur aufeinander, sondern auch auseinander folgen,17 und ein Ende der Ereignisse, so dass die Serie erkennbar wird. Die Geschichte der letzten Ehefrau wird deshalb erzählwürdig, weil sie den letzten Punkt einer Serie von Ereignissen darstellt. Bestechend ist die Ökonomie der Erzählung. Mittels der Kammer musste Perrault die Geschichte mehrerer Morde nur einmal erzählen.18
Tiecks Perrault-Rezeption
Gegen dieses Prinzip erzählerischer Ökonomie verstieß Tieck programmatisch, indem er mit vielen verschwenderischen Worten ein Frauen-Schicksal nach dem anderen zählte und erzählte. Bei Perrault war pauschal von mehreren Frauen die Rede, nur das Schicksal der letzten wurde erzählt. Tieck öffnete sozusagen die Kammer und schilderte, wie sechs der sieben Ehefrauen des Blaubarts hineingekommen waren. Er verschaffte den Opfern, im Unterschied zu Perrault, Namen und Schicksale. Die erzähltechnische Öffnung der Kammer machte diese eigentlich überflüssig, aber Tieck behielt sie bei. Allerdings beherbergt sie keine Leichen. Als eine andere Art von Archiv wird sie von einem der Sprache mächtigen, intelligenten bleiernen Kopf bewohnt, das Geschenk einer Fee an den Ritter Peter Berner, der an fortschreitender Dummheit leidet und daher auf einen transportablen Ratgeber angewiesen ist, den er überall hin mitnehmen kann (Tieck, S. 73/74). Diese Fee zaubert ihm auch den blauen Bart an, weil er sich ungalant über ihr Alter geäußert hat (Tieck, S. 97).
Aber Peter Berner ist nicht nur dumm oder ungalant. Er kann außerdem weder lesen noch schreiben (Tieck, S. 62). Er ist in jeder Beziehung das Gegenteil des Konversationsideals «honnête homme».19 Er ist ein Ritter. Tieck war nicht der erste, der Perraults Blaubart ins Ritter-Milieu versetzte. In der französischen Oper Raoul Barbe-Bleu von André-Erneste-Modeste Grétry (Libretto Michel-Jean Sedaine), uraufgeführt 1789 in Paris und auch noch Anfang des neunzehnten Jahrhunderts auf Deutschlands Bühnen gespielt, ist der Titelheld von Adel, ein Protagonist ist ein Ritter.20 Unabhängig davon, ob Tieck diese Oper gekannt hat, bescheinigte Rudolf Haym der schon erwähnten Komödie Ritter Blaubart. Ein Ammenmärchen in vier Akten «eine natürliche Tendenz zur Oper».21 Haym sah sich in ein Kasperletheater versetzt, wo es vor allem um das Kopfabschlagen geht: «Blaubart läßt seinen Gegnern den Kopf abschlagen, wie man einen Schluck Wasser trinkt; (...) seine Brutalität ist so selbstverständlich, so zuversichtlich naiv, daß sie uns herzlich lachen macht; (...)».22 Als intimer Kenner von Schauer- und Ritterromanen, neben den Liebesromanen die am weitesten verbreiteten Genres der zeitgenössischen Unterhaltungsliteratur, verstand Tieck sich auf die Verwendung des Rittermotivs. Einem mittelalterlichen Ritter trauten nach seiner Einschätzung die Zeitgenossen offenkundig am ehesten die schändlichen Bluttaten des Blaubarts zu. Es ist historisch nicht korrekt, wenn Karl Voretzsch in seinem Artikel «Blaubart» für das Handwörterbuch des deutschen Märchens den Begriff des «Lustmörders» ins Spiel bringt. Dieser Begriff und die mit ihm verbundenen Verbrechen wurden erst Ende des neunzehnten Jahrhunderts populär.23 Auch der Begriff des Serienmörders war dem achtzehnten Jahrhundert nicht vertraut. Der «Serienmörder» ist eine Konstruktion des zwanzigsten Jahrhunderts. Literarische Darstellungen von Schwerverbrechen im achtzehnten Jahrhundert stützten sich in den seltensten Fällen auf tatsächliche Delikte. Überwiegend schilderten sie Phantasiekriminalität, dies gilt zum Beispiel noch für Schillers Räuber (1781). Schillers Erzählung Der Verbrecher aus verlorener Ehre (1786/1792) veranschaulichte erstmals in der deutschsprachigen Literatur die kriminelle Karriere eines Mörders und Serientäters.24 Tiecks Blaubart-Vita war demgegenüber ein phantastisches Gebilde.
Serielles Erzählen
Gemäß der zeitgenössischen Regelpoetik, wonach der Gute schön, der Böse aber hässlich ist, kodierte Perrault die bösartige Gesinnung seiner Titelfigur mit einer physiognomischen Besonderheit, dem hässlichen blauen Bart. Bei Tieck spielte dieser Kode nur eine untergeordnete Rolle.25 Im ausgehenden achtzehnten Jahrhundert glaubte keiner mehr ernsthaft daran, dass dem Bösen die Bosheit ins Gesicht geschrieben sei. Entscheidend für das Urteil über Blaubart wird nun die Beobachtung seiner Taten. Die aber sind, so Peter Berners Mentor Bernard, zusammenhanglos, sie verfolgen keinen Plan und ergeben deshalb keine Romanhandlung. Peter Berner tauge nicht einmal zum Helden eines Ritterromans. Sein blauer Bart sei allenfalls komisch, aber kein Kennzeichen von Individualität wie die Narbe bei Friedrich mit der gebißnen Wange (1785-88), Friedrich Christian Schlenkerts Kolportageroman über den Markgrafen Friedrich I. von Meißen (1257-1323), den seine Mutter aus Abschiedsschmerz einst in die Wange gebissen hatte. Seine Dummheit sei durchaus der des Hasper a Spada in Carl Gottlob Cramers gleichnamigem Ritterroman (1792/93) ebenbürtig, seinen Abenteuern mangele es jedoch an mittelalterlicher Folklore, an Brückenketten, Burgverließen usw. Insgesamt fehle seinem Leben die Einheit einer Geschichte. Die Vorschläge Bernards, durch planvolle Taten eine Romanfigur zu werden, die sich im Rahmen einer Handlung entwickelt, schlägt Berner, lebhaft unterstützt vom Verfasser, in den Wind. Der Verfasser schreibt hierzu: «Lieber Leser, Du sprichst so viel von der Einheit, vom Zusammenhange in den Büchern, greife einmal in Deinen Busen, und frage Dich selber; am Ende lebst Du ganz so, oder noch schlimmer, als ich schreibe. Bei tausend Menschen (...) nehme ich in ihrem Lebenslaufe lauter abgerissene Fragmente wahr, keine Ruhepunkte, aber doch einen ewigen Stillstand, keine lebendige Fortschreitung der Handlung, obgleich viel Bewegung und hin und wieder Laufens, (...)» (Tieck, S. 186).
Aus der Planlosigkeit des Lebens folgt keineswegs Unstrukturiertheit. Tieck setzt darauf, dass sich «planlose» Taten «von selbst» zu sinnvollen Handlungen und beschreibbaren Serien konfigurieren. Diesem Gesetz der Serie, so heißt ein Buch des Biologen Paul Kammerer über Wiederholungen im Leben und im Weltgeschehen aus dem Jahre 1919,26 sind die Sieben Weiber des Blaubart verpflichtet. Man kann von einer Tieckschen Ausdifferenzierung der Serie sprechen, wobei Perraults Mehrfachtäterplot Hilfestellung leistete. Über die Wahl des Erzählmodells gibt der Verfasser folgendes zu Protokoll: «(...) und darum habe ich mir eben unter so vielen tausend Geschichten, die ich nehmen konnte, gegenwärtige ausgesucht, weil sie meinem Humor am besten zusagte. Charaktere treten auf und verschwinden wieder schnell, ohne daß sie die närrische und lästige Prätension machen, daß man sie genau beibehalten und durchführen soll; (...)» (Tieck, S. 146/147).
Pausenloses Auf- und Abtreten von Charakteren ist verankert in der Erzähltradition des Kasperletheaters, des Reigens, des Totentanzes oder eben des Perraultschen Mehrfachtäterplots. Eine auf serielle Muster und das heißt auf Wiederholung abgestellte Erzählhandlung freilich bewirkt qua Redundanz den Effekt der Langeweile. Und daher ist Tieck gezwungen, die Erzählung interessant zu machen. Kaum ein anderer theoretischer Begriff taucht in den Sieben Weibern des Blaubart häufiger auf als «interessant» bzw. «uninteressant».27 Interessant/langweilig ist die Leitdifferenz des Textes. Das Interessante und die Zusammenhanglosigkeit des Erzählens sind Kampfbegriffe romantischer Erzähltheorie gegen die Objektivität und das planvolle Erzählen der Klassiker, insbesondere Goethes. Die sieben Weiber des Blaubart entwerfen eine frühromantische Erzähltheorie im praktischen Vollzug, mit Goethes Wilhelm Meister als Fluchtpunkt der Reflexion. In einer von ihm für die Schriften des Novalis besorgten, sehr tendenziösen Zusammenstellung der Urteile Novalis’ über die Lehrjahre ließ Tieck sein Sprachrohr wiederholt über das Undichterische, Ökonomische des Romans herziehen: «Wilhelm Meisters Lehrjahre sind gewissermaaßen durchaus prosaïsch – und modern. Das Romantische geht darinn zu Grunde – auch die Naturpoësie, das Wunderbare (...) Künstlerischer Atheismus ist der Geist des Buches. Sehr viel Oeconomie (...)».28 Und an anderer Stelle schrieb Novalis, wieder über die Lehrjahre: «Hinten wird alles Farçe. Die Oeconomische Natur ist die Wahre – Übrig bleibende».29 Dass im Lager der Romantiker keine Einigkeit herrschte, belegte Friedrich Schlegels 1797 formulierte Auffassung, das von Goethes Kunst erreichte «Objektive» führe aus der «Krise des Interessanten» heraus.30 Es sind im Wesentlichen drei Verfahren, mit deren Hilfe Tieck das Interessante erzeugte: 1. Variation und Paradoxierung. 2. Das Wunderbare (Überraschendes und Neues). 3. Vielstimmigkeit (Polyphonie).
1. Variation und Paradoxierung
Die Variationen betreffen in erster Linie die unterschiedlichen Todesarten und die verschiedenartigen Liebesgeschichten, von denen noch die Rede sein wird. Nicht alle Hinrichtungen werden geschildert, nicht alle Opfer sterben von Blaubarts Hand (Catharine stirbt aus Lust am Gruseln [Tieck, S. 204]), und nicht immer ist Blaubart der Mörder. Seine Haushälterin Mechthilde hat einen Giftmord an ihrem Verführer begangen und wird ihrerseits Opfer eines Giftanschlags durch die eifersüchtige Jakobine. Ein besonders auffälliges Beispiel für Paradoxierung ist die Behauptung, Peter Berner könne weder lesen noch schreiben, und die Tatsache, dass er Horaz zitiert (Tieck, S. 165). Der Verfasser schreibt selbst, dass dies eigentlich Unsinn sei (Tieck, S. 186). Die Kunst jedoch habe das Privileg, «widersprechende(n) Unsinn» reden, im gleichen Atemzug sowohl «ja» als auch «nein» sagen zu dürfen (Tieck, S. 185).
2. Das Wunderbare (Überraschendes und Neues)
Das Wunderbare begegnet den Protagonisten der Erzählung in mannigfaltiger Gestalt. Peter Berner wird von der Fee, die ihm den bleiernen Kopf geschenkt hat und ihm später den blauen Bart anzaubert, mit einem Tischleindeckdich bewirtet. Sie führt ihm ein virtuelles Ritterturnier (mit Vögeln) vor. Und Peter Berner besitzt eine Wunderkammer, ohne es zu wissen. Es ist die von Arno Schmidt hoch gelobte, zum stun-denlangen Träumen einladende31 Mord-Kammer, in der Peter den bleiernen Kopf verwahrt. Als seine erste Ehefrau Friederike das Verbot übertritt und die Kammer öffnet, erstaunt sie, denn das Tabu-Zimmer ist leer: «Sie ging mit dem Lichte hin und her, und alles war leer. Die Wand war von bunten wunderbaren Tapeten bekleidet, die rote Farbe und das Gold darauf schillerte, indem sie die Leuchte vorübertrug, und die grotesken Figuren schienen Leben und Bewegung zu bekommen. Es waren alte biblische Geschichten, von Schlachten und Verhören, die hier dargestellt waren; die häßlichsten Umrisse hoben sich durch die grellsten Farben heraus, und ein König David sah mit einem unwilligen fürchterlichen Blicke nach Friederiken hin» (Tieck, S. 124). Die durch das Herumtragen des Lichtes beleuchteten und wieder im Dunkeln verschwindenden alttestamentarischen Schreckgestalten aus Friederikes frühesten Kindertagen gewinnen nach und nach an Leben, treten aus den Tapeten heraus und beginnen zu sprechen. Friederike bleibt wie festgenagelt vom Blick des «furchtbaren David» stehen und versucht, den «gräulichen Erinnerungen» zu entfliehen, die ihre Laterne ins Leben gerufen hat. In diesem Moment tritt Peter Berner in die Kammer und bestraft seine Ehefrau für das Öffnen der Tür mit dem Tod.
Das sukzessive Beleuchten und Verdunkeln, die Bewegungen der biblischen Bilderbogen in der Raumluft – es sind, der damaligen Bedeu-tung von «Tapete» entsprechend, Wandteppiche (Gobelins) mit eingewirkten Motiven, «strips», die anstelle der Frauenleichen von den Wänden der Kammer herabhängen – erzeugen eine proto-kinematographische Illusion. Die Kammer wiederholt und bekräftigt das serielle Erzählen in einem anderen Medium; sie sendet eine Tapetenfilm-Miniserie: Die erste Betrachterin des Tapetenfilms ist Friederike. Nachdem Berner sie getötet hat, beleben sich die Figuren in den Tapeten erneut und treten vollständig aus dem Bildhintergrund heraus. Ein drittes und letztes Mal verlassen die biblischen Figuren ihre Tapete, um Catharine ihre eigene Beisetzungsfeier vorzuspielen, als diese, lüstern auf etwas neues Wunderbares, die verbotene Kammer betritt. Der Anblick des eigenen Todes tötet Catharine auf der Stelle (Tieck, S. 204).
Blaubarts Kammer ist ein Archiv der Kindheitserinnerungen, die biblisch kodiert sind, da die Bibel, Biographien von Päpsten, Kirchenvätern und anderen geistlichen Helden im achtzehnten Jahrhundert zur Lektüre der Kinder gehörten. Spezielle Kinderliteratur gab es damals nicht. Die alttestamentarische Literatur diente nicht selten als Skript für Kinderspiele. So erinnert sich Wilhelm Meisters Mutter noch sehr genau, wie ihr Sohn sich eines Tages einen David und Goliath aus Wachs fertigte, dem Riesen den Kopf abschlug und diesen auf einer großen Stecknadel mit wächsernen Griff dem kleinen David in die Hand klebte.32 Die infantile Reinszenierung der biblischen Enthauptungsszene weckt in Wilhelm Meister zunächst das Interesse an Theaterstücken, die er mit Geschwistern und Spielkameraden nachspielt, allerdings «nur die fünften Akte, wo’s an ein Totstechen ging»,33 und später den Wunsch, Schöpfer eines deutschen Nationaltheaters zu werden, was er aus vielen, in der Struktur des so genannten Bildungsromans liegenden Gründen schließlich nicht wird.
Während sich Frau Meister an den Hinrichtungsspielen ihres Sohnes ergötzt («Ich hatte damals so eine herzliche mütterliche Freude über dein gutes Gedächtnis und deine pathetische Rede»34), flößt König David der armen Friederike nur Angst ein. Und Peter Berner, seinerseits in der Kammer mit dem virtuellen König David konfrontiert, zeigt keinerlei Interesse an diesem, sondern lediglich am schönen Helm eines Kriegsknechts. Anders als bei Wilhelm Meister entzündet die Begegnung mit dem alttestamentarischen Helden bei Peter Berner keinen Wunsch nach Höherem, sondern lediglich das Begehren nach dem Helm. Berner will nur eins, Ritter sein und Ritter bleiben. Das bald darauf auch wieder vergessene Begehren nach dem Helm kommentiert und parodiert den aus einer Schlüsselszene zu Beginn der Lehrjahre entwickelten Bildungsgedanken, der sich selbstverständlich in der von Tieck abgelehnten Erzählökonomie Goethes niederschlug.
3. Vielstimmigkeit (Polyphonie)
Ein signifikantes Mittel, um Vielstimmigkeit zu erzeugen, ist die Multiplikation der Erzählinstanzen und -perspektiven. Für die Einheit der Perspektiven und die Wahrheit dieser «wahren Familiengeschichte» bürgt die Herausgeberfiktion. In der Ausgabe von 1797 heißt der Herausgeber Gottlieb Färber, in der Ausgabe von 1828 L.[udwig] T.[ieck]. In der «Zuschrift an den Herrn Peter Lebrecht», den pseudonymen Autor der Blaubart-Komödie, gibt der Verfasser der Sieben Weiber an, er wolle die dunkel gelassene Vorgeschichte dieses Dramas aus ihm vorliegenden Papieren heraus rekonstruieren. In der Schlußadresse an Peter Lebrecht und den Leser behauptet er, dies sei ihm gelungen.35 Peter Berners Haushälterin (und Mätresse) Mechthilde repräsentiert eine weibliche Erzählinstanz. Sie erzählt den Roman ihres Lebens und ein Ammenmärchen (eine Horrorgeschichte). Als Konkurrent des Verfassers greift Bernard immer wieder in die Handlung ein. Er ist aber eher ein Theoretiker als ein Schriftsteller, da alle Erzählversuche am Widerstand seines Helden Peter Berner (und seines Verfassers) scheitern. Bernard steht in der Tradition der Geniusfiguren des Geheimbund- und Schauerromans, deren Aufgabe es ist, als Abgesandte einer geheimen Gesellschaft oder auf eigene Rechnung den Romanhelden zu manipulieren. Auch Wilhelm Meister wird von den Emissären der Turmgesellschaft geleitet und beraten, ohne dass er dieses bemerkt. Die Erfolglosigkeit Bernards darf man als fortlaufenden Kommentar zu den Bemühungen der Emissäre in den Lehrjahren lesen, insbesondere zur, so Novalis, fatalen Figur des Abbé.36
Der Gattungsmix ist ein weiteres Mittel der Polyphonie. Lieder, dramatische Dialoge, Idyllen, Liebesgeschichten und Märchen wechseln einander in unsystematischer Reihenfolge ab. Bevorzugt werden Genres, die «Sehnsuchtsorte» beschreiben, etwa den «locus amoenus» der bukolischen Dichtung (plätschernde Wasser, kühlende Bäume, sanftes Moos) oder das biblische Paradies selbst, in das die Fee Almida ihren Schützling Adelheid vor den Nachstellungen Peter Berners rettet: «Und vor ihren Augen lag eine liebliche Insel da, von hellem Grün bekleidet, von süßmurmelnden Bächen durchflossen, mit schattigen Gebüschen und Wäldern, durch welche süße Töne irrten und heller Himmel den elysischen Aufenthalt umfing» (Tieck, S. 167). Eine Variante des Gattungsmix ist die Intertextualität der Blaubart-Arabeske. Tieck schließt an die beiden «Moral» genannten Nachschriften Perraults zu seinem Barbe-bleue an. Das erste Kapitel der Sieben Weiber trägt den Titel «Moralität» und beinhaltet einen Exkurs über Erzählen und Moral. In der Fassung von 1828 beginnt die eigentliche Handlung in Anführungszeichen, mit einem Schauerliteratur-Zitat: «‹Der losgelassene Sturmwind zog mit aller seiner Macht durch den Wald, und schwarze Wolken hingen schwer vom Himmel herunter; in einer abseits liegenden Burg brannte ein einsames Licht, und ein Wandersmann ging durch die Nacht auf der großen Straße fort›» (Tieck 1828, S. 97). Ob Tieck selbst oder eine fremde Hand diesen Passus als Fiktion eines Zitats gekennzeichnet hat, bleibt unklar. In der Fassung von 1797 fehlen An- und Abführungszeichen (Tieck, S. 47). Die mediale Wunderkammer setzt darüber hinaus einen intermedialen Akzent.
Liebe ist kein Gefühl, sondern ein Kode