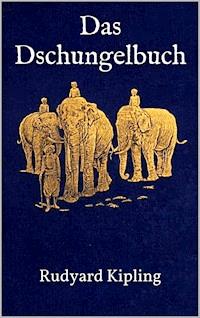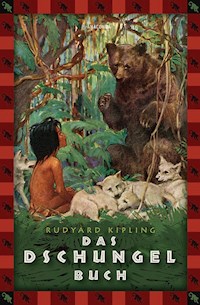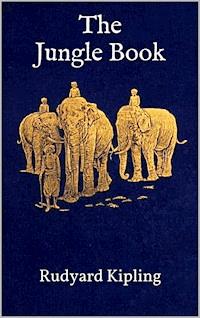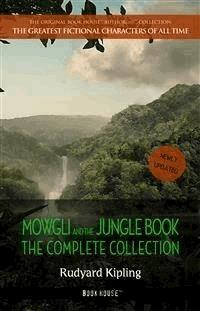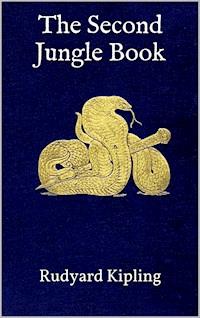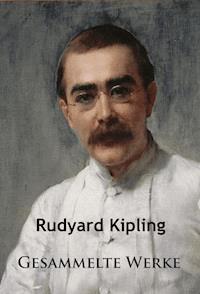14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fischer Klassik Plus
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Die späten Erzählungen von Kipling - zum ersten Mal auf Deutsch von Gisbert Haefs. »Bewundernswert und verschwiegen hat er sich bis zum Ende immer wieder erneuert«, schrieb Borges über die letzten Erzählungen von Kipling, der Meistererzähler, dessen Werk immer noch im Schatten des ›Dschungelbuchs‹ steht. Kurz nach dem Tod seines Sohnes geschrieben, bieten seine letzten Geschichten das dunkel-leuchtende psychologische Porträt eines inneren Schmerzes und den Ausweg aus dem Labyrinth. Seine aus dem Leben geschnittenen Helden überschritten bis zuletzt jede Grenze.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 586
Ähnliche
Rudyard Kipling
Die späten Erzählungen
Aus dem Englischen von Gisbert Haefs
FISCHER E-Books
Inhalt
Mißbrauchter Morgen
Mißbrauchter Morgen
C’est moi, c’est moi, c’est moi!
Je suis la Mandragore!
La fille des beaux jours qui s’eveille à l’aurore
Et qui chante pour toi!
C. Nodier
In den Tagen ohnegleichen vor den Großen Prüfungen sah ein Genie namens Graydon voraus, daß die Fortschritte der Bildung und der Lebensstandard alle Flutmarken des Geistes in einem Schlammschwall standardisierten Lesestoffs würden versinken lassen; deshalb schuf er das »Syndikat für Prosa-Nachschub«, um den Bedarf zu decken.
Da ihnen ein paar Tage Arbeit bei ihm mehr Geld einbrachten als eine Woche anderswo, zog es viele junge Männer – einige sind heute berühmt – in seine Dienste. Er ließ sie das Groschenbuch der Träume und den Katalog der Army and Navy Stores im Auge behalten (diesen für wechselnde Hintergründe und Ausstattungen) sowie den Freund für Heim und Herd, ein Wochenblatt, das sich mit unvergleichlichem Erfolg auf die häuslichen Emotionen spezialisiert hatte. Trotz allem ließ sich jedoch die Jugend nicht verleugnen, und einiges von dem in Kollaboration gezeugten Liebesgeflüster in Heillos ist die Leidenschaft und Enas verlorene Liebschaften wie auch die Schilderung der Ermordung des Earls in den Tragödien in Wickwire – um nur einige Meisterwerke zu erwähnen, die heute aus Angst vor Verleumdungsklagen nie mehr genannt werden – war mindestens so gut wie alles, was die gleichen Autoren in vornehmeren Jahren mit ihren wirklichen Namen unterzeichneten.
Unter den jungen Raben, die es dazu trieb, eine Weile in Graydons Arche zu nisten, befand sich James Andrew Manallace – ein langsamer, dämmeriger Mensch aus dem Norden, von der Sorte, die nicht selber zündet, sondern in Gang gesprengt werden muß. Gab man ihm eine schriftliche oder mündliche Handlungsskizze, so war er nutzlos; aber mit einem halben Dutzend Bilder, um die er seine Geschichte schreiben konnte, leistete er Erstaunliches.
Und er verehrte die Frau, die später Vidal Benzaquens Mutter wurde und die litt und starb, weil sie einen liebte, der es nicht wert war. Zur Truppe gehörte auch ein manierierter, bauchiger Mensch namens Alured Castorley, der über »Bohème« redete und schrieb, sich aber immer fürchtete, durch die wöchentlichen Abendessen in Neminakas Café am Hestern Square »kompromittiert« zu werden; dort wurde die Arbeit des Syndikats aufgeteilt, und dort kümmerte sich keiner um andere. Auch er hatte eine Zeitlang Vidals Mutter geliebt, auf seine Weise.
Es war an einem Samstag im Neminaka. Graydon, der Manallace ein Bündel Drucke gegeben hatte – aus einem vergessenen Kinderbuch mit dem Titel Philippas Königin gerissen –, über die er improvisieren sollte, erkundigte sich nach dem Ergebnis. Manallace griff in die Tasche seines Ulster, zögerte einen Moment und sagte, der Stoff sei in seinen Händen zu Dichtung geraten.
»Blödsinn!«
»Eben nicht«, gab der Junge zurück. »Es ist ziemlich gut geworden.«
»Dann können wir es nicht gebrauchen.« Graydon lachte. »Hast du die Ausschnitte wieder mitgebracht?«
Manallace reichte sie ihm. In der Serie gab es eine Burg; einen Ritter oder so ähnlich in Rüstung; eine alte Dame mit geflügeltem Kopfputz; eine junge dito; einen sehr offensichtlichen Juden; einen Schreiber, mit Feder und tragbarem Tintenfaß, der auf einem Kai Weinfässer inspizierte; und einen Kreuzritter. Auf der Rückseite eines der Drucke stand: »Warum kann er nicht gefangengenommen und für Lösegeld festgehalten werden, wenn er nicht gehen will?« Graydon fragte, was das alles bedeute.
»Weiß ich noch nicht. Vielleicht eine komische Oper«, sagte Manallace.
Graydon, der selten Zeit vergeudete, gab die Ausschnitte einem anderen und zahlte Manallace wie üblich ein paar Sovereigns als Vorschuß, damit er weitermachen konnte; Castorley war verärgert darüber und hätte etwas Unersprießliches gesagt, man ließ ihn aber nicht zu Wort kommen. Als das Abendessen halb vorüber war, erzählte Castorley der Truppe, ein Verwandter sei gestorben und habe ihm genug hinterlassen, um sich unabhängig zu machen; und er ziehe sich hiermit zurück vom »Geschreibsel«, um der »Literatur« zu obliegen. Normalerweise freute sich das Syndikat, wenn einer der Kameraden das große Los zog, aber Castorley hatte die Gabe, Leute gegen sich aufzubringen. Die Nachricht wurde folglich mit einem Dankesvotum quittiert. Castorley ging sofort und machte, wie es heißt, ’Dal Benzaquens Mutter einen Antrag, den sie ablehnte. Er kam nie zurück. Manallace, schon in gehobener Stimmung eingetroffen, war vor Mitternacht so betrunken, daß einer bleiben und ihn heimbringen mußte. Alkohol beeinträchtigte ihn aber niemals oberhalb der Gürtellinie, und als er ein wenig geschlafen hatte, rezitierte er dem Gasleuchter die Dichtung, die er aus den Bildern gemacht hatte; sagte, er überlege sich, ob er nicht eine komische Oper daraus machen sollte; beklagte den Einfluß von Gilbert & Sullivan, der dem des Upasbaums gleiche; sang ein wenig, um sein Argument zu illustrieren; und wurde – übrigens nachdem er Worte mit einer Negerin in gelbem Satin gewechselt hatte – in seine Gemächer gesteuert.
Innerhalb weniger Jahre wurden Graydons Voraussicht und Genie belohnt. Das Publikum begann, auf höheren Ebenen zu lesen und zu argumentieren, und das Syndikat wurde reich. Noch später verlangten die Leute von ihren Druck-Sachen, was sie von Kleidung und Möbeln erwarteten. Ebenso wie der Handtasche für drei Guineas binnen dreier Wochen ihre durch nichts zu unterscheidende Schwester für dreizehn Shilling und siebeneinhalb Pence folgt, erfreuten sie sich vollkommen synthetischen Ersatzes für Handlung, Empfindung und Gefühl. Graydon starb, ehe die Schule der Filmuntertitel ins Geschäft kam, aber er hinterließ seiner Witwe siebenundzwanzigtausend Pfund.
Manallace gelangte zu Ruhm und, wichtiger, zu Geld für Vidals Mutter, als ihr Mann fortlief und sich die ersten Symptome ihrer Paralyse zeigten. Sein Gebiet waren heiter-sentimentale Abenteuer à la Wardour Street, erzählt in einem Stil, der allen Erwartungen exakt entsprach, sie aber niemals übertraf.
Wie er einmal auf die Aufforderung, »ein richtiges Buch« zu schreiben, sagte: »Ich hab mein Markenzeichen, das lass’ ich nicht sausen. Wenn man den Leuten das Denken erspart, kann man alles mit ihnen machen.« Abgesehen von seinen Erzeugnissen war er wirklich ein Literat. Er mietete ein kleines Haus auf dem Land und sparte an allem, außer an Pflege und Sorge für Vidals Mutter.
Castorley klomm höher. Als seine Erbschaft ihn vom »Geschreibsel« befreite, wurde er zuerst Kritiker – in welchem Gewerbe er in treuer Verbundenheit all seine alten Gefährten skalpierte, sobald sie aufstiegen – und hielt dann Ausschau nach einer Spezialisierung. Nachdem er sie gefunden hatte (Chaucer war das Opfer), sicherte er seine Position, ehe er sie einnahm, durch vorsichtige Rede, kultiviertes Betragen und die Flüsterworte seiner Freunde, denen auch er die Plage des Denkens erspart hatte. Als er seine ersten ernsthaften Artikel über Chaucer veröffentlichte, sagten daher alle an Chaucer Interessierten: »Hier spricht eine Autorität.« Aber er war kein Hochstapler. Er lernte und kannte seinen Dichter und dessen Zeit; und in einem einmonatigen Kleinkrieg in einem strengen literarischen Wochenblatt stellte er sich einem anerkannten Chaucer-Experten jener Tage und zerfetzte ihn. »Aus alter Verbundenheit«, wie er einem Freund schrieb, machte er sich sogar die Mühe, eines von Manallace’ Büchern zu rezensieren, mit einer Menge ins Intime reichender, unappetitlicher Deduktionen (das war vor den Tagen Freuds), die sehr lange ihresgleichen suchten. Ein Mitglied des weiland Syndikats nahm die Gelegenheit wahr und fragte ihn, ob er nicht – »aus alter Verbundenheit« – Vidals Mutter zu einer neuen Behandlung verhelfen wolle. Er antwortete, er habe »die Dame nur flüchtig gekannt«, und durch andere Verpflichtungen sei seine Börse so beansprucht, daß etc. Der Briefschreiber zeigte die Antwort Manallace, der sagte, er sei froh, daß Castorley sich nicht eingemischt habe. Zu dieser Zeit war Vidals Mutter ganz paralysiert. Nur ihre Augen bewegten sich, und die suchten immer nach dem Mann, der sie verlassen hatte. So starb sie in Manallace’ Armen, im April des ersten Kriegsjahres.
Während des Kriegs wuschen Manallace und Castorley gewissermaßen die schmutzige Wäsche einer Abteilung im Amt für Koordinierte Überwachung. Hierbei lernte Manallace Castorley wieder kennen. Castorley, der einen süßen Zahn hatte, schnorrte für seinen Tee Zuckerstückchen von einer Schreibkraft, und als die Frau begann, sie einem jüngeren Mann zu geben, richtete Castorley es ein, daß sie wegen Rauchens in dafür nicht vorgesehenen Räumen angezeigt wurde. Manallace beschaffte sich alle Einzelheiten der Affaire, als Entschädigung für die Rezension seines Buchs. Dann kam eine Nacht, in der die beiden Männer in Erwartung eines großen Luftangriffs wie Menschen miteinander redeten, und Manallace sprach über Vidals Mutter. Castorley gab ihm eine Antwort, und in dieser Stunde – wie einige Jahre danach herauskam – begannen Manallace’ wahre Lebensaufgabe und Interessen.
Nach Kriegsende setzte Castorley alles daran, sich zum Pontifex maximus in Sachen Chaucer zu machen, mit Methoden nicht sehr fern der Verwendung von Giftgas. Der englische Chaucerpapst war infolge privaten Kummers verstummt, und den gelehrten Hunnen, der auf dem Kontinent die Lehnsherrschaft beanspruchte, hatte die Grippe dahingerafft. So krähte Castorley denn unangefochten von Uppsala bis Sevilla, während Manallace in sein Landhäuschen mit dem Foto von Vidals Mutter über dem Kaminsims zurückkehrte. Sie schien sein Leben entleert und ihm nur flüchtiges Interesse an Lappalien gelassen zu haben. Seine privaten Zerstreuungen waren Experimente mit ungewissem Ausgang, die ihn, wie er sagte, nach einem Tag Raubbau und Steinekloppen erfrischten. Ich fand ihn zum Beispiel an einem Wochenende in der Waschküche seines Werkzeugschuppens, wo er aus schleimiger Borke ein Gebräu kochte, das gemischt mit Galläpfeln, Vitriol und Wein zu einem Tintenpulver werden sollte. Wir kochten es bis zum Montag, und es wurde ein Klebstoff daraus, stärker als Vogelleim, in dem wir uns beide verfingen.
Zu anderen Zeiten schleppte er mich alle paar Wochen zu Castorley, zu dessen Füßen wir dann saßen, um ihn über Chaucer reden zu hören. In seiner Jugend, als man sie niederschreien konnte, war Castorleys Stimme schlimm genug gewesen, aber mit Kultiviertheit und Takt war sie nun fast unerträglich geworden. Auch seine Manieriertheiten hatten sich vervielfacht und festgesetzt. Er minzte und maunzte, posierte und zerkaute seine Wörter an diesen furchtbaren Abenden; und er vergiftete nicht nur Chaucer, sondern jedes Stückchen englischer Literatur, das er verwendete, um ihn auszuschmücken. Außerdem war er schamlos, was Eigenwerbung und »Anerkennung« angeht – er spann ausgetüftelte Intrigen; er schloß schäbige Freundschaften und Bündnisse, um sie eine Woche später zugunsten verheißungsvollerer Allianzen wieder zu lösen; er scharwenzelte, schmähte, dozierte, organisierte und log so unermüdlich wie ein Politiker, auf der Jagd nach jenem Rittertum, das nicht etwa ihm gebührte (er rief immer seinen Schöpfer an, solch einen Gedanken zu verhüten), sondern ein Tribut an Chaucer sein sollte. Und doch konnte er sich bisweilen von seiner Besessenheit befreien und beweisen, daß eines Menschen Werk immer versuchen wird, seine Seele zu retten. Er erzählte uns bezaubernde Geschichten über Kopisten des fünfzehnten Jahrhunderts in England und den Niederlanden, die die Chaucermanuskripte vervielfältigt hatten, von denen – er nannte uns die genaue Anzahl – erhalten waren, und wie er (und er ließ anklingen, er allein) jeden dieser Schreiber von jedem anderen unterscheiden konnte, an Besonderheiten der Buchstabenformung, am Abstand oder ähnlichen Tricks des Federwerks; und wie er die Daten ihrer Arbeit auf fünf Jahre genau bestimmen konnte. Manchmal bescherte er uns eine Stunde voll von wirklich interessanten Dingen und kam dann auf seine überfällige »Anerkennung« zurück. Mich ekelten diese Übergänge an, aber Manallace verteidigte ihn, da er ein Meister auf seinem Gebiet sei und Chaucer zumindest einer dankbaren Seele entschleiert habe.
Soweit ich mich erinnere, war das in jenem Herbst, in dem Manallace Ferien auf den Shetlands oder den Färöern machte und mit einem steinernen Quern zurückkam – einer Handmühle für Getreide. Er sagte, sie interessiere ihn vom ethnologischen Standpunkt aus. Diese Laune hielt bis zum nächsten Herbst an und wurde abgelöst von religiösen Krämpfen, die sich natürlich in Literatur niederschlugen. Er zeigte mir eine arg mitgenommene und verstümmelte Vulgata von 1485, deren Rücken mit Fetzen von Pergamenturkunden geflickt war; er hatte sie für fünfunddreißig Shilling gekauft. Der Versuch irgendeines Mönchs, Kapitelinitialen rot auszumalen, hatte, wie es schien, seine schweifende Schrulligkeit eingefangen, und wochenlang schmierte er mit Farbnäpfchen voll Gold und Silber herum.
Auch das verblaßte, und er reiste auf den Kontinent, um Lokalkolorit für eine Liebesgeschichte zu sammeln, in der es um Alba und die Holländer ging, und im nächsten Jahr sah ich praktisch nichts von ihm. Das ersparte es mir, viel von Castorley zu sehen, aber in großen Abständen besuchte ich ihn zum Abendessen, bei welchen Gelegenheiten seine Frau – eine unappetitliche, aschfarbene Person – kein Geheimnis daraus machte, daß seine Freunde sie fast so sehr langweilten wie er. Aber bei einer späteren Begegnung, kurz nachdem Manallace seinen niederländischen Roman beendet hatte, fand ich Castorley bis zum Platzen gebläht von Triumph und erhabener Information, die er kaum zurückhalten konnte. Er teilte mir vertraulich mit, eine Zeit sei gekommen, da wichtige Dinge zutage treten würden, und »Anerkennung« sei dann unvermeidlich. Natürlich nahm ich an, in Chaucerkreisen seien neue Skandale oder Häresien im Umlauf, und so hielt sich meine Neugier in Grenzen.
Bald darauf kabelte New York, ein Fragment einer bisher unbekannten »Canterbury-Geschichte« liege sicher in den stählernen Grüften der sieben Millionen Dollar schweren Sunnapia-Kollektion. Das war eine Nachricht von internationalem Rang – die Neue Welt jubelte – die Alte beklagte »die Bürde britischer Besteuerung, die solche Schätze dazu treibt«, etc., und die leichtfertigeren Blätter tummelten sich ihrer Leserschaft entsprechend; denn »unser Dan«, wie ein ernsthafter Leitartikler eines Sonntagsblatts bemerkte, »liegt dem Herzen der Nation näher, denn wir deß kundig gewest«. Aus Gründen allgemeinen Anstands suchte ich Castorley auf, der zu meinem Erstaunen noch nicht in die Arena gestiegen war. Ich fand ihn verjüngt vom Jubel und vertieft in eben eingetroffene Korrekturfahnen.
Ja, sagte er, alles stimme. Natürlich habe er von vornherein Bescheid gewußt. Man habe einhundertsieben neue Zeilen von Chaucer gefunden, angehängt an einen verkürzten Schluß von The Persone’s Tale, all dies das Werk von Abraham Mentzius, besser bekannt als Mentzel von Antwerpen (1388–1438/39) – sicher entsönne ich mich, daß er über ihn gesprochen habe; seine kennzeichnenden Besonderheiten seien eine gewisse byzantinische Formung der Gs und die Verwendung einer »sichelförmig abgeschrägten« Riedfeder, die bei bestimmten Buchstaben ins Kalbspergament schneide; vor allem jedoch ein Hang dazu, englische Wörter gemäß holländischen Gepflogenheiten zu buchstabieren, wofür es im Manuskript ein überzeugendes Beispiel gebe. Und zwar (er schrieb es für mich auf) folgendes – ein Mädchen betet um Verschonung von einer unerwünschten Heirat und sagt:
Ah Jesu-Moder, pitie my oe peyne.
Daiespringe mishandeelt cometh nat agayne.
[Ah Jesu-Mutter, erbarm dich meiner Schmerzen.
Mißbrauchter Morgen kommt nie wieder.]
Ob ich, bitte sehr, die Schreibweise »mishandeelt« [engl. mishandled] beachten wolle? Eindeutig holländisch und Mentzels Gewohnheitssünde! Aber in seiner Position nehme man natürlich nichts als selbstverständlich hin. Die Seite sei Teil der Versteifung eines alten Bibelrückens gewesen, zusammen mit anderen Objekten von Dredd gekauft, dem großen Antiquar, und von Dredd mit einer Lieferung von ähnlichem Krimskrams an die Sunnapia-Kollektion verschifft, wo man in Glaskästen eine Ausstellung der gesamten Geschichte illuminierter Manuskripte mache und sich nicht darum schere, wie viele Bücher zu dem Zweck ausgeschlachtet würden. Dort habe jemand einen Riß im Rücken des Bandes bemerkt und es ausgegraben. Er fuhr fort: »Zuerst wußten sie nicht, was sie mit dem Ding tun sollten. Aber sie wußten von mir! Sie haben Stillschweigen bewahrt, bis sie mich konsultiert hatten. Vielleicht ist dir aufgefallen, daß ich drei Monate lang nicht in England war.
Ich war natürlich drüben. Es war ein sogenannter ›Abfall‹ – eine Seite, die Mentzel mit seiner holländischen Schreibweise verdorben hatte – ich nehme an, er hat sich das Englische diktieren lassen – dann hat er offenbar das Velin benutzt, um seine Riedfedern auszuprobieren; und schließlich, glaube ich, hat er es fortgeworfen. Der ›Abfall‹ war gefaltet, zusammengeklebt und als Versteifung in den alten Buchdeckel eingeschoben worden. Ich habe es mit Wasserdampf öffnen lassen und das Abwasser analysiert. Die Mehlklümpchen vom Kleister waren darin – grob, wegen des alten Mühlsteins – und dann auch noch Spuren vom Steinkorn selbst. Was? Ach, möglicherweise eine Handmühle aus Mentzels Zeit. Vielleicht hat er die Abfallseite selbst gefaltet und für ein Polster genommen, um Holzschnitte zu stützen. Kann sein, daß die Seite jahrelang in seiner Werkstatt herumgeflogen ist. Das ist nebenbei so gut wie sicher, es hat nämlich ein Anfänger aus den Niederlanden sein Ried an ein paar Zeilen aus irgendeinem Mönchslied versucht – übrigens gar nicht schlecht, das Lied –, das allgemein verbreitet gewesen sein muß. O ja, die Seite kann durchaus für andere Bücher benutzt worden sein, ehe sie in die Vulgata gekommen ist. Das spielt auch keine Rolle, aber das hier wohl! Paß auf! Zum Analysieren habe ich einen Fleck in einer Ecke ausgewaschen – der muß dahin gekommen sein, nachdem Mentzel es aufgegeben hatte, aus der Seite noch etwas zu machen, und nachlässig geworden war – und ich habe tatsächlich die Tinte dieser Epoche erhalten! Das Zeug hält sich beinahe ewig; es ist zusammengesetzt nach der Formel von – jetzt habe ich doch seinen Namen vergessen – natürlich der Schreiber aus Bury St. Edmunds – aus Weißdornrinde und Wein. Jedenfalls, nach seiner Formel. Das interessiert dich wahrscheinlich nicht so sehr, aber zusammen mit allen anderen Beweisen macht es die Sache hieb- und stichfest. (Du wirst das alles am Montag in meiner Pressemitteilung lesen können.) Überwältigend, nicht wahr?«
»Überwältigend«, sagte ich ehrlich. »Aber erzähl mir doch, worum es in der Geschichte geht. Das fällt eher in mein Gebiet.«
»Ich weiß; aber ich muß für alle Gebiete gerüstet sein. Die Verse sind relativ einfach, man kann sie gut wiedergeben. Die Frische, die Freude, die Menschlichkeit, der Duft von allem, alles ruft – nein, schreit –, daß es Dans Arbeit ist. Also, allein ›Daiespring mishandled‹ trägt den Prägestempel von Dans Münze. Laut und deutlich wie die Trompeten des Jüngsten Gerichts, mein Lieber! Steht alles in meiner Erklärung. Also, im wesentlichen handelt das Fragment von einem Mädchen, dessen Eltern wollen, daß es einen ältlichen Freier heiratet. Die Mutter legt nicht soviel Wert darauf, wohl aber der Vater, ein alter Ritter. Das Mädchen liebt natürlich einen jüngeren und ärmeren Mann. Alte Geschichte? Na klar. Dann wird der Vater, der dazu überhaupt keine Lust hat, auf einen Kreuzzug geschickt, und um den Tritt von oben an jemand unter ihm weiterzugeben, wie wir im Krieg gesagt haben, ordnet er an, daß das Mädchen unter Verschluß bleibt, bis er zurückkommt oder sie der Heirat mit dem alten Freier zustimmt. Immer noch eine alte Geschichte? Ja, natürlich. Jedenfalls ist das zuviel für die Mutter. Sie erinnert den alten Ritter an sein Alter und seine Unpäßlichkeit und an die Unbequemlichkeiten von Kreuzzügen. Langweile ich dich auch ganz bestimmt nicht?«
»Überhaupt nicht«, sagte ich; allerdings hatte die Zeit begonnen, durch mein Hirn rückwärts zu wirbeln, zum roten Samt und Pomadengeruch eines Nebenzimmers von Neminaka und zu Manallace, der mit trotzigem Gesicht für den Gasleuchter deklamierte.
»Du kannst das alles nächste Woche in meiner Erklärung lesen. Summa summarum erzählt die alte Dame ihm von einem abenteuernden Ritter an der französischen Küste, der für ein gewisses Entgelt Ritter überfällt, die sich nicht viel aus Kreuzzügen machen, und der sie bei unmöglichen Lösegeldforderungen gefangenhält, bis die Kriegssaison vorüber ist oder bis sie krank werden. Er hat ein Schiff im Kanal, um sie aufzupicken; seine Vögel bringt er dann in seine Burg auf dem Festland, wo er sie angeblich sehr gut behandelt. Und die alte Dame sagt ihm:
And if perchance thou fall into his honde
By God how canstow ride to Holilonde?
[Und wenn du zufällig in seine Hand fällst,
bei Gott, wie kannst du ins Heilige Land reiten?]
Na? Im Prinzip so modern wie Gilbert und Sullivan, aber in der Durchführung so, wie nur Dan das konnte! Und sie erinnert ihn daran, daß ›Ehre und altes Gebein‹ füreinander längst keine guten Gefährten mehr sind. Er beschwört einmal ganz prächtig den Geist der Ritterlichkeit:
Lat all men change as Fortune may send,
But Knighthood beareth service to the end
[Die Menschen mögen sich wandeln, gemäß ihrem Geschick,
aber Ritterschaft dient bis zum Ende]
und danach ergibt er sich natürlich:
For what his woman willeth to be don
Her manne must or wauken Hell anon
[Denn was seine Frau getan sehen will,
muß ihr Mann tun, sonst weckt er bald die Hölle]
Dann deutet sie an, daß der junge Liebhaber der Tochter – er ist im Bordeaux-Weinhandel – die Verhandlungen über eine Entführung in Gang bringen könnte, ohne ihn zu kompromittieren. Und dann versaut dieser achtlose Trottel Mentzel seine Seite und schmeißt sie weg! Aber was da ist, reicht, um zu sehen, worauf es hinausläuft. Du wirst das alles in meiner Erklärung finden. Hat es jemals einen literarischen Fund gegeben, der sich damit messen kann? … Und dann macht man Krämer zu Rittern, weil sie Käse verkaufen!«
Ich ging, ehe er auf diesem Kurs richtig in Fahrt kommen konnte. Ich wollte nachdenken und mit Manallace sprechen. Aber ich wartete, bis Castorleys Erklärung herauskam. Er hatte sich kein Schlupfloch offengelassen. Und als bald darauf sein »wissenschaftlicher« Bericht (nominell der der Sunnapia-Leute) über ihre Analysen und Tests erschien, legte sich jede Kritik, und einige Zeitungen begannen, »öffentliche Anerkennung« zu fordern. Manallace schrieb mir zu diesem Thema, und ich fuhr zu seinem Häuschen, wo er mich sofort aufforderte, eine Eingabe zu Castorleys Gunsten zu unterzeichnen. Mit ein wenig Glück, sagte er, könnten wir ihm einen K.B.E. in der nächsten Liste der Ehrungen verschaffen. Ob ich die Erklärung gelesen hätte?
»Hab ich«, antwortete ich. »Aber zuerst möchte ich dich etwas fragen. Erinnerst du dich an die Nacht, in der du dich im Neminaka betrunken hast und ich dageblieben bin, um auf dich aufzupassen?«
»Ach, diese Zeit«, sagte er versonnen. »Warte mal! Ich erinnere mich, daß Graydon mir zwei Pfund vorgeschossen hat. Er war ein großzügiger Zahlmeister. Und ich erinnere mich – also, wer zum Teufel hat mich unters Sofa gerollt – und warum?«
»Das waren wir alle«, erwiderte ich. »Du wolltest uns vorlesen, was du zu diesen Chaucer-Ausschnitten geschrieben hattest.«
»Daran erinnere ich mich nicht. Nein! Ich erinnere mich an gar nichts mehr, nach der Sofa-Episode … Du hast doch immer erzählt, du hättest mich nach Hause gebracht, oder?«
»Hab ich, und du hast vor dem alten Empire zu Kentucky Kate gesagt, daß du treu gewesen bist, Cynara, auf deine Weise.«
»Hab ich?« sagte er. »Mein Gott! Na ja, wahrscheinlich hab ich wirklich.« Er starrte ins Feuer. »Was noch?«
»Bevor wir Neminaka verlassen haben, hast du mir rezitiert, was du aus den Ausschnitten gemacht hattest – und zwar die ganze Geschichte! Also – verstehst du?«
»Ja-a.« Er nickte. »Was willst du damit machen?«
»Was machst du?«
»Ich sorge dafür, daß er seinen Titel kriegt – zuerst mal.«
»Warum?«
»Ich will dir erzählen, was er über ’Dals Mutter gesagt hat – in der Nacht, als der Luftangriff auf das Amt war.«
Er erzählte es.
»Deshalb«, sagte er. »Reicht das als Grund?«
Mir erschien es vollkommen ausreichend.
»Aber nachdem er seinen Titel bekommen hat?« fuhr ich fort.
»Das kommt drauf an. Es gibt ein paar Dinge, die ich mir vorstellen kann. Es interessiert mich.«
»Lieber Himmel! Ich hab immer gedacht, du bist ein Mensch ohne Interessen.«
»War ich auch. Meine Interessen verdanke ich Castorley. Jedes einzelne habe ich von ihm, außer der Geschichte selbst.«
»Wo hast du die bloß her?«
»Bei diesen gräßlichen Drucken war irgendwas, das etwas in mir ausgelöst hat – eine Art Besessenheit, glaub ich. Außerdem war ich verliebt. Kein Wunder, daß ich mich in der Nacht betrunken hab. Eine Woche lang war ich Chaucer! Dann hab ich mir gedacht, aus der Idee könnte man eine komische Oper machen. Aber Gilbert und Sullivan waren zu stark.«
»Ich erinnere mich, daß du mir das damals gesagt hast.«
»Ich hab’s mit mir rumgeschleppt, und das hat dafür gesorgt, daß ich mich für Chaucer interessiert hab – philologisch und so weiter. Unter dem Aspekt hab ich dann jahrelang daran gearbeitet. Spätestens anno vierzehn war der Text makellos. Seitdem brauchte ich kaum noch was dran zu machen.«
»Hast du je einem anderen außer mir davon erzählt?«
»Nein, nur ’Dals Mutter – zum Einschlafen – als sie noch etwas hören konnte. Aber als Castorley gesagt hat … was er über sie gesagt hat, da dachte ich, ich könnte es verwenden. War gar nicht schwierig. Er hat’s mir beigebracht. Erinnerst du dich an meine Experimente mit Vogelleim und wie wir das Zeug an den Händen hatten? Ich hatte über ein Jahr lang versucht, diese Tinte hinzukriegen. Castorley hat mir gesagt, wo ich die Formel finden kann. Und weißt du noch, wie du über die Handmühle gestolpert bist?«
»Daher der Steinstaub unterm Mikroskop?«
»Ja. Den Weizen hab ich hier im Garten gezogen und selbst gemahlen. Castorley hat mir Mentzel komplett geliefert. Er hat mich auf ein Manuskript im Britischen Museum hingewiesen und gesagt, das sei das beste Beispiel für seine Arbeit. Ich habe seine ›byzantinischen Gs‹ monatelang kopiert.«
»Und was ist eine ›sichelartig abgeschrägte‹ Feder?« fragte ich.
»Du mußt eine Kante von deiner Rohrfeder so einkerben, daß sie bei den Rundungen der Buchstaben hängenbleibt und kratzt. Castorley hat mir von Mentzels Abständen und Rändern erzählt. Ich brauchte nur noch ein Gefühl für seine Schrift zu kriegen.«
»Wie lang hast du dafür gebraucht?«
»Ein paar Jahre – ab und an. Zuerst war ich zu ehrgeizig – ich wollte das ganze Gedicht liefern. Das wäre riskant gewesen. Dann hat Castorley mir von Abfall-Seiten erzählt, und an den Tip hab ich mich gehalten. Ich habe ›Dayspring mishandeelt‹ so buchstabiert wie Mentzel – um ihn ganz sicher zu ködern. An sich ist das Verspaar gar nicht schlecht. Hast du gelesen, wie sehr er das ›Laute und Deutliche‹ daran bewundert?«
»Laß ihn mal beiseite. Mach weiter!« sagte ich.
Er machte weiter. Castorley war die ganze Zeit sein unfehlbarer Führer gewesen und hatte bis zu den winzigsten Details jede Falle eingehend beschrieben, die später für seine Füße ausgelegt werden sollte. Das schließlich verwendete Kalbspergament war ein Antwerpener Fund, und die Einarbeitung dieses Velins in den Umschlag der Vulgata hatte nach einem langen Kurs in »Buchbinderei für Liebhaber« begonnen. Schließlich bettete er es zwischen Stücke eines alten juristischen Dokuments und eine gedruckte Seite (1686) aus den Oden von Horaz, beides von verschiedenen Besitzern im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert ganz legitim für Ausbesserungen verwendet; und um Castorleys Theorie zu bestätigen, daß Abfall-Seiten in den Schreibwerkstätten von Anfängern benutzt wurden, hatte er im letzten Augenblick ein paar lateinische Wörter in der Schrift des fünfzehnten Jahrhunderts – Castorleys Presseerklärung nannte das genaue Datum – auf eine freie Stelle des Fragments geschrieben. Der Text lautete: »Illa alma Mater ecca, secum afferens me acceptum. Nicolaus Atrib.« Das Ding unterzubringen war schließlich das leichteste. Er hatte sich lediglich in den fünfzehn Räumen von Dredds düsterem Buchladen herumgetrieben, wo man ihn gut kannte, und dort bisweilen etwas gekauft, aber meistens nur gestöbert, bis ihm eines Tages Dredd Senior ein Regal mit billigen Frakturbänden aus England und vom Kontinent zeigte – sie wurden eben für die Sunnapia-Leute verpackt –, und Manallace steckte seinen Beitrag hinein, wobei er sorgsam den Rücken ausreichend beschädigte, um ernsthaft Suchende auf die richtige Fährte zu locken.
»Und dann?« fragte ich.
»Nach ungefähr sechs Monaten hat Castorley mich kommen lassen. Sunnapia hatte es gefunden, und da Dredd es übersehen hatte und kein Geldmotiv sichtbar war, waren sie von Anfang an ziemlich überzeugt, daß es echt wäre. Aber sie haben ihn nach drüben eingeladen. Er hat sich mit ihren Experten beraten und die wissenschaftlichen Tests vorgeschlagen. Ich hab ihm das vor seiner Abreise in den Kopf gesetzt. Das ist alles. – Bist du jetzt bereit, unsere Eingabe zu unterzeichnen?«
Ich unterschrieb. Noch ehe wir es überall herumgereicht hatten, half uns bereits ein Haufen einflußreicher Namen, desgleichen die Wucht der gesamten literarischen Diskussion, die sich um jede Einzelheit der glorreichen trouvaille erhoben hatte. Das Endergebnis war ein K.B.E. für Castorley auf der nächsten Liste der Ehrungen; und noch am gleichen Nachmittag besuchte Lady Castorley mit geziemend gedruckten Visitenkarten ihre Bekannten.
Einen oder zwei Tage später lud Manallace mich ein, ihn zu begleiten, um den beiden unsere Freude und Genugtuung auszudrücken. Wir wurden belohnt durch den Anblick eines entspannten und entgürteten – um nicht zu sagen: sich nackt suhlenden – Mannes auf dem Wogenkamm des Erfolgs. Er versicherte uns, »Der Titel« werde in unseren hinkünftigen Beziehungen keinerlei Rolle spielen, da dieser ja in keiner Weise persönlich, sondern, wie er oft gesagt habe, ein Tribut an Chaucer sei; »und letzten Endes«, sagte er mit einem Blick in den Spiegel über dem Kaminsims, »war Chaucer ja der Prototyp des ›gar vil edeln lobebaeren Ritters‹ des Britischen Empire, soweit dies damals existierte.«
Auf dem Heimweg sagte Manallace mir, er erwäge entweder eine Enthüllung (ohne Vorankündigung) in der übleren Presse, die dann Castorley als Frühstückslektüre seine Reputation um die Ohren hauen würde, oder ein vertrauliches Gespräch, in dem er Castorley klarmachen würde, daß er sich nun bis an sein Lebensende hinter die Fälschung stellen müsse, unter Manallace’ Drohung, ihn hochgehen zu lassen, wenn er kniffe.
Er neigte dem zweiten Projekt zu. »Wenn ich den Hahn für die kalte Dusche in der Zeitung aufdrehe«, sagte er, »könnte Castorleys vil edle lobebaere Sicherung durchknallen. Ich möchte seinen Intellekt erhalten.«
»Wie steht’s mit deiner eigenen Position? Die Fälschung ist nicht so wichtig. Aber wenn du es bekanntmachst, bringst du ihn um.«
»Das habe ich auch vor. Und meine Position? Ich bin tot, seit – seit April anno vierzehn. Aber das hat keine Eile. Was hat sie dir denn beim Rausgehen gesagt?«
»Sie hat mir erzählt, wieviel ihm deine Sympathie und dein Verständnis bedeutet haben. Sie hat gesagt, sie glaubt, daß nicht einmal Sir Alured das ganze Ausmaß seiner Verpflichtungen dir gegenüber erkennt.«
»Sie hat recht, aber es gefällt mir nicht, daß sie es so ausdrückt.«
»Das ist doch nur ganz herkömmlich – wie Castorley immer sagt.«
»Bei ihr nicht. Die kann dich denken hören.«
»Den Eindruck hat sie auf mich aber nie gemacht.«
»Du spielst ja auch nicht gegen sie.«
»Schlechtes Gewissen, Manallace?«
»Hm! Wenn ich das wüßte. Meins oder ihres? Ich wünschte wirklich, sie hätte das nicht gesagt. ›Größeres Ausmaß als sogar er erkennt.‹ Ich werde mich da eine Weile nicht blicken lassen.«
Er hielt sich fern, bis wir lasen, Sir Alured sei infolge einer leichten Unpäßlichkeit nicht in der Lage gewesen, ein ihm zu Ehren veranstaltetes Dinner zu besuchen.
Erkundigungen ergaben, daß es sich nur um eine natürliche Reaktion auf zu große Anspannung handle, und zwar im Moment in Form nervöser Verdauungsstörungen, und er würde sich jederzeit über Manallace’ Besuch freuen. Manallace berichtete, er habe ihn ziemlich angespannt und erschöpft gefunden, aber erfüllt vom neuen Leben und dem neuen Status und stolz darauf, daß seine Mühen ihm solch ein Martyrium abverlangten. Er wolle all seine Erklärungen und Schlußfolgerungen versammeln, vergleichen und erweitern, zu einem maßgeblichen Band.
»Ich muß mir selbst die Mühe machen«, sagte Manallace. »Ich habe fast all sein Zeug über den Fund gesammelt, soweit es in Zeitungen erschienen ist, und er hat mir alles versprochen, was fehlt. Ich werde ihm helfen. Das wird ein neues Interessengebiet sein.«
»Wie willst du es machen?« fragte ich.
»Ich schätze, ich werde seine Folgerungen aus den Indizien zitieren und meine Experimente daneben halten – die Tinte und den Kleister und alles andere. Es dürfte sehr interessant werden.«
»Aber selbst dann kannst du dich nur auf dein Wort stützen. Es ist schwer, gegen eine gut etablierte Lüge anzukommen«, sagte ich. »Vor allem, wenn man selbst sie in Umlauf gebracht hat.«
Er lachte. »Dagegen habe ich vorgebaut – falls mir irgendwas zustößt. Erinnerst du dich an dieses ›Mönchslied‹?«
»Aber ja! Inzwischen gibt es schon ganz schön viel Literatur darüber.«
»Also, schreib diese zehn Wörter untereinander und lies von oben nach unten zuerst die ersten und dann die zweiten Buchstaben; und laß dich überraschen, was dabei rauskommt.[1] Meine Bank hat die Formel.«
Er widmete sich liebevoll und gemächlich seiner neuen Aufgabe, und Castorley hielt sein Wort und half ihm dabei. Praktisch arbeiteten die beiden zusammen, denn Manallace regte an, Castorleys streng wissenschaftliche Beweise sollten übersichtlich zusammengestellt werden, mit den Deduktionen und Dithyramben als Anhang. Er versicherte ihm, die Öffentlichkeit würde diese Anordnung vorziehen, und nach ernsthafter Erwägung stimmte Castorley zu.
»So ist es besser«, sagte Manallace mir. »Auf die Art brauche ich bei meinen Textauszügen nicht so viele Löcher zu lassen. Bei Pünktchen haben die Leser immer das Gefühl, daß man mit seinem Gegner nicht anständig umgeht. Ich werde ihn einfach am Stück zitieren und zerfetzen, Beweis für Beweis, Datum für Datum, in parallelen Spalten. Allerdings frißt das Buch ihn mehr auf, als mir gefällt. Seit ich angefangen habe, mit ihm zu arbeiten, haben ihn schon zweimal Bauchschmerzen umgeworfen. Und er ist genau die Sorte Stinker, die an Blinddarm sterben könnte.«
Binnen kurzem erfuhren wir, daß die Anfälle ihre Ursache in Gallensteinen hatten, die eine Operation nötig machten. Castorley trug es mit großer Fassung. Er hatte volles Vertrauen zu seinem Arzt, einem alten Freund des Hauses; großes Zutrauen zu seiner körperlichen Verfassung; eine kraftvolle Gewißheit, daß ihm nichts zustoßen würde, ehe nicht das Buch vollendet wäre; und, vor allem, den Willen zum Leben.
Er verbreitete sich über diese Trümpfe mit einer Stimme, die bisweilen ein wenig schwankte, und seine Augen waren heller als sonst, neben einer schärfer hervortretenden Nase.
Ich hatte Gleeag, den Arzt, nur ein- oder zweimal in Castorleys Haus getroffen, aber allenthalben gehört, er sei ein überaus fähiger Mann. Er sagte Castorley, seine Schmerzen seien der Preis, den in der einen oder anderen Form alle entrichten müßten, die ihrem Lande gedient hätten; und in Belastungseinheiten gemessen sei Castorley in jenen drei Jahren im Amt für Koordinierte Überwachung praktisch an der Front gewesen. Man habe das Problem aber beizeiten erkannt, und in ein paar Wochen werde er sich keine Sorgen mehr darüber machen.
»Aber angenommen, er stirbt?« sagte ich zu Manallace.
»Tut er nicht. Ich hab mit Gleeag gesprochen. Er sagt, Castorley ist in Ordnung.«
»Meinst du nicht, daß Gleeag dir einfach etwas ganz Herkömmliches sagt?«
»Ich wünschte, du hättest das nicht gesagt. Aber Gleeag hätte doch bestimmt nicht die Stirn, mit mir solche Spielchen zu machen – oder mit ihr.«
»Warum nicht? Ich glaube, das hat’s schon gegeben.«
Aber Manallace bestand darauf, daß es in diesem Fall nicht möglich sei.
Die Operation war erfolgreich, und einige Wochen danach begann Castorley, große Teile des Stoffs und die ganze Anordnung des Buchs zu bearbeiten. »Laß mich doch«, sagte er, als Manallace Einwände erhob. »Die behandeln mich doch alle wie ein Kind. Es ist wirklich nicht nötig, daß Gleeag jetzt jeden Tag nach mir sieht.« Aber Lady Castorley sagte uns, er bedürfe sorgsamer Aufsicht. Die Belastung habe sein Herz angegriffen, und jede Art von Ärger oder Enttäuschung sei zu vermeiden. »Auch wenn Sie« – sie wandte sich an Manallace – »viel besser wissen, wie das Buch angeordnet werden sollte, als er selbst.«
»Aber hören Sie«, fing Manallace an. »Ich will mich nun wirklich überhaupt nicht ein…«
Sie drohte ihm spielerisch mit dem Finger. »Das meinen Sie; aber vergessen Sie nicht, er erzählt mir alles, was Sie ihm sagen, genauso wie er mir alles erzählt hat, was er Ihnen einmal gesagt hat. Ach, nicht die Dinge, über die Männer manchmal reden, die meine ich nicht. Ich meine, über seinen Chaucer.«
»Das wußte ich nicht«, sagte Manallace schwach.
»Das hatte ich angenommen. Er verschont mich nie mit irgend etwas; aber mir macht das nichts aus«, sagte sie lachend, und dann ging sie zu Gleeag, der seine tägliche Visite machte. Gleeag sagte, er habe keine Einwände dagegen, daß Manallace mit Castorley zu bestimmten Zeiten an dem Buch arbeite – etwa zweimal die Woche –, unterstützte jedoch Lady Castorleys Forderung, ihn in jenen Zeiten, die sie die »heiligen Stunden« nannte, nicht allzu sehr zu beanspruchen. Der Mann wurde in Umgang und Zusammenarbeit immer schwieriger, und wenn er bisher sein Eigenlob noch ein wenig im Zaum gehalten hatte, ließ er diesem nun völlig die Zügel schießen.
»Er sagt, in der Geschichte der Literaturwissenschaft hätte es nie etwas Vergleichbares gegeben.« Manallace stöhnte. »Er will es mir jetzt zueignen – er widmet nämlich nie, weißt du –, zueignen will er es, mir, als seinem ›überaus geschätzten Assistenten‹. Das Teuflische dabei ist, daß sie ihn bestärkt, was baldige Publikation angeht. Warum? Was meinst du, wieviel sie wohl weiß?«
»Wieso sollte sie denn überhaupt etwas wissen?«
»Du hast doch wohl gehört, was sie gesagt hat, daß er ihr alles erzählt hat, was er mir über Chaucer erzählt hat? (Mir wäre wirklich lieber, sie hätte das nicht gesagt!) Wenn sie zwei und zwei zusammenzählt, kann sie doch gar nicht übersehen, daß jede einzelne seiner Ideen und Theorien zum besten gehalten worden ist. Aber wenn … aber wenn … Wieso will sie dann, daß es so bald veröffentlicht wird? Sie sagt, ich verdrieße ihn. Dabei ist sie dauernd hinter ihm her, damit er sich beeilt.«
Castorley mußte sich überarbeitet haben, denn nach ein paar Monaten klagte er über Stechen in der rechten Seite; Gleeag sagte, dies seien leichte Folgeerscheinungen, Nachwehen der Operation. Es warf ihn ein wenig zurück, aber er ließ sich nicht unterkriegen und machte sich wieder an sein Werk.
Das Buch sollte im Herbst erscheinen. Der Sommer ging vorüber, der Verleger drängelte, und – so erzählte er mir, als ich ihn nach längerer Pause besuchte – Manallace hatte sich ausgerechnet diese Zeit ausgesucht, um Ferien zu machen. Er sei gar nicht zufrieden mit Manallace, seinem einstmals unermüdlichen aide, der nun alles verzögere und zeitraubende Einwände erhebe. Auch Lady Castorley habe dies bemerkt.
Inzwischen versuche er mit Lady Castorleys Hilfe, nach besten Kräften das Buch fertigzustellen; aber Manallace habe wichtiges Material, das er ihm diktiert habe, verlegt – ob ich dächte, es könne aus Neid geschehen sein? Und Lady Castorley schrieb Manallace, der im Ausland durch einen kleinen Autounfall aufgehalten worden war, der Verdruß darüber, warten zu müssen, sei der Gesundheit ihres Gatten abträglich. Nach seiner Rückkehr vom Kontinent zeigte Manallace mir diesen Brief.
»Ich glaube schon, daß er ein bißchen verdrossen war«, sagte ich.
Manallace schüttelte sich. »Wenn ich im Ausland bleibe, helfe ich, ihn umzubringen. Wenn ich ihm helfe, das Buch schnell zu beenden, werde ich ihn umbringen. Sie weiß alles«, sagte er.
»Du bist verrückt. Das bildest du dir bloß ein.«
»Tu ich nicht! Paß mal auf! Du erinnerst dich, daß Gleeag mir erlaubt hat, zweimal die Woche von vier bis sechs mit ihm zu arbeiten. Sie hat das die ›heiligen Stunden‹ genannt. Hast du doch gehört, oder? Na also – die Stunden sind heilig! Das sind nämlich die, in denen sie und Gleeag zusammen sind. Aber sie ist so furchtbar unansehnlich, und ich bin so ein Trottel, daß ich Wochen gebraucht hab, um dahinterzukommen.«
»Das ist deren Angelegenheit«, antwortete ich. »Es beweist nicht, daß sie irgendwas über den Chaucer weiß.«
»Weiß sie aber! Er hat ihr alles gesagt, was er mir erzählt hat, die ganzen Jahre, in denen ich ihn ausgehorcht hab. Sie hat zwei und zwei zusammengezählt, als das Ding gefunden wurde. Sie hat ganz genau begriffen, wie ich die Fallen gestellt hab. Ich weiß es! Sie hat versucht, mich dazu zu bringen, daß ich es zugebe.«
»Was hast du gemacht?«
»So getan, als ob ich nicht versteh, worauf sie hinauswill. Und dann hat sie in meiner Gegenwart Gleeag gefragt, ob er nicht auch meint, daß Sir Alured sich über die Verzögerungen mit dem Buch ärgert. Er meinte nein. Er hat gesagt, die Veröffentlichung, wenn sie erst erfolgt ist, könnte ihm jedes Interesse nehmen. So viel Anstand hat er immerhin. Der Teufel ist sie!«
»Was will sie denn deiner Meinung nach erreichen?«
»Wenn Castorley erfährt, daß er reingelegt worden ist, bringt ihn das um. Sie löchert mich dauernd indirekt, daß ich es rauslasse. Ich hab dir doch erzählt, sie will eine Art Scherz unter uns daraus machen. Gleeag ist bereit zu warten. Er weiß, daß Castorley ein toter Mann ist. Das kommt raus, wenn sie reden. Sie sagen ›Er war‹, nicht ›Er ist‹. Beide wissen es. Aber sie will, daß er schneller erledigt wird.«
»Ich glaube es nicht. Was willst du tun?«
»Was kann ich denn tun? Jedenfalls lasse ich ihn nicht umbringen.«
Mannhaft erfand er Kompromisse, durch die Castorley auf interessante Abwege gelockt werden sollte, um die Veröffentlichung zu verzögern. Das war kein Erfolg. Der Herbst ging vorüber, Castorley wurde immer verdrossener, und seine schlimmen Koliken kehrten wieder. Schließlich sagte Gleeag ihm, seiner Meinung nach könnten sie auf einen übersehenen Gallenstein zurückzuführen sein, der sich nun in Bewegung gesetzt habe. Eine zweite, vergleichsweise harmlose Operation würde die Behelligung ein für allemal beheben. Für den Fall, daß Castorley eine zweite Meinung hierzu einholen wollte, nannte Gleeag ihm einen berühmten Chirurgen. »Und dann«, sagte er fröhlich, »können er und ich Sie bereden.« Castorley wollte nicht beredet werden. Schmerzen in der Seite, die zunächst auf ein von Gleeag verschriebenes Lebertonikum reagiert hatten, bedrückten ihn; nun blieben sie – wie Zahnschmerzen – hinter allem. Am wohlsten fühlte er sich in seinem Schlaf- und Arbeitsraum, umgeben von seinen Korrekturfahnen. Sollten die Schmerzen unerträglich werden, wolle er die zweite Operation in Erwägung ziehen. In der Zwischenzeit stimme Manallace – »der pedantische Manallace«, nannte er ihn – mit ihm darin überein, daß das von der Sunnapia-Bibliothek angefertigte Mentzel-Faksimile für das Große Buch nicht unbedingt gut genug sei, und die Sunnapia-Leute seien so anständig, ein neues Faksimile der Seite herstellen zu lassen. Dadurch verschiebe sich alles bis ins frühe Frühjahr; das habe aber durchaus Vorteile, denn so könne er alles noch einmal frischen Geistes durchsehen.
Man erfuhr diese Neuigkeiten im Verlauf sporadischer Besuche, während die Tage kürzer wurden. Er bestand darauf, daß Manallace die »heiligen Stunden« einhielt, und Manallace bestand darauf, daß ich ihn begleitete, sooft es möglich war. Bei diesen Gelegenheiten pflegten er und Castorley eine halbe Stunde allein zu beraten, während ich im Salon einer unerträglichen Uhr lauschte. Dann ging ich zu ihnen und half, die restliche Zeit herumzubringen, während Castorley abschweifte. Seine Reden waren nun oft umwölkt und ungenau – Ergebnis des »Lebertonikums«; und sein Gesicht begann altem Kalbspergament zu ähneln.
Es war einige Tage nach Weihnachten – die Operation war bis zum folgenden Freitag aufgeschoben worden –, als wir gemeinsam einen Besuch machten. Sie teilte uns zur Begrüßung mit, Sir Alured habe sich einen ärgerlichen kleinen Winterhusten geholt, infolge einer Erkältungswelle, aber deshalb brauchten wir keineswegs unseren Besuch abzukürzen. Wir fanden ihn schweißtriefend und nach Friar’s Balsam duftend vor. Er wedelte uns mit dem alten Sunnapia-Faksimile zu. Wir bestätigten ihm, daß es seines Buches hätte würdiger sein können. Er nahm eine Dosis von seiner Mixtur, ließ sich zurücksinken und bat uns, die Tür abzuschließen. Irgendwo, flüsterte er, sei irgendwas falsch. Er könne es nicht genau benennen, aber es liege in der Luft. Er fühle, daß man ihm übel mitspiele. Er möge es nicht. Rings um ihn her sei etwas sehr faul. Ob wir es bemerkt hätten? Manallace und ich verneinten verschiedentlich und mit Nachdruck, etwas in der Art bemerkt zu haben.
Fast übergangslos, nach einem leichten Hustenanfall, verfiel er in die gräßliche, hilflose Panik der Kranken – jener, die schlimmer als bloße Gefangene daliegen und zu jedem Dienst und jeder Hoffnung dem Urteil und der Gnade von Gesunden ausgeliefert sind. Er wolle fort. Ob wir ihm helfen könnten, seine Reisetasche zu packen? Oder, falls das bei gewissen Leuten zu viel Aufmerksamkeit errege, ihm helfen könnten, sich anzuziehen und zu gehen? Da sei eine dringliche Angelegenheit in Ordnung zu bringen, und nun da er Den Titel habe und wisse, was er wolle, werde alles gut ausgehen, und er werde wieder gesund. Ob wir ihn bitte hinausgehen lassen wollten, er wolle nur sprechen mit … Er nannte ihren Namen; er nannte ihren Kosenamen aus den alten Neminaka-Zeiten. Manallace stimmte energisch zu und empfahl ihm einen Schluck von seinem »Lebertonikum«, um sich nach der langen Zeit im Haus zu stärken. Er nahm den Schluck, und Manallace regte an, nach seinem Ausgang solle er doch am besten zum Landhäuschen kommen und die Korrekturen mitbringen. Dort könnten sie dann das letzte Kapitel noch einmal überarbeiten. Er reagierte auf diese Droge und auf einiges Lob für seine Arbeit, und bald lächelte er schläfrig. Ja, das Buch sei wirklich gut – obwohl er es selbst sagte, was er eigentlich nicht dürfe. Er lobte sich einige Zeit, bis er uns mit fragend gerunzelter Stirn und geschlossenen Augen erzählte, sie habe kürzlich gesagt, es sei zu gut – das Ganze, wenn wir es verstünden, sei zu gut. Er wünsche, daß wir genau verstünden, in welcher Nuanciertheit sie das gesagt habe. Sie habe diesen Zweifel angedeutet, oder besser: impliziert. Sie habe gesagt – er wolle uns unsere Schlüsse selber ziehen lassen –, der Chaucer-Fund sei »den Wünschen der Menschheit zuvorgekommen«. Johnson, natürlich. Das brauche man ihm doch nicht zu sagen. Aber was zum Teufel sie damit wohl andeuten wolle? O Gott! Sein Leben sei nie etwas anderes als eine lange Anspielung gewesen! Außerdem habe sie noch gesagt, man könne alles mit jedem anstellen, solange man ihm nur die Plage des Denkens erspare. Was sie denn damit meine? Er habe sich doch nie vor dem Denken gedrückt. Sein ganzes Leben habe er unaufhörlich gedacht. Es sei doch nicht wirklich zu gut, oder? Manallace halte es doch nicht für zu gut, oder etwa doch? Aber dieses Pick-pick-picken an Hirn und Werk eines Mannes sei doch wahrlich zu schlimm, nicht wahr? Warum sie denn immer Manallace ins Spiel bringe, der doch nur ein Freund sei – kein Gelehrter, sondern einer, dem die Sache Spaß mache – Eh? – Manallace würde das bestimmt bestätigen, wenn er nur hier wäre, statt sich in dem Moment, da er am meisten gebraucht werde, auf dem Kontinent herumzutreiben.
»Ich bin wieder da«, unterbrach Manallace ihn schwankend. »Ich kann jedes einzelne Wort bestätigen, das du gesagt hast. Daran ist nichts, worüber du dir den Kopf zerbrechen mußt. Es ist dein Fund – dein Verdienst – dein Ruhm und – und überhaupt alles.«
»Dann schwör mir, daß du ihr das sagst«, sagte Castorley. »Sie glaubt mir kein einziges Wort. Sie hat mir gesagt, sie hat mir schon seit vor unserer Hochzeit kein Wort geglaubt. Versprich es mir!«
Manallace versprach, und Castorley setzte hinzu, er habe ihn zu seinem literarischen Testamentsvollstrecker gemacht; die Einkünfte aus dem Buch sollten seiner Frau zukommen. »Alle Gewinne ohne Abzug«, keuchte er. »Riesenverkauf, wenn man es richtig anfängt. Du brauchst ja kein Geld … Graydon schießt dir doch jede Summe vor. Es wäre eine lange …«
Er hustete, und als er nach Luft schnappte, brachen seine Schmerzen durch alle Drogen, und der Aufschrei füllte den Raum. Manallace sprang auf, um Gleeag zu holen, als eine volle, hohe, affektierte Stimme, die seit einer Generation keiner mehr gehört hatte, die Laute eines Tieres im Todeskampf zu begleiten schien und sagte: »Mein Gott, wenn doch einer dieses alte Schwein da knebeln würde, damit es aufhört zu heulen! Ich kann nicht … Ich wollte euch sagen, Jungs, daß verdammt viel passieren muß, bevor Graydon mir zwei Pfund vorschießt.«
Wir flohen gemeinsam und trafen Gleeag auf dem Treppenabsatz, wo er wartete, zusammen mit Lady Castorley. Am nächsten Morgen rief er mich an und teilte mir mit, Castorley sei an einer Bronchitis gestorben, die er in seinem geschwächten Zustand nicht mehr habe überwinden können. »Ist vielleicht auch besser so«, setzte er hinzu, als Antwort auf die Beileidsbekundungen, die der Witwe zu übermitteln ich ihn bat. »Wir hätten es sonst vielleicht mit etwas zu tun bekommen, womit wir nicht fertig geworden wären.«
Die Entfernung von dem Haus machte mich kühn.
»Sie haben es die ganze Zeit gewußt, nicht wahr? Was war es denn wirklich?«
»Etwas Bösartiges in den Nieren – am Schluß hatte es sich ausgedehnt. Sinnlos, ihn damit noch zu behelligen. Wir haben versucht, es ihm so leicht wie möglich zu machen. Ja! Eine glückliche Erlösung … Was? … Oh! Einäscherung. Freitag, um elf.«
Dort und dann trafen Manallace und ich einander. Er erzählte mir, sie habe ihn gefragt, ob das Buch denn nun noch veröffentlicht werden müsse; und er habe ihr gesagt, es sei nun notwendiger als je zuvor, sowohl in ihrem als auch in Castorleys Interesse.
»Sie wird als seine Witwe bekannt werden – wenigstens eine gewisse Zeit. Habe ich ihm gegenüber eigentlich einen Meineid geleistet?«
»Nicht ausdrücklich«, erwiderte ich.
»Also, jetzt hab ich’s getan – ihr gegenüber – ausdrücklich«, sagte er und zog seine schwarzen Handschuhe hervor …
Als wie auf ein Losungswort hin der Sarg seitlich durch die geräuschlos zurückschwingenden Türflügel kroch, sah ich, daß Lady Castorleys Augen sich Gleeag zuwandten.
Gertrude’s Prayer
(Modernised from the ›Chaucer‹ of Manallace)
That which is marred at birth Time shall not mend,
Nor water out of bitter well make clean;
All evil thing returneth at the end,
Or elseway walketh in our blood unseen.
Whereby the more is sorrow in certaine –
Dayspring mishandled cometh not agen.
To-bruized be that slender, sterting spray
Out of the oake’s rind that should betide
A branch of girt and goodliness, straightway
Her spring is turned on herself, and wried
And knotted like some gall or veiney wen –
Dayspring mishandled cometh not againe.
Noontide repayeth never morning-bliss –
Sith noon to morn is incomparable;
And, so it be our dawning goth amiss,
None other after-hour serveth well.
Ah! Jesu-Moder, pitie my oe paine –
Dayspring mishandled cometh not againe!
Gertrudes Gebet
(modernisiert nach dem »Chaucer« von Manallace)
Was bei Geburt verunstaltet ist, wird die Zeit nicht heilen,
noch Wasser aus bitterer Quelle reinwaschen;
alles Üble kehrt am Ende zurück
oder wandelt ungesehen durch unser Blut.
Wodurch Kummer um so gewisser ist –
Mißbrauchter Morgen kommt nie wieder.
Wenn verletzt wird dieser schlanke junge Trieb
aus der Eichenrinde, der mit der Zeit
ein dicker gesunder Zweig werden sollte, sogleich
wendet seine Kraft sich gegen ihn selbst, verdreht
und knotig wie ein Gallapfel oder gemasertes Geschwür –
Mißbrauchter Morgen kommt nie wieder.
Der Mittag entgilt nie des Morgens Seligkeit –
da Mittag mit Morgen nicht zu vergleichen ist;
und wenn also unser Frühdämmer fehlgeht,
wird keine spätere Stunde gelingen.
Ach, Mutter Jesu, erbarm dich meiner Schmerzen –
Mißbrauchter Morgen kommt nie wieder.
Die Frau in seinem Leben
Dinah in Heaven
She did not know that she was dead,
But, when the pang was o’er,
Sat down to wait her Master’s tread
Upon the Golden Floor,
With ears full-cock and anxious eye
Impatiently resigned;
But ignorant that Paradise
Did not admit her kind.
Persons with Haloes, Harps, and Wings
Assembled and reproved;
Or talked to her of Heavenly things,
But Dinah never moved.
There was one step along the Stair
That led to Heaven’s Gate;
And, till she heard it, her affair
Was – she explained – to wait.
And she explained with flattened ear,
Bared lip and milky tooth –
Storming against Ithuriel’s Spear
That only proved her truth!
Sudden – far down the Bridge of Ghosts
That anxious spirits clomb –
She caught that step in all the hosts,
And knew that he had come.
She left them wondering what to do,
But not a doubt had she.
Swifter than her own squeal she flew
Across the Glassy Sea;
Flushing the Cherubs every where,
And skidding as she ran,
She refuged under Peter’s Chair
And waited for her man.
.....
There spoke a Spirit out of the press,
’Said: – »Have you any here
That saved a fool from drunkenness,
And a coward from his fear?
»That turned a soul from dark to day
When other help was vain;
That snatched it from wanhope and made
A cur a man again?«
»Enter and look,« said Peter then,
And set The Gate ajar.
»If I know aught of women and men
I trow she is not far.«
»Neither by virtue, speech nor art
Nor hope of grace to win;
But godless innocence of heart
That never heard of sin:
»Neither by beauty nor belief
Nor white example shown.
Something a wanton – more a thief –
But – most of all – mine own.«
»Enter and look,« said Peter then,
»And send you well to speed;
But, for all that I know of women and men
Your riddle is hard to read.«
Then flew Dinah from under the Chair,
Into his arms she flew –
And licked his face from chin to hair
And Peter passed them through!
Dinah im Himmel
Sie wußte nicht, daß sie tot war,
aber als der Schmerz endete,
setzte sie sich hin und erwartete ihres Herrn Schritt
auf dem Goldenen Boden,
mit aufgestellten Ohren und begierigen Augen,
ungeduldig ergeben;
aber sie wußte nicht, daß ihre Art
im Paradies nicht zugelassen wurde.
Personen mit Heiligenschein, Harfe und Flügeln
sammelten sich und tadelten sie
oder sprachen ihr von Himmelsdingen,
aber Dinah regte sich nicht.
Es gab da einen Schritt auf der Treppe,
die zum Himmelstor führt;
und bis sie ihn hörte, war es ihre Aufgabe –
erklärte sie –, zu warten.
Und sie erklärte es mit angelegtem Ohr,
gehobener Lefze und milchweißem Zahn –
tobte wider Ithuriels Speer,
der nur ihre Wahrheit bewies!
Plötzlich – tief unten auf der Geisterbrücke,
die bange Seelen erklommen –
fing sie unter all den Heerscharen diesen Schritt auf
und wußte, er war angekommen.
Sie ließ die anderen ratlos zurück,
doch hatte sie keinen Zweifel.
Schneller als ihre eigenen Quieklaute flog sie
über die See aus Glas,
scheuchte überall Cherubim auf
und schlitterte beim Rennen,
verbarg sich unter Petrus’ Thron
und wartete auf ihren Mann.
.....
Aus dem Gedränge sprach ein Geist,
sagte: »Habt ihr jemand hier,
der einen Narren aus der Trunkenheit rettete
und einen Feigling aus seiner Furcht?
Der eine Seele aus dem Dunkel zum Tag brachte,
als andere Hilfe vergeblich war?
Der ihn aus der Hoffnungslosigkeit riß
und eine Memme wieder zum Mann machte?«
»Tritt ein und schau«, sagte Petrus da
und öffnete halb das Himmelstor.
»Wenn ich etwas über Frauen und Männer weiß,
glaub ich, sie ist nicht weit weg.«
»Nicht durch Tugend, Rede oder Geschicklichkeit
noch Hoffnung, Gnade zu erringen,
sondern gottlose Unschuld des Herzens,
die nie von Sünde hörte;
nicht durch Schönheit oder Glaube
oder leuchtendes Beispiel.
Etwas liederlich – mehr noch Dieb,
aber – vor allem – mein eigen.«
»Tritt ein und schau«, sagte Petrus da,
»und spute dich dabei;
Doch bei allem, was ich von Frauen und Männern weiß –
Dein Rätsel ist schwer zu verstehen.«
Da schoß Dinah unter dem Thron hervor,
flog in seine Arme –
und leckte sein Gesicht vom Kinn bis zum Haar,
und Petrus ließ beide ein!
Die Frau in seinem Leben
Fairest of darkie daughters
Was Dinah Doe!
Negro Melody
Von Kindheit an hatte John Marden ein Händchen dafür, um Haus und Grund seines Vaters kleine Geräte zu improvisieren oder zu verbessern, die einem Arbeit abnahmen. Als kurz nach Beginn seiner Lehre bei einer Werkzeugfirma in den Midlands der Krieg kam, trat er folglich den Pionieren bei und fand sich schließlich an einem Ort namens Messines wieder, wo er viele Monate lang unter der Erde arbeitete, inmitten interessanter Geräte. Dort traf er einen Cockney namens Burnea, der durch Berührung – mit geschlossenen Augen – Krankheiten bei Maschinen diagnostizierte. Die beiden und ein paar andere sorgten dafür, daß der Messines-Rücken hochging.
Nach dem Krieg steckten die beiden Männer mit einem Dutzend junger Messines-Veteranen ihre Fähigkeiten und viertausend Pfund Kapital in ein paar gemietete Schuppen in einem Londoner Vorort und eine Sammlung gebrauchter Drehbänke sowie Präge- und Stanzmaschinen. Sie teilten mit, sie seien bereit, alles für jeden herzustellen.
Ein südafrikanischer Bergwerksmanager erkundigte sich nach einer abnehmbaren Vorrichtung an einem Bohrkopf, die er auf dem freien Markt nicht für weniger als vier Shilling und sieben Pence (Großhandel) kaufen konnte. Marden brütete über den Zeichnungen und reduzierte die Anzahl beweglicher Teile um die Hälfte. Burnea brachte eine verblüffte Maschine dazu, seltsame Aufgaben zu übernehmen, und als sie sie ruiniert hatten, konnten sie den Artikel für einen Shilling und zehn Pence liefern. Eine neu eröffnete Mine auf einem Bergrücken in den Anden, wo Lamas vorläufig billiger waren als Lastwagen, brauchte Klammern und Versteifungen aus Metall (Zeichnung anbei) für Packsättel. Das erste Modell wurde noch vor Ablauf eines Monats ausgehändigt. Zwei Wochen später war der Auftrag mit Verbesserungen erledigt. Ein Unternehmen, das den Orinoko ausbaggerte und Kummer mit ein paar Kähnen hatte, die goldhaltigen Schlamm nicht so behandelten, wie sie es sollten, und eine Truppe, die Probebohrungen an einem Strand von Neuguinea machte, wo die Eingeborenen Sprengkapseln mißachteten, schrieben am Ende des ersten Jahres ihren Freunden, man könne Burnea und Marden ruhig die gröbsten Skizzen seiner Wünsche schicken, weil sie sie verstünden.
Auf diese Weise gedieh die Firma. Die jungen Veteranen arbeiteten Schichten von zehn Stunden pro Tag; die vielseitigen, aber demoralisierten Maschinen wurden durch belastbarere ersetzt, und im dritten Jahr war der Profit fünfstellig. Dann starb Burnea, mit dem Kopf für Finanzen, an Lungenproblemen, Nebenprodukt einer Gasvergiftung, und hinterließ Marden seinen Anteil an der Firma plus sechsunddreißigtausend Pfund, fest angelegt bei einer Bank, weil er sich im Schützengraben mit dem Leiter einer ihrer Zweigstellen angefreundet hatte. Die Werkstätten wurden sogleich vergrößert, und Marden arbeitete vierzehn Stunden am Tag statt zwölf, und um Zeit zu sparen, hielt er sich an Burneas Gepflogenheit, Geld, das er gerade nicht brauchte, derselben Bank zu denselben bescheidenen Zinskonditionen zu überlassen. Aber um den Anschein zu wahren, stellte er einen richtigen Finanzsekretär ein, der sich arg erschüttert zeigte, als John ihm die Anlagetheorie der Firma erklärte, und einige Änderungen vorschlug, um die sich zu kümmern Marden zu beschäftigt war. Sechs Monate später fielen ihm drei große Aufträge zu, die seine kühnsten Träume von Habgier übertrafen. In dieser Zeit nahm er den Schlaf, zu dem sein Körper ihn zwang, auf einer Pritsche in Burneas altem Büro zu sich. Und ebenfalls zu dieser Zeit trat Jerry Floyd, ehemals Sergeant der Pioniere bei Messines, der pro Woche achtzehn Pfund plus unregelmäßige Zulagen bezog, lauthals in Streik.
»Was ist denn mit Ihrem Job, Jerry?« fragte John.
»Is kein Job – das is alles. Meine Maschinen erledigen alles für mich, außer streiken. Das muß ich machen«, sagte Jerry vorwurfsvoll.
»Leichter Job. Bleiben Sie dabei«, riet John ihm.
»Wobei soll ich denn bleiben? Zwei Hähne drehn un an drei Hebel fummeln? Dafür könn Se sich n Mädchen holen. Ewiges Wiederholen! Ich hab die Nase voll!«
»Nehmen Sie zehn Tage frei, Sie Trottel«, sagte John; was Jerry tat, und er wurde festgenommen, weil er mit zu hoher Geschwindigkeit auf dem Pferdemarkt von Brough durch verärgerte Zigeuner fuhr. John Marden ging wie gewöhnlich hinter seinem Büro schlafen und erlitt – ohne Vorwarnung – eine so denkwürdige Nacht, daß er im Adreßbuch den nächsten Arzt nachschlug und ihn aufsuchte. Da er nicht beredt war, wenn es nicht um die Werkstatt ging, erklärte er, er fühle sich irgendwie lustlos – schal, ausgelaugt und so weiter. Er nehme an, er habe vielleicht ein bißchen zuviel gearbeitet; aber er sagte kein Wort über das Grauen, die Schwärze, den Bedeutungsverlust aller Dinge, die Zusammenbrüche am Schluß, das Aufraffen, die erneute Durchquerung des Höllenkreises jener Nacht, und auch nicht, daß dadurch ein bestimmtes geheimes Entsetzen geweckt worden war, das er seit der Demobilisierung verdrängt hatte.
»Können Sie sich nicht ein bißchen ausruhen?« fragte der Arzt, dessen eigentliches Interesse Nierensteine waren.
»Habe ich nie versucht.«
»Haben Sie denn keine Hobbys – oder Freunde?«
»Nichts außer der Firma.«
»Nichts – nichts Wichtigeres im Leben?«
Johns Gesicht war Antwort genug. »Nein! Nein! Aber was soll ich machen? Was soll ich bloß machen?« fragte er ungestüm. »Ich – ich hab mich noch nie so gefühlt!«
»Ich gebe Ihnen was zur Beruhigung, aber Sie müssen ausspannen und sich ablenken. Ja! Das ist es. Lenken Sie sich ab.«