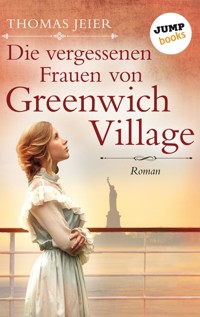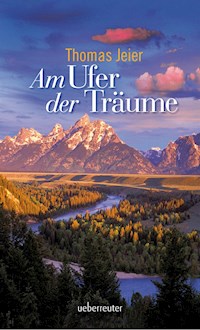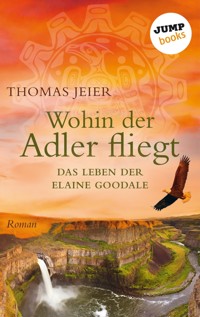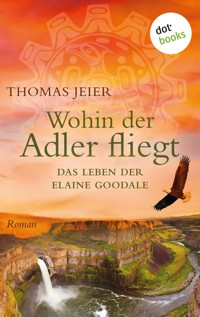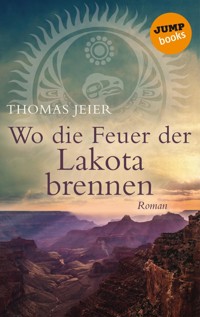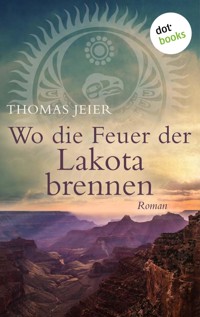Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: dotbooks VerlagHörbuch-Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Make love, not war! Zwei junge Frauen und ein Krieg, der die Welt veränderte: "Die Sterne über Vietnam" von Thomas Jeier als eBook bei dotbooks. USA, 1969: Seit ihr Bruder im Vietnam-Krieg gefallen ist, will die junge Debbie nur noch eins: dass dieser aussichtslose, brutale Krieg endlich endet! Dafür geht sie auch auf die Straße und demonstriert mit Tausenden gegen die Pläne von Präsident Johnson. Umso härter trifft sie die Nachricht, dass nun auch ihre beste Freundin Linda als Krankenschwester nach Vietnam geschickt wird. Ein Jahr ist schnell vorbei, sagen sich die beiden Frauen – doch als Linda zurückkehrt, ist nichts mehr wie zuvor … Ein bewegender Roman über die Schrecken des Krieges, Liebe, Freundschaft und das höchste Gut der Menschheit: Frieden. Jetzt als eBook kaufen und genießen: Zwischen San Francisco und Woodstock, zwischen Tet-Offensive und Saigon – "Die Sterne über Vietnam" von Erfolgsautor Thomas Jeier. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 367
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
USA, 1969: Seit ihr Bruder im Vietnam-Krieg gefallen ist, will die junge Debbie nur noch eins: dass dieser aussichtslose, brutale Krieg endlich endet! Dafür geht sie auch auf die Straße und demonstriert mit Tausenden gegen die Pläne von Präsident Johnson. Umso härter trifft sie die Nachricht, dass nun auch ihre beste Freundin Linda als Krankenschwester nach Vietnam geschickt wird. Ein Jahr ist schnell vorbei, sagen sich die beiden Frauen – doch als Linda zurückkehrt, ist nichts mehr wie zuvor …
Ein bewegender Roman über die Schrecken des Krieges, Liebe, Freundschaft und das höchste Gut der Menschheit: Frieden.
Über den Autor:
Thomas Jeier wuchs in Frankfurt am Main auf, lebt heute bei München und „on the road“ in den USA und Kanada. Seit seiner Jugend zieht es ihn nach Nordamerika, immer auf der Suche nach interessanten Begegnungen und neuen Abenteuern, die er in seinen Romanen verarbeitet. Seine über 100 Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und mehrfach ausgezeichnet.
Bei dotbooks erscheint auch:
Die Tochter des Schamanen
Biberfrau
Das Lied der Cheyenne
Weitere Titel sind in Vorbereitung.
Die Website des Autors: www.jeier.de
Der Autor im Internet: www.facebook.com/thomas.jeier
***
eBook-Neuausgabe Dezember 2017
Copyright © der Originalausgabe 2005 by Verlag Carl Ueberreuter, Wien
Copyright © der Neuausgabe 2017 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Syda Production (Frau im Kornfeld), schankz (Vogelschwarm)
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (sh)
ISBN 978-3-96148-350-1
***
Damit der Lesespaß sofort weitergeht, empfehlen wir dir gern weitere Bücher aus unserem Programm. Schick einfach eine eMail mit dem Stichwort Die Sterne über Vietnam an: [email protected]
Gerne informieren wir dich über unsere aktuellen Neuerscheinungen – melde dich einfach für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html
Besuch uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Thomas Jeier
Die Sterne über Vietnam
Roman
dotbooks.
Dedicated to Dana Shuster and all the other nurses who served in Vietnam. And to Colonel William E. Zoesch, who still suffers from the nightmares he experienced in Nam.
And it's one, two, three What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn, Next stop is Vietnam.«
Country Joe McDonald, »I-Feel-Like-I'm-Fixin'-To-Die-Rag«
»Ich habe versucht, die Vergangenheit zu verleugnen. Ich habe versucht, vor ihr davonzulaufen. Das hat nicht funktioniert. Ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll. Vielleicht schaffe ich es gar nicht.«
Dana Shuster, Army Nurse/Krankenschwester in Vietnam
Debbie
Das Rattern war so laut, dass Debbie sich die Ohren zuhielt. Die Rotorblätter des Hubschraubers zerschnitten die flimmernde Hitze und wirbelten rote Erde auf. Als er noch einen Meter über dem Boden war, schleppten zwei Soldaten einen Verwundeten heran und schoben ihn unter heiseren Zurufen durch die offene Tür. Der Pilot antwortete etwas, das im Lärm unterging. Kaum hob der Hubschrauber vom Boden ab, schlug eine Granate am Flussufer ein. Schlamm und Wasser spritzten nach allen Seiten. Der Bordschütze feuerte mit verkniffenem Gesicht aus seinem Maschinengewehr, während der Hubschrauber in einer dichten Wolke aus Rauch und Schmutz davonflog. Die beiden Soldaten auf dem Boden, die nur noch als dunkle Punkte zu sehen waren, tauchten im Gras unter. Dann brach der Film ab und die betretene Miene des Nachrichtensprechers erschien auf dem Bildschirm. »Heute erscheint es mir sicherer denn je zuvor«, sagte Walter Cronkite in seinem Kommentar, »dass unser blutiger Einsatz in Vietnam in einer Sackgasse enden muss ...«
Debbie griff nach ihrem Pappbecher und schleuderte ihn gegen den Fernseher. Cola spritzte nach allen Seiten. »Hast du das auch schon gemerkt? Sag das Präsident Johnson, der hätte unsere Soldaten schon vor drei Jahren zurückholen sollen!« Sie ging zum Fernseher und zog wütend das Kabel aus der Steckdose. »Ich kann diese Bilder nicht mehr sehen! Reicht es denn nicht, dass sie meinen Bruder auf dem Gewissen haben? Er ist in diesem verdammten Land gestorben, für nichts und wieder nichts ...«
»Johnny war ein tapferer Mann«, erwiderte Linda leise.
»Er war ein Idiot!«, tobte Debbie. »Er ist auf das Gesülze dieser blödsinnigen Armee reingefallen und für eine Sache draufgegangen, die sowieso keinen interessiert! Hätte er auf mich gehört, wäre er nach Kanada abgehauen. Dann wäre er noch am Leben!«
»Beruhige dich, Debbie!«
»Ich will mich aber nicht beruhigen!« Debbie packte ihre Freundin an den Schultern und schüttelte sie heftig. »So wie mein Bruder sterben Tausende junge Männer! Und wofür? Weil man ihnen weismacht, dass die Kommunisten ganz Asien überrennen und nach Kalifornien einmarschieren wollen! Sie sterben für eine Lüge! Für die Politiker, die unbedingt die Größten sein wollen, und für die Konzerne, die mit dem Krieg ihre Dollar verdienen! Selbst in den Nachrichten sagen sie schon, dass der Krieg verloren ist! Hast du gehört? Wir stecken in einer Sackgasse! Wir sitzen fest! Und die Politiker hetzen unsere Jungs in den Dschungel und machen sie zu grausamen Mördern! Unsere Soldaten töten unschuldige Zivilisten, Linda, Bauern, die keine Ahnung haben, warum dieser Scheißkrieg stattfindet! Wir müssen raus aus Vietnam, besser heute als morgen!«
Linda berührte ihre Freundin an der Schulter. Seit Debbie ihren Bruder verloren hatte, bekam sie öfter solche Wutanfälle. »Ich versteh dich ja, Debbie. Es tut bestimmt weh, wenn man seinen Bruder verliert. Meine Eltern und ich, wir haben auch geweint, als deine Mutter anrief. Aber so schlecht, wie du unsere Jungs machst, sind sie nicht! Die töten keine Unschuldigen! Die wollen doch nur verhindern, dass die Vietcong nach Süden vordringen und ganz Vietnam kommunistisch wird! Mein Dad war im Zweiten Weltkrieg, da waren sie auch nicht gerade zimperlich, aber er kämpfte für den Frieden in Amerika ...«
»Du bist naiv!«, fuhr Debbie sie an. »Das war doch was anderes damals, da ging es gegen diesen Hitler und die Japaner, die uns in Pearl Harbor angegriffen hatten! Da stand die Freiheit der ganzen Welt auf dem Spiel! Aber was hat das mit Vietnam zu tun? Seit über zehn Jahren treiben sich unsere Soldaten da drüben rum, seit neunzehnsechsundfünfzig. Und warum? Niemand hat uns gebeten, da einzugreifen! Wir haben in Vietnam nichts zu suchen, Linda! Und das Schicksal der freien Welt war vielleicht in Kuba bedroht, vor ein paar Jahren, als die Russen ihre Atomraketen abfeuern wollten und Kennedy ihnen das Ultimatum stellte, aber Vietnam ... das interessiert doch niemanden! Die meisten Soldaten wissen nicht mal, wo das liegt!«
Debbie beobachtete missmutig, wie Linda den Pappbecher aufhob und in den Papierkorb warf. Manchmal ging ihr die Freundin mit ihrem erwachsenen Getue auf die Nerven. Linda war einundzwanzig, drei Jahre älter als sie, und gerade dabei, ihre Ausbildung als Krankenschwester abzuschließen. Mit ihren halblangen dunkelblonden Haaren und in dem braunen Rock und der karierten Bluse sah sie ziemlich bieder aus und ihre fürsorgliche Art war auch nicht jedermanns Sache, aber so musste man als Krankenschwester wohl sein.
Sie mochte Linda, obwohl sie nicht immer dieselben Ansichten hatten. Linda war stets guter Laune, und wenn man sie näher kannte, stellte man fest, dass sie gar nicht so bürgerlich war. Okay, sie stand auf die Beach Boys, aber sie trank Bier und kannte schmutzige Witze und sie hatte die Karten für das Jefferson-Airplane-Konzert in Cleveland besorgt. Am Nachmittag hatten sie in einem billigen Motel eingecheckt, zwei Blocks von dem Club entfernt, in dem die Band auftreten würde.
Debbie hatte ihre Freundin auf einem Rockfestival in Kent kennen gelernt. Die Beach Boys waren nach einer Psychedelic Band aus der Umgebung aufgetreten und Linda hatte ihr vor lauter Begeisterung die Schirmmütze vom Kopf gefegt. Linda war auf allen vieren durch die Menge gekrochen, um die Mütze wiederzufinden, und sie hatten beide so gelacht, als hätten sie gerade Marihuana geraucht. Bei ihr stimmte das sogar, sie zog gern mal an einem Joint, während Linda nicht mal ein Bier brauchte, um in Stimmung zu kommen. Und weil sie beide in Ravenna wohnten, hatten sie sich für den nächsten Abend in Charlie's Pool Hall verabredet. Seitdem waren sie unzertrennlich, obwohl Linda in Cleveland auf die Medical School ging und nur an den Wochenenden zu Hause war. Debbie hatte manchmal das Gefühl, dass sie sich schon Jahre kannten. »Ich hab Hunger«, sagte sie. »Gehen wir vor dem Konzert bei McDonald's vorbei? Ich lade dich auf einen Burger ein!«
Sie vergaßen den Krieg und gingen zu McDonald's in der nächsten Querstraße. Vom Lake Erie wehte ein kühler Wind herauf. Sie waren an das wechselhafte Wetter in Ohio gewöhnt und hatten beide ihre Anoraks dabei. Sie bestellten Cheeseburger, Pommes frites und Cola und setzten sich ans Fenster. Vor dem Lokal standen zwei Hippies, ein älterer Typ in einer ledernen Fransenjacke und mit schulterlangen Haaren und ein junges Mädchen in bestickten Jeans und ärmelloser Jacke. Ihre dunklen Haare waren zu Zöpfen gebunden, was sie wie eine Indianerin aussehen ließ.
»Die gehen bestimmt auch aufs Konzert«, sagte Debbie mit vollem Mund, »sonst wären sie sicher nicht nach Cleveland gekommen. Oder hast du schon mal einen Hippie in Ohio gesehen?«
»Einmal«, antwortete Linda kauend. »Auf einem Truckstopp, als ich mit meinen Eltern beim Tanken war. Aber die waren auf der Durchreise. Du hättest meinen Vater hören sollen, als die Typen auftauchten! Komm mir bloß nicht mit so einem Gammler nach Hause, hat er gesagt!«
»Hippies sind keine Gammler«, erwiderte Debbie. »Die denken nur anders und ziehen sich anders an. Auf jeden Fall sind sie mir tausendmal lieber als die Marines mit ihren geschorenen Nacken! Hippies sind für den Frieden! Mit 'ner Knarre und den Stars and Stripes hab ich noch keinen Hippie rumlaufen sehen!«
»Mein Vater sagt, sie sind Gammler. Und sie wären unpatriotisch, weil sie nichts arbeiten und die Flagge verbrennen. Er würde mir eine runterhauen, wenn ich so einen nach Hause brächte!«
Debbie biss verächtlich in ihren Cheeseburger. »Mein Alter hat nur Football im Kopf. Bei dem dreht sich alles um die Cleveland Browns. Und meine Mutter macht alles, was er sagt. Manchmal glaube ich, sie hat ihn nur geheiratet, um aus ihrem verdammten Kaff in Alabama rauszukommen! Und ich, ich war wahrscheinlich nur ein Betriebsunfall! Seit mein Bruder tot ist, reden sie sowieso kaum noch mit mir. Als wär ich schuld daran, dass er gefallen ist!« Sie trank einen Schluck Cola und deutete auf die restlichen Pommes frites. »Wenn du satt bist, ess ich die, okay?«
Linda nickte und Debbie stopfte die Pommes frites gierig in sich hinein. Sie konnte alles essen ohne zuzunehmen. Sie war größer und schlanker als ihre Freundin und kam auch besser bei den Männern an. Wenn sie zusammen in eine Disko gingen, standen die Jungen bei ihr Schlange, und wenn sie auf der Tanzfläche ausflippte, klatschten sie begeistert. Linda wirkte erst, wenn man länger mit ihr sprach. Nicht jeder wusste ihren versteckten Humor zu schätzen und nur Ältere mochten ihre mütterliche Art. Debbie wirkte lässiger, auch was ihre Kleidung betraf. Sie trug meist zerfranste Jeans und gemusterte Männerhemden und darüber ärmellose Westen und ohne ihre braune Schirmmütze ging sie selten aus dem Haus. Die gehörte einfach dazu, so wie ihre kurzen schwarzen Haare, obwohl sie in letzter Zeit öfter ankündigte, sich die Haare so lang wie Joan Baez wachsen zu lassen.
Die Protestsängerin gehörte zu ihren absoluten Favoriten, immerhin war ihr We Shall Overcome zu so etwas wie eine Nationalhymne der Kriegsgegner geworden. Und Debbie war schon auf etlichen Demonstrationen gewesen, sehr zum Leidwesen ihres Vaters, der bei den städtischen Wasserwerken arbeitete und den guten Ruf der Familie gefährdet sah. »Die halbe Stadt ist gegen den Krieg«, antwortete sie ihm, »und wenn das so weitergeht in Vietnam, ist bald das ganze Land dagegen!« Debbie ging auf eine Schule, an der viel protestiert wurde, wollte unbedingt einen Hochschulabschluss haben, bevor sie zu arbeiten anfing. Was die Ausbildung anging, war sie konservativ. »Ich will mal was Besseres als meine Eltern werden«, sagte sie, wenn ihr Vater nicht in der Nähe war.
Vor dem McDonald's hielt ein Chevy Nova und ein Soldat in Ausgehuniform betrat das Lokal. Sofort verstummten die Gespräche. Die Abzeichen an seiner Brust verrieten den meisten Gästen, dass er in Vietnam gewesen war. Selbst die junge Frau, die ihn bediente, blickte ihn wie einen Besucher von einem anderen Planeten an. »Zwei Hamburger und Pommes frites zum Mitnehmen«, bestellte er.
Debbie sprang auf und rief: »Ich wollte, deine Kameraden kämen auch nach Hause!« Linda versuchte sie auf ihren Stuhl zurückzuziehen, aber Debbie blieb stehen und blickte den Soldaten vorwurfsvoll an. Der war einen Augenblick verunsichert und verließ dann rasch das Lokal. Er schlug einen Bogen um die beiden Hippies und sprang in den Wagen. Der Chevy brauste davon.
»Er kann doch nichts dafür«, schimpfte Linda, als Debbie sich wieder setzte. »Dein Bruder hat dieselbe Uniform getragen, hast du das vergessen? Wenn einer schuld ist, dann nur die Politiker!«
»Und warum trägt er dann seine verdammten Orden spazieren? Ich hab von Soldaten gehört, die ihre Orden auf den Müll geworfen haben, weil sie nichts mehr mit dieser Armee zu tun haben wollen! Du solltest dir mal anhören, was manche dieser Jungs erzählen! Da wird dir schlecht! Die werfen gefangene Vietcong aus fliegenden Hubschraubern! Und das ist keine verdammte Propaganda! Das hat mir ein Soldat selbst erzählt!«
Linda ließ die furchtbaren Gedanken nicht an sich heran. »Lass uns von was anderem reden, Debbie! Unsere Welt besteht doch nicht nur aus Krieg! Wenn ich ständig an die Patienten denken würde, die uns unter den Händen wegsterben, würde ich verrückt!«
»Krankenschwestern!«, lästerte Debbie.
Sie verließen das Lokal und wurden von den Hippies aufgehalten. »Habt ihr mal 'nen Dollar?«, fragte das Mädchen leise. Sie trug eine bunte Perlenkette mit dem Friedenszeichen aus Messing. »Wir haben unser ganzes Geld für Airplane-Karten ausgegeben!«
Debbie kramte einen Dollar aus ihrer Anoraktasche und gab ihn dem Mädchen. Sie wartete, bis Linda es ihr nachmachte. »Wir gehen auch hin«, sagte Debbie. »Kommt ihr aus San Francisco?«
»Detroit«, antwortete das Hippiemädchen lächelnd. Sie ließ die Dollar in einer Tasche verschwinden. »Wir waren nie in Frisco. Aber Timmy erbt etwas Geld von seiner Tante, dann fahren wir hin!«
»Peace«, sagte Timmy.
Debbie konnte wenig mit Hippies anfangen. Sie bewunderte ihren Mut, ein Leben außerhalb der Gesellschaft zu führen, und sie war mit ihnen einer Meinung, was den Krieg in Vietnam betraf, aber sie hätte sich niemals vorstellen können, so wie sie zu leben. Hippies waren ihr zu passiv. Fröhliche Lieder zu singen und sich Blumen ins Haar zu stecken war ihr zu wenig. Wenn ihr etwas nicht passte, haute sie auf den Tisch. Sie sagte überall ihre Meinung, auch wenn ihr das einen Nachteil einbrachte, und ging immer frontal auf die Probleme los. Mehr als einmal hatte sie ihren Eltern vorgeworfen, »das Leben von den Zuschauerrängen aus zu verfolgen«.
Sie gingen zum Motel zurück und machten sich für den Abend zurecht. »Man weiß nie, wen man auf so einem Konzert trifft«, meinte Debbie lachend. Sie hatte sich vor einigen Wochen von ihrem Freund getrennt und war längst bereit für ein neues Date. Aber sie wollte keinen dieser angepassten College-Bubis, die Simon and Garfunkel und die Beatles hörten und sich Filme mit Jane Fonda ansahen. Noch weniger hatte sie mit den Superpatrioten am Hut, die in Pick-ups durch die Gegend fuhren und von Football und Baseball redeten.
»Mr Right lauert überall«, sagte Linda.
Debbie blickte in den Spiegel und grinste zufrieden. Sie hatte sich einen neuen Lippenstift gekauft, der genau zu ihrem Typ passte und sie noch frecher und verführerischer aussehen ließ. »Also, wenn ich ein Junge wäre, würde ich auf mich fliegen!«, prahlte sie. Linda wirkte in ihren Blue Jeans und der grellbunten Bluse, die sie für solche Gelegenheiten reserviert hatte, wesentlich jünger als in Rock und karierter Bluse, und wenn ihre blauen Augen so leuchteten wie jetzt, konnte sie jeden Mann rumkriegen ... oder zumindest jeden zweiten. And you need somebody to love ..., sang Debbie.
Der Club, in dem das Konzert stattfand, ähnelte einer großen Turnhalle. Nur die flackernden Spotlights und die aufgespannten Leinwände mit den verschmelzenden Farbklecksen sorgten für etwas Atmosphäre. Die Bühne war in blaues Licht getaucht. Debbie und Linda arbeiteten sich bis in die erste Reihe vor und blieben vor der Absperrung stehen, die vor der Bühne einen breiten Gang freiließ. Debbie tanzte ausgelassen zu der dröhnenden Musik.
»He«, sagte sie zu dem Jungen, der neben ihr tanzte.
»He«, erwiderte er. »Ich bin Paul. Und du?«
»Debbie«, antwortete sie.
Paul war nicht gerade ihr Traummann. Etwas zu klein und an den Hüften zu mollig, und die brave Frisur mit dem sauberen Seitenscheitel erinnerte sie an den Typ, der in einer diesen albernen Comedy-Shows im Fernsehen immer für die Lacher sorgte. Aber in seinen Augen war irgendwas, das ihr gefiel. Und dass er tanzen konnte, wusste er wohl selbst, sonst hätte er sich nicht so in Szene gesetzt. »Magst du Airplane?«, fragte sie in den Lärm.
»Grace Slick ist die Größte«, rief er zurück.
Sie wechselte einen raschen Blick mit Linda, die spöttisch die Augen verdrehte und lachte. Die Musik verklang und sie wandte sich wieder dem Jungen zu.
»Bist du von hier?«, fragte Paul.
»Ravenna«, sagte sie.
»Streetsboro.«
Aus den Boxen dröhnten schrille Gitarren und sie musste beinahe schreien. »Das sind nur ein paar Meilen den Highway hoch.«
»Am nächsten Wochenende ist Rodeo. Wollen wir hingehen?«
Sie hasste Rodeos. »Na klar. Ruf mich an.« Sie ließ sich einen Stift geben und schrieb ihre Nummer auf seinen Arm. Ohne weiter auf ihn zu achten fing sie wieder an zu tanzen und landete neben Linda. »Kein Spruch, okay? Ich weiß selbst, dass er keine Schönheit ist.«
»Warum gibst du ihm dann deine Nummer?«
»Frag mich was Leichteres«, antwortete sie.
Die Musik verstummte und in der Halle verloschen die Lichter. Ein erwartungsvolles Raunen ging durch die Menge. Dann flammten die Scheinwerfer auf und tauchten die Bühne in grelles Licht. »Ladies and Gentlemen«, erklang eine unsichtbare Stimme, »endlich sind sie bei uns in Cleveland! Die Sensation aus San Francisco! Hier sind sie ... die RCA Recording Stars Jefferson Airplane!«
Unter dem begeisterten Johlen der Fans kamen die Musiker auf die Bühne. Sie stimmten die Takte eines Instrumentals an – und dann erschien Grace Slick wie eine Göttin; sie trug ein bodenlanges Samtkleid, die schwarzen Haare umrahmten ihr klassisches Gesicht, die strahlend blauen Augen waren auf das Publikum gerichtet. Scheinbar ungerührt von dem frenetischen Empfang griff sie nach dem Mikrofon und schon diese sparsame Bewegung ließ die Leute aufschreien. Als die ersten hämmernden Takte von Somebody to Love erklangen, war die Menge kaum noch zu halten. And you want somebody to love, oh, you need somebody to love ...
White Rabbit, ihren zweiten Superhit, sang sie erst gegen Ende des Konzerts. »Diesen Song widme ich den Jungs, die in den sinnlosen Krieg nach Vietnam ziehen müssen«, rief sie. Einige Leute weinten, als sie sang: Feed your head! Feed your head!
Linda
»Ich gehe nach Vietnam«, sagte Linda. Sie saß mit ihren Eltern beim Mittagessen, ungefähr zwei Wochen nachdem sie die Prüfung an der Schwesternschule bestanden hatte, und an einem ihrer wenigen dienstfreien Wochenenden. »Gestern war ein Offizier in unserem Krankenhaus und ich habe mich zur Armee gemeldet. In zwei Wochen werde ich vereidigt und im Januar muss ich nach Fort Sam Houston in Texas zur Grundausbildung.«
Ihre Eltern brauchten ein bisschen, um die Nachricht zu verarbeiten. Angespannte Stille machte sich breit, als hätte jemand die Zeit angehalten. Linda wartete nervös auf eine Antwort. Während der ganzen Rückfahrt hatte sie darüber nachgedacht, wie ihre Eltern wohl reagieren würden, nur wenige Wochen nachdem der Bruder ihrer besten Freundin gefallen war. Sie war das einzige Kind, und obwohl ihr Vater den Krieg verteidigte, hatte er bestimmt nicht damit gerechnet, dass sich seine Tochter zur Armee meldete. Junge Frauen zogen nicht in den Krieg, nicht in Amerika.
Doch Rick Corman lächelte. Als junger Mann hatte er sich selbst zur Armee gemeldet, nur einen Tag nach der Bombardierung von Pearl Harbor, und er war immer stolz darauf gewesen, für sein Land in den Krieg gezogen zu sein. Nicht einmal seine Frau wusste, dass er sich während der Grundausbildung verletzt hatte und in einer Schreibstube auf einem Stützpunkt in Alabama gelandet war, mehrere tausend Meilen von Europa und der Front entfernt. »Ich bin stolz auf dich«, sagte er, »das ist sehr mutig von dir!«
»Vietnam? Du gehst nach Vietnam?«, erwiderte Martha Corman ängstlich. Die Möglichkeit, dass ihre Tochter in den Krieg ziehen könnte, hatte sie nie in Erwägung gezogen. »Und wenn dir was passiert? Du bist unser einziges Kind! Warum hast du das getan?«
Linda legte ihre Gabel auf den Teller. »Ich will helfen, Mom! Die Armee braucht jede Krankenschwester, die sie kriegen kann! Ich hab eine gute Ausbildung. Soll ich in einem Krankenhaus in Cleveland arbeiten und alten Männern die Bettpfannen leeren, wenn unsere Jungs in Vietnam dringend Hilfe benötigen?«
»Aber es gibt Ärzte und Pfleger!«, widersprach ihre Mutter verzweifelt. Vor lauter Aufregung hatte sie zu essen aufgehört. »Krieg ist was für Männer! Frauen haben in Vietnam nichts zu suchen!«
»Und wer kümmert sich um die Männer, wenn sie verwundet sind oder im Sterben liegen? Das können nur Frauen.« Sie berührte den Arm ihrer besorgten Mutter und lächelte zuversichtlich. »Außerdem schicken sie uns in sichere Gegenden. Wo wir arbeiten, wird nicht geschossen. In Vietnam ist noch keine einzige Krankenschwester ums Leben gekommen! Mach dir keine Sorgen, Mom!«
»Irgendjemand muss die Arbeit tun«, sagte ihr Vater. Er hatte ihre Unterhaltung schweigend verfolgt, als hätte er die Worte gar nicht zur Kenntnis genommen. »Von den Schwestern, die mit uns im Zweiten Weltkrieg waren, sind sogar einige mit Orden ausgezeichnet worden! Ich weiß, mit welcher Hochachtung die Männer von ihnen gesprochen haben.« Seine Augen waren feucht. »Ich bin stolz auf dich, mein Schatz!«, sagte er wieder.
So hatte er sie seit vielen Jahren nicht mehr genannt. Linda nahm an, dass ihn ihre Nachricht an die eigenen Kriegsjahre erinnerte. Er sprach selten über den Krieg, und weder ihre Mutter noch sie hatten ihn jemals gedrängt über die schrecklichen Erlebnisse zu berichten. So verzweifelt, wie er aussah, wenn die Rede auf den Zweiten Weltkrieg kam, musste der Krieg tiefe Wunden in ihm gerissen haben. Sie konnten nicht wissen, dass er niemals in Europa gewesen war und die Wunden eher von seinem schlechten Gewissen rührten, niemals an der Front gewesen zu sein. Er hatte sich nichts vorzuwerfen. Der Beinbruch war so kompliziert gewesen, dass er wochenlang im Hospital gelegen hatte und während der heißen Phase des Krieges gezwungen war im Innendienst zu bleiben. Seiner Frau, der er drei Jahre nach Kriegsende begegnet war, und seinen Verwandten und Bekannten hatte er vorgelogen, sich das Bein während der Invasion gebrochen zu haben. Eine Lüge, die er längst bereute, aber jetzt war es zu spät, die Wahrheit zu sagen. Vielleicht gelang es seiner Tochter, die Familienehre zu retten. »Wann soll es denn losgehen?«, fragte er.
»Im Frühjahr«, antwortete Linda. »Im Januar und Februar muss ich zur Grundausbildung und dann geht es gleich nach Vietnam!«
»Wirst du als Lieutenant eingestellt?«
»Second Lieutenant.« Sie war froh, dass ihr Vater auf diese eher belanglosen Fragen ausgewichen war. Er wollte wohl ihre Mutter ablenken, die regelrecht verstört schien, seit Linda mit der Neuigkeit herausgeplatzt war. Ich hätte daran denken sollen, dass Mom sich alles viel zu sehr zu Herzen nimmt, dachte sie. »Wenn ich Glück habe, komme ich als First Lieutenant oder Captain zurück!«
»Wir werden für dich beten!« Ihre Mutter nahm einen Schluck von dem Leitungswasser, das sie zu jedem Essen trank, und wischte sich den Mund mit der Serviette ab. »Gott darf nicht zulassen, dass unserer einzigen Tochter etwas passiert!« Sie bekreuzigte sich und murmelte ein leises »Gelobt sei Jesus Christus!«. Martha Corman war eine sehr religiöse Frau, hatte eine Klosterschule besucht und sogar daran gedacht, einem Orden beizutreten. Nur die hohen Kosten hatten sie und ihren Mann davon abgehalten, auch ihre Tochter auf eine katholische Schule zu schicken. Linda war froh darüber. Obwohl sie alle Gebete mitsprach, konnte sie mit dem katholischen Glauben wenig anfangen. Doch sie respektierte ihre Mutter, die nach den Gesetzen der Kirche lebte und sogar den Krieg in Vietnam damit rechtfertigte: »Gott will verhindern, dass die Chinesen nach Vietnam einmarschieren, deshalb verlangt er diese großen Opfer von uns!«
»Gott wird mir beistehen«, sagte Linda. »Aber ich muss gehen! Der Gedanke, einer unserer Männer könnte leiden, weil ich mich vor der Verantwortung drücke, wäre mir unerträglich!« Sie blickte ihre Mutter an. »Du verstehst mich doch, Mom? Es ist meine Pflicht! Hast du nicht selbst gesagt, wir müssen Opfer bringen?«
»Ich weiß, mein Kind! Es ist nur ... ich möchte dich nicht verlieren!« Sie wechselte einen Blick mit ihrem Mann. »Ich bin auch ... ich bin auch stolz auf dich, aber ... pass gut auf dich auf, hörst du?«
Linda versprach es und war erleichtert, als das Mittagessen vorüber war und sie aufstehen und das Geschirr in die Küche tragen durfte. »Ich mach das schon, Mom!«, sagte sie und hoffte, dass ihre Mutter sitzen blieb und sie den Abwasch ohne sie machen konnte. Sie wollte mit ihren Gedanken allein sein. Natürlich erschien ihre Mutter doch, aber sie ging nicht mehr auf Vietnam ein und erzählte stattdessen von dem neuen Choral, den sie mit dem Kirchenchor einstudiert hatte. Sie gehörte zu den aktiven Mitgliedern der St. Mary's Church und hatte noch keine Probe ihres geliebten Chors versäumt. »Du hättest Karriere als Sängerin machen können«, glaubte Linda, »dann wärst du im Fernsehen aufgetreten wie Connie Francis!« Martha Corman liebte Connie Francis, hielt die moderne Rockmusik für »Geschrei«.
Zu dem »Geschrei« gehörten auch die Beach Boys, obwohl ihre Musik im Vergleich zu Jefferson Airplane oder den Rolling Stones schon beinahe bieder klang. Linda stellte ihren Plattenspieler auf halbe Lautstärke, als sie nach dem Abwasch in ihrem Zimmer verschwand und sich die neue LP anhörte. »And then I kissed her«, sang die Band. Linda schloss die Augen und ließ sich von den vielstimmigen Harmonien davontragen, versuchte nicht daran zu denken, wie wohl ihre Freundin reagieren würde, wenn sie ihr erzählte, dass sie nach Vietnam ging. Seit dem Jefferson-Air-plane-Konzert hatten sie sich nicht mehr gesehen. Ein paarmal telefonierten sie miteinander, auch nachdem Linda sich zur Armee gemeldet hatte, aber sie besaß nicht den Mut, ihr die Wahrheit zu sagen.
Und Debbie war viel zu verliebt, um die falschen Zwischentöne in ihrer Stimme zu erkennen. »Paul ist ein heißer Typ«, schwärmte sie. »Stell dir vor, er kennt alle Texte von Jefferson Airplane auswendig und vor ein paar Monaten war er in San Francisco auf einem Grateful-Dead-Konzert. Eigentlich wollten ihn seine Eltern nach Disneyland mitnehmen, aber er konnte sich abseilen. Grateful Dead! Mann, ich würde sonst was dafür geben, die mal zu sehen!« Stattdessen war sie mit Paul auf dem Rodeo in Streetsboro gewesen und hatte einen Country-und-Western-Sänger zugehört. »Die reinste Plage, der Typ! Als er die Nationalhymne sang, fing ich an zu pfeifen und wir mussten Hals über Kopf verschwinden, sonst hätte uns einer dieser patriotischen Stiernacken den Schädel eingeschlagen! Aber Paul hatte mich sowieso nur zum Rodeo eingeladen, weil ihm in der Eile nichts anderes einfiel. Er ist ganz anders, als er aussieht, und hat sogar eine Vereinigung gegründet, die gegen den Krieg protestiert: ›College Students For A Better Future‹. Er will Schriftsteller werden! So was wie Jack Kerouac.«
Linda war kaum zu Wort gekommen, und wenn sie ehrlich war, nervte sie die Schwärmerei ihrer Freundin auch. Vielleicht lag es daran, dass sie keinen Freund hatte und schon lange nicht mehr mit einem jungen Mann ausgegangen war. Sie war kein Fotomodell, aber sie war auch kein Mauerblümchen, und wenn sie ihr schickes Kostüm anzog, fielen ihre überflüssigen Pfunde kaum auf. Mehrmals hatte sie ein junger Arzt um ein Date gebeten, doch leider war er verheiratet, und der Pfleger mit den blonden Locken, der sie seit ein paar Wochen bedrängte, hatte so starken Mundgeruch, dass ihr regelmäßig schlecht wurde, wenn er in der Nähe war. Seit sie bei der Armee unterschrieben hatte, dachte sie sowieso nicht mehr daran, sich fester an einen jungen Mann zu binden. »Ich habe noch viel Zeit«, sagte sie zu ihrer Mutter, wenn die auf das Thema zu sprechen kam und sie die leidigen Worte zu hören bekam: »Wann heiratest du endlich und bekommst Kinder? Du weißt doch, wie sehr ich mir Enkelkinder wünsche!«
Die Beach Boys sangen California Girls und sie stellte den Plattenspieler lauter. »Linda! Nicht so laut!«, rief ihre Mutter aus dem Nachbarzimmer. »Man versteht ja sein eigenes Wort nicht mehr!« Wahrscheinlich saß sie neben ihrem Vater vor dem neuen Farbfernseher und schaute ihm dabei zu, wie er sein Footballteam anfeuerte. Bis zum ersten Touchdown saß sie neben ihm, das war so eine Art Ritual, das die beiden im Laufe der Jahre entwickelt hatten. Dann ging Martha Cor-man in die Küche und backte einen Kuchen. Sie backte jedes Wochenende einen Kuchen oder wenigstens Muffins oder Doughnuts. Dabei telefonierte sie mit einer Freundin aus dem Kirchenchor oder von der Nachbarschaftshilfe.
Erschrocken stellte Linda fest, dass es schon nach vier Uhr war. Debbie und Paul hatten darauf bestanden, sie zum Konzert einer Amateurband aus Kent mitzunehmen, die am frühen Abend in der Community Hall spielte. Danach wollten sie in Charlie's Pool Hall einen Cheeseburger essen und eine Runde Billard spielen. Linda hatte große Angst vor dem Treffen. Nicht wegen Paul. Es störte sie nicht, das dritte Rad am Wagen zu sein, das war sie schon gewohnt. Debbie ging alle paar Wochen mit einem anderen Jungen aus. Sie selbst war eher vorsichtig, verabredete sich nur mit einem jungen Mann, wenn sie es wirklich ernst meinte. Zum Glück wusste sie nicht, dass manche Ärzte und Pfleger im Krankenhaus sie »Eiserne Jungfrau« nannten. Ein Ausdruck, der ihrer Mutter sicher gefallen hätte. Martha Corman hielt nichts vom lockeren Lebensstil der jungen Generation, ihr war schon die Freundschaft ihrer Tochter mit dieser Debbie ein Dorn im Auge. »Du solltest dich wirklich fragen, ob dieses Mädchen der richtige Umgang für dich ist«, sagte sie. »Man weiß doch, was auf diesen Rockkonzerten passiert!« Und Linda antwortete: »Debbie ist okay, Mom! Sie ist etwas lockerer, das ist alles! Und bei den Rockkonzerten passiert gar nichts!«
Das war natürlich gelogen. Auf den Konzerten wurde kräftig geraucht, Marihuana und Hasch, und manche nahmen sogar LSD. »Was meinst du, was Grace Slick nimmt, bevor sie auf die Bühne geht?«, hatte jemand auf dem letzten Konzert zu ihr gesagt. »Die schluckt 'ne ganze Apotheke!« Auch Linda hatte auf einem solchen Konzert ihren ersten Joint probiert, vor zwei Jahren, bei irgendeiner Band, die es nicht mehr gab. Seitdem hatte sie kein Rauschgift mehr angerührt, das Zeug schmeckte ihr einfach nicht. Sie hielt sich an Budweiser oder Coors, und das auch nur, weil sie sich dann so herrlich verrucht vorkam. Im Krankenhaus und in ihrem kleinen Zimmer trank sie Kaffee, Wasser und Orangensaft.
Sie ging ins Bad, zog sich aus und stellte sich unter die Dusche. Das heiße Wasser prickelte auf ihrer hellen Haut. Sie seifte ihren Körper ein und wusch ihre Haare und blieb viel zu lange unter dem Wasserstrahl, als könnte er das beklemmende Gefühl vertreiben, das sie vor ihrem Treffen mit Debbie quälte. Wie erklärte man einer erbitterten Kriegsgegnerin, dass man sich freiwillig zur Armee gemeldet hatte? Sie trocknete sich ab und zog sich an, die hellen Jeans und den leichten Pullover mit den blauen Streifen und die bequemen Schuhe. Sie schminkte sich nur wenig und sparte auch beim Lippenstift, verbrachte die meiste Zeit damit, ihre Haare zu trocknen und durchzukämmen. »Bleib nicht so lange!«, sagte ihre Mutter, als es klingelte und sie zur Tür ging. Sie konnte sich immer noch nicht daran gewöhnen, dass sie erwachsen war.
»He, Linda!«, begrüßte Debbie sie fröhlich. Ihre Freundin war sichtlich aufgeblüht, seitdem sie Paul kennen gelernt hatte, und trug einen neuen Minirock, der zwei Handbreit über ihren Knien endete und sie noch jünger aussehen ließ. Sie beugte sich nach vorn und flüsterte ihr verschwörerisch zu: »Wir haben einen heißen Typ für dich dabei, einen Freund von Paul! Er gefällt dir bestimmt!«
Linda funkelte sie böse an. »Wer hat was von einem Typ gesagt? Ich hab keine Lust, mich den ganzen Abend mit einem Jungen rumzuärgern, den ich nicht kenne! Schick ihn nach Hause!«
»Nun stell dich nicht so an!«, zischte Debbie ihr ins Ohr. »Ich hab ja nicht gesagt, dass du gleich was mit ihm anfangen sollst! Greg ist ein netter Kerl! Er ist ein paar Jahre älter als du ... er ist Arzt, stell dir vor!«
»Der hat mir gerade noch gefehlt!«
»Nun sei keine Spielverderberin! Der Typ frisst dich nicht auf! Es ist nur ... na ja, damit du nicht so allein rumsitzt, wenn wir zu Charlie's gehen! Nun komm ... und mach bloß keine Szene, hörst du?«
Linda folgte ihrer Freundin widerwillig zu dem rostigen Buick am Straßenrand. Sie begrüßte Paul durch das offene Seitenfenster und stieg ein. Im Autoradio sangen die Rascals Young Love.
»Hi«, sagte der junge Mann auf dem Rücksitz. »Greg Flynn.« Er sah besser aus, als Linda vermutet hatte, groß, schlank und dichtes blondes Haar wie Dennis Wilson von den Beach Boys. Sein Lächeln gefiel ihr und seine Stimme auch. Er deutete nach vorn. »Die beiden meinten, ich müsste dich unbedingt kennen lernen!«
»Linda Corman«, erwiderte sie. Der junge Mann war ihr sympathisch, doch sie weigerte sich freundlich zu ihm zu sein. »Ich hatte keine Ahnung, dass du mitkommst! Wenn ich ehrlich bin ... ich halte nicht besonders viel von Blind Dates! Schon gar nicht mit Ärzten! Die hab ich jeden Tag um mich rum!« Sie wusste selbst nicht, warum sie ihrer Stimme einen ruppigen Klang gab. Wahrscheinlich wollte sie Debbie eins auswischen. Sie hatte ihr die Sache eingebrockt. »He, warum fährst du nicht?«, fragte sie Paul.
Paul fuhr los und Debbie beugte sich nach hinten. Zu Greg sagte sie: »Linda hat Haare auf den Zähnen! Mach dir nichts draus! Zu den Männern, die sie besonders mag, ist sie am unfreundlichsten!«
»Miststück!«, zischte Linda nach vorn.
Zur Community Hall war es nicht weit. Sie parkten in einer Seitenstraße und stiegen aus. »Tut mir Leid«, bedauerte Linda, als Greg ihr aus dem Wagen half, »ich hab heute wohl nicht meinen besten Tag!« Sie tauschte einen raschen Blick mit ihrer Freundin und wurde rot, als sie Debbie grinsen sah. »Ist die Band auch gut?«, fragte sie um ihre Verlegenheit zu überspielen. »Ich hab gehört, die haben noch nie in einer so großen Halle gespielt.«
»Sie haben einen Wettbewerb in Cleveland gewonnen!«, hörte sie Greg antworten. Im Dämmerlicht sah er noch besser aus, stellte Linda widerwillig fest. Seine Augen waren grau oder grün. Aber was interessierte sie das eigentlich? Selbst wenn der Typ ihr absoluter Traummann wäre, müsste sie ihn in ein paar Monaten verlassen.
Die Band war tatsächlich gut. Nicht so professionell wie Jefferson Airplane und nicht so originell, aber rockig genug um die Leute zum Tanzen zu bringen. Debbie und Paul tanzten so wild, dass die Paare einen Kreis um sie bildeten und begeistert klatschten.
Linda und Greg lehnten an der langen Theke und hielten sich an ihren Bierflaschen fest. Die Band war so laut, dass sie gar nicht erst den Versuch machten, sich zu unterhalten. Manchmal blickte er sie verstohlen von der Seite an und lachte spitzbübisch, wenn sich ihre Blicke trafen. Sie fand ihn netter als beabsichtigt und lächelte zurück. Zum Teufel, ein neuer Freund war das Letzte, was sie in ihrer Situation brauchen konnte. In ein paar Wochen flog sie zur Grundausbildung nach Texas und dann weiter nach Vietnam.
Die Band spielte zwei Zugaben, danach kehrten sie zum Auto zurück. »Die waren richtig gut!«, schwärmte Debbie. Paul sagte irgendetwas zu Greg und beide lachten. Linda hatte ein Bier zu viel getrunken und lallte etwas, bevor sie sagte: »Ich gehe nach Vietnam!«
Die Stille, die ihren Worten folgte, schien sie zu erdrücken. Es war schlimmer, viel schlimmer als bei ihren Eltern. »Ich gehe nach Vietnam!«, wiederholte sie. »Ich hab bei der Armee unterschrieben! Im Frühjahr geht es los! Ich konnte nicht anders, Debbie ... ich ...«
»Scheiße!«, sagte Debbie.
Debbie
Vor Charlie's Pool Hall hielten sie an. Sie blieben schweigend im Wagen sitzen und starrten in die bunten Neonlichter an den Häuserwänden. Debbie schüttelte den Kopf. Sie beugte sich über den Sitz und rief verzweifelt: »Warum hast du das getan, Linda? Zur Armee, verdammt! Wer hat dich dazu gebracht, bei diesen Babykillern zu unterschreiben? Deine Eltern? Dein Pfarrer? Hat dir einer dieser verdammten Offiziere was von Vaterlandsliebe und der beschissenen Flagge erzählt? Die Dreckskerle stecken voller Lügen! Die wollen doch nur, dass du ihr blödsinniges Papier unterschreibst und die Drecksarbeit für sie machst! Warum, Linda? Warum machst du so einen Scheiß?«
»Ich will helfen, Debbie!«, sagte Linda so leise, dass es kaum zu verstehen war. »Ich bin Krankenschwester und helfe den Ärzten die verwundeten Soldaten gesund zu machen. Was ist so falsch daran? Die meisten Männer können gar nichts dafür, dass man sie nach Vietnam geschickt hat. Das sind junge Kerle, die für ihr Vaterland in den Krieg ziehen, weil sie glauben einer gerechten Sache zu dienen! Selbst wenn du Recht hast und dieser Krieg falsch ist und wir nicht in Vietnam sein dürften ... selbst dann muss ich den Männern helfen! Das ist mein Beruf!«
»Sie haben dir das Gehirn gewaschen«, seufzte Debbie. »Sie haben dich mit diesem ganzen patriotischen Mist vollgestopft, stimmt's? Von wegen frage nicht, was dieses Land für dich tun kann, sondern frage, was du für dieses Land tun kannst! So ist es doch, oder? Du glaubst diesen ganzen Blödsinn! Du denkst, da drüben sind nur Helden unterwegs! Edle Krieger, die einen gerechten Kampf gegen das Böse führen, für die Freiheit der Welt! Mann, bist du naiv! Was meinst du denn, was in Nam los ist? Das ist eine einzige Abschlachterei! Sie kippen das verdammte Gift auf die Bäume, bis keine Blätter mehr dran sind, und mähen alles nieder, was ihnen im Weg ist! Unsere Jungs! Mein Bruder, die Jungs von der High School, mit denen wir am See rumgeknutscht haben! Die Armee hat sie zu gefühllosen Mördern gemacht, und wenn du aus der verdammten Grundausbildung kommst, bist du genauso! Lass den Scheiß, Linda! Geh nicht!«
»Ich muss, Debbie! Es ist meine Pflicht! Ich will auch nicht, dass unsere Soldaten in den Krieg ziehen! Aber ich muss gehen!«
»Einen Dreck musst du!«, schrie Debbie. Sie stieg aus dem Wagen und knallte die Tür hinter sich zu. »Haut ab!«, rief sie ihren Freunden zu. »Ich will euch nicht mehr sehen!« Sie stapfte wütend davon und verschwand in Charlie's Pool Hall. Im Lokal blieb sie stehen und wartete, bis sich ihre Augen an das Halbdunkel gewöhnt hatten. Sie rieb sich die Tränen aus den Augen und schob sich auf einen Barhocker. »Gib mir 'n Bier!«, sagte sie zu dem Wirt.
»Du bist zu jung«, antwortete der schnauzbärtige Mann gelassen. »Ich darf dir keinen Alkohol ausschenken, das weißt du doch!«
»Dann gib mir 'nen Whisky oder 'nen Brandy! Irgendwas!«
»Du kannst 'ne Cola haben.« Er stellte ihr eine Coke hin und sie leerte die Flasche in einem Zug. Schon um den Wirt zu provozieren ging sie zum Automat und zog ein Päckchen Zigaretten. Sie steckte sich eine an und grinste herausfordernd. »Probleme?«
»Ich will keinen Ärger! Rauch meinetwegen so viele Zigaretten, wie du willst, aber komm mir nicht mit dem anderen Zeug! Sonst muss ich die Polizei rufen, kapiert? Ich hab ein sauberes Lokal!«
»Schon gut«, erwiderte sie missmutig. Sie drückte die angerauchte Zigarette in einem Aschenbecher aus und bestellte noch eine Cola. Außer ihr standen zwei erwachsene Männer an der Theke und starrten auf den Fernseher, der stumm über dem Durchgang zur Küche lief. Ausschnitte aus einem dämlichen Footballspiel. Aus den Lautsprechern bei den Billardtischen drang ein Top-Hit.
»Was meint ihr?«, fragte Debbie in die Runde. Sie musste irgendwie die aufgestaute Wut loswerden. »Wie lange sollen wir noch in Vietnam bleiben? Eine Woche? Ein Jahr? Zehn Jahre? Wie lange sollen wir diesen beschissenen Krieg noch führen?«
Die beiden Männer sahen sie nicht einmal an. Und bei den Billardtischen war es so laut, dass sie niemand hörte. Sie warf die Cola-Flasche auf den Boden und schrie: »Ich hab euch was gefragt, verdammt? Wie lange sollen wir den Scheißkrieg führen?«
Der Wirt kam um die Theke herum und baute sich vor ihr auf. Er war dreimal so schwer wie sie. »Lass den Unsinn, Mädchen! Ich weiß nicht, was plötzlich in dich gefahren ist, aber so einen Mist wollen wir hier nicht hören! Überlass solche Sprüche den Hippies!«
»Und wenn du's schon wissen willst«, erwachte einer der beiden Männer zum Leben, »wir bleiben so lange in Vietnam, wie es nötig ist! Einer meiner Söhne ist während der beschissenen Tet-Offensive gefallen, letztes Jahr, als die Vietcong ihr Neujahr mit Granaten feierten, und der zweite geht rüber, sobald er alt genug ist, um eine Knarre zu halten und den gelben Scheißkerlen eine Kugel in den Wanst zu jagen! Solange noch einer dieser Burschen am Leben ist, bleiben wir dort! Oder willst du, dass sich die Commies bei uns breit machen? So, und jetzt geh nach Hause und zieh dir was Anständiges an! Wenn meine Tochter so einen Fetzen anhätte, würde ich ihr den Hintern versohlen!«
Debbie warf einen Schein auf die Theke und ging zur Tür. »Wichser!«, beschimpfte sie den Mann. »Du hast doch keine Ahnung!«
Sie verließ das Lokal und ging ein paar Blocks. Nach einigen Minuten an der frischen Luft war ihre Wut verraucht. Sie blieb vor einem Schaufenster stehen und blickte hinein ohne wirklich etwas zu sehen. Als sie daran dachte, was sie dem wütenden Mann an der Theke geantwortet hatte, musste sie grinsen. Sie ging weiter und lehnte sich an einen Bretterzaun bei einer Bushaltestelle. Während sie auf den Bus wartete, bereute sie bereits, ihre Freunde vertrieben zu haben und in der Kneipe ausgerastet zu sein.
»He, Debbie!« Paul hielt mit seinem Buick am Straßenrand und winkte sie zu sich heran. »Komm, wir gehen einen Cheeseburger essen, dann geht's dir bestimmt besser! Steig schon ein, Debbie!«
Sie öffnete die Tür und ließ sich auf den Beifahrersitz fallen. Eine Weile fuhren sie schweigend durch die Gegend. »Sorry«, sagte sie nach einer Weile, »ich hab einfach die Nerven verloren!« Sie blickte in die Dunkelheit hinaus und schüttelte den Kopf. »Ich kapier einfach nicht, wie sie so etwas tun kann! Wir tun alles, damit dieser Krieg endlich zu Ende geht, und sie meldet sich freiwillig! Elender Mist! Ich dachte, sie wäre ein bisschen schlauer!«
»Sie ist Krankenschwester«, antwortete Paul, »sie lebt dafür, anderen Menschen zu helfen.« Es klang beinahe wie eine Entschuldigung. »Wenn ihr Vater so ein toller Kriegsheld war, wie du sagst, haben sie bestimmt die Stars and Stripes vor dem Haus hängen und ihr Vater sitzt jeden Abend vor den Nachrichten und feuert unsere Jungs an, damit sie es den verdammten Commies zeigen!«
Debbie verzog abfällig das Gesicht. »Meinst du, meine Eltern sind anders? Die sind jetzt noch für den Krieg! ›Warum werfen sie keine Atombombe in den Dschungel, so wie in Hiroshima, dann wäre Ruhe?‹, sagt mein Vater. Und am Tod von meinem Bruder bin natürlich ich schuld! Weil ich mich mit diesem Kommunistenpack rumtreibe und die Moral unserer Truppen untergrabe!« Ihre Stimme hatte einen ironischen Unterton. »Als ob der Präsident und seine Generäle sich darum scheren, wenn wir auf die Straße gehen!«
»Eines Tages werden sie müssen!«, erwiderte Paul entschlossen. »Auf der ganzen Welt protestieren die Menschen gegen diesen Krieg und es werden täglich mehr! Und wenn sie weiter im Fernsehen zeigen, wie Tausende unserer Jungs in Särgen nach Hause gebracht werden, haben wir in Amerika bald die Mehrheit! Wir dürfen nicht aufgeben, Debbie! Auf keinen Fall!«
Debbie wirkte entschlossen. »Keine Angst! Ich geh so lange auf die Straße, bis wir aus Vietnam draußen sind! Und meine so genannte beste Freundin kann mich schon gar nicht davon abhalten! Soll sie doch nach Vietnam gehen! Wenn sie nichts Besseres zu tun hat als die Amme für diese Killer zu spielen ... soll sie doch!«