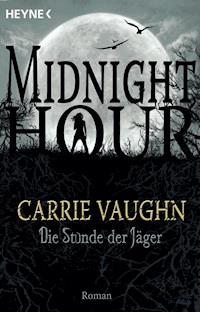
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Midnight Hour
- Sprache: Deutsch
Die coolste Heldin der Mystery – Kitty Norville, Radiomoderatorin und Werwölfin
Kitty Norville ist der Star der Radiosendung „Midnight Hour“ – und sie ist eine Werwölfin. Seit sie ihre Identität gelüftet hat, war ihr Leben mehr als einmal in Gefahr. Um zur Ruhe zu kommen, zieht sie sich in einen kleinen Trailer in die Wildnis zurück. Kitty ist jedoch nicht allein – die Geschöpfe der Dunkelheit ruhen nie. Ein tödliches Katz-und-Maus-Spiel beginnt ...
Düster und sexy.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 440
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Das Buch
Kitty Norville hat sich nach den turbulenten Ereignissen in Washington, wo sie gezwungen wurde, sich vor laufender Kamera in einen Werwolf zu verwandeln, in eine einsame Hütte im Süden Colorados zurückgezogen. Doch ihr ruhiges Leben dort wird schon bald durch unheimliche Vorkommnisse gestört – Tierkadaver und Kruzifixe aus Stacheldraht liegen vor ihrer Tür, und die Polizei nimmt sie nicht ernst. Dann taucht plötzlich der Werwolfjäger Cormac auf, zusammen mit Kittys Anwalt Ben O’Farrell, seinem Cousin, der gebissen und mit Lykanthropie infiziert wurde. Die Situation gerät völlig außer Kontrolle, als eine Reihe blutiger Massaker an Tierherden in der Umgebung verübt werden. Und Kitty ist Verdächtige Nummer eins …
MIDNIGHT HOUR
Erster Roman: Die Stunde der Wölfe
Zweiter Roman: Die Stunde der Vampire
Dritter Roman: Die Stunde der Jäger
Vierter Roman: Die Stunde der Hexen
Fünfter Roman: Die Stunde der Spieler
Die Autorin
Carrie Vaughn wurde 1973 in Kalifornien geboren. Nach ihrem Studium im englischen York und in Boulder, Colorado, hatte sie zunächst diverse Jobs in der Kultur- und Theaterszene, ehe sie sich als Autorin von Dark-Fantasy-Geschichten einen Namen machte. Der endgültige Durchbruch gelang ihr mit der Mystery-Serie um die junge Moderatorin und Werwölfin Kitty Norville. Carrie Vaughn lebt und schreibt in Boulder.
Inhaltsverzeichnis
Für Andrea, Denise, April, Melissa, Kevin und Tim, die von Anfang an dabei waren.
Eins
Sie läuft aus purer Freude, weil sie es kann, jeder Sprung misst über dreieinhalb Meter. Ihr Maul steht offen, damit sie die Luft schmecken kann, die beißend kalt ist. Es ist Monatswende, und der zunehmende Mond versilbert den Nachthimmel, erhellt einzelne verschneite Stellen im Wald. Es ist noch nicht Vollmond; dass sie vor ihrer Zeit freigelassen wird, kommt nur selten vor, doch die andere Hälfte ihres Wesens hat keinen Grund, sie wegzusperren. Sie ist allein, aber sie ist frei, und deshalb rennt sie.
Als sie etwas wittert, weicht sie von ihrer Bahn ab, verlangsamt das Tempo zum Trab und senkt die Schnauze zu Boden. Beute, frisch und warm. Die gibt es viel hier in der Wildnis. Der Geruch brennt in der Winterluft. Sie pirscht sich an, atmet mit bebenden Nüstern ein und hält nach der geringsten ruckartigen Bewegung Ausschau. Ihr leerer Magen krampft sich zusammen, treibt sie vorwärts. Der Geruch lässt ihr das Wasser im Mund zusammenlaufen.
Sie hat sich daran gewöhnt, allein auf die Jagd zu gehen. Muss vorsichtig sein, darf kein Risiko eingehen. Sie berührt den Boden leicht mit den Pfoten, bereit, einen Satz nach vorne zu machen, in die eine oder andere Richtung zu stürzen, ohne auf dem Waldboden auch nur das geringste Geräusch zu verursachen. Der Geruch – Moschus, heißes Fell und Kot – nimmt zu und jagt durch ihr Gehirn. All ihre Nerven lodern auf. Sie ist jetzt nahe dran, näher, kriecht auf Jägerpfoten vorwärts …
Das Kaninchen springt aus seinem Versteck hervor, einem morschen Baumstamm, der von Sträuchern überwuchert ist. Sie ist bereit, weiß, ohne es zu sehen oder zu hören, dass es da ist; ihr Jagdsinn ist angefüllt von der Gegenwart des Beutetiers. In dem Augenblick, in dem es losläuft, setzt sie zum Sprung an, drückt es mit ihren Krallen und ihrem Körper zu Boden, schlägt ihm die Zähne in den Nacken, umschließt ihn mit ihren Kiefern und reißt. Ihm bleibt keine Zeit zu schreien. Sie trinkt das Blut, das aus seinem zerfetzten und gebrochenen Hals quillt, verschlingt das Fleisch, bevor das Blut abkühlt. Die Wärme und Lebendigkeit füllen ihren Magen, lassen ihre Seele aufleuchten, und sie hält inmitten des Blutbads inne, um ein Siegesheulen auszustoßen …
Ich zuckte am ganzen Körper zusammen, als hätte ich davon geträumt zu fallen und wäre jäh aufgewacht. Keuchend atmete ich aus – ein Teil von mir befand sich immer noch in dem Traum, stürzte immer noch, und ich musste mich selbst ermahnen, dass ich mich in Sicherheit befand, dass ich nicht gleich auf dem Boden aufschlüge. Meine Hände schlossen sich reflexartig, doch da waren keine Decke oder ein Kissen, die ich packen konnte. Eine Handvoll abgestorbener Blätter vom letzten Herbst zerbröckelte in meinem Griff.
Langsam setzte ich mich auf, kratzte mich am Kopf und strich mir die zerzausten blonden Haare zurück. Unter mir spürte ich den rauen Erdboden. Ich war nicht im Bett, ich war nicht in dem Haus, in dem ich seit zwei Monaten wohnte. Ich lag in einer Mulde, die in die Erde gegraben war, bedeckt von Geröll aus dem Wald, im Schutz von ausladenden Kiefern. Außerhalb der Höhle lag an schattigen Stellen verkrusteter Schnee. Die Luft war kalt und beißend. Mein Atem gefror zu kleinen Wölkchen.
Ich war nackt, und die Schicht, die meine Zähne bedeckte, schmeckte nach Blut.
Verdammt. Ich hatte es schon wieder getan.
Viele Leute träumen davon, auf dem Titelblatt einer überregionalen Zeitschrift zu landen. Es ist eines der Kennzeichen von Berühmtheit, Reichtum oder aber wenigstens von fünfzehn Minuten Ruhm. Viele Leute gelangen tatsächlich auf die Titelblätter landesweiter Zeitschriften. Die Frage ist nur: Findet man sich in einem Designerkleid auf dem Cover eines glamourösen Haute-Couture-Hochglanzmagazins wieder und sieht toll aus? Oder auf dem Cover von Time, verdreckt und völlig durcheinander, mit einer Schlagzeile, die lautet: »Ist dies das Gesicht eines Monsters?« und »Schweben SIE in Gefahr?«
Es dürfte nicht schwer zu erraten sein, welches mein Titelbild war.
Das Haus, das ich gemietet hatte – eher ein Häuschen, eine Ferienhütte mit zwei Zimmern, die durch eine unbefestigte Straße und Satellitenfernsehen mit der Zivilisation verbunden war –, lag so weit von der Stadt und der Straße entfernt, dass ich mir nicht die Mühe machte, mich für den Rückweg anzuziehen. Allerdings hätte ich das auch gar nicht gekonnt, denn ich hatte vergessen, ein paar Kleider zu verstecken. Warum hätte ich das auch tun sollen, da es schließlich überhaupt nicht meine Absicht gewesen war, mich zu verwandeln und zu rennen? Es blieb mir nichts anderes übrig, als nackt zurückzugehen.
Es fühlte sich richtig gut an, mit entblößter Haut zu gehen, die in der kalten Luft von einer Gänsehaut überzogen war. Irgendwie fühlte ich mich reiner. Freier. Ich machte mir keine Sorgen – ich folgte keinem Weg, keine Wanderpfade durchzogen diese Wälder. Niemand würde mich sehen in diesem abgelegenen Abschnitt des San Isabel National Forest in Südcolorado, der mitten in die Berge eingebettet war.
Genau so wollte ich es.
Ich hatte von allem weg gewollt. Der Nachteil daran war allerdings, dass es weniger gab, was mich mit der Welt verband. Ich hatte nicht mehr so viele Gründe, in meinem menschlichen Körper zu bleiben. Wenn ich mir Sorgen gemacht hätte, dass mich jemand nackt sehen könnte, hätte ich mich wahrscheinlich gar nicht erst verwandelt. Vollmondnächte waren nicht die einzige Zeit, zu der Lykanthropen Wolfsgestalt annehmen konnten; wir konnten dies jederzeit tun. Ich hatte schon von Werwölfen gehört, die sich verwandelt hatten, in den Wald gelaufen waren und nie wieder zurückkehrten. Ich wollte nicht, dass mir das passierte. Jedenfalls hatte ich früher immer gedacht, dass ich das nicht wollte.
Doch es wurde schrecklich einfach, zum Wolf zu werden und zu rennen, ob nun Vollmond war oder auch nicht.
Eigentlich sollte ich an einem Buch schreiben. In den letzten beiden Jahren war mir so einiges zugestoßen: der Start meiner Radioshow; ich hatte live auf Sendung bekanntgegeben, ein Werwolf zu sein, und die Leute hatten mir tatsächlich geglaubt; dann hatte ich vor einem Anhörungsausschuss des Senats ausgesagt und viel mehr Aufmerksamkeit erregt, als ich je gewollt hatte, auch wenn mir das vielleicht im Vorhinein hätte klar sein müssen – all das lieferte ausreichend Material für ein Buch, jedenfalls glaubte ich das. Memoiren oder so etwas. Wenigstens glaubte ein großes Verlagshaus, ich hätte genügend Stoff, und bot mir so viel Geld an, dass ich mir eine Auszeit von meiner Sendung nehmen und schreiben konnte. Ich war eine angesagte Berühmtheit, und wir alle wollten Kapital aus meinem Ruhm schlagen, solange er anhielt. Sich zu verkaufen hatte so traumhaft geklungen.
Ich stellte etwa ein Dutzend »Best of Midnight Hour«-Folgen zusammen, die ohne mich ausgestrahlt werden konnten, sodass die Show selbst während meiner Auszeit weiterlief. Auf diese Weise würden die Leute nicht das Interesse verlieren, mein Name wäre weiter in aller Munde, und vielleicht würde es sogar ein paar neue Fans anlocken. Ich hatte vor, einen auf Walden zu machen und mich von der menschlichen Gesellschaft zurückzuziehen, um besser nachdenken zu können. Ich wollte den Bedrängnissen des Lebens entkommen, mich selbst befreien, um mich mit den tiefen philosophischen Fragen zu befassen, über die ich zweifellos nachgrübeln würde, während ich mein großes Meisterwerk verfasste.
Das Problem war, man konnte der Gesellschaft zwar den Rücken kehren und lernen, autark zu sein, wie Thoreau es befürwortet hatte. Die Nase rümpfen angesichts des erbarmungslosen Konkurrenzkampfes. Doch man entkam nicht sich selbst, den eigenen Zweifeln, dem eigenen Gewissen.
Ich wusste noch nicht einmal, wie man damit anfing, ein Buch zu schreiben. Ich hatte seitenweise hingekritzelte Notizen, aber keine einzige fertige Seite. Auf Papier wirkte alles so unecht. Im Ernst, wo sollte ich anfangen? »Ich erblickte das Licht der Welt …« und dann zwanzig Jahre eines völlig gewöhnlichen Lebens beschreiben? Oder bei dem Überfall anfangen, der mich zum Werwolf gemacht hatte? Jene ganze Nacht war so kompliziert und schien ein etwas jäher Einstieg für eine Geschichte zu sein, die ja eigentlich einen optimistischen Grundton haben sollte. Sollte ich bei den Senatsanhörungen beginnen? Wie erklärte ich dann den ganzen Schlamassel, der mich überhaupt erst dorthin gebracht hatte?
Also legte ich die Kleider ab, verwandelte mich und rannte in den Wäldern, um dem Problem aus dem Weg zu gehen. So sehr ich mich auch abgemüht hatte, mir meine menschliche Natur zu bewahren, war diese Lösung doch einfacher.
Von meiner Hütte aus war Walsenburg in etwa dreißig Meilen Entfernung die nächste nennenswerte Stadt, und das war nicht gerade eine Metropole. Der Ort hatte in den Sechzigern quasi aufgehört zu wachsen. Die Hauptstraße war der State Highway, der durch die Stadt verlief, kurz bevor er in den Interstate Highway mündete. Gesäumt wurde die Hauptstraße von altmodischen Backsteinbauten. Viele hatten noch die ursprünglichen Schilder: Familienbetriebe, Eisenwarenhandlungen, Bars und dergleichen. Etliche waren mit Brettern vernagelt. Ein Denkmal gegenüber dem Kreisgericht ehrte die Kohlebergleute, die die Gegend ursprünglich besiedelt hatten. Im Südwesten erhoben sich die Spanish Peaks, Zwillingsberge, die mehr als zweitausend Meter über die Ebene emporragten. Um sie herum erstreckte sich viel wilder, einsamer Wald.
Am folgenden Nachmittag fuhr ich in die Stadt, um mich mit meinem Anwalt Ben O’Farrell in einem Diner am Highway zu treffen. Er weigerte sich, tiefer als bis nach Walsenburg in die Wildnis von Südcolorado zu fahren.
Ich bemerkte sein Auto, das bereits am Straßenrand parkte, und hielt dahinter an. Ben hatte sich in einer Sitzgruppe in der Nähe der Tür breitgemacht. Er war bereits dabei, einen Hamburger und einen Teller Pommes frites zu vernichten. Ben hielt nicht viel von Förmlichkeiten.
»Hi.« Ich ließ mich auf die Bank ihm gegenüber gleiten.
Er griff nach etwas neben sich und ließ es dann vor mir auf den Resopaltisch fallen: ein Stapel Post für mich, zu seinen Händen adressiert. Ich versuchte, so viel Schriftverkehr wie möglich über ihn laufen zu lassen. Es war schön, einen Filter zu haben. Teil der Walden-Sache. In dem Stapel befanden sich unter anderem ein paar Zeitschriften, nichtssagende Umschläge, Anmeldeformulare für Kreditkarten. Ich machte mich ans Sortieren.
»Mir geht es gut, danke, wie geht es dir?«, sagte ich sarkastisch. Irgendwann hatte ich aufgehört, meinen Anwalt zu siezen.
Ben war Anfang dreißig, ein Typ mit Ecken und Kanten. Ständig machte er den Eindruck, mit dem Rasieren einen Tag hinterher zu sein, und seine hellbraunen Haare waren zerzaust. Er trug ein graues Anzugjackett, doch sein Hemdkragen stand offen, von einer Krawatte keine Spur.
Er lächelte zwar, ihm war aber anzusehen, dass er insgeheim mit den Zähnen knirschte.
»Bloß weil ich den ganzen Weg hier rausgefahren bin, solltest du nicht von mir verlangen, auch noch freundlich zu sein.«
»Würde mir im Traum nicht einfallen.«
Ich bestellte bei der Kellnerin Mineralwasser und einen Hamburger, während Ben seine Aktentasche auf den Tisch stellte und Papierstapel hervorzog. Er benötigte an etwa einer Million Stellen meine Unterschrift. Das Gute daran war, dass ich laut dieser Dokumente die Begünstigte etlicher großzügiger außergerichtlicher Vergleiche war, die mit dem Fiasko zusammenhingen, mit dem meine Reise nach Washington, D.C., letzten Herbst geendet hatte. Wer hätte gedacht, dass es so lukrativ sein könnte, entführt und live im Fernsehen zur Schau gestellt zu werden? Außerdem durfte ich zu Protokoll gegebene eidesstattliche Aussagen in zwei Strafprozessen unterschreiben. Das fühlte sich gut an!
»Du kriegst zwanzig Prozent«, sagte ich. »Eigentlich solltest du strahlen.«
»Ich weiß immer noch nicht, ob es die Sache wert ist, die erste Werwolfprominente auf der Welt zu vertreten. Du bekommst sehr eigenartige Anrufe, ist dir das klar?«
»Warum, meinst du, gebe ich den Leuten deine Nummer und nicht meine?«
Er nahm mir die Stapel wieder ab, überprüfte sie, packte sie zusammen und steckte sie zurück in seine Aktentasche. »Du kannst von Glück sagen, dass ich so ein netter Kerl bin.«
»Mein Held.« Ich stützte das Kinn in die Hände und klimperte mit den Wimpern. Sein prustendes Lachen verriet mir, wie ernst er mich nahm. Mein Grinsen wurde nur noch breiter.
»Noch etwas«, sagte er, während er weiterhin Papiere in seine Tasche stopfte und meinen Blick mied. »Der Verlag hat angerufen. Will wissen, wie es mit dem Buch läuft.«
Genau genommen hatte ich einen Vertrag. Genau genommen hatte ich einen Abgabetermin. Eigentlich sollte ich mir über solche Dinge keine Sorgen machen müssen, während ich versuchte, meine Eigenständigkeit unter Beweis zu stellen, indem ich einfach lebte und zurück zur Natur unterwegs war.
»Es läuft und läuft und läuft, ist schon ganz außer Puste«, murmelte ich.
Er faltete die Hände. »Ist es zur Hälfte fertig? Ein Viertel? «
Ich richtete den Blick auf eine Stelle an der Wand gegenüber und hielt den Mund.
»Sag mir, dass du zumindest angefangen hast.«
Ich stieß ein tiefes Seufzen aus. »Ich spiele mit dem Gedanken, ehrlich.«
»Weißt du, für jemanden in deiner Situation ist es völlig akzeptabel, einen Ghostwriter anzuheuern. Oder sich wenigstens einen Co-Autor zu suchen. Das machen die Leute ständig.«
»Nein. Ich habe einen Abschluss in Englisch. Ich sollte in der Lage sein, ein paar Sätze aneinanderzureihen.«
»Kitty …«
Ich schloss die Augen und hob abwehrend die Hand. Er erzählte mir nichts, was ich nicht sowieso schon wusste.
»Ich werde daran arbeiten. Ich möchte daran arbeiten. Ich werde etwas zusammenschustern, das wir ihnen zeigen können, um sie zufriedenzustellen.«
Er presste die Lippen zusammen, was aber nicht einmal ansatzweise nach einem Lächeln aussah. »Okay.«
Ich richtete mich auf und tat so, als hätten wir uns nicht gerade über das Buch unterhalten, an dem ich nicht schrieb. »Hast du etwas gegen diese Schlange unternommen? «
Verärgert sah er von seinem Essen auf. »Es gibt keine Grundlage für eine Klage. Keine Copyright-Verletzung, keine Warenzeichenverletzung, nichts.«
»Komm schon, sie hat meine Sendung geklaut!«
Diese Schlange! Sie nannte sich »Ariel, Priesterin der Nacht« und hatte vor etwa drei Monaten angefangen, eine Radiotalkshow über das Übernatürliche zu moderieren. Genau wie ich. Na ja, genau wie ich früher.
»Sie hat die Idee geklaut«, sagte Ben gelassen. »Das ist alles. So etwas kommt ständig vor. Du weißt schon, wenn ein Sendernetz einen Hit mit einer Krankenhausserie landet, nimmt in der nächsten Saison jedes andere Sendernetz eine solche Serie ins Programm, weil sie meinen, dass alle scharf darauf sind. Wegen so etwas kann man niemanden gerichtlich belangen. Früher oder später wäre es ohnehin passiert.«
»Aber sie ist furchtbar! Ihre Sendung ist der reinste effekthascherische Müll!«
»Dann mach es eben besser«, sagte er. »Geh wieder auf Sendung. Erziele höhere Einschaltquoten. Etwas anderes kannst du nicht tun.«
»Das geht nicht. Ich brauche eine Auszeit.« Ich ließ mich gegen die Lehne der Sitzbank fallen.
Träge rührte er mit einem Stück Pommes frites das Ketchup auf seinem Teller um. »Für mich sieht es so aus, als würdest du die Flinte ins Korn werfen.«
Ich sah weg. Ich hatte mich mit Thoreau verglichen, weil er die Flucht in die Wälder so edel klingen ließ. Trotzdem war es eine Flucht.
Ben fuhr fort: »Je länger du wegbleibst, desto mehr scheint es, als hätten die Leute in D.C. gewonnen, die dir den Garaus machen wollten.«
»Du hast recht.« Meine Stimme klang weich. »Ich weiß ja, dass du recht hast. Mir fällt bloß nichts ein, was ich sagen könnte.«
»Wie kommst du dann darauf, du könntest ein Buch schreiben?«
Ben hatte für einen Tag oft genug recht gehabt. Ich blieb ihm eine Antwort schuldig, und er ließ das Thema fallen.
Er ließ mich zahlen. Gemeinsam traten wir auf die Straße hinaus.
»Fährst du direkt zurück nach Denver?«, fragte ich.
»Nein. Ich fahre nach Farmington und treffe mich mit Cormac. Er möchte, dass ich ihm bei einem Auftrag helfe.«
Ein Auftrag. Bei Cormac bedeutete das etwas Gefährliches. Er jagte Werwölfe – nur solche, die Ärger bereiteten, hatte er mir versichert – und brachte nebenbei noch den einen oder anderen Vampir zur Strecke. Einfach weil er es konnte.
Farmington, New Mexico, war noch einmal zweihundertfünfzig Meilen südwestlich von hier. »Für mich kommst du bloß bis nach Walsenburg, aber für Cormac fährst du bis nach Farmington?«
»Cormac gehört zur Familie«, sagte er.
Ich kannte noch immer nicht die ganze Geschichte und fragte mich häufig, wie ich an die beiden geraten war. Ben hatte ich kennengelernt, nachdem Cormac ihn mir empfohlen hatte. Wie kam ich nur dazu, mich ausgerechnet von einem Werwolfjäger bei der Wahl meines Anwalts beraten zu lassen? Allerdings gab es keinen Grund zur Klage: Beide hatten mich mehr als einmal aus heiklen Situationen gerettet. Ben schien keinerlei moralische Skrupel zu haben, sowohl einen Werwolf als auch einen Werwolfjäger zu vertreten. Doch waren Anwälte überhaupt zu moralischen Skrupeln fähig?
»Pass auf dich auf«, sagte ich.
»Keine Sorge.« Er lächelte. »Ich fahre bloß den Wagen und stelle die Kaution. Cormac ist derjenige, der gerne gefährlich lebt.«
Er öffnete die Tür seines dunkelblauen Autos, schleuderte seine Aktentasche auf den Beifahrersitz und stieg ein. Mit einem Winken fuhr er vom Bordstein los und steuerte wieder auf den Highway.
Auf dem Rückweg zu meiner Hütte hielt ich in dem noch kleineren Städtchen Clay, Einwohnerzahl dreihundertzwanzig, zweitausendzweihundertfünfundfünfzig Meter über dem Meeresspiegel. Es hatte eine Tankstelle mit dazugehörigem Lebensmittelgeschäft, ein Bed & Breakfast, einen Ausstatter für Hinterwäldler und eine hundert Jahre alte Steinkirche aufzuweisen – das war’s auch schon. Der Lebensmittelladen, der »Clay Country Store«, verkaufte die besten selbst gebackenen Chocolate Chip Cookies diesseits der Kontinentalen Wasserscheide. Sie waren unwiderstehlich.
Als ich eintrat, erklangen etliche Glöckchen, die am Türgriff hingen. Der Mann an der Kasse blickte auf, runzelte die Stirn und griff unter den Ladentisch. Er zog ein Gewehr hervor. Sagte kein Wort, sondern hielt es einfach nur auf mich gerichtet.
Yeah, die Leute in der Gegend kannten mich. Dank Internet und 24-Stunden-Nachrichtensendern konnte ich nicht anonym bleiben, noch nicht einmal am Ende der Welt.
Ich hob die Hände und trat weiter in den Laden. »Hi Joe. Ich brauche bloß etwas Milch und Cookies, dann mache ich mich wieder vom Acker.«
»Kitty? Sind Sie’s?« Das Gesicht einer Frau tauchte hinter einer Regalwand voll mit Motoröldosen und Eiskratzern auf. Sie war wie Joe etwa Mitte fünfzig und hatte graue Haare, die zu einem hin- und herschwingenden Pferdeschwanz zusammengebunden waren. Während Joe mich finster musterte, strahlte sie mich an.
»Hi Alice«, sagte ich lächelnd.
»Joe, leg das weg. Wie oft soll ich dir das denn noch sagen?«
»Darf kein Risiko eingehen«, knurrte er.
Ich achtete nicht auf ihn. Manche Kämpfe konnte man nicht gewinnen. Als er so reagiert hatte, als ich zum ersten Mal den Laden betreten und er in mir »diesen Werwolf aus dem Fernsehen« wiedererkannt hatte, war ich so stolz gewesen, nicht ausgeflippt zu sein. Ich hatte lediglich mit erhobenen Händen dort gestanden und gefragt: »Haben Sie da Silberpatronen drin?« Er hatte erst mich angesehen, dann das Gewehr, und verärgert die Stirn gerunzelt. Bei meinem nächsten Besuch hatte er verkündet: »Diesmal hab ich Silber.«
Ich ging um die Regale auf Alice zu. Dort bot ich Joe und seiner Flinte keine so leichte Zielscheibe.
»Es tut mir leid«, sagte Alice. Sie räumte Suppendosen ein. »Eines Tages werde ich das Ding noch verstecken. Wenn Sie vorher anrufen würden, könnte ich mir eine Arbeit für ihn ausdenken, damit er nicht im Laden ist.«
»Machen Sie sich keine Sorgen. Solange ich keine Bedrohung darstelle, habe ich nichts zu befürchten, stimmt’s?« Nicht dass die Leute bei meinem Anblick – ich war eine kesse Blondine in den Zwanzigern – im Allgemeinen an einen »blutdurstigen Werwolf« dachten.
Sie verdrehte die Augen. »Als könnten Sie eine Bedrohung sein. Ich schwöre, dieser Mann lebt in seiner eigenen kleinen Welt.«
Ja, genau: in der Art Welt, in der Ladenbesitzer Gewehre unter dem Tresen aufbewahrten, während ihre Ehefrauen oben auf der Registrierkasse Heilkristalle aufreihten. Außerdem war über der Ladentür ein Kruzifix festgenagelt, und an den Fenstern hingen weitere Heilkristalle.
Sie hatten wohl beide ihre eigenen Schutzmaßnahmen.
Ich wusste nicht recht, ob die Sache mit den Werwölfen manchen Leuten tatsächlich nichts ausmachte, oder ob sie sich einfach immer noch weigerten, daran zu glauben. Bei Alice war vermutlich Letzteres der Fall. Wie meine Mom, die mit dem Thema umging, als sei ich einem Verein oder Ähnlichem beigetreten. Nach Vollmondnächten sagte sie für gewöhnlich etwas wie: »Hattest du Spaß bei deinem kleinen Ausflug, mein Schatz?«
Wenn man sein Leben lang geglaubt hatte, dass solche Dinge nicht existierten, war es schwer, diese Überzeugung einfach so über Bord zu werfen.
»Wie schaffen Sie beide es, verheiratet zu bleiben?«
Sie warf mir einen Blick von der Seite zu, setzte ein schiefes Grinsen auf und antwortete nicht. Doch ihre Augen funkelten. Okay, dieser Frage würde ich nicht weiter nachgehen.
Alice tippte meine Einkäufe in die Kasse ein, während Joe wütend über sein Gewehr hinweg zusah. Ich musste mich als Botschafterin des guten Willens begreifen – keine ruckartigen Bewegungen machen, nichts Abfälliges sagen. Vielleicht würde er eines Tages erkennen: Nur weil ich ein Monster war, bedeutete das nicht, dass ich, nun ja, ein Monster war.
Ich bezahlte, und Alice reichte mir die braune Papiertüte. »Danke«, sagte ich.
»Jederzeit. Rufen Sie einfach an, wenn Sie etwas brauchen sollten.«
Selbst meine lässige Unbekümmertheit kannte ihre Grenzen. Ich konnte Joe und seinem Gewehr nicht den Rücken zukehren, also ging ich rückwärts auf die Tür zu, griff nach hinten, um sie aufzuziehen, und schlüpfte unter Glöckchengeklingel nach draußen.
Während sich die Tür hinter mir schloss, konnte ich Alice sagen hören: »Joe, um Himmels willen, steck das Ding weg!«
Ach ja, das Leben in einer kleinen Stadt in den Bergen. Einfach unvergleichlich.
Zwei
In der vorderen Hälfte meines Häuschens befanden sich ein Wohnzimmer und eine Küche, während der hintere Teil aus einem Schlaf- und einem Badezimmer bestand. Die beiden Hälften wurden nur teilweise von einer Wand getrennt, damit das ganze Haus an der einzigen Heizquelle teilhaben konnte: einem Holzofen im Wohnzimmer. Der Heißwasserboiler funktionierte mit Propangas, alles andere war strombetrieben. Ich ließ das Feuer im Holzofen ständig brennen, um den Winter auf Abstand zu halten. In dieser Höhe war ich zwar nicht eingeschneit, aber es war trotzdem verdammt kalt, besonders nachts.
Im Wohnzimmer stand außerdem mein Schreibtisch, genauer gesagt ein kleiner Tisch mit meinem Laptop und ein paar Büchern: ein Wörterbuch sowie eine Ausgabe von Walden voller Eselsohren. Unter dem Tisch hatte ich zwei Kisten verstaut, in denen sich weitere Bücher und ein paar CDs befanden. Mein ganzes Erwachsenenleben hatte ich beim Radio gearbeitet – ich brauchte etwas, das die Stille durchbrach. Der Schreibtisch stand vor dem gewaltigen Fenster, das auf die Veranda und die Lichtung hinausging, auf der ich meinen Wagen geparkt hatte. Jenseits der Lichtung kletterten Bäume und braune Erde den Hügel empor, auf den blauen Himmel zu.
Ich hatte viele Stunden damit verbracht, am Schreibtisch zu sitzen und durch das Fenster nach draußen zu starren. Zumindest hätte ich mir die Mühe machen sollen, ein Haus mit schönem Blick auf die Berge zu finden, um in den langen Phasen meines Aufschiebens etwas zu tun zu haben.
Als die Dämmerung hereinbrach und der Himmel ein sattes Königsblau annahm, um dann später tiefdunkel zu werden, wusste ich, dass ich einen weiteren Tag vergeudet hatte, ohne ein einziges annehmbares Wort geschrieben zu haben.
Doch es war Samstag, und ich konnte mich auch anderweitig unterhalten lassen. Sehr spät, kurz vor Mitternacht, schaltete ich das Radio ein. Es war Zeit für Ariel, Priesterin der Nacht. Ich machte es mir mit einem weichen Kissen und einem Bier auf dem Sofa bequem.
Die Homepage von Ariel, Priesterin der Nacht war vollkommen schwarz mit liebesapfelroten Buchstaben und einem großen Bild von Ariel. Sie wirkte relativ jung, vielleicht so alt wie ich – Mitte zwanzig. Sie hatte blasse Haut, einen Porzellanteint, schwarz gefärbte Haare, die ihr in verschwenderischen Wellen über die Schultern fielen, und strahlend blaue Augen, die von schwarzem Eyeliner umrandet waren. Dieses Blau – das mussten Kontaktlinsen sein. Zwar schien sie sich in einem Radiostudio zu befinden, doch aus irgendeinem Grund war der Tisch vor ihr mit rotem Samt überzogen, auf dem sie sich verführerisch rekelte. Ihr schwarzes Satinkleid ließ ziemlich tief blicken, und sie beugte sich über ein Mikrofon, als wolle sie es im nächsten Moment ablecken. Um den Hals trug sie ein Pentagramm an einer Kette, je ein silbernes Anch-Kreuz an den Ohren und einen Strassstein als Nasenpiercing. In den vier Ecken der Internetseite flatterten Zeichentrickfledermäuse.
Und als ob das nicht schon ausreichen würde, um mich in den Wahnsinn zu treiben, war da noch die Kennmelodie der Sendung: »Bela Lugosi’s Dead« von Bauhaus.
Nach ein paar Takten des Songs kam die Frau selbst live auf Sendung. Ihre Stimme war tief und erotisch, so verführerisch, wie es sich jede Femme fatale aus dem Film noir nur wünschen konnte. »Seid gegrüßt, Mitreisende durch die Dunkelheit. Es ist an der Zeit, den Schleier zwischen den Welten zurückzuziehen. Lasst mich, Ariel, Priesterin der Nacht, Eure Führerin sein beim Erkunden der Geheimnisse, Rätsel und Schatten des Unbekannten.«
Ach, komm schon!
»Vampire«, fuhr sie fort, wobei sie das Wort in die Länge zog und mit einem falschen britischen Akzent aussprach. »Sind sie Opfer einer Krankheit, wie es uns gewisse sogenannte Experten glauben machen wollen? Oder sind sie Auserwählte, die als untote Boten der Vergangenheit dienen? Ist ihre Unsterblichkeit lediglich eine biologische Besonderheit – oder ist sie eine mystische Berufung?
Ich habe hier im Studio einen ganz außergewöhnlichen Gast. Er hat sich bereit erklärt, sein Heiligtum zu verlassen, um sich heute Abend mit uns zu unterhalten. Gustaf ist der Vampirgebieter in einer US-amerikanischen Großstadt. Er hat mich aus Gründen der Sicherheit gebeten, nicht zu sagen, um welche Stadt es sich handelt.«
Natürlich würde sie das nicht sagen.
Ich schmollte ein wenig. Mir war es nie gelungen, einen Vampirgebieter als Gast in meine Sendung zu holen. Falls dieser Gustaf denn tatsächlich ein Gebieter war. Falls er überhaupt ein Vampir war.
»Gustaf, danke, dass du heute Abend hier bist.«
»Es ist mir ein Vergnügen.« Gustaf hatte eine tiefe, melodiöse Stimme, die klang, als werde er im nächsten Moment über einen Witz lachen, den er jedoch nicht mitzuteilen gedachte. Sehr geheimnisvoll.
»Hm, darauf möchte ich wetten«, schnurrte Ariel. »Sag mal, Gustaf, wann bist zu zum Vampir geworden?«
»Im Jahr 1438. Es geschah in den Niederlanden, heute von den Leuten auch Holland genannt. Eine sehr gute Zeit und ein sehr guter Ort. So viel Handel, Verkehr, Kunst, Musik – so viel Leben. Ich war ein junger Mann, aussichtsreich, voller Lebensfreude. Dann traf ich … sie.«
Ach ja, sie. Typische Dunkle-Lady-der-Nacht-Kost. Sie war erlesen, besaß mehr Intelligenz und Weltklugheit als jede andere Frau, der er jemals begegnet war. Mehr Brillanz, mehr Schönheit, mehr was auch immer. Sie hatte sein Herz im Sturm erobert, bla bla bla, und hier war er nun, gute sechshundert Jahre später, und die ganze Zeit über hatten sie ein Spielchen aus Verführung und Chaos gespielt, das sich wie etwas aus einem Groschenroman anhörte.
Es war zweifellos eine Geschichte voll Gefahr und Spannung. Hier draußen, allein in einer Hütte im Wald, mit einem brennenden Feuer im Ofen und dem Wind, der draußen durch die Kiefern fuhr, hätte ich eigentlich wie Espenlaub zittern sollen.
Am liebsten würde ich Ariel einmal richtig Angst machen!
Das brachte mich auf eine Idee. Eine richtig miese Idee.
Ich holte mein Handy vom Schreibtisch. Dann wählte ich die Nummer, die sich mir dank Ariels ärgerlicher Stimme ins Gedächtnis gebrannt hatte.
»Ariel, Priesterin der Nacht«, sagte ein Mann, der ganz gewöhnlich und gar nicht geheimnisvoll klang.
»Hi«, sagte ich. O mein Gott, kein Besetztzeichen! Ich sprach mit jemandem. Würde ich tatsächlich in der Sendung landen?
»Kannst du mir bitte deinen Vornamen sagen und woher du anrufst?«
Mist, ich hatte das nicht ordentlich durchdacht. »Ähm, ja, klar. Ich heiße … Sue. Und ich komme aus … Albuquerque. «
»Und worüber möchtest du sprechen?«
Ja, worüber eigentlich? Mein Hirn hatte einen Aussetzer. Passierte so etwas, wenn jemand in meiner Sendung anrief? Schließlich übernahm mein großes Mundwerk die Führung. »Ich möchte mit Ariel über Angst sprechen«, sagte ich.
»Hast du Angst vor Vampiren?«, fragte mich der Typ, der das Vorgespräch führte.
»Sicher.«
»Na schön, dann mach bitte dein Radio aus und warte einen Moment.«
Scheiße. Verdammte Scheiße. Ich schaltete das Radio aus.
Statt Warteschleifenmusik wurde mir übers Telefon Ariels Sendung eingespielt, damit ich nichts verpasste.
Gustaf sprach über den inbegriffenen selbstlosen Edelmut, den der Vampirismus verlieh. »Man beginnt, sich in gewisser Weise als Verwalter der Menschheit zu betrachten. Wir Vampire sind selbstverständlich die mächtigeren Wesen. Doch wir sind, was unser Überleben anbelangt, von euch Menschen abhängig. Genauso wie die Menschheit gelernt hat, dass sie nicht folgenlos die Regenwälder vernichten oder die Ozeane zerstören kann, können wir nicht ungestraft die Menschheit beherrschen. Was wir zweifellos könnten, wenn wir nicht so pflichttreu wären.«
Die Menschen waren also nichts weiter als eine Horde vom Aussterben bedrohter Affen? Und das war’s? Nein, Vampire wären niemals in der Lage, die Weltherrschaft an sich zu reißen, weil sie generell viel zu selbstverliebt sind.
Schließlich machte Ariel die Ansage, auf die ich gewartet hatte: »Also gut, liebe Zuhörer, unsere Telefone sind jetzt geschaltet. Habt ihr eine Frage oder einen Kommentar für Gustaf? Jetzt ist die Gelegenheit dazu.«
Ich wollte unbedingt, dass Ariel mich in die Sendung holte, damit ich klarstellen konnte, welchen Mist der Typ verzapfte. Stattdessen wählte sie eine andere Anruferin. Eine schrecklich ehrfürchtige Frau meldete sich zu Wort.
»Oh, Ariel, danke, und vielen Dank, Gustaf, dass du dich mit uns allen unterhältst. Du weißt ja nicht, wie viel es bedeutet, solch einem alten und weisen Wesen wie dir zuzuhören. «
»Schon gut, meine Liebe, es ist mir ein Vergnügen«, sagte Gustaf gnädig.
»Ich begreife nicht, warum ihr – und damit meine ich sämtliche Vampire – nicht sichtbarer in Erscheinung tretet. Ihr habt so viel mit angesehen, ihr verfügt über solch einen großen Erfahrungsschatz. Wir könnten so viel von euch lernen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die Welt ein besserer Ort wäre, wenn wir Menschen unter der Führung von Vampiren ständen …«
Ariel mischte sich ein. »Willst du damit sagen, dass Vampire deiner Meinung nach gute Staatsoberhäupter abgäben? «
»Natürlich – sie haben den Aufstieg und Niedergang von Nationen mit angesehen. Sie wissen besser als jeder andere, was funktioniert und was nicht. Sie sind die idealen Herrscher.«
Großartig. Eine verdammte Monarchieanhängerin. Oh, was ich dieser Frau sagen würde, wenn sie in meiner Sendung wäre …
Ariel war unerträglich diplomatisch. »Du bist eine Frau mit traditionellen Werten. Ich kann nachvollziehen, weshalb zeitlose Wesen wie Vampire dich ansprechen.«
»Da die Welt zweifellos besser dran wäre, wenn Vampire das Sagen hätten – warum ist es dann nicht der Fall? Warum ergreifen sie nicht die Macht?«
Gustaf lachte glucksend, offensichtlich auf distanzierte, herablassende Weise belustigt. »Oh, das könnten wir ganz gewiss, wenn wir es denn wollten. Aber ich glaube, du unterschätzt, wie scheu die meisten Vampire sind. Wir mögen das grelle Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit ganz und gar nicht.«
Ach ja?
Ariel sagte: »Ich möchte jetzt zu unserer nächsten Anruferin übergehen. Hi Sue, du bist auf Sendung.«
Sue – das war ich. Wow, ich hatte es geschafft! Wieder auf Sendung – gewissermaßen jedenfalls. Ha! Also dann los …
»Hi Ariel. Vielen Dank, dass du meinen Anruf entgegengenommen hast.« Ich kannte meinen Text. Wie sich ein Fan anhörte, wusste ich. Ich hatte es schon oft genug von der anderen Seite aus gehört. »Gustaf, ich glaube nicht, dass alle Vampire unbedingt so sensibel und wohltätig sind, wie du behauptest. Sind sie Verwalter, die sich um die Regenwälder kümmern, oder Schäfer, die dafür sorgen, dass die Schafe gemästet und auf den Markt getrieben werden?«
Gustaf schnaubte ein wenig. »Jeder Vampir ist früher einmal ein Mensch gewesen. Die Besten von uns vergessen ihre Wurzeln niemals.«
Selbst wenn sie jene Wurzeln trocken saugen mussten … »Aber wenn man den schlimmsten Menschen die Macht und Unsterblichkeit eines Vampirs verleiht, was erhält man dann? Das Dritte Reich – und zwar für immer. Und wisst ihr, warum Vampire meiner Meinung nach noch nicht die Weltherrschaft an sich gerissen haben?«
Mein Gott, klang ich patzig! Ich hasste es immer, wenn solche Leute bei mir in der Sendung anriefen. Griesgrämige Besserwisser.
»Warum?«, fragte Ariel.
»Theatralik.«
»Theatralik?«, wiederholte Ariel. Sie klang belustigt, was mich ärgerte.
»Ja, genau, Theatralik. Das Posieren, das sich Zurechtmachen, die langatmigen Geschichten über romantische Liebe und Verführung, obwohl Gustaf hier in Wirklichkeit wahrscheinlich nichts als ein naiver Jüngling gewesen ist, der übers Ohr gehauen wurde. Man nehme all die kleinlichen, meuchlerischen Machtspielchen, die in jeder Gruppe ablaufen, und multipliziere sie mit ein paar Jahrhunderten – das Ergebnis sind Leute, die zu sehr damit beschäftigt sind, ihre eigenen Egos zu streicheln und ihren Ruf auf Hochglanz zu polieren, als dass sie je den Antrieb fänden, die Weltherrschaft an sich zu reißen.«
Gustaf sprach reserviert. »Bist du jemals einem Vampir begegnet?«
»Ich kenne den einen oder anderen«, sagte ich. »Und es sind Individuen, genau wie jeder andere auch. Was wahrscheinlich der wahre Grund ist, weshalb sie nicht die Weltherrschaft angetreten haben. Sie würden es einfach nicht schaffen, sich auf etwas zu einigen. Habe ich nicht recht, Gustaf?«
Ariel sagte: »Sue, du klingst ein klein bisschen verärgert über die ganze Angelegenheit. Warum denn?«
Mit der Frage hatte ich nicht gerechnet. Eher hatte ich erwartet, dass sie längst zum nächsten Anrufer übergegangen wäre. Aber nein, sie war dabei nachzubohren. Sodass ich vor der Entscheidung stand: Sollte ich die Frage beantworten? Oder Schluss machen? Was würde sie mehr wie eine Idiotin aussehen lassen, ohne dass ich selbst wie eine wirkte?
Auf einmal wurde mir klar: Ich hasste es, an diesem Ende der Radiosendung zu sitzen. Doch ich konnte jetzt nicht aufhören.
»Verärgert? Nein, bin ich nicht. Das hier hat nichts mit Ärger zu tun. Sondern mit Sarkasmus.«
»Aber mal im Ernst.« Ariel ließ nicht locker. »Unsere letzte Anruferin verehrt Vampire geradezu. Warum bist du so wütend?«
Weil ich mitten im Wald festsaß und niemandem außer mir selbst die Schuld daran geben konnte. Weil ich irgendwann die Kontrolle über mein Leben verloren hatte.
»Ich bin die Klischees leid«, sagte ich. »Ich bin es leid, dass so viele Menschen den Klischees aufsitzen.«
»Aber du hast keine Angst vor Vampiren. Diese Wut rührt nicht von Furcht her.«
»Nein«, sagte ich. Ich hasste die Unsicherheit in meiner Stimme. Natürlich wusste ich nur zu gut, wie gefährlich Vampire sein konnten, besonders wenn man einem persönlich in einem dunklen Zimmer über den Weg lief. Ich hatte es selbst erlebt. Sie rochen gefährlich. Und diese Frau hatte nichts Besseres zu tun, als für einen zu werben, als sei er ein verfluchter Menschenfreund.
»Wovor hast du dann Angst?«
Davor zu verlieren. Ich hatte Angst zu verlieren. Sie hatte ihre Sendung, und ich nicht. Eigentlich sollte ich die schwierigen Fragen stellen. Meine Antwort lautete: »Ich habe vor gar nichts Angst.«
Dann legte ich auf.
Ich schaltete das Radio aus, und es wurde still in der Hütte. Ein Teil von mir wollte es wieder einschalten und hören, was Ariel über meinen – beziehungsweise Sues – jähen Abgang zu sagen hatte und was Gustaf sonst noch über den angeborenen Edelmut von Vampiren von sich gab. Doch ich verhielt mich endlich einmal vernünftig und ließ das Radio aus. Ariel und Gustaf sollten miteinander glücklich werden.
Ich wollte schon das Handy wegwerfen, ließ es jedoch erstaunlicherweise bleiben. Ich war zu müde.
Angst. Wer war sie schon, dass sie mir unterstellen konnte, ich hätte Angst? Sie war diejenige mit der Radiosendung. So einfach war das.
Ich konnte nicht schlafen. Ein Teil von mir war ganz aus dem Häuschen vor Schadenfreude über den machtvollen Hieb, den ich meiner Konkurrenz versetzt hatte. Hm, machtvoller Hieb oder unbedeutender Streich? Ich hatte mich wie ein Kind aufgeführt, das mit Steinen nach dem Spukhaus wirft, und Ariel noch nicht einmal aus dem Konzept gebracht. Das nächste Mal würde ich es besser machen.
In Wirklichkeit sah es so aus, dass ich mittlerweile zu Scherzanrufen gezwungen war, gefolgt von Schlaflosigkeit.
Rennen. Ich sollte Rennen gehen.
Ruhelosigkeit weckte Verlangen. Die Wölfin war wach und wollte sich nicht besänftigen lassen. Los, los …
Nein.
Normalerweise passierte Folgendes: Ich konnte nicht schlafen, und der nächtliche Wald lockte. Wenn ich erst einmal ein paar Stunden lang auf vier Beinen herumgerannt war, wäre ich gewiss so erschöpft, dass ich wie eine Tote schlief. Außerdem würde ich nackt im Wald aufwachen und wäre wütend auf mich, weil ich es so weit hatte kommen lassen. Ich hatte das Sagen, nicht jene andere Seite meiner selbst.
Ich schlief in Jogginghose und Trägertop. Die Luft war trocken durch die Hitze und den Aschegeruch des Ofens. Kalt war mir zwar nicht, doch ich kuschelte mich in meine Decke und wickelte sie mir fest um die Schultern. Dann zog ich mir ein Kissen über den Kopf. Ich musste einschlafen.
Vielleicht gelang es mir sogar ein oder zwei Minuten. Vielleicht hatte ich geträumt, doch ich konnte mich nicht daran erinnern. Im Gedächtnis geblieben war mir nur, dass ich mich durch Watte bewegte, versuchte, mir mit den Krallen einen Weg aus einem Labyrinth aus Fasern zu bahnen, weil etwas nicht stimmte, ein Geruch in der Luft, ein Geräusch, das nicht hierhergehörte. Obwohl ich nichts als den Wind in den Bäumen und gelegentlich das Knacken trockenen Holzes im Ofen hätte hören sollen, war da noch etwas anderes … raschelnde Blätter, Schritte.
Ich träumte davon, wie eine Wölfin durch totes Laub auf dem Waldboden trabt. Sie ist auf der Jagd, und sie ist sehr gut. Sie hat das Kaninchen beinahe erreicht, bevor es davonstürzt. Es macht nur einen einzigen Satz, da springt sie darauf zu, beißt es, und es schreit, während es im Sterben liegt …
Das Schreien des Kaninchens war ein schreckliches, hohes, herzzerreißendes, teekesselhaftes, pfeifendes Kreischen, das niemals von so einem liebenswerten flaumigweichen Wesen ausgestoßen werden sollte.
Ruckartig setzte ich mich mit rasend klopfendem Herzen kerzengerade auf, sämtliche Nerven zum Zerreißen gespannt.
Das Geräusch hatte nur eine Sekunde gedauert, nun herrschte wieder Stille. Es war direkt vor meiner Haustür gewesen. Ich rang keuchend nach Atem und lauschte: der Wind in den Bäumen, zischende Glut im Ofen.
Ich schlug die Decke zurück und stieg aus dem Bett.
Leise, barfuß auf dem Holzboden, ging ich ins Vorderzimmer. Mein Herzschlag wurde einfach nicht langsamer. Vielleicht müssen wir davonlaufen, vielleicht müssen wir kämpfen. Ich krümmte die Finger, spürte unsichtbare Krallen. Wenn es sein musste, konnte ich mich verwandeln. Ich konnte kämpfen.
Durch das Fenster hielt ich nach Bewegungen Ausschau, nach Schatten. Ich erblickte lediglich die Bäume jenseits der Lichtung, dunkle Gestalten mit einem Rand aus silbernem Mondschein. Langsam atmete ich ein, um die Gefahr vielleicht wittern zu können, doch der Geruch des Ofens war stärker als alles andere.
Ich berührte die Klinke der Haustür. Eigentlich sollte ich bis zum Morgen warten, bis die Sonne schien und es sicher war. Doch etwas hatte auf meiner Veranda geschrien. Vielleicht hatte ich es bloß geträumt.
Ich machte die Tür auf.
Da lag es vor mir. Der Geruch von Blut und Galle schlug mir entgegen. Das Ding roch, als sei es ausgeweidet worden. Das Kaninchen lag ausgestreckt da, den Kopf zurückgeworfen, sein Fell an Kehle und Bauch war dunkel, verfilzt und aufgerissen. So wie es roch, hätte es eigentlich in einer Blutlache liegen müssen. Es roch noch nicht einmal nach Kaninchen – bloß nach Eingeweiden und Tod.
Meine Nase juckte, meine Nasenflügel bebten. Ich – die Wölfin – konnte Blut riechen, das dickflüssige Blut eines Tieres, das an tiefen Verletzungen gestorben war. Ich wusste, wie das roch, weil ich selbst schon Kaninchen solche Schäden zugefügt hatte. Das Blut war vorhanden, bloß nicht an dem Kaninchen.
Ich öffnete die Tür ein Stück weiter und betrachtete sie.
Jemand hatte mit Blut ein Kreuz auf die Außenseite meiner Haustür gemalt.
Drei
Ich ging nicht mehr zurück ins Bett. Stattdessen legte ich zwei frische Scheite in den Holzofen, stocherte im Feuer herum, bis es hell aufloderte, wickelte mich in eine Decke und machte es mir auf dem Sofa bequem. Ich wusste nicht recht, was ich schlimmer fand: Dass jemand ein Kreuz aus Blut auf meine Tür gemalt hatte, oder dass ich keine Ahnung hatte, wer dahinter steckte. Ich hatte nichts gesehen, nach dem Todesschrei des Kaninchens nichts mehr gehört oder auch nur eine Spur Pfefferminzbonbon geschnuppert. Außerdem konnte ich mich nicht erinnern, ob ich den Kaninchenschrei nur geträumt oder ob ich ihn tatsächlich gehört hatte. Ob er echt gewesen und einen Weg in meinen Traum gefunden hatte, oder ob mein Unterbewusstsein ihn sich ausgedacht hatte. So oder so hatte jemand das Kaninchen getötet, meine Tür mit Blut beschmiert und war dann verschwunden.
Sobald es dämmerte, rief ich bei der Polizei an.
Zwei Stunden später saß ich im Schneidersitz auf der Veranda – auf der anderen Seite, so weit wie möglich von dem Kaninchen entfernt – und sah zu, wie der Bezirkssheriff und einer seiner Deputys die Tür, die Veranda, das tote Kaninchen und die Lichtung untersuchten. Sheriff Avery Marks war ein erschöpft wirkender Mann mittleren Alters mit schütteren braunen Haaren, einer frischen Uniform sowie einem großen Parka darüber. Seine Untersuchung bestand darin, dass er etwa fünf Minuten lang auf der Veranda stand und sich die Tür ansah, dann neben dem Kaninchen in die Hocke ging und es etwa fünf Minuten lang anstarrte, und dass er, die Hände in die Hüften gestemmt, auf dem Waldboden stand und die ganze Szene etwa zehn Minuten lang betrachtete. Sein Deputy, ein bärtiger Typ um die dreißig, wanderte um die ganze Hütte und die Lichtung davor, den Blick gebannt auf den Boden gerichtet, schoss Fotos und schrieb etwas auf einen Notizblock.
»Sie haben nichts gehört?«, fragte Marks zum dritten Mal.
»Ich dachte, ich hätte das Kaninchen schreien gehört«, sagte ich. »Aber ich habe noch geschlafen. Oder war im Halbschlaf. Ich erinnere mich nicht wirklich daran.«
»Sie sagen, Sie können sich nicht daran erinnern, ob Sie etwas gehört haben?« Er klang verärgert über meine Antworten, was ich ihm nicht verübeln konnte.
»Ich dachte, ich hätte etwas gehört.«
»Gegen wie viel Uhr war das?«
»Ich weiß es nicht. Ich habe nicht auf die Uhr gesehen.«
Er nickte wissend. Ich hatte keine Ahnung, welchen Schluss er aus dieser Information gezogen haben könnte.
»Die Sache sieht mir nach einem Streich aus«, sagte er.
Ein Streich? Das Ganze war nicht lustig. Kein bisschen. »Würde jemand hier in der Gegend so etwas lustig finden?«
»Ms Norville, ich sage das nur ungern, aber Sie sind berühmt genug, um Zielscheibe für solche Dinge zu sein.«
Ach ja? »Was werden Sie also unternehmen?«
»Halten Sie die Augen offen. Wenn Sie etwas Verdächtiges bemerken, wenn Sie jemanden hier herumstreichen sehen sollten, dann lassen Sie es mich wissen.«
»Werden Sie denn gar nichts tun?«
Er musterte mich und schenkte mir das herablassende Stirnrunzeln, das Fachleute sich für unaufgeklärte Laien aufsparten. »Ich werde mich mal umhören, werde ein paar Nachforschungen anstellen. Das hier ist eine kleine Gemeinde. Es wird schon etwas dabei herauskommen.« Er wandte sich an den ernsthaften Deputy. »Hey, Ted, vergiss auf keinen Fall, Fotos von den Reifenspuren zu machen.« Er deutete auf die Spuren, die von meinem Wagen wegführten.
Ich setzte nicht gerade mein ganzes Vertrauen in diesen Mann.
»Wie – wie soll ich das alles sauber kriegen?«, fragte ich. Ich war dankbar, dass Winter war. Der Geruch war nicht allzu erdrückend, und Fliegen gab es auch keine.
Er zuckte mit den Schultern. »Mit dem Schlauch abspritzen? Das Ding vergraben?«
Es war, als spräche ich mit einer Backsteinmauer.
Im Haus klingelte mein Handy, ich konnte es von der Veranda hören. »Es tut mir leid, aber ich sollte rangehen.«
»Machen Sie das. Ich gebe Ihnen Bescheid, sobald ich etwas herausfinde.« Marks und sein Deputy gingen auf ihren Wagen zu und ließen mich mit dem Blutbad allein. Ihre unmittelbar bevorstehende Abfahrt ließ in mir ein eigenartiges Gefühl der Erleichterung aufsteigen.
Ich machte einen Bogen um das Kaninchen, schaffte es durch die Tür, ohne das Blut zu berühren, und griff nach dem Telefon. Die Anruferkennung verriet mir, dass es sich um Mom handelte. Ihr allwöchentlicher Anruf. Sie hätte sich einen günstigeren Zeitpunkt aussuchen können. Seltsamerweise hatte ich auf einmal jedoch das starke Verlangen, ihre Stimme zu hören.
»Hi«, sagte ich, als ich an den Apparat ging. Ich klang ziemlich kläglich. Mom würde gleich wissen, dass etwas nicht stimmte.
»Hi Kitty. Hier spricht deine Mutter. Wie geht es dir?«
Wenn ich ihr erzählte, was genau passiert war, wäre sie entsetzt. Dann würde sie verlangen, dass ich bei ihr und Dad wohnte, in Sicherheit, obwohl ich das nicht konnte. Ich hatte es eine Million Mal erklärt, als ich ihr letzten Monat gesagt hatte, dass ich über Weihnachten nicht nach Hause käme. Mir blieb keine andere Wahl: Das Rudel in Denver hatte mich in die Verbannung geschickt. Sollte ich zurückkehren, und sie fänden es heraus, würden sie mich vielleicht nicht mehr fort lassen. Jedenfalls nicht ohne Kampf. Ohne einen großen Kampf. Mom ließ dennoch nicht locker. »Wir wohnen in Aurora«, sagte sie. »Aurora ist nicht Denver, dafür hätten sie doch bestimmt Verständnis. « Genau genommen hatte sie recht, Aurora war ein Vorort, doch was das Rudel anbelangte, war alles in einem Radius von hundert Meilen Denver.
Ich musste versuchen, das Gespräch kurz zu halten. Ohne direkt zu lügen. Verdammt.
»Ach, mir ging’s schon mal besser.«
»Was ist los?«
»Mit dem Buch läuft es nicht so gut, wie ich möchte. Allmählich
Titel der amerikanischen Originalausgabe
KITTY TAKES A HOLIDAY
Deutsche Übersetzung von Ute Brammertz
Deutsche Erstausgabe 06/2009
Redaktion: Sabine Thiele
Copyright © 2006 by Carrie Vaughn
Copyright © 2009 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH Satz: Christine Roithner Verlagsservice, Breitenaich
eISBN 978-3-641-06353-5
www.heyne-magische-bestseller.de
www.randomhouse.de
Leseprobe





























