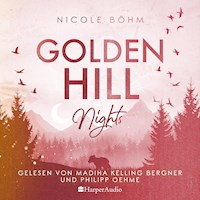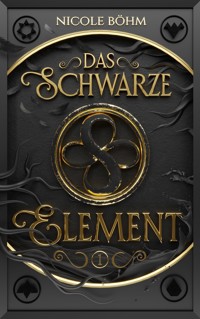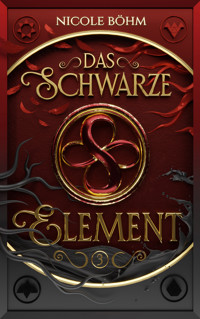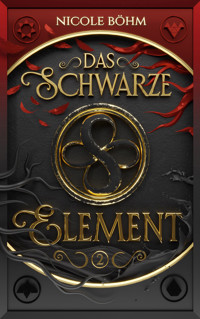Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Arkani Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Die Chroniken der Seelenwächter
- Sprache: Deutsch
Gewinner des Deutschen Phantastik Preises 2017 als "Beste Serie"! Gewinner des Deutschen Phantastik Preises 2016 als "Beste Serie"! Ein Vermächtnis aus tiefster Vergangenheit stürzt das Leben von Jess ins Chaos. Als ein magisches Ritual anders endet als erwartet, wird sie nicht nur mit den gefährlichen Schattendämonen konfrontiert, auch die geheime Loge der Seelenwächter greift in ihr Leben ein. Als wäre das nicht genug, scheint ihre Familiengeschichte direkt mit dem ewigen Kampf zwischen Licht und Schatten verknüpft. Magie, Mystery, gefährliche Rätsel und eine dramatische Liebe definieren den ewigen Kampf zwischen den Seelenwächtern und den Schattendämonen. Nicole Böhm verknüpft uralte Sagen mit Ereignissen der Gegenwart. Dies ist der 1. Roman aus der Reihe "Die Chroniken der Seelenwächter". Empfohlene Lesereihenfolge: Bände 1-12 (Staffel 1) Die Archive der Seelenwächter 1 (Spin-Off) Bände 13-24 (Staffel 2) Die Archive der Seelenwächter 2 (Spin-Off) Bände 25-36 (Staffel 3) Bände 37-40 (Staffel 4) Das schwarze Element (die neue Reihe im Seelenwächteruniversum) Bände 1-7
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 174
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
1. Kapitel4
2. Kapitel9
3. Kapitel17
4. Kapitel23
5. Kapitel30
6. Kapitel32
7. Kapitel37
8. Kapitel46
9. Kapitel50
10. Kapitel53
11. Kapitel62
12. Kapitel66
13. Kapitel70
14. Kapitel72
15. Kapitel79
16. Kapitel84
17. Kapitel89
18. Kapitel98
Die Lesereihenfolge von der Serie »Die Chroniken der Seelenwächter«108
Die Fortsetzung der Seelenwächter:109
Impressum110
Die Chroniken der Seelenwächter
Die Suche beginnt
Von Nicole Böhm
Für meinen Mann Andreas,
der meine Worte das Laufen lehrte.
Und für Sarah,
die Jaydee aus meiner Gefangenschaft befreite.
1. Kapitel
Jaydee
Ich rannte durch den Park. Der Kies knirschte unter meinen Stiefeln, das Adrenalin peitschte in meinen Adern und schwemmte meine Hemmschwelle davon. Mein Blut war in Aufruhr wie die See bei einem Orkan. Ich atmete ein, schwelgte in Euphorie, Vorfreude, der Gewissheit, dass mir nichts und niemand entkommen konnte. Der Jäger kontrollierte mich längst und stärkte meine Sinne. Ich hörte die Käfer im Gras kriechen, roch den süßlich-herben Duft der Akazienbäume, spürte das Prickeln des Morgens auf meiner Haut. Es gab mir mit jedem Atemzug, mit jedem Herzschlag neue Kraft. Für die Zeit der Jagd fühlte ich mich lebendig; frei, als wäre es genau das, wofür ich erschaffen wurde.
Ich sah zum Himmel. In etwa einer Stunde löste der Tag die Nacht ab, und in den Morgenstunden war der Park bei Joggern besonders beliebt. Wenn ich ungestört mit meiner Beute bleiben wollte, sollte ich mich beeilen.
Eine Duftnote streifte mich wie die Berührung einer Frau in einer Bar; scheu, aber mit der festen Absicht, mich in ihr Territorium zu locken. Ich stoppte, blickte zur Eiche, die einsam auf einer Wiese thronte. Oh bitte, sie hatte sich nicht ernsthaft hinter diesem Baum versteckt. Ich hasse dumme Beute. Das war wie Sex ohne Höhepunkt: absolute Zeitverschwendung.
Ich bog vom Weg ab und schlich über die Wiese, die nach Morgentau duftete. Die Beleuchtung reichte nicht aus, um diesen Teil aufzuhellen, was nichts machte, denn selbst im Halbdunkel erkannte ich noch die Adern der Blätter an den Bäumen, die Ameisen, die durchs Gras wuselten oder die Läuse in den Büschen. Der Geruch meiner Beute wurde intensiver, je näher ich der Eiche kam. Sie saß tatsächlich dahinter und glaubte, sich verstecken zu können. Unfassbar. Ich legte eine Hand auf den Baumstamm, ließ meine Fingerspitzen über das Holz gleiten. Auf der Jagd zog ich stets fingerlose Lederhandschuhe an, damit ich die Energie der Dinge, die ich anfasste, direkt aufnehmen konnte. Ich sog die Stärke des Baumes in mich, während ich ihn umrundete. Vor meinem geistigen Auge sah ich die Pärchen, die unter seinen Ästen Schatten gesucht hatten; Studenten, die schwatzten, lernten, plauderten, stritten. Und schließlich sah ich meine Beute, die hinter der Eiche kauerte und mich anstarrte. Sie schnaufte schwer. Einige blonde Strähnen hatten sich aus ihrem Zopf gelöst und klebten feucht in ihrem Gesicht. Ich hatte sie in der letzten Stunde vom Restaurant am See einmal quer durch den Park und bis an ihre Grenzen getrieben. Ihre Haut schimmerte blass im kargen Mondlicht. Ich schätzte, sie war um die zwanzig. Sie trug Sportkleidung, als käme sie gerade vom Joggen. Nette Tarnung, doch die würde ihr nichts nützen. Sie krallte die Nägel in die Rinde und erkannte, was für ein schlechtes Versteck sie sich gesucht hatte. Sie würde keine Gelegenheit haben, aus ihrem Fehler zu lernen.
»Was … was willst du von mir?« Ernsthaft? Sie fragte, was ich von ihr wollte? Ihre Stimme klang sanft, weinerlich; die letzten Versuche, mich weichzuklopfen. Sie kramte hektisch in ihren Taschen, zog ein paar Scheine hervor. »Hier, nimm. Das ist alles, was ich bei mir habe. Warte! Den kannst du auch haben.« Sie riss einen Ring vom Finger und warf ihn mir ebenfalls vor die Füße, während sie langsam vor mir zurückwich.
Erbärmlich, wie sie um ihr Leben feilschte. Ich ging langsam auf sie zu. Sämtliche Farbe wich aus ihrem Gesicht, als sie merkte, dass ich nicht auf ihr Geheule einging. Sie musterte mich, ihr Blick blieb in meinem Schritt haften. Jetzt machte sie sich wirklich lächerlich. Ich hatte mich noch nie einer Frau aufgedrängt und gewiss nicht vor, heute damit anzufangen. Ich folgte ihr im gleichen Tempo, in dem sie vor mir davonschlich.
Sie wurde blass vor Panik. »Hilfe! Feuer!«
»Feuer? Im Ernst?« Die Unfähigkeit meiner Beute verdarb mir den Geschmack an der Jagd. Ich sollte es rasch beenden, anstatt weiter mit ihr zu spielen.
»Ich werde überfallen. HILFE!« Sie drehte sich um, wollte abhauen, aber ich war schneller, packte ihren Pferdeschwanz und zerrte sie mit einem kräftigen Ruck von den Füßen. Sie schrie auf, knallte mit dem Rücken auf die Wiese und hustete sich die Lunge aus dem Leib. Was für eine Theatralik. Breitbeinig stellte ich mich über sie und ließ mich gemächlich auf ihr nieder. Sie wimmerte. Wirklich schade, dass ich nichts für Dramen übrig hatte.
»Du könntest deinen Spaß mit mir haben und mich gehen lassen. Ich schreie auch nicht. Versprochen.«
Ich schluckte den Zorn hinunter und klemmte ihre Hände mit den Knien fest. Wenn sie noch einmal mit diesem Thema anfing, würde ich ihr die Zunge herausschneiden. Ich beugte mich nach vorne, berührte mit der Nasenspitze fast ihre Haut. Jetzt roch sie nach Schweiß und Angst. Gut so. Ich strich mit dem Zeigefinger über ihre Wange. Es kribbelte auf meiner Haut, als mich ihre Emotionen trafen: Eine Träne kullerte ihre Wange hinab. Ich strich sie mit dem Daumen weg, suchte in den Abgründen meiner Seele nach etwas wie Mitleid für sie. Ich fand es nicht.
»Wie heißt du?«
»Jo … Joanne.«
»Mhm, ein guter Name. Weißt du, was er bedeutet, Joanne?«
Sie schüttelte den Kopf.
Ich beugte mich nach vorne, strich mit meinen Lippen über ihr Ohr und flüsterte: »Es bedeutet, dass Gott dir gnädig ist. Ziemlich paradox, findest du nicht?«
Sie atmete hektischer. Ihr Brustkorb drückte gegen meine Beine. »Lass mich bitte gehen. Ich hab dir doch nichts getan.«
Mir nicht, das stimmte. Ich griff in meinen Stiefel und zog den Dolch aus seiner Halterung. Sie versuchte, sich zu befreien, wand sich, schrie. Ich verpasste ihr eine Ohrfeige, der kurze Adrenalinkick, den ich dadurch bekam, war berauschend. Es war so überaus befriedigend, anderen Leid zuzufügen. Und so überaus verboten.
»Bitte nicht.« Ihre Stimme brach in ein gequältes Flüstern. Ich strich ihr mit der Klinge über die Wange bis hinunter zu ihrer Kehle. Der Puls jagte unter ihrer Haut, ich hörte jeden einzelnen Herzschlag. Bawumm, Bawumm … Ein Zeichen für das Leben in ihr, obwohl es widersprüchlich war. Ich setzte mein Messer direkt auf ihren Kehlkopf.
»Ich habe Geld. Viel Geld. Ich könnte dafür sorgen, dass du …«
Ich knallte ihr den Griff des Messers auf die Nase. Sie schnappte nach Luft, schluckte hektisch, als ihr das Blut in den Rachen lief. Wenn ich könnte, würde ich stundenlang so weitermachen. Ich drückte die Dolchspitze erneut auf ihren Kehlkopf.
Joanne wimmerte. »Ich bin zu jung zum Sterben.«
»Du bist doch schon längst tot.« Gerade als ich den Schnitt ansetzen wollte, hörte ich Schritte auf mich zukommen. Sekunden später blickte ich in das grelle Licht einer Taschenlampe.
»Gehen Sie von der Frau runter!« Ein Parkwächter stand vor mir und hielt eine Glock auf mich gerichtet. Mist, ich hätte mir ein ruhigeres Plätzchen suchen sollen.
»HILFE! Bitte helfen Sie mir«, schrie Joanne, versuchte den Kopf zu drehen, um den Parkwächter anzublicken.
»Keine Sorge, Miss, okay? Es wird Ihnen nichts geschehen.«
Ich blickte knapp neben dem Strahl der Lampe vorbei. Der Wachmann streckte die Schultern durch, was dazu führte, dass sein fetter Bauch über den Hosenbund quoll. In der Silhouette sah er aus wie eine Boje, und er zitterte so heftig, als würde er tatsächlich auf dem Meer treiben.
»Sie la-sse … sie lassen sofort die Frau los.«
»Sonst was? Erschießt du mich? Hast du überhaupt eine Patrone im Lauf?«
Der Wachmann fummelte am Schlitten seiner Glock, versuchte ihn zurückzuziehen, um die Kugel zu laden. Was für ein Idiot.
»Ich zähle bis drei. Eins …«
Ich hörte ein metallenes Klacken, als die Patrone in den Lauf glitt. Immerhin hatte er das hinbekommen. Mal sehen, ob er auch mit der Waffe umgehen konnte.
»Zwei …«
War ich schnell genug, Joanne zu töten und den Wachmann aufzuhalten?
»D-d-drei.«
Ich knurrte und drückte die Klinge tiefer in Joannes Haut. Sie schrie. In dem Moment fiel der erste Schuss. Ich duckte mich, fühlte einen beißenden Schmerz an der Schulter. Der Idiot hatte mich tatsächlich getroffen. Warmes Blut sickerte aus der Wunde, aber mein Körper würde gleich heilen. Joanne riss ein Knie hoch, rammte es mir mit Wucht in die Weichteile. Ich fluchte und taumelte. Die Mistkröte hatte Kraft.
Sie rollte sich unter mir weg, ich griff nach ihr, da feuerte der Wachmann ein zweites Mal. Diesmal zischte die Kugel haarscharf an meinem Kopf vorbei. Ich ließ Joanne abhauen, warf mich mit einem Satz auf den Wachmann und landete in einem Pool aus Angst. Sie war so stark in ihm, dass sie alle anderen Gefühle überdeckte und ich aufpassen musste, nicht selbst davon beeinflusst zu werden. Er landete auf dem Rücken, ich direkt neben ihm in der Hocke. Während Joanne wie ein Hase auf der Flucht über die Wiese raste, rollte der Wachmann herum und zog seinen Schlagstock vom Gürtel. Ich duckte mich, sein Hieb ging ins Leere.
»Jetzt hab ich echt die Faxen dicke«, sagte ich, nahm ihm den Schlagstock weg und drosch ihm damit auf die Lippen.
Er schrie auf, griff an seinen Mund, versuchte die Blutung zu stillen.
»Wie heißt du?«
Mit der freien Hand fuhr er an sein Funkgerät. Bevor er die erste Taste drücken konnte, riss ich ihm das Ding aus den Knubbelfingern und zerrte ihn in die Höhe. Er stank nach Knoblauch und Zigaretten. Ich versuchte es zu ignorieren, verdrehte den Arm auf seinem Rücken, damit er sich nicht mehr wehren konnte. Er keuchte auf. Der Schweiß rann ihm den Nacken hinab, sein Hemd wurde patschnass.
»Also noch mal: Wie heißt du?«
»Edward. Edward Shoemaker.«
»Okay, Edward Shoemaker, das läuft folgendermaßen: Ich werde deine Erinnerung an dieses schöne Ereignis löschen, du gehst nach Hause zu deiner Frau. Du hast doch eine Frau, oder trägst du den Ring nur zur Deko?«
Er schüttelte den Kopf, dann nickte er. »Ich habe eine Frau.«
Ich beugte mich näher zu ihm, griff in den Beutel in meiner Jackentasche und nahm eine Handvoll Federnstaub heraus.
»Sieh mich an!«, blaffte ich. Er reagierte mehr aus Reflex denn aus Überlegung. Ich pustete ihm den Staub ins Gesicht und strich mit den Fingern über seine Hand, um meine Suggestion zu verstärken. »Geh nach Hause. Erzähl deiner Holden, dass du dir heute Nacht eine Schlägerei mit Jugendlichen geliefert und dabei eine abbekommen hast. Trag’ so dick wie nötig auf, beeindrucke sie. Danach habt ihr beide euren Spaß und du fühlst dich gigantisch dabei. Du hast für Recht und Ordnung gesorgt. Du bist ein Held, Kumpel.« Sein Widerstand bröckelte. Die Muskeln lockerten sich. Der Federnstaub entfaltete seine Wirkung. »Hast du alles verstanden?«
Er nickte so heftig, dass sein Schwabbelkinn Wellen schlug. Ich klopfte ihm auf die Schulter, schickte ihm mit meiner Berührung Ruhe und Vertrauen. Emotionen flossen immer in zwei Richtungen. Ich konnte geben und nehmen. »So ist’s brav.« Ich ließ ihn los und hob meinen Dolch auf. »Ach ja, lass die Qualmerei und such dir ’nen anderen Job. Beides wird dich frühzeitig ins Grab befördern.«
Ich wandte mich ab und folgte der Spur von Joanne. Im Laufen steckte ich den Dolch zurück in meinen Stiefel. Ich hatte dem Jäger ein Opfer versprochen. Er sollte es bekommen.
2. Kapitel
Jessamine
Mit einem Rums fiel die Tür hinter mir ins Schloss. Das Echo hallte von den hohen Wänden, wie ein Dutzend Kanonenschüsse. Ich japste und zog automatisch den Kopf ein, als könnte mich das Geräusch umnieten. Hastig bekreuzigte ich mich, obwohl ich nicht einmal gläubig war. Aber schaden konnte es nicht, immerhin war ich in die Spukkirche eingebrochen, die seit Jahren leer stand und in die sich höchstens noch Ungeziefer oder arme Irre verirrten. So wie ich …
Einige Sekunden später herrschte wieder Stille.
Fast.
Der Wind pfiff durch die zahlreichen Löcher in der Decke, in den Ecken raschelte es. Vermutlich von den Mäusen, die eilig ein Plätzchen suchten, um sich zu verstecken. Ich hätte mich am liebsten mit ihnen verkrochen, aber jetzt war ich hier und würde das durchziehen.
Ich drehte mich noch einmal zur Tür, drückte die Klinke, nur um sicherzugehen, dass ich nicht eingesperrt war. Sie ließ sich öffnen. Natürlich. Die Kirche war schließlich kein Gefängnis. Nur ein Ort, der Menschen in den Wahnsinn treibt. Das Metall der Klinke schmiegte sich kalt gegen meine Haut. Meine Finger schlossen sich fester um den Griff, als wäre er mein letzter Anker in die Realität. Noch war es nicht zu spät. Noch konnte ich umkehren, ohne Schaden angerichtet zu haben. Bei der Menge des Schlafmittels, das ich Violet in den Tee geschüttet hatte, schlummerte sie ganz sicher noch, und Ariadne weckte nicht mal eine Marschkappelle, die vor ihrem Fenster für das nächste Konzert probte. Ich drückte die Tür einen Spalt auf. Der Duft nach Moder und Staub wehte mir entgegen. Es war ganz einfach. Ich laufe durch den Gang zurück, verlasse das Gebäude übers Büro, nehme wieder ein Taxi und fahre nach Hause.
»Nach Hause.« Die Worte schmeckten schal, wie abgelutschter Kaugummi. Es war kein Zuhause mehr, nachdem, was Ariadne getan hatte. Ich ließ die Klinke los, drehte mich um und lief tiefer in die Kirche.
Der Schutt knirschte unter meinen Stiefeln. Ein tröstliches Geräusch; so als wäre ich nicht mutterseelenallein, sondern in Begleitung hier. Der Vollmond spitzelte durch die Löcher im Dach. Sein Schein genügte nicht, damit ich etwas erkennen konnte, also zog ich die Taschenlampe aus der Seitentasche meines Rucksacks und knipste sie an. Staubpartikel tanzten im Strahl meiner Lampe wie Konfetti. Ich leuchtete in die Dunkelheit, scannte die Wände, den Boden, die Rundbögen. Das künstliche Licht wirkte wie ein Störenfried, der einen mitten in der Nacht aus dem Bett schmiss und die Festbeleuchtung anknipste. Die Statuen und alle heiligen Insignien waren entfernt worden, die Kirche entweiht. Das Gemäuer war wie ein ausgeweidetes Tier, das man zum Verrotten zurückgelassen hatte.
Dort, wo der Brandherd gewesen war, klebte Ruß an den Wänden. An einer Stelle waren die Marmorfließen im Boden gesplittert, wie Hitzerisse in einer ausgedörrten Wüste. Hier war es wohl geschehen. Hier musste die Statue umgefallen sein, die den Pfarrer unter sich begraben und getötet hatte. Ich konnte mich noch gut an den Brand erinnern, obwohl ich erst neun Jahre alt gewesen war. Meine Mum war danach zu Tode erschüttert gewesen. Sie hatte den Pfarrer gekannt und war mit mir, als ich klein war, einige Male in seinem Gottesdienst gewesen.
Mich schüttelte es trotz der Bullenhitze. Ich atmete tief ein. Statt nach verbranntem Fleisch und Tod roch es mittlerweile nach Dreck und Staub. Der Duft, der alten Gebäuden anhaftete, in die sich keine Menschenseele mehr verirrte. Nicht, nachdem ein Penner kurz nach dem Brand hier übernachtet hatte. Am nächsten Morgen war er nackt über die Straßen gerannt und hatte behauptet, der Geist des Pfarrers würde ihn verfolgen. Der Alte saß immer noch in der Geschlossenen. Armer törichter Mann. Oder arme törichte Jess. Je nachdem, wie das heute ablief, könnte ich ihm bald Gesellschaft leisten. Was für eine tolle Schlagzeile für die morgige Ausgabe der Morning News: Spuk-Kirche fordert nächstes Opfer.
Verwirrt und offenbar nicht bei Verstand: 18-Jährige nach Geisterbeschwörung von Polizei auf Straße aufgegriffen. Zerrüttete Familienverhältnisse als Auslöser? Alle Hintergründe auf Seite 3.
Ich biss auf meine Unterlippe, bis der Schmerz meine Gedanken zur Ruhe zwang. Geister und Dämonen. Es wäre wesentlich einfacher, wenn ich wüsste, dass diese Wesen nicht existierten, dass der Penner sich das nur ausgedacht hatte; aber ich lebte mit einem dieser Wesen Seite an Seite, denn meine beste Freundin Violet war eine von ihnen.
Etwas Graues flitzte von rechts nach links. Ich machte einen Hüpfer, mein Schuh verhedderte sich zwischen zwei Holzlatten und ich landete beinahe im Schutt.
»Herrgott noch eins. Reiß dich zusammen!« Das waren nur Ratten. Wie ich sie tagtäglich im Wald sah. Keine Monster, Ungeheuer oder sonst etwas. Ich befreite meinen Fuß aus dem Unrat und ging weiter zu dem Platz, an dem früher der Altar gestanden hatte. Die Ränder und Einkerbungen waren noch deutlich zu erkennen.
Ich kniete mich in die Mitte und öffnete die Sporttasche. Nacheinander räumte ich erst die Kerzen, dann das Stück Kreide, die Holzkohle, die Feder und die Myrrhe aus der Tasche. Meine Bewegungen liefen so mechanisch ab, als hätte ich sie tausendfach einstudiert, aber das hatte ich nicht. Das Ritual hatte mir eine Hexe aus England zusammengestellt, die ich in einem Internetforum kennengelernt hatte. Sie versprach, es würde funktionieren, wenn ich mich genau an ihre Anweisungen hielte. Also würde ich das tun. Entweder führte es mich zum Ziel oder in den Abgrund, wie Violet es prophezeit hatte.
Meine Zunge klebte pelzig am Gaumen, von meiner Stirn tropften die Schweißperlen. Hätte ich auf Violet hören sollen? Immerhin war sie mein Schutzgeist. Meine Fylgja, die meine Aura abdeckte. Von meiner Mum kurz nach meiner Geburt gerufen und in einen menschlichen Körper gebannt, damit sie an meiner Seite aufwachsen und über mich wachen konnte.
»Du leuchtest wie der Abendstern, Jess«, sagte Violet zu mir, als ich sie fragte, warum das nötig war. »Es gibt Wesen da draußen, die sich von diesem Strahlen angezogen fühlen, daher dämme ich es ein.«
Das mochte alles so stimmen, aber heute hätte ich nicht meine Fylgja, sondern meine Freundin gebraucht. Für eine Nacht hätte sie ihre Kontrollsucht zurückstellen können. Für eine Nacht hätte sie mal unvernünftig sein können. Ich legte den Kopf in den Nacken.
Nein hätte sie nicht.
Violet war, was sie war, und sie konnte genauso wenig aus ihrer Haut wie ich. Ich schloss die Augen. Wie hatte Mum früher zu mir gesagt, wenn ich mich im Wald verirrt hatte: Wenn du nicht weiter weißt, gehe dorthin zurück, wo du hergekommen bist.
Also gut. Zurück zum Anfang: Warum war ich hier? Weil ich den Geist von Pfarrer Stevens beschwören wollte.
Wieso? Vor einigen Wochen fand ich, nach einem Wasserrohrbruch im Büro, einen Brief von Pfarrer Stevens, den er, einen Monat vor Mums Verschwinden, an sie geschickt hatte. Außerdem lag ein USB-Stick in dem Umschlag. In seinem Schreiben bat er Mum, keine Dummheiten zu machen, sondern mir die Wahrheit zu sagen. Über was oder wen, erwähnte er leider nicht. Und dann war Mum fort. Sie hatte uns verlassen; ohne Abschied, ohne Nachricht - ohne alles.
Was waren die Alternativen? Es gab keine. Die einzige, die etwas über den Brief oder die Dateien auf dem Stick wissen könnte, war Ariadne, mein Vormund. Sie hatte Mum besser als jeder andere gekannt. Stattdessen hatte Ariadne die Sachen verbrannt und gesagt, ich müsse das alles endlich hinter mir lassen und weiterleben. Immerhin hatten wir Mum jahrelang vergeblich gesucht. Vielleicht war sie schon gar nicht mehr am Leben.
Ein Kribbeln durchfuhr mich, zusammen mit diesem wohligen Gefühl, das einen befiel, wenn man begriffen hatte, wie es weiterging. Ich nickte, auch wenn niemand hier war, der es sehen konnte und öffnete die Augen. »Los geht’s.«
Eine halbe Stunde später war alles vorbereitet. Die Kerzen waren in einem Kreis rings um den ehemaligen Altar aufgestellt, das Pentagramm mit Kreide auf den Boden gemalt. An jeder der fünf Ecken stand je ein Gegenstand: eine Schale mit Myrrhe, eine Feder, ein Glas mit geweihtem Wasser und ein Topf mit Erde. Auf der Spitze des Pentagramms stand der Kelch, der mein Blut auffangen sollte; der Part, vor dem mir am meisten graute.
Ich öffnete meinen Rucksack und holte das letzte Utensil für die Beschwörung aus der Tasche: einen Silberdolch. Ariadne hatte die Waffe unter Mums Kopfkissen gefunden am Tag, als Mum aus der Klinik verschwunden war. Der Dolch war das einzige, was sie uns hinterlassen hatte. Erst dachten wir an ein Verbrechen, aber es hatte weder Anzeichen eines Kampfes noch sonstige Hinweise gegeben. Das Zimmer sah aus, als wäre sie zu einem Spaziergang aufgebrochen. Ariadne hatte den Dolch eingesteckt, bevor die Polizei hinzugeschaltet worden war, und ein paar Monate später schenkte sie ihn mir. Jetzt war er meine letzte Verbindung zu Mum. Er war bei ihr gewesen, als sie verschwand. Er hatte sie gesehen, er war im gleichen Raum gewesen wie sie. Er war mein Zeuge, obwohl er nur ein Gegenstand war. Albern irgendwie, aber in den letzten Jahren hatte mich dieser Gedanke getröstet. Es erschien mir passend, den Dolch bei dem Ritual zu verwenden.