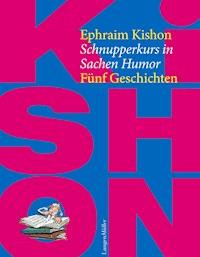8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Langen-Müller
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sie lauern überall und unaufhörlich, die Stolpersteine in Familie, Politik, Beruf und Finanzwesen. Ephraim Kishon, hat es geahnt: Was wir wirklich brauchen, in guten wie in schlechten Zeiten, ist das Lachen. Und die Erkenntnis, dass Krisen vorübergehen, solange der Humor bleibt. Eine amüsante Zusammenstellung der positivsten Satiren, die in Zeiten wie diesen jedem von uns nur guttun kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 165
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Ephraim Kishon
Die täglicheKatastrophe
Ausgewählt und zusammengestelltvon Lisa Kishon
LangenMüller
Besuchen Sie uns im Internet unter
www.langen-mueller-verlag.de
© für die Originalausgabe und das eBook: © 2009, 2020 LangenMüller in der F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, Stuttgart Alle Rechte vorbehalten Schutzumschlag: STUDIO LZ, Stuttgart Illustration: Saul Steinberg, Untitled, 1959 © The Saul Steinberg Foundation/Artists Rights Society (ARS), New York Satz: Filmsatz Schröter GmbH, München
Inhaltsverzeichnis
Keine Gnade für GläubigerAutokaufAgententerrorGipfeltreffen mit HindernissenIhre Zimmernummer, SirTagebuch eines HaarspaltersBargeldloser VerkehrKoexistenz mit AmeisenEin Vater wird geborenSchnarchereiKarriereDer Eindringling und der WohltäterSubventionspokerTagungen müssen seinOpfer der InflationProfessor Honig macht KarriereAuch die Waschmaschine ist nur ein MenschDie Brille, das unbekannte WesenEnorm in FormIch habe ja so rechtDer Löw’ ist losKredit auf lange SichtDer verwaltete KonkursElefantiasisKein Weg nach OslogrollsÜber den Umgang mit ComputernArmut bereichertAnleitungen zum persönlichen WohlstandDie Sekretärin oder das Ende vom LiedMeine Stunde NullKeine Gnade für Gläubiger
7. September. Traf heute zufällig Manfred Toscanini (keine Verwandtschaft) auf der Straße. Er war sehr aufgeregt. Wie aus seinem von Flüchen unterbrochenen Bericht hervorging, hatte er sich von Jascha Obernik 100 Pfund ausborgen wollen, und dieser Lump, dieser Strauchdieb, dieses elende Stinktier hatte sich nicht entblödet, ihm zu antworten: »Ich habe sie, aber ich borge sie dir nicht!« Der kann lange warten, bis Manfred wieder mit ihm spricht!
Ob wir denn wirklich schon so tief gesunken wären, fragte mich Manfred. Ob es denn auf dieser Welt keinen Funken Anständigkeit mehr gäbe, keine Freundschaft, keine Hilfsbereitschaft?
»Aber Manfred!«, beruhigte ich ihn. »Wozu die Aufregung?« Und ich händigte ihm lässig eine Hundertpfundnote aus.
»Endlich ein Mensch«, stammelte Manfred und kämpfte tapfer seine Tränen nieder. »In spätestens zwei Wochen hast du das Geld zurück, du kannst dich hundertprozentig darauf verlassen!«
Wenn ich meine Frau richtig verstanden habe, bin ich ein Idiot. Aber ich wollte Manfred Toscanini den Glauben an die Menschheit wiedergeben. Und ich will ihn nicht zum Feind haben.
18. September. Als ich das Café Rio verließ, lief ich in Manfred Toscanini hinein. Wir setzten unseren Weg gemeinsam fort. Ich vermied es sorgfältig, das Darlehen zu erwähnen, doch schien gerade diese Sorgfalt Manfreds Zorn zu erregen. »Nur keine Angst«, zischte er. »Ich habe dir versprochen, dass du dein Geld in vierzehn Tagen zurückbekommst, und diese vierzehn Tage sind noch nicht um. Was willst du eigentlich?« Ich verteidigte mich mit dem Hinweis darauf, dass ich kein Wort von Geld gesprochen hätte. Manfred meint, ich sei nicht besser als alle anderen, und ließ mich stehen.
3. Oktober. Peinlicher Zwischenfall auf der Kaffeehausterrasse: Manfred Toscanini saß mit Jascha Obernik an einem Tisch und fixierte mich. Er war sichtlich verärgert. Ich sah möglichst unverfänglich vor mich hin, aber das machte es nur noch schlimmer. Er stand auf, trat drohend an mich heran und sagte so laut, dass man es noch drin im Kaffeehaus hören konnte: »Also gut, ich bin ein paar Tage in Verzug. Na wennschon! Deshalb wird die Welt nicht einstürzen. Und deshalb brauchst du mich nicht so vorwurfsvoll anzuschauen!« Ich hätte nichts dergleichen getan, replizierte ich. Daraufhin nannte mich Manfred einen Lügner und noch einiges mehr, was sich der Wiedergabe entzieht.
Meine Frau sagte, was Frauen in solchen Fällen immer sagen: »Hab ich’s dir nicht gleich gesagt?«, sagte sie und lächelte sardonisch.
11. Oktober. Wie ich höre, erzählt Manfred Toscanini überall herum, dass ich ein hoffnungsloser Morphinist sei und dass außerdem zwei bekannte weibliche Rechtsanwälte Vaterschaftsklagen gegen mich eingebracht hätten. Natürlich ist an alldem kein wahres Wort. Morphium! Ich rauche nicht einmal.
Meine Frau ist trotzdem der Meinung, dass ich um meiner inneren Ruhe willen auf die 100 Pfund verzichten soll.
14. Oktober. Sah Toscanini heute vor einem Kino Schlange stehen. Bei meinem Anblick wurden seine Augen starr, seine Stirnadern schwollen an, und seine Nackenmuskeln verkrampften sich. Ich sprach ihn an: »Manfred«, sagte ich gutmütig, »ich möchte dir einen Vorschlag machen. Vergessen wir die Geschichte mit dem Geld. Das Ganze war ohnehin nur eine Lappalie. Du bist mir nichts mehr schuldig. In Ordnung?« Toscanini zitterte vor Wut. »Gar nichts ist in Ordnung!«, fauchte er. »Ich pfeif auf deine Großzügigkeit. Hältst du mich vielleicht für einen Schnorrer?« Er war außer Rand und Band. So habe ich ihn noch nie gesehen. Obernik, mit dem er das Kino besuchte, musste ihn zurückhalten, sonst hätte er sich auf mich geworfen.
Meine Frau sagte zu mir: »Hab ich’s dir nicht gleich gesagt?«
29. Oktober. Immer wieder werde ich gefragt, ob es wahr ist, dass ich mich freiwillig zum Vietkong gemeldet habe und wegen allgemeiner Körperschwäche abgewiesen wurde. Ich weiß natürlich, wer hinter diesen Gerüchten steckt. Es dürfte derselbe sein, der mir in der Nacht mit faustgroßen Steinen die Fenster einwirft. Als ich gestern das Café Rio betrat, sprang er auf und brüllte: »Darf denn heute schon jeder Vagabund hier hereinkommen? Ist das ein Kaffeehaus oder ein Asyl für Obdachlose?« Um Komplikationen zu vermeiden, drängte mich der Cafetier zur Tür hinaus.
Meine Frau hatte es gleich gesagt.
8. November. Heute kam mein Lieblingsvetter Aladar zu mir und bat mich, ihm 10 Pfund zu leihen. »Ich habe sie, aber ich borge sie dir nicht«, antwortete ich. Aladar ist mein Lieblingsvetter, und ich möchte unsere Freundschaft nicht zerstören. Ich habe ohnehin schon genug Schwierigkeiten. Das Innenministerium hat meinen Pass eingezogen. »Wir erwarten Nachricht aus Nordvietnam«, lautete die kryptische Antwort auf meine Frage, wann ich den Pass wiederbekäme. So viel zu meinem Plan, ins Ausland zu fliehen.
Meine Frau – deren Warnungen ich in den Wind geschlagen hatte, als es noch Zeit war – lässt mich nicht mehr allein ausgehen. In ihrer Begleitung suchte ich einen Psychiater auf. »Toscanini hasst Sie, weil Sie ihm Schuldgefühle verursachen«, erklärte er mir. »Er leidet Ihnen gegenüber an einem verschobenen Vaterkomplex. Sie könnten ihm zum Abreagieren verhelfen, wenn Sie sich für einen Vatermord zur Verfügung stellen. Aber das ist wohl zu viel verlangt?« Ich bejahte. »Dann gäbe es, vielleicht, noch eine andere Möglichkeit. Toscaninis mörderischer Hass wird Sie so lange verfolgen, wie er Ihnen das Geld nicht zurückzahlen kann. Vielleicht sollten Sie ihn durch eine anonyme Zuwendung dazu in die Lage setzen.« Ich dankte dem Seelenforscher überschwänglich, sauste zur Bank, hob 500 Pfund ab und warf sie durch den Briefschlitz in Toscaninis Wohnung.
11. November. Auf der Dizengoffstraße kam mir heute Toscanini entgegen, spuckte aus und ging weiter. Ich erstattete dem Psychiater Bericht. »Probieren geht über studieren«, sagte er. »Jetzt wissen wir wenigstens, dass es auf diese Weise nicht geht.« Eine verlässliche Quelle informierte mich, dass Manfred eine große Stoffpuppe gekauft hat, die mir ähnlich sieht. Jeden Abend vor dem Schlafengehen, manchmal auch während des Tages, sticht er ihr feine Nadeln in die Herzgegend.
20. November. Unangenehmes Gefühl im Rücken, wie von kleinen Nadelstichen. In der Nacht wachte ich schweißgebadet auf und begann zu beten. »Ich habe gefehlt, o Herr!«, rief ich aus. »Ich habe einem Nächsten in Israel Geld geliehen! Werde ich die Folgen meines Aberwitzes bis ans Lebensende tragen müssen? Gibt es keinen Ausweg?«
Von oben hörte ich eine tiefe, väterliche Stimme: »Nein!«
1. Dezember. Nadelstiche in den Hüften und zwischen den Rippen, Vaterkomplexe überall. Auf einen Stock und auf meine Frau gestützt, suchte ich einen praktischen Arzt auf. Unterwegs sahen wir auf der gegenüberliegenden Straßenseite Obernik. »Ephraim«, flüsterte meine Frau, »schau ihn dir einmal ganz genau an! Das rundliche Gesicht … die leuchtende Glatze … eine ideale Vaterfigur!« Sollte es noch Hoffnung für mich geben?
3. Dezember. Begegnete Toscanini vor dem Kaffeehaus und hielt ihn an. »Danke für das Geld«, sagte ich rasch, bevor er mich niederschlagen konnte. »Obernik hat deine Schuld auf Heller und Pfennig an mich zurückgezahlt. Er hat mich zwar gebeten, dir nichts davon zu sagen, aber du sollst wissen, was für einen guten Freund du an ihm hast. Von jetzt an schuldest du also die 100 Pfund nicht mir, sondern Obernik.« Manfreds Gesicht entspannte sich. »Endlich ein Mensch«, stammelte er und kämpfte tapfer seine Tränen nieder. »In spätestens zwei Wochen hat er das Geld zurück.«
22. Januar. Als wir heute Arm in Arm durch die Dizengoffstraße gingen, sagte mir Manfred: »Obernik, diese erbärmliche Kreatur, sieht mich in der letzten Zeit so unverschämt an, dass ich ihm demnächst ein paar Ohrfeigen herunterhauen werde. Gut, ich schulde ihm Geld. Aber das gibt ihm nicht das Recht, mich wie einen Schnorrer zu behandeln. Er wird sich wundern, verlass dich darauf!«
Ich verlasse mich darauf.
Autokauf
Es kam, wie es kommen musste. Eines katastrophalen Morgens entschloss ich mich, mir einen Gebrauchtwagen anzuschaffen, und ging zu einem Gebrauchtwagenhändler namens »Smiling Joe« (was mit »lächelnder Josef« durchaus zureichend übersetzt wäre). Smiling Joe nahm in den Zeitungen täglich einige Quadratkilometer Inseratenraum in Anspruch, auf denen er seine 600 Gebrauchtwagen begeistert anpries. Er war ein kräftiger, gutgelaunter, temperamentvoller junger Mann, und als er hörte, dass ich aus Israel kam, kannte seine Begeisterung keine Grenzen. Er selbst, wie er ausdrücklich betonte, war zwar kein Jude, aber er hatte einen Freund, der Finkelstein oder so ähnlich hieß, und das genügte.
Smiling Joe zeigte mir persönlich seine 20 Gebrauchtwagen und pries jeden einzelnen von ihnen begeistert an. Als ich mich nach den restlichen 580 erkundigte, raunte er mir vertraulich zu, dass sie für prominente Gäste aus dem Nahen Osten – also zum Beispiel für mich oder König Ibn Saud – auf einem Geheimgelände bereitgehalten würden.
»Es ist nur fünf Minuten von hier«, sagte Smiling Joe. »Fahren wir los.« Und er lud mich in seinen eigenen Wagen ein.
Nach ungefähr eineinhalb Stunden flotter Fahrt fragte ich ihn, was eigentlich mit den fünf Minuten los wäre. Smiling Joe gestand mir unter dröhnendem Gelächter, dass er dabei an ein Überschallflugzeug gedacht hätte. Aber jetzt würde es wirklich nur noch zehn Minuten dauern.
Dämmerung sank herab. Die Wüste, die wir durchfuhren, zeigte alle Merkmale subtropischer Vegetation. Immerhin waren wir noch vor Einbruch der völligen Dunkelheit in Arizona. Auf dem geheimen Gelände standen, leicht überschaubar, neun Gebrauchtwagen.
»Ist das alles?«, fragte ich. »Wo sind die anderen?«
»Verkauft«, grinste Smiling Joe. »Die Dinger gehen weg wie die warmen Semmeln. Am Morgen hatte ich noch 500 Wagen hier. Wenn ich’s mir recht überlege, bin ich gar nicht scharf drauf, den Rest zu verkaufen. Ich kann mit dem Geld sowieso nichts anfangen.«
Unwillkürlich drängte sich die Frage auf meine Lippen, warum er mich dann überhaupt hergeführt habe.
Smiling Joe grinste abermals. Geld bedeute ihm nichts, meinte er. Viel wichtiger sei der gute Ruf, »Fairness und Ehrlichkeit« lautete die Devise.
Ich hatte währenddessen den rudimentären Wagenpark besichtigt und zu meiner Freude einen verhältnismäßig gut erhaltenen Chevrolet entdeckt, der laut kreidiger Aufschrift auf der Windschutzscheibe nur 299,99 Dollar kosten sollte.
»Der Wagen gefällt mir«, sagte ich. »Den will ich haben.«
»Junge, Junge!« Smiling Joe hieb mir anerkennend seine Pranke auf die Schulter. »Das nenne ich ein sicheres Auge! Schaut hin – und hat auch schon mein bestes Stück! Der Wagen ist zwar verkauft, an den Gouverneur dieses aufstrebenden Staates – aber wenn ich Sie damit glücklich machen kann, dann blättern Sie 400 Dollar auf den Tisch des Hauses und der Chevy gehört Ihnen.«
»Wieso 400? Da steht doch ganz deutlich 299,99?«
»Listenpreis, mein Junge. Ohne Reifen. Wenn Sie für 299,99 einen Wagen ohne Reifen kaufen wollen – ich habe nichts dagegen. Aber vergessen Sie nicht, dass Chevrolet eine der teuersten Automarken Amerikas ist.«
Ich zeigte wortlos auf die Neonlicht-Reklame am Eingang, die in großen Blinklichtern besagte: »Chevrolet – der preisgünstigste Wagen Amerikas!«
Smiling Joe büßte weder seine Ruhe noch sein Grinsen ein. »Wer kümmert sich heute noch um Neonreklame? Längst überholt!«
Ich hatte den Wagen mittlerweile von allen Seiten geprüft und fand ihn immer mehr nach meinem Geschmack.
»Okay«, sagte ich. »Ich nehme ihn.«
»Großartig!« Smiling Joe schüttelte begeistert meine Hände. »Sie sind ein Glückspilz! Machen Sie, dass Sie rauskommen, bevor ich’s mir überlege! Sie werden diesen Wagen mit 500 Dollar Profit verkaufen.«
»Wo sind die Schlüssel?«
»Schon mal was von automatischer Kupplung gehört?«, grinste Smiling Joe, während er mir die Schlüssel aushändigte. »Und das Lenkrad können Sie mit einem Finger ganz herumdrehen.«
Ich versuchte das Lenkrad mit einem Finger ganz herumzudrehen, hörte aber sofort auf, als es in zwei Hälften zu zerbrechen drohte.
»Sehen Sie«, triumphierte Smiling Joe. »Es rührt sich nicht. Solide wie Stahl. Und erst der Zehnzylindermotor! Junge, Junge.«
Ich öffnete die Haube und zählte knappe sechs Zylinder.
»Eben!« Smiling Joe überschlug sich vor Begeisterung. »Was das nur für eine Benzinersparnis bedeutet! Und die automatische Vorzündung!«
Ich demonstrierte ihm mühelos, dass die Vorzündung in keiner Weise automatisch war, sondern mühsam mit der Hand bedient werden musste.
Smiling Joe beglückwünschte mich aufs Neue zu meinem Fang. Die automatische Vorzündung sei ohnehin nichts wert gewesen und werde zu den neuesten Modellen nicht mehr geliefert.
»Glauben Sie, ich würde Ihnen einen schlechten Wagen verkaufen, he? Ich Ihnen? Ein Jude dem andern? Sie werden sich in diesem Wagen wie ein König vorkommen! Und wenn Sie Musik hören wollen, brauchen Sie nur das Radio anzudrehen.«
Smiling Joe zeigte mir den Knopf und drehte ihn an. Sofort setzten sich die Scheibenwischer in Betrieb.
»Wer zum Teufel braucht ein Radio?«, fragte Smiling Joe beseligt. »Was bekommt man da schon zu hören? Den ganzen Tag lang Schallplatten. Vollkommen überflüssig. Viel wichtiger ist, dass Sie einen fantastischen Fahrersitz haben, den Sie sogar verschieben können.«
Ich versuchte den Sitz zu verschieben – und er verschob sich. Ich versuchte es noch einmal – und er verschob sich wieder. Warum hatte Smiling Joe dann aber gesagt, dass sich der Sitz verschieben ließ? Das war verdächtig. Ich nahm eine gründliche Untersuchung des Wagens vor – er war so gut wie neu.
»Er ist so gut wie neu«, grinste Smiling Joe. »Er hat nicht mehr drauf als 17000 Meilen.«
Das konnte nicht wahr sein. Ich warf einen Blick auf den Zähler. Er zeigte 3000 Meilen. Mein Misstrauen wuchs.
»Wieso zeigt er nur 3000?«
»Leicht zu erklären. Der frühere Besitzer war ein Leuchtturmwächter, der immer nur um seinen Leuchtturm herumfahren konnte.«
Jetzt hatte ich genug. Wenn ich Smiling Joes Verkaufstechnik richtig interpretierte, musste der Wagen spätestens nach hundert Metern auseinanderfallen.
»Schön«, sagte ich. »Dann werden wir leider kein Geschäft miteinander machen. Ich lasse mich nicht zum Narren halten.«
»Ganz wie Sie wünschen.«
Zum ersten Mal verlor sich das Grinsen aus Smiling Joes Gesicht.
»Wie komme ich nach Hause?«
»Per Auto?«
»Nein. Zu Fuß.«
»Immer nach Osten, mein Freund, immer nach Osten …«
Ich überlegte: Wenn Smiling Joe »Osten« sagte, wäre »Westen« vermutlich das Richtige. Aber da man sich bei ihm nicht einmal auf das Gegenteil seiner Aussagen verlassen kann, ginge ich wohl am besten nach Süden.
Auf meinem Weg in nördlicher Richtung kam ich durch fruchtbares Ackerland, durch schattige Wälder mit Bächen und Wasserfällen – und trotzdem nach Hause. Unser Nachbar stützte mich die Stiegen hinauf und informierte mich (leider zu spät), dass man in Amerika zum Kauf eines Gebrauchtwagens unbedingt mit dem eigenen Wagen vorfahren müsse.
Agententerror
Liegt das nun an der sprunghaften Verbesserung unserer Wirtschaftslage oder am schönen Wetter – gleichviel, ich stehe in der letzten Zeit unter ständigem Druck vonseiten angelsächsischer Versicherungsagenten.
Warum es immer angelsächsische sind, ahne ich nicht, aber wenn am frühen Vormittag mein Telefon geht, meldet sich todsicher ein unverkennbarer Gentleman in unverkennbarem Oxford-Englisch:
»Guten Morgen, Sir. Ich spreche im Auftrag der Allgemeinen Südafrikanischen Versicherungsgesellschaft. Darf ich Sie um zehn Minuten Ihrer kostbaren Zeit bitten, Sir? Ich möchte Sie mit einer völlig neuen Art von Lebensversicherung bekannt machen.«
Daraufhin gefriere ich in Sekundenschnelle. Erstens bin ich gegen Lebensversicherungen, weil ich sie für unmoralisch halte. Zweitens habe ich nicht die Absicht, jemals zu sterben. Drittens sollen die Mitglieder meiner Familie, wenn ich trotzdem einmal gestorben sein sollte, selbst für ihr Fortkommen sorgen. Und viertens bin ich längst im Besitz einer Lebensversicherung.
Ich lasse also Mr. Oxford wissen, dass er sein gutes Englisch an mich verschwendet und dass mein Leichnam bereits 170 000 Shekel wert ist.
»Was sind heutzutage 170 000 Shekel?«, höre ich aus Oxford. »Die Allgemeine Südafrikanische hält für den beklagenswerten Fall Ihres Hinscheidens eine doppelt so hohe Summe bereit. Gewähren Sie mir zehn Minuten, Sir.«
»Im Prinzip recht gerne. Die Sache ist nur die, dass ich in einer Stunde nach Europa abfliege. Für längere Zeit. Vielleicht für zwölf Jahre.«
»Ausgezeichnet. Ich erwarte Sie am Flughafen.«
»Dazu wird die Zeit nicht ausreichen, weil ich noch nicht gefrühstückt habe.«
»Ich bringe ein paar Sandwiches mit.«
»Außerdem möchte ich mich von meiner Familie verabschieden.«
»Nicht nötig. Wir schicken sie Ihnen mit dem nächsten Flugzeug nach. Die Tickets gehen selbstverständlich zu unseren Lasten. Ich warte im Flughafen-Restaurant, Sir.«
Auf diese Weise bin ich schon dreimal hintereinander nach Europa geflogen, aber der Andrang lässt nicht nach. Erst vor wenigen Tagen versuchte ich den Gentleman von der Neuseeland International Ltd. damit abzuschrecken, dass mein Leben auf eine Million Dollar versichert sei. »Was ist denn schon eine Million Dollar!«, erwiderte er geringschätzig und entwickelte innerhalb von zehn Minuten einen einzigartigen Lebensversicherungsplan, demzufolge der Versicherungsnehmer gar nicht zu sterben braucht, es genügt, wenn er in Ohnmacht fällt, absolut inflationssicher, mit Abwertungsklausel und Farbfernsehen.
Als er nicht lockerließ, gestand ich ihm, dass ich zahlungsunfähig war. Pleite. Vollkommen pleite.
»Macht nichts«, tröstete er mich. »Wir verschaffen Ihnen ein Darlehen von der Regierung.«
»Ich bin krank.«
»Wir schicken Ihnen einen Arzt.«
»Aber ich will keine Lebensversicherung abschließen.«
»Das glauben Sie nur, Sir. Sie wollen.«
Gegen irgendeinen levantinischen Schwarzhändler wüsste ich mir zu helfen. Aber gegen Oxford-Englisch bin ich machtlos.
Heute Vormittag war die Wechselseitige Australische am Telefon und bat um zehn Minuten. Geistesgegenwärtig schaltete ich auf schrillen Sopran: »Hier Putzfrau von Herr Kishon sprechen. Armer Herr gestern gestorben.«
»In diesem Fall, Madame«, sagte die Wechselseitige, »möchten wir der Familie des Verstorbenen einen revolutionären Versicherungsvorschlag unterbreiten. Es dauert nur zehn Minuten.«
Ich sterbe vor Neugier, ihn zu erfahren.
Gipfeltreffen mit Hindernissen
Kaum war es kalt geworden, als in der Wand meines Arbeitszimmers ein Wasserleitungsrohr platzte und ein dunkelbrauner Fleck auf der Tapete erschien. Ich ließ dem Rohr zwei Tage Zeit, sich von selbst in Ordnung zu bringen. Das geschah jedoch nicht. So blieb mir nichts übrig, als unseren Installateur zu rufen.
Der legendäre Platschek lebte in Holon und war nur sehr schwer zu erreichen. Glücklicherweise traf ich ihn im Fußballstadion, und da seine Mannschaft gewonnen hatte, erklärte er sich bereit, am nächsten Tag zu kommen, vorausgesetzt, ich würde ihn mit dem Auto abholen, und zwar um halb sechs Uhr früh, bevor er zur Arbeit ginge. Auf meine Frage, warum denn so früh und ob denn das, was er bei mir zu tun hätte, keine Arbeit sei, antwortete Platschek: Nein.
Ich holte ihn pünktlich ab. Er warf einen flüchtigen Blick auf die feuchte Mauer und sagte: »Wie soll ich an das Rohr herankommen? Holen Sie zuerst einen Maurer und lassen Sie die Wand aufbrechen!«
Damit verließ er mich, nicht ohne indigniert darauf hinzuweisen, dass er einen ganzen Arbeitstag verloren hätte. Ich blieb zurück, allein mit einem braunen Fleck an der Wand und der brennenden Sehnsucht nach einem Maurer. Ich kenne keinen Maurer. Ich weiß auch nicht, wo man einen Maurer findet. Wie sich zeigte, wusste das auch keiner meiner Freunde, Nachbarn, Bekannten und Kollegen. Schließlich empfahl mir jemand, dessen Bruder in einem Maklerbüro arbeitete, einen Allround-Handwerker namens Gideon, der irgendwo in der Nähe von Bat Jam wohnte.