
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Kater Max hat sieben Leben. Und er wird jedes einzelne davon brauchen … Wenn ein Kater sprechen könnte, dann würde er wahrscheinlich genauso klingen wie Max. Max kommt aus Belgien, und irgendjemand hat ihn gekidnappt und in ein Tierversuchslabor gebracht. Warum? Wieso? Wozu? Eins nach dem anderen, erst einmal muss er da weg! Auf der Flucht begegnet Max der zwölfjährigen Millie, Tierschützerin aus Überzeugung. Klar, dass sie dem Kater hilft. Aber das ist doch ziemlich gefährlich, oder? Wird es den beiden gelingen, Max' Katzenfreunde aus dem Labor zu befreien?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 262
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Natalie Haynes
Die tollkühne Flucht
Thriller
Fischer e-books
1
Millie blickte einige Sekunden auf ihre Uhr, ehe ihr wieder einfiel, dass sie ja kaputt war. Das Ziffernblatt war beschlagen und die Zeiger hingen unbeweglich auf fünf nach zehn fest. Sie starrte auf die Uhr. Angeblich sollte sie wasserdicht sein. Wie um Entschuldigung bittend, tänzelte in der Nähe des Minutenzeigers ein Wassertropfen umher.
Millie seufzte tief. Es war schon schlimm genug, sich zu langweilen und nass zu sein. Aber noch schlimmer war es, nicht einmal zu wissen, wie lange dieser Zustand bereits dauerte. Geschweige denn, wie lange man noch bleiben musste. Außerdem stank sie nach Spülflüssigkeit oder was auch immer für ein Zeugs im Eimer war. Wie man die Sache auch betrachtete, Millies Sommerferien verliefen alles andere als gut.
Ihr Vater befand sich auf der anderen Seite des hässlichen riesigen Glaskastens, den sie gerade putzten. Er stand mit seinem Freund Bill auf einer an Seilen befestigten Hängebühne, auf der sie sich Etage für Etage an der Fensterfront nach oben putzten. Millie konnte die beiden gerade so eben noch lachen hören, während sie auf ihr eigenes Spiegelbild in den Fenstern starrte. Der Mann vom Wachdienst, der am Rezeptionstresen saß, erwiderte ihren Blick und grinste sie dämlich an.
Pah! Als ob sie ihn anstarren würde!
Erwachsene können so ichbezogen sein, dachte sie und ignorierte ihn einfach. Wie kamen Bill und ihr Vater eigentlich dazu, sich dort oben zu amüsieren, während sie hier unten alleine herumhängen musste? Aber Millie wusste genau, ihr Vater würde sie nicht auf die Hängebühne lassen. Aus Angst, dass sie herunterfallen könnte.
»Dieses Ding ist nicht für jemanden gebaut, der so klein ist wie du«, hatte er erklärt.
»Ich bin nicht klein«, hatte sie gegiftet.
»Ich weiß, du bist zwölf. Und für zwölf bist du ein Koloss.«
»Hast du mich etwa gerade fett genannt?«
»Neeeeein!« Ihr Vater musste lachen. Deswegen machte sie auch keinen allzu großen Aufstand. Er lachte in der letzten Zeit nicht viel. Jedenfalls nicht, seit er seinen Job verloren hatte.
»Wie hast du sie genannt?«, hatte Bill gerufen, während er ihre Ausrüstung auflud.
»Einen Koloss«, antwortete Millie. Ihr Vater blickte sie erwartungsvoll an. Sie verdrehte die Augen und fuhr fort. »Das ist eine große Statue. Es gab eine von Kaiser Nero. Vor dem Kolosseum in Rom. Daher der Name.«»Du hast eine ganz schön schlaue Tochter, Allan.«
»Ne«, sagte Millie und wand sich verlegen. »Ich hab nur einen ziemlich dummen Vater.«
»Komm her, du!« Ihr Vater machte Anstalten, hinter ihr herzujagen, und Millie hatte gelacht und sich mit einem Satz in Sicherheit gebracht.
Das war nun schon Wochen her oder zumindest kam es ihr so vor. Vermutlich aber waren es nur ein paar Stunden. Ihr Vater hatte ihr gesagt, dass sie nicht mitkommen müsse, wenn sie nicht wollte. Wenn es ihr lieber wäre, könnte sie auch zu Hause bleiben, und die Nachbarin würde gelegentlich nach ihr sehen.
Millie hatte eine Nanosekunde lang darüber nachgedacht und Vorteile gegen Nachteile abgewogen. Einerseits würde sie den ganzen Tag im Garten sitzen und lesen können. Andererseits würde Mrs Ellis alle zwanzig Minuten ankommen und fragen, welches Buch sie las, wie viele Seiten es hatte, wovon es handelte, ob es so gut wie eins von Enid Blyton sei und so weiter und so weiter. Bei dieser Vorstellung überkam Millie das Verlangen, sich eine Gabel in den Arm zu rammen. Oder besser noch in den von Mrs Ellis. Wie auch immer, beides wäre wahrscheinlich keine wirklich gute Idee. Also hatte sie sich für den Putzeimer entschieden. Aber mit Entscheidungen war es immer so eine Sache. Im Grunde war es doch so, als hätte man sie gefragt, ob sie lieber mit einem spitzen oder einen stumpfen Stift ins Auge gestochen werden wollte.
In der letzten Woche – genaugenommen seit ihrem ersten Fensterputzeinsatz – hatte sie sich mehrmals gefragt, ob das die richtige Entscheidung gewesen war.
Und dann war am letzten Dienstag etwas passiert. Sie war gerade dabei gewesen, frisches Wasser in eine Industrieseifenlösung zu kippen, die einem eine penetrante Duftkombination aus Geschirrspülmittel und Swimmingpool verlieh, als urplötzlich ein Kombiwagen vor der Rückseite des Bürogebäudes hielt.
Der Wagen schien einfach aus den Feldern hinter ihr aufgetaucht zu sein, wie ein plötzlich aus dem Nichts heraus materialisierter Busch aus Blech. Die Tür sprang auf, und ein Mann kam ihr entgegengestürzt.
»Hallo«, begrüßte er sie. »Für einen Fensterputzer bist du ein bisschen jung, oder?«
»Ich helfe hier nur meinem Vater«, antwortete Millie.
»Äh, ja. Ach so. Ich hoffe, ich habe dich nicht erschreckt, weil ich über die hintere Zufahrt gekommen bin.« Er musste gesehen haben, dass sie vor Schreck einen Satz gemacht hatte.
»Es ist ein bisschen schwierig, vorne reinzukommen, weißt du. Mit all den Demonstranten …« Er brach ab.
»Was für Demonstranten?«, fragte Millie.
»Hast du nicht …? Ach nein, natürlich. Du bist wahrscheinlich zu früh hier gewesen. Solche Leute stehen bestimmt nicht mit den Lerchen auf, was?«
»Weiß ich nicht«, antwortete Millie. Sie hatte keine Ahnung, um wie viel Uhr Lerchen aufstanden. Oder Demonstranten.
Dieser Mann hatte das seltene Talent, sowohl langweilig als auch ein bisschen schräg zu sein.
»Nun, das tun sie gewöhnlich nicht. Aber sie mögen nicht, was wir hier tun. Also sind sie fast täglich hier und machen ihren Standpunkt klar.« Der Mann blickte sich um, wie um sich zu vergewissern, ob sich hinter seinem Rücken nicht plötzlich eine kleine Demo gebildete hatte.
»Sie dürfen nicht auf unser Grundstück. Klar, das ist unbefugtes Betreten. Aber sie sind fast täglich vorne auf der Hauptstraße, weißt du, und schreien und grölen da rum. Es ist, als wäre das so was wie eine Religion für sie, wenn du mich fragst.«
Millie verzichtete darauf hinzuweisen, dass sie ihn nicht gefragt hatte. Aber da er so gesprächig war, stellte sie die Frage, die ihr durch den Kopf ging, seit er die Demonstranten zum ersten Mal erwähnt hatte.
»Was machen Sie denn hier, was die Demonstranten nicht mögen?«
»Nun ja, weißt du … Manche Leute sind generell gegen den Fortschritt, und … Meine Güte!«, stieß der Mann plötzlich hervor. Er stürmte um den Wagen herum, als ob seine Schuhe in Brand geraten wären und er genau für solch einen Fall einen Feuerlöscher im Kofferraum parat hatte. »Ich muss mich beeilen. Lass dich von mir nicht aufhalten.« Er öffnete die Heckklappe des Wagens und nahm einen Handkarren heraus, den er neben sich stellte. Er hob nacheinander zwei Kisten aus dem Kofferraum und stellte beide auf den Handkarren. Dann schlug er den Kofferraum zu.
Er wirbelte herum und schob seine Kisten rasch auf eine kleine Tür zu.
Millie hätte es nicht beschwören können. Aber sie war sich fast sicher, ein Miauen gehört zu haben.
2
»Dad?«
»Ja, mein Schatz?«
»Was machen die da?«
»Wer? Wo?« Ihr Vater guckte irritiert.
»In diesem Labor.«
»Oh. Wissenschaftliche Forschung«, erwiderte er unbekümmert.
»Ich weiß, dass es um wissenschaftliche Forschung geht, Dad. Es ist ein Labor. Ich meine, was für Forschung?«
»Ich weiß es nicht. Medizinische vielleicht?« Millie erkannte sofort, dass er nicht die Wahrheit sagte.
»Sie machen dort Tierversuche, oder?«, sagte Millie und starrte ihn an.
»Wie kommst du darauf?« Ihr Vater versuchte, Zeit zu gewinnen.
»So ein Typ hat mir von Demonstranten an der Haupteinfahrt erzählt. Er musste über die hintere Zufahrt kommen, weil sie ihn vorn nicht durchgelassen hätten.«
»Nun, die Leute demonstrieren gegen eine Menge Dinge, Liebes. Krieg, Globalisierung …«
»Tierversuche«, ergänzte Millie.
»Ja, auch dagegen. Aber das heißt nicht, dass sie das dort machen. Es könnte alles Mögliche sein.« Er schien eine Aura ruhiger Vernunft auszustrahlen, die Millie zum Zähneknirschen brachte.
»Dann glaubst du also, dass sie hier im kleinen Haverham vor einem abgelegenen Gebäude gegen einen Krieg demonstrieren?«, fragte sie und zog die Augenbrauen hoch.
»Nein.«
»Das wäre nämlich ein ziemlich kleiner Krieg, Dad. Würde er die ganze Welt verschlingen oder nur unser winziges Kaff, was meinst du?«
»Okay, sie protestieren wohl nicht gegen einen Krieg. Aber das bedeutet nicht, dass es um Tierversuche geht.«
»Der Mann hat Kisten in das Labor getragen, in denen Katzen waren, Dad.«
»Hast du die Katzen gesehen?«, fragte er schnell.
»Nein, gehört.« Sie würde jetzt nicht lockerlassen.
»Nun, vielleicht hast du dich verhört.«
»Klar, Dad. Vielleicht hatten die eine Kiste mit Sachen drin, die miauen, bei denen es sich aber nicht um Katzen handelt und die man zufällig in ein Labor gebracht hat, vor dem Menschen gegen Tierversuche protestieren.«
»Äh, nun ja … trotzdem …« Ihr Vater schien zu merken, dass er auf verlorenem Posten stand.
»Nein, Dad, hör mir auf mit deinem trotzdem. Die Katzen sind nicht Teil von irgendwelchen Kriegsvorbereitungen, oder?«
»Ich denke mal nicht. Es sei denn, der Krieg richtet sich gegen Mäuse.«
»Mach dich nicht lustig. Das ist nicht witzig.« Millies Mine war wie versteinert.
»Ich weiß, Millie, ich weiß. Du liebst Katzen. Und die benutzen sie für ihre Experimente. Das ist nicht lustig.«
»Was, wenn sie Nadeln in sie reinstechen, so wie auf den Plakaten?« Im letzten Sommer waren Millie und ihr Vater an einem Menschen-für-die-ethisch-korrekte-Behandlung-von-Tieren-Stand vorbeigekommen. Durch die dort gezeigten Bilder war ihr die Lust vergangen, jemals wieder Fleisch zu essen. Und sie hatte ihren Vater dazu gebracht, nur Seife und Creme zu kaufen, die ein Ohne-Tierversuche-Siegel trugen.
»Ich weiß, Millie.« Er klang müde. »Ich weiß, dass es falsch ist. Und ich weiß nicht genau, was sie dort machen. Und ich möchte es auch nicht wissen. Ich muss arbeiten, wenn wir weiterhin was zu essen haben wollen. Was auch immer sie in diesem Labor tun, wird dadurch nicht besser, dass jemand anderes ihre Fenster putzt.«
»Aber Dad, du kannst durch die Fenster gucken. Hast du mitbekommen, dass sie irgendwelchen Tieren weh getan haben?«
»Nein Millie, hab ich nicht. Ich schwör’s.« Er blickte sie an und versuchte zu lächeln. Aber sie sah ihn so durchdringend an, dass es nicht richtig klappen wollte. »Ich weiß, es ist nicht schön. Aber Bettler dürfen nicht wählerisch sein.«
»Wir sind keine Bettler«, erwiderte sie sanft.
»Nein, aber wir werden es sein, wenn ich nicht jeden Tag ein paar Fenster putze. Und einmal in der Woche muss ich eben die Fenster dieser Firma putzen. Außerdem hat Bill einen Vertrag mit ihnen, und ich möchte ihn nicht im Stich lassen.
Es ist ja nicht für immer, Liebes. Nur für eine Weile.«
Millie seufzte, als ihr Vater ging und die Treppe hinaufstapfte.
»Du brauchst nicht zu putzen. Du brauchst nur einen neuen Computerjob.« Aber das sprach sie flüsternd zu sich selbst, denn sie wusste, es war sinnlos, dieses Streitthema wieder aufzuwärmen. Ihr Vater hatte vor ein paar Monaten seine Arbeit verloren und sich schlichtweg geweigert, eine neue zu suchen. Stattdessen hatte er zwei Wochen lang zu Hause rumgesessen, nur gelesen und war kaum rausgegangen. Bill hatte ihm schließlich ein paar Gelegenheitsjobs in seiner Fensterputz-Firma angeboten und er hatte zögernd eingewilligt. Bill erklärte ihr, dass ihr Vater sein Selbstvertrauen wiedergewinnen müsse. Millie konnte nicht nachvollziehen, warum ihr Vater in Punkto Software-Entwicklung und Virusbekämpfung mehr Selbstvertrauen brauchte. Schließlich beschäftigte er sich schon damit, solange sie denken konnte. Sogar noch länger, denn eigentlich war er schon ein Computerfreak gewesen – wie er sich selbst gern nannte –, bevor Millie überhaupt geboren worden war. Aber im Moment schien er einfach nicht viel auf die Reihe zu kriegen, und sie verstand nicht warum. Bill verstand das vermutlich auch nicht. Aber immerhin war er bemüht zu helfen. Er hatte auch versucht, ihren Vater dazu zu überreden, sich auf ein Date mit einer hoffnungslos langweiligen Frau einzulassen, die sie mal bei Bill zu Hause kennengelernt hatten. Millies Mutter war gestorben, als Millie noch klein war. Das war bereits so lange her, dass sie sich kaum an sie erinnern konnte. Sie sah durchaus ein, dass ihr Vater seine Zeit nicht immer nur mit ihr verbringen konnte. Aber wenn schon nicht auf eine gute Fee, so hoffte sie doch wenigstens auf ein Wesen, mit dem sie über etwas anderes sprechen konnte als über Schuhe.
Aber ein paar Tage später stand Millie wieder vor dem Laborkomplex. Zuerst war sie fest entschlossen gewesen, niemals wiederzukommen. Doch dann dachte sie, dass sie vielleicht Beweise dafür finden könnte, was hier wirklich vor sich ging. Und wenn ihr Vater die sähe, ließ er sich möglicherweise davon überzeugen, irgendwo anders die Fenster zu putzen. Und dann würde sie ihrem Abgeordneten schreiben. Etwas, das ihr Vater ihr letztes Jahr geraten hatte, als sie wegen des Menschen-für-die-ethisch-korrekte-Behandlung-von-Tieren-Standes und deren Bilder so aufgebracht gewesen war. Millie hatte geschrieben und einen Antwortbrief erhalten, in dem stand, dass ihr Anliegen zur Kenntnis genommen worden sei und geprüft werden würde. Mehr war dann allerdings nicht passiert.
Jetzt also war sie wieder hier und putzte die Erdgeschossfenster und die hässlichen Glastüren.
Der Wachmann schien genug davon zu haben, ihr Grimassen zu schneiden, und hatte sich hinter seiner Zeitung verschanzt. Frustrierenderweise war er die einzige Person gewesen, die sie den ganzen Nachmittag über gesehen hatte. Kein Lieferant war an der Hinterfront erschienen, und nicht einmal ein gehetzter Schlipsträger hatte das Gebäude verlassen. Sie war kein bisschen schlauer als letzte Woche.
Die Mittagspause lag schon Ewigkeiten zurück. Sie war sich sicher, dass es bald Zeit war, nach Hause zu gehen. Nach ihrer Schätzung hatten sie noch fünfzehn Minuten vor sich, höchstens eine halbe Stunde, und dann könnten sie gehen.
Millie musste nur noch die Fronttüren reinigen, und das wär’s dann. Als sie sich bückte, um noch mehr Wasser aufzunehmen, nahm sie plötzlich drinnen eine Bewegung wahr. Vom Ende des langen Korridors kam etwas an der Rezeption vorbeigeflitzt. Es bewegte sich so schnell auf die Glastüren zu, dass Millie nicht mehr als einen grauen Flecken erkennen konnte. Aber sie war sich ziemlich sicher, dass es, was immer es auch war, vier Beine und einen Schwanz hatte. Millie drückte auf den Schalter, um die Tür zu öffnen. Der Sicherheitsmann schaute nicht hoch. Warum sollte er auch? Millie wurschtelte schließlich schon über zwanzig Minuten an den Türen herum. Das Etwas schoss durch den schmalen Türspalt und blieb so abrupt stehen, dass es eine kleine Staubwolke gab.
»Hallo, wer bist du denn?«, flüsterte Millie.
»Pardon«, sagte die Katze. »Für ’öflichkeiten ist nun wirklich keine Zeit. Könntest du mich jetzt bitte verstecken, und dann stellen wir uns später richtig vor?«
3
Millie vollführte einen stattlichen Zehn-Zentimeter-Satz in die Luft. »W… Wa…?«, stammelte sie.
»Kein Grund, Angst zu haben. Ich bin eine Katze und somit nicht dein natürlicher Fressfeind. Du ’ast ja nicht mal einen natürlichen Fressfeind. Okay, wenn du in Kenia wärst, vielleicht. Dann könnten die Löwen … Na ja … Dafür ist jetzt auch keine Zeit.« Die Katze sah Millie an, als ob sie diejenige wäre, die überraschenderweise sprechen konnte. »Ich stecke etwas in Schwierigkeiten. Wenn du mir also ’elfen könntest …? Dein Unterkiefer ’ängt übrigens ’erunter.«
»Du kannst …«
»Reden? Ja! Warum ich das kann? Das ist eine lange Geschichte. Glücklicherweise bin ich in der Lage, dass ich sie dir selbst erzählen kann. Aber nicht jetzt.« Die Katze fauchte jetzt fast und blickte sich argwöhnisch um.
Millie kam wieder zur Besinnung, wenn auch nur vorübergehend. »Natürlich kann ich dich verstecken. Also los.« In einer einzigen fließenden Bewegung hob sie ihren Pullover auf, den sie auf den Boden hatte fallen lassen, als die Sonne herausgekommen war, und schnappte sich dabei die Katze, die dankbar aufseufzte. Millie rannte zum Van hinüber und legte das Pulloverpaket auf einen Stapel Putztücher im Kofferraum.
»Alors, geh wieder an deine Arbeit zurück«, kommandierte die Katze. »Und was auch immer du gefragt wirst, lüg einfach.«
Millie rannte zur Glastür zurück, verschloss sie wieder und hob ihr Putztuch auf. Die letzten paar Schritte verlangsamte sie ihr Tempo jedoch, damit der Mann vom Wachdienst nicht auf die Idee kam, dass hier etwas Komisches vor sich ging. Schließlich sprintete sie normalerweise ja auch nicht einfach so ohne Grund in der Gegend herum.
Sie schaffte es gerade noch rechtzeitig. Denn ein paar Sekunden später kam ein Mann durch den Korridor auf den Wachmann zugerannt.
Seine Beine wirbelten nur so über den Boden dahin, und sein Laborkittel flatterte in alle Richtungen. Schwer atmend landete er am Rezeptionstresen. Millie spitzte die Ohren, aber sie konnte nichts durch die Türen hindurch hören. Sie sah, wie der Mann vom Wachdienst einmal den Kopf schüttelte. Dann noch einmal, dieses Mal energischer. Er hörte eine Minute lang zu und drehte seinen Kopf dann ruckartig in Millies Richtung. Sie versuchte, sehr geschäftig mit ihrem Eimer auszusehen. Der Katzenjäger kam auf die Tür zugestürzt, die sich jedoch nicht öffnete.
»Hallo? Hallo?«, stieß er hervor.
»Hallo«, sagte Millie.
»Die Tür geht nicht auf«, rief der Mann wild gestikulierend.
»Nein, ich musste sie abschließen«, erklärte Millie, während sie die Verriegelung löste und die Tür freigab. »Wenn ich die Tür nicht verschlossen hätte, könnte ich sie nicht putzen. Richtig? Sie würde dauernd aufgehen.«
»Wie lange war die Tür verschlossen?«
Millie sah, dass der Mann vom Wachdienst sie intensiv musterte.
»Ungefähr acht Sekunden lang – bevor Sie hier angerannt kamen.« Das wäre die Wahrheit gewesen. Die moralisch richtige Antwort jedoch lautete: »Die letzten zehn Minuten. Und ich habe übrigens die gleiche Nase wie Pinocchio. Ich kann unmöglich lügen, ohne dass Sie das sehen würden.«
Aber die Tür war offen gewesen, als Millie die Katze herausgelassen hatte. Und vielleicht hatte der Mann vom Wachdienst – auch wenn er nicht aufgeschaut hatte – den Luftzug gespürt, der dabei entstanden war. Deswegen beschloss Millie, auf Nummer sicher zu gehen, und sagte: »Weiß nicht. Ne Weile.«
»Wie lange?«, fragte der Mann noch einmal. Es lag unverkennbar Hysterie in seiner Stimme.
»So lange, wie es dauert, die Türen zu putzen.«
»Wie lange war sie hier?«, fragte der Mann den Wachdienst aus.
»Ungefähr eine halbe Stunde«, schätzte der.
»Die Tür waren die ganze Zeit verschlossen?«
Millie nickte bestätigend. Offenbar hatte ihr der Mann vom Wachdienst keinerlei Aufmerksamkeit geschenkt.
»Verdammt, die muss den anderen Weg genommen haben …« Der Mann trat den Rückweg auf den Korridor an. »Verschließ die Türen wieder, Mädchen. Sofort!« Millie zuckte die Achseln und tat, wie ihr befohlen. Der Mann vom Wachdienst zuckte ebenfalls die Achseln und verzog das Gesicht, um anzudeuten, dass er den Mann ein wenig sonderbar fand.
Millie erwiderte seine Grimasse und machte ein genervtes Gesicht. Der Wachdienst nickte, verdrehte die Augen und wandte sich wieder seiner Zeitung zu.
Aufregung vorbei. Sie waren in Sicherheit.
Millie putzte das Fenster zu Ende und achtete dabei darauf, sich nicht zu sehr zu beeilen. Für den Fall, dass der Laborkittel-Mann wieder auftauchte. Dann ging sie zum Van zurück.
»Bist du okay?«, fragte sie leise und nahm den Pullover von der Katze.
»Ich stinke nach Reinigungsmittel, was nicht gerade mein Lebensziel war. Aber ansonsten geht es mir gut.«
»Sucht dich ein Mann im Laborkittel?«, fragte sie.
»Ja. ’ast du ihn an der Nase ’erumgeführt?«
»Ja. Dein Akzent ist lustig. Wo kommst du her?«
»Noch vor einer Minute konntest du nicht glauben, dass ich sprechen kann. Und jetzt ’ast du was an meiner Aussprache auszusetzen? Das ist nur, weil ich gerade so aufgeregt bin. Normalerweise spreche ich astreines ’ochdeutsch! Das ist ganz schön pingelig, weißt du.«
»Ich hab nichts auszusetzen … Ich war nur interessiert.«
»Aber du ’ast einen kritisierenden Ton in deiner Stimme.«
»Tut mir leid«, erwiderte Millie, die fand, dass die Katze selbst einen ziemlich kritisierenden Ton hatte.
»Ich bin aus …«
»Halt! Mein Vater kommt. Kannst du hier hineinkrabbeln?« Millie schnappte sich ihre Tasche von der Rückbank.
»Muss ich?«, fragte die Katze angeekelt und beäugte mit geringschätzigem Blick Millies Leinenrucksack, der mit Sternen, Abzeichen und Zierbändern übersät war.
»Ja!«, sagte Millie entschieden. Sie schob die Katze in den Rucksack, zog den Verschluss zu und drapierte ihren Pullover über den sich windenden Beutel, bevor sie zu ihrem Vater und Bill herumwirbelte, die auf den Van zukamen.
4
»Ich mach ein bisschen was am Computer, Dad«, rief Millie, kaum zu Hause angekommen, und stürmte die Treppen zu ihrem Zimmer hinauf. Sie hörte ihn noch etwas sagen, als sie die Tür hinter sich schloss. Aber sie nahm an, dass es, worum auch immer es sich handeln mochte, warten konnte. Sie öffnete ihren Kleiderschrank, der sich direkt hinter der Zimmertür befand. Wenn jemand die Tür zu ihrem Zimmer öffnete, würde er zuerst einmal gegen die Kleiderschranktür stoßen und käme nicht sofort hinein. Es war kein besonders ausgeklügeltes System, aber es bot einen gewissen Schutz vor unliebsamen Überraschungen. Vor allen in Notfällen, was für Millie die treffendste Bezeichnung für die aktuelle Lage zu sein schien.
Sie legte ihren Rucksack aufs Bett und öffnete ihn. »Du kannst rauskommen!«, sagte sie.
»Na, endlich!«, seufzte die Katze und bahnte sich ihren Weg ins Freie. »Ich dachte schon, ich muss ewig da drin bleiben.«
»Tut mir leid. Wir wohnen ziemlich weit vom Labor weg.«
»Unter den gegebenen Umständen ist das im Prinzip eine gute Sache. Es war nur ein bisschen eng da drin.«
Das Tier blickte noch einmal missbilligend auf die Tasche und streckte seinen Rücken.
»Ist das dein Zimmer?«, fragte es und blickte sich um.
»Japp.«
»Du hast einen eigenen Computer?« Die Katze schien beeindruckt zu sein.
»Japp.« Millie nickte. Der Computer war ihr Ein und Alles.
»Dann können wir also …« Die Katze begann nachzudenken.
»Was können wir?«
»Planen, wie wir Monty, Celeste und die anderen befreien.«
»Wie bitte?«
Die Katze fuhr mit ihren Überlegungen fort: »Ich meine, wenn wir …«
Millie fand, dass es an der Zeit war, die Kontrolle über die Situation zurückzugewinnen, ehe sie ihr ganz zu entgleiten drohte. »Stopp. Einen Moment bitte.«
Die Katze sah zu ihr auf und runzelte die Stirn.
»Könnten wir bitte noch mal von vorne anfangen? Ich bin Millie«, sagte Millie.
»Bonjour«, antwortete die Katze. »Ich bin Max.«
Sie blickten sich an, und Millie hielt Max zögernd ihre Hand entgegen. Max streckte eine Vorderpfote aus. Sie stupsten Hand und Pfote gegeneinander.
»So, sagt ihr also zur Begrüßung Hallo in England, oder wie? In Belgien küssen wir uns dreimal auf die Wange. Das ist freundlicher, finde ich.«
»Wie bist du hier gelandet, wenn du eigentlich aus Belgien kommst?«, fragte Millie mit weit aufgerissenen Augen. Sie hätte Max’ Akzent niemals einordnen können. Es klang fast wie Französisch und fast wie noch etwas anderes. Etwas, das dann vermutlich Belgisch war.
Max hatte eine überraschend tiefe Stimme. Obwohl man sich sicher fragen konnte, welche Stimmlage bei einer Katze eigentlich nicht überraschend gewesen wäre.
Max’ Augen verengten sich. »Per Katzenklau!«, fauchte er.
»Katzenklau?« Millie ließ sich im Schneidersitz auf dem Bett nieder.
»Genau. Ich schlenderte gerade durch Ixelles. Das ist in der Nähe von die Avenue Louise. In Brüssel.«
»Wo du gelebt hast?«
»Wo ich immer noch lebe«, korrigierte Max sie. »Ich bin nur in diesem Moment nicht dort. Ich schätze, es war so um die Mittagszeit, und ich dachte darüber nach, etwas Schönes zum Essen aufzutreiben. Vielleicht in die Küche eines dieser Cafés …«
»Du wolltest Essen aus einem Café stehlen?«
»Nicht stehlen. Befreien.«
»So könnte man es natürlich auch nennen.«
»Er ist ein schlauer Mann. Wie auch immer. Ich schlenderte auf einer schmalen Gasse gerade zu La Perruche zurück – meinem Lieblingscafé, in der sie sehr gutes Huhn servieren – und kam an einem grauen Lieferwagen vorbei. Und als ich daran vorbeiging, schmiss jemand etwas über mich, ein … ich weiß das englische Wort nicht … Was ihr zum Fischfangen benutzt.«
»Ein Netz?«
»Ja. Ein Netz. Welch eine Demütigung: Ein Kater, gefangen wie ein Fisch!«
»Mit einer Angelleine gefangen zu werden wäre noch peinlicher gewesen«, versuchte Millie ihn zu trösten
»Stimmt.« Max nickte. »Das ist ein ganz anderes Dummheits-Level, das sonst nur ein Fisch erreichen kann. Ooooh? … Was ist das, das wie eine kleine Mahlzeit aussieht und an einem scharfen Metallhaken hängt? Ich werde es einfach mal mit meinem Maul umschließen. Das ist bestimmt die sicherste Weg, mehr herauszufinden. Oh! Jetzt bin ich gefangen, wer konnte das vorhersehen? – Jeder, bis auf den blöden Fisch, natürlich. Kein Wunder, dass die am Aussterben sind. Sie haben es nicht besser verdient.«
»Ich bin mir nicht sicher, ob das der exakte Grund für ihr Aussterben ist«, sagte Millie, die es für wenig wahrscheinlich hielt, dass man industriellen Fischfang mit Angelruten betrieb.
Max ignorierte vornehm ihren Einwand. Man konnte eben nicht jede Meinungsverschiedenheit aus der Welt schaffen. Vor allem nicht, wenn Fische involviert waren.
»Außerdem war dieses Netz verdammt schwer, so dass ich mich nicht mehr befreien konnte. Und ehe ich wusste, wie mir geschah, wurde ich in den Lieferwagen gehoben und in eine Box gesteckt.«
»Du musst ganz schön Angst gehabt haben«, sagte Millie mitfühlend.
»Keine Angst. Niemals. Katzen sind sehr tapfer, weißt du. Eher wütend und unsicher, wie man entkommen kann. Und vielleicht ein bisschen nervös, weißt du.« Der Kater beobachtete sie argwöhnisch, als er fortfuhr. »Danach wurde ich in einen Raum verfrachtet, der voller Kisten mit anderen Katzen war. Und am nächsten Tag fand ich mich, zusammen mit einem Dutzend oder noch mehr Katzen, in einem großen Auto mit schwarz getönten Scheiben wieder. Wir fuhren eine Weile, und dann ging es auf so ein großes Boot.« Max schauderte. Die Entführung, die schlimme Erinnerung an die lange, beengte Fahrt und die blanke Wut, dass man ihn gezwungen hatte, auf dem Wasser zu reisen – was für Katzen genauso unnatürlich war, wie auf Flügeln durch die Luft zu fliegen … Das alles war einfach zu viel gewesen.
»Ich hab dieses Auto gesehen!«, rief Millie und bemühte sich sofort, leise zu sprechen, damit ihr Vater nichts mitbekam. »Letzte Woche. Da war so ein Typ. Der hatte ein paar Kisten, die …«
»Die was?«
»Die miauten«, flüsterte sie.
»Das müsste die neueste Lieferung gewesen sein. Noch mehr geklaute Katzen!«
»Miiiiiilliiiiiie!«, schrie ihr Vater von unten. »Essen ist fertig.«
»Ich komm sofort!«, rief sie.
»Ich bin gleich wieder zurück«, sagte sie zu Max. »Na ja, es wird eine halbe Stunde dauern. Hast du Hunger? Ich bring dir was mit.«
»Ein wenig Hühnchen oder einen Fisch vielleicht. Das wäre schön.«
»Äh.«
»Äh, was?«
»Ich bin Vegetarierin. Wir haben eigentlich nie Fleisch im Haus.«
»Kein Fleisch?« Max blickte sie an, als hätte sie ihm gerade eröffnet, dass sie und ihr Vater ihren Lebensunterhalt damit verdienten, aus Katzenfellen Mäntel und Hüte zu fertigen.
»Na ja, du würdest es auch nicht mögen, gegessen zu werden.«
»Das ist wahr. Aber Fische sind doof und Hühner hässlich! Ein Raubtier zu fressen ist was anderes … Wir sind klug und …«
»Hör mal, nur weil du etwas umbringen kannst, heißt das nicht, dass du es auch sollst. Das ist doch wohl Ehrensache! Es sei denn, man hat keine andere Wahl. Etwa wenn ich auf einer einsamen Insel wäre oder so was und Fisch essen müsste, um nicht zu verhungern.« Bei diesem Gedanken runzelte Millie finster die Stirn, obwohl die Wahrscheinlichkeit, dass sie in East Anglia irgendwie auf einer einsamen Insel landen würde, ziemlich gering war.
»Wenn wir alle so denken würden«, schnaubte Max, »würde die Welt von Mäusen überflutet werden.«
Millie überlegte eine Minute. »Okay. Du fängst Mäuse oder Vögel und isst sie. Schön. Aber Menschen müssen das nicht tun. Wir können alles essen.«
»So interessant diese feinsinnigen philosophischen Unterscheidungen auch sein mögen, die Frage ist doch: Was hast du sonst für mich zu essen?«
»Käse?«, traute Millie sich zu fragen.
»Käse geht für den Moment, danke. Aber morgen müssen wir was anderes organisieren. Ich kann nicht wie eine Comic-Maus von Käse leben. Ich brauche Aminosäuren, die nur in Fleisch enthalten sind.«
»Für eine Katze bist du ziemlich gut informiert.«
»Ich habe drei Monate in einem Labor verbracht. Da schnappt man ein paar Dinge auf.«
»Miiiilliiiiie!«
»Ich komm so schnell wie möglich zurück. Wenn du jemanden die Treppe hochkommen hörst, versteck dich unter dem Schreibtisch!«
Die Katze nahm einen leidenden Gesichtsausdruck an. »Besorg du mir lieber schnell ein großes Stück Käse. Du kannst es vielleicht so zurechtschneiden, dass es einem Spatz ähnelt. Oder einem Goldfisch. Eichhörnchen wäre auch okay.«
Millie machte sich nicht erst die Mühe, darauf zu antworten, und schloss die Tür hinter sich. Neugierig blickte sich die Katze in ihrem neuen Zuhause um.
5
Millie hatte das zweitgrößte Zimmer im Haus. Das größte hatte sich ihr Vater beim Einzug unter den Nagel gerissen. »Weil ich der Größte bin«, wie er zweifellos richtig aufgezeigt hatte. Das kleinste war für »Besucher« reserviert, wobei es sich dabei normalerweise um Freunde von Millie handelte. Max sah sich um. Noch nie zuvor war er in einem Mädchenzimmer gewesen. In Brüssel lebte er bei Sofie und ihrem Sohn Stef, der seiner Schätzung nach im gleichen Alter wie Millie sein musste. Max hatte immer gedacht, dass Mädchenzimmer, na ja, irgendwie … mädchenhafter aussehen würden. Mit viel Rosa und so. Millies Zimmer war absolut nicht so. An den Wänden hingen Luftaufnahmen. Ein paar davon zeigten das Meer, und der Kater schauderte erneut. Es gab etliche Regale voller Bücher. Auf dem Schreibtisch standen ein Computer, ein Drucker sowie ein paar andere Geräte, die er nicht benennen konnte. Vielleicht ein Scanner, überlegte er, obgleich er nicht genau wusste, was das eigentlich war. Er sprang auf den Schreibtisch und betrachtete Millies Computer näher. Das Gerät erschien ihm kleiner und neuer zu sein als die im Labor.
Max kam zu dem Schluss, dass das Zimmer in vielerlei Hinsicht das Wesen seiner Besitzerin widerspiegelte. Millie hatte sehr kluge Gesichtszüge, aber sie war nicht besonders mädchenhaft oder hübsch. Im Notfall hätte Max vermutlich versucht, eine etwas nettere Beschreibung für sie zu finden. Na ja, vielleicht auch nicht. Eine Katze war schließlich dazu verpflichtet, stets die Wahrheit zu sagen. Millie hatte dunkelbraunes Haar und eine Frisur, die man selbst bei wohlwollender Betrachtung nur als ziemliches Durcheinander bezeichnen konnte. Sie war auch nicht sehr groß für ihr Alter, und so wie sie sich kleidete, mochte sie ebenso gut als Junge durchgehen. Doch im Grunde spielte das alles keine Rolle. Millie konnte in Notsituationen klar denken. Und das hatte Max heute am meisten gebraucht und würde es auch weiterhin brauchen, wenn er sein Versprechen gegenüber Monty halten wollte.
Max blinzelte. Einige Katzen im Labor waren ziemlich langweilig gewesen, fand er. Und ein oder zwei sogar ziemlich unangenehm. Vor allem ein riesiger fuchsfarbener Kater namens Ariston, der versucht hatte, Max gleich bei seiner Ankunft zu drangsalieren. Und dann war da der Kater, der sich für ihn eingesetzt und Ariston daran gehindert hatte, ihn zu schikanieren: Monty. Mit seinen fünfzehn Jahren war er die älteste Katze im Labor gewesen und als Einziger zusammen mit Familienangehörigen gekidnappt worden. Montys Tochter Celeste hatte im Käfig unter Max gewohnt. Diese beiden waren die Einzigen gewesen, die Max nicht ausgelacht hatten, als er von seinen Fluchtplänen erzählte.
Max hatte den beiden versprochen, zurückzukommen und sie zu retten, sobald sich ihm die Chance dazu bot.
Bei der bloßen Vorstellung, dass Max es in die Welt nach draußen schaffen könnte – geschweige denn zu seinen Freunden zurückkehrte –, hatte Ariston nur höhnisch geschnaubt. Selbst Monty hatte Max bloß traurig zugenickt, so als würde er nicht richtig glauben, dass Max es schaffen könnte. Nur Celeste hatte ihm, als er seine Flucht in die Tat umsetzte, noch zugeflüstert: »Komm zurück, Max, und rette uns. Wir warten auf dich.« Max holte tief Luft. Anerkennend blickte er sich auf Millies mit elektronischen Geräten vollgestelltem Schreibtisch um und begann, einen Plan zu schmieden.
Max hatte keine Ahnung, wie lange er dagesessen und gegrübelt hatte, als er ein verräterisches Knarren auf der Treppe hörte. In weniger als einer Sekunde war er unter dem Bett verschwunden. Die Tür öffnete sich und wurde rasch wieder geschlossen.
»Max?«
Er kroch unter dem Bett hervor, schaute Millie vorwurfsvoll an und nieste zweimal.
»Tut mir leid«, sagte sie schuldbewusst. »Ich nehme mir ständig vor, mal unter dem Bett zu saugen, aber ich vergesse es immer. Deshalb dachte ich, du solltest dich lieber unter dem Schreibtisch verstecken.«
»Ja«, stimmte Max kläglich zu.
»Ich habe dir Käse mitgebracht.«
»Vielen Dank.«
»Und jetzt erzähl mal was über das Haverham-Labor.«
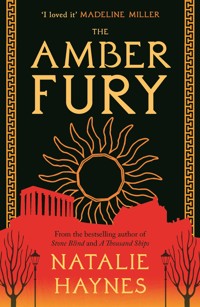
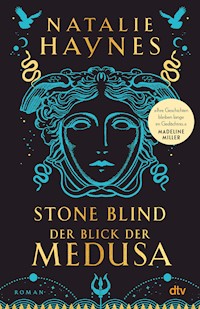
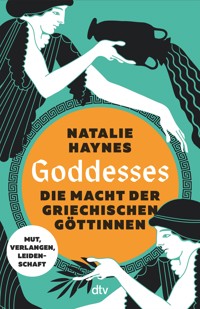
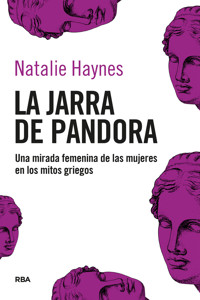

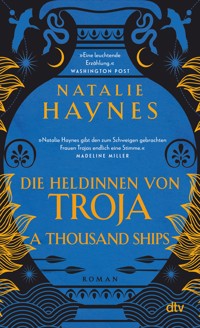













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)









