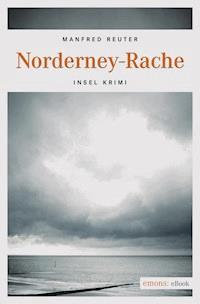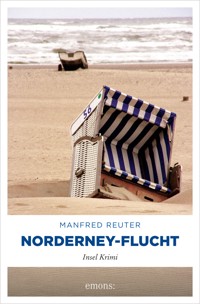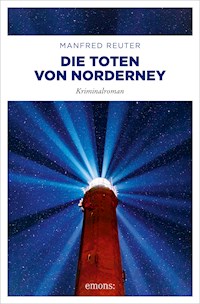
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Cold Case Norderney – Gent Visser, Band 4 An der Ostspitze von Norderney wird die Leiche einer seit zwölf Jahren vermissten jungen Frau entdeckt. Oberkommissar Gent Visser rollt den Fall neu auf – und setzt damit eine Reihe verhängnisvoller Ereignisse in Gang ... In Die Toten von Norderney nimmt ein alter Fall um eine lange vermisste Insulanerin neue Fahrt auf. Ein spannungsgeladener Krimi mit starken Figuren und überraschenden Wendungen – bis zur letzten Seite. Nordsee-Liebhaber und Krimifans kommen hier gleichermaßen auf ihre Kosten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 350
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Manfred Reuter, Journalist, Jahrgang 1957, stammt aus der Eifel und arbeitet als freier Autor in Ostfriesland, vornehmlich auf Norderney. Er lebt mit seiner Familie in Aurich.
www.reutermanfred.de
www.facebook.de/manfredreuterkrimi
www.instagram.com/norderneykrimi
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
Lust auf mehr? Laden Sie sich die »LChoice«-App runter, scannen Sie den QR-Code und bestellen Sie weitere Bücher direkt in Ihrer Buchhandlung.
© 2020 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: mauritius images/Marcel Kusch/Alamy
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept
von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Christine Derrer
eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-601-2
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Das Leben verlieren ist keine große Sache. Aber zusehen, wie der Sinn des Lebens aufgelöst wird, das ist unerträglich.
Albert Camus (1913–1960),
EINS
»Mir ging ganz schön die Düse. Das war Angst. So was wie am Sonntag habe ich noch nie gespürt. Ich werde das Gefühl nicht mehr los. Und das, obwohl ich ja eigentlich gar keine Angst haben musste. Aber sie war da, und sie wollte einfach nicht gehen. Wirklich heftig. Da kriegen mich keine zehn Pferde mehr hin.«
Exakt dreihundertvierunddreißig Reaktionen erhielt Janko Rass auf diesen Facebook-Post, außerdem vierundzwanzig sogenannter Freundschaftsanfragen. Innerhalb einer guten halben Stunde hatten sich die Kommentare auf neunundachtzig summiert. Sie reichten von »Krass«, »Armer Janko« und »fuck alter, prutahle Scheise« bis »Die Mörder sind unter uns«. Mit rasender Geschwindigkeit verbreiteten sich ebenso die Schock-, Tränen- und Angst-Emojis auf Jankos Seite. Solch einen Ansturm auf seinen Account »Janko-Insel-Pictures« hatte er noch nie erlebt. Der vergangene Sonntag hatte ihn ganz offensichtlich zu einem kleinen Helden gemacht. Aber Janko wusste, dass es sich hier – zumindest facebooktechnisch – nur um eine Momentaufnahme handelte, denn in den sozialen Netzwerken liegt das Verfallsdatum von Entsetzen und Empörung bekanntermaßen extrem nahe am Ereignis.
Der durchdringende Schrei einer Möwe hatte Janko Rass zwei Tage zuvor unsanft aus dem Schlaf gerissen. Nachdem er die erste Nachthälfte über kaum geschlafen hatte, immer wieder aufgewacht und über die ungelösten Kleinigkeiten des Alltags ins Grübeln geraten war, entschloss er sich, das Möwengekreische zum Anlass zu nehmen und aufzustehen. Nach einem extrastarken Kaffee packte er die Kameratasche, schwang sich in seinen Jeep und bretterte Richtung Ostheller. Nach dieser bescheidenen Nacht konnte der Tag nur gut werden, dachte er. Und tatsächlich. Vom Wetter her war es mit Sicherheit eine kluge Entscheidung, den Vormittag für einen ausgedehnten Foto-Spaziergang zu nutzen. Gewiss würde es ihm guttun, ein paar Stunden mit sich und seiner Kamera allein zu sein, überlegte Janko, als er den Wagen abschloss und sich vom östlichsten Parkplatz der Insel aus auf den Weg machte in Richtung Wrack. Nur wenige Schritte musste er gehen, da hörte er von Norden her schon die Brandung, während von der südlichen, der Wattenmeerseite, die Sonne vorsichtig über die Dünen blinzelte und orangefarbene Streifen zwischen die Wolken malte. Janko kniff die kleinen braunen Augen zusammen und genoss den Wind, der deutlich auffrischte und sein blasses, ein wenig kindliches Gesicht berührte.
Der zweistündige Fußmarsch zum Wrack wirkte stets befreiend auf ihn. In den seltensten Fällen traf er zu dieser frühen Stunde auf Menschen, dafür schenkten ihm die sich vor ihm ausbreitenden Dünentäler durchdringende Stille und den unverstellten Blick auf eine Inselnatur, die in diesem Abschnitt optisch zwar extrem derb wirkte, in Wirklichkeit aber sensibel wie ein verletztes Gemüt war. Tagtäglich hatte sie sich zahlreicher Angriffe zu erwehren. Schuhe, Scherben, Schrott: Wie ein geschundener Körper spuckte die Nordsee aus, was ihr Magen nicht mehr fassen konnte. Die Menschen taten also gut daran, sorgsam mit ihr umzugehen, wollten sie den Zauber der Insel auch künftig genießen. Janko wusste um all die magischen Momente: Die sich bisweilen stündlich ändernden Farben und Formen der Dünenlandschaft wirkten mitunter fremdartig schön und schauderhaft zugleich auf ihn, und jetzt noch viel mehr, da er auf der Aussichtsplattform der Möwendüne stand und sich vollkommen unerwartet mächtige Wolken vor die Sonne schoben. Innerhalb weniger Minuten kesselte eine vom Meer hereinschwebende Nebelformation die komplette Insel ein, als plane sie, das Eiland zu verschlingen. Janko wusste: Hier hatte er es mit Seenebel zu tun, einem Naturphänomen, das ihm schon als Kind Angst und Schrecken eingejagt hatte. »Grau Katt« nannten die Norderneyer diese Form des Nebels, und wenn sie davon sprachen, lief den meisten gleich ein kalter Schauder über die Haut. Denn wie eine mächtige graue Katze schlich der Nebel heran; düster, lautlos und kühl. Es gab kaum einen Norderneyer, der keine eigene Geschichte über die Grau Katt kannte; und immer wenn sie davon erzählten, wurde es im Raum gleich totenstill.
Auch heute glich diese undurchdringliche Wand aus unzähligen allerfeinsten Wassertröpfchen einer Bedrohung, die sich wie eine bis zum Himmel reichende Mauer, grau und frostig, auf ihn zuschob. Die Unentrinnbarkeit aus diesem Nebelfeld empfand Janko als extrem unangenehm und beklemmend. Er wickelte ein Stück Stoff, das er immer bei sich trug, um seine am Trageriemen baumelnde, sündhaft teure Kamera. Er wollte sie unter allen Umständen vor Feuchtigkeit schützen, denn der Nebel legte sich wie ein nasses Tuch auf alles, was sich ihm in den Weg stellte, und hinterließ auf allem, was er berührte, deutliche Spuren. Jetzt, da es binnen weniger Minuten grimmiger und die Sicht immer schlechter wurde, zog Janko sich die Jacke über die schmalen Schultern und stellte den Kragen hoch. Der Gedanke, hier so weit draußen ganz allein zu sein und womöglich die Orientierung zu verlieren, trieb ihm kalten Schweiß auf die Stirn. Er spürte einen Druck in der Brust, so, als wäre er von einem Faustschlag getroffen worden. Außerdem beschlich ihn mehr und mehr das Gefühl, dass jemand hinter ihm herlief.
Grau Katt, dachte er. Ob es sie wirklich gibt? Das Wrack nun endlich vor Augen, drehte er sich trotzdem immer wieder um. Natürlich ist da niemand, machte er sich im Stillen Mut. Doch mit der unaufhaltsam sinkenden Temperatur und den stärker werdenden Böen, die pfeifend und heulend an den rostigen Planken des alten Saugbaggers schliffen, spürte er plötzlich ein Brennen im Magen. Janko rang nach Luft. Einzig die Aussicht, das seit mehr als fünf Jahrzehnten hier ruhende Schiffswrack in dieser besonderen Wetterlage fotografieren zu können, hielt ihn auf den Beinen. Bei Instagram würden die Aufnahmen ihm viele hundert Likes und zahlreiche neue Follower bringen, vielleicht würde es eines der Bilder sogar bis in eine Ausstellung im Norderneyer Conversationshaus schaffen. Fotos vom Wrack waren begehrt.
Die meisten Touristen, auch sehr viele Einheimische, schafften es nicht ein einziges Mal im Leben, so weit hinaus zum heimlichen Wahrzeichen Norderneys zu laufen. Der Weg war für viele zu beschwerlich. Die Wanderung konnte sich zu einem kraftraubenden Zickzackkurs durch die Dünen entwickeln, wenn man sich nicht auskannte. Nicht wenige brachen deshalb unterwegs ab, weil sie entkräftet waren und sie der Frust packte. Vom Wrack selbst hatten die meisten Leute deshalb auch eine vollkommen falsche Vorstellung. Sie kannten es nur von mehr oder weniger gelungenen Sommerbildern, dachten, das alte Schiff wäre groß, bunt, erhaben. Doch die Szenerie wechselte oft. Wind und Sand spielten mit dem, was übrig geblieben war bei der schicksalhaften Havarie der »Capella« im Winter 1967. Je nach Witterung lag der rostige Schiffsrumpf mal fast komplett eingesandet da, mal befand er sich in einer Wasserlache, ein anderes Mal hatte eine Sturmflut die »Capella« wiederum nahezu freigespült.
Auch heute trieb die Natur ihr Spiel mit dem Norderneyer Wrack. Hinzu kam noch dieser Seenebel, der nun die gesamte Ostspitze aufzusaugen und in seinem nicht enden wollenden Schlund verschwinden zu lassen drohte.
Janko nahm das Tuch von seiner EOS und legte sich auf den Bauch. Er tauchte auf diese Weise unter der gigantischen Nebelwand ab und richtete den Fokus der Kamera auf die nun klar erkennbaren rostigen, aber tropfnassen Kanten, auf die Planken und die mächtige Stahlwinde des Wracks. Gleichzeitig drückte der Nebel wie ein konturlos schwebender Geist unnachgiebig und immer tiefer in das Schiff. Janko wusste schon jetzt, dass ihm diese Bilder eine Menge Anerkennung einbringen würden.
Nach den ersten fünfzehn bis zwanzig Aufnahmen drehte er sich auf den Rücken, um das Ergebnis im Display in Ruhe zu betrachten. Was er sah, gefiel ihm außerordentlich. Doch dann stellten sich ihm die Haare auf. Er benötigte einige Sekunden, um zu realisieren, dass er ein furchteinflößendes Detail zuvor übersehen hatte und es erst jetzt, auf dem Display, wahrnahm. Gleichzeitig wurde ihm klar, dass dieses Ding sich nur wenige Zentimeter neben seinem Kopf befinden musste. Da durchströmte ein gewaltiger Schauer seinen gesamten Körper. Und von der einen Sekunde auf die andere war die Angst wieder da, viel intensiver noch als zuvor, als der Nebel aufgezogen war und ihm fast den Atem genommen hatte. Der blanke Horror bäumte sich vor Janko auf und hielt ihn fest umklammert.
Es dauerte eine kleine Ewigkeit, bis er es wagte, sich aufzurichten, um die Sandkuhle vor dem Wrack mit eigenen Augen zu betrachten. Ihn durchfuhr ein heftiges Reißen in der Brust, hinzu kamen Schwindel und Zittern am ganzen Körper. Plötzlich sah Janko den Nebel nicht mehr, auch nicht mehr das Wrack. Das Kameradisplay begann vor seinen Augen zu verschwimmen, wurde schließlich schwarz, und der salzig-brackige Geruch des Wattenmeeres drang ebenfalls nicht mehr zu ihm vor. Dann gaben die Beine nach, und Janko sackte in sich zusammen. Seine rechte Hand schlug gegen den Schiffsrumpf, sein Kopf klatschte in den Sand, unmittelbar neben der skelettierten Hand, von der man meinen konnte, sie wollte nach ihm greifen.
***
Als Oberkommissar Gent Visser den Ostheller erreichte, war die Schranke am Eingang zum Nationalpark bereits geöffnet. Die Insel-Feuerwehr war einmal mehr verdammt schnell unterwegs, gleichzeitig hatten die Jungs daran gedacht, zwei Kameraden am Parkplatz zurückzulassen, um den Bereich abzuriegeln. Hier kam ab sofort niemand mehr durch. Auch nicht zu Fuß. Als Visser die Feuerwehrleute sah, drosselte er die Geschwindigkeit, schob den bulligen Kopf aus dem Fenster und grüßte die Kameraden im Vorbeifahren, indem er mit einem Finger an die Schläfe tippte und ihnen ein kurzes »He!« entgegenbrummte. Dann gruben sich die Reifen des blau-silbernen Pritschenbullis in den Sand, und auf ging die wilde Fahrt am Spülsaum entlang in Richtung Wrack.
»Hier Florian 22-43-01. Wir sind nun am Objekt. Was sollen wir tun?«
Als er diesen Funkspruch hörte, war Visser nicht nur klar, dass die Feuerwehrleute mit dem LF 8, also dem großen Gerödel, unterwegs waren, er wusste nun auch, dass die Norderneyer Floriansjünger es geschafft hatten, vor ihm am Zielort zu sein. So etwas konnte ihn bisweilen bei der Ehre packen. Was ihn diesmal allerdings rasend machte, war die Frage, die von den Wehrleuten in den Äther geschickt worden war. Denn das machte seiner Meinung nach in der Tat den Eindruck, die Polizei würde nicht zu Potte kommen.
»Die sollen die Klappe halten und sich um Janko kümmern, solange der Rettungsdienst noch nicht da ist«, schrie Visser seinem Kollegen Neumann gegen die Schläfe, der auf dem Beifahrersitz saß und verschüchtert den Kopf einzog. Denn er wusste: Wenn Visser seine cholerischen zehn Minuten bekam, war es besser, nichts zu sagen und einfach abzuwarten, bis er wieder auf normal schaltete.
»Kümmert euch um Janko. Wir sind in zwei Minuten da. Im Rückspiegel sehe ich schon die Kollegen von Promedica. Also seht erst mal zu, dass ihr mit eurem roten Lastwagen am Fundort keine Spuren kaputt fahrt. Ich hoffe, ihr habt nicht auch noch die Drehleiter dabei. Ende der Durchsage.«
Nach diesem Funkspruch erhielt Visser von Neumann nicht nur ein vorwurfsvolles Kopfschütteln, sondern gleichzeitig einen mitleidigen Blick. Visser wusste sofort, dass er mit dieser Ansage sowohl gegen die Funkdisziplin verstoßen hatte als auch rein inhaltlich weit übers Ziel hinausgeschossen war. Es gab diese Tage, da brauchte ihm bloß eine Laus über die Leber zu laufen, und schon war er nur schwer zu ertragen. Heute lag es vielleicht daran, dass ausgerechnet Janko Rass in Schwierigkeiten war. Janko und er waren seit vielen Jahren befreundet. Auch die Ehefrauen verstanden sich gut miteinander. Und weil Gent fast zwanzig Jahre älter war als Janko, war er für ihn über die Jahre so etwas wie ein väterlicher Freund geworden. Eine Insel wie Norderney ist eben überschaubar. Einer hilft dem anderen. Jeder kennt jeden. Zumindest die Insulaner untereinander.
Aus dieser Freundschaft resultierte in diesem Fall dann auch das Alarmierungsverfahren. Als Janko aus seiner Ohnmacht erwacht war und wieder das Gefühl bekam, festen Boden unter den Füßen zu haben, hatte er zunächst seinen Freund Gent Visser angerufen. Der wiederum informierte die Rettungsleitstelle in Wittmund und machte die Sache damit offiziell. Innerhalb weniger Minuten waren daraufhin alle auf der Insel befindlichen Rettungsdienste alarmiert. Bis auf die Tatsache, dass Gent es trotz des neuen allradgetriebenen Bullis nicht geschafft hatte, den Zielort als Erster zu erreichen, war er bei der Ankunft am Wrack mit dem Einsatz zufrieden. Denn nicht nur, dass kurz hinter ihm und Neumann die Rettungsassistenten von Promedica eintrafen; er sah auch, dass die »Eugen« bereits etwa auf Höhe der Möwendüne die Wellen beiseitepflügte. Der Rettungskreuzer der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger war nach der Alarmierung ebenso rasch ausgerückt wie die Schnelleinsatzgruppe und die Taucher der Norderneyer DLRG.
Visser sprang aus dem Bulli und stapfte durch den nassen Sand zum Feuerwehrwagen. Er schaute kurz nach links. Dort hatten die Wehrleute das Wrack großflächig mit rot-weißem Flatterband abgesperrt. An der Bugspitze standen Norderneys Stadtbrandmeister Ralf Junghoff und sein Stellvertreter Jörg Schon. Wieso sie immer noch ihre Helme und die schweren Jacken trugen, erschloss sich Visser nicht. Denn die Temperaturen hatten an diesem frühsommerlichen Sonntag im Mai wieder tüchtig zugelegt. Längst hatte sich der Seenebel aufgelöst, die Sonne schien, und der Himmel war makellos blau. Die beiden müssen doch schwitzen wie die Bullen, dachte Visser, dessen kurzärmeliges Polizeihemd wie gewohnt hinten aus der Hose hing und im Wind flatterte. Ein kurzer Blick reichte, um über den Rand seiner Hornbrille direkt vor den Schuhen der Feuerwehrleute ein merkwürdiges Gebilde zu sehen, bei dem es sich um die Skelettreste handeln musste. Visser passierte den Fundort und ging mit raumgreifenden Schritten ein paar Meter weiter zum LF 8. Dort saß Janko auf der Rückbank. Die Kameraden hatten ihn in eine Decke gehüllt. Er zitterte immer noch. Neben ihm lag der geöffnete Notfallrucksack der First Responder. Diese hatten ihm zunächst aber nur Traubenzucker und eine Wasserflasche gegeben. Visser lief um den Wagen herum und kletterte hinein. Er sank neben Janko ins Polster. Dann legte er ihm vorsichtig den Arm auf die Schulter und schaute ihn an.
»He. Wie geht’s? Was machst du denn für Sachen?«
»Ich weiß auch nicht, was mit mir los war. Wäre der Nebel nicht gewesen, wäre es wahrscheinlich nicht ganz so schauerlich gewesen. Ich hatte auch noch nichts gegessen heute Morgen.«
»Musst dich nicht entschuldigen. Aber mit Sicherheit hast du zu wenig getrunken, mein Lieber. Eine Strecke ist ungefähr fünf Kilometer lang. Du weißt doch: Wer zum Wrack geht, der muss sich mit Wasser eindecken. Alte Norderneyer Wanderregel.«
»Mir ist plötzlich schwarz vor Augen geworden. Aber mein Blutdruck ist inzwischen wieder okay.«
Visser lächelte und kratzte sich am schwarzsilbern glänzenden Dreitagebart. Er schaute auf Jankos Kameratasche. »Ich hoffe, die Bilder sind gut geworden. Hast doch garantiert welche gemacht.«
Nun lächelte auch Janko wieder. »Klar habe ich Bilder gemacht. Dafür hat es noch gereicht. Ich nenne sie ›Wrack mit Hand‹. Die Exklusivrechte sind bei mir.«
»Schick sie uns trotzdem. Für die Handakte.« Visser lächelte gequält. »Oh, Handakte. Schlechtes Wortspiel. Aber mail uns die Fotos rüber. Wir können sie möglicherweise gut gebrauchen.«
Visser sprang aus dem Fahrzeug und steuerte direkt auf das Wrack zu. Mit einem weit ausholenden Scherenschritt überwand er das Flatterband und drängte sich von hinten zwischen Ralf und Jörg, die in die Hocke gegangen waren, um die Hand näher zu betrachten. Als sie Visser bemerkten, standen sie auf. Dann baute Visser seine Einszweiundneunzig auf, fuhr die langen Arme aus, senkte den Kopf ein wenig und legte den beiden Feuerwehrleuten seine Pranken auf die Schultern. »Tut mir leid wegen eben. Das war unnötig.«
»Jo«, sagte Jörg.
Was folgte, war ein gedehnter Blickwechsel zwischen Jörg und Ralf, danach ein kurzes zustimmendes Nicken in Richtung Visser.
»Ist schon gut, Gent. All up stee«, sagte Ralf.
Visser presste die Lippen zusammen und schloss eine Sekunde lang die Augen. Er war erleichtert. Nun nickte auch er, was so viel wie »Danke« heißen sollte. Dann tippte er den beiden Feuerwehrleuten mit dem Finger auf die Helme und brummte noch einmal kurz. Nach exakt sechzehn Wörtern, zweimaligem Nicken und einem Brummen war das Männergespräch beendet und die Sache aus der Welt geschafft.
Visser hatte die Alarmierung am Morgen nur bedingt ernst genommen. In erster Linie hatte er sich um seinen Freund Janko gesorgt, gedacht, dass dieser überreagiert und ein paar skelettierte Tierknochen als die Hand eines Menschen wahrgenommen hätte. Jetzt, da Visser sich in den Sand kniete, die Brille absetzte und genau hinsah, bemerkte er gleich, dass er Janko mit dieser Vermutung unrecht getan hatte. Man musste kein Pathologe, Kriminaltechniker oder Orthopäde sein, um festzustellen, dass es sich hier um die Hand eines Menschen handelte. Visser rutschte noch ein wenig näher heran und stützte sich auf beiden Unterarmen ab. Was er sah, war eine komplett skelettierte, aber bis auf das Endglied des Zeigefingers vollständige Hand eines erwachsenen Menschen. Bis zum Handballen ragte sie aus dem Sand. Die Finger waren gestreckt. Hier brauchen wir die Kriminaltechnik samt Gerichtsmedizin aus Oldenburg, wusste Visser. Dann wuchtete er seinen Oberkörper wieder hoch, blieb aber zunächst noch auf den Knien. Sein Blick streifte die rostigen Reste der »Capella« und traf am Horizont auf die schäumende Nordsee. Im Rauschen der Brandung verloren sich seine Gedanken, und er ahnte nicht ansatzweise, was in den nächsten Tagen auf ihn zukommen würde.
Visser wusste nicht genau, wie lange er vor dem Wrack gehockt und vor sich hingeträumt hatte. Erst als ihm jemand auf die Schulter klopfte, schüttelte er sich und stand auf.
»Lass uns zur Wache fahren. Ich habe die Inspektion in Aurich schon informiert. Die schicken die Kollegen von Mord und Totschlag. Faust wird in spätestens zwei Stunden auf der Insel sein«, sagte Neumann. Er sah besorgt aus. Genau wie Visser. Der schaffte es nur mit größter Mühe, die Augen vom Wrack zu lösen. Tiefe Furchen gruben sich in seine Stirn. Sein schelmisches Grinsen war ihm abhandengekommen.
ZWEI
Vor dem Surf-Café herrschte am frühen Nachmittag helle Aufregung. Alle in der Nähe flanierenden Touristen – und dies waren nicht gerade wenige – mussten sich dieses Spektakel ansehen. Es blieb ihnen gar keine andere Wahl. Zischend und fauchend pflügten mächtige Rotorblätter die Luft über dem Norderneyer Januskopf. Gemessen am Lärmpegel wirkte der im Anflug befindliche Polizeihubschrauber regelrecht filigran.
Visser und Neumann hatten ihre Dienstmützen abgenommen und unter die Arme geklemmt. Visser überlegte kurz, dann nahm er auch die Brille ab, weil er nicht riskieren wollte, dass sie ihm von der Nase flog. Er hatte den silber-blauen Dienstpassat auf der Promenade Richtung Georgshöhe geparkt und vom Personal des Surf-Cafés die kniehohen Schachfiguren der Außenanlagen sicherheitshalber wegräumen lassen. Er wollte unter allen Umständen vermeiden, dass sie den Schaulustigen um die Ohren fliegen und sie sogar verletzen würden. Und das alles nur wegen einer Marotte. Denn es war nicht das erste Mal, dass Visser sich diesen Auftritt seines Kollegen Carlo Faust mit ansehen musste.
Faust war Chef des Fachkommissariats eins bei der Polizeiinspektion Aurich und damit in der vorgesetzten Dienststelle zuständig für Mord und Totschlag. Immer wenn es um schwerwiegende Fälle ging, reiste Faust an, allerdings nicht wie die normalsterblichen Polizisten mit der Fähre, sondern mit dem Heli. Visser und Faust hatten sich über die Jahre kennen- und schätzen gelernt, gleichwohl nötigten Fausts Extravaganzen dem bodenständigen Insulaner Gent Visser immer wieder Kopfschütteln ab.
Bei seiner Ankunft auf dem Deckwerk vor dem Surf-Café setzte Faust dieses Mal noch einen drauf. Denn als er gesehen hatte, dass die lokale Presse mit gezückten Kameras komplett versammelt war, wartete er nicht ab, bis der Hubschrauber den Boden berührte. Nein. Kurz vorher schwang er sich auf die Kufen und nahm die letzten eineinhalb Meter bis zum Inselboden mit einem Sprung. Nach dieser filmreifen Einlage zeigte das ansonsten hochgradig relaxte Inselpublikum doch die eine oder andere Emotion. Faust hatte einmal mehr für eine willkommene Abwechslung im Urlaubsalltag gesorgt.
Als der Hubschrauber wieder aufgestiegen und mit elegantem Schwung in Richtung Festland davongeflogen war, richtete sich Faust die dunkelgraue Bomberjacke, schließlich war diese bei dem Landemanöver deutlich über die Hüften gerutscht. So konnte das nicht bleiben. Nach einem prüfenden Blick in Richtung seiner Schusswaffe drehte er diese Körperseite zum Café hin. Dort standen immerhin die meisten Touristen. Er kontrollierte zunächst, ob die P2000 noch fest im Holster saß. Nachdem er festgestellt hatte, dass sich auch die Handfesseln und die Etuis für Pfefferspray und das Ersatzmagazin in korrektem Zustand befanden, strich er sich mit der mächtigen Hand über die Glatze und schlenderte auf Visser zu. Der hatte Brille und Dienstmütze inzwischen wieder aufgesetzt. Ein kräftiger Handschlag, eine kurze freundschaftliche Umarmung, dann gingen sie zum Auto. Mit Blaulicht und Sondersignal steuerte Neumann die beiden zum Parkplatz am Ostheller, wo der Pritschenbulli zur Weiterfahrt zum Wrack bereits auf sie wartete.
***
Er zog die Tür ins Schloss. Das Klicken war kaum zu hören. Er wusste, dass er nun mit sich und seiner Welt allein war. Wände als Schutz von allen Seiten. Boden unter den Füßen, Decke über dem Kopf. Raum ohne Fenster, Welt ohne Licht, Ort ohne Tag. Er öffnete die Augen und sah nichts.
Bis zur gegenüberliegenden Wand waren es genau viereinhalb Schritte. Je näher er ihr kam, desto deutlicher nahm er den süßlich bitteren Geruch der Holzvertäfelung wahr. Es war das Einzige, das man hier riechen konnte. Jeder weitere noch so leichte Duft hätte dem Raum die Bestimmung, den Zauber genommen. Längst musste er nicht mehr fühlen, nicht mehr tasten. Er kannte alles, jeden Millimeter, er sah alles, jedes Detail, jeden Gegenstand, mit geschlossenen Augen. Seine Hände folgten seinem Denken. Uneingeschränkt synchron.
Mit den Fingern der rechten Hand drehte er den Schlüssel. Auch hier ein nahezu geräuschloses Klicken, und die Tür sprang auf. Oben rechts das Gefäß. Edelchrom. Keine Ornamente, makellose Glätte, einundzwanzig Komma acht Zentimeter hoch, vierzig Komma drei Zentimeter Umfang an der breitesten Stelle, handgebürstet und poliert. Er griff mit beiden Händen danach und zog es fest an seine Brust. Die Augen blieben geschlossen, er drückte sie jetzt noch fester zu. Als er den kalten Behälter spürte, durchzog ihn ein Kribbeln.
Mit flackernden Lidern machte er nun zwei Schritte zurück, drehte sich nach links und ging zwei weitere Schritte nach vorn. Er hörte seinen Atem, sonst nichts. Er setzte sich auf den Stuhl und stellte das Gefäß auf dem Tisch ab. Der Filz unter dem Sockel sorgte dafür, dass auch dies lautlos geschah. Mit den Fingern der linken Hand schaltete er die Tischlampe an. Langsam, ja regelrecht irritiert, als würde er gerade aus einer Trance aufwachen, öffnete er seine Augen, sie sollten den dünnen, weichen Lichtschimmer nur stufenweise spüren. Auch diese Sinneskraft durfte nur behutsam zur vollen Entfaltung kommen. Jede noch so kleine Störung war zu vermeiden. Jedes Geräusch, jede abrupte Bewegung, alles Plötzliche würde der Handlung schaden.
Als sich seine Augen an das schummrige Licht gewöhnt hatten, sah er im Spiegelbild des kühl glänzenden Chromgefäßes, wie seine Hände danach griffen und es in die Mitte des Tisches stellten. Erst als er den Deckel vorsichtig aufgedreht hatte, streifte er die eng anliegenden Handschuhe ab. Das hauchdünne Leder schimmerte im Schein der Lampe, während die dünnen weißen Finger aus dem mit Kaschmir ausgestatteten Innenfutter glitten.
Während er nun damit begann, sich über das geöffnete Gefäß zu beugen, spürte er, wie ihn Wärme durchzog und ihm Blut in den Kopf schoss. Das Pochen des Herzens spürte er in Brust und Hals. In den Ohren erhöhte sich der Druck, in die Augen trat Glanz, auf die Wangen Röte. Und nun, da er den ausströmenden Duft aufsog, umschlossen seine Hände das Gefäß erneut, so, als wollte er es sich einverleiben und ein Teil dessen werden, was seine Vorstellungskraft gerade in ihn hineinströmen ließ. Doch er besann sich. Er durfte nicht überreagieren. Trotz des Abtauchens in die andere Welt durfte er die Haltung nicht verlieren.
Er streifte sich die Handschuhe wieder über und drehte den Deckel zurück auf das Gefäß. Aus der Schublade nahm er ein schwarzes Poliertuch und wischte damit die Abdrücke, die seine Finger hinterlassen hatten, weg. Dann schob er die Urne an den äußersten Rand des Tisches, öffnete die Kladde und schrieb:
»4370. Manchmal denke ich, es geht zu Ende. Es fällt mir immer schwerer, die richtigen Worte zu finden. Und dann frage ich mich, ob das alles noch Sinn ergibt, und mir wird kalt. Ja, auch jetzt. Ich sitze hier an diesem Tisch und friere. Komisch. Vor einigen Minuten war mir noch siedend heiß. Aber das war, als ich dich an meine Brust gedrückt habe. Manchmal frage ich mich, ob du das bemerkst. Es passiert ja jeden Tag, dass ich deine Nähe suche. Ich kann gar nicht anders. Ich sehe dich dann vor mir. Ich fühle deine Haut. Ich sehe, wie du meinen Blick erwiderst und wie du mir in die Augen schaust. Und dann, ohne Vorankündigung, verlässt mich dieses Gefühl. Es ist, als ob ich aufwache. Aus einem wunderbaren, bunten Traum. Danach fühle ich mich schlecht. Von einer Sekunde auf die andere. Manchmal wird mir sogar übel. Trotzdem werde ich nicht damit aufhören, deine Nähe zu suchen und das Glück zu genießen. Auch wenn es nur ein paar Minuten sind. Ich gebe nicht auf. Ich werde nie aufgeben. Denn die Liebe bleibt. Sie ist wie eine Sucht. So stelle ich mir Sucht vor. Meine Sucht ist das Verlangen nach dir. Nach deinem Lächeln, nach deinem Atem. Manchmal habe ich Angst davor, dass ich auch diesen Raum verlieren könnte, diese Welt, diesen Schatz. Es ist so viel und doch so wenig. Es ist alles, was ich habe. All das, was ich hier spüre, in den wenigen Momenten unserer Zweisamkeit, das ist mein Leben. Es ist auf diese wenigen Momente reduziert. Und ja, es ist ein Leben in der Versenkung, aber ich kann ihm nicht entrinnen. Vielleicht ist dieses Leben aber auch nicht mehr als eine Illusion, eine schlecht geschriebene Geschichte. Okay, Liebes, ich möchte dich mit diesen Gedanken nicht langweilen. Vor allem heute nicht. Denn sie werden unklar, sie verschwimmen wie dein Gesicht vor meinen Augen. Es ist besser, wenn ich gehe. Ich bringe dich zurück und mache mich wieder auf den Weg nach draußen. In die Kälte. In diesen gnadenlosen Alltag. Und trotzdem bin ich bei dir. Immer und überall. Morgen ist ein neuer Tag. Auch morgen zwitschern die Vögel in den Bäumen. Auch morgen rauscht die Brandung heran. Und auch morgen werde ich mich nach dir verzehren.«
Er löschte das Licht und griff nach dem Gefäß. Dann stand er auf. Schloss die Augen. Drehung nach rechts, zwei Schritte nach vorn. Drehung nach links, zwei Schritte nach vorn. Der Schrank war noch geöffnet. Er stellte die Urne an ihren Platz. Oben rechts. Er drückte die Tür ins Schloss und öffnete die Augen. Er sah nichts. Kein Licht. Kein Tag. So sollte es sein. Er drehte sich um, viereinhalb Schritte nach vorn. Halbe Armlänge bis zum Türknauf. Knappe Drehung nach links. Leises Klicken. Lichteinfall. Dann verließ er den Raum.
***
Faust stand mit verschränkten Armen vor dem Wrack. Sein ungläubiger Blick traf erst die Hand, dann Visser. Der hatte sich erneut in den Sand gekniet.
»Wenn wir mal davon ausgehen, dass es sich hier tatsächlich um die Hand eines Menschen handelt: Gibt es auf der Insel einen aktuellen Vermisstenfall?«
Vissers Miene verriet Erstaunen. »Wenn ich mal davon ausgehe, dass ein aktueller Fall circa vier bis acht Monate zurückliegt, dann frage ich mich, wie eine Hand während dieser kurzen Zeitspanne derart zum Skelettteil werden kann.«
»Du weißt genau, wie ich das gemeint habe. Da war doch mal –«, hob Faust erneut an, allerdings grätschte Visser ihm mitten in den Satz.
»Ja. Stimmt. Aber das halte ich für ausgeschlossen.«
»Wieso möchtest du nicht darüber reden?«, fragte Faust.
»Ich möchte zunächst die Ergebnisse der Kriminaltechniker abwarten. Und wer weiß, vielleicht brauchen wir hier sogar die Gerichtsmedizin vor Ort.«
Visser erhob sich. Nachdem er sich gestreckt und mit beiden Händen den Sand von den Knien gestreift hatte, stand er nun Schulter an Schulter mit Faust. Der hatte beschlossen, sich zum jetzigen Zeitpunkt unnötige Fragen an Visser zu verkneifen. Schließlich kannte er seinen Kollegen und Freund nur zu genau: Wenn dessen dickes Fell dünn zu werden drohte, musste man ihn erst mal eine Zeit lang in Ruhe lassen.
»Gut«, sagte Faust und steckte sein Handy zurück in die Hosentasche. »In ein paar Stunden sind wir schlauer. Die Kollegen vom archäologischen Polizeidienst haben die Fähre gerade eben verlassen. Die Feuerwehr hat sie am Hafen in Empfang genommen. In einer guten halben Stunde sind sie da. Die haben alles dabei. Vom Klappspaten bis zum feinen Pinsel. Wenn die sich hier in Trance gebuddelt haben, dann wissen wir auch bald, wem die Hand gehört oder ob es sich nur um einen Karnevalsartikel handelt.«
Fausts lockere Art gefiel Visser heute gar nicht. Die krampfigen Grimassen, die er ungewollt zog, verrieten, dass es in ihm brodelte. Er mochte zwar Fausts Humor und normalerweise auch dessen saloppe Sprüche, heute aber konnte er diese nur schwer ertragen. Um einem Wortgefecht mit seinem Kollegen aus dem Weg zu gehen, drehte er sich von Faust ab, verschränkte die Arme vor der Brust und ging ein paar Schritte in Richtung Ostspitze. Vor ihm lag Baltrum, die kleinste der sieben Ostfriesischen Inseln. Nur ein paar hundert Meter Nordsee trennten die beiden Inseln voneinander, und doch waren sie so unterschiedlich. Norderney, das mondäne, weltläufige Eiland im Westen, und Baltrum, die kleine und stille, aber schöne Nachbarin. Hier wie dort wärmte die Maiensonne an diesem Nachmittag den Flutsaum.
Der kalte Nebel vom frühen Morgen war längst vergessen. Visser genoss die leisen Minuten, allein mit sich und seiner Zigarette. Er schaute Richtung Süden. Dort sah er den Küstenstreifen, der sich wie eine fein gekrümmte Linie vor seinen Augen ausbreitete. Vom kleinen Hafen in Neßmersiel legte gerade eine Fähre ab. In einer guten halben Stunde würde sie Baltrum erreichen und jede Menge Touristen ausspucken. Visser nahm noch einen tiefen Zug, bevor er die Kippe in den Sand trat, um sie anschließend in der Streichholzschachtel und schlussendlich in der Hosentasche verschwinden zu lassen. Dann machte er kehrt. Er wollte wieder zurück in Richtung Wrack laufen. Seine Hemdsärmel flatterten im Wind. Gleichzeitig plusterte sein weißes Hemd sich mit dem entgegenkommenden Westwind am Rücken auf wie ein Ballon, was daran lag, dass es ausnahmsweise korrekt in der Hose steckte.
Während Vissers Zigarettenpause waren die Kollegen vom Kriminaltechnischen Dienst am Wrack eingetroffen. Die Spezialisten des Fachkommissariats fünf begannen sofort damit, ein großes geschlossenes Zelt aufzustellen und die Absperrung rund um den Fundort deutlich zu erweitern. Gleichzeitig nahmen drei Leichenspürhunde ihre Arbeit auf.
Als Visser das Zelt betrat und sah, wie die Kriminaltechniker anfingen, sich zunächst mit Spaten, dann mit immer feinerem Gerät weiträumigen Zugang zu einem eventuell vorhandenen kompletten Skelett zu verschaffen, musste er dann doch wenigstens einmal kurz schmunzeln. Vom Gesamtbild her nämlich glich der Fundort bei oberflächlicher Betrachtung in der Tat einer archäologischen Grabungsstätte. Die Hoffnung, dass an dieser Stelle die sterblichen Überreste eines mittelalterlichen Ostfriesenhäuptlings freigespült worden waren, ließ Visser erst gar nicht aufkommen. Um sich solchen Träumereien hinzugeben, war er dann doch zu sehr Realist. Also konzentrierte er sich jetzt lieber auf einen Hünen in weißem Polizeioverall, der sich tief über die skelettierte Hand beugte. Mit feinen Pinselstrichen entfernte er kaum sichtbare Sedimentanhaftungen. Es dauerte nur wenige Sekunden, dann erhob er sich.
»Ich kann euch noch nicht viel sagen. Nur: Hier handelt es sich definitiv um die rechte Hand eines Menschen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es die Hand einer Frau ist. Beziehungsweise war.« Dann setzte er seine Wasserflasche an und nahm einen großen Schluck. Die Kapuze behielt er dabei auf, sodass von seinem Gesicht nur die kleinen braunen Augen, die ausgeprägte Nase und der braune Vollbart zu sehen waren.
Visser behielt die Hände in den Hosentaschen und starrte auf den Boden. Nach ein paar Sekunden sagte er: »Was macht Sie so sicher, dass es eine weibliche Hand ist?«
»Ich vermute es wegen der zierlichen Knochen. Gebt uns Zeit. Je nachdem, was hier noch alles zum Vorschein kommt, kann es mit detaillierten Ergebnissen noch eine Weile dauern. Vielleicht sogar bis morgen Mittag.«
Visser und Faust warfen sich einen kurzen fragenden Blick zu. »Na denn«, brummte Visser.
Der Polizeihüne in Weiß zog den Kopf ein, schob die Plane am Eingang des Schutzzelts mit dem Arm zur Seite und verschwand darin. Wortlos gingen Visser und Faust zum Bulli. Auf der Dienststelle gab es einiges zu tun.
Bevor die beiden Polizisten zur Wache fuhren, machten sie einen Stopp in der Strandstraße. Doch das war nicht so leicht. Denn auch am frühen Abend schoben sich die Touristen dort wie in einer Prozession von einem Laden zum anderen. Die Strandstraße lag mitten im Zentrum Norderneys und war eine der besonders frequentierten Flaniermeilen auf dem Westkopf der Insel.
»Fehlt nur noch, dass du Blaulicht und Sondersignal einschaltest, Carlo. Das muss doch nicht sein.« Man sah Visser die Verärgerung deutlich an. Es war ihm unangenehm, dass sie sich mit dem Pritschenbulli im Schritttempo durch die Menschenmassen drängten. Viele Leute reagierten erschrocken, weil sie dachten, es wäre etwas Schlimmes passiert. Andere schienen davon genervt und schüttelten den Kopf. Wenn es Visser möglich gewesen wäre, dann hätte er sich irgendwo im Wagen verkrochen, damit ihn bloß niemand sah. »Mensch, Carlo! Und das alles wegen zwei fettigen Dönern. Die Leute halten uns doch für total bescheuert. Dir kann das egal sein, wenn die so glotzen. Aber mich kennen hier viele. Das ist einfach nur peinlich.«
»Bleib ganz ruhig«, sagte Faust und hielt den Wagen direkt vor dem Dönerladen an. Er zeigte auf das Schild »Grill & Chill« und rief Visser zu: »Ich gehe rein und besorge die Döner, und du chillst solange, okay?«
Visser verzichtete auf eine Antwort. Er schaute aus dem Fenster, schämte sich und tat so, als würde er die teils abfälligen Kommentare der Passanten nicht hören.
Als Faust mit den beiden Dönermonstern aus dem Laden kam, fuhren sie nicht, wie zunächst vorgesehen, zur Wache an die Knyphausenstraße. Faust steuerte den Bulli stattdessen vor das offene Fluttor am Westbadestrand. »Sonnenuntergang gucken und Döner essen. Was gibt es Schöneres!«, schwärmte Faust und blies gut gelaunt in die Backen. Er saß erwartungsfroh am Steuer, nahm durch die Frontscheibe den Horizont ins Visier und schob das Papier bis zur Mitte des Döners. Dann sagte er: »Hm, Knoblauch«, holte noch einmal tief Luft, öffnete den Mund so weit er konnte und setzte zur Vernichtung an.
»Bevor wir hier vor lauter Sonnenuntergangsduselei und Döner den Sinn für die Wirklichkeit verlieren, lass uns auch noch mal darüber reden, wie wir nun weitermachen. Wobei ich durchaus weiß, dass wir aktuell nichts Konkretes unternehmen können. Wir könnten allerdings mögliche Szenarien durchsprechen.«
»Solange die Kriminaltechnik noch keine Ergebnisse hat, sind uns die Hände gebunden. Wir müssen abwarten. Mit Sicherheit brauchen wir auch den Bericht der Gerichtsmedizin, vielleicht sogar ein Isotopengutachten.«
»Allein in Deutschland werden pro Jahr mehrere hundert Tote gefunden, die auf die Schnelle nicht identifiziert werden können. Also wenn wir mit Zahnabgleich und DNS-Analyse nicht weiterkommen, dann müssen die Rechtsmediziner die nächste Rakete zünden«, murmelte Visser.
Faust nahm einen weiteren Bissen. Dass dabei eine nicht unerhebliche Menge Knoblauchsoße aus dem Fladen quoll und auf seine Hose tropfte, bemerkte er zunächst nicht. Denn er war abgelenkt. Einerseits faszinierte ihn der Himmel, der praktisch minütlich von der untergehenden Sonne in ein neues Licht getaucht wurde. Andererseits begeisterten ihn die immensen Fortschritte der Wissenschaft, die es zuließen, die Herkunft, das ungefähre Alter und die Lebensumstände eines vor vielen Jahren gestorbenen Menschen zu bestimmen.
»Das ist korrekt. Wir können im Moment nicht viel tun«, sagte Faust, während er den Soßenklecks entdeckte und diesen kurzerhand mit der Papierserviette von der Hose wischte. »Die sogenannte Isotopensignatur sagt dir genau, ob der oder die Tote vor fünfzig Jahren vorwiegend Spargel und Geflügel gegessen hat und welche Luft eingeatmet wurde. Ruhrpott oder Nordsee zum Beispiel.«
»Aber so weit sind wir noch nicht«, antwortete Visser. Er wischte sich den Mund ab, öffnete die Wagentür und stieg aus. Faust gesellte sich zu ihm. Schweigend beobachteten die Männer den Sonnenuntergang. Vor ihnen auf der Strandpromenade hielt sich kaum noch jemand auf. Die meisten Gäste tummelten sich direkt unten am Strand, viele hatten ihre Kameras längst in Position gebracht, etliche Paare spazierten Hand in Hand barfuß durch die flachen, müde anlandenden Wellen. Und auch an diesem Abend war der eigentliche Höhepunkt, nämlich das Versinken der Sonne im Meer, nur von kurzer Dauer. Innerhalb von gut drei Minuten schluckte die Nordsee den heute tieforange glühenden Feuerball, ein Ereignis, das tatsächlich alle, die sich am Strand versammelt hatten, faszinierte. Denn sie schwiegen und zollten diesem anmutigen Augenblick allein damit Respekt und Würde.
Visser und Faust lehnten direkt nebeneinander an der Promenadenmauer. Visser strich sich mit der Hand über den Bauch, der nach dem Döner unangenehm gegen den Gürtel drückte. Mit einem leichten Seufzer, der ebenso Nachdenklichkeit wie Sorge verriet, drehte sich Faust seinem Kollegen zu und schaute ihn scharf von der Seite an. »Gent, ich weiß, woran du gerade denkst.«
»Glaub ich dir«, gab Visser zurück, während er nach wie vor geradeaus über den Westbadestrand hinweg mit müden Augen den Horizont fixierte. In seiner Stimme klang Gleichmut mit. Doch das täuschte. In seinem Inneren bauten sich gerade Gefühlswelten auf, von denen er gedacht hatte, sie würden ihn für den Rest seines Lebens in Frieden lassen. Doch jetzt kamen sie zurück.
Faust legte Visser die Hand auf die Schulter. »Du denkst an die Kleine, die damals verschwunden ist. Stimmt’s?«
»Kann sein«, brummte Visser. Er wandte sich Faust zu und sah ihm in die Augen. »Komm, wir machen Feierabend. Heute können wir nichts mehr reißen.«
***
Frauke saß auf dem Sofa. Sie hatte die Haare hochgesteckt und war geschminkt. Das ansonsten eher Burschikose in ihrem Gesicht war verschwunden, das Make-up hatte die Konturen um Mund und Augen weichgezeichnet. Wimperntusche und Lidschatten hatte sie ebenfalls aufgetragen. Das wiederum hatte ihre ohnehin großen dunklen Augen zusätzlich hervorgehoben.
»Wie siehst du denn aus?«, fragte Visser, als er das Wohnzimmer betrat. »Hast du noch was vor?«
»Was ist das denn für eine Begrüßung? Gefalle ich dir etwa nicht?«
Visser hatte die Schuhe ausgezogen und das Uniformhemd aufgeknöpft. Aus dem Halsausschnitt seines Unterhemds lugten einige dunkle Brusthaare hervor. Im Fernsehen lief im WDR gerade eine Reisereportage über das Ruhrgebiet. Frauke hatte den Ton abgeschaltet. Mit seinen Gedanken war Visser noch am Wrack. Er stellte sich vor, wie die Kollegen von der Kriminaltechnik gerade unter gleißendem Scheinwerferlicht über einem Schädel hockten und diesen vorsichtig bargen. Dann traf sein Blick endlich wieder Fraukes Gesicht, die ihn mitleidig anschaute. Erst jetzt wachte Visser aus seinem Gedankentorso auf und bemerkte, dass die grobe Art der Begrüßung wirklich fehl am Platz war. Eigentlich konnte er froh sein, dass seine Frau ihm keine Szene machte, weil er einmal mehr aus dienstlichen Gründen einen kompletten Sonntag geopfert und sie allein zu Hause sitzen gelassen hatte. Also ging er auf Frauke zu, beugte seinen Oberkörper tief nach unten und drückte ihr einen Kuss auf den Mund.
»Hm. Lippenstift. Das kenne ich ja gar nicht von dir«, sagte er, grinste und wischte sich mit dem Handrücken über den Mund.
»Ja. Ich übe für nächsten Samstag. Weißt du noch, was dann ist?«, fragte Frauke und gab die Antwort gleich hinterher. »Unsere silberne Hochzeit. Unser großes Fest in der Giftbude. Mit vielen Gästen. Sogar die Neumanns, die sonst nirgendwo hingehen, haben zugesagt. Außerdem mittlerweile auch all deine Kumpels vom Boßelteam. Mit Anhang.«
Dann stand Frauke auf und zeigte sich ganz. Visser, der sich in den gelben Lesesessel hatte fallen lassen und in eine Scheibe Brot biss, die er daumendick mit Leberwurst beladen hatte, schaute auf. So hatte er seine Frauke schon lange nicht mehr gesehen. Wenn überhaupt. Sie trat einen Schritt nach vorn, neigte den Kopf fesch zur Seite und lächelte ihn an. Visser legte die Stulle auf den Zeitungsstapel, der sich auf dem Beistelltisch türmte. Da er höchst irritiert war und nicht genau hinsah, stieß er mit der Hand gegen sein Wasserglas. Es rutschte vom Tisch und ergoss sich auf dem Boden. Doch er nahm das Malheur nicht wirklich wahr. Was er sah, war Frauke. Sonst nichts. Sie trug ein dunkelblaues, knapp über die Knie reichendes Cocktailkleid mit Stickereien und funkelnden Pailletten. Der mit Samt abgesetzte V-Ausschnitt sorgte für ein hinreißendes Dekolleté, das, wie die gesamte Schulter- und Armpartie, von weich schimmerndem Tüll bedeckt wurde. Dazu stand Frauke auf blauen Pumps mit Pfennigabsätzen. Sie lächelte immer noch. Visser schluckte. Und er schluckte noch einmal und noch einmal. Dann nahm er die Brille ab, wischte die Rückseite seiner Pranke mehrfach durchs Gesicht. Fast hätte man meinen können, ihm wäre – ganz aus Versehen – eine winzige Träne entglitten.
Mit Mühe und Not brachte seine kellertiefe Stimme ein schüchternes »Wat moi!« heraus, was in diesem Fall so viel bedeutete wie: Schatz, du siehst phantastisch aus. Wie gut, dass Frauke ihren Gent so gut kannte. Sie hatte seine hinter der breiten Brust verborgene Gefühlswallung durchaus als Kompliment verstanden.