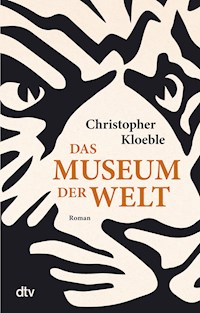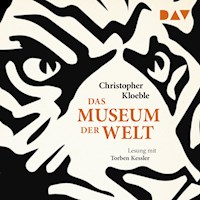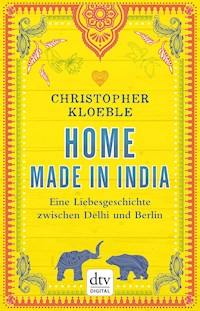9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jetzt im Taschenbuch! Reich an Glanz und voller dunkler Seiten ist die Geschichte der außergewöhnlichen Familie Salz: Sie beginnt Anfang des 20. Jahrhunderts. In den Vierzigerjahren muss sich Lola Salz auf eine Odyssee quer durch das Deutsche Reich begeben; das Leben mit ihr beschreibt Tochter Aveline in den 60ern als Horror. Kurt Salz ist 1989 Teil einer herrlichen Wendekomödie, seine Tochter Emma Salz sucht 2015 detektivisch nach ihrem Schatten und der Wahrheit. Stets im Zentrum: das prächtige Hotel ›Fürstenhof‹ in Leipzig, Zuhause und Existenzgrundlage der Familie Salz – und die Frage: welche Schatten werfen wir auf die Generationen nach uns?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 550
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Christopher Kloeble
Die unsterbliche Familie Salz
Roman
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Für meine Familie
»Es gibt dort [in der Hölle] keine Feuerhaken«, sagte Aljoscha leise und ernst, dabei sah er seinen Vater unverwandt an.
»Richtig, richtig, nur Schatten von Feuerhaken. Ich weiß es, ich weiß. Wie hat doch ein Franzose die Hölle beschrieben: ›J’ai vu l’ombre d’un cocher qui avec l’ombre d’une brosse frottait l’ombre d’une carosse. [Ich hab den Schatten des Kutschers gesehen, welcher mit dem Schatten einer Bürste den Schatten einer Kutsche reibt.]‹«
›Die Brüder Karamasow‹ Fjodor Michailowitsch Dostojewski
WENDY: »After all, one can’t leave his shadow lying about and not miss it sooner or later.«
›Peter Pan‹ James Matthew Barrie
EMMASALZ2015
Meine Großmutter starb zwei Mal. Nur war sie nach dem ersten Mal nicht tot.
Am 15. Juli 1990 stieg Lola Rosa Salz, wenige Tage nachdem sie den Leipziger Fürstenhof in Besitz genommen hatte, aus unerfindlichen Gründen und trotz ihres Alters von fünfundachtzig Jahren auf das Dach des Grandhotels und stürzte.
Sie stürzte so schlimm, dass ihr Herz aussetzte. Als es wieder zu schlagen begann, tat es das nicht kräftig genug, um sie zurück ins Leben zu bringen.
Sie lag seitdem in einem tiefen Schlaf, den mein Vater (ihr Sohn) Koma nannte. Aber war es das wirklich? Selbst Tante Ava, ihre Tochter und Pflegerin, war darüber erstaunt, wie mühelos Lola gewöhnliche Nahrung zu sich nehmen konnte. (Am liebsten Eclairs mit extra viel Sahne.) Kauen, Schlucken, Verdauen, Ausscheiden – alles, ein bisschen Hilfe vorausgesetzt, kein Problem. Mit offenen Augen lag sie in ihrem französischen Bett und redete vor sich hin. Die meisten Worte waren unverständlich, die wenigen verständlichen ohne klaren Zusammenhang. Als flüchteten sich kleine Reste ihrer Träume in die Welt.
Abgesehen von ich soll sie am häufigsten folgende vier Wörter von sich gegeben haben: Mama, Herr Salz und Maria. (Herr Salz war vermutlich ihr lange verstorbener Vater und Maria ihre noch länger verstorbene Großmutter.) Wollte sie etwas beichten? Wollte sie ihre Erfahrung weitergeben, um nicht zu schnell in Vergessenheit zu geraten? Oder brabbelte sie bloß Unsinn?
Ihr Leben reichte so weit zurück, dass die meisten Jahre davon längst in Geschichtsbüchern standen. Sie war ein lebendes Beispiel dafür, wie wenig von dem, was wir sind, übrig bleibt. Nicht umsonst bezeichnen wir das Früher als Geschichte. Mehr als eine Geschichte, die sich die Lebenden über die Toten erzählen, ist es nämlich nicht.
In meinem Fall könnte es eine sehr kurze Geschichte werden. Ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr noch leben werde. Ich glaube daran. Aber ich weiß es nicht. Deshalb muss ich häufig an meine Großmutter denken. Was hatte sie mitzuteilen? Und was habe dagegen ich, die beträchtlich jüngere Enkelin, mitzuteilen?
Vielleicht war ihr Gerede viel mehr, als wir ahnten, vielleicht erzählte sie als Fast-Tote eine Geschichte über die Lebenden, aus der wir, auch wenn es nur eine Geschichte war, viel hätten lernen können.
Hätten wir uns mehr Mühe geben sollen, sie zu verstehen?
Meine Mutter, die ihr nie besonders zugetan gewesen war, nannte den kaum verständlichen Monolog Lolas Bewerbungsgespräch für den Tod. Den Tod schien meine Großmutter, anders als ich, allerdings nicht sonderlich zu interessieren, er ignorierte sie lange Zeit. Was auch immer in Lolas Kopf vor sich ging, sie driftete viele Jahre lang irgendwo zwischen hier und dort. Immer im Fürstenhof, der einst das Zuhause ihrer Familie gewesen war. Dort übte sie als untoter Dauergast ihr lebenslängliches Wohnrecht aus – sie besetzte eine Suite direkt unter dem Dach, auf dem sie gestürzt war. Und wartete auf ihren zweiten Tod.
LOLAROSASALZ1914
Ich habe nie jemandem von 1914 erzählt. Es war das Jahr, in dem meine Familie einen Mord beging und ich Mama rettete.
Nun aber wird es höchste Zeit. Ich bereue viele Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe. Diese eine nicht. Meine Kinder müssen davon erfahren. Sie sollen wissen, dass ich mehr bin als die teuflische Person, für die sie mich halten. Darum bitte ich Sie, wer Sie auch sind, hören Sie mir zu. Wenn Sie das nicht tun, wird es sein, als hätte ich nie gesprochen.
Verstehen Sie?
Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist die Luft über Leipzig. Als neue Eigentümerin des Hotel Fürstenhof habe ich kurz nach der Inbesitznahme im Juli 1990 die Erfüllung eines lange gehegten Wunsches in Angriff genommen: eine Dachbesteigung. Seit 1914 war ich nicht mehr dort oben gewesen.
Für die Klettertour benötigte ich länger als mein neunjähriges Ich damals. Auf dem höchsten Punkt, genau in der Mitte über den Lettern HOTELFÜRSTENHOF, nahm ich Platz und ließ die Beine baumeln. Ich hoffte, einem alten Freund zu begegnen. Aber er ließ sich nicht blicken. Vielleicht erkannte er mich nicht – immerhin hatte die Zeit mir einigen Schaden zugefügt.
Dieser Freund blieb also fern. Während ich mich damit abfand, stellte ich fest: Nicht nur ich hatte mich verändert. Die Luft dieses neuen alten Deutschlands roch nichtssagend. In ihr ließ sich kein Hinweis auf die Geschichte dieses Ortes, unsere Geschichte, erschnuppern.
Ich setzte zum Abstieg an.
Im nächsten Moment bin ich hier aufgewacht. Wo dieses hier ist, weiß ich nicht. Mich umgibt stumme Dunkelheit, perfekte, geräuschlose, sternenlose All-Schwärze. Ich nenne es: das Reich der Schatten. Ein bisschen melodramatisch, ja, aber zutreffend. Licht spielte in meinem Leben eine untergeordnete, höchstens Schatten generierende Rolle.
Ich frage mich, wie viel Zeit inzwischen vergangen ist. Minuten? Stunden? Ein Tag?
Dunkelheit schert sich nicht um die Zeit. Wenn ich in Gedanken meinen Körper abwandere und versuche, hier einen Finger und dort ein Augenlid zu bewegen, mich zu rühren, vergeht eine halbe Ewigkeit, bis ich erfolglos aufgebe.
Andererseits: Ist nicht erst eine Sekunde verstrichen, seitdem ich mit mundgerechten Eclair-Stückchen gefüttert wurde? Waren Sie das? Jedes Lebensende sollte so köstlich schmecken.
Sonst ist mir kein Sinn geblieben. Ich bin gefangen im Reich der Schatten. Nur meine Worte können ihm entfliehen – ich hoffe sehr, sie sind gut bei Ihnen aufgehoben.
1914 also – das entscheidende Jahr. Was damals geschah, prägte meine Familie für immer. Zugegeben, ein wenig fürchte ich mich davor, zum Anfang meiner Biografie zu reisen. Aber wer weiß, wie viel Zeit uns bleibt. Vielleicht sind dies meine letzten Augenblicke. Besser, wir brechen umgehend auf.
Hören Sie?
Im Januar 1914 lebte ich mit meiner Familie in München. Meine Eltern hatten die Pacht des legendären Löwenbräukellers inne, und dieser merkwürdige, bajuwarische Bau war auch unser Zuhause. Der kleinere Turm mit den blanken Schindeln, der zur Augustenstraße hinausging und längst nicht mehr existiert, gehörte zu unserer Privatwohnung und beherbergte unter anderem das Kinderzimmer. Dort gab es eine Wand, an der die gerahmten Schattenrisse meiner Familie hingen, angeordnet wie bei einem Stammbaum. Zentral: meine runde, kartoffelnasige Mama neben meinem Vater mit Vollbart und dichtem Haupthaar. Auf selber Höhe: das anmutige Profil von Tante Alli, Mamas Schwester, sowie das zylinderförmige Haupt ihres Ehemannes, Onkel Brem. Über den Geschwistern: meine arg wabbelige Großmama. Und ganz unten: meine Schwester Gretl, eine jüngere Version meiner Mutter, sowie ich, deren feinere Gesichtszüge an die meines Vaters erinnerten.
Für jeden von uns fertigte Mama alljährlich zum Geburtstag einen neuen, aktualisierten Schattenriss an. Auf welche Weise sie ihren eigenen produzierte, habe ich mich als Kind nie gefragt. Heute würde ich gerne wissen, wie ihr dieses Kunststück gelungen ist.
Damit Mama die Schattenrisse in Ruhe tuschieren konnte, mussten wir regungslos in ihrem Silhouettierstuhl sitzen – wofür ich, das flatterigste Familienmitglied, wenig Talent besaß. Das demonstrierte ich einmal mehr und insbesondere im Januar 1914, wenige Tage vor meinem neunten Geburtstag.
»Nicht bewegen«, sagte Mama, so streng sie konnte. Es klang also überhaupt nicht streng, vielmehr gütig, und veranlasste mich überhaupt nicht dazu, stillzuhalten.
»Meine Liebe«, sagte sie schließlich, »weißt du eigentlich, warum ich immer unsere Schatten male?«
Noch während ich überlegte, ob ich es wusste, fuhr sie fort: »Es ist ein Geheimnis.«
»Kennt Papa es?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Und Gretl?«
Wieder Kopfschütteln. »Du bist die erste Person, der ich davon erzähle. Nicht jeder würde das verstehen.«
Nun wollte ich es unbedingt erfahren.
»Wenn du genau achtgibst«, sagte Mama, »wirst du feststellen, dass jeder Schatten, gemalt oder nicht, dir ein Stückchen Wahrheit verraten kann.«
Ich dachte kurz darüber nach und kam zu dem Schluss: »Schatten reden doch nicht.«
Sie schmunzelte. »Bist du sicher? Sie verwenden keine Wörter. Aber sie können dir trotzdem viel mitteilen. Ich erinnere mich noch gut daran, was das Erste war, das sie mir über dich gesagt haben.« Sie legte eine Pause ein und musterte mich. »Bei deiner Geburt warf der Schein einer Lampe deinen Schatten an die Wand. Ein verschwommener, dunkler, wabernder Fleck kündigte jene noch ungeformte Persönlichkeit an, die ich im nächsten Augenblick in den Armen halten sollte. Aber selbst nachdem ich dich an mich gedrückt und dein Gesicht geküsst und zum ersten Mal deinen Namen zu dir gesagt hatte, musste ich wieder zu deinem Schatten an der Wand blicken, der vom Schatten einer Mutter gewiegt wurde.«
»Warum?«, fragte ich.
»Weil erst dein Schatten mir versicherte, mich restlos davon überzeugte, dass du angekommen warst; er war und ist dein Abdruck auf der Welt, der endgültige Beweis für deine Existenz. Mit anderen Worten: Ohne dich gäbe es deinen Schatten nicht und ohne deinen Schatten dich nicht.«
»Und wenn ich meinen Schatten verliere?«
»Dann«, sagte sie und deutete zur Wand mit den Schattenrissen, »kannst du ihn immer hier finden. Darum male ich ihn ja.«
Ich dachte daran, wie oft ich mich in der Vergangenheit geweigert hatte, für Mama Porträt zu sitzen. Mit einem Mal fühlte ich mich schuldig, es tat mir leid. Prompt nahm ich Haltung auf dem Silhouettierstuhl an. »Ich rühre mich erst wieder, wenn du fertig bist«, verkündete ich, »ich bin starr wie ein Stein, Mama. Versprochen!«
Und was tat sie? Anstatt rasch die Gelegenheit zu ergreifen, drückte sie mich an sich und küsste mein Gesicht und sagte meinen Namen zu mir, als würde sie mich zum ersten Mal sehen. Erst danach fuhr sie mit dem Tuschieren fort.
Es sollte mein letzter Schattenriss werden.
Von da an betrachtete ich die Schattenrisse mit anderen Augen, ich bemühte mich, sie zu lesen. Ich verbrachte Stunden vor der Wand im Kinderzimmer und studierte den Verlauf der Linie zwischen Schwarz und Weiß. Dennoch fiel es mir schwer, mehr in den Schattenrissen zu sehen als schwarze Flächen.
»Ich glaube, ich kann die Wahrheit nicht so gut lesen«, gestand ich Mama am nächsten Tag.
»Das wird schon noch«, sagte sie. »Dazu gehört viel Übung.«
Das mochte sein, nur benötigte man für viel Übung auch Disziplin, etwas, das ich mit fast neun Jahren noch nicht aufbrachte. Mein Analphabetismus frustrierte mich derart, dass ich extreme Maßnahmen ergriff: Ich erwog, meine Schwester zu involvieren.
Dazu muss man wissen: Gretl und ich, wir hatten nicht mehr gemeinsam als Nachnamen und Eltern. Seit ich mich erinnern kann, umgab sie ein unsichtbarer Schutzschild, der sie vom Leben abschirmte und das Leben von ihr. Selten stellte sie eine Frage oder drückte Interesse aus, noch seltener zeigte sie eine Reaktion, die über ein Lächeln oder eine unaufgeregte Geste hinausging. Gretl tat für gewöhnlich genau das, was man von ihr erwartete. Ihr Schatten, so vermutete ich insgeheim, barg keine Wahrheit, die ich nicht längst kannte.
Das war letztendlich aber nicht der Grund, aus dem ich mich dagegen entschied, sie zur gemeinsamen Schattenlektüre einzuladen. Mama hatte ihr Geheimnis allein mir erzählt, es verband uns. Ich wollte es mit niemandem sonst teilen.
Somit behielt ich es für mich und verschob die Analyse der Schatten wie eine schwierige Schulaufgabe auf unbestimmte Zeit – ich hätte mir mehr Mühe geben sollen, ihnen Wahrheiten zu entlocken! Wäre es mir dann gelungen zu verhindern, was später geschah? Mamas Schattenriss etwa: Wie viel von dem, was ich heute weiß, und wie viel mehr noch als das hätte ich ihm entnehmen können?
Mama war im Pasinger Kloster aufgewachsen und hatte somit eine Erziehung genossen, die nicht so ganz geeignet war, sie auf die Welt vorzubereiten. Sie war ein Unschuldsgeschöpf, das den Zweck der Ehe darin sah, Kinder zu produzieren, so wie man es ihr im Kloster eingeprägt hatte. Und sie hatte sich nun ausgerechnet in den Herrn Salz verliebt, der, als Kellner in London und der halben Welt, bereits mit allen nicht gerade reinen Wassern gewaschen war.
Auch wenn ich ihn ungern als solchen bezeichnen möchte, galt der Papa als Idealmann. Von seinen hervorstechendsten Merkmalen verriet sein hübscher Schattenriss allerdings nichts. Seinen Augen wohnte eine blaugraue Frostigkeit inne. Und er war klein – zu klein, um ein ganz schöner Mann zu sein. Ich möchte hinzufügen: Es mangelte ihm nicht nur in dieser Hinsicht an Größe.
Allein ein Schattenriss in meiner Familie wurde ausführlicher gemustert und mehr bewundert als der meines Vaters: der von Tante Alli. Jeder Mann, der ihn betrachtete, wollte ihre Bekanntschaft machen, und jede Frau ihren Mann genau davon abhalten. Tante Allis Profil hob sich so deutlich von den anderen ab, wie sie sich vom Rest der Familie abhob. Das lag vermutlich daran, dass sie unter genealogisch nebulösen Verhältnissen entstanden war: Sie war das Ergebnis eines frühen Sündenfalls meiner Großmutter, Maria Franziska Grasberger, der dann durch eine hurtige Heirat mit dem biederen Herrn Olwerther zugedeckt wurde. Ein offenes Familiengeheimnis. Selbst jemand, der nichts davon wusste, konnte es ahnen. Keiner sonst in der Familie hatte nur annähernd Tante Allis Schönheit, Charme, Lebenslust. Sogar ihr Luxusbedürfnis und ihre Verschwendungssucht wirkten attraktiv aufs andere und so manches Mal sogar aufs gleiche Geschlecht. Hätte sie zu Zeiten von Ludwig I. gelebt, wäre ihr Schattenriss in die Schönheitsgalerie gekommen. Seit jeher trug sie den Übernamen »Comtesse Guckerl«.
Nur wies sie dadurch schon in jungen Jahren Schicksalsschönheitsfehler auf: Sie hatte ganz ordentlich Verehrer. Ein besonders ernst zu nehmender, an den ich mich erinnere, ein Baron, überschüttete sie mit Geschenken, darunter einmal ein spinnendünner, feiner Windhund, von dem Tante Alli dermaßen entzückt war, dass Großmama ihn flugs zurücksandte, da sie verstand, solch kostspielige Präsentchen galten als sicheres Indiz dafür, dass die Verehrung des Barons keineswegs bloß platonischer Art war. Sie beendete die Liaison und nahm sich vor, ihre sinnenfrohe Tochter unter die Haube zu bringen. Nun, für Tante Alli einen Mann zu finden, das war nicht schwer. Man verfiel auf den sehr soliden Herrn Joseph Brem, und er verfiel Alli. Joseph Brem war früher, wie auch mein Vater, Oberkellner im Bamberger Hof und inzwischen Pächter der gut besuchten Münchner Bahnhofswirtschaft.
Bei ihrer Hochzeit wurde dieser blödsinnige Brauch geübt, dass man den Schleier zerriss, um feierlich kundzutun: Heute Nacht wird ihre Jungfernschaft zerstört! Dabei war das bei der Tante Alli keineswegs erst durch die Hochzeit der Fall. Für diesen Festtag fertigte Mama extra einen Schattenriss von ihrer Schwester an. Jeder, der diesen später betrachtete, verstand sofort: Sie war das größte Luxusgut vom Onkel Brem – und das wollte schon etwas heißen. Immerhin war er aufgrund seiner Pacht ein steinreicher Mann geworden (was er jeden, der nicht schnell genug flüchten konnte, auf nicht unbedingt subtile Weise wissen ließ, indem er zum Beispiel ausführte, wie er als einer der ersten Passagiere überhaupt in einem Luftfahrtschiff mit Graf von Zeppelin eine Runde geflogen war). Von ihm bekam sie dreireihige Perlenketten, nicht etwa Zuchtperlen, sondern Meeresperlen, dazu passende Ohrringe, Rubinschmuck, Smaragdringe. Sie galt als eine der elegantesten Frauen in München, ausschließlich in Maßkleider gehüllt, alle bei Schober geschneidert, wo sie manchmal das lebensgroße, präparierte, dezent schielende Pferd bestieg, um Weite, Länge, Faltenwurf ihrer Reitröcke zu begutachten.
Eine Fortsetzung der Schicksalsschönheitsfehler, die Onkel Brem anscheinend weder ihrem Lebensstil noch ihrem Schattenriss entnahm: Tante Alli hatte auch ganz ordentlich Affären. Eine besonders ernst zu nehmende führte sie Anfang 1914 mit einem Herrn Tott, dem Sohn des Besitzers vom Regina Palasthotel am Lenbachplatz. Die beiden trafen sich bei Gelegenheit, soupierten miteinander, schwelgten in Musik. Das Schauspiel suchten sie selten auf, da musste man zu viel nachdenken. Tante Alli versäumte keine Tristanaufführung, obwohl sie vollkommen unmusikalisch war. Aber in dieser Geschichte wurde eben der Ehebruch gelobt, und Tante Alli, Sekt zur Linken, Herrn Tott zur Rechten, schmolz dahin. Sie war halt so veranlagt und konnte nichts dafür, so wie Tristan und Isolde nichts dafür konnten, weil Brangäne etwas in den Trank gemischt hatte.
»Du solltest besser stillschweigend genießen«, riet ihr Mama wieder einmal bei einem von mir bespitzelten Kaffeekränzchen im Januar, am Vorabend meines neunten Geburtstags, da für Tante Alli Geheimhaltung ein Fremdwort war und sie bis ins schlüpfrige Detail von ihren Eskapaden berichtete.
»Niemals! Wenn ich alles für mich behalte, ist das beinahe, als wäre es nie passiert.« (Worin ich ihr, wenn auch nur retrospektiv, unbedingt zustimmen muss.)
»Hast du keine Angst, dass Joseph davon erfährt?«
»Oh doch! Es wäre furchtbar!« Tante Alli verschlang ein obszön großes Stück Krokanttorte und fuhr mit vollem Mund fort: »Aber ihr werdet mich doch nicht verraten, oder?«
Sie sah Mama an, die sofort den Kopf schüttelte, und dann meinen Vater, der es ihr gleichtat. Tante Allis Temperament belebte jede Gesellschaft. Allerdings musste in dieser Gesellschaft schon mindestens ein Mann sein, damit Tante Alli sich nicht langweilte.
Mama, eine viel zartere Seele als ihre Schwester, fragte: »Wollt ihr denn keine Kinder haben?«
»Selbstverständlich wollen wir!«, rief Tante Alli. »Mindestens ein halbes Dutzend!«
»Aber wie kannst du dann sicher sein«, flüsterte Mama, »dass die Kleinen alle …?«
»… von ihm sind?«, ergänzte Tante Alli. Sie zuckte mit den Schultern. »Nur bedingt.«
Meine Eltern wechselten einen Blick.
»Ach«, sagte Tante Alli, »ein bisschen Durchmischung in der Ahnenreihe hat noch keiner Familie geschadet. Da kommen die schönsten Kinder bei raus. Siehe mich.«
Am darauf folgenden Gelächter beteiligte sich auch mein selten fröhlicher Vater. Mamas Reaktion war eine andere: Augenniederschlagen und helle Gesichtsröte. Gegen derlei Spitzen wehrte sie sich nie, dafür war sie viel zu lieb. Wahrscheinlich glaubte sie sogar, sie müsste sich so manche Unverschämtheit von ihrer Schwester gefallen lassen, da mein Vater und Mama die Pacht des Löwenbräukellers Tante Alli zu verdanken hatten.
Vor ein paar Jahren hatte sie die Idee gehabt, sich in einem ihrer schicksten Kostüme, mit einem delikaten Pleureusehütchen, zum Öberschten der Löwenbräu Brauerei aufzumachen, ihn zu bezirzen, bierspritzend mit ihm auf ihre ertragreiche Zusammenarbeit anzustoßen und ihm fast beiläufig das Kleingedruckte ihres Gesprächs unterzujubeln: Wenn er nach Ablauf der derzeitigen Pacht nicht ihre Schwester und deren Mann als Pächter im Löwenbräukeller nähme, dann würden sich die Brems eventuell – hier legte sie eine Pause ein und wiederholte dieses unschuldig anmutende Wörtchen noch einmal: eventuell – überlegen, ob sie in der Bahnhofswirtschaft weiterhin Löwenbräu ausschenken oder eventuell … eventuell zu einer anderen Brauerei in München übergehen würden.
Das hätte, gar nicht eventuell, einen gewaltigen Verlust für die Löwenbräu Brauerei bedeutet. Damals fuhr man ja noch nicht per Auto in den Süden, und alles, was gen Tirol, Italien und so weiter aufbrach, kehrte am Bahnhof in München ein und trank, soff, verschüttete das berühmte Bier. So war dem Öberschten gar keine andere Wahl geblieben – was sich, zumindest in ökonomischer Hinsicht, als beste Wahl herausstellte. Mein Vater, das muss ich ihm lassen, entpuppte sich als geschickter Geschäftsmann. Er brachte den Betrieb sehr auf die Höhe, vor allen Dingen in der Faschingszeit, wo es ihm, dem Rheinländer, durch aufwendige Dekorationen und kabarettistische Einlagen gelang, allerhand Kundschaft anzulocken, die sich in den zwielichtigen, verrauchten, von Gekreische und Gejauchze erfüllten Ecken des Löwenbräukellers auf exzessive Weise amüsierte. Nach der Faschingssaison trug er mehr als hunderttausend Mark in Gold auf die Bank.
Während der Faschingsumzüge, bei denen der Löwenbräukeller nun sogar einen eigenen Wagen hatte, von Braupferden gezogen, thronte aber nicht mein Vater ganz oben – sondern, wie an der Wand mit den Schattenrissen, meine Großmama.
Maria Franziska Olwerther, die wachsame Matriarchin, war eine tätige, gescheite, aber auch herrische Frau, die sich nicht so ohne Weiteres aufs Altenteil zurückziehen wollte. Als Dame vom Garde Manger wachte sie in ihrer schneeweißen Schürze über den Betrieb. Da sie Mitpächterin im Löwenbräukeller war, gab es immer Zwistigkeiten, vor allem zwischen meinem Vater und ihr, weil sie Wert auf eine korrekte Geschäftsführung legte – wohingegen mein Vater Wert auf Gewinn legte.
Großmamas Schattenriss hatte größte Ähnlichkeit mit dem eines Kleinkindes: Dreifachkinn, knubbelige Nase, wulstiger Mund; der einzige markante Unterschied waren buschige Augenbrauen. Die Vermutung liegt nahe, dass sie selbst in jungen Jahren keine Frau gewesen war, nach der sich ein Mann umgedreht hätte. (Tante Alli, der frühe Sündenfall, muss im Dunkeln und von einem so liebeshungrigen wie blendend aussehenden Mann gezeugt worden sein.)
Aber manchmal sind es eben gerade die hässlichen Menschen, die sich dem Erhalt des Schönen widmen. Jeden Morgen polierte Großmama in aller Früh, noch vor Arbeitsantritt, das Messingschild ihrer Münchner Wohnung. Das Haus lag direkt gegenüber vom Löwenbräukeller, an der Ecke, wo die Briennerstraße sich auf den Stiglmaierplatz hinausbegibt.
Dort klingelte ich am 22. Januar 1914, meinem Geburtstag, weil sie mich hatte rufen lassen. Das Mädchen, selbstverständlich mit weißem Häubchen, öffnete und wies mir den Weg. Die Wohnstube war eine typisch bürgerliche, sie hatte sogar eine Art Podium, auf dem saß Großmama, wie so oft, und sah auf den Stiglmaierplatz hinaus. Daneben wurde ein großes, eichenes Büfett von einem ausgestopften Fuchs mit Glasaugen behütet, den mein Vater, in jüngeren Jahren passionierter Jäger, geschossen hatte.
»Na, Lolo, jetz schau amoi ins Büfett nei«, sagte Großmama. Ihr krachendes Bayrisch klingt mir noch heute im Ohr.
Mein Hochdeutsch dagegen wirkte zahm: »Hast du was für mich?« Mein Vater legte Wert darauf, dass ich nicht bayrisch redete, und korrigierte meine Aussprache bei jeder Gelegenheit, vermutlich, um Großmama eins auszuwischen.
Vorsichtig klappte ich beide Türen auf, ein wenig in der Angst, der ausgestopfte Fuchs könnte nach mir schnappen, und fand einen Steiff-Hund mit Knopf im Ohr, der mich herzerweichend ansah. Ich drückte ihn sofort an meine Brust.
»Wie heißt er?«, fragte ich sie.
»Wie soll er denn heißen?«, fragte sie mich.
Ich blickte ihn einen Moment lang an. »Foxl«, entschied ich.
»Foxl?! Des is a Hund!«
»Kann ein Hund nicht Foxl heißen?«
»A Fuchs im Hundspelz. So einen ham ma ja scho in der Familie.«
»Wir haben einen Fuchs? Wirklich?«
Darauf antwortete sie nicht – Jahre vergingen, bis ich verstand, wen sie meinte. Stattdessen betrachtete sie weiter den Löwenbräukeller vom Podium aus, als suchte sie den Horizont nach Unwettern ab.
»Weißt, Lolo, mach dir keine Sorgn«, sagte sie, ohne den Blick abzuwenden oder zu blinzeln, »was auch gschieht, ich werd die Familie bschützn und dafür sorgn, dass alles mit rechten Dingen zuageht. Davon ko mi niamand abhaltn.«
Niemand – bis auf einen.
Großmama begegnete dem Tod zwei Tage nach meinem Geburtstag. Bei einem Aufenthalt am Tegernsee erlitt sie einen Schlaganfall. Sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Dort lag sie stundenlang bewusstlos. Mama wischte ihr den Todesschweiß von der Stirn. Tante Alli verharrte an der Tür, als herrsche Ansteckungsgefahr. Angst hing in der Luft. Man hörte sie in der Stille. Heute frage ich mich, welche Angst genau das war. Gewiss fürchteten die Schwestern, eine geliebte Person zu verlieren. Aber das war noch nicht alles. Ich glaube, sie hatten Angst davor, was mit ihnen ohne ihre Beschützerin passieren würde.
Die Beerdigung erfolgte bei dem betenden Marmorengel auf dem Ostfriedhof. Als wir ihn verließen, holte mich Tante Alli auf der Höhe von Doktor Guddens Grab ein und sagte leise zu mir, trotz aller Erschütterung: »Weißt du, Lola, wir zwei, wir haben in der Trauerkleidung am schönsten ausgeschaut.«
Tante Alli überspielte ihre Angst und besaß noch dazu kaum Weitsicht. Doch wenn Sie mir aufmerksam zugehört haben, werden Sie verstehen: Mit Großmama war nicht nur das älteste Familienmitglied dahingeschieden, sondern auch unsere Bewacherin, unsere Garde Famille. Die bisherige Ordnung gab es nicht mehr, auch wenn anfangs nur eine kleine Veränderung darauf hindeutete: Großmamas Schattenriss wurde von der Wand genommen und meine Eltern rückten gemeinsam mit Tante Alli und Onkel Brem in die oberste Position auf. Wobei man die neuen Haken nicht ganz präzise anbrachte: Wer genau hinsah, konnte erkennen, dass der Schattenriss meines Vaters ein Stückchen höher als der Rest hing.
Danach dauerte es gerade einmal einen Monat bis zu jenem Ereignis, das unsere Lebensläufe unwiderruflich in neue Richtungen lenken sollte. Lion Feuchtwanger, ein gern und oft gesehener Gast im Löwenbräukeller, streifte es sogar in seinem Roman ›Erfolg‹, wenn er auch nicht die Namen meiner Eltern nannte.
Lassen Sie mich zuallererst darauf hinweisen, dass es in München, mehr als irgendwo sonst, notwendig war, dass im Bierkrug oder im Bierglas eine ordentliche Schaumhaube aufstieg. Das nahm nun allerdings im Löwenbräukeller unter der nicht mehr großmütterlich korrekten, sondern der gewinnmaximierenden neuen Leitung meines Vaters überhand – und nicht ganz lautere Formen an. Diese gewaltigen Schaumhauben stiegen so manchem biederen Biermünchner in die falsche Kehle. Mein Vater wurde angezeigt wegen »unreellen Einschenkens«.
Es kam zum Prozess – in dessen erster Instanz mein Vater freigesprochen wurde. Doch da stand Tante Alli im Gerichtssaal auf, klatschte operngerechten Beifall und rief: »Bravo! Braaavo!« Es mangelte ihr, wie gesagt, an Weitsicht, denn dieser Applaus wiederum geriet nun dem Herrn Staatsanwalt in die falsche Kehle. Es wurde Berufung eingelegt. In zweiter Instanz wurde mein Vater verurteilt. Zehn Tage Haft. Alle Anstrengungen der Familie, diese in eine Geldstrafe umzuwandeln, schlugen fehl. Er war ein Preiß, und man wollte ein Exempel statuieren.
Am Tag des Urteils war der Himmel ostentativ blau. Man hatte mir, dem neunjährigen Töchterchen, die unheilvollen Neuigkeiten nicht ganz wahrheitsgemäß mitgeteilt: Mama setzte mich bloß darüber in Kenntnis, dass der Papa für eine Weile fortgehen würde. Deshalb galt meine größte Sorge an diesem Tag meinen hölzernen Tierchen. Es war eine mühselige Aufgabe, die bunt gemischte Arche-Noah-Horde aufzustellen. Den ganzen Nachmittag verbrachte ich damit, bis sie endlich das Wohnzimmer bevölkerte. Als mein Vater hereinkam, rief ich nach ihm, um mein Werk zu präsentieren. Er reagierte nicht, schien mich nicht wahrzunehmen. Wie ein Schlafwandler schritt er durchs Zimmer und gab einen Schrei von sich, als er auf ein Zebra trat. Nun schien er mit einem Mal wach. Aus seinem Waffenschrank nahm er eine Flinte, rief: »Jetzt gehen wir auf die Jagd!«, stieß mit dem Gewehrlauf alles um, vernichtete meinen Zoo.
Ich sprang auf. »Das ist gemein!«
Da er einfach weitermachte, fügte ich noch ein Wort hinzu, das ich von ihm aufgeschnappt hatte: »Wie hinterhältig!« So bezeichnete er seit Kurzem alles Bajuwarische.
Endlich hielt er inne. »Du denkst, das ist hinterhältig?« Erst jetzt sah er mich an, mit einer selbst für ihn ungewohnten Kälte, und ich wagte nicht, ihm zu antworten.
»Ich zeig dir, was hinterhältig ist«, sagte er, legte die Flinte beiseite und schritt zum Fenster, an das ich meinen Foxl mit einem blauen Bändchen gebunden hatte, und schubste den Foxl, sodass er am Bändchen über dem Abgrund baumelte. Mit der reichen Fantasie eines Kindes glaubte ich, mein Foxl würde erwürgt. Ich schrie. Ich flehte, ihn wieder hereinzunehmen.
Mein Vater aber verließ das Zimmer und gleich darauf die Stadt. Er setzte sich nach Hamburg ab, um mehr Freiheit in Amerika zu suchen, wie er es in einem kurzen Schreiben formulierte, das Mama am selben Abend auf dem Küchentisch fand.
Das Weinen in den Stunden danach färbte ihre Augen so rot wie sonst nur ein verrauchtes Faschingsfest im Löwenbräukeller. Als ich sie fragte, wie lange der Papa denn fort sei, antwortete sie mit noch mehr Tränen. Sie nahm seinen Schattenriss von der Wand, betrachtete ihn sehnsuchtsvoll und weichte ihn mit ihren Tränen auf. Als sie ins Bett ging, legte sie ihn neben sich auf das Kopfkissen meines Vaters.
In derselben Nacht reiste Onkel Brem ihm hinterher und machte ihn tags darauf in der Hansestadt ausfindig, bevor mein Vater einen Dampfer besteigen konnte. Arm in Arm kehrten sie zurück, und man zelebrierte ein familiäres Abendmahl, nahezu ein Da-Vinci-Plagiat, jedoch ohne Jesus, dafür mit Mama als Maria, die andauernd die Hand meines Vaters tätschelte, als wolle sie sagen: »Ist schon in Ordnung, dass du uns im Stich lassen wolltest. Kommt halt vor. Es zählt allein, dass du wieder da bist.«
Aber war er das wirklich? Ich glaube, nein, ich weiß, Onkel Brem hatte nur einen Herrn namens Salz zurückgebracht, nicht meinen Vater. Mein richtiger Vater hatte uns längst verlassen. Mein richtiger Vater hätte uns vieles erspart.
Zehn Tage saß Herr Salz in Marquartstein ein und büßte seine Haftstrafe ab. Danach wurde meinen Eltern die Pacht entzogen. Herr Salz musste sich nach einem anderen Geschäft umsehen. Dieser Aufgabe ging er im Café Luitpold in der Briennerstraße nach, wo er Fachzeitschriften durchstöberte und sich das Hirn über unsere Zukunft zermarterte.
Zumindest erzählte er uns das. Nie durften wir ihn begleiten. Der Nachmittag gehörte dem Herrn Salz und der Herr Salz in dieser Zeit dem Kaffeehaus, wo er bald jene Verkaufsanzeige lesen sollte, deren Text, verfasst im plumpen, trockenen Informationsstil eines Geschichtslehrbuchs aus der Sexta, mit dem Namen jenes Hotels gespickt war, mit dem mein Leben gespickt sein würde.
Der Fürstenhof im sächsischen Leipzig trug anfangs nicht den Namen Fürstenhof. Das Haus, das später einmal als Fürstenhof bekannt werden sollte, wurde 1770 vom reichen Leipziger Bankier Eberhard Heinrich Löhr an der Promenade, gegenüber dem Komödienhaus, erbaut. Lange Zeit war der zukünftige Fürstenhof ein beliebter Ort für die feine Gesellschaft der aufblühenden Messe-, Buch- und Universitätsstadt. Aber 1813 besetzten kaiserliche Truppen die Stadt und machten sie zum Hauptquartier der Großen Armee. Napoleon kam, und der Hausherr des Fürstenhofs starb. Seine Witwe und Tochter mussten für den französischen Stadtkommandanten Napoleons den Fürstenhof räumen, der dort rauschende Feste feierte. Nach Napoleons Abzug holten die Damen Löhr aus ihrem Weimarer Exil viele Fürstlichkeiten in ihr Haus. Damit sie im Fürstenhof standesgemäß speisen konnten, richteten sie im Fürstenhof einen prunkvollen Speisesaal ein, den sie mit Serpentin-Gestein, dem »Marmor der sächsischen Könige«, und geschnitzten Türen aus Ebenholz auskleiden ließen. Bis 1886 blieb der Fürstenhof in Familienbesitz. Dann wurde der Fürstenhof an die Leipziger Immobiliengesellschaft verkauft, die das Grundstück aufteilte und mit viel Gewinn weiterverkaufte. 1889 wurde das Haus zum Hotel Fürstenhof umgebaut. Nun besaß auch Leipzig ein erstklassiges Hotel, von den Sachsen liebevoll »Fürstenhöfle« genannt, in dem alles, was Rang und Namen hatte, verkehrte.
Entzückt von dem Gedanken, dass er mit dem Erwerb des Fürstenhofs quasi den Titel eines Fürsten erlangen würde, trug Herr Salz die Anzeige wie eine Trophäe nach Hause. In der Annahme, dass Mama ihm beim Kauf fraglos mit dem nötigen Kleingeld ihrer Familie aushelfen würde, las er ihr so euphorisch wie lautstark vor.
Er kam nur bis zum vierten Wort.
»Sachsen?«, unterbrach sie ihn.
Herr Salz nickte und setzte von Neuem an.
Wieder kam er nicht weiter als bis zum vierten Wort.
»Sachsen!«, rief sie.
Ein letztes Mal nahm er Anlauf.
Diesmal stoppte sie ihn schon vorher.
»Sachsen«, sagte sie zu ihm und damit alles.
Er hatte die Münchnerin in ihr unterschätzt. Mama hatte nicht das geringste Interesse daran, sich von ihrem Heimatort zu trennen, den sie in so vielerlei Hinsicht und selbst für seine Fehler liebte.
Sie liebte München für unsere Neubauwohnung in der Lucile-Grahn-Straße, gleich um die Ecke vom Prinzregententheater, in die wir im März 1914 nach dem Bierschaum-Prozess zogen. Sie besaß ein so großes Kinderzimmer, dass Mama dort voll Freude die Schattenrisse befestigte, mit dem Hinweis, dass noch viel Platz für weitere sei. Ebenso liebte sie München für den Hofgarten, wo wir gelegentlich den Prinzen Albrecht (dessen Schattenriss zu tuschieren Mama sich insgeheim wünschte) bei seinen Schneeglöckchen-Ausrupforgien beobachteten. Auch liebte sie es für den zoologisch aufgeschlossenen Herrn, der täglich an unserer Haustür vorbeispazierte, mit einem Fuchs an der Leine, denn sie sagte jedes Mal, wenn sie ihn sah: »Das hätte Großmama gefallen!« Ganz besonders liebte sie München, weil es das natürliche Habitat für ein mittlerweile ausgestorbenes Wesen darstellte, nämlich die Schienaramma-Resi. Dabei handelte es sich um eine ausschließlich weibliche Spezies, deren Angehörige auf einem Eisenstühlchen saßen, winters dick eingemummt, sommers im Dirndl, winters wie sommers ein flaches Trachtenhütchen mit einer kecken Feder auf, und die – etwa am Max-Weber-Platz, Schnittpunkt einiger Straßenbahnlinien – mit einem langen, metallenen Stecken Schienen in die richtige Stellung bringen mussten, damit alle Fahrgäste unbeschadet dort ankamen, wo sie hinwollten. Dieser Schienaramma-Resi fühlte Mama sich, wie sie mir einmal erzählte, aufgrund ihrer verantwortungsvollen »Lenkungsarbeit« zutiefst verbunden, auch wenn sie nie ein Wort mit einer dieser Frauen gewechselt hatte. Zwar liebte Mama München nicht ganz so für das Café Luitpold, wo Herr Salz sich manchmal länger aufhielt als in unserer Wohnung. Aber dafür liebte sie München umso mehr für seine altmodische, dem Fortschritt nicht im Übermaß zugetane Bevölkerung, für die Onkel Brem ein ausgezeichnetes Beispiel war. Dieser gab jedes Mal, wenn er vor die Tür seiner Bahnhofswirtschaft trat und eines der stinkenden Automobile an ihm vorbeifauchte, kund: »Das hat keine Zukunft.«
Dasselbe galt für den Fürstenhof, musste der mangelhaft große Herr Salz gedacht haben, als er sich mit Mamas bedingungsloser Münchenliebe konfrontiert sah. Niemals würde eine Vollblutbayerin wie sie das Vermögen ihrer Familie in sächsischen Besitz investieren. Herrn Salz waren somit die Hände gebunden: Das Hotel wurde nicht gekauft, und wir zogen nicht nach Leipzig. Wäre es doch dabei geblieben!
Doch Mamas Liebe zu München leistete einer neuen, törichten Liebe Vorschub, die sich in jeder Hinsicht zerstörerisch auswirken sollte. Das Folgende hat Tante Alli mir in einem Brief mitgeteilt, den ich erhielt, als meine Eltern sich bereits von ihr distanziert hatten. Sie ließ mich wissen: Zu ihren eher ungünstigen Hobbys zählte das Sammeln der Liebesbotschaften, die sie von diversen Herren zugesteckt bekam. Zwischen den vielen Schreiben befand sich sogar ein Aktfoto. All diese Trophäen wurden in einer Kassette in Tante Allis Wäscheschrank aufbewahrt. Das war schon a bisserl blöd.
Hinzu kam, dass sie sich mit ihren Männern so häufig bei Hoteltagungen in Rom, Paris und wo auch immer traf, dass Onkel Brem ihre vielen Abwesenheiten allmählich recht bedenklich vorkamen. Er entschloss sich, seine Frau durch einen Detektiv überwachen zu lassen. Als sie wieder einmal nach Wiesbaden gereist war – weiß Gott, zu welcher Kur, sie war ja kerngesund –, kamen ihr Zweifel, ob sie die Kassette auch richtig abgeschlossen hatte. Aus einer Telefonkabine im Hotel rief sie meine arme, brave, harmlose Mama an: Sie möge unter irgendeinem Vorwand in Tante Allis Zimmer gehen und jene Kassette an sich nehmen, bevor Onkel Brem sie finden konnte. Aber, so schärfte sie ihr ein: Sie dürfe sie keinesfalls öffnen.
Dieses Gespräch hatte der Detektiv abgehört. Mama machte sich als treue Schwester auf. Bereits an der Tür wurde sie von ihrem Schwager empfangen, mit den Worten: »Du kommst zu spät, Rosa.« Dann reichte er ihr das Aktfoto. Der entkleidete Mann darauf räkelte sich in einer Pose, die entfernt an die Ästhetik eines Freskos von Michelangelo erinnerte. Er streckte sich, als würde er versuchen, sich größer erscheinen zu lassen.
Auch Tage später, nachdem Mama sich wieder gefasst hatte, konnte sie nicht entscheiden, was sie mehr verletzte: dass der Mann ihr Mann war – oder dass sie ihn im ersten Augenblick gar nicht erkannt hatte, weil sein nackter Körper ihr so fremd war. (Im ehelichen Schlafzimmer, darüber hatten Mama und Tante Alli sich zuweilen unterhalten, wurden Zärtlichkeiten nur nachts und ohne Licht ausgetauscht. Wenn überhaupt.) Mama behielt das Aktbild und studierte es hinter verriegelter Tür. Das also war ihr Mann. Er schien das Posieren im Adamskostüm zu genießen. Wünschte er sich mehr Unanständigkeit von ihr? Wollte er sich auch vor ihr räkeln (und dabei fotografieren lassen)?
Mama, meine viel zu gute Mama, übte sich in der Freigeistigkeit ihrer Schwester: Sie machte Tante Alli und Herrn Salz keine Vorwürfe. Das vermittelte sie den Ehebrechern sogar in einem Gespräch unter sechs Augen. Beide, davon war Mama überzeugt, konnten nichts dafür; Tante Alli war von Natur aus liebeshungrig, und Herr Salz hatte bei ihr bloß Ablenkung von seiner miserablen Lebenssituation gesucht. Statt Zorn empfand Mama Schuld, dass sie ihren Mann zu einer solch extremen Maßnahme wie einer Affäre gezwungen hatte. Er tat ihr leid. Lange dachte sie darüber nach, wie sie ihm eine bessere oder, sollte er sich danach sehnen, schlechtere Frau sein könnte, und kam zu dem Schluss, dass sie ihrer einen Liebe entsagen musste, um ihre andere Liebe zu retten.
Im Monat darauf zogen wir nach Sachsen.
Onkel Brem, der andere Betrogene, zeigte sich weniger verständnisvoll: Er kaufte einen Revolver (den ich nie gesehen habe, mir aber schwer, unhandlich und silbern glänzend vorstelle). Dieser wurde, ganz anti-tschechowisch, keinmal abgefeuert, sondern erfüllte seinen Zweck – die Androhung lebensverkürzender Konsequenzen – durch bloße Präsenz: indem er im Bett unter Onkel Brems Kopfkissen und damit neben Tante Allis Kopf ruhte. Dort hatte er ihn platziert, um nicht den Verführungskünsten seiner sirenenhaften Frau zu erliegen und dadurch die Scheidung hinfällig zu machen. Nachdem diese vollzogen und Tante Alli ihrer Position in der Münchner Gesellschaft enthoben worden war, zahlte der anständige Onkel Brem ihr immerhin eine hübsche Apanage, und sie verschwand in den vornehmen Kurort Bad Kreuth, wo sie die trauernde Geschiedene mimte. Dort verliebte sie sich gleich nach der Ankunft in einen Arzt, Herrn Doktor Steinmetz, verkaufte binnen Wochen ihren Rubinschmuck, mit Bracelet und Ringen und so weiter, um dessen Praxis einzurichten, inklusive Schildpattgarnitur und Nymphenburger Teekannen für über hundert Mark das Stück, und bereute das nicht wenig, als er ihr mitteilte, dass er eine jüngere Dame heiraten werde.
Noch in derselben Woche erhielt ich den Brief von ihr, in dem sie mir ihre Verfehlungen beichtete. Sie schrieb: »Du musst es erfahren, sonst ist all das wie nie geschehen.« Für derlei Geschichten war ich damals zwar noch nicht reif genug, aber Tante Alli, die in mir offenbar eine natürliche Verbündete sah, konnte darauf wenig Rücksicht nehmen. Sie wusste vermutlich, ihr blieb nicht mehr viel Zeit. Kurz nach dem Versenden des Briefs begleitete Tante Alli einen Verkäufer der Münchner Werkstätten auf einer Autotour die Isar entlang. Weil die Straßen noch nicht gekehrt waren, trug Tante Alli einen großen, wallenden Schleier, um sich vor dem Staub zu schützen. Dieser verwickelte sich, gerade als sie das Deutsche Museum passierten, in einem der Autoräder und erdrosselte sie bei der Fahrt.
Im Leichenhaus blieb ihr Sarg geschlossen. Selbst der sonst so steife Onkel Brem soll zu Tränen gerührt gewesen sein. Ich kann das nicht bestätigen, da meine Eltern, Gretl und ich zu der Zeit längst in Leipzig lebten und nicht zur Beerdigung anreisten. Herrn Salz’ Entscheidung. »Eine unnötige Belastung für eure Mutter«, behauptete er. Eine furchteinflößende Belastung für ihn, behaupte ich. Bestimmt war er sich bewusst, wie sehr er zu Tante Allis jähem Ende beigetragen hatte. Unser einziges Abschiedsritual: als Mama weinend ihren (und Onkel Brems) Schattenriss von der Wand in unserer Privatwohnung im Leipziger Fürstenhof nahm.
Tante Allis Tod wurde in den Akten der Münchner Gendarmerie als Unfall verbucht. Ich bin mir da nicht so sicher. Fast alles hatte sie verspielt: Besitz, Ehemann, die innige Beziehung zur Schwester. Jetzt wollte sie auch noch den letzten Rest geben – aber dies selbstbestimmt und auf eine für die Operndame standesgemäße Art und Weise! Ich glaube, sie schnürte ihren Schleier absichtlich fest um ihren Hals, sodass sie gerade noch atmen konnte, ließ ihn aus dem Auto flattern und wie eine Angelschnur länger und länger werden, geduldig abwartend, mit heftigem Herzklopfen, in Erwartung des größten Höhepunkts ihres Lebens, bis der Autoreifen endlich zuschnappte und sie mit einem Ruck nach hinten gerissen wurde.
Sie hören mir noch zu? Ich hoffe – um ehrlich zu sein: erwarte es! Alles, alles müssen Sie sich merken. Keine Ausflüchte! Machen Sie sich meinetwegen Notizen. Für Wiederholungen bleibt uns keine Zeit. Wenn meine Kinder verstehen sollen, wer ich bin, wer ich wirklich bin, müssen sie erfahren, wie alles begann.
Und bitte – ich bin mir bewusst, dass es immer einen Anfang vor dem Anfang gibt. Darum habe ich ja mit einem Ende begonnen: Tante Alli ließ ihr Leben hinter sich, meine dezimierte Familie das Blau-Weiße – und ich, verzeihen Sie das Pathos, meine Kindheit.
Herr Salz hatte für den verfluchten Fürstenhof über eine Million Goldmark hingelegt. Da er so viel Geld nicht besaß, musste er sich den Großteil von Mamas Verwandtschaft leihen. (Zurückgezahlt hat der Hund – eine passende Bayernvokabel für einen Fuchs wie ihn – seine Schulden dann in den Zeiten der großen Inflation, als ein Brötchen Hunderttausende kostete.) Nichtsdestotrotz ließ er sich als alleiniger Inhaber eintragen – seine Frau kam in den Unterlagen nicht vor. Doch das war nicht das Ärgste. Für mich steht fest: Auch wenn nicht er Mama umgebracht hat, war es doch im Wesentlichen Herr Salz, der ihr das Leben nahm.
Als Mama, Gretl, ich und mein Foxl im Mai 1914 mit dem Zug nach Leipzig fuhren, wartete Herr Salz dort bereits auf uns. Wir wollten nicht an das denken, was hinter uns lag, und wir wussten nicht, was vor uns lag. Mit einer Ausnahme: Mama war schwanger. Damit wir unser Coupé mit niemandem teilen mussten, trat sie bei jeder Haltestelle ans Fenster und präsentierte ihren bereits ausladenden Bauch, in der zutreffenden Vermutung, dass sich bei ihrem Anblick niemand zu uns drängen würde. Während der Fahrt las Mama immer wieder die Rückseite von einer der Postkarten, die Herr Salz als Werbung für das Hotel Fürstenhof hatte herstellen lassen: »Behagliches, ruhiges Heim in schönster Lage und mit modernstem Komfort. 140 Zimmer, davon 80 ruhig gelegene Innenzimmer, alle mit fließendem Kalt- und Warmwasser, Doppeltüren, Reichstelefon, 40 Zimmer mit Privatbad. Mäßige Preise, Bier und Weinrestaurant, Garage nebenan.«
Als wir in Leipzig ankamen, stand Herr Salz am Bahnsteig des Hauptbahnhofs. Wir purzelten aus dem Zug. In einem Plaid trug Mama eine teure Rotweinflasche bei sich, die sie Herrn Salz, dem Rheinländer, als Glückwunschtrank zum Neuanfang mitbringen wollte. Diese entglitt ihr nun und zerschellte auf dem Bahnsteig.
Herr Salz wandte sich sofort von uns ab und verließ den Bahnhof, als würde er uns nicht kennen. Mama starrte auf die Scherben und die blutrote Flüssigkeit. Ein Rinnsal bewegte sich gleich einem Tentakel auf ihre Füße zu.
Von dieser missglückten Ankunft lenkte kurz darauf der Fürstenhof ab, dessen hübsche Jugendstil-Fassade, als ich sie zum ersten Mal sah, mir imponierte, also mich täuschte. Bloße Tarnung. Aber das wusste ich damals noch nicht, damals war ich jung und glaubte, dass alles, was schön aussieht, auch schön sein muss. Herr Salz hatte eine grundlegende Renovierung in Auftrag gegeben, die unter anderem das Installieren einer hochmodernen Ozon-Belüftungsanlage beinhaltete, die kalte oder warme Frischluft in acht verschiedenen Duftnoten in die Räume blies. Als wir auf den Eingang zuliefen, rissen Boys in silberbeknöpften Uniformen für uns die Türen auf. Der Fahrstuhl brachte uns direkt in unsere Privatwohnung ganz oben, in der nicht mehr Waschkrug und Waschschüsseln und Eimer standen, sondern es fließendes kaltes und warmes Wasser gab. Wir rannten durch die Räumlichkeiten, die Herr Salz selbst eingerichtet hatte. Zuerst: unser Mädchenzimmer. Dann: das große Wohnzimmer. Daraufhin: das Babyzimmer. Und schließlich: zwei gleich große Zimmer mit je einem Einzelbett.
Wir blieben davor stehen, unentschlossen, welches wir betreten sollten.
»Ich habe eine Mauer errichten lassen«, sagte Herr Salz.
»Eine Mauer?«, fragte Mama.
»Sie teilt das Zimmer genau in der Mitte«, sagte er. »Du kannst deine Schattenrisse an ihr aufhängen.«
»Ihr schlaft nicht zusammen?«, fragte ich.
Herr Salz schüttelte den Kopf. »Ihr wisst doch, meine Insomnie. Ich würde Mama nur wach halten. Dabei braucht sie doch besonders viel Schlaf. In ihrem Zustand.«
»Natürlich«, sagte Mama. »Wie lieb von dir.«
Und sie versuchte, eine Falte in der Decke ihres neuen Bettes glatt zu streichen, mit einer vehementen Geste, die ihren Schatten verzerrte.
In jener ersten Nacht im Fürstenhof fand ich keinen Schlaf. Selbst Foxl spendete mir kaum Trost. Gretl im Bett neben mir gab wie immer Schnarchlaute von sich, die in Anbetracht ihres fragilen Mädchen-Resonanzkörpers einem akustischen Wunder gleichkamen. So sorglos hätte ich auch gern geruht. In dieser Hinsicht war Gretl unserer Mama am ähnlichsten. So ganz aus der untersetzt-standhaften Olwerther’schen Familie stammend, waren beide dazu in der Lage, auch unter widrigsten Umständen zu schlummern.
Ich dagegen hatte, so unerquicklich der Gedanke auch ist, mehr Salz abbekommen: Ich war ausgestattet mit feinstem Nasenbein und offenkundig ebenfalls unter Insomnie leidend. Waren die Gene dafür verantwortlich, dass ich in dieser Nacht aus dem Bett und im Wohnzimmer auf einen Stuhl stieg, um ein Dachfenster zu öffnen und den Kopf ins Freie zu stecken? Ich wollte mir diese Stadt ansehen, die unmöglich mit unserem geliebten München mithalten konnte. Und tatsächlich: Statt des majestätisch erleuchteten Prinzregententheaters auf der gegenüberliegenden Straßenseite flimmerten hier nur ein paar verschwommene Lichter irgendwo in der schwarzen Luft. Auch war das unmelodiöse Donnern der Straßenbahn auf dem Tröndlinring kein Vergleich zu den selbst aus der Ferne noch vernehmbaren, akustischen Delikatessen der Oper. Und nicht zuletzt erzählte die Nachtluft weder von Isarfrische noch von Schweinebraten und Bier, sondern von den Ausdünstungen wilder Kreaturen: Die Inhaftierten des städtischen Zoos besaßen ein so dominantes Odeur, dass bei Nordwind stets alle Fenster im Fürstenhof geschlossen bleiben mussten, um die Gäste vor den olfaktorischen Attacken von Leopardenkot und Schimpansenschweiß zu schützen.
Da nahm ich eine Gestalt zu meiner Linken wahr, die, nur wenige Meter entfernt, wie eine kleine Galionsfigur auf dem zentralen Dachbogen saß. In der Dunkelheit konnte ich sie kaum erkennen. Sie war nicht mehr als ein Schatten. Ihre Umrisse ließen auf ein Kind oder einen zierlichen Erwachsenen schließen.
»Hallo?«, sagte ich.
Die Gestalt rührte sich nicht.
»Wer sind Sie?«, fragte ich.
Sie blieb starr und stumm, als wäre sie ein Teil des Gebäudes. Ein menschlicher Wasserspeier.
»Das ist unser Dach«, erläuterte ich mit dem Selbstbewusstsein einer Schulmeisterin.
Daraufhin bewegte die schattenhafte Gestalt ihren Kopf, und ich erschrak und fiel vom Stuhl. Bis ich ihn wieder erklommen hatte, war sie verschwunden. Ich hielt noch eine Weile Ausschau nach ihr – vergebens.
Gretl oder meinen Eltern erzählte ich davon nichts. Meine Schwester hätte mir niemals geglaubt und mein nächtliches Abenteuer als bloße Träumerei abgetan; dem Herrn Salz wagte ich nicht zu verraten, dass ich gegen die von ihm verordnete Bettruhe verstoßen hatte; und meine Mama wollte ich nicht zusätzlich belasten, weil dies – wortwörtlich – unser demnächst eintreffendes Geschwisterchen bereits zur Genüge tat.
Lieber schlich ich in jeder darauffolgenden Nacht zum Dachfenster, stieg auf den Stuhl und hielt nach dem menschlichen Wasserspeier Ausschau – weiterhin vergebens. Sodass ich nach einigen Tagen aufgab und mich fragte, ob ich ihn wirklich gesehen hatte oder er, rein theoretisch, das Ergebnis einer Träumerei gewesen sein konnte.
Es dauerte nicht lange, bis ich ihn vergaß. Viel Neues drängte sich in unser Leben.
Zuallererst: die Schule! Bereits nach der ersten Unterrichtswoche kamen Gretl und ich überein, dass die Sachsen Barbaren waren. Dies zeigte sich unserer Meinung nach schon daran, wie sie die deutsche Sprache misshandelten. Sogar unsere Lehrer behaupteten, es heiße die anstatt der Butter und der anstatt das Tunnel. Ganz zu schweigen von dem Dialekt: Leepzsch. Säggssch. Glubbschoochn. Modschekiebchen. Schpeggfeddbämme.
Umso mehr erfreuten wir uns an der internationalen Kundschaft im Hotel, die uns grammatikalisch einwandfreie Sätze und wohlklingende Wörter direkt in unser Zuhause lieferte. Für die Gäste war der Fürstenhof die beste Adresse in Leipzig, und das Geschäft brummte. Sogar einige Passagiere, die den Untergang der Titanic überlebt hatten, kehrten bei uns ein. Darüber wurde ausführlich in der Presse berichtet, und es hinterließ ordentlich Eindruck.
Wenn Herr Salz nicht gerade militärisch anmutende Kommandos von sich gab, die aus der Belegschaft eine kopfsenkende, herumhuschende, wispernde Untertanenschar machten, zeigte er sich für das Hofieren der Gäste verantwortlich. Es war mir ein Rätsel, wie er diesen Fremden so viel herzliche Freundlichkeit entgegenbringen konnte, während er seine eigene Familie wie Fremde behandelte.
Mama suchte in der Küche Zuflucht, dort etablierte sie ihr neues Zuhause. Das Küchenpersonal unterstand ihrer Oberaufsicht. Ich sehe sie noch jeden Abend in einer lilienweißen Bluse mit dem Küchenchef zusammensitzen und das Menü für die nächsten Tage komponieren – wenigstens etwas, das sie lenken konnte. Wenn ich sie aufsuchte, blieb ich immer an dem Bassin stehen, in dem sich die lebenden Fische tummelten. Diese beobachtete ich genau und mit viel Freude. Aber die Erinnerung daran ist eine traurige. Es kommt mir im Nachhinein vor, als wären wir alle bloß Fische in einem Bassin in der Küche gewesen, die umherschwammen und nicht ahnten, was sie erwartete.
So vergingen die ersten Wochen in Leipzig. Allein Sonntagnachmittage standen für Familienzeit, die den Herrn Salz mit einschloss. Gretl und ich hatten dann meist etwas Musikalisches einstudiert und versuchten uns an vierhändigem Klavierspiel. Gretl wurde aufgrund ihrer nicht gerade ausgereiften Fingerfertigkeit eine Vorreiterin hochexperimenteller Atonalität. Das hatte zwei Möglichkeiten des Endens: Entweder brach ich, weil wir nie beisammen waren, zum Schluss in wahnsinniges Gelächter aus und Gretl nicht – oder ich wollte mich aus Verzweiflung prügeln und Gretl nicht.
Eine willkommene Alternative: Roulette. Gretl sah dabei lieber zu, als Risiken einzugehen. Herr Salz bewies sich als guter Glücksspieler und schlechter Verlierer, unsere Mama als das Gegenteil und ich mich als schlechte Gewinnerin.
Auch schmetterte ich an solchen Sonntagnachmittagen Schmachtfetzen, denn seit Neuestem wollte ich Opernsängerin werden. Das ergab sich aus familiären Umständen: Unsere Eltern besaßen zwar ein Abonnement für die Oper, gingen aber so gut wie nie hin. Für gewöhnlich fehlte die Zeit, und war diese doch vorhanden, dann mangelte es an Lust (in welchem Fall die Ausrede ebenfalls fehlende Zeit lautete). Häufig telefonierten sie in letzter Minute aus der Rezeption unten herauf: »Wenn jemand von euch in die Vorstellung gehen will, unsere Karte ist frei.« Gretl wollte nie. Ich dagegen nannte die etwas erhöht liegende Leipziger Oper bald den Magnetberg. Es waren meine seligsten Abende, wenn ich auf dem scheenen Augustusplatz hingehen durfte, den unsere lieben Genossen später in Karl-Marx-Platz umtauften. Dort habe ich mit entzückten Schauern den ganzen Ring, Carmen, Mozartopern und auch die Spielopern von Lortzing erlebt. Die mich begleitenden Erzieherinnen existierten für mich gar nicht, ebenso wenig die restlichen Publikumsgäste. Es gab für mich nicht einmal die Sänger oder Musiker. Wer guter Musik lauscht, ist immer für sich allein.
So allein, wie ich es jetzt in meiner absoluten Dunkelheit bin. Mit dem Unterschied, dass ich nichts hören kann. Nicht einmal meine eigene Stimme. Recht tragisch, denken Sie? Mitnichten! Meine Stimme, dieses rostige, verstimmte Instrument einer fast Neunzigjährigen, gehört keinesfalls zu den Dingen, die ich vermisse.
Meine Mama dagegen vermisse ich sehr. Ich bin so alt, viel älter, als sie werden durfte, und trotzdem vermisse ich sie wie ein Kind. Ich wünsche sie zu mir. Erfolgversprechender wäre es wohl, ich wünschte mich zu ihr. Aber noch nicht, noch nicht.
Den Herrn Salz vermisse ich durchaus auch. Wäre er nur hier! Ich würde ihm mitteilen, was ich von ihm halte, einem Mann, der seine schwangere Frau im Beisein seiner nicht taubstummen Töchter täglich erinnerte: »Hoffentlich wird’s ein Sohn.«
»Ein Töchterchen hätten wir auch lieb«, erwiderte Mama darauf wie automatisch und hob die Stimme jedes Mal mit den letzten beiden Silben. Eine versteckte Frage an ihn.
Seine offene Antwort: »Töchterchen haben wir schon.«
Von einem Sohn erhoffte sich Herr Salz den Fortbestand seines Namens. Die Erfüllung seines Wunsches nach einem männlichen Erben stand Ende Juni kurz bevor. Wir sollten derweil ins Káschberltheater. Ich fühlte mich zu alt für diese Kunstform, doch es war die einzige, für die meine ältere Schwester vages und somit überproportional starkes Interesse aufbrachte. Herr Salz drängelte und drängelte, bis wir endlich, lange vor der Zeit, das Haus verließen.
Als wir dann aus dem Káschberltheater zurück in den Fürstenhof kamen, wurde uns mitgeteilt, dass wir ein Brüderchen hatten. Mama saß in einem rosaseidenen Schlafrock in ihrem Bett, den Fritz im Arm, der – darin waren Gretl und ich uns ausnahmsweise einig – frappierende Ähnlichkeit mit dem Christkind aufwies. Und der Herr Salz, das werde ich nie vergessen, betrachtete Mama auf eine verstörende Art und Weise, wie ich es kein zweites Mal erlebt habe: verliebt.
Wie bei jeder Liebe steckte darin allerdings eine gehörige Portion Selbstliebe. Endlich hatte seine Frau einen anständigen Nachkommen produziert, der den Namen Salz, über den Tod vom Herrn Salz hinaus, verbreiten und damit seine Chancen auf Unsterblichkeit um wenige Prozentpunkte nach dem Komma erhöhen würde.
An diesem Abend lag ich allein im dunklen Kinderzimmer. Zumindest dachte ich das. Fritzls Ankunft in der Familie hatte Gretl ungewöhnlich aufgeregt, sie lehnte strikt ab, sich von Mama zu trennen, nicht einmal über Nacht wollte sie von ihrer Seite weichen. Unsere wie immer viel zu liebe Mama, die wenige Stunden zuvor mal eben so ein Kind zur Welt gebracht hatte, tröstete Gretl und erlaubte meiner Schwester, bei ihr zu schlafen. Herr Salz mischte sich nicht ein. Solange niemand seine Ruhe störte, war ihm alles recht – was ich, in dieser ersten Nacht ohne Gretl, nachzuvollziehen lernte. Welch ein Luxus, mir mit dem Einschlafen Zeit lassen zu dürfen und mich nicht sputen zu müssen, ehe sie mit ihrer Schnarcherei loslegte! Mit offenen Augen träumte ich von meinen eigenen, geräuschlosen Privatgemächern im Fürstenhof.
»Guten Abend.«
Ich schrak hoch. Mein Herz klopfte. Diese vorsichtige, brüchige Bubenstimme – die, wie mir erst später bewusst wurde, einwandfreies Hochdeutsch sprach – hatte ich noch nie vernommen. Sie gehörte keinem in der Familie und keinem der Bediensteten.
Ich wollte das Lämpchen auf meinem Nachttisch einschalten. Doch dann hielt ich inne.
Ich fürchtete mich vor dem, was das Licht mir präsentieren könnte.
»Guten Abend«, kam es noch einmal – und diesmal fordernder – aus der Schwärze des Raums. Ich zog mir die Bettdecke hoch bis zum Kinn. Wie antwortete man einem Eindringling in einer solchen Situation? Als angehende Opernsängerin erwog ich: mit theatralischem Geschrei. Aber was, wenn er mich daraufhin attackieren würde?
Am meisten Angst machten mir seine nächsten Worte: »Du brauchst keine Angst zu haben.«
»Bitte tun Sie mir nichts«, sagte ich.
Fast ein wenig entrüstet: »Wir tun dir nichts.«
Nun wollte ich erst recht kein Licht. Wie viele waren es?
»Was wollen Sie?«, fragte ich.
Stille. Sekunden verstrichen. Oder Minuten.
»Sind Sie Räuber?«
»Wir sind keine Räuber.«
»Sind Sie Diebe?«
»Wir sind keine Diebe.«
Ich überlegte. »Sie sind Einbrecher!«
»Nein, wir sind keine Einbrecher!«
»Aber das ist unsere Wohnung. Das hier ist mein Zimmer.«
Wieder Stille. Dann: »Vielleicht sind wir doch Einbrecher.«
Seltsamerweise fand ich das beruhigend zu hören. Ich ließ die Bettdecke ein Stück sinken. »Klauen Sie uns jetzt etwas?«
»Nein. Wir klauen nie etwas. Fast nie.«
»Dann sind Sie fast nie richtige Einbrecher.«
Erleichtertes Ausatmen.
»Wer sind Sie?«, fragte ich.
»Dürfen wir uns vorstellen?«
Ich deutete ein Nicken an. Noch bevor ich ein »Ja« hinterherschicken konnte, leuchtete im Dunkeln eine kleine Flamme auf. Wie ein Irrlicht schwebte sie in der Luft. Als meine Augen sich daran gewöhnt hatten, erkannte ich das schmale, bleiche Gesicht eines Jungen, kaum älter als ich. Markante Wangenknochen, schulterlanges, fettiges Haar, das ihm ins Gesicht fiel und seine schwarzen oder dunkelbraunen Augen verbarg. Er hielt ein Feuerzeug in der Hand und lächelte mit geschlossenem Mund. Wenn überhaupt, dann war er höchstens ein sehr entfernter Metiers-Verwandter des Räubers, den Gretl und ich wenige Stunden zuvor im Káschberltheater erlebt hatten.
»Ich heiße Maria«, sagte er.
»Maria?«
Er nickte.
»Meine Großmama hieß so. Das ist ein Mädchenname«, erklärte ich diesem fast nie richtigen Einbrecher.
Er schien kurz darüber nachzudenken. »Das ist auch ein Jungenname. Denn ich heiße ja so.«
Dem konnte ich kaum widersprechen.
Ohne sich umzudrehen, deutete Maria mit dem Daumen hinter sich. »Und das ist Geist.«
»Wer?«
»Geist.«
Ich suchte im Dunkeln nach diesem Geist. »Ich sehe niemanden.«
Maria verdrehte die Augen. »Geist ist scheu. Versteckt sich gern hinter mir.« Nun hielt er das Feuerzeug hinter seinen Rücken, sodass sein schmaler Schatten auf den Boden zwischen uns fiel. »Da bist du ja.«
Ich sah Maria an. »Wo?«
»Na, da«, sagte er und deutete auf seinen Schatten.
»Dein Schatten heißt Geist?«
Kopfnicken.
»Hat er dir gesagt, dass das sein Name ist?«, fragte ich.
Maria lachte auf. »Schatten können doch nicht reden!«
»Nicht mit Worten.«
»Stimmt«, sagte er. »Du kennst dich ein bisschen aus mit Schatten. Was weißt du noch?«
»Ich weiß«, sagte ich, »dass Schatten keine Namen haben.«
»Doch. Mein Schatten heißt Geist.«
»Ja, aber normale Schatten haben keine Namen.«
»Natürlich. Jeder Schatten hat einen.«
»Mein Schatten«, sagte ich, »hat keinen.«
Maria sah mich bestürzt an. »Dann musst du ihm sofort einen geben.«
»Warum?«
»Sonst weiß er ja nicht, wie er heißt!«
Das leuchtete ein. Wieso hatte mich bisher niemand, nicht einmal Mama, darauf hingewiesen?
Als ich das Nachttischlämpchen einschaltete, schirmte Maria seine Augen mit der Hand ab. Ich beugte mich über meinen auf der Bettdecke zerknitterten Schatten und überlegte. Ich spürte Marias erwartungsvollen Blick auf meiner Wange.
»Figaro«, sagte ich schließlich. »Ich nenne dich Figaro.«
»Wie in der Oper«, sagte Maria.
Ich lächelte. »Du kennst die?«
»Das wundert dich.«
»Du siehst nicht aus wie jemand, der in die Oper geht.«
»Wie sieht denn jemand aus, der in die Oper geht?«
»Anders als du. Wo lebst du?«
»Ganz in der Nähe.«
»Wie bist du hier reingekommen?«
»War nicht schwer. Dank dir.«
»Was meinst du?«
Er sah mich an, als wüsste ich die Antwort. »Wir müssen jetzt gehen«, sagte er dann.
»Schon?«, fragte ich, und als er darauf nicht reagierte: »Kommst du wieder?«
»Du darfst niemandem sagen, dass wir hier waren.«
»Warum nicht?«
»Sonst holen sie uns.« Da war Angst in seiner Stimme.
»Wer?«
Maria schritt zur Tür, dicht gefolgt von Geist.
»Warte.«
Maria hielt inne.
»Weißt du, wie ich heiße?«
»Lola«, sagte er. »Lola Rosa Salz.«
Mein Name hatte noch nie so schön geklungen.
Im nächsten Moment schlüpfte Maria ins Wohnzimmer. Ich sprang aus dem Bett, folgte ihm. Wo war er hin? Kein Fenster stand offen, auch die Eingangstür war von innen verriegelt. Alles sprach dafür, dass er sich noch in der Wohnung befand. Aber mein Gefühl sagte mir, was nach einer ausführlicheren Suche feststand: Er war weg. Mein Herz klopfte noch immer heftig, nur inzwischen aus einem anderen Grund. Ich hatte keine Angst mehr vor dem Besucher, sondern davor, dass er vielleicht nicht wiederkäme.
»Haben alle Schatten einen Namen?«
Darauf hatte jeder in meiner Familie am nächsten Morgen eine andere Antwort.
Mama, erschöpft vom Kinderkriegen, noch in die Daunenkissen ihres Bettes versunken: »Natürlich, Liebling. Geh, geh und finde sie alle heraus.«
Fritzl, erschöpft vom Auf-die-Welt-kommen, den Mund voll Milchbusen: zweifelndes Stirnrunzeln.
Herr Salz, verborgen hinter seiner Morgenmaske, der Titelseite der ›Leipziger Volkszeitung‹, an jenem Tag großflächig bedruckt mit einem Bild des prominent-schnurrbärtigen Thronfolgers sowie Mordopfers Franz Ferdinand von Österreich-Este: »Hm.«
Gretl, erfüllt von Stolz, weil sie und nicht ich die Nacht bei Mama verbracht hatte: »Nein. Keinesfalls. Nie und nimmer.«
Und Figaro, mein treuer Figaro: heftiges Kopfnicken.
Ich musste Maria und Geist so bald wie möglich wiedersehen. Der Tag wurde zum längsten aller Tage. In der Schule dehnte die Lateinlehrerin die neuen Vokabeln bis zur Unkennt- beziehungsweise Unendlichkeit. Auf der Tramfahrt nach Hause wurden wir von einem dreibeinigen Muli überholt, der einen Karren voll solider Grabsteine zog. Am Mittagstisch mussten Gretl und ich stundenlang auf Herrn Salz warten, sodass die Mädchen, als er endlich eintraf, die kalt gewordenen, eingetrockneten Krautwickel und Schwenkkartoffeln noch einmal aufwärmen mussten. Der Nachmittag weigerte sich vehement, dem Abend zu weichen. Ich zog unsere Standuhr mehrmals auf, im Glauben, sie sei stehen geblieben – und fand die darin liegende Ironie nicht lustig, vielmehr grausig, da ausgerechnet meine eigentlich gegen jegliche Feinsinnigkeit immune Schwester mich darauf hinwies. Mama konnte mich auch nicht ablenken – wir durften sie nicht aufsuchen, weil sie sich weiter von den Strapazen der Geburt erholen musste. Die Nachtruhe wünschte ich mir sonst nur ähnlich inbrünstig herbei, wenn Weihnachten bevorstand.
Dann endlich lagen fast alle in ihren Betten. Gretl musste sich wieder mit ihrem angestammten in meiner Nachbarschaft begnügen und ich mich mit der Kakofonie ihres Atmens, Mama hatte ihres seit Fritzls Geburt kein einziges Mal verlassen. Nur Herr Salz räkelte sich vermutlich als etwas zu kurz geratenes Fotoaktmodell auf dem Bett einer uns unbekannten Dame, da er vor dem kuss- und grußlosen Verlassen der Wohnung seine Abwesenheit wieder einmal mit einer »dringenden Affäre« angekündigt hatte. Als ich mir also sicher war, dass mich niemand aufhalten würde, schlich ich ins Wohnzimmer, stieg auf einen Stuhl, öffnete das Fenster – und fand Maria wie vor ein paar Wochen auf der Kante des Dachbogens sitzend. Er ließ die Beine baumeln; wer genau hinsah, konnte die schwarzen Socken an seinen Füßen als Schmutz enttarnen.
»Komm«, sagte er.
»Aufs Dach?«
»Wird dir gefallen.«
»Das ist gefährlich.«
»Wir achten schon auf dich.«
»Du und Geist?«
Er hielt mir seine offene Hand hin, und obwohl er zu weit entfernt war, um notfalls nach mir greifen zu können, nahm mir das doch ein wenig von meiner Furcht. Ich kletterte aus dem Fenster und hielt mich am Rahmen fest. Mein weißes Nachthemd flatterte im Wind. Sechs Stockwerke unter mir war der Hoteleingang. Wenn ich jetzt fiel, würde ich zur übernächsten Morgenmaske des Herrn Salz werden.
»Dir passiert nichts«, sagte Maria. Er klang, als sei er sich seiner Sache sehr sicher.
»Und wenn ich abrutsche?«
»Musst eben aufpassen.«