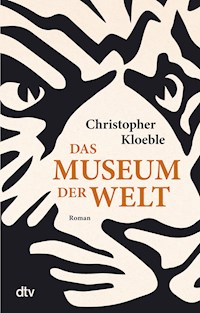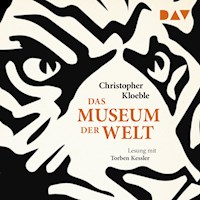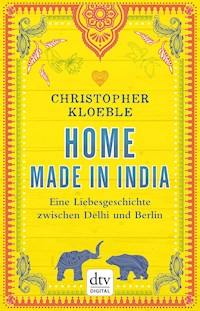
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Eine hinreißende Liebesgeschichte Die Inder, die Deutschen und ein Autor, der sich fragt: Was ist Heimat? Seit seiner Heirat mit Saskya aus Indien ist Christopher Kloeble eine staatlich verbriefte »Person indischer Herkunft«. Was es für ihn bedeutet, zwischen den Kontinenten zu pendeln, dem spürt er in diesem Buch nach: einfühlsam, unterhaltsam, nuanciert. Klischees und Vorurteile gibt es hier wie dort – Inder mokieren sich gerne über die Ungeduld und Regelgläubigkeit der Deutschen, während die Deutschen oftmals ein recht exotisches Bild von Indien im Kopf haben: Ob Saskya wohl auf einem Elefanten zur Schule geritten ist? Kloeble schildert Verständigungsschwierigkeiten und kulturelle Differenzen. Vor allem aber schreibt er über die Menschen, denen er begegnet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 386
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Christopher Kloeble
Home made in India
Eine Liebesgeschichte zwischen Delhi und Berlin
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Für Saskya
in Dankbarkeit und Liebe
PrologEine unwahrscheinliche Liebesgeschichte
Neu-Delhi, Dezember 2012. Im Garten tummeln sich zweihundert Hochzeitsgäste, aber der Bräutigam fehlt: ich. Mein aufgeregtes Zappeln macht es Jaswant, unserem Fahrer, nicht leicht, meinen Turban zu binden. Gegen meine Nervosität schenkt er mir sein charismatisches Lächeln. Das setzt er in den meisten unserer Konversationen auf. Manchmal bedeutet es: »Ich warte im Wagen.« Manchmal: »Keine Ahnung, was du versuchst zu sagen.« (Mein Hindi-Vokabular beschränkt sich auf alles, was mit Essen zu tun hat.) Und jetzt gerade: »Halt still, sonst sitzt der Turban schief.«
Als Jaswant fertig ist, trete ich vor den Spiegel: Der Mann in dem weiß leuchtenden Sherwani aus roher Seide erinnert kaum an den pausbäckigen Bub, der früher täglich über das Kopfsteinpflaster der Königsdorfer Hauptstraße zur Bäckerei Reindl radelte, um ein paar Pfennige gegen saure Drops zu tauschen.
Ich bin mir nicht sicher, ob der Bub und der Mann dieselbe Person sind. Ich weiß nur, Indien und eine Tochter Delhis haben viel damit zu tun, dass aus dem einen der andere geworden ist.
Draußen erwartet mich einer dieser nebligen Morgen, bei denen man nie weiß, ob man die Sonne am selben Tag nicht nur spüren, sondern auch sehen wird.
Der Turban sitzt erstaunlich fest, mein Herz klopft zwischen den Schläfen. Ich blicke mich nach meiner zukünftigen Frau um, kann sie nirgends entdecken. Anstatt in ihre Arme zu fallen, werde ich von Verwandten und Freunden der Familie in die Arme genommen, denen ich noch nie begegnet bin. Bisher habe ich kaum zwei Monate in Indien verbracht. Frauen zupfen meinen Schal zurecht, Männer klopfen mir auf die Schulter und alle beglückwünschen mich zu meiner Festkleidung. Ich bevorzuge sie gegenüber einer Lederhose. Als Tölzer Sängerknabe habe ich hinreichend oft bayerische Tracht bei volkstümlichen Konzerten getragen, um zu wissen, wie hartnäckig Wollstrümpfe kratzen und in die Kniekehlen schneiden.
Da lenkt ein Gast alle Aufmerksamkeit auf sich. So kann ich unbeobachtet den Turban lockern. Erst danach stelle ich fest: Der neue Gast trägt einen Hochzeits-Sari. Für einen Augenblick verfliegt all meine Nervosität aus Vorfreude auf die Heirat mit Saskya.
»Chalo, Christopher!«, ruft ein nicht blutsverwandter Onkel, der mich zum Rest der Familie führt und mir mit einem Augenzwinkern versichert, ich werde das schon hinbekommen.
Also ziehe ich meine Schuhe aus und setze mich neben meine nach Jasmin duftende Braut ans obere Ende des Mandap, ein Pavillon aus Holz und Blumen, in dem die Zeremonie abgehalten wird. Der Priester, alias Pandit, begrüßt die Familie und es geht los. Den Turban spüre ich nicht mehr. Nur, wie fest Saskya meine Hand drückt.
Wir sind das vorläufige Ergebnis einer mäandernden Familiengeschichte. Saskyas österreichischer Großvater war Botaniker in Afghanistan, weshalb ihre Mutter unter anderem in Kabul aufwuchs, in einer Ära, als Frauen dort in Miniröcken Fahrrad fuhren. Während ihres Studiums in Heidelberg lernte sie einen ehrgeizigen Doktor der Kunstgeschichte aus Bombay kennen. Saskyas Vater stammt aus einfachen Verhältnissen. Heute gilt er als bedeutender Professor und Intellektueller des Landes. Er hat prominente Museen und Institutionen gegründet, in dieser Funktion Staatsgäste aus der ganzen Welt empfangen, er kennt die Gandhis persönlich, wird dementsprechend hofiert, sogar von der Kaiserfamilie Japans, und lebt dennoch bescheiden.
Seine Tochter wird nun den Urenkel des verschlagenen Pächters vom Löwenbräukeller in München heiraten, der aufgrund eines Bierschaum-Skandals nach Leipzig umsiedeln musste, wo er jahrzehntelang das Hotel Fürstenhof führte. Lola, sein zweites Kind, entpuppte sich, nicht nur im Rampenlicht, als willensstarke Theaterfrau, die einen zartbesaiteten Staatsschauspieler aus Karlsruhe verführte, welcher unter anderem den Mackie Messer in der Uraufführung der ›Dreigroschenoper‹ gegeben hatte. Als Konsequenz dieser dramatischen Verbindung konnte sich auch ihr älterer Sohn, mein Vater, dem Theater nicht entziehen. Der Schauspieler tobte sich lange Zeit auf der Bühne und in Frauenschlafzimmern aus, bis er eine Familie gründete sowie eine Produktionsfirma für Film und Fernsehen (auch wenn er immer Schauspieler blieb, also den Produzenten nur mimte). Diese beiden Rollen gab er mit Großzügigkeit, Leidenschaft, Verdruss und Witz, bis sein Herz ihn im Stich ließ. Fast ein Infarkt. Er setzte sich zur Ruhe und zog in eine Berliner Wohnung – zusammen mit seiner dritten und vierten Ehefrau, meiner Mutter, die nach vierzig Jahren als Hausfrau nun zum ersten Mal eine Anstellung hat, und zwar als beliebte, wenn auch gefürchtete Servicekraft eines Boutique-Hotels.
Die beiden Familienstränge haben so wenig gemeinsam, nur eine unwahrscheinliche Liebesgeschichte konnte sie miteinander verbinden.
Aber dieses Buch erzählt von mehr als einer Liebe. Bevor ich Saskya kennenlernte, war Indien für mich ein Land, von dem ich noch nicht einmal wusste, ob ich es besuchen wollte. Heute, während ich das hier schreibe, kann ich mir ein Leben ohne Indien nicht mehr vorstellen. Auch wenn es mich jedes Mal erneut wie ein Juggernaut überrollt: Ich liebe dieses Land. Die eine Hälfte des Jahres verbringen wir dort, die andere in Deutschland. Wir pendeln zwischen Saskyas Heimat und meiner. Das ist schwierig, zuweilen beängstigend und wunderbar. Es öffnet mir nicht nur die Augen für einen kompletten Kontinent, sondern auch für ein kompliziertes, widersprüchliches und exotisches Land: Deutschland. Ich lerne vieles zu schätzen, das ich bisher als gewöhnlich hingenommen habe; gleichzeitig stört mich inzwischen so einiges, was mir früher überhaupt nicht auffiel.
Dass ich Saskyas Heimat jemals ganz zu meiner machen kann, glaube ich nicht. Ebenso wird sie sich in Berlin niemals so zu Hause fühlen wie in Delhi. Unsere Heimat befindet sich nicht an einem Ort. Sie ist keine geografische Region. Vielmehr erschaffen wir diese dritte und wichtigste Heimat immer dort, wo wir zusammen sind.
Zumindest wünsche ich mir das. Ob uns das auf Dauer wirklich gelingt, wird sich noch zeigen.
Teil IWie es dazu kam
1Ein Bub aus Bayern und eine Tochter Delhis
Zug’roaster
Der singende Klößle
Solange ich schreiben kann
Erste Begegnung und letzter Abschied
100 Seiten E-Mails
Wo es sich besser küsst
Zug’roaster
In seinem pränatalen Stadium trug dieses Buch den Arbeitstitel ›Ein Bayer indischer Herkunft‹. Es gab noch andere Varianten. Jede von ihnen rückte den Kontrast zwischen Indien und Bayern in den Vordergrund. Modisch: ›Turban und Lederhose‹. Filmisch: ›Von Bayern nach Bollywood‹. Kulinarisch: ›Zwischen Curry und Wurst‹.
All diese Titel verwarf ich. Abgesehen von der Simplifizierung störte mich vor allem der Fokus auf Bayern. Ich bin mir nicht sicher, ob ich einer von dort bin. Manch ein Weißblauer würde mir widersprechen: Ich wurde in München geboren und habe die prägenden Jahre meines Lebens im Voralpenland verbracht – wie könne ich kein Bayer sein?
Lassen Sie mich ein paar Jahre zurückgehen, lassen Sie mich Ihnen einen molligen, hellstimmigen Bub vorstellen, dessen Augenfarbe – graublaues Grün – so unentschieden ist wie sein Verhältnis zu Bayern.
Im Sommer 1983 wagen meine Eltern einen radikalen Schritt. Noch in meinem ersten Lebensjahr ziehen wir von München ins Voralpenland: nach Königsdorf in Oberbayern. Meine Eltern wollen nicht, dass ihr Sohn in der Stadt aufwächst. Das Land, glauben sie, sei besser für mich. »Dort kennen sich die Leute, Kinder können im Freien spielen und die Schule ist nur einen Spaziergang weit entfernt!«
Doch meine Eltern unterschätzen, wie bayerisch dieses Land ist.
Stammtisch, Frühschoppen, Schützenmärsche, Erzkatholizismus, Alpenpanorama, Fußballhuldigung, Schweinsbratenaroma, weißblau geringelte Maibäume.
All diese Klischees entsprechen der Wahrheit und dem Leben in Königsdorf.
Dort wachse ich als Kind einer hessischen Mutter und eines badischen Vaters auf. Ich könnte ebenso aus dem Ausland kommen. Bin also ein »Zug’roaster«. Einer von woanders.
Als ich kaum drei Jahre alt bin, reißt ein aus der Wohnzimmerwand ragender Nagel ein Loch in meine Wange und heile Kleinkindwelt. An den Schmerz erinnere ich mich nicht. (Wir Kloebles sind ausgezeichnete Verdränger.) Der Arzt, der die Wunde flickt, verspricht meinen Eltern, sie werde spurlos verheilen.
Er irrt sich. Eine Narbe bleibt. Sie markiert die erste Verletzung meines Lebens. Die nächste folgt sogleich: Nachbarskinder nennen mich »Preiß«, Preuße. Und das, noch bevor ich lerne, wer oder was überhaupt ein Preuße ist. Instinktiv spüre ich aber, was die Bayern damit sagen wollen: Ich bin nicht von hier. Jemand, der von hier ist, geht sonntags zur Kirche, spricht nicht hochdeutsch und trägt einen Familiennamen, der sich auf mindestens einem Straßenschild in der Umgebung finden lässt.
Eine lieblichere Erfahrung schenkt mir die blonde Christine, als sie sich einverstanden erklärt, mich zu heiraten. Wir sind fast sechs Jahre alt und besuchen den Königsdorfer Kindergarten, unter dem Regime katholischer Ordensschwestern. Sie bezeichnen Coca-Cola als Teufelszeug und verdammen uns selbst im Hochsommer dazu, heißen, ungezuckerten Kamillentee zu trinken. Und Schwester Alfonsa, die Diktatorin, lässt uns keinmal aus dem Kindergarten, ehe wir nicht unsere Schnürsenkel selbst gebunden haben. (Ich trage ausschließlich Schuhe mit Klettverschluss.) Christina und ich versprechen einander, gleich nach der Schule vor den Altar zu treten. Und mindestens drei Kinder zu haben!
Leider wird daraus nichts. Eine Woche nach unserem Schwur teilt sie mir mit, dass sie sich nun doch für ihren Tischnachbarn Stefan entschieden habe. Der kann im Bastelunterricht nämlich besser als ich, alias Speckfinger, mit der Schere umgehen. Meine einzige Chance auf wahre Liebe – dahin. Tagelang weigere ich mich, den Kindergarten zu besuchen. Ich kann ja nicht wissen, dass fast 6.000 Kilometer südöstlich von mir meine zukünftige Frau aufwächst.
Saskya wird in Ahmedabad im indischen Bundesstaat Gujarat geboren, aus dem auch Mahatma Gandhi und der spätere Premierminister Narendra Modi stammen. In ihrem zweiten Lebensjahr zieht sie mit ihrer Familie nach Delhi.
Ausgerechnet 1984. Kurz vor einem Fernsehinterview mit Peter Ustinov wird Indira Gandhi von ihren Sikh-Leibwächtern erschossen, an denen sie trotz der Separationsbewegung der Sikhs festgehalten hatte. Ausgangssperren werden verhängt. Dennoch ziehen rachsüchtige Mobs durch die Straßen. Polizei und Politiker der regierenden Kongresspartei sehen weg. Rajiv Gandhi, Indira Gandhis Sohn, rechtfertigt die Ausschreitungen mit den Worten: »When a big tree falls, the earth shakes.« Saskya, ihr Bruder und ihre Eltern wohnen zu diesem Zeitpunkt im Stadtteil Jangpura, wo auch viele Sikhs leben, die nach der Teilung Britisch-Indiens dort Zuflucht gefunden haben. Aus Angst vor Übergriffen verbarrikadiert sich die Familie tagelang im Haus; nachts sammelt Saskyas Vater Ziegelsteine, um sie im Notfall vom Dach auf Angreifer werfen zu können. Es gehen Gerüchte um, dass der Mob das Grundwasser vergiftet habe. In den Tagen nach dem Attentat werden über dreitausend Sikhs ermordet.
In derselben Zeit veranstalte ich in Oberbayern mit der Nachbarstochter Schlangenspiele: Wir finden Gefallen daran, Seile über unsere nackte Haut gleiten zu lassen und dabei leise zu zischen.
Meine Welt damals beschränkt sich auf den Radius, in dem ich alle Viertelstunde die Kirchenglocken hören kann. Das Zentrum meines Daseins heißt Königsdorf. Hier erlebe ich jeden Tag Abenteuer, die meisten sind idyllischer Natur. Ich schminke unseren Hund mit Mutters Lippenstift von Cartier. Ich löse die Handbremse unseres Autos, das am Hang parkt. Ich ersticke fast in einer selbst gebauten Schneehöhle. Ich finde ein vierblättriges Kleeblatt. Ich stehle Abziehbildchen aus einem aufgeschweißten Kaugummiautomaten (und lege sie zurück, als mein Vater mich darauf hinweist, dass Undercover-Polizisten mich womöglich beim Klauen beobachtet haben). Ich rutsche beim Spielen auf dem benachbarten Bauernhof aus und lande in einem dampfenden Kuhfladen, sodass meine Mutter mich mit dem Gartenschlauch abspritzen muss.
Außerdem bemühe ich mich um Integration. Ich bin ein Zug’roaster mit hehren Intentionen! Aber meine Versuche, Bayrisch zu sprechen, bringen Einheimische bestenfalls zum Lachen. Ich vermag es nur, jemanden, der kein Bayrisch kann, davon zu überzeugen, dass ich Bayrisch kann.
Unsere Nachbarin Anni, eine Bäuerin, die mit ihren vierzig doppelt so alt aussieht, rät meiner Mutter und mir einmal, wir sollten ein Ohr in unsere Garage legen, damit der Marder die Gummischläuche unseres Autos nicht anknabbert. Meine Mutter und ich staunen. Woher sollen wir ein Ohr bekommen? Anni kann doch unmöglich ein menschliches meinen. Ein Schweinsohr vielleicht? Auf Nachfrage hin erläutert Anni: »A Hühnerohr.« – »Ein Hühnerohr?«, fragt meine Mutter. »Haben Hühner Ohren?« – »Naaa!«, ruft Anni über den Zaun, als würde sie mit Taubstummen sprechen, »a OA! A frisch g’legt’s!«
Erst da begreifen wir.
Es ist aber nicht allein die Aussprache, die meinen Eltern und vor allem mir zu schaffen macht. Selbst wenn ich jedes einzelne Wort verstehe, kann ich oft nicht ganz folgen. Bayern kommunizieren anders miteinander als Nicht-Bayern.
An einem Nachmittag durchquere ich mit einer Gruppe Kinder einen Nachbarshof, da kommt der Bauer aus dem Stall und schimpft, wir sollen von seinem Grund und Boden verschwinden. Ich denke, er meint das ironisch. »Nein«, scherze ich, »wir gehen nicht!« Und grinse breit. Ich komme mir ziemlich witzig vor, fühle mich bestätigt durch das Kichern meiner Altersgenossen – die sich allerdings zurückziehen. Im nächsten Moment begreife ich, warum. Der Bauer jagt mich mit einer Mistgabel auf und davon.
Eine weitere meiner Anstrengungen, als einer von hier wahrgenommen zu werden: Fußballspielen. Es heißt schließlich immer, Fußball verbindet. Bayerische Buben können dribbeln, bevor sie sprechen lernen. Ungläubig beobachte ich die innige Beziehung ihrer Füße zum Ball. Fantastisch, wie sie in vollem Tempo rennen und dabei den Ball mit ihren Füßen scheinbar mühelos vor sich hertragen. Bisher ist noch jeder Ball meinen Füßen davongesprungen. Dennoch strenge ich mich an, trainiere, weil ich denke, so kann ich Eindruck schinden. Im Dribbeln bin ich talentfrei, doch beim Elfmeterschießen im eigenen Garten verwandele ich fast jeden Schuss in ein Tor – mein Vater bekommt den Ball nie zu fassen.
Leider stellt sich bald heraus: Dies ist kein Beweis für mein Können, sondern für das meines Vaters. Seinem Sohn zuliebe wirft er sich jedes Mal darstellerisch überzeugend in die falsche Ecke. Seinen Trick durchschaue ich erst, als mir im Sportunterricht kein Tor gelingen will. Danach überrascht es mich nicht, dass Michi, der Kapitän meiner Mannschaft, mich bittet, möglichst nicht ins Spiel einzugreifen, um uns nicht unnötig zu schwächen. Meine Aufgabe lautet, hinter der letzten Abwehrreihe darauf zu warten, dass ein gegnerischer Stürmer sich dem Tor nähert. Ich soll nicht versuchen, ihm den Ball abzunehmen. Nein. Wie sollte ich, der Fußballantigott, das auch bewerkstelligen. Stattdessen soll ich mich ganz darauf konzentrieren, den Gegner aufzuhalten, indem ich ihn umrenne. Einen ganzen Menschen kann selbst ich nicht verfehlen. Wenigstens dieser Aufgabe bin ich gewachsen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes: Ich bin »gesund« (meine Mutter), »stark« (mein Vater), »dick« (ich).
Der singende Klößle
Mit zunehmendem Alter entwickle ich eine Sensibilität für meine voluminöse Erscheinung. Im Schwimmunterricht wird mir übel, weil ich, solange wir nicht im Wasser sind, die ganze Zeit über meinen Bauch einziehe, um mich chamäleonhaft meinen spindeldürren Altersgenossen anzupassen. Mit mäßigem Erfolg. Einer fragt mich aufrichtig interessiert: »Warum bist du eigentlich so fett?« Er meint das nicht böse. An seinem schmalen Brustkorb, um den ich ihn beneide, tritt jede Rippe einzeln hervor. Ein schlankes Bürschchen wie er kann einfach nicht nachvollziehen, wie es mir gelungen ist, schon in jungen Jahren so viel Ballast auf meine Rippen zu packen. Ich besitze ein Paar Brüste, richtige Bübchenbrüste, die wie zwei verdorbene Früchte trostlos nach unten deuten und den frühpubertären Mädchen in unserer Klasse Konkurrenz machen.
Wenn wir an heißen Tagen im Sportunterricht in Teams aufgeteilt werden, sorge ich stets dafür, dass Trikotleibchen zur Verfügung stehen, dank denen man die Gegner von ihren Mitspielern unterscheiden kann. Sind keine vorhanden, neigt unser Lehrer zur pragmatischen Lösung: Ein Team muss oben ohne spielen. Meine Brüste und meinen Bauch will ich keinesfalls schwabbelnd der Welt präsentieren. Ich hasse dieses Gefühl, wenn beim Laufen der Speck an meinem Körper wackelt, zerrt, eine sich wild formende, immer im Wandel befindliche Masse, die Aufmerksamkeit erregt. So überfallen mich in derlei Momenten oftmals dramatische Kopfschmerzen, Schwindelanfälle oder höllisches Zahnweh.
Bei Bergbesteigungen am Wandertag bin ich immer der Letzte, bei der Gesundheitsmusterung zu Beginn des Schuljahres empfiehlt mir der Arzt, ich solle mehr rausgehen, an die frische Luft. Der Frust über mein Äußeres regt meinen Appetit an – auf noch mehr Schokoladentafeln, in heiße Milch getunkte Kekse, saure Gummibärchen oder Sahnetorten.
Im Tölzer Knabenchor wird mir bald ein treffender, wenn auch nicht besonders ausgefallener Spitzname zugedacht: Klößle.
Seit der Grundschule bin ich Mitglied. Im Musikunterricht habe ich nach dem Vorsingen von einem netten Herrn einen Brief für meine Eltern zugesteckt bekommen und daraufhin bei der Aufnahmeprüfung »sehr ordentlich« gesungen.
Mehr als einmal bitte ich meine Eltern, einen neuen Familiennamen zu wählen.
Der von Saskya hätte mir gewiss mehr zugesagt: Jain[1]. Nicht nur klingt er so viel schneidiger, er erinnert auch an einen Glauben, der älter und sympathischer ist als die meisten Religionen. Im Jainismus gibt es keine Götter, allein sogenannte geistige Führer, ähnlich wie im Buddhismus. Als oberstes Gebot gilt, Lebewesen möglichst keinen Schaden zuzufügen. Was bedeutet, dass strenggläubige Jains abgesehen von Fleisch, Fisch und Eiern nicht einmal Zwiebeln, Kartoffeln oder Knoblauch zu sich nehmen, da sie mit ihrer Wurzel geerntet werden. Auch wenn Saskyas Eltern weder religiös sind noch ihre Kinder so erziehen, entwickelt Saskya durch die Tradition, die mit ihrem Familiennamen verbunden ist, eine tief gehende Sensibilität für Leben – und für Nahrung.
Ich dagegen verspeise in Bayern mit leidenschaftlicher Lust Weißwürste und Leberkäse und Schweineschnitzel. Das Ergebnis dieser Ernährung begegnet mir täglich im Spiegel.
Meine Eltern trösten mich und versprechen, sich diese Jungs vorzuknöpfen, die es wagen, ihren gesunden, starken Bub zu malträtieren. Ich rücke aber keine Namen heraus. Ihr Eingreifen würde alles nur noch schlimmer machen.
Es kommt trotzdem schlimmer.
In der Vorweihnachtszeit reisen wir Chorknaben von einer mittelgroßen Stadt zur nächsten. Ein Schreiben des Bayerischen Kultusministeriums befreit uns den ganzen Dezember über vom Schulunterricht. So können wir vor ergrautem Publikum die »schönsten deutschen Weihnachtslieder« trällern und mindestens einmal täglich als Engelknaben bezeichnet werden. Während der Busfahrt zwischen zwei Konzertstationen proben wir die Lieder. Oder die Gesangslehrer testen stichprobenartig unser auswendig gelerntes Strophenwissen – und Weihnachtslieder haben verflucht viele Strophen. Stellt sich heraus, dass einer der Knaben ein Lied nicht Wort für Wort beherrscht, wird er mit Schelte und Geldabzug bestraft. Ja, Geldabzug. Wir Chorknaben erhalten nämlich bescheidene Honorare für unsere Auftritte. Wenige von uns – die herausragenden Solisten – streichen sogar nennenswerte Honorare ein. Sie kommen auf mehrere tausend Mark im Jahr. Und das im Alter von zehn, elf, zwölf Jahren. Allerdings wird eben auch jedes noch so kleine Vergehen mit Geldstrafen geahndet, die umgehend in einem Notizbuch festgehalten werden. Bleistift vergessen? Fünf Mark Abzug! Bettruhe gestört? Zwanzig Mark Abzug! Sich geprügelt? Fünfzig Mark Abzug!
Ich lerne schon früh die erzieherischen Vorzüge eines kapitalistischen Systems kennen.
Bei einer dieser Busfahrten ist der Chef – so nennen alle den Chorleiter – in dermaßen guter Laune, dass er mein Übergewicht nicht nur mit einem spitzen Kommentar bedenkt, nein, er lässt seiner Kreativität freien Lauf. Der Chef widmet mir den umgedichteten Refrain eines Volksliedes, das wir gemeinsam einstudieren: ›Das Fass von Königsdorf‹. Munter und aus voller Kehle singen alle Knaben die Zeilen nach. Nur gelegentliches Kichern oder Lachen hält sie davon ab. Manche beobachten mich mit Schadenfreude. Andere zwingt ihr schlechtes Gewissen, die Augen niederzuschlagen. Ich sehe aus dem Fenster. Im Glas spiegelt sich ein dicker Junge, der sein Weinen nicht unterdrücken kann. Je mehr ich mir in Gedanken sage, dass es mir nichts ausmacht, desto mehr weine ich.
Danach – als wir im Hotel ankommen und uns aufgetragen wird, in fünf Minuten auszupacken, zu duschen und bettfertig zu sein, sonst, Sie ahnen es, drohe Geldabzug – will kein Knabe auf ein Zimmer mit mir. Jeder fürchtet, meine Opferrolle sei ansteckend. Am Ende teilt der Chef mir einen Zimmergenossen zu, der darüber nicht sonderlich erfreut scheint. In weniger als fünf Minuten habe ich alles erledigt und liege im Bett. Ich starre ins Dunkel und schwöre mir, nie mehr zuzulassen, dass mich jemand so fertigmacht. Dies war das letzte Mal.
Es bleibt nicht das letzte Mal. Sechs Jahre lang bin ich ein Tölzer Sängerknabe.
In Delhi übt Saskya sich im indischen Tanzstil Kathak – in Bayern lerne ich, mich gegen Spott zu verteidigen. Ich entdecke ein effektives Antidot: Humor. Menschen stellen sich gern auf die Seite dessen, der sie zum Lachen bringt. Wenn ich schnell genug einen guten Witz mache, am besten über mich selbst, manchmal aber auch über frische, in der Hackordnung des Chors noch weiter unten angesiedelte Knaben, dann lässt das jeden Witz von anderen über mich verblassen. Ein erfolgreiches Überlebensmodell. Und Überleben bedeutet in diesem Fall: es bis zum Stimmbruch schaffen. Dieser ereilt mich zu meinem Glück bereits mit elf Jahren. Ich verlasse den Tölzer Knabenchor. Er hat bestätigt, was sich schon früh andeutete: Obwohl ich nie eine andere Heimat als Bayern gekannt habe, bin ich nicht von dort.
Solange ich schreiben kann
Längst habe ich einen Ort entdeckt, an dem ich mich viel mehr zu Hause fühle. Jedes Mal, wenn ich ihn aufsuche, sieht er anders aus – aber immer genau so, wie ich will. Ich kann ihn überall betreten. Dafür brauche ich nur einen Stift und ein Blatt Papier. In Leipzig, so höre ich, kann man Kreatives Schreiben studieren. Also bringe ich das Abitur hinter mich, bewerbe mich am Deutschen Literaturinstitut und siedle nach bestandener Aufnahmeprüfung um gen Sachsen. Dreieinhalb Jahre später darf ich mich einen diplomierten Schriftsteller schimpfen.
Davon lässt sich leider niemand beeindrucken. Ich verfasse einen Roman, verschicke ihn an zahlreiche Agenten sowie Lektoren und mahne meine Hoffnung zur Geduld.
Ein Absagebrief trudelt ein. Und dann noch einer. Und noch einer. Die Mappe, in denen ich die zahllosen »Nein« aufbewahre, schwillt an.
Weil meine damalige Freundin sich an der Freien Universität eingeschrieben hat, ziehe ich mit ihr nach Berlin. Mein erster Eindruck von der Stadt: miserabel. Den größten Teil meines Lebens habe ich in einem Dorf verbracht. Dort kann man, egal wo man sich befindet, binnen einer halben Stunde den gesamten Ort hinter sich lassen. Berlin dagegen spinnt ein Netz endloser Straßen um mich. Es fehlt nie an Menschen und immer an Ruhe. Der Alltag meiner Mitbewohner ist verwoben mit meinem: Jedes Türklingeln, Spülen, Hämmern erinnert mich an die Präsenz anderer – und vor allem daran, dass ich, ob ich es nun will oder nicht, ebenso ein Teil ihrer Leben bin. Da ich kaum Geld besitze, wohne ich in einem zugigen, vollgestellten WG-Zimmer, in dem ich bald so modrig rieche wie meine niemals vollständig getrocknete Wäsche. U-Bahn-Fahrten meide ich, um das Geld für Tickets zu sparen, was man an meinen abgetretenen Schuhsohlen ablesen kann. Ich trage freiwillig die Flaschen und Dosen der WG zum Supermarkt, damit ich die paar Cents einstreichen darf. Beim Einkaufen lautet meine oberste Regel, nicht mehr als fünf Euro auszugeben. Ich esse viel Nudeln mit Tomatensoße. Glücklicherweise sieht man mir das nicht an. Dank meiner Größe von 1,90 Meter wurde mein Kinderspeck gedehnt und verteilt sich nun gleichmäßig auf meinem Körper. Das vermittelt den Eindruck, ich sei schlank. Fast täglich gehe ich laufen: Ich renne vor einem dickeren Ich davon – und meine Freundin bald mir. Sie hat jemanden kennengelernt. Er ist allein mit dem Motorrad durch den Irak gereist. Da kann ich nicht mithalten. Mir gelang es nicht einmal, auf einem Moped Königsdorf zu durchqueren. Eine Sternstunde für mein Selbstmitleid. Ich bin nun allein in Berlin. So allein, wie man sich nur an einem Ort mit vielen Menschen allein fühlt. Aber ich habe ja das Schreiben. Solange ich schreiben kann, ist alles nicht so schlimm. Ich verfasse noch einen Roman. Und dieser findet tatsächlich ein Zuhause. Mein zweites Buch wird mein erstes und erscheint im Herbst 2008. Ich bin nun also ein Autor. Leute geben mir Geld für mein Schreiben. Eine, wie ich finde, ungeheuerliche Sache: Man bezahlt mich dafür, dass ich lüge. Damit meine ich nicht die Geschichten. Nein. Ich meine, ich behaupte ja nur, ein Autor zu sein. Ich weiß nicht wirklich, was ich tue. Ich setze einen Satz nach dem anderen, ohne einen blassen Schimmer, wo mich das hinführen wird, und wenn ich irgendwann ausreichend Sätze beisammen habe, bezeichne ich das Ganze als Roman, Zeitungsartikel, Drehbuch. Ich habe nichts mit richtigen Autoren gemein. Richtige Autoren sind Denker. Sie lenken die Worte. Mir scheint es eher, als lenkten die Worte mich. Ich folge ihnen und komme selten dort an, wo ich hinwill – und dafür erhalte ich dann auch noch Geld! Im Prinzip bin ich ein Hochstapler. Es ist nur eine Frage der Zeit, bald wird mir jemand auf die Schliche kommen.
Bis dahin will ich bloß schreiben, so viel wie möglich schreiben.
Erste Begegnung und letzter Abschied
Im März 2011 erhalte ich eine Nachricht von Anderson Literary Management aus New York, einer Literaturagentur, die Autoren vertritt. Eine gewisse Saskya Iris Jain schreibt mir: »I was very excited by your work which I believe stands out in the landscape of writing coming out of Germany today.« Den Satz lese ich mehrmals. So einen Satz bekommt man als Autor selten serviert. Ich mag diese Saskya Iris Jain auf Anhieb. Sie füttert mich in dieser E-Mail mit weiteren Schmeichelhäppchen und offeriert mir, mich zusammen mit ihrer Chefin, Kathleen Anderson, auf dem englischsprachigen Buchmarkt zu vertreten. Weniger als drei Prozent der Neuerscheinungen in den USA sind Übersetzungen. Da Englisch der Schlüssel zu Lesern auf der ganzen Welt ist, kämpfen viele Autoren um einen Platz unter diesen drei Prozent.
Ich bin damit aufgewachsen, bei jedem Amerikabesuch mit meinem Vater in einem Barnes & Noble einzufallen und ihn erst wieder zu verlassen, wenn wir Beute, also mindestens ein Dutzend Bücher, erlegt hatten. Nie hätte ich es damals gewagt mich der Hoffnung hinzugeben, eines Tages könnten mit meinen Wörtern gefüllte Seiten auf einem dieser Büchertische zu finden sein. Was hatte ich schon jemandem in New York, San Francisco, Chicago mitzuteilen? Ich war schließlich bloß das Fass von Königsdorf.
Die Bereitschaft einer Literaturagentin aus Manhattan, mich zu vertreten, würde meine Chancen erheblich steigern, auf einem dieser Büchertische zu landen. Trotz der hohen Zahl an Agenturen in den USA wählt jede Agentur ihre Autoren, und als ausländischer Autor lässt sich noch schwerer ein Platz ergattern. Umso euphorischer bin ich ob der Nachricht dieser Saskya Iris Jain – auch wenn ich das ihr gegenüber verberge. Sie ist ja sozusagen mein neuer Geschäftspartner.
Ich schreibe ihr, dass ich mir eventuell vorstellen kann, von einer US-Agentur vertreten zu werden. Ein paar E-Mails später vereinbaren wir ein Treffen.
Ein sonniger Tag. Ich warte, umgeben von den Düften des Curry 36 und von Mustafas Gemüsekebap, am Mehringdamm, wo wir uns verabredet haben. Saskya ist beruflich in Berlin. Unter vier Augen lässt sich viel besser über das Manuskript des Romans sprechen, der im Jahr darauf in Deutschland erscheinen soll und den Anderson Literary Management in Amerika vertreten möchte.
Ich überlege, ob ich bei der Begrüßung erwähnen soll, dass gleich nebenan Gottfried Benn seine Praxis geführt hat. Ein bisschen Eindruck schinden mit Lokalwissen. Mein E-Mail-Verkehr mit Saskya hat mir deutlich gemacht, dass sie eine gebildete, präzise arbeitende, verlässliche Frau mit scharfsinnigem Humor ist. Deshalb glaube ich, sie könne nicht besonders attraktiv sein. Diese fragwürdige Folgerung legt mir meine bescheidene Erfahrung nahe. Ich stelle mir Saskya als kräftig gebautes Mädchen vor, das seine Freizeit lieber online als in Clubs verbringt und aus Einsamkeit zig Schokoladenriegel verdrückt. Ich habe sie nicht einmal gegoogelt. So überzeugt bin ich davon, dass sie unansehnlich ist.
Sie ist alles andere als unansehnlich. Wir spazieren zur typischen Kreuzberger Variante eines italienischen Restaurants, mit gepiercten Kellnern und Klappstühlen, und ich kann mich nicht davon abhalten, sie ausführlich zu mustern. Es ist schwer, einen schönen Menschen nicht zu betrachten. Ihre Lebendigkeit und Schlagfertigkeit, verbunden mit formvollendeter Höflichkeit, lassen mich sofort alle beneiden, die Saskya zu ihren Freunden zählt. Dabei ist sie erst wenige Minuten zuvor dem Anschlag eines Gasofens entkommen. Eine Stichflamme hat ihre Haare versengt. Was mir allerdings nicht auffällt – sie hat dunkles Haar.
Alle kritischen Anmerkungen Saskyas zu meinem Roman sind klug und erhellend. Sie werden, das weiß ich sofort, das Buch erheblich verbessern. Unser Gespräch verläuft so angenehm, als würden wir uns schon lange kennen. Wenig später sehe ich auf die Uhr. Drei Stunden sind vergangen.
Ich erlaube mir nicht darüber nachzudenken, wie es wäre, sie privat wiederzusehen. Wir leben so weit voneinander entfernt. Zudem habe ich ja keine Ahnung, was sie von mir hält. Und nicht zuletzt haben wir beide angedeutet, dass wir derzeit jemanden sehen.
Benutzen wir absichtlich diesen Anglizismus? Um anzudeuten, dass wir nicht in festen Händen sind?
Bei meinem letzten Aufenthalt in den USA, im heimeligen Iowa, habe ich Lindsay kennengelernt. Auf den ersten Blick eine klassische Frau aus dem Mittleren Westen. Blond, hübsch, mit einem Häuschen in »Suburbia«, das sie abbezahlt. Lindsay arbeitet an verschiedenen Highschools als Betreuerin schwer erziehbarer Kinder und geht sonntags zur Kirche.
Aber das ist nur eine Seite von Lindsay. Andere Facetten lerne ich mit der Zeit kennen. Sie ist passionierte Zigarrenraucherin. An einem Teil ihres Körpers, der nur selten dem Licht ausgesetzt wird, trägt sie zwei Tattoos. Ein Fischsymbol und ein Cinderella-Schuh. Ersteres erinnert sie an ihren geliebten Jesus, Letzteres an den nicht minder geliebten Papa. In einem Disput über Waffenbesitz – sie als Tochter eines Jägers ist dafür, ich als pazifistischer Oberlandbub dagegen – teilt Lindsay mir mit, ich würde bei ihr über einer Schusswaffe schlafen. Sie bewahrt ihren Revolver unter dem Bett auf. Dieser hat verblüffende Ähnlichkeit mit dem Monster, mit dem Jack Nicholson im ersten ›Batman‹-Film Michael Keaton in seinem Batwing vom Himmel holte. Der Lauf ist so lang wie ein Bratspieß.
Ich weiß nicht, ob ich mich auf diese amerikanische Liebe eingelassen habe, weil ich mit einem Vater aufgewachsen bin, zu dessen ersten Erinnerungen ein Soldat der US-Armee gehört, der ihm von einem Panzer Hershey-Schokolade zuwarf, einem Vater, der mir eine ungebrochene Begeisterung für dieses Land vorgelebt hat, das mir so viel Furcht und Hoffnung einflößt. Obwohl ich spüre, dass Lindsay und ich nicht dazu bestimmt sind, eine Beziehung zu führen, will ich mir das nicht eingestehen. Sie bedeutet mir etwas. Ich habe mich nicht in sie verliebt, vielmehr geht von ihr und ihrem Leben eine Anziehungskraft aus. Und inzwischen liebt ein Teil von mir einen Teil von ihr. Dieser Teil drängt mich dazu, mir Mühe zu geben. Ich muss versuchen, sie zu verstehen. Vielleicht wird es ja dann mit uns dreien klappen: ihr, mir und Iowa als neuer Heimat. Also schlage ich einen Kompromiss vor: einen Ausflug zur Shooting Range.
Dort gibt es fünfzig Kugeln für zehn Dollar; dort steht auf einer Plastikhandgranate: Complaint Dept. Take a number; dort rät Lindsay mir, die anderen Schießenden eine Weile zu beobachten und, falls jemand verdächtig wirke, lieber wieder zu gehen; dort horcht der Ladenbesitzer auf, als er meinen deutschen Akzent bemerkt, und sagt, das gehe aufs Haus. »How come?«, frage ich. »We go way back«, meint er. Die Frage, wie weit way back, will er nicht beantworten.
Das nächste und letzte Mal sehe ich Lindsay in New York. Wir führen zahlreiche Diskussionen während dieser Tage. Ihr wiederholter Vorwurf: Ich sei »no fun«. Was ich mit meinem Deutschsein verteidige. Ich muss ab und zu debattieren und vor allem korrigieren, das ist ein oft unsympathisches, pragmatisches und wesentliches Stückchen meiner germanischen Seele.
So verbringen wir den Abend unseres letzten gemeinsamen Tages, der gleichzeitig mein 29. Geburtstag ist: Ich werfe der christlichen Lindsay an den Kopf, Menschen würden nur an Gott glauben, um sich ihrer Verantwortung entziehen zu können. Es gibt überhaupt keinen Gott, schimpfe ich auf dem Heimweg zum Hotel und mache mich mit jedem Gefühlsausbruch kleiner, er ist nur eine Erfindung von Menschen, die nicht mit der Tatsache klarkommen, dass jeder von uns allein auf der Welt ist.
Als sie verstummt, tut es mir leid. Ich will das Ende mit einem guten Glas Wein retten. Kaufe eine Flasche. Rechne aber nicht damit, dass unser Hotel keinen einzigen Korkenzieher besitzt. Bei einem leichtsinnigen Öffnungsmanöver bleibt der Korken im Flaschenhals stecken. Also trinken wir zum Abschied Leitungswasser und vergeuden unsere finalen Stunden mit Vorwürfen. Ich gebe eine dramatische Performance und drohe damit, in einem anderen Zimmer, ja, in einem anderen Hotel zu übernachten. Lindsay weist mich auf die Uhrzeit hin. Draußen dämmert es bereits. Wir wachen bis zum Sonnenaufgang nebeneinander, zu erschöpft, um zu streiten oder zu schlafen. Ich bringe sie zum Taxi. Der Abschied ist zärtlich und endgültig.
100 Seiten E-Mails
Am Abend desselben Tages habe ich einen Termin in einer Bar in Brooklyn. Saskya Jain, meine neue Agentin, will mir Aaron Kerner vorstellen, einen potenziellen Übersetzer für meinen Roman. Sie kennen sich von Saskyas Creative-Writing-Studium an der Boston University.
Aaron ist ein schlanker, zwei Meter großer Hüne mit einem nervösen, freundlichen Lächeln, sensiblen Augen und einem Purzeln in der Stimme, als hätte er seinen Stimmbruch erst vor Kurzem überwunden. Er hat sich die deutsche Sprache angeeignet, weil er vor Jahren einmal einen Essay von Walter Benjamin lesen wollte, der nicht auf Englisch übersetzt war – woraufhin Aaron das kurzerhand selbst übernahm. Wort für Wort. Ich bin tief beeindruckt von seiner Sprachbegabung. Der Essay von Benjamin würde mir selbst auf Deutsch viel Mühe abverlangen.
Wir sitzen im Hinterhof einer schrattigen Bar in Williamsburg. Die Luft ist erfüllt von Cannabisgeruch und dem Sirenengeheul etlicher Ambulanzen. Das Bier und mein angeknackstes Herz lassen mich zu viel reden. Die beiden wissen nicht, wie ihnen geschieht. Ich hetze von einer Anekdote zur nächsten und fühle mich durch ihr Lachen sowie ihre tadellose Aufmerksamkeit darin bestätigt weiterzumachen. Munter plappere ich und nutze aus, dass ich zwei so interessierten wie höflichen Menschen gegenübersitze. Ihnen würde es nicht im Traum einfallen, mich zu unterbrechen oder auf die Uhrzeit hinzuweisen. Wie so oft, wenn viel geredet wird, sage ich nur wenig. Als der Abend zu Ende geht, spüre ich deutlich eine Sehnsucht: Könnte ich nur länger hierbleiben, in diesen muffigen Sesseln mittelmäßiges Bier schlürfen und weitere Stunden mit Saskya und Aaron teilen. Aber irgendwann muss selbst ich die Klappe halten. Der Flughafen ruft.
Wenige Tage später wohne ich als Trauzeuge im Königsdorfer Rathaus der zweiten Hochzeit meiner Eltern bei. Danach schlafe ich eine letzte Nacht in dem dreihundertfünfzig Jahre alten Bauernhaus, von denen wir fast dreißig mit ihm verbracht haben, ehe meine Eltern den Käufern die Hausschlüssel überreichen und wir der oberbayerischen Gemeinde den Rücken kehren. Es ist ein großer Umbruch für meine Familie. Meine Eltern ziehen gemeinsam mit meiner Schwester Anna, die gerade ihr Abitur bestanden hat, nach Berlin. Ein wichtiger Lebensabschnitt geht zu Ende.
Ich bin mir nicht bewusst, dass ein neuer längst begonnen hat.
Saskya und ich, wir schreiben einander. Anfangs sind es kurze Nachrichten, die Arbeit am Roman betreffend, manchmal begleitet von neckenden Kommentaren, für die ich in einem persönlichen Gespräch niemals den Mut aufbringen würde. In den Botschaften, die ich über den Großen Teich sende, an eine Frau, die ich womöglich nie wiedersehen werde, in diesen Botschaften bin ich weitaus abenteuerlicher in meiner Wortwahl. Und nicht nur ich. Immer wieder überrumpelt Saskya mich mit Provokationen, vieldeutigen Anspielungen, die ich dieser Frau gar nicht zugetraut hätte.
Wir schreiben einander nur auf Englisch. Dabei könnte Saskya ebenso gut auf Deutsch schreiben. Oder auf Hindi. Französisch. Oder Farsi. Saskyas Sprachtalent lässt mich an meinen Fähigkeiten zweifeln. Ich beherrsche ja nicht einmal Bayrisch. Wieso wir Englisch wählen? Ich glaube, weil es die Sprache ist, mit der wir gestartet sind. Unsere Verbindung ist so fragil. Wir wollen sie nicht unnötig mit Deutsch belasten. Auf Deutsch würden wir anders miteinander kommunizieren. Ich würde in ein größeres Vokabular flüchten. Meine limitierten Englischkenntnisse zwingen mich dazu, meine Gedanken klarer zu formulieren. Auf Englisch fällt es mir leichter, mich neu zu erfinden. Ich bilde mir sogar ein, auf Englisch humorvoller zu sein. Und höflicher. Im Deutschen entwischen mir viel öfter grobe, unpassende, verletzende Aussagen.
Andererseits: Vielleicht hat es überhaupt nichts mit meiner Verwendung von Sprache zu tun, sondern bloß mit den Gesprächspartnern. Durchaus möglich, dass englischsprachige Personen besser darin sind, meine problematischen Kommentare mit einem Lachen zu entschärfen – wohingegen allein das Stirnrunzeln meiner Landsleute ausreicht, um mich daran zu erinnern, dass ich in ein Fettnäpfchen gesprungen bin.
Saskya eröffnet mir, sie sei ebenfalls Autorin. Derzeit schreibe sie ihren ersten Roman. Zwei Schriftsteller beim Schreiben! Unsere Botschaften wachsen mit der Zeit beträchtlich an. Ein romantischer Ernst stiehlt sich hier und da in einen Satz. Auch nimmt die Häufigkeit zu. Bald verfassen wir jeden Tag seitenlange Nachrichten. Für diese benötige ich stets ein paar Stunden. Was vermutlich an meinem Englisch liegt – und der Tatsache, dass ich, um mir Gelassenheit einzuflößen, mit Whiskey nachhelfe. Irgendwann erwähne ich das Saskya gegenüber. Darauf beichtet sie, beim Schreiben der E-Mails ebenfalls an einem Glas Jameson zu nippen. Diese Frau, die ich interessanter finde als alle anderen Frauen in meinem Leben, verblüfft mich stets aufs Neue. Obwohl wir beinahe gleich alt sind, hat sie schon so viel mehr erlebt. Aufgewachsen ist sie in Delhi, mit sporadischen Besuchen bei den Großeltern in Deutschland. Hat in Berlin, New York und Boston zwei Studiengänge mit Bestnoten abgeschlossen. Arbeitet als wissenschaftliche Lektorin für die FU, als Literaturagentin und Babysitterin, um fern ihrer Heimat ein unabhängiges, selbstbestimmtes Leben zu führen. Und schreibt quasi nebenbei ihren ersten Roman – sowie Hunderte charismatischer E-Mails an einen Kerl aus Bayern, der ihr keinesfalls das Wasser reichen kann.
Wo es sich besser küsst
Ich ertappe mich bei der Wunschvorstellung, Saskya wiederzusehen. E-Mails reichen mir nicht mehr. Ich frage mich, ob es Saskya ähnlich ergeht. Bisher haben wir kein einziges Mal telefoniert – oder diese Möglichkeit erwähnt. Nicht, weil wir zu scheu sind. Eher, weil wir Autoren sind. Was wir in unsere Zeilen und dazwischen stecken, würde ein Ferngespräch niemals zulassen. Wir führen eine Briefbeziehung wie in einem Jane-Austen-Roman des 21. Jahrhunderts: Ohne uns zu hören oder zu sehen, kommen wir uns über Monate hinweg näher.
Nur auf eine Art. Wir haben noch nicht einmal Händchen gehalten, sind aber gemeinsam unsere Lebenswege abgeschritten und wissen intimste Geheimnisse voneinander. Was alles Körperliche betrifft, Küsse, Gerüche und so weiter, können wir nur hoffen. Das gruselige Glucksen meiner Wohnungsnachbarin beim Sex füttert meine Fantasie mit unangenehmen Szenarien.
Ein Wiedersehen muss her! Dank einer Einladung an die Columbia University werde ich bald New York besuchen. Ich schlage Saskya vor, ein paar Tage dranzuhängen. Sie erwidert: Warum nicht gleich drei Wochen bleiben? Also packe ich meine Sachen und suche meine Eltern auf, um ihnen mitzuteilen, warum ich so lang verreise.
Als ich Saskyas Heimat erwähne, fällt mir meine Mutter ins Wort: »Indische Männer sind die schönsten Männer überhaupt!«
Auf dem Flug betäube ich meine anwachsende Nervosität mit Cognac. Wir sind für den Abend verabredet. Saskya soll mich in Harlem abholen, dort hat mich die Universität in einem Hotel untergebracht. Aber was, wenn dieses Treffen in einem Fiasko endet? Dann muss ich zwanzig Tage in New York ohne Hotel überleben. Es ist ja eigentlich kein Wiedersehen, eher ein Neusehen – wir werden uns diesmal auf eine Weise sehen, wie wir uns bei den ersten beiden Treffen nicht gesehen haben. Hoffentlich wird Saskya nicht sofort auffallen, wie wenig ich über Indien weiß. In den E-Mails war es ein Leichtes, mein Unwissen zu verbergen. Ich weiß so wenig, ich kenne gerade einmal Klischees: mehr Farben als in einem Regenbogen, Gandhi (das lächelnde Antlitz von Ben Kingsley), Elefanten, die East India Trading Company, die Affenhirnszene im zweiten ›Indiana Jones‹-Film, das Taj Mahal (von dem ich glaube, es sei Hindu-Architektur). Ich nehme mir vor, nichts davon Saskya gegenüber zu erwähnen. Sie soll mich nicht für einen dieser weißen Jungs halten, deren Ignoranz sie bisher davon abgehalten hat, dem größeren Teil des Erdballs Aufmerksamkeit zu schenken. Auch wenn ich genau so einer bin.
Was ich nicht ahne: Inzwischen hat Kathleen Anderson, Saskyas Chefin, von unserem amourösen Verhältnis Wind bekommen. Doch anstatt Einspruch zu erheben, nahm Kathleen Saskya beiseite. Kathleen ist eine blond gefärbte, stämmige Frau in ihren späten Fünfzigern, mit glasklaren blauen Augen und einer herzlichen, enthusiastischen Aura, die mitunter ins Hysterische kippt. Eine Umarmung von ihr ist gleichzeitig eine Drohung, dass sie nie mehr loslassen wird. Ihre Agentur befindet sich in ihrer Wohnung unweit vom Union Square. Dort haust sie mit einem haarenden Golden Retriever, den sie besser behandelt als ihre Assistenten, die im Monatstakt wechseln. Sie trägt vorzugsweise Cowboystiefel und neigt zu Superlativen. »You’re going to be a star!«, schreibt sie mir einmal. Ich bin erstaunt, dass es noch Menschen gibt, die solche Sätze verwenden. Schließlich wissen wir beide, dass ich nie ein »Star« sein werde. Dafür ist es schon zu spät. Ich bin ja ein Autor.
Kathleens Rat an Saskya lautet, sie soll sich daran erinnern, wie Kate Prince William geangelt hat: mit einem durchsichtigen Kleid.
Als Saskya mich in der Hotellobby abholt, trägt sie kein durchsichtiges Kleid. Ihres verbirgt und enthüllt genau die richtigen Stellen. Wir lachen nervös, umarmen uns, eilen nach draußen. Ich ergreife ihre Hand. Das fühlt sich fremd und schön und beängstigend an. Später am Abend, nach dem Dinner, spazieren wir in Richtung Hudson River. Wir harren eines stimmungsvollen Ortes am Wasser. Von diesem schneidet uns jedoch ein Highway ab. Trotzdem küssen wir uns dort zum ersten Mal. Seitdem kann ich Highways nur empfehlen. Es küsst sich dort so viel besser.
Wir essen Soup Dumplings bei Joe’s Shanghai, Chicken & Waffles bei Pies ’n’ Thighs, Octopus Balls bei Otafuku und Banh Mi Sandwiches im Saigon Shack. So wunderbar das schmeckt, wir könnten auch täglich Zwieback verdrücken. In Saskyas Gegenwart mundet alles. Wir tanzen im Le Poisson Rouge, wo ich Saskya die eigenwilligen Bewegungskünste eines ungelenken Hünen demonstriere und sie mich trotzdem nicht auslacht. Wir treffen Nassia und Sheida und Lilly, Saskyas New Yorker Gang glanzvoller, witziger und angenehm verrückter Frauen, die mich mit Ironie herausfordern, ehe sie Saskya ihre Zustimmung geben. Wir fahren mit dem Bus nach Montauk, wo wir in einem klammen Motel einchecken, überteuerten Hummer bestellen, eine Flasche Maker’s Mark nachts am Strand leeren, unsere Hotelschlüssel im Sand verlieren und am Tag darauf wiederfinden. Wir schlafen in Saskyas WG-Zimmer in Bushwick auf einer Matratze am Boden vor einem Fenster, das sich nicht ganz schließen lässt. Jedes Mal, wenn draußen einer der Stadtbusse mit gewaltigem Zischen hält, werde ich aus dem Schlaf gerissen. Aber obwohl ich einen leichten Schlaf habe, macht mir das überhaupt nichts aus. Ich bin glücklich. Und dieses Glück lässt mich so gut schlafen wie noch nie.
2Mein erstes Mal
Der feine Unterschied zwischen Writer und Author
Indien beginnt
Guten Morgen, Delhi
Ein Spaziergang durch die Zukunft
Hochzeiten
Die Unmöglichkeit eines Mädchens
Das Schimmern der Erleichterung
Meistens alles sehr schnell
Der feine Unterschied zwischen Writer und Author
Nach New York wollen Saskya und ich uns bald wiedersehen. In Indien.
Dem steht nichts im Wege, bis auf das Visum. Die erste indische Erfahrung mache ich noch auf deutschem Boden. Bei Cox & Kings, der Agentur für Indienvisa mit dem Namen, der an einen mittelalterlichen Pornofilm erinnert, fülle ich brav das Antragsformular für ein Touristenvisum aus und gebe an, ich sei ein »Writer«. Die Dame am Schalter will wissen, was für eine Art Writer. Ich erwähne meine Prosa und Drehbücher. Ihr Fazit: »So you work in the media?« Ich hätte nicht nicken sollen. Sie fordert eine Bestätigung meines Arbeitgebers, dass ich in Indien keine journalistischen Aktivitäten unternehmen werde. Ich lasse mich gar nicht erst auf die Diskussion ein, dass ich als freischaffender Autor keinen richtigen Arbeitgeber habe. Stattdessen wende ich mich an Günther, meinen stets hilfsbereiten Lektor, und schicke der Dame ein entsprechendes Schreiben.
Daraufhin erhalte ich eine E-Mail: »Congratulations! You can now apply for a journalist visa!« Ich bin nicht so glücklich über die Botschaft wie die Ausrufezeichen nahelegen. Mit einem Journalistenvisum einzureisen, würde mich lebenslang als Journalist brandmarken. Das bedeutet nicht nur höhere Gebühren, sondern auch einen umständlichen Anmeldeprozess bei jeder Einreise. Ich suche die Dame auf und insistiere, kein Journalist zu sein. »Either you come as a journalist«, erwidert sie, »or you don’t come.« Ich bin verzweifelt, rufe Saskya an. Sie verspricht mir, die Sache auf indische Weise zu regeln. Dank einem Kontakt ihrer Familie kann ich einen Termin mit dem Kulturattaché der indischen Botschaft vereinbaren.
Professor H. S. Shiva Prakash ist ein massiger Mann mit lustigen Augen und schütterem Haar. Er besitzt die Ausstrahlung eines freundlichen Walrosses. Von seinem Büro in der Botschaft hat er einen weiten Blick über den Tiergarten. Bei der Begrüßung teilt er mir mit, eigentlich sei er kein Diplomat, vielmehr Akademiker – vor allem aber Lyriker und Dramatiker. Ein in seinem Heimatstaat Karnataka durchaus geachteter Dichter, wie ich später erfahre. Aufmerksam hört er mir zu, als ich meinen Fall schildere. Er lacht auf und meint: »Sie wollen dir also eine neue Identität geben?! Das ist ja wie in einem Roman von Kafka!« In meiner Anwesenheit führt er ein paar Telefongespräche auf Hindi und empfiehlt mir dann, Mister G. von Cox & Kings aufzusuchen. Was ich umgehend tue. Im Büro von Mister G. sitze ich flankiert von einem großflächigen Bild des Taj Mahals auf der einen Seite und des Kölner Doms auf der anderen. Mister G. telefoniert wie wild. Schließlich setzt er ein Siegerlächeln auf. Er verkündet mir, die Sache sei geregelt. Ich könne nun als Tourist nach Indien. Das Missverständnis beruhe auf meiner falschen Angabe. Nächstes Mal solle ich nicht »Writer« ankreuzen, sondern »Author«.
Indien beginnt
Anfang Januar 2012 fängt die Reise an – und Indien bereits in München. Dort muss ich umsteigen. Am Gate des Anschlussflugs herrscht eine undeutsche Atmosphäre. Kein Zeitungsrascheln oder Verlegenheitsräuspern – es finden lautstarke Unterhaltungen statt. Fremde Menschen setzen sich nebeneinander, obwohl sie drei freie Sitzplätze belegen könnten, und beginnen fast augenblicklich eine Konversation. Auch wenn ich kein Wort Hindi verstehe, habe ich den Eindruck, dass die Leute sich bloß locker unterhalten – würden Deutsche in dieser Lautstärke kommunizieren, man müsste von einem Streit ausgehen. Lebendige Gesten sind ein essenzieller Teil des Gesprächs. Handflächen, ausgestreckte Zeigefinger oder das weltberühmte, für Ausländer missverständliche Kopfschütteln, das eigentlich gar kein Kopfschütteln ist, vielmehr eine Geste der Aufmerksamkeit, ein Kopfnicken.
Nach dem Aufruf zum Boarding setzen sich alle in Bewegung. Ein deutsches Paar drängelt sich auf klassische Weise vor: Zaghaft schieben sie sich vor mich, als könnten sie nichts dagegen tun und hätten mich übersehen. Die südasiatische Anstehvariante ist direkter: Jeder bahnt sich seinen eigenen Weg. Berührungsängste kennt dabei kaum einer. Ein Mann positioniert sich so nah hinter mir, dass sein Potbelly – die indische Version des Bierbauchs – meinen Rücken wie ein Heizkissen wärmt. Jedes Mal, wenn ich zurückweiche, rückt er nach, als hätte ich ihn aufgefordert, mir zu folgen. Wir tanzen uns tiefer in die Traube von Menschen. Die Deutschen vor mir werden fortgespült. Von hinten und links und rechts wird geschoben. Aber alle schieben mehr oder weniger gleich viel. Ich gebe mich dem Strom hin. So werde ich von ihm ins Flugzeug befördert.