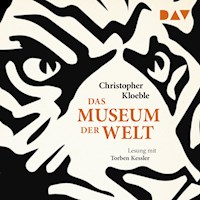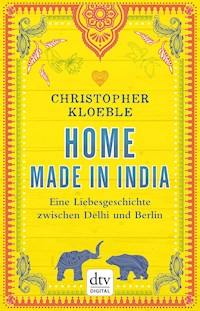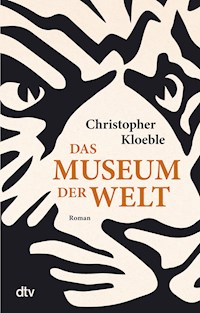
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein indischer Waisenjunge auf der Reise seines Lebens Bartholomäus ist ein Waisenjunge aus Bombay, mindestens zwölf Jahre alt und er spricht fast ebenso viele Sprachen. Daher engagieren ihn die deutschen Brüder Schlagintweit, die 1854 mit Unterstützung Humboldts zur größten Forschungsexpedition ihrer Zeit aufbrechen, als Übersetzer für ihre Reise durch Indien und den Himalaya. Bartholomäus folgt ihnen fasziniert, aber misstrauisch: Warum vermessen ausgerechnet drei Deutsche das Land, sammeln unzählige Objekte, wagen sich ins unbekannte Hochgebirge, riskieren ihr Leben? Es ist doch seine Heimat – und er will der Mann werden, der das erste Museum Indiens gründet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 601
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über das Buch
Bartholomäus ist ein Waisenjunge aus Bombay, er ist mindestens zwölf Jahre alt und spricht fast ebenso viele Sprachen. Als Übersetzer für die deutschen Brüder Schlagintweit, die 1854 mit Unterstützung Alexander von Humboldts zur größten Forschungsexpedition ihrer Zeit aufbrechen, durchquert er Indien und den Himalaya. Bartholomäus sehnt sich danach, das erste Museum Indiens zu gründen. Dafür sammelt er die bemerkenswertesten und gefährlichsten Objekte des Kontinents, und selbst Unsichtbares wie Gefühle, Träume oder Erinnerungen. So entsteht ein Museum der Welt, seiner Welt. Was Bartholomäus nicht ahnt: Je tiefer er mit den Schlagintweits in den Kontinent vordringt, desto mehr verstricken sie sich ins »Great Game«, das verhängnisvolle Spiel zwischen den Mächten aus England, Russland und China, die um die Vorherrschaft in Zentralasien kämpfen.
Für meinen Vater
»Unter all den Dingen, zu denen ich mitgewirkt, ist Ihre Expedition nun eine der wichtigsten geblieben. Es wird mich dieselbe noch im Sterben erfreuen.«
Alexander von Humboldt,Brief an die Brüder Schlagintweit
»Die Aufgabe lautet nämlich, den Spuren der Brüder Schlagintweit […] und so vieler andern berühmten Reisenden nachzuziehen.«
Jules Verne,Les Enfants du Capitaine Grant
»Ich wünschte, die Schlagintweits wären nie nach Indien gekommen.«
Bartholomäus aus Bombay
Von 1854 bis 1857, am Ende der Kleinen Eiszeit und kurz vor Ausbruch des ersten indischen Unabhängigkeitskrieges, reisten die bayerischen Brüder Hermann, Adolph und Robert Schlagintweit durch Indien und Hochasien. Dank der einflussreichen Unterstützung Alexander von Humboldts und im Auftrag der britischen East India Company, die über weite Teile des Subkontinents wie eine Staatsmacht herrschte, nahmen die drei Wissenschaftler eine breite Palette an Untersuchungen vor. Nur zwei von ihnen kehrten nach Deutschland zurück. Es war eine der teuersten und aufwendigsten Expeditionen der Neuzeit. Die Brüder stellten einen neuen Höhenrekord auf, drangen in unerforschte Gebiete vor, betrieben Spionage, sammelten fast 40 000 Objekte und gewannen, wie sie selbst nicht scheu waren zu betonen, bemerkenswerte Erkenntnisse in vielen Wissenschaftsbereichen.
Das wäre ihnen niemals ohne die Hilfe ihrer zahlreichen Begleiter gelungen.
Einer von ihnen war ein Waisenjunge aus Bombay.
I
Bombay, 1854
BEMERKENSWERTES OBJEKT NO. 1
Das Museum der Welt
Mein Name ist Bartholomäus, ich bin mindestens zwölf Jahre alt und heute, am 20. Oktober 1854, habe ich das erste Museum Indiens gegründet. Ich nenne es das Museum der Welt. Smitaben sagt, es sollte vielmehr das Museum der Armseligkeit heißen. Aber was weiß eine Köchin aus dem fernen Gujarat schon von solchen Dingen. Ich will nichts Schlechtes über sie schreiben (auch wenn sie nicht lesen kann), doch überrascht sie mich immer wieder damit, wie wenig sie versteht, und zwar in mehr als einer Hinsicht. Nach mehr als zehn Jahren in Bombay spricht sie kaum ein Wort Marathi oder Hindi. Ohne meine Hilfe wüsste niemand im Glashaus, welche Speisen sie uns auftischt, und Smitaben könnte dem Sabzi-Wallah unmöglich mitteilen, welches Gemüse sie benötigt. Wenn er in den frühen Morgenstunden mit seinem Karren vor dem Tor hält, ist sie längst wach und putzt eines der vielen Fenster, denen Sankt Helena seinen Beinamen verdankt. Smitaben steht von uns allen immer als Erste auf, ich bin nicht einmal sicher, ob sie überhaupt schläft. Abends, wenn das Licht im Schlafsaal gelöscht wird, hören wir sie noch unten in der Küche, wie sie Töpfe schrubbt und Schaben jagt. Sie hat keine Familie, jedenfalls keine leibliche. Alle Waisen nennen sie Maasi, auch wenn sie von niemandem die richtige Tante ist. Ihr Haar ist weiß, nicht grau wie das anderer Maasis, sondern so weiß wie der Teig des portugiesischen Brotes, das sie uns manchmal backt. Mit dem Geschmacksinn kennt sich Smitaben aus. Ihr salzig-süßes Handvo ziehe ich fast allen, nein, allen Speisen Bombays vor. Leider sind ihre anderen Sinne weniger entwickelt. Sie hat so viel Lebenszeit damit verbracht, Gewöhnliches zu sehen, dass alles Bemerkenswerte für sie unsichtbar ist. Wie einfältig von mir, das nicht zu bedenken! Smitaben reagierte auf das erste Museum Indiens entsprechend ihrer bäuerlichen Natur: Sie gab mir einen Klaps auf den Hinterkopf, der aber nicht wehtat, und verschwand wieder in ihrem Territorium, der Küche.
Ich machte mich auf nach draußen, um das Museum Devinder zu zeigen. Devinder ist unser Gärtner. Er stammt aus dem Punjab. Obwohl er kein Sikh ist, lässt er sein Haar wachsen. Überall, hat er mir einmal zugeflüstert. Er behauptet, sich die Haare zu schneiden oder gar zu rasieren, wie etwa Vater Fuchs, entbehre jeglicher Männlichkeit. Ich behaupte, Devinder ist zu faul und auch zu arm, um einen Barber aufzusuchen. Ersteres lässt sich eindeutig am Zustand der Pflanzen rund ums Glashaus ablesen: Die Palmen beugen sich, als würden sie sich vor der Sonne verneigen, der Rasen ist in die Erde zurückgekrochen und die Blüten von Mogra verwelken, bevor sie richtig aufgegangen sind. Vater Fuchs bringt es dennoch nicht übers Herz, Devinder zu entlassen. Daher weiß ich, dass Devinder arm ist. Denn Vater Fuchs behandelt alle, die er als arm betrachtet, viel zu freundlich. Er muss einer der freundlichsten Menschen in ganz Bombay sein.
Aber ich wollte von Devinder erzählen. Auch ohne Vater Fuchs wüsste ich, dass Devinder arm ist. Alle Menschen, die ich kenne, sind arm. Wir besitzen nicht mehr als unsere Kleidung und Hoffnung. Darauf, dass wir eines Tages vielleicht nicht reich, aber zumindest weniger arm sein werden. Es gibt nämlich nur ein reich und viele Formen von arm. Das Problem ist, gerade Hoffnung kann ein dämonischer Besitz sein. Devinder ist geradezu von ihr besessen. Was niemanden erstaunen wird, lebt er doch mit seiner Großmutter und seinen Eltern und seiner Frau und ihren Eltern und seinen Kindern in einem Chawl in Blacktown. Dort teilen sie ein Zimmer. Auf ein und derselben Matte schlafen sie, essen sie und werden mehr. Devinders Familie stirbt viel langsamer als sie wächst. An einem langen, rostigen Nagel in der Wand des Zimmers hängt ein Stuhl. Dieser Stuhl wird nur heruntergeholt, wenn sie Besuch haben. Besuch von respektablen Gästen wie Vater Fuchs. Vor einigen Jahren hat Devinder den Stuhl in einer Bucht gefunden und vor dem Salzwasser gerettet. Die Parsis, Banias, Portugiesen und natürlich die Vickys* können es sich leisten, Eigentum ins Meer zu werfen. Sie besitzen weitaus mehr Möbelstücke als Familienmitglieder.
Wahrscheinlich ist Devinder gar nicht faul, eher müde. Es kostet ihn Kraft, die Hoffnung am Leben zu halten. Das macht er am liebsten hinter dem Gartenschuppen, im Schatten eines Feigenbaumes. Buddha hat unter einem solchen Weisheit erlangt, Devinder dagegen flößt sich Hoffnung ein. Er tut das wie die meisten von uns, indem er schläft. Vor allem in den Mittagsstunden, wenn die dicke Luft Bombays den Schweiß aus den Menschen presst wie Smitaben den Saft aus einer reifen Imli.
Die Gegenstände meines Museums waren beim Transport in den Garten verrutscht. Bevor ich Devinder weckte, musste ich sie neu hinrichten. Dann stupste ich ihn mit dem Fuß.
Devinder bat mich, ihn weiterschlafen zu lassen.
Ich versprach ihm, so etwas wie mein Museum habe er noch nie gesehen.
Damit ließ er sich locken. Anders als Smitaben ist Devinder noch hungrig auf Bemerkenswertes. Er rieb sich die Augen.
Vorsichtig stellte ich das Museum neben ihm ab. Devinder blinzelte einige Male, betrachtete es, dann mich, dann wieder es und schließlich erneut mich.
Ich fragte ihn, was er sehe.
Eine alte Holzkiste, sagte er.
Eine Ausstellungsfläche, sagte ich und fragte ihn, was er darin sehe.
Unrat, sagte er.
Meine Sammlung, sagte ich.
Du sammelst Unrat?, fragte er mich.
Ich wollte nicht gleich aufgeben.
Meine Sammlung ist eine holistische, sagte ich.
Seine Miene war ausdruckslos.
Ich sagte: Holistisch bedeutet das Ganze betreffend. Es baut auf der Idee, dass alles mit allem zusammenhängt. Jedes Objekt, wie wertlos es auch erscheinen mag, ist auf seine Art bemerkenswert und kann uns helfen, die Welt zu verstehen.
Selbst ein Stein?
Besonders ein Stein.
Jetzt lächelte er durch seinen dichten Bart.
Damit stehe ich in der Tradition von Humboldt, sagte ich.
Er wollte wissen, was ein Humboldt ist.
Der größte Wissenschaftler unserer Zeit!
Der größte Wissenschaftler unserer Zeit sammelt Unrat?
Das war mir dann allerdings doch zu viel, ich nahm mein Museum und ging.
Ich hatte noch etwas nicht bedacht: Um etwas Bemerkenswertes zu erkennen, braucht es nicht nur Hunger, sondern eine gewisse Schärfe im Blick.
Ich trug das Museum zum Papierzimmer. Die Wände, Böden, Regale und der Schreibtisch dort sind von so vielen Lagen Schriftrollen und Depeschen und Briefen überzogen, dass man meinen könnte, der Raum sei aus Papier gebaut. In ihm hält sich meist der Herr der Existenz auf. Das ist die Bedeutung von Hormazds Namen, die er niemandem vorenthält. Sie ist auch zutreffend, denn er ist für die Finanzen vom Glashaus verantwortlich. Im Gegensatz zu Smitaben oder Devinder kann Hormazd lesen und schreiben. Als Parsi wurde er schon im Mutterleib mit Zahlen und Buchstaben gefüttert. An guten Tagen liest mir Hormazd aus der Bombay Times vor, was in der Welt geschieht. An schlechten Tagen trinkt er zu viel Pale Ale und verbringt die Nacht im Papierzimmer, weil er eine, wie er stets sagt, elaborierte Debatte mit seiner Frau hatte. Nach solchen elaborierten Debatten hat er oftmals ein blaues Auge und trägt sein Topi schief auf dem Kopf. Smitaben hat mir erzählt, um welches Thema diese Debatten kreisen. Obwohl Hormazd die am wenigsten arme Person ist, die ich kenne (er lebt im Fort und nicht in Blacktown), fehlt es ihm doch wesentlich an einem: Nachkommen. Hormazd und seine Frau missen, was Devinder im Überschuss hat. Woran das liegt? An Hormazd, sagt seine Frau. An seiner Frau, sagt Hormazd. An seinem falschen Glauben, sagen Devinder und Smitaben. Die beiden teilen selten eine Meinung, aber in einem sind sie sich einig: Hormazd hätte längst Kinder gezeugt, wenn er als Hindu auf die Welt gekommen wäre. Ich sage, Hormazds Lösung befindet sich doch direkt vor ihm. Er arbeitet schließlich in einem Waisenheim. Auf diese Idee sind auch schon andere gekommen. Einige Kinder sind ausnehmend freundlich zu ihm, bringen ihm eine Chiku, stellen ihm Fragen zum Zoroastrismus, als würden sie sich dafür interessieren. Sie verstehen nicht, dass er niemals einen von uns adoptieren wird. Ein Parsi nimmt nur Parsis in seine Familie auf (falls es Parsi-Waisenkinder gibt; ich bin noch nie einem begegnet). Ein Hindu, Moslem oder Christ würde nicht anders handeln. Darin liegt das Problem von Indien, sagt Vater Fuchs, Tausende unterschiedliche Bausteine wollen nicht für dasselbe Gebäude verwendet werden. Dabei könnten sie gemeinsam einen Palast erschaffen!
Als ich die Tür zum Papierzimmer öffnete, entstand ein Luftzug und die vielen losen Seiten raschelten. So, stelle ich mir vor, muss der Herbst in Vater Fuchs’ Heimat klingen. Eine Jahreszeit, die es bei uns nicht gibt. Wir haben immer Sommer. In Bombay wechselt der Hochsommer mit dem Monsun in einen Sommer, in dem es von unten und von oben regnet, bevor sich der Sommer gegen Jahresende ein wenig zurücknimmt, nur um bald darauf wieder mit aller Kraft zu brennen.
Im Papierzimmer ballte sich heiße Luft. Vor dem geöffneten Fenster hingen Tücher. Sie waren steif und trocken, Hormazd hatte sie lange nicht mehr in Wasser getaucht.
Ich stellte das Museum neben dem Schreibtisch ab, an dem er saß. Seine rot unterlaufenen Augen waren geöffnet, aber ich musste auch ihn wecken. Wenn er kalkuliert, verstopfen die Zahlen seinen Kopf.
Ich tippte ihm auf die Schulter.
Nicht jetzt, sagte er.
Aber das sagt er immer, es bedeutet: Gib dir mehr Mühe, damit ich weiß, dass du meine Zeit wert bist.
Hormazd Sir?
Hormazd Sir ist beschäftigt, sagte er.
Sein Atem roch nach Pale Ale, allerdings lallte er nicht und sein Blick war klar.
Sie sind doch ein gebildeter Mensch?, fragte ich.
Hormazd grunzte und legte die Zahlenkolonnen beiseite.
Der einzige gebildete Mensch weit und breit, sagte er. Was willst du?
Ich habe das erste Museum Indiens gegründet.
Hast du das?
Es heißt das Museum der Welt.
Und wo befindet sich dieses Museum mit dem bescheidenen Namen?
Ich zeigte es ihm.
Hormazd musterte es ausführlich.
Nach einer Weile sagte er: Das ganze Museum bist du. Es ist ein Bild, ohne ein Bild zu sein.
Ich nickte.
Aber, sagte er, warum sollte das auch nur einen Menschen interessieren?
Das British Museum, sagte ich.
Hormazd hob müde eine Augenbraue.
Das British Museum ist ein Museum in London, sagte ich.
Das weiß ich, sagte er ungeduldig.
Vater Fuchs war schon einmal dort, sagte ich.
Hormazd verdrehte die Augen. Natürlich, Vater Fuchs. Was hat er dir nun wieder für Ideen in den Kopf gesetzt! Hast du denn keine Freunde?
Ich habe Vater Fuchs.
Das ist nicht dasselbe.
Nein, es ist besser! Vater Fuchs sagt, das British Museum ist ein Tempel. Und er sagt, die Vickys …
Vickys?, fragte er.
Die Viktorianer.
Du meinst Engländer?
Ja, die Vickys eben. Ihr Tempel erinnert sie daran, wer sie sind: Ein Volk, das den halben Globus beherrscht!
Ich glaube, das wissen sie auch ohne Tempel.
Vielleicht. Aber wir in Indien, wir brauchen einen.
Davon haben wir bereits viel zu viele.
Aber so einer fehlt uns! Wir wissen nicht, wer wir sind. Darum lassen wir uns von den Vickys sagen, wer wir sein sollen.
Sagt Vater Fuchs, sagte Hormazd.
Ja! Wenn wir frei sein wollen, müssen wir uns daran erinnern, wer wir sind. Wir brauchen alle ein Museum. Und das hier, ich deutete auf das Museum, das hier bin ich.
Nun presste Hormazd die Lippen aufeinander, nickte kurz, beugte sich wieder über seine Tabelle und suchte mit beiden Zeigefingern einen Weg durch das Zahlenlabyrinth.
Gefällt es Ihnen?, fragte ich.
Die Zeigefinger stoppten. Noch einmal wendete er sich mir zu.
Bartholomäus, wenn ich dir einen Rat geben darf: Du wirst niemals frei sein. Du bist eine Waise. Schlimmer noch, eine ambitionierte Waise! Wenn du nicht aufpasst, wird dein Leben eine Reihe von Enttäuschungen sein. Einer wie du gründet keine Museen. Einer wie du muss dankbar sein, wenn er nicht als Kind krepiert.
Ich nahm das Museum, dankte ihm für den Rat, der fast physisch wehtat, und machte mich auf den Weg zur Kapelle, um dort auf den Mann zu warten, der mir immer die besten Ideen in den Kopf setzt. Tagsüber hält Vater Fuchs sich meist in Blacktown auf. Trotz der Hitze, in der selbst die Fliegen nicht den Schatten verlassen, wandert er von Chawl zu Chawl und bietet den Bewohnern seine Hilfe an. Er ist ein großer Bewunderer von Hildegard von Bingen und sein Wissen in Kräuterheilkunde gilt als unübertroffen. Nur kann er es in Bombay kaum anwenden. Dazu fehlen ihm die Kräuter. Aber er interessiert sich für unsere Heilmethoden. Dafür wird ihm viel Respekt entgegengebracht. Die meisten Firengi, vor allem die Vickys, halten sich von Bazars fern. Sie glauben, indem sie ihre Diener schicken, können sie sich vor dem neutralsten Richter auf allen sieben Inseln schützen: Cholera. (Als würden Diener ihnen nur Einkäufe vom Bazar mitbringen!) Vater Fuchs dagegen empfindet große Freude, wenn er auf seinen Erkundungen in Blacktown ein Öl entdeckt, das Zahnfäule stoppt, oder ein Pulver, das die Verdauung fördert. Ich denke, Vater Fuchs wäre ein ausgezeichneter Forscher geworden. Wenn Gott ihn nicht vor der Wissenschaft entdeckt hätte.
Auf dem Korridor kamen mir die Anderen entgegen. Im Glashaus leben siebenundvierzig Waisen und ich kenne jeden einzelnen beim Namen, aber die Anderen als Bezeichnung für sie ist völlig ausreichend.
Wir kommen aus allen Himmelsrichtungen des Landes. Man sollte annehmen, dass wir uns deutlich voneinander unterscheiden. Aber ich habe gelernt, dass eine Waise oft wie jede andere Waise ist. Etwa reden sie alle nur mit mir, wenn es sein muss. Also im Prinzip nie. Mit der Ausnahme von Abenden, an denen wir Cricket spielen und sie mich anbrüllen. Sobald die Hitze sich ein wenig zurückzieht, es aber noch hell genug ist, um den Ball zu erkennen, finden wir uns auf der Esplanade zusammen und bilden zwei Gruppen. Ich werde immer als vorvorletztes Teammitglied gewählt. Nur der blinde Aloisius und der Linkshänder Francis, dem ausgerechnet sein linker Arm fehlt, sind noch weniger gefragt. Viel besser als diese beiden bin ich auch nicht.
Eigentlich sollte meine Flinkheit meine Unfähigkeit als Batsman ausgleichen. Nur gehorcht mir mein Körper in solchen Situationen nicht. Wenn ich antreten soll, weigern sich meine Beine, mich aufs Feld zu tragen, mein Kopf rastet ein und meine Arme hängen nutzlos von den Schultern. Am Ende verliert immer das Team, für das ich streite.
Allein die Mutprobe ist noch qualvoller!
In Bori Bunder befindet sich seit April die erste Bahnstation in ganz Asien. Die Vickys haben sie gebaut, für den Transport ihrer Waren und aufgeplusterten Gemüter. Die Mutprobe besteht darin, zwischen den Rädern und über die Gleise zu kriechen, sobald der Zug sich in Bewegung setzt. Selbst Francis ist das bereits gelungen (den Arm hat er vor seiner Zeit bei uns verloren). Ich kann das nicht. Jedes Mal, wenn ich mich den polternden, quietschenden, mit einem tiefen Basston summenden Riesen stelle, fährt alle Kraft aus mir und ich kann mich nicht rühren, weil ich weiß, was passieren wird, wenn ich mich rühre. Ich sehe es deutlich vor mir. Und ich sehe es nicht nur. In solchen Momenten spüre ich förmlich die Eisenräder durch meinen Leib schneiden wie durch Ghee.
Die Anderen nennen mich Bartholo-Maus, spucken in mein Dal oder träufeln mir, während ich schlafe, Zwiebelsaft in die Augen. Wenn ich will, dass sie mich in Ruhe lassen, muss ich ungesehen bleiben. Ich mache mich noch kleiner als ich bin, sitze im Unterricht in der letzten Reihe, belege im Schlafsaal das Bett unter der Dachschräge, an dem Fenster mit dem blitzartigen Riss, und vermeide es generell, sie anzusehen.
Lange Zeit wusste ich nicht, warum die Anderen so sind. Ich suchte in meinem Spiegelbild nach Antworten. Das war gar nicht so einfach. Auf die trüben Pfützen Bombays ist kein Verlass, sie zeichnen mich mal runder als Smitaben und mal mager wie ein Straßenkind aus Blacktown. Und das Meer gibt sich wenig Mühe, es skizziert bloß eine schattenhafte Wolke.
Der einzige Spiegel, der die Wahrheit sagt, befindet sich in Vater Fuchs’ Zimmer. Er zeigt mir den kleinsten mindestens Zwölfjährigen, den ich kenne. Meine Hautfarbe wechselt mit den Jahreszeiten; im brennenden Sommer sehe ich aus wie ein Fischer aus Bandra und im Monsun-Sommer wie ein behüteter Bengali-Sohn, der selten das Haus verlässt. Vater Fuchs sagt, meine Augen sind bernsteinfarben. Ich habe noch nie einen Bernstein gesehen, aber das Licht darin soll ähnlich leuchten wie die Flaschen des Battliwala in der Abendsonne.
Je öfter und genauer ich mich betrachtete, desto klarer wurde mir, was die Anderen stört. Es hat nichts mit meinem Aussehen zu tun. Und doch findet sich die Antwort im Spiegel.
Vater Fuchs.
Als er mich einmal dabei ertappte, wie ich mich musterte, erinnerte er mich an das Schicksal von Narziss.
Darauf erwiderte ich neunmalklug, dass mein Vater gewiss kein Flussgott ist, sonst könnte ich ja schwimmen.
Das meiste, was ich weiß, habe ich von Vater Fuchs gelernt. Sogar meinen Namen hat er mir beigebracht (und gegeben). Vor mir gab es nur zwei Mal einen Bartholomäus in Indien. Der erste hat hier gepredigt. Er war ein Apostel, Jesus nannte ihn den Mann ohne Falschheit. Der zweite, Bartholomäus Ziegenbalg, hat im letzten Jahrhundert in der dänischen Kolonie Tranquebar gelebt. Vor ihm gab es noch nie einen deutschen Missionar in Indien. Er war auch eine Waise und ein bemerkenswerter Mensch. Die meisten Firengi zwingen uns, ihre Sprache zu lernen. Ziegenbalg aber hat seine Zunge Tamil gelehrt! Und er hat Schulen und ein Kinderheim aufgebaut. Ich trage seinen Namen mit Stolz. Auch wenn ich meine Götter seinem Gott vorziehe. Die Christen tun mir leid, dass sie nur einen haben. Das ist eine traurige Familie.
Manche der Missionare schimpfen mit mir, wenn ich solche Gedanken mit ihnen teile. Vater Fuchs nicht. Er sagt, ich werde schon noch den Pfad der Erleuchtung finden. Wir sprechen immer auf Deutsch miteinander. Die Anderen, von denen es keiner so gut wie ich beherrscht, sagen, dass ich deshalb wie ein alter Mann rede. Aber ich will ja auch gar nicht wie ein Kind reden. Nach dem Unterricht, wenn die Anderen nach draußen rennen, als stünde die Schule in Flammen, bleibe ich noch eine Weile und unterhalte mich mit Vater Fuchs. Er schenkt mir viele sonderbare Worte, manchmal sogar welche auf Bairisch. Das spricht man dort, wo Vater Fuchs herkommt. Wenn er von Bayern erzählt, klingt er traurig und froh. Er sagt, seine Heimat ist ein Land ohne Meer und Mangos, und seine Leute sind den Punjabis ähnlich: ehrenvoll und selbstbewusst und herzlich, allerdings mit deutlich weniger Haar gesegnet.
Das beschreibt auch Vater Fuchs ziemlich gut. Noch dazu besitzt er ein Lächeln, das nie aus seinem Gesicht weicht. Ich muss bloß daran denken und schon macht es mir nichts aus, dass ich bei der Mutprobe versteinere. Sein Lächeln ist wie Smitabens Kochkünste. Wenn man zu lange nichts davon bekommt, wird man schwach, müde, traurig, wütend. Vater Fuchs’ Lächeln ist nicht breit und nicht einmal bemerkenswert schön. Aber es ist ein ehrliches Lächeln, es spendet mehr Hoffnung als ein Nickerchen im Schatten des Feigenbaums.
Dieses Lächeln schenkt er mir oft, im Spiegel und auch so.
Den Anderen entgeht das nicht.
Als ich das Papierzimmer verließ und ihnen im Korridor begegnete, drückte ich mich wie ein Gecko gegen die Wand und versuchte, mit ihr zu verschmelzen. Aber das Museum erregte ihre Aufmerksamkeit. Sie bildeten einen Halbkreis um mich.
Ein Anderer fragte, was ich bei mir hätte.
Unrat, sagte ich und wich ihrem Blick aus. Sie durften nicht erfahren, dass ich etwas besaß. Sonst würden sie es mir wegnehmen.
Lügner!, rief ein Anderer.
Noch ein Anderer sagte: Devinder hat erzählt, das soll ein Museum sein, das erste von ganz Indien!
Alle Anderen lachten. Sie nahmen das Museum und zerbrachen die Objekte. Ich konnte sie nicht davon abhalten. Mein Körper gehorchte mir nicht. Nachdem sie das meiste zerstört hatten, schienen sie gelangweilt. Sie wendeten sich ab.
Da sah einer von ihnen, dass ich mich daranmachte, die Reste des Museums wegzutragen. Sie folgten mir nach draußen. Ich lief davon. Eigentlich bin ich schneller als sie. Aber das Museum war zu schwer. Sie holten mich ein, rissen es mir aus den Armen und traten darauf ein. Wieder konnte ich nichts dagegen tun. Ein Anderer brachte eine heiße Kohle, die er dem Istry-Wallah geklaut hatte. Damit zündete er ein paar trockene Champablätter an und warf sie ins Museum. Es begann sofort zu brennen. Die Anderen warteten auf meine Reaktion. Sie sahen mich hungrig an. Ich konzentrierte mich darauf, keine Träne aus meinen Augen zu lassen. Es dauerte nicht lange, bis sie mich allein ließen. Trotzdem löschte ich das Feuer nicht. Ich wusste, die Anderen würden es sofort wieder entfachen. Das Museum der Welt zerfiel vor mir in seine kleinsten Teile. Der Rauch schmeckte scharf.
Als Vater Fuchs zu mir kam, war die Sonne längst untergegangen und die Abendmesse vorüber. Die Anderen hatten sich gewaschen und lagen, gefüllt mit Smitabens Pav Bhaji**, in ihren Betten.
Ich saß noch immer vor der Asche, die kalt und grau war wie alte Vogelkacke.
Vater Fuchs kündigte sich durch sein keuchendes Husten an. Das Husten von Vater Fuchs ist eines der vorzüglichsten Geräusche Bombays. Wenn er hustet, lassen mich die Anderen in Ruhe. Wenn er hustet, kann ich gut einschlafen und schnell aufwachen. Wenn er hustet, weiß ich, dass ich bald wieder ein bisschen mehr wissen werde.
Er blieb neben mir stehen und hielt sein bayerisches Taschentuch vor seinen Mund. Es ist mit roten Rosen bestickt. Ich habe noch nie so vollkommene Rosen gesehen. Die Rosen auf den Bazars in Blacktown gleichen verschrumpelten Korallen. Allein die auf Vater Fuchs’ Taschentuch verwelken nie. Sie blühen sogar frisch von seinem Blut, wenn er hustet. Das ist gut, so kommt alles raus, sagt Vater Fuchs. Aber Smitaben sagt, das kann nicht gut sein, so viel sollte nicht rauskommen.
Er fragte, was passiert sei.
Ich habe ein Museum gegründet, sagte ich, wie wir besprochen haben.
Er wollte wissen, wo.
Ich deutete auf die Asche.
Ein Moment verstrich. Ich war ihm dankbar, dass er nicht fragte, wie dieser Haufen mein Museum sein konnte.
Das ist das erste Museum Indiens, sagte er.
Das war das erste Museum Indiens, sagte ich.
Er bat um eine Führung.
Es ist verbrannt, sagte ich.
Aber nicht in deinem Kopf, richtig? Was in deinem Kopf ist, können sie nicht verbrennen.
Nein, sagte ich, können sie nicht.
Dann mach, dass ich es sehen kann, sagte er und schloss die Augen, führe mich durch dein Museum.
Ich zögerte.
Ich warte, sagte er.
Also begann ich mit dem Handvo.
Es war, sagte ich und Vater Fuchs sagte: Es ist.
Es ist, sagte ich, Glück, das man essen kann; aber wie man dieses aus Ghee, Dal, Masala und Geduld herstellt, das Geheimnis kennt nur eine bäuerliche Maasi aus Gujarat.
Dann war … ist da eine Tiffindose. Aber nicht irgendeine Tiffindose! In ihr wird schon lange keine Mahlzeit mehr aufbewahrt; dieses Exemplar hat ein fauler oder müder Gärtner im Monsun verlegt, sodass sie von einer dicken Rostschicht ummantelt ist und niemals wieder geöffnet werden kann; und doch füttert sie jeden, der sie schüttelt, mit etwas, nämlich mit Hoffnung; denn in ihr klackt und klickt es ganz herrlich.
Dann ist da eine Schriftrolle; dank Bombays Luft ist sie so geschmeidig wie ein Algenblatt; sie riecht nach Pale Ale und die Tintenzahlenfamilie darauf ist verschwommen; wenn man sie aber lange genug betrachtet, kann man fast alles darin erkennen, was man sich wünscht, Kinder, Eltern, Reichtum, ein Museum.
Dann sind da einige kleinere und ganz kleine Gegenstände, die ich von der Straße aufgesammelt habe; sie wurden weggeworfen oder vergessen, wie Waisenkinder; welchem Zweck sie dienen, ist schwer zu bestimmen; aber sie haben ein Recht auf einen Platz im Museum wie alle anderen Objekte.
Dann ist da ein hölzernes Kreuz, das mir geschenkt wurde, als ich vom Glashaus aufgenommen wurde; es erinnert mich jeden Tag daran, wo ich zu Hause bin und von wem ich so viel lerne.
Und dann, dann ist da noch ein leerer Platz; dort würde etwas sein, wenn die Vickys nicht nach Indien gekommen und meine Eltern noch am Leben wären.
Nachdem ich fertig war, rührte Vater Fuchs sich lange nicht, als wäre er ich bei der Mutprobe. Dann öffnete er die Augen und applaudierte. So laut und lang klatschte er in die Hände, dass die Anderen aus dem Fenster sahen und mit ihren Blicken nach mir stachen.
Ich gratuliere, sagte Vater Fuchs, dein ganzes Museum ist ein bemerkenswertes Objekt!
Er lief ins Heim und holte eine Mango, unsere Lieblingsfrucht. Eigentlich ist die Saison schon lange vorüber, aber in Mazagaon, wo die süßesten Mangos des Landes herkommen, hatte Vater Fuchs ein paar letzte auftreiben können. Er schnitt sie mit einem Messer in zwei Hälften, entnahm den Kern und legte ihn fast zärtlich beiseite. Als Nächstes ritzte er ein Gittermuster in das Fruchtfleisch jeder Hälfte, stülpte sie um und reichte mir eine. Gleichzeitig bissen wir rein, schlürften und kauten. Saft lief über mein Kinn. Eine reife Mango schmeckt so gut wie Vater Fuchs’ Husten sich anhört.
Nachdem wir die letzten Reste aus der Schale genagt und unsere Finger abgeleckt hatten, fragte er: Wie heißt das Museum?
Ich sagte es ihm.
Er sah zum Nachthimmel, der Mond war so weiß und rund wie ein frisches Idli.
Eine gute Namenswahl, sagte er, und doch … fehlt da nicht etwas?
Was?, fragte ich.
Vater Fuchs lächelte, wie er lächelt, wenn er mir eine Idee in den Kopf setzt.
Was?, fragte ich noch einmal.
Er schlug mir einen Handel vor: Wenn ich umgehend ins Bett ginge, würde er mir dafür noch vor dem Frühstück den perfekten Namen verraten.
Darüber musste ich nicht lange nachdenken.
Jetzt liege ich im Schlafsaal und wünsche mir den Morgen herbei.
Schreiben hilft. So bewegt sich die Zeit schneller. Vater Fuchs hat mir ein Büchlein geschenkt. Er sagt, das ist der beste Ort für mein Museum. Darin kann ich alles sammeln, was ich möchte, die teuersten und schwersten und gefährlichsten Objekte des Kontinents, und selbst Unsichtbares wie Gefühle, Träume oder Erinnerungen. Wenn ich mich anstrenge, mir wirklich Mühe gebe, sagt Vater Fuchs, kann es sogar ein Museum für alle Indier sein. Die Seiten sind weißer als der Mond heute Nacht, ich werde sie füllen wie ein richtiger Forscher, mit vielen bemerkenswerten Objekten.
No. 1 ist das Museum der Welt.
Draußen auf den Fluren hallt das Echo von Vater Fuchs’ Husten. Ich höre es deutlich, obwohl die Anderen lärmen. Bartholo-Maus, rufen sie immer wieder, Bartholo-Maus!
Aber das schert mich nicht.
Mein Name ist Bartholomäus, ich bin mindestens zwölf Jahre alt und heute, am 20. Oktober 1854, habe ich das erste Museum Indiens gegründet.
*Vater Fuchs sagt, die Engländer benennen alles und jeden in Indien, wie es ihnen beliebt. Also ist es nur gerecht, wenn ich sie auch benenne, wie es mir beliebt.
**Smitaben besteht darauf, dass sie es erfunden hat. Auch wenn es mittlerweile in jeder, wie sie sagt, armseligen Küche in Bombay imitiert wird.
BEMERKENSWERTES OBJEKT NO. 2
Die Bambusrute
Am Morgen nach meinem ersten Eintrag musste ich auch als Erster im Schlafsaal aus dem Bett springen. An anderen Tagen hätte ich versucht, die Nacht mit geschlossenen Augen festzuhalten. Nicht an diesem Tag. Ich spürte mehr und mehr Hoffnung in mir, als würde ich sie einatmen.
Ich schlüpfte in meine Kurta, die nach verkohltem Museum roch, und lief aus dem Schlafsaal.
Vater Holbein, der uns beaufsichtigte, rief meinen Namen. Erst drohend, dann zornig. Er betonte jede Silbe, sodass es sich fast anhörte, als würde er ein Gebetslied anstimmen.
Bar-tho-lo-mä-us!
Dabei hob er seine Bambusrute, die er stets bei sich trägt. Sie ist die Verlängerung seiner Hände. Selbst die stärksten Anderen widersetzen sich ihm nicht. Seine Rute kennt jede empfindliche Stelle an unseren Körpern.
Trotzdem blieb ich nicht stehen.
Ich war mir bewusst, das würde Konsequenzen nach sich ziehen. Fünf Hiebe, mindestens.
Aber das war mir ein perfekter Name wert.
Auf dem Flur vor Vater Fuchs’ Zimmer bremste ich ab, schnappte nach Luft und klopfte an.
Er antwortete nicht.
Ich versuchte es noch einmal. Erst da fiel mir auf: Etwas war anders als sonst. Ich horchte. In der Ferne kündigten zwei Kanonenschüsse das wöchentliche Eintreffen des Postschiffes an; ein Makake fläzte sich auf einem Balken über mir; am Haupteingang stritten der Sabzi-Wallah und Smitaben über faule oder reife Amruts; und Vater Holbein näherte sich in seinen Chappals mit schlurfenden Schritten.
Ein gewöhnlicher Morgen im Glashaus also. Bis auf …
Das Husten. Es fehlte. Hatte Vater Fuchs unseren Handel vergessen und war bereits nach Blacktown aufgebrochen?
Ich schob die Tür zu seinem Zimmer auf.
Er war nicht da. Um sicherzugehen, sah ich sogar im Spiegel nach.
Mit einem Mal war Vater Holbein über mir. Mit Daumen und Zeigefinger packte er die Haut unter meinem Kinn und zog mich hinter sich her. Ich unterdrückte den Schmerz und fragte nach Vater Fuchs. Er schwieg. Was mich nicht wunderte. Vater Holbein spricht vorzugsweise mit seiner Rute.
Im Schlafsaal ließ er los und befahl mir, meine Kurta auszuziehen.
Ich gehorchte.
Auf alle Viere, sagte er. Seine Stimme klang nicht hart, eher anweisend, als wolle er mir helfen.
Mit den Händen suchte ich Halt im Steinboden und achtete darauf, dass meine Knie nicht auf einer spitzen Stelle ruhten. Dann machte ich, wie er wünschte, einen Buckel, damit die Haut an meinem Rücken spannte.
Vater Holbein schlug mich nicht sofort. Zuerst wartete er, bis im Schlafsaal Ruhe eingekehrt war. Aus den Augenwinkeln konnte ich die nackten, schmutzigen Füße der Anderen sehen. Es war mir recht so. Wenigstens musste ich nicht ihre Blicke aushalten.
Der erste Hieb fühlte sich an, als würde er einen Schnitt mit einem scharfen Messer machen. Mit jedem weiteren Hieb drang der Schmerz tiefer in meinen Rücken ein und floss wie kochend heißes Wasser in alle Richtungen. Ich konzentrierte mich darauf, die Hiebe zu zählen. Aber Vater Holbein schlug nicht in einem regelmäßigen Takt. Er komponierte seine Schläge eigenwillig, setzte Pausen, die einige Sekunden oder eine Minute lang andauern konnten. Die Plötzlichkeit des Schmerzes war Teil seiner Bestrafung.
Ich kam mit dem Zählen durcheinander. Jedes Mal, wenn ich dachte, er sei fertig, schlug er erneut zu. Erst als ich aufgab und mit vielen weiteren Hieben rechnete, trat Vater Holbein einen Schritt zurück. Niemand im Schlafsaal rührte sich. Mein Schnaufen war das einzige Geräusch.
Vater Holbein trug mir auf, mich zu waschen, und wendete sich wieder den Anderen zu.
Ich erhob mich langsam. Jede Bewegung war noch ein Hieb. Langsam kehrten die Stimmen der Anderen zurück.
Als ich Wasser über meinen Rücken laufen ließ, kam es rosa bei meinen Füßen an. Vater Fuchs wird die Wunden mit einer Heilsalbe behandeln, dachte ich, ich dachte: sobald er zurück ist, kümmert er sich um mich.
Im Speisesaal bekam ich kein Frühstück. Vater Holbeins Bestrafung war noch nicht zu Ende. Ich musste in der Ecke stehen und den Anderen beim Essen zusehen. Manche von ihnen leckten das Khichri absichtlich langsam von ihren Fingern. Ich atmete den Duft ein und sagte mir, dass ich davon satt werden würde. Mein Rücken brannte, als hätte ich mich in eine von Smitabens großen, heißen Pfannen gelegt.
Vater Fuchs fehlte am Tisch der Erwachsenen.
Nach der Morgenmesse ging ich zu Smitaben und fragte sie nach Vater Fuchs. Sie sah sich erschrocken um und schob mich mit beiden Händen aus der Küche. Die Glöckchen an ihren Füßen bimmelten aufgeregt.
Vater Holbein hatte ihr Instruktionen erteilt. Er wusste, wie gut ich mich mit ihr verstehe, nämlich in einer Sprache, die er nicht ansatzweise beherrscht.
Im Garten hackte Devinder ungewohnt eifrig auf die Erde im Gemüsebeet ein. Schweißtropfen hingen wie glitzernde Steinchen in seinem Bart. Ich fragte ihn, ob er mir etwas über Vater Fuchs’ Verbleib verraten könne. Er tat so, als würde er mich nicht verstehen. Ich versuchte es auf Hindi und Punjabi und mit Zeichensprache: Ich deutete auf das Fenster von Vater Fuchs’ Zimmer. Aber Devinder grub einfach weiter die sandige Erde um.
Die Tür zum Papierzimmer stand offen. Hormazd hatte den Blick zu Boden gerichtet und stakste durchs Zimmer, ähnlich einem Storch. Als er fand, was er suchte, schnappte er zu und das Papier zappelte in seinen Händen wie ein unglücklicher Fisch.
Bevor ich etwas sagen konnte, schüttelte er den Kopf und ahmte mit einer Hand jemanden nach, der mit einer Rute zuschlägt.
Ich verließ das Zimmer.
Auf dem Korridor hörte ich ein Räuspern hinter mir. Es war Hormazd. Er presste den Zeigefinger auf seine rissigen Lippen und hielt mir einen Zettel hin. Darauf stand: Der Herr der Existenz lässt sich nichts von einem HOHLbein sagen. Er reichte mir ein weißes Tuch, das zu einem Beutel geschnürt war. Darin befanden sich Mutton Tikkas. Ich mag Hammelfleisch nicht besonders, aber dieses duftete wie eine köstliche Fleischpflanze. Ich steckte mir ein Stück in den Mund. Es schmeckte buttrig und scharf. Ich schluckte es fast ohne Kauen herunter. Hormazd krümmte seine Lippen. (Im Lächeln ist er nicht sehr geübt.)
Ich beeilte mich, damit ich nicht zu spät zum Unterricht erschien. Vorher wollte ich noch die Tikkas hinter dem Gartenschuppen verschlingen.
Aber dazu kam es nicht. Als ich durch den Eingang rannte, blieb mein Fuß an etwas hängen und ich fiel auf die Treppenstufen. Die Wucht des Aufpralls wurde von meiner Schulter abgefangen, und doch fühlte sich mein Rücken an, als würde etwas in ihm reißen. Ein paar Andere lachten, sie hatten eine Stolperschnur gespannt.
Einer von ihnen fragte, was in dem Beutel sei.
Ein Anderer rief: Ein Museum!
Das fanden sie alle sehr komisch.
Sie nahmen mir den Beutel weg, öffneten ihn und sahen mich an, erstaunt darüber, wie ich an die Tikkas gekommen war, aber bestimmt auch darüber, was für ein Geschenk ich ihnen damit machte.
Zuerst stopften sie sich die Mäuler voll. Dann riefen sie Vater Holbein.
Seitdem sind fünf Tage vergangen. Heute ist der erste Tag, an dem ich mich stark genug fühle, um zu schreiben. Aufstehen kann ich noch immer nicht. Vater Holbein hat diesmal meine Füße und Kniekehlen gewählt.
Morgens und abends wechselt Smitaben die Verbände. Dabei beugt sie sich absichtlich so über mich, dass ich die Wunden nicht sehen kann. Aber ich weiß trotzdem, dass sie da sind. Und wie ich das weiß! Der Schmerz erinnert mich daran. Ich versuche, flach zu atmen und mich wenig zu rühren, damit er klein bleibt. Manchmal, wenn Smitaben zu mir kommt, muss ich weinen, auch wenn ich gar nicht weinen möchte. Sie sieht mich dann an, als würde sie etwas Freundliches sagen wollen.
Aber es ist niemandem erlaubt, mit mir zu reden.
Außerdem hat Vater Holbein eine Kreidelinie um mein Bett gezogen. Diese dürfen allein zwei Personen überqueren: Smitaben und er. Wenn ich ihn frage, wo Vater Fuchs ist, hebt er die Rute. Sie glänzt noch immer, als würde er sie nie verwenden.
Das mag ich an Bambus. Selbst wenn man ihn abschneidet oder entwurzelt oder biegt, lebt er lange und stolz weiter. Will ich herausfinden, was mit Vater Fuchs geschehen ist, muss ich so stark wie Bambus sein.
BEMERKENSWERTES OBJEKT NO. 3
Das bayerische Taschentuch
Heute sind drei weiße Männer ins Waisenheim gekommen. Aber keiner von ihnen war Vater Fuchs. Sie ließen sich von Vater Holbein herumführen. Er zeigte ihnen die Küche und das Papierzimmer, die Schule, den Garten und die Kapelle. Ich bin ihnen heimlich gefolgt. (Seit einigen Tagen kann ich wieder gehen, wobei ich den Kreidestrich eigentlich nur für einen Gang zur Latrine überqueren darf.) Damit Vater Holbein mich nicht bemerkte, hielt ich Abstand. Deshalb konnte ich nicht hören, worüber sie sprachen.
Vater Holbein stellte die Männer auch Smitaben, Devinder und Hormazd vor. Sie redeten aber nur mit Hormazd. Ich vermute, weil er als Einziger Englisch beherrscht. Vater Holbein fuchtelte die ganze Zeit mit seiner Rute herum. Das hielt die Anderen fern. Auch wenn sie sich hinter Hecken und Türen scharten, um die Besucher zu beobachten.
Selbstverständlich war ihre Garderobe außerordentlich hässlich und unnütz; Hosen und Hemden und eine Vielzahl an Knöpfen schnürten ihre Körper ein, sodass kaum Luft an ihre Haut reichen konnte. Ihre Köpfe waren fast so rot wie Smitabens Bindi.
Aber diese Männer boten selbst für Firengi einen ungewöhnlichen Anblick. Vor allem drei Dinge fielen mir auf:
1.Ihre Art zu gehen. Sie machten große Schritte, als müssten sie möglichst schnell möglichst viel Distanz zurücklegen. Ein Bombayite ist da vorsichtiger; er setzt die Füße dicht hintereinander, da er sich bewusst ist, dass ein achtloser Schritt ihn an einen unangenehmen Ort bringen kann. Zudem erinnerten mich die Schritte der Männer an die Schritte, die Devinder macht, wenn er eine Gartenfläche ausmisst.
2.Ihre Gesichter. Sie sahen aus wie drei Versionen desselben Mannes. Der jüngste von ihnen trug einen Hut mit breiter Krempe und hatte abstehende, spitze Ohren wie eine Fledermaus. Er war nicht viel älter als ich. Seinen Blick kann ich nicht anders beschreiben als nach innen gekehrt. Seine etwas reifere Ausführung, der mittlere Mann, ließ den Blick dagegen lustig umherschweifen und blähte seine fetten Backen beim Atmen. Der älteste wiederum kultivierte ein Haarbüschel auf seiner Oberlippe, das wie ein nervöses Tierchen zappelte, wenn er redete. Und er redete viel!
3.Ihre Wirkung auf Vater Holbein. In Anwesenheit der Männer schwang er die Rute durch die Luft als wäre sie kein gefürchtetes Instrument, sondern ein Pinsel, mit dem er lustige Bilder malte. Er stolperte mehrmals in seinen Chappals, weil er beim Gehen auf die Männer achtete und nicht auf den Boden. Und er übte sich in zahlreichen Formen des Lächelns: aufmerksam, erfreut, hoffnungsvoll, lieb. Ich habe nicht gewusst, dass Vater Holbein so lächeln kann.
Als er die Männer in den Schlafsaal führte, war ich bereits vorausgeeilt und lag wieder in meinem Bett. Sie steuerten direkt auf mich zu.
Das ist er?, fragte Haarbüschel.
Vater Holbein nickte.
Er ist sehr klein, sagte Pausbacke.
Fledermaus trat näher und musterte mich.
Sag etwas, verlangte Vater Holbein.
In welcher Sprache?, fragte ich auf Deutsch.
Vater Holbein lachte und richtete die Rute auf mich.
Sehen Sie?, sagte er zu den Männern.
Wie vieler Sprachen bist du mächtig?, fragte Haarbüschel.
Warum wollen Sie das wissen?, fragte ich.
Vater Holbein legte seine Rute auf meine Schulter.
Antworte, sagte er.
Ich beherrsche Hindi und Englisch und Deutsch und Gujarati und Punjabi und Marathi. Mein Persisch lässt zu wünschen übrig. Aber dafür lerne ich derzeit Bairisch.
Bairisch!, platzte es aus Pausbacke.
Wir sind aus Bayern, sagte Haarbüschel.
Kennen Sie Vater Fuchs?, fragte ich.
Wir waren mit ihm in Kontakt.
Wissen Sie, wo er ist?
Nein, sagte er, leider nicht.
Sag etwas auf Bairisch, verlangte Pausbacke.
Ich sagte: Kruzifix.
Haarbüschel schlug die Hände zusammen.
Sehr ordentlich!, rief er.
Fledermaus schmunzelte.
Pausbacke verengte seine Augen.
Ich bin nicht überzeugt, sagte er.
Wir können ihn erproben, sagte Haarbüschel.
Eine ausgezeichnete Idee!, sagte Vater Holbein. Wollen Sie ihn gleich mitnehmen?
Haarbüschel sah seine jüngeren Versionen an. Sie nickten.
Warum nicht, sagte er.
Dann ist es beschlossen, sagte Vater Holbein und deutete mit der Rute auf meine Nasenspitze. Wasch dich und zieh dich an!
Wohin gehen wir?, fragte ich.
Das wirst du früh genug sehen, sagte Pausbacke.
Du solltest froh sein, sagte Vater Holbein, dass du diesen Herren dienen darfst.
Ich bin kein Diener, sagte ich.
Pausbacke wollte etwas erwidern, aber Haarbüschel kam ihm zuvor.
Wer bist du denn?, fragte er.
Ich bin Bartholomäus, sagte ich.
Einer der zwölf Apostel, sagte er.
Ich weiß, sagte ich.
Hermann Schlagintweit, sagte er und reichte mir seine Hand.
Ich schüttelte sie und drückte dabei fest zu, damit er meine Stärke spürte.
Die Hand von Hermann Schlagintweit war rauer als die von Devinder. Ungewöhnlich für einen Firengi. Er deutete erst auf Pausbacke, dann auf Fledermaus.
Das sind Adolph und Robert Schlagintweit, sagte er, meine Brüder. Wir befinden uns auf einer Forschungsreise.
Sie sind Forscher?! Was erforschen Sie?
Hermann, sagte Pausbacken-Adolph, das Essen wartet.
Richtig, sagte Hermann, aber warum begleitest du uns nicht?
Er hat schon gegessen, sagte Vater Holbein und schob die Brüder in Richtung Ausgang.
Ich könnte noch etwas vertragen, sagte ich.
Vater Holbeins Hand spannte sich um seine Rute. Aber Hermann hatte bereits einen Arm um mich gelegt und begann zu reden.
Damit hat er den ganzen Abend über nicht aufgehört. So erfuhr ich, dass die Brüder drei Jahre lang durch Indien sowie Hochasien reisen und in dieser Zeit wissenschaftliche Untersuchungen durchführen wollen. Zunächst werden sie sich jedoch einige Wochen in Bombay aufhalten, um die Stadt zu studieren und ihre Expedition vorzubereiten.
Wir saßen im Speisesaal am Tisch der Erwachsenen, wo niemals zuvor ein Kind gesessen hat. Ich konnte die Anderen nicht sehen, aber ich spürte, dass sie uns beobachteten. Smitaben tischte ausreichend Gerichte für eine komplette Schiffsbesatzung auf. Ich stopfte mich mit Handvo voll, während Hermann uns mit Wörtern vollstopfte. Es war, als müsste er all die Wörter verbrauchen, die Robert sparte. Der schwieg weiterhin. (Vielleicht besitzt er keine Stimme.) Adolph dagegen schmatzte mehr, als dass er sprach. Und Vater Holbein pustete ausgiebig auf jeden Löffel Dal, bevor er ihn zum Mund führte. In all den Jahren bei uns hat er noch immer nicht begriffen, dass Dal nur dann schmeckt, wenn man es dampfend heiß genießt.
Hermann erzählte, dass er und seine Brüder bereits Unterricht in Hindi nahmen … genommen hatten. Bei einem Moslem, den Adolph als Muselmann und Hermann als Munschi bezeichnete. Mit ihm hatten sie ein, ihrer Ansicht nach, höher als notwendiges Honorar vereinbart. Wie hoch, verrieten sie nicht. Ich vermute also: nicht besonders hoch. Als es zur Bezahlung kam, verlangte der Munschi plötzlich für jeden einzelnen von ihnen die ausgemachte Summe. (Natürlich!, echauffierte sich Vater Holbein an dieser Stelle.) Die Brüder weigerten sich. Vehement!, betonte Hermann. Am Tag darauf, als sie von einer Messung des Grundwassers zurückkehrten, erlebten sie eine, wie er es nannte, indische Sonderbarkeit: ihnen wurde von einem Chaprasi eine gerichtliche Vorladung ausgehändigt. Der Munschi hatte sie verklagt und sie mussten vor dem Court of Petty Sessions erscheinen. Diese werden, obwohl in Bombay sehr viel mehr Indier als Firengi leben, abwechselnd von einem Europäer und einem einheimischen Richter abgehalten. Dabei sollte, wenn man mich fragt, nur jeder vierte oder fünfte Richter europäisch sein. Die Firengi können sich glücklich schätzen, dass sie überhaupt Richter in unserem Land haben. Sitzen denn indische Richter in London? Die Brüder jedenfalls traf das Los eines Parsis. (Natürlich!, wieder Vater Holbein.) Aber zu ihrer Überraschung wurden sie dennoch freigesprochen. (Natürlich!, hätte ich beinahe gerufen. Wir sind nicht so voreingenommen wie die – und außerdem haben Parsis bekanntermaßen eine Schwäche für den Westen.)
Diese Erfahrung, sagte Hermann, hat uns zu der Einsicht gebracht, dass es wohl ratsam ist, keine schlitzohrigen Lehrer sondern besser einen brillanten Übersetzer anzuheuern.
Zum ersten Mal verstummte er und sah mich an. Von seinem Haarbüschel tropfte Lassi wie Farbe von einem Pinsel.
Wie alt bist du?, fragte er.
Mindestens zwölf Jahre, sagte ich.
Nicht sehr alt.
Alt genug, sagte Adolph, in seinem Alter sind wir alleine in den Alpen gekraxelt!
Nicht ganz allein, sagte Hermann.
Das wäre er ja auch nicht, erwiderte Adolph.
Die beiden starrten einander an wie es manchmal Vater Fuchs und Vater Holbein tun, wenn der eine lächeln und der andere seine Rute benutzen will.
Es wurde still im Speisesaal.
Ich nutzte die Gelegenheit und teilte ihnen mit, dass ich ihnen nicht behilflich sein könne.
Vater Holbein legte seinen Löffel beiseite und ergriff das Besteck daneben, seine Rute: Du wirst tun, was sie von dir verlangen.
Das kann ich nicht, sagte ich und fragte mich, welche Stelle meines Körpers dafür Bekanntschaft mit der Rute machen würde.
Adolph lachte auf: Bist ein ganz schöner Hund!
Ich bin kein Hund, sagte ich.
Das ist bloß eine Redewendung, sagte Hermann.
Was bedeutet sie?, fragte ich.
Dass man dir nicht trauen kann, sagte Adolph und wendete sich an seinen Bruder: Lass es sein, Hermann. Vergiss nicht, der Junge wurde von Jesuiten erzogen!
Ich muss doch sehr bitten, sagte Vater Holbein.
Adolph achtete nicht auf ihn und redete weiter: Was sollen wir mit einem wie ihm anfangen? Er wird uns nur in Schwierigkeiten bringen.
Hermann leckte seine Finger ab. (Ich war angetan, dass er sich bemüht hatte, mit den Händen zu essen.)
Wirst du uns in Schwierigkeiten bringen?, fragte er mich.
Drei Brüder und ein Vater warteten auf meine Antwort.
Höchstwahrscheinlich, sagte ich.
Vater Holbein schnappte nach Luft, Adolph lachte in sich hinein und Robert zog seinen Hut tiefer ins Gesicht.
Er kommt mit, sagte Hermann zu Vater Holbein.
Adolph sagte: Hermann!
Hermann sagte: Adolph.
Vater Holbein sagte: Großartig!
Robert sagte nichts.
Und ich sagte: Das geht nicht! Ich muss hier sein, wenn Vater Fuchs zurückkommt!
Nur ein paar Tage, sagte Hermann, allenfalls einige Wochen.
Wochen!, rief ich.
Sei froh, sagte Vater Holbein zu mir, du wirst Bombay von einer Seite kennenlernen, die du noch nie gesehen hast.
Dann schickten sie mich, meine Sachen holen.
Im Schlafsaal stopfte ich mein Notizbuch und die zweite Kurta, die ich besaß, in einen Beutel.
Ein Anderer fragte: Sie nehmen dich mit?
Er klang verwirrt. So etwas war noch nie vorgekommen. Viele Andere beobachteten mich skeptisch aus ihren Betten.
Auf dem Weg zurück zum Speisesaal machte ich in Vater Fuchs’ Zimmer halt. Ich trennte eine Seite aus dem Notizbuch und schrieb:
Lieber Vater Fuchs,
Sie müssen mir helfen. Die Gebrüder Schlagintweit haben mich geholt.
Bartholomäus
Als ich die Seite ans obere Ende seiner Matratze klemmte, sah ich es. Unter dem Bett lag das bayerische Taschentuch mit den roten Rosen. Ich nahm es, befreite es von Staub und steckte es ein.
Heute ist meine erste Nacht in Bombay, die ich nicht im Glashaus verbringe. Aber vielleicht ist das gut so. Vater Fuchs würde sein Taschentuch niemals ohne triftigen Grund zurücklassen. Er hat es absichtlich dort platziert, als geheime Botschaft an mich. Etwas ist ihm zugestoßen. Er will, dass ich nach ihm suche. Vater Fuchs muss irgendwo in Bombay sein. Und ich werde ihn finden.
BEMERKENSWERTE OBJEKTENO. 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10
Keine richtige DiyaBlasenfreies EisDer Bammelo-FischDie BildermaschineDer Geschmack von NacktheitDie Insel der GötterEine Khana
Ich werde Vater Fuchs niemals finden! Der November, der schönste Monat in einem Bombay-Jahr, ist verstrichen, und auch wenn er mich mit kühler aber nicht kalter Brise gestreichelt und mit warmer aber nicht heißer Luft in den Schlaf gewogen, mich mit meinem ersten Eis gefüttert und mir eine Bildermaschine gezeigt hat, und auch wenn er mich sogar auf einem Boot hat reiten und mich Nacktheit hat schmecken und mich fast hat fliegen lassen, kann ich ihm nicht verzeihen. Von jetzt an werde ich ihn den schlimmsten Monat des Jahres nennen.
Er begann damit, dass ich bei den Schlagintweits einzog. Ich wollte ihnen nicht dienen. Aber zurück ins Glashaus konnte ich nicht und die Brüder stellten die beste aller Chancen dar, Vater Fuchs zu finden. Sie bekunden andauernd, dass sie an allen Niederungen und Höhen Indiens interessiert sind. Das machte mir eine, wie ich jetzt weiß, dämonische Hoffnung. In Bombay kennt man immer jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Jeder Bombayite schleppt ein unsichtbares Netz hinter sich her, in dem sich große Fische aus dem Fort und kümmerliche Fische aus Blacktown verfangen. An der Seite der Schlagintweits würde ich früher oder später über Vater Fuchs’ Netz stolpern, dachte ich.
Leider ist im Durchschnitt nur jeder vierte Bayer angenehm. Das lernte ich in meiner Zeit bei den Brüdern. Allerdings ist jeder von ihnen auf ganz eigene Weise unangenehm. Mit Vater Fuchs haben sie nichts gemein. Außer dass sie ebenfalls aus Bayern stammen.
Sie wohnten bei einem Konsul.
Ich habe sie gefragt, warum sie nicht in eins der zwei Parsi-Hotels im Fort ziehen wollten.
Adolph ignorierte mich. Robert vielleicht auch. Sein Schweigen kann Zustimmung oder Ablehnung sein; die Wahl überlässt er meist seinem Gegenüber.
Hermann aber antwortete, dies seien keine passenden Absteigequartiere. Die Lage der Hotels im Fort sage ihnen nicht zu. Sie wollten lieber etwas näher bei den anderen Europäern sein.
Was sind das für Forscher, die Tausende von Kilometern reisen, damit sie dort ankommen, von wo sie aufgebrochen sind?
Die Residenz des Konsuls befindet sich westlich vom Fort. Das Glashaus würde mindestens zwei Mal hineinpassen. Aber noch protziger als die Residenz selbst ist die Luft um die Residenz. Da gibt es so viel Platz, so viel Nichts, das man atmen, durch das man laufen und in dem man bis zum Himmel schauen kann. In Blacktown ist jeder Platz etwas. Um die Residenz des Konsuls erstreckt sich ein Garten, der so weitreichend ist, dass er darin ausreiten kann, auf einem aus Australien importierten Rappen, weil die indischen angeblich minderwertig und arabische derzeit nicht in Mode sind. In der Residenz bezog jeder Schlagintweit ein eigenes Zimmer. Jedem von ihnen stand ein Bett zur Verfügung, in dem Devinders halbe Familie hätte bequem schlafen können. Hermann begeisterte sich für das Chunam* und betrachtete lange die Ornamente, die von den, wie er sie nennt, Eingeborenen geschaffen wurden. Er gefällt sich darin, forscherisch zu erscheinen. Adolph dagegen bedauerte das Fehlen jeglicher Ölgemälde**. Er gefällt sich darin, künstlerisch zu erscheinen.
Ich wurde in einer Dachkammer untergebracht, die ich mit niemandem teilen musste. Ich habe noch nie nichts geteilt. Es kam mir unrecht vor. Ich hatte ein Bett, eine Waschschüssel, viele Haken für meine wenigen Sachen und ein Fenster, durch das ich den Leuchtturm von Kolaba sehen konnte. Er ragt wie eine riesige Kerze in den Himmel und soll über hundertfünfzig Fuß hoch sein. (Die Füße der Vickys sind aber nicht nur kränklich weiß, sondern auch klein, da sie stets eingeschnürt und dadurch im Wachsen gehemmt sind.) Wenn ich auf ihn steigen und das Licht hätte bedienen können, wäre meine Suche von kurzer Dauer gewesen.
Eine kleinere Kerze befand sich auf dem Fenstersims, sie steckte in einem metallenen Unterteller. Daneben einige Schwefelhölzer. Ein Licht ganz für mich allein. Darüber freuen konnte ich mich nicht. Was sollte ich mit so viel Licht anfangen? Manchmal zündete ich die Kerze am helllichten Tag an und hielt meine Hand darüber, bis ich es nicht mehr aushielt. Der Schmerz war kein Schmerz, denn er tat gut; je stärker ich ihn spürte, desto wacher fühlte ich mich. An Diwali ließ ich die Kerze nachts brennen. Natürlich konnte sie eine richtige Diya nicht ersetzen. Aber vielleicht würde sie Vater Fuchs trotzdem zu mir leiten. So wie die Diyas Rama und Sita in ihre Heimat geleitet haben.
Jeden Morgen und jeden Abend holte ich Vater Fuchs’ Taschentuch hervor. Es erinnerte mich an mein Ziel, meine Mission. Es waren nur wenige Tränen von mir im Stoff. Man konnte sie gar nicht erkennen.
Die ersten Tage im schlimmsten Monat des Jahres verbrachte ich an Hermanns Seite. Seine Mitteilsamkeit machte mir das Übersetzen nicht leicht. Er spülte so viele Wörter durch meinen Kopf! An diese musste ich noch weitere von mir dranhängen, ohne dass er es merkte. Meine Fragen nach Vater Fuchs fädelte ich in jedes Gespräch ein. Ich brachte ganz Bombay zum Kopfschütteln. Niemand hatte Vater Fuchs gesehen, niemand erinnerte sich an ihn. Ich gab jedoch nicht auf. Bald war Hermann auf der Straße bekannt als der Firengi, der nach einem Jesuiten sucht. Nur Hermann wusste nicht, wofür er bekannt war.
Am Ende eines Tages fühlte ich mich ganz satt. Ich hatte noch nie so viel gehört und gesprochen. Und das gleichzeitig. Bombayites reden lieber, als dass sie nicht reden. Besonders dann, wenn man gerade keine Zeit zum Reden hat. Aber Hermann war der unbarmherzige König des Redens. Auf den Bazars flohen selbst Banias und Jains vor uns, weil er sie kaum zu Wort kommen ließ. Und was ist ein Händler ohne seine Worte?
Wenn Hermann gerade einmal nicht spricht, dann schreibt er. In seinem Notizbuch. Er verwendet einen Bleistift, den er gestohlen oder ausgeliehen hat. Faber steht darauf. Hermann füllt seine Seiten schneller als ich. Ich habe ihn mehrmals gefragt, was genau er eigentlich aufschreibt. Er gab mir keinmal Auskunft. Das schien mir verdächtig. Ich beschloss, die Antwort selbst herauszufinden. Vielleicht würde ich so einen Hinweis auf Vater Fuchs entdecken.
Tagelang kam ich nicht einmal in die Nähe des Notizbuchs. Hermann trug es stets in seiner Brusttasche und hütete es wie Smitaben eine reifende Papaya. Aber gegen Ende der ersten Woche mit den Schlagintweits bot sich mir eine Gelegenheit.
Am Abend tranken die Brüder Gin mit Konsul Ventz auf dessen Baramahda (die von den Firengi fälschlicherweise als Veranda bezeichnet wird).
Den Gin hatte der Konsul direkt aus London geschickt bekommen, die Lieferung eines Bekannten namens Charles Tanqueray. Eis kühlte ihre Drinks. Noch nie in meinem Leben hatte ich Eis gesehen.
Ich fragte, ob ich ein Stück probieren dürfe.
Konsul Ventz wendete sich mir zu, seine Nase hatte die gleiche rötliche Tönung wie die von Hormazd. Du willst blasenfreies Eis aus den Seen Nordamerikas kosten?
Ich nickte.
Indier!, rief er den Brüdern zu und lachte. Das Eis hat doch nicht den weiten Weg um die Südspitze Afrikas gemacht, um in deinem Mund zu landen!
Knirschend zerkaute er das Eis und hielt dem Diener sein leeres Glas hin, der ihm umgehend einen neuen Drink zubereitete.
Als ich zu den Brüdern sah, ignorierte Adolph meinen Blick. Hermann döste. Und Robert blinzelte – oder vielleicht war es mehr ein Zwinkern. Jedenfalls trank er sein Glas leer und stellte es neben seinem Korbstuhl ab, schob es sogar noch ein Stück von sich. Das Eis darin funkelte.
Während der Konsul klagte, dass es in ganz Indien keine vernünftigen Äpfel gäbe, bewegte ich mich unauffällig zum Glas, schnappte mir in einem günstigen Moment das Eis und ließ es in meinem Mund verschwinden. Zuerst schmeckte es scharf und herb, der Gin. Dann aber breitete sich eine salzige Kälte aus, sie floss meinen Hals hinunter und stieg in meinen Kopf. Ich hätte nicht gedacht, dass etwas so Kaltes so angenehm sein konnte! Ich lutschte vorsichtig, damit das Eis langsam schmolz. Erst, als es nur mehr eine dünne Scheibe auf meiner Zunge war, biss ich drauf und es zerbrach herrlich in kleine Stückchen. Für einen Augenblick – aber nur einen kurzen – war ich froh, dass die Schlagintweits mich rekrutiert hatten. Gerne hätte ich Smitaben davon berichtet. Ich fragte mich nicht zum ersten Mal, wie es ihr und allen anderen, außer den Anderen, wohl ging.
Dort, wo ich nun stand, war ich nur zwei Schritte von Hermann entfernt. In der rechten Tasche seiner Weste, die er über die Rückenlehne seines Sessels gehängt hatte, steckte sein Notizbuch. Da er nicht redete, musste er eingenickt sein. Behutsam zog ich das Notizbuch aus der Tasche und entfernte mich.
Bartholomäus!, rief jemand. Zuerst erkannte ich Roberts Stimme nicht, weil er sie so selten verwendet; sie klingt selbstbewusst und passt nicht zu seinen Fledermausohren und glatten Wangen.
Ich blieb stehen.
Was hast du da?, fragte er.
Ich versuchte es mit: Nichts.
Dann steck dieses Nichts dorthin zurück, wo du es her hast.
Indier!, nuschelte Konsul Ventz in seinen Gin. Es liegt in ihrer Natur, die können schlichtweg nicht anders.
Ich wollte es nur ausleihen, sagte ich zu meiner Verteidigung. Zum Lesen.
Er kann lesen? Konsul Ventz schob seinen plumpen Körper in eine aufrechte Position. Wo haben Sie denn dieses Exemplar gefunden? Ich verlange eine Demonstration, statim!
Adolph machte eine einladende Geste.
Ich soll vorlesen?
Hermann hat nichts dagegen, sagte Adolph und grinste.
Darauf stieß Robert ihm gegen die Schulter.
Ich schlug das Buch an einer beliebigen Stelle auf. Hermanns Handschrift war kindlich, aber ich konnte sie trotz der übertriebenen Schnörkel entziffern.
Ich las: Gemeinsam ist zu Gunsten aller indischen Rassen anzuführen, dass selbst in Straßen, so dicht gefüllt wie jene von Bombay während eines großen Teiles des Tages sind, Streit und gefährliches Drängen nur selten ist; allerdings ist auch die Ambition nicht sehr groß, viel Arbeit in kurzer Zeit zu vollenden.
Wie wahr!, sagte Konsul Ventz und forderte mich, als ich innehielt, zum Weiterlesen auf.
Ich überflog ein paar Absätze und suchte nach einer passenden Stelle. Der erste Eindruck, las ich, welchen der Ankömmling durch das Benehmen der Europäer gegen die Eingeborenen erhält, ist kein befriedigender; die Europäer erscheinen den indischen Hindus und Muselmanns gegenüber sich selbst sehr zu überschätzen.
Das steht aber nicht wirklich dort!, sagte Konsul Ventz. Er erhob sich, suchte Gleichgewicht, fand Gleichgewicht, nahm mir das Buch ab und studierte die Seite.
Tatsächlich!, rief er. Herr Schlagintweit!
Hermann begann sich zu rühren.
Hermann Schlagintweit!, polterte Ventz und leerte seinen Gin in einem Zug.
Hermann sah zu ihm auf.
Sie sind zur Erforschung Indiens hier, sagte er. Was sollen diese Vorurteile gegenüber ihren eigenen Leuten?
Adolph und Robert schmunzelten.
Überlassen Sie das Wissenschaftliche lieber den Wissenschaftlern, sagte Hermann, unsere Untersuchungen haben einen holistischen Anspruch.
Holistisch?, fragte Ventz.
Holistisch bedeutet das Ganze betreffend, sagte ich.
Alle vier sahen mich an, als hätten sie mich nie zuvor gesehen.
Das weiß ich!, rief Ventz. Denken Sie, ich weiß das nicht? Natürlich weiß ich das!
Hermann nahm ihm sein Buch ab. Es ist spät, sagte er, ich empfehle mich.
Komm, sagte er zu mir, als er ins Haus ging, und ich folgte ihm.
In der Bibliothek, die wie das Papierzimmer muffelte, deutete Hermann mit dem Zeigefinger auf mich.
Woher weißt du, was holistisch bedeutet?
Vater Fuchs, sagte ich.
Es ist außergewöhnlich, wie viel er dich lehren konnte.
Ich habe auch meinen Teil dazu beigetragen.
Hermann strich seinen Schnurrbart glatt.
Ich kann verstehen, warum er dir so viel bedeutet. Ohne ihn wärst du nur einer von vielen Eingeborenen.
Helfen Sie mir, ihn zu finden?
Du solltest ihn vergessen. Bald reisen wir weiter, nach Madras. Deine Fähigkeiten sind zu wertvoll für uns. Ich habe entschieden: Du wirst uns begleiten.
Ich kann nicht nach Madras!
Diese Entscheidung liegt nicht bei dir.
Was mich am meisten störte, war die Nüchternheit, mit der er sprach. Ich suchte nach einer Formulierung, die ihn heftig treffen würde, und schoss sie sogleich auf ihn ab: Sie sind ein unappetitlicher Mensch!
Mag sein, mag sein, sagte er und hielt mir sein Notizbuch hin. Für dich. Ich kann dich mehr lehren als ein Gottesmann.
Da ich nicht reagierte, legte er es auf die Armlehne eines Sessels und ließ mich allein.
Ich gab mir das Versprechen: Unter keinen Umständen würde ich mit den Brüdern nach Madras ziehen – eher weglaufen und in Blacktowns Gassen Zuflucht finden!
In dieser Nacht verbrauchte ich eine ganze Kerze und danach viel Mondlicht. Vom Blättern in Hermanns Notizbuch wurden meine Finger silbrig. Der Schlagintweit notierte alles. Beobachtungen, Messungen, Gedanken. Manches verstand ich nicht. Periodische Veränderungen und magnetische Observationen und absolute Intensitätsbestimmungen.