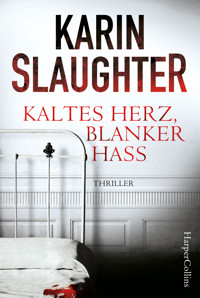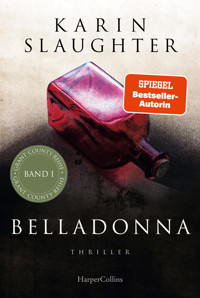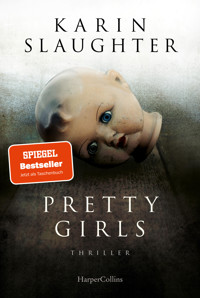9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ecco Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Vierzig Jahre Schweigen: Karin Slaughters neuer SPIEGEL-Bestseller zeichnet das aufrüttelnde Portrait eines grausamen Mordes Ein Mädchen mit einem Geheimnis ... Ein kleiner Ort an der US-Ostküste, 1982: Sorgfältig macht sich die siebzehnjährige Emily Vaughn für ihren Abschlussball zurecht. Doch sie verbirgt ein Geheimnis, das ihr am Ende des Abends zum Verhängnis werden soll. Ein ungelöster Mord ... Nicht nur Emily wurde in der Horrornacht vor vierzig Jahren zum Schweigen gebracht. Ihre Freunde und Familie haben sich abgeschottet, die Gemeinde spricht nicht über das brutal ermordete Mädchen. Aber dem malerischen Küstenort steht ein gewaltiger Sturm bevor. Eine letzte Chance, den Täter zu finden ... US-Marshal Andrea Oliver ist aus scheinbar unverfänglichen Gründen in Longbill Beach: Sie soll eine Richterin vor Morddrohungen zu beschützen. Doch der Auftrag ist eine Tarnung. In Wirklichkeit ist Andrea auf den Spuren von Emilys Mörder – und sie muss die Wahrheit aufdecken, bevor sich die Tragödie des Jahrs 1982 wiederholt ... »Ein mühelos gelungener Thriller« The Times »Karin Slaughter [zeigt] erneut ihre Bestform.« Kulturnews »Dieser Thriller liefert, was er verspricht. Er ist überraschend, berührend und spannend. Ich finde ihn absolut faszinierend« Adele Parks, Autorin von One Last Secret »Gewohnt geschickt lässt Erfolgsautorin Slaughter die Handlung Haken schlagen, schickt Leserschaft und Ermittler gleichermaßen durch ein Labyrinth der Vermutungen und Anschuldigungen.« Axel Hill, Kölnische Rundschau »Dieser erstklassige Detektivthriller ist ein düsteres, raffiniertes Juwel« Janice Hallett, Autorin von The Appeal »Alles in allem hat mich das Buch von Anfang bis Ende wirklich gefesselt, auch weil der Schreibstil unglaublich mitreißend ist und ich unbedingt wissen wollte, was hinter dem Tod von Emily steckt.« feliz auf Vorablesen.de »Ich mag Karin Slaughter, je spannender desto besser! Und hier hat sie wieder einen grandiosen Thriller hingelegt!!! Was ist mit der jungen Emily damals am Tag ihres Abschlussballs wirklich passiert? Wer hat sie so kaltblütig ermordet und warum?« Martina Dienstl, Buchhändlerin, auf NetGalley.de »Erneut beweist Karin Slaughter ihr Gespür für lebensechte Charakterzeichnungen und einen Plot ohne überflüssigen Ballast.« Johannes Baumstuhl, Galore »Sagenhaft spannende[r] Thriller der US-Autorin Karin Slaughter.« Morgenpost am Sonntag Lesen Sie Karin Slaughters neuen Cold-Case-Thriller Die Vergessene, bereits jetzt ein SPIEGEL-Bestseller!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 716
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem TitelGirl, Forgotten bei William Morrow, New York.
© by Karin Slaughter Deutsche Erstausgabe © 2022 für die deutschsprachige Ausgabe by HarperCollins in der Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH, Hamburg Published by arrangement with William Morrow, an imprint of HarperCollins Publishers, US Covergestaltung von Hafen Werbeagentur, Hamburg Coverabbildung von Gary Isaacs / Trevillion Images, Groundback Atelier / Shutterstock E-Book-Produktion von GGP Media GmbH, Pößneck ISBN E-Book 9783749905034www.harpercollins.de
WIDMUNG
Für Mrs. D. Ginger
17. APRIL 1982
Emily Vaughn blickte stirnrunzelnd in den Spiegel. Das Kleid war genauso schön wie im Laden. Ihr Körper war das Problem. Sie drehte sich, und dann drehte sie sich noch einmal, um einen Blickwinkel zu finden, in dem sie nicht aussah wie ein gestrandeter Wal.
Omis Stimme ertönte aus der Ecke: »Du solltest die Finger von den Keksen lassen, Rose.«
Emily stutzte kurz. Rose war Omis Schwester, die während der Großen Depression an Tuberkulose gestorben war. Emily hieß zum Andenken an das Mädchen mit zweitem Vornamen Rose.
»Omi.« Sie legte die Hand auf den Bauch und sagte zu ihrer Großmutter: »Ich glaube nicht, dass es an den Keksen liegt.«
»Bist du dir sicher?« Ein Lächeln spielte um Omis Mund. »Ich habe gehofft, du würdest damit herausrücken.«
Emily warf einen weiteren missbilligenden Blick auf ihr Spiegelbild, ehe sie sich zu einem Lächeln zwang. Sie ging unbeholfen vor dem Schaukelstuhl ihrer Großmutter in die Knie. Die alte Frau strickte einen Pullover in Kindergröße. Ihre Finger tauchten wie Kolibris in schneller Folge in den kleinen gekräuselten Kragen. Der lange Ärmel ihres geblümten Rüschenkleids war nach oben gerutscht. Emily berührte sanft den dunkelblauen Bluterguss um ihr dünnes Handgelenk.
»Ich alter Tollpatsch.« Sie leierte die Worte im Tonfall tausendmal gebrauchter Ausflüchte. »Freddy, du musst dieses Kleid ausziehen, bevor Papa nach Hause kommt.«
Jetzt dachte Omi, Emily sei ihr Onkel Fred. Demenz glich irgendwie einem Spaziergang im Familienschrank mit vielen Skeletten.
»Soll ich dir ein paar Kekse holen?«, fragte Emily.
»Das wäre wunderbar.« Omi strickte weiter, aber ihr Blick, der nie auf etwas Bestimmtes fokussiert war, hing plötzlich wie gebannt an Emily. Ihr Mund verzog sich zu einem Lächeln. Sie legte den Kopf schief, als betrachtete sie die Perlmuttschicht in einer Muschel. »Schau sich nur einer diese glatte Haut an. Du bist so hübsch.«
»Das liegt in der Familie.« Emily staunte über den beinahe greifbaren Zustand des Erkennens, der den Blick ihrer Großmutter verwandelt hatte. Sie war wieder ganz da, so als hätte ein Besen die Spinnweben aus dem wirren Gehirn gefegt.
Emily berührte ihre faltige Wange. »Hallo, Omi.«
»Hallo, mein liebes Kind.« Sie legte das Strickzeug beiseite, um Emilys Gesicht mit beiden Händen zu umfassen. »Wann ist dein Geburtstag?«
Emily wusste, dass sie jetzt so viele Informationen wie möglich liefern musste. »Ich werde in zwei Wochen achtzehn, Großmutter.«
»Zwei Wochen.« Omi lächelte noch mehr. »Es ist so wunderbar, jung zu sein. Solch ein Versprechen. Dein ganzes Leben ist wie ein ungeschriebenes Buch.«
Emily wappnete sich mit einer unsichtbaren Festung gegen eine Flut von Empfindungen. Sie würde diesen Moment nicht ruinieren, indem sie zu weinen anfing. »Erzähl mir eine Geschichte aus deinem Buch, Omi.«
Omi sah erfreut aus. Sie liebte es, Geschichten zu erzählen. »Hab ich dir von der Zeit erzählt, als ich mit deinem Vater schwanger war?«
»Nein«, sagte Emily, obwohl sie die Geschichte Dutzende Male gehört hatte. »Wie war das?«
»Grauenhaft.« Sie lachte, um dem Wort die Schwere zu nehmen. »Mir war von früh bis spät übel. Ich konnte kaum aufstehen, um zu kochen. Das Haus war ein Saustall. Draußen war es brütend heiß, das kann ich dir sagen. Ich wollte mir unbedingt das Haar schneiden. Es war so lang, ging mir bis zur Taille, und wenn ich es wusch, war es durch die Hitze ruiniert, noch bevor es ganz trocken war.«
Emily fragte sich, ob Omi ihr Leben mit der Kurzgeschichte Bernice schneidet ihr Haar ab verwechselte. F. Scott Fitzgerald und Ernest Hemingway stahlen sich oft in ihre Erinnerungen. »Wie kurz hast du dein Haar geschnitten?«
»O nein, ich habe nichts dergleichen getan«, sagte Omi. »Dein Großvater erlaubte es nicht.«
Emily öffnete überrascht den Mund. Das klang eher nach dem wahren Leben als nach einer Kurzgeschichte.
»Es gab ein ziemliches Theater. Mein Vater mischte sich ein. Er und meine Mutter kamen, um für mich Partei zu ergreifen, aber dein Großvater weigerte sich, sie ins Haus zu lassen.«
Emily hielt die zitternden Hände ihrer Großmutter fest.
»Ich weiß noch, wie sie auf der Veranda gestritten haben. Sie waren kurz davor, sich zu prügeln, aber meine Mutter flehte sie an, aufzuhören. Sie wollte mich mit nach Hause nehmen und sich um mich kümmern, bis das Baby kam, aber dein Großvater ließ sie nicht.« Sie schaute überrascht drein, als wäre ihr gerade ein Gedanke gekommen. »Stell dir vor, wie anders mein Leben verlaufen wäre, wenn sie mich an diesem Tag mit nach Hause genommen hätten.«
Emily war nicht imstande, es sich vorzustellen. Sie konnte nur an die Umstände ihres eigenen Lebens denken. Sie war genauso in die Falle geraten wie ihre Großmutter.
»Mein Lämmchen.« Omis gichtknotige Finger fingen Emilys Tränen auf. »Sei nicht traurig. Du wirst entkommen. Du wirst aufs College gehen. Einen Jungen kennenlernen, der dich liebt. Kinder haben, die dich anbeten. Du wirst in einem schönen Haus leben.«
Emily wurde die Brust eng. Der Traum von einem solchen Leben war ihr abhandengekommen.
»Mein Schatz«, sagte Omi. »Du musst mir in dieser Sache vertrauen. Ich habe mich im Schleier zwischen Tod und Leben verfangen, was mir einen Blick auf die Vergangenheit wie auf die Zukunft gewährt. Und ich sehe nichts als Glück für dich in der Zeit, die vor uns liegt.«
Emily spürte, wie ihre Festung unter dem Gewicht des drohenden Schmerzes zu bröckeln begann. Was auch geschah, ob es gut, schlecht oder unbestimmt war –, ihre Großmutter würde es nicht mitbekommen. »Ich liebe dich so sehr.«
Es gab keine Reaktion. In Omis Blick lag wieder die vertraute Verwirrung. Sie hielt die Hand einer Fremden. Peinlich berührt griff sie nach den Stricknadeln und arbeitete weiter an dem Pullover.
Emily wischte sich die letzten Tränen fort und stand auf. Es gab nichts Schlimmeres, als eine Fremde weinen zu sehen. Der Spiegel lockte, aber es ging ihr schon schlecht genug, ohne dass sie sich weiter betrachtete. Davon abgesehen würde es nichts ändern.
Omi blickte nicht auf, als Emily ihre Sachen zusammenpackte und hinausging.
Sie lief die Treppe hinauf und lauschte. Der schneidende Tonfall ihrer Mutter wurde von der geschlossenen Tür ihres Arbeitszimmers gedämpft. Emily horchte angestrengt auf den tiefen Bariton ihres Vaters, aber er war vermutlich noch in seiner Fachbereichssitzung. Dennoch zog Emily ihre Schuhe aus, als sie vorsichtig die Treppe wieder hinunterschlich. Das Knarren des alten Hauses war ihr so vertraut wie das laute Gezänk ihrer Eltern.
Ihre Hand streckte sich schon zur Eingangstür, als ihr die Kekse einfielen. Die mächtige alte Standuhr ging auf fünf zu. Ihre Großmutter würde sich nicht an die Bitte erinnern, aber bis weit nach sechs würde sie auch nichts zu essen bekommen.
Emily stellte ihre Schuhe neben der Tür ab und lehnte ihre kleine Handtasche gegen die Absätze. Dann schlich sie auf Zehenspitzen zur Küche.
»Wohin, zum Teufel, willst du denn in diesem Aufzug?« Die Küche stank nach Zigarren und dem schalen Bier ihres Vaters. Das schwarze Anzugjackett hatte er über einen Stuhl geworfen und die Ärmel des weißen Hemds hochgekrempelt. Eine ungeöffnete Dose Natty Boh stand neben zwei eingedrückten leeren auf der Anrichte.
Emily sah einen Tropfen Kondenswasser an der Dose hinunterlaufen.
Ihr Vater schnippte mit den Fingern, als treibe er einen seiner Studenten zu mehr Eile an. »Antworte mir.«
»Ich wollte nur …«
»Ich weiß, was du nur wolltest«, unterbrach er sie. »Du bist nicht zufrieden mit dem Schaden, den du dieser Familie bereits zugefügt hast, nicht wahr? Du hast vor, unser Leben komplett in die Luft zu jagen, zwei Tage vor der wichtigsten Woche in der ganzen Karriere deiner Mutter?«
Emilys Gesicht brannte vor Scham. »Es geht nicht um …«
»Es interessiert mich einen feuchten Dreck, worum es deiner Ansicht nach geht oder nicht geht.« Er zog den Ring von der Dose und warf ihn in die Spüle. »Du darfst kehrtmachen, dieses grässliche Kleid ausziehen und in deinem Zimmer bleiben, bis ich dir etwas anderes sage.«
»Ja, Sir.« Sie öffnete den Küchenschrank, um die Kekse für ihre Großmutter herauszuholen. Emilys Finger hatten die orange-weiße Packung kaum berührt, als sich die Hand ihres Vaters um ihr Handgelenk schloss. Ihre Gedanken fokussierten sich nicht auf den Schmerz, sondern auf die Erinnerung an den handschellenförmigen Bluterguss am zarten Gelenk ihrer Großmutter.
Du wirst entkommen. Du wirst aufs College gehen. Du wirst einen Jungen kennenlernen, der dich liebt …
»Dad, ich …«
Er drückte härter, und der Schmerz raubte ihr den Atem. Emily ging in die Knie, die Augen fest geschlossen, als sein stinkender Atem in ihre Nase drang. »Was habe ich dir gesagt?«
»Du …« Ihr Atem stockte, als die Knochen in ihrem Handgelenk zu zittern begannen. »Es tut mir leid, ich …«
»Was habe ich dir gesagt?«
»Ich … Ich soll auf mein Zimmer gehen.«
Der Schraubstock seiner Hand löste sich, und vor lauter Erleichterung stieß Emily einen tiefen Seufzer aus. Sie stand auf, schloss die Schranktür, ging aus der Küche. Sie lief durch den Flur zurück und stellte den Fuß auf die unterste Stufe, genau dort, wo sie am lautesten knarrte, bevor sie ihn zurückzog und wieder auf den Boden setzte.
Emily drehte sich um.
Ihre Schuhe standen zusammen mit ihrer Handtasche noch neben der Eingangstür. Sie waren in einer Nuance von Türkis eingefärbt, die perfekt zu ihrem Seidenkleid passte. Aber das Kleid war zu eng, und sie bekam die Strumpfhose einfach nicht höher als bis zu den Knien. Außerdem waren ihre Füße schmerzhaft geschwollen, deshalb ließ sie die Schuhe stehen und schnappte sich beim Hinausgehen nur das Täschchen.
Eine sanfte Frühlingsbrise strich um ihre nackten Schultern, als sie den Rasen überquerte. Das Gras kitzelte sie an den Füßen. Sie nahm den stechenden Salzgeruch des Ozeans in der Ferne wahr. Der Atlantik war viel zu kalt für die Touristen, die im Sommer zur Strandpromenade strömen würden. Für den Moment gehörte Longbill Beach den Einheimischen, die nie in einer langen Schlange für einen Eimer Fritten vor Thrasher’s anstehen oder staunend auf die Apparate starren würden, die im Fenster des Süßwarenladens lange bunte Toffeefäden zogen.
Sommer.
Nur wenige Monate entfernt.
Clay, Nardo, Ricky und Blake bereiteten sich alle auf ihre Abschlussprüfungen vor; sie standen im Begriff, ihr Erwachsenenleben zu beginnen und diesen erdrückenden, armseligen Badeort zu verlassen. Würden sie jemals wieder an Emily denken? Dachten sie jetzt überhaupt an sie? Vielleicht voller Mitleid. Wahrscheinlich erleichtert, weil sie die Fäule endlich aus ihrem inzestuösen kleinen Kreis herausgeschnitten hatten.
Ihr Außenseitertum schmerzte nicht mehr so stark wie zu Beginn. Emily hatte schließlich akzeptiert, dass sie nicht mehr zum Leben der anderen gehörte. Im Gegensatz zu dem, was ihre Großmutter prophezeit hatte, würde Emily nicht entkommen. Nicht aufs College gehen. Keinen Jungen kennenlernen, der sie liebte. Am Ende würde sie unverschämte Bengel mit ihrer Rettungsschwimmerpfeife verwarnen oder hinter der Theke von Salty Pete’s kostenlose Softeisportionen ausgeben.
Ihre Fußsohlen klatschten auf den warmen Asphalt, als sie um die Ecke bog. Sie hätte gern zum Haus zurückgeschaut, aber sie versagte sich die theatralische Geste. Stattdessen beschwor sie das Bild ihrer Mutter herauf, die mit dem Telefon am Ohr in ihrem Arbeitszimmer auf und ab lief und ihre Strategie entwarf. Ihr Vater würde die Dose Bier leeren und vielleicht die Entfernung zwischen dem restlichen Bier im Kühlschrank und dem Scotch in der Bibliothek abwägen. Ihre Großmutter würde den winzigen Pullover zu Ende stricken und sich fragen, für welches Kind sie ihn wohl angefangen haben mochte.
Ein Auto näherte sich, und Emily wich von der Straßenmitte an den Rand zurück. Sie sah einen zweifarbige Chevy Chevette vorbeirollen, dann leuchteten die grellroten Bremslichter auf. Laute Musik dröhnte aus den offenen Fenstern: die Bay City Rollers.
S-A-T-U-R-D-A-Y Night!
Mr. Wexlers Blick schwenkte vom Rückspiegel zum Seitenspiegel. Die Hecklichter blinkten, als er mit dem Fuß zwischen Brems- und Gaspedal wechselte, unschlüssig, ob er weiterfahren sollte oder nicht.
Emily trat zur Seite, als der Wagen zurücksetzte. Sie konnte den Joint im Aschenbecher riechen. Vermutlich sollte Dean heute Abend Aufsicht führen, aber sein schwarzer Anzug war eher für eine Beerdigung angemessen als für einen Ball.
»Em!«, brüllte er wegen der Lautstärke des Songs. »Was hast du vor?«
Sie streckte die Arme aus, um auf ihr türkisfarbenes Ballkleid hinzuweisen. »Wonach sieht es denn aus?«
Sein Blick huschte über sie, dann musterte er sie noch einmal, jetzt langsamer. Genau so hatte er Emily angesehen, als sie zum ersten Mal in sein Klassenzimmer spaziert war. Er unterrichtete nicht nur Sozialkunde, sondern war auch der Leichtathletikcoach, deshalb hatte er burgunderrote Shorts und ein weißes, kurzärmeliges Polohemd getragen – genau wie die anderen Trainer.
An diesem Punkt endeten die Ähnlichkeiten aber bereits.
Dean Wexler war nur sechs Jahre älter als seine Schüler, aber er war welterfahren und klug, wie es keiner von ihnen je sein würde. Vor seinem Studium hatte er ein Jahr Auszeit genommen und war als Rucksacktourist durch Europa gereist. Er hatte Brunnen für Dorfbewohner in Lateinamerika gegraben. Er trank Kräutertees und baute sein eigenes Gras an. Er hatte einen dichten, üppigen Schnauzbart wie Tom Selleck in Magnum. Er sollte sie eigentlich in Staatsbürgerkunde unterrichten, aber in der einen Unterrichtsstunde las er mit ihnen einen Artikel darüber, wie das Insektizid DDT immer noch das Grundwasser verseuchte, und in der nächsten erklärte er ihnen, dass Reagan eine Geheimabsprache mit den Iranern wegen der Geiseln traf, um die Wahl zu seinen Gunsten zu beeinflussen.
Kurz gesagt, alle waren der Ansicht gewesen, dass Dean Wexler der coolste Lehrer war, den sie je gehabt hatten.
»Em.« Er wiederholte den Namen wie einen Seufzer. Die Gangschaltung ging auf Parken. Er zog die Handbremse, stellte den Motor ab und unterbrach den Song bei n-i-i-ght.
Dean stieg aus. Er ragte drohend vor ihr auf, doch sein Blick war zur Abwechslung nicht unfreundlich. »Du kannst nicht zum Ball gehen. Was sollen die Leute denken? Was werden deine Eltern sagen?«
»Das ist mir egal«, sagte sie, und ihre Stimme ging am Satzende nach oben, denn es war ihr alles andere als egal.
»Du musst die Folgen deines Handelns bedenken.« Er machte Anstalten, nach ihren Armen zu greifen, dann überlegte er es sich offenbar anders. »Deine Mutter wird in diesem Augenblick von höchster Ebene auf Herz und Nieren überprüft.«
»Tatsächlich?«, fragte Emily, als hätte ihre Mutter nicht so viele Stunden telefoniert, dass ihr Ohr die Form des Telefonhörers angenommen hatte. »Ist sie irgendwie in Schwierigkeiten?«
Sein lautstarker Seufzer sollte zeigen, dass er um Geduld bemüht war. »Ich glaube, du bedenkst nicht, dass dein Handeln alles, wofür sie gearbeitet hat, zunichte machen könnte.«
Emily beobachtete eine Möwe, die über einem Wolkenhaufen schwebte. Dein Handeln. Dein Handeln. Dein Handeln. Sie hatte Dean schon herablassend erlebt, aber nie ihr gegenüber.
»Was, wenn jemand ein Foto von dir macht?«, fragte er. »Oder wenn ein Journalist an der Schule ist. Überleg mal, was für ein Licht das auf sie wirft.«
Eine Erkenntnis dämmerte und brachte sie zum Lächeln. Er scherzte. Natürlich scherzte er.
»Emily.« Dean scherzte eindeutig nicht. »Du kannst nicht …«
Wie ein Pantomime deutete er mit den Händen die Umrisse ihres Körpers an: nackte Schultern, zu große Brüste, zu breite Hüften, die gespannten Nähte an ihrer Taille, weil die türkisfarbene Seide die Rundung ihres Bauchs nicht verbergen konnte.
Deshalb strickte Omi den winzigen Pullover. Deshalb hatte ihr Vater sie die letzten vier Monate nicht aus dem Haus gehen lassen. Deshalb hatte der Direktor sie der Schule verwiesen. Deshalb war sie von Clay, Nardo, Ricky und Blake getrennt worden.
Sie war schwanger.
Schließlich fand Dean seine Sprache wieder. »Was würde deine Mutter sagen?«
Emily zögerte, sie versuchte die Flut von Scham zu durchwaten, die ihr entgegenströmte, die Scham, die sie ertragen musste, seit bekannt geworden war, dass sie nicht mehr das brave Mädchen war, das ein vielversprechendes Leben vor sich hatte, sondern das böse Mädchen, das einen hohen Preis für seine Sünden zahlen würde.
»Seit wann machen Sie sich so viele Gedanken um meine Mutter?«, fragte sie. »Ich dachte, sie sei nur ein Rädchen in einem korrupten System?«
Ihr Ton war schärfer als beabsichtigt, aber ihr Zorn war echt. Er hörte sich genau wie ihre Eltern an. Wie der Direktor. Wie die anderen Lehrer. Der Pastor. Ihre früheren Freunde. Sie hatten immer recht, und Emily lag immer falsch, falsch, falsch.
Sie sagte die Worte, die ihn am meisten verletzten: »Ich habe an Sie geglaubt.«
Er schnaubte höhnisch. »Du bist zu jung, um ein glaubhaftes System von Überzeugungen zu besitzen.«
Emily biss sich auf die Unterlippe, um ihre Wut zu beherrschen. Wieso hatte sie nicht früher bemerkt, was für ein Dreckskerl er war?
»Emily.« Er schüttelte noch einmal betrübt den Kopf, versuchte noch immer, sie zu demütigen, damit sie gehorchte. Er interessierte sich nicht für sie – nicht wirklich. Er wollte nichts mit ihr zu tun haben. Er wollte auf keinen Fall mitansehen, wie sie auf dem Ball eine Szene machte. »Du siehst ungeheuerlich aus. Du wirst dich nur zum Gespött machen. Geh nach Hause.«
Genau das würde sie nicht tun. »Sie haben gesagt, wir sollen die Welt niederbrennen. Genau das haben Sie gesagt. ›Brennt alles nieder. Fangt neu an. Baut etwas auf …‹«
»Du wirst nichts aufbauen. Du hast eindeutig nur eine Show im Sinn, um die Aufmerksamkeit deiner Mutter auf dich zu ziehen.« Er hatte die Arme verschränkt und blickte jetzt auf seine Uhr. »Werd erwachsen, Emily. Die Zeit für Egoismus ist vorbei. Du musst daran denken, was …«
»Woran muss ich denken, Dean? Woran, meinen Sie, muss ich denken?«
»Nicht so laut, um Himmels willen.«
»Sagen Sie mir nicht, was ich tun soll!« Sie spürte, wie ihr Herz bis zum Hals schlug, und sie hatte die Fäuste geballt. »Sie haben es selbst gesagt. Ich bin kein Kind mehr. Ich bin fast achtzehn Jahre alt. Und ich habe es gründlich satt, dass Leute – Männer – mir sagen, was ich tun soll.«
»Dann bin ich jetzt also das Patriarchat?«
»Sind Sie es, Dean? Gehören Sie zum Patriarchat? Wir werden sehen, wie schnell man die Wagenburg schließt, wenn ich meinem Vater erzähle, was Sie getan haben.«
Feuer schoss in ihren Arm und bis in die Fingerspitzen. Sie wurde hochgehoben, herumgeworfen und krachte gegen die Autotür. Das Metall war heiß an ihren bloßen Schulterblättern. Sie hörte den abkühlenden Motor knistern. Eine Hand von Dean umschloss ihr Handgelenk, die andere war auf ihren Mund gepresst. Sein Gesicht war ihrem so nah, dass sie die feinen Schweißperlen in seinem Schnauzbart erkennen konnte.
Emily wehrte sich. Er tat ihr weh, richtig weh.
»Was für einen verlogenen Scheißdreck willst du deinem Vater erzählen?«, zischte er. »Sag schon.«
In ihrem Handgelenk knackte etwas. Sie fühlte die Knochen wie Zähne klappern.
»Was wirst du sagen, Emily? Nichts? Wirst du nichts sagen?«
Emilys Kopf ging auf und nieder. Sie wusste nicht, ob Deans schweißnasse Hand ihn bewegte, oder ob ein Überlebensinstinkt in ihr sie nachgeben ließ.
Langsam löste er seine Finger. »Was wirst du also sagen?«
»N-nichts. Ich … Ich werde ihm nichts erzählen.«
»Ganz recht, verdammt noch mal. Denn es gibt nichts zu erzählen.« Er wischte sich die Hand an seinem Hemd ab und trat einen Schritt zurück. Sein Blick ging kurz nach unten, er begutachtete den Preis ihres geschwollenen Handgelenks nicht, sondern berechnete ihn. Er wusste, sie würde ihren Eltern nichts verraten. Sie würden ihr höchstens vorwerfen, dass sie das Haus verlassen hatte, obwohl sie ihr befohlen hatten, sich zu verstecken. »Geh nach Hause, bevor dir etwas wirklich Schlimmes zustößt.«
Emily trat zur Seite, damit er in den Wagen steigen konnte. Der Motor tuckerte einmal, dann noch einmal, dann sprang er an. Die Musik von der Kassette war wieder zu hören.
S-A-T-U-R-D-A-Y …
Emily hielt ihr geschwollenes Handgelenk, während die abfahrenden Reifen quietschend Haftung suchten. Dean ließ sie in einer Qualmwolke aus verbranntem Gummi zurück. Der Geruch war stechend, aber sie blieb stehen, wo sie war, die nackten Füße klebten am heißen Asphalt. Das linke Handgelenk pochte im Takt ihres Pulsschlags, die rechte Hand lag auf dem Bauch. Sie stellte sich vor, wie die schnellen Pulsschläge, die sie im Ultraschall gesehen hatte, mit ihrem eigenen Herzschlag Schritt hielten.
Sie hatte alle Ultraschallbilder an ihren Badezimmerspiegel geklebt, weil sie glaubte, dass man das von ihr erwartete. Die Aufnahmen zeigten, wie sich der winzige bohnenförmige Klecks langsam entwickelte – wie Augen und eine Nase sprossen, dann Finger und Zehen.
Sie sollte eigentlich etwas empfinden, oder?
Anschwellende Gefühle? Eine unmittelbare Verbundenheit? Ein Gefühl von Ehrfurcht und Erhabenheit?
Stattdessen hatte sie Angst empfunden. Sie hatte die Bürde der Verantwortung gespürt, und schließlich war aus diesem Gefühl der Verantwortung etwas Greifbares entstanden: ein Zielbewusstsein.
Emily wusste, wie schlechte Eltern aussahen. Jeden Tag – oft mehrmals täglich – versprach sie ihrem Kind, dass sie die wichtigsten Pflichten einer Mutter erfüllen würde.
Jetzt sprach sie die Worte zur Erinnerung laut aus.
»Ich werde dich beschützen. Niemand wird dir jemals wehtun. Du wirst immer sicher sein.«
Zu Fuß dauerte es noch einmal eine halbe Stunde bis in die Stadt. Ihre bloßen Füße fühlten sich zuerst versengt an, dann so, als hätte man von ihnen die Haut abgezogen, und schließlich völlig taub, als sie die Strandpromenade aus weißem Zedernholz überquerte. Der Atlantik lag zu ihrer Rechten, die Wellen scharrten über den Sand, wenn die Ebbe sie zurückholte. Die im Dunkel liegenden Schaufenster zu ihrer Linken spiegelten die Sonne auf ihrer langsamen Bahn über die Delaware Bay. Sie stellte sich vor, wie sie über Annapolis hinwegzog, dann über Washington, dann durch den Shenandoah-Nationalpark, wo sie sich auf ihre Reise nach Westen vorbereitete – und das alles, während Emily sich über die immer gleiche Tretmühle von Strandpromenade schleppte, die sie wahrscheinlich für den Rest ihres Lebens entlanglaufen würde.
Letztes Jahr um diese Zeit hatte Emily den Foggy Bottom Campus der George-Washington-Universität erkundet. Bevor alles so prächtig aus dem Ruder gelaufen war. Bevor sich das Leben, wie sie es kannte, unwiderruflich verändert hatte. Bevor sie das Recht auf Hoffnung verloren hatte, ganz zu schweigen von Träumen.
Der Plan hatte folgendermaßen ausgesehen: Als eine Art Familienerbe wäre ihre Aufnahme an der GWU reine Formsache. Sie würde ihre Collegezeit eingebettet zwischen dem Weißen Haus und dem Kennedy Center verbringen. Sie würde ein Praktikum bei einem Senator machen. Dann in die Fußstapfen ihres Vaters treten und Politikwissenschaft studieren. Dann in die Fußstapfen ihrer Mutter treten und in Harvard Jura studieren, dann fünf Jahre in einer angesehenen Wirtschaftskanzlei arbeiten, danach ein Staatsrichteramt erhalten und schließlich vielleicht noch eines als Bundesrichterin.
Was würde deine Mutter sagen?
»Dein Leben ist vorbei!« Das hatte ihre Mutter geschrien, als Emilys Schwangerschaft offensichtlich geworden war. »Niemand wird dich mehr respektieren!«
Das Komische dabei war: Wenn sie auf die letzten Monate zurückblickte, hatte ihre Mutter recht behalten.
Emily verließ die Promenade und bog in die lange dunkle Gasse zwischen dem Süßwarenladen und der Hotdogbude ein, überquerte den Beach Drive und fand sich schließlich auf dem Royal Cove Way wieder. Mehrere Autos fuhren vorbei, einige bremsten ab, um einen Blick auf das verdreckte Strandgut in dem leuchtend türkisfarbenen Ballkleid zu werfen. Emily rieb sich die Arme, es war kühl. Sie hätte nicht in einer derart schreienden Farbe ausgehen sollen. Sie hätte sich nicht für ein trägerloses Kleid entscheiden sollen. Sie hätte es ändern lassen sollen, damit ihr wachsender Körper darin Platz fand.
Aber bis gerade eben war ihr keine dieser fabelhaften Ideen in den Sinn gekommen, und deshalb quollen ihre angeschwollenen Brüste aus dem Oberteil, und ihre Hüften schwangen hin und her wie das Pendel an einer Standuhr.
»Hey, du heiße Nummer!«, schrie ein Junge aus dem offenen Fenster eines Mustangs. Seine Freunde hatten sich auf den Rücksitz gequetscht. Aus einem Fenster ragte ein Bein. Sie roch Bier, Gras und Schweiß.
Emily legte die Hand auf ihren runden Bauch, als sie über den Schulhof ging. Sie dachte an das Kind, das in ihr heranwuchs. Zunächst war es ihr nicht real erschienen, dann war es wie ein Anker gewesen. Erst in letzter Zeit fühlte es sich wie ein menschliches Wesen an.
Ihr menschliches Wesen.
»Emmie?«
Sie drehte sich um und war verblüfft, Blake verborgen im Schatten eines Baums zu entdecken. Er hielt die Hand über eine Zigarette gewölbt. Überraschenderweise war er für den Ball gekleidet. Seit der Grundschule hatten sie alle gelästert, dass Bälle und Tanzveranstaltungen nichts als Festivitäten für aufgedonnerte Proleten seien, die sich an die wahrscheinlich besten Abende ihres armseligen Lebens klammerten. Nur Blakes formeller schwarzer Smoking unterschied ihn von dem strahlenden Weiß und den Pastelltönen, die sie an anderen Typen in den vorbeifahrenden Autos gesehen hatte.
Sie räusperte sich. »Was machst du hier?«
Er grinste. »Wir dachten, es könnte Spaß machen, sich aus nächster Nähe über die Prolls lustig zu machen.«
Sie sah sich nach Clay, Nardo und Ricky um, denn die vier waren eigentlich immer im Rudel unterwegs.
»Die anderen sind drinnen«, sagte er. »Bis auf Ricky. Sie verspätet sich.«
Emily wusste nicht, was sie sagen sollte. Danke erschien ihr nicht angemessen angesichts der Tatsache, dass Blake sie bei ihrem letzten Gespräch als dummes Miststück bezeichnet hatte.
Sie wandte sich zum Gehen und murmelte nur ein flüchtiges »Bis dann«.
»Em?«
Sie blieb nicht stehen und drehte sich nicht um, denn er hatte zwar recht damit, dass sie ein Miststück sein konnte, aber Emily war nicht dumm.
Musik hämmerte aus den offenen Türen der Sporthalle. Sie spürte den Bass in ihren Backenzähnen vibrieren, als sie über den Hof ging. Das Ballkomitee hatte sich offenbar für das Thema »Romance by the Sea« entschieden, was so traurig wie vorhersehbar war. Papierfische in Regenbogenfarben flitzten zwischen Reihen blauer Luftschlangen umher. Keiner davon war ein Longbill, der Fisch, nach dem die Stadt benannt war, aber wer war sie schon, das Komitee zu korrigieren? Sie war nicht einmal mehr Schülerin hier.
»Lieber Himmel«, sagte Nardo. »Du hast vielleicht Nerven, in dem Zustand hier aufzutauchen.«
Er stand seitlich neben dem Eingang, an genau dem Ort, an dem sie ihn erwartet hätte. Der gleiche schwarze Smoking wie Blake, aber mit einem ISHOTJ.R.-Anstecker am Revers, um deutlich zu machen, dass er in den Scherz eingeweiht war. Er bot Emily einen Schluck aus einer halb vollen Flasche hochprozentigem Alkohol mit Kirschlimonade an.
Sie schüttelte den Kopf. »Ich hab das Trinken für die Fastenzeit aufgegeben.«
Er lachte schallend und schob die Flasche in seine Jackentasche. Sie sah, dass die Naht vom Gewicht des Fusels bereits eingerissen war. Eine selbst gedrehte Zigarette steckte hinter seinem Ohr. Emily erinnerte sich an etwas, was ihr Vater nach seiner ersten Begegnung mit Nardo über ihn gesagt hatte …
Der Junge wird im Gefängnis enden oder an der Wall Street, aber nicht in dieser Reihenfolge.
»So.« Nardo nahm die Zigarette in die Hand und suchte nach seinem Feuerzeug. »Was führt ein schlimmes Mädchen wie dich an einen netten Ort wie diesen?«
Emily verdrehte die Augen. »Wo ist Clay?«
»Wieso, hast du ihm etwas zu sagen?« Er zog die Augenbrauen hoch, während er demonstrativ auf ihren Bauch starrte.
Emily wartete, bis seine Zigarette brannte. Sie rieb sich mit der heilen Hand über den Bauch wie eine Hexe über eine Kristallkugel. »Was, wenn ich dir etwas zu sagen habe, Nardo?«
»Verdammt«, knurrte er und warf einen nervösen Blick hinter sie, wo sich etliche Neugierige versammelt hatten. »Das ist nicht komisch, Emily.«
Sie rollte wieder mit den Augen. »Wo ist Clay?«
»Zum Teufel, ich weiß es nicht.« Er wandte sich von ihr ab und täuschte Interesse an einer weißen Stretchlimousine vor, die auf den Parkplatz fuhr.
Emily ging in die Sporthalle, weil sie wusste, dass Clay sich irgendwo in der Nähe der Bühne aufhalten würde, wahrscheinlich umringt von einer Schar schlanker, schöner Mädchen. Ihre Fußsohlen nahmen die niedrigere Temperatur wahr, als sie über den polierten Holzboden lief. Das Strandthema der Party setzte sich im Gebäude fort. Ballons stießen an die Balken der hohen Decke, bereit, zum Ende der Nacht herabzusinken. Große runde Tische waren mit Tafelaufsätzen passend zur Meeresthematik geschmückt, vereint mit Muscheln und leuchtend rosa Pfirsichblüten.
»Schau mal«, sagte jemand. »Was macht die denn hier?«
»Verdammt.«
»Die hat vielleicht Nerven …«
Emily hielt den Blick geradeaus gerichtet. Die Band richtete sich gerade auf der Bühne ein, aber eine Schallplatte lief, um die Stille zu füllen. Emilys Magen knurrte, als sie an den Tischen mit dem Büfett vorbeikam. Der widerlich süße Sirup, der sich als Bowle ausgab. Sandwiches, dick mit Wurst und Käse belegt. Toffee, das von der Touristensaison des Vorjahrs übrig war. Metallbehälter mit schlaffen Pommes frites. Würstchen im Blätterteigmantel. Krabbenküchlein. Kekse und Kuchen.
Emily hielt auf ihrem Weg zur Bühne inne. Die Geräusche der Menge waren verstummt. Alles, was sie hörte, war das Echo von Rick Springfield, der sie warnte, nicht mit Fremden zu sprechen.
Leute starrten sie an. Betreuer. Eltern. Ihre Kunstlehrerin, die ihr bemerkenswerte Fähigkeiten bescheinigt hatte. Ihr Englischlehrer, der Ich bin beeindruckt! auf ihre Arbeit über Virginia Woolf geschrieben hatte. Ihr Geschichtslehrer, der Emily versprochen hatte, sie würde die Chefanklägerin beim diesjährigen Übungsprozess sein.
Bis …
Emily hielt sich gerade, als sie auf die Bühne zuging, ihr Bauch ragte vor wie der Bug eines Ozeandampfers. Sie war in dieser Stadt aufgewachsen, hatte die lokalen Schulen besucht, war zur Kirche gegangen, ins Ferienlager, auf Exkursionen, Wanderungen und zu Übernachtungen bei Freundinnen. Das hier waren ihre Klassenkameraden gewesen, ihre Nachbarn, ihre Mitpfadfinderinnen, Labor- und Lernpartner, die Kids, mit denen sie sich herumgetrieben hatte, wenn Clay mit Nardos Familie nach Italien reiste und Ricky und Blake ihrem Großvater im Diner aushalfen.
Und jetzt …
Alle ihre ehemaligen Freundinnen wichen zurück, als wäre das, was Emily hatte, ansteckend. Sie waren solche Heuchler. Sie hatte das getan, was alle taten oder gern getan hätten, aber sie hatte das Pech gehabt, dabei erwischt zu werden.
»Lieber Himmel!«, flüsterte jemand.
»Ungeheuerlich!«, sagte ein Elternteil.
Ihre Vorhaltungen schmerzten nicht mehr. Dean Wexler in seinem beschissenen zweifarbigen Chevy hatte die letzte Schicht von Scham abgelöst, die Emily wegen ihrer Schwangerschaft je empfunden hatte. Sie erschien nur deshalb falsch, weil diese voreingenommenen Arschlöcher sich einredeten, dass sie falsch war.
Sie blendete das Getuschel aus und wiederholte lautlos die Versprechen an ihr Baby …
Ich werde dich beschützen. Niemand wird dir je wehtun. Du wirst immer sicher sein.
Clay lehnte an der Bühne und wartete mit verschränkten Armen auf sie. Er trug den gleichen schwarzen Smoking wie Blake und Nardo. Oder wahrscheinlich trugen sie eher das Modell, das Clay sich ausgesucht hatte. So war es immer gewesen bei den Jungs. Was Clay auch tat, der Rest folgte ihm.
Er sagte nichts, als Emily vor ihm stehen blieb, sondern hob nur erwartungsvoll eine Augenbraue. Sie bemerkte, dass er trotz seiner Verachtung für Cheerleader von ihnen umzingelt war. Der Rest der Gruppe redete sich wahrscheinlich ein, dass sie den Ball nur aus Ironie besuchten. Nur Clay wusste, dass sie zur Feier kamen, damit eine von ihnen ihn ins Bett kriegte.
Rhonda Stein, die Anführerin der Cheerleader, ergriff das Wort, als es sonst niemand tat. »Was macht die denn hier?«
Sie hatte Emily angesehen, aber die Frage an Clay gerichtet.
Eins von den anderen Mädchen sagte: »Vielleicht ist das so wie in Carrie.«
»Hat jemand Schweineblut mitgebracht?«
»Wer wird sie krönen?«
Es gab nervöses Gelächter, aber alle warteten darauf, dass Clay den Ton vorgab.
Er holte tief Luft, ehe er langsam ausatmete. Dann zuckte er beiläufig eine Schulter. »Ist ein freies Land.«
Emilys Kehle war rau, als sie schluckte. Wenn sie sich diesen Abend vorgestellt hatte, wenn sie sich beim Gedanken an den kollektiven Schock ergötzt und in der Geschichte geschwelgt hatte, die sie ihrer Tochter erzählen würde, die Geschichte von ihrer Mutter, der radikalen, unkonventionellen Verführerin, die es gewagt hatte, schwanger auf ihrem Abschlussball zu tanzen, dann hatte Emily mit jeder Gefühlsregung gerechnet, nur nicht mit der einen, die sie jetzt empfand: nämlich Erschöpfung. Sie fühlte sich geistig wie körperlich nur noch imstande, kehrtzumachen und den Weg zurückzugehen, den sie gekommen war.
Was sie dann auch tat.
Die Menge teilte sich immer noch vor ihr, aber die Stimmung war deutlich in Richtung Mistgabeln und scharlachrote Buchstaben umgeschwenkt. Jungs bleckten wütend die Zähne. Mädchen wandten ihr buchstäblich den Rücken zu. Sie sah Eltern und Lehrer angewidert den Kopf schütteln. Was treibt sie hier? Warum verdirbt sie allen anderen den Abend? Isebel. Hure. Sie hat es sich selbst zuzuschreiben. Was bildet sie sich ein? Sie wird das Leben eines armen Jungen ruinieren.
Emily wurde erst bewusst, wie drückend die Luft in der Sporthalle war, als sie sicher im Freien angelangt war. Nardo lauerte nicht mehr neben der Tür. Blake hatte sich in einen anderen Schatten verdrückt. Ricky war, wo sie in solchen Momenten immer war, nämlich nicht da, wo man sie gebraucht hätte.
»Emily?«
Sie drehte sich um und war überrascht, Clay vor sich stehen zu sehen. Er war ihr aus der Sporthalle gefolgt – wo doch Clayton Morrow nie jemandem folgte.
»Was tust du hier?«, fragte er.
»Ich haue gerade ab«, sagte sie. »Los, geh wieder hinein zu deinen Freunden.«
»Zu diesen Losern?« Er verzog den Mund. Sein Blick ging an ihr vorbei und folgte etwas, was sich viel zu schnell bewegte, als dass es ein Mensch sein könnte. Er liebte es, Vögel zu beobachten. Das war der heimliche Nerd in Clay. Er las Henry James und liebte Edith Wharton, er bekam glatte Einser in Infinitesimalrechnung, dafür konnte er nicht erklären, was ein Freiwurf war oder wie man einen Fußball anschnitt, aber das interessierte niemanden, weil er so verdammt hinreißend war.
»Was willst du, Clay?«, fragte Emily.
»Du bist doch hier aufgetaucht und hast nach mir gesucht.«
Sie fand es merkwürdig, dass Clay annahm, sie sei seinetwegen gekommen. Emily hatte nicht erwartet, einen von der Clique auf dem Ball anzutreffen. Sie hatte den Rest der Schule beschämen wollen, weil sie geschnitten wurde. Wenn sie ehrlich war, hatte sie gehofft, Mr. Lampert, der Direktor, würde Chief Stilton anrufen und sie verhaften lassen. Dann müsste man eine Kaution für sie hinterlegen, ihr Vater wäre stinkwütend und ihre Mutter …
»Mist«, murmelte Emily. Vielleicht ging es bei der Sache hier ja doch um ihre Mutter.
»Emily?«, fragte Clay. »Komm schon. Warum bist du hier? Was willst du von mir?«
Er wollte keine Antwort. Er wollte Absolution.
Aber Emily war nicht seine Seelsorgerin. »Geh wieder hinein und amüsier dich, Clay. Reiß eine von den Cheerleadern auf. Geh aufs College. Such dir einen tollen Job. Spazier durch all die Türen, die dir immer offenstehen. Genieß den Rest deines Lebens.«
»Warte …« Seine Hand lag auf ihrer Schulter, ein Steuerruder, das sie wieder in seine Richtung lenkte. »Du bist unfair.«
Sie sah in seine klaren blauen Augen. Dieser Moment war bedeutungslos für ihn – eine unangenehme Begegnung, die später wie ein Wölkchen Rauch aus seiner Erinnerung verschwinden würde. In zwanzig Jahren würde Emily nichts weiter als eine anhaltende Quelle des Unbehagens sein, wenn er seinen Briefkasten öffnete und eine Einladung zu einem Klassentreffen der Highschool vorfand.
»Mein Leben ist unfair«, sagte sie. »Dir geht es gut, Clay. Dir geht es immer gut. Dir wird es auch immer gut gehen.«
Er seufzte schwer. »Ich hoffe, du entpuppst dich nicht als eine dieser langweiligen, verbitterten Frauen, Emily. Das fände ich wirklich sehr schade für dich.«
»Lass Chief Stilton nicht hören, was du hinter halb geschlossenen Türen treibst, Clayton.« Sie stellte sich auf die Zehenspitzen, damit sie die Angst in seinen Augen sehen konnte. »Das fände ich wirklich sehr schade für dich.«
Eine Hand schoss vor und packte sie am Hals. Die andere war zur Faust geballt und holte aus. Wut verdunkelte seine Augen. »Du bringst dich noch selbst ins Grab, du verdammte Fotze.«
Emily schloss die Augen und wartete auf den Schlag, aber alles, was sie hörte, war nervöses Gelächter.
Sie öffnete die Augen ein wenig.
Clay ließ sie los. Er war nicht so dumm, ihr vor Zeugen etwas anzutun.
Der wird im Weißen Haus enden, hatte ihr Vater gesagt, als er Clay zum ersten Mal begegnet war. Falls er nicht am Galgen landet.
Emily hatte ihre Handtasche fallen lassen, als er sie packte. Clay hob sie auf, wischte den Schmutz ab und reichte sie ihr wie ein Kavalier.
Sie riss sie ihm aus der Hand.
Diesmal folgte Clay Emily nicht, als sie sich entfernte. Sie kam an mehreren Gruppen von Ballbesuchern mit Reifröcken und Kleidung in unterschiedlichen Pastelltönen vorbei. Die meisten blieben nur stehen und starrten sie mit offenem Mund an, aber sie fing ein warmes Lächeln von Melody Brickel auf, ihrer früheren Freundin bei den Orchesterproben, und es bedeutete ihr viel.
Emily wartete auf das Ampelsignal, um die Straße zu überqueren. Es gab diesmal keine anzüglichen Zurufe, auch wenn ein weiteres Auto voller Jungs bedrohlich langsam vorbeifuhr.
»Ich werde dich beschützen«, flüsterte sie der kleinen Passagierin zu, die in ihr heranwuchs. »Niemand wird dir jemals wehtun. Du wirst immer sicher sein.«
Endlich schaltete die Ampel um. Die Sonne versank am Horizont und warf einen langen Schatten am Ende des Fußgängerüberwegs. Emily hatte sich immer gut aufgehoben gefühlt, wenn sie allein in der Stadt unterwegs war, aber jetzt hatte sie Gänsehaut an den Armen. Ihr war nicht wohl bei dem Gedanken, wieder durch die Gasse zwischen dem Süßwarenladen und der Hotdogbude zu gehen. Ihre Füße schmerzten von dem mörderischen Spaziergang. Auch ihr Hals schmerzte, wo Clay sie gepackt hatte. Ihr Handgelenk pochte immer noch, als ob es entweder gebrochen oder böse verstaucht wäre. Sie hätte nicht hierherkommen sollen. Besser, sie wäre zu Hause geblieben und hätte Omi Gesellschaft geleistet, bis es Zeit zum Abendessen war.
»Emmie?« Schon wieder Blake, er trat wie ein Vampir aus dem Schatten des Hotdogstands. »Bist du okay?«
Sie spürte, wie sie etwas von ihrem Schwung verlor. Schon länger hatte sie niemand mehr gefragt, ob sie okay wäre. »Ich muss nach Hause.«
»Em …« Er würde sie nicht so einfach weitergehen lassen. »Es ist nur … Geht es dir wirklich gut? Es ist nämlich verrückt, dass du hier bist. Es ist verrückt, dass wir alle hier sind, aber besonders weil … Na ja, deine Schuhe. Die sind anscheinend verschwunden.«
Sie blickten beide auf ihre nackten Füße hinunter.
Emily lachte laut auf, es hallte wie eine Glocke durch ihren Körper. Sie lachte so heftig, dass ihr der Bauch wehtat. Sie lachte, bis sie nicht mehr aufrecht stehen konnte.
»Emmie?« Blake legte ihr die Hand auf die Schulter. Bestimmt dachte er, dass sie den Verstand verloren hatte. »Soll ich deine Eltern anrufen oder …«
»Nein.« Sie richtete sich auf und wischte sich über die Augen. »Es tut mir leid. Mir ist nur eben klar geworden, dass ich buchstäblich barfuß und schwanger bin.«
Blake lächelte widerstrebend. »War das Absicht?«
»Nein. Ja?«
Sie wusste es wirklich nicht. Vielleicht stellte ihr Unterbewusstsein komische Sachen mit ihr an. Vielleicht steuerte das Baby ihre Hormone. Sie wollte gern an eine der beiden Erklärungen glauben, denn die dritte Möglichkeit – dass sie nämlich komplett verrückt war – wäre eine unliebsame Entwicklung gewesen.
»Es tut mir leid«, sagte Blake, aber seine Entschuldigungen klangen immer hohl, weil er immer wieder dieselben Fehler machte. »Was ich früher gesagt habe. Nicht vorhin, sondern viel früher. Ich hätte es nicht sagen sollen … Ich meine, es war falsch zu sagen …«
Emily wusste genau, wovon er sprach. »Dass ich es im Klo runterspülen soll?«
Er wirkte beinahe so perplex, wie Emily es gewesen war, als er ihr vor Monaten diesen Vorschlag gemacht hatte.
»Das … ja. Das hätte ich nicht sagen sollen.«
»Nein, das hättest du nicht.« Es schnürte Emily die Kehle zu, denn die Wahrheit war, dass es nie ihre Entscheidung gewesen war. Ihre Eltern hatten sie getroffen. »Ich muss …«
»Lass uns irgendwohin gehen und …«
»Verdammt!« Sie riss ihr lädiertes Handgelenk aus seinem Griff. Ihr Fuß trat auf eine Unebenheit am Gehweg. Sie stolperte und klammerte sich noch im Fallen erfolglos an Blakes Smokingjacke, ehe sie mit dem Steißbein auf den Asphalt krachte. Der Schmerz war grausig. Sie rollte sich zur Seite. Zwischen ihren Beinen sickerte Nässe hervor.
Das Baby.
»Emily!« Blake fiel neben ihr auf die Knie. »Alles okay mit dir?«
»Geh weg!«, flehte sie, obwohl sie seine Hilfe brauchte, um aufzustehen. Ihre Handtasche war bei dem Sturz kaputtgegangen; der Samtstoff war aufgerissen. »Blake, bitte geh einfach. Du machst alles nur noch schlimmer! Wieso machst du alles immer noch schlimmer?«
In seinen Augen blitzte Schmerz auf, aber sie konnte sich jetzt nicht seinetwegen sorgen. Tausend Möglichkeiten, wie ein so heftiger Sturz womöglich ihrem Kind geschadet haben könnte, schossen ihr durch den Kopf.
»Ich wollte nicht …«, sagte er.
»Natürlich wolltest du es nicht!«, brüllte sie. Er war derjenige, der immer noch Gerüchte verbreitete. Er war es, der Ricky dazu drängte, so grausam zu sein. »Du wolltest nie irgendetwas, oder? Es ist nie deine Schuld, du baust nie Mist, du bist nie verantwortlich. Aber weißt du was? Das ist sehr wohl deine Schuld. Du hast bekommen, was du wolltest. Es ist alles, verdammt noch mal, deine Schuld!«
»Emily …«
Sie stolperte und konnte sich gerade noch an der Ecke des Süßwarenladens abstützen. Sie hörte Blake etwas sagen, aber in ihren Ohren schrillte ein hoher Schrei.
War es ihr Baby? Schrie es um Hilfe?
»Emmie?«
Sie stieß ihn weg und stolperte die Gasse entlang. Heiße Flüssigkeit tropfte an den Innenseiten ihrer Schenkel hinab. Sie presste die Handfläche an die rauen Ziegel, um zu verhindern, dass sie auf die Knie fiel. Ein Schluchzen steckte in ihrer Kehle fest. Sie öffnete den Mund, um tief einzuatmen. Salzige Luft brannte in ihrer Lunge. Die Sonne, die von der Promenade reflektiert wurde, blendete sie. Sie trat in die Dunkelheit zurück und lehnte sich an die Mauer der Gasse.
Emily warf einen Blick hinaus auf die Straße. Blake hatte sich verdrückt. Niemand konnte sie sehen.
Sie raffte ihr Kleid hoch und hielt den Stoff mit dem verletzten Arm fest. Mit der gesunden Hand griff sie sich zwischen die Beine. Sie hatte damit gerechnet, Blut an ihren Fingern zu sehen, aber da war nichts. Sie roch an ihrer Hand.
»Oh«, flüsterte sie.
Sie hatte sich eingenässt.
Emily lachte wieder, aber diesmal unter Tränen. Die Erleichterung machte sie ganz schwach in den Knien, sodass sie zu Boden sank. Ihr Steißbein schmerzte, aber es kümmerte sie nicht. Sie war erschreckenderweise überglücklich, dass sie sich vollgepinkelt hatte. Die dunklen Orte, die ihr Gehirn aufgesucht hatte, als sie annahm, Blut würde zwischen ihren Beinen hervorströmen, waren heller beleuchtet gewesen als jedes Ultraschallbild, das sie sich an den Spiegel kleben konnte.
In diesem Moment hatte sich Emily verzweifelt gewünscht, dass ihr Baby wohlauf war. Nicht aus Pflichtgefühl. Ein Baby war mehr als eine Verantwortung. Es war eine Gelegenheit, jemanden so zu lieben, wie sie selbst nie geliebt worden war.
Und zum ersten Mal in dieser ganzen Geschichte voller Scham, Demütigung und Hilflosigkeit wusste Emily Vaughn zweifelsfrei, dass sie dieses Baby liebte.
»Es sieht nach einem Mädchen aus«, hatte der Arzt bei der letzten Untersuchung gesagt.
Damals hatte Emily die Neuigkeit nur als weiteren Schritt in dem ganzen Prozess abgehakt, aber jetzt ließ die Erkenntnis den Damm brechen, der ihre Gefühle so lange zurückgestaut hatte.
Ihr Mädchen.
Ihr winziges, kostbares kleines Mädchen.
Emily war so kraftlos vor Erleichterung, dass sie umgekippt wäre, hätte sie nicht bereits auf dem kalten Boden gesessen. Sie ließ den Kopf auf die Knie sinken. Große, dicke Tränen kullerten ihr über die Wangen. Ihr Mund stand offen, doch ihre Brust war so erfüllt von Liebe, dass sie keinen Laut hervorbrachte. Sie presste die Handfläche auf den Bauch und stellte sich vor, dass eine kleine Hand von der anderen Seite dagegendrückte. Ihr Herz machte einen Sprung, als sie daran dachte, dass sie eines Tages diese winzigen Fingerspitzen küssen würde. Omi hatte gesagt, dass jedes Baby einen besonderen Geruch hatte, den nur die Mutter erkannte. Emily wollte diesen Geruch kennen. Sie wollte in der Nacht aufwachen und dem raschen Ein- und Ausatmen des wunderschönen Mädchens lauschen, das in ihrem Bauch herangewachsen war.
Sie wollte Pläne schmieden.
In zwei Wochen wurde Emily achtzehn Jahre alt. In weiteren zwei Monaten wurde sie Mutter. Sie musste sich eine Arbeit suchen und bei ihren Eltern ausziehen. Omi würde es verstehen, und was sie nicht verstand, würde sie vergessen. Dean Wexler hatte in einem Punkt recht: Emily musste erwachsen werden. Sie durfte von jetzt an nicht mehr nur an sich selbst denken. Sie musste Longbill Beach verlassen und anfangen, ihre Zukunft zu planen, statt sie von anderen Leuten planen zu lassen. Noch wichtiger war: Sie würde ihrem kleinen Mädchen all das geben, was sie selbst nie gehabt hatte.
Güte. Verständnis. Geborgenheit.
Emily schloss die Augen. Sie beschwor das Bild ihres Babys herauf, das fröhlich in ihrem Bauch herumschwamm. Sie holte tief Luft und begann ihr Mantra, diesmal aus tiefer Liebe, nicht aus Pflichtgefühl.
»Ich werde dich beschützen …«
Ein lautes Krachen, und sie riss die Augen auf.
Emily sah schwarze Lederschuhe, schwarze Socken, den Saum einer schwarzen Hose. Sie blickte auf. Die Sonne wurde kurz verdeckt, als ein Knüppel durch die Luft schwang.
Ihr Herz ballte sich zur Faust. Sie war plötzlich, unausweichlich von Angst erfüllt.
Nicht um sich selbst – um ihr Baby.
Emily beugte sich vor, die Arme um den Bauch geschlungen, die Beine angezogen, und so fiel sie zur Seite. Sie wünschte sich verzweifelt einen weiteren Moment, einen weiteren Atemzug, damit die letzten Worte an ihr kleines Mädchen keine Lüge wären.
Irgendwer hatte immer beabsichtigt, ihnen wehzutun.
Sie waren nie sicher gewesen.
GEGENWART
1
Andrea Oliver versuchte das Rumoren in ihrem Magen zu unterdrücken, während sie den Waldweg entlangrannte. Die Sonne brannte auf ihre Schultern. Nasse Erde sog an ihren Schuhen. Der Schweiß hatte ihr Shirt in Frischhaltefolie verwandelt, die an ihrer Haut haftete. Ihre Wadenmuskeln waren wie Banjosaiten, die bei jedem harten Aufsetzen ihrer Fersen klirrten. Sie hörte Stöhnen hinter sich, von den Nachzüglern, die sich zwangen, Schritt zu halten. Vor ihr waren die Streber, die Typ-A-Persönlichkeiten, die durch einen Bach voller Piranhas waten würden, wenn wenigstens ein Prozent Wahrscheinlich bestand, dass sie das Ziel als Erste erreichten.
Sie gab sich damit zufrieden, mit der Masse des Rudels anzukommen, weder Trödlerin noch Topathletin, was schon eine Leistung für sich war. Vor zwei Jahren wäre Andrea mit Sicherheit weit hinten gelegen oder hätte sogar noch geschlafen, während der Wecker zum fünften oder sechsten Mal schrillte. Ihre Klamotten hätten verstreut in der winzigen Wohnung über der Garage ihrer Mutter herumgelegen. Sämtliche ungeöffnete Schreiben auf ihrem Küchentisch wären mit FÄLLIGKEITÜBERSCHRITTEN gestempelt gewesen. Wäre sie dann endlich aus dem Bett gekrochen, hätte sie drei Nachrichten von ihrem Vater auf dem Handy gehabt, der sie bat, sich zu melden, weitere sechs von ihrer Mutter, die wissen wollte, ob sie von einem Serienkiller entführt worden war, und einen verpassten Anruf von der Arbeit, in dem man ihr mitteilte, dies sei die letzte Warnung, bevor sie gefeuert würde.
»Scheiße«, murmelte Paisley.
Andrea warf einen Blick über die Schulter, wo sich Paisley Spenser vom Rudel löste. Einer der Nachzügler war gestolpert. Thom Humphrey lag flach auf dem Rücken und starrte zu den Bäumen hinauf. Ein kollektives Stöhnen erfüllte den Wald. Die Regel lautete, wenn einer von ihnen nicht ins Ziel kam, mussten sie alle den Lauf wiederholen.
»Steh auf! Steh auf!«, schrie Paisley und lief zurück, um Thom entweder Mut zu machen oder ihn so lange zu treten, bis er aufstand. »Du schaffst es! Komm schon, Thom!«
»Los, Thom!«, brüllte der Rest.
Andrea presste die Laute hervor, aber sie traute sich nicht, den Mund zu öffnen. Ihr Magen schlingerte wie die Liegestühle auf der Titanic. Seit Monaten machte sie Sprints, Liegestütze und Burpees, kletterte Seile hinauf und lief täglich gefühlte sechzehntausend Kilometer, aber sie war immer noch ein Leichtgewicht. Galle schoss ihr in den Rachen. Sie biss die Zähne zusammen und ballte die Fäuste, als sie um die letzte Kurve bog. Sie war auf der Zielgeraden. Noch einmal fünf Minuten, und sie würde diesen aufreibenden Höllenkurs nie wieder laufen müssen.
Paisley flog vorbei, mit Vollgas zur Ziellinie. Thom hatte sich wieder eingegliedert. Die Läuferreihe rückte zusammen. Alle gaben ihr Letztes.
Andrea hatte nichts mehr zu geben. Sie wusste, sie würde wahrscheinlich ihre Eingeweide auskotzen, wenn sie sich noch härter antrieb. Ihre Lippen teilten sich, um Luft einzusaugen, aber stattdessen schluckte sie nur eine Wolke Mücken. Sie hustete und verfluchte sich, denn sie hätte es besser wissen müssen. Sie hatte sich zwanzig Wochen lang im Trainingscenter der Bundespolizei in Glynn County, Georgia, abgerackert. Mit den Moskitos, Sandfliegen, Mücken, Waldschaben in der Größe von Ratten und Ratten in der Größe von Hunden und angesichts der Tatsache, dass das Trainingscenter mehr oder weniger mitten in einem Sumpf lag, hätte ihr klar sein müssen, dass sie lieber nicht Luft holen sollte.
Ein fernes Donnern drang an ihre Ohren. Sie konzentrierte sich auf ihre Füße, da es bergab ging. Der Donner verwandelte sich in ein markantes Stakkato aus Klatschen und Anfeuerungsrufen. Die Streber hatten die Ziellinie überquert. Sie wurden von Angehörigen bejubelt, die gekommen waren, um den Abschluss ihrer mörderischen, dantesken Tortur zu feiern, die offenbar dem Zweck diente, sie entweder umzubringen oder stärker zu machen.
»Heilige Scheiße«, murmelte Andrea aufrichtig erstaunt. Es hatte sie nicht umgebracht. Sie war nicht ausgestiegen. Monatelanges Schulbankdrücken, fünf bis acht Stunden Nahkampftraining täglich, Überlebenstechniken, Haftbefehlsvollstreckungen, Schießtraining und so viel Sport, dass sie vier Pfund Muskeln zugenommen hatte, und jetzt endlich, sie konnte es kaum glauben, war sie zwanzig Meter davon entfernt, eine Deputy beim United States Marshal Service zu werden.
Thom zog links an ihr vorbei, was so verdammt typisch für ihn war. Andrea mobilisierte ihren letzten Atem, nur um ihn zu ärgern. Ihr wurde schwindlig von dem Adrenalinstoß. Ihre Beine begannen zu pumpen. Sie überholte Thom und schloss zu Paisley auf. Die beiden grinsten einander triumphierend an – drei Leute waren in der ersten Woche ausgestiegen, weitere drei waren aufgefordert worden zu gehen, ein Typ war verschwunden, nachdem er einen rassistischen Witz gemacht hatte, ein zweiter, der handgreiflich geworden war. Sie und Paisley Spenser waren zwei von nur vier Frauen unter den achtundvierzig Teilnehmern des Lehrgangs. Noch wenige Schritte, und alles, was dann zu tun blieb, war der Gang zur Bühne und das Abholen ihrer Urkunde.
Paisley war eine Nasenlänge vor ihr, als sie die Ziellinie überquerten. Beide warfen jubelnd die Arme hoch. Paisleys riesige Großfamilie umringte sie lauthals kreischend. Ringsum sah Andrea ähnliche Freudenszenen und Umarmungen. In jedem einzelnen Gesicht stand ein Lächeln, mit Ausnahme von zweien.
Andreas Eltern.
Laura Oliver und Gordon Mitchell hatten die Arme verschränkt. Ihr Blick folgte Andrea, während Fremde ihr gratulierten und auf die Schulter klopften. Paisley boxte sie spielerisch gegen den Oberarm. Andrea boxte zurück und sah, wie Gordon sein Handy hervorholte. Sie lächelte, aber ihr Vater wollte Andreas bedeutsame Leistung gar nicht mit einem Foto würdigen. Er wandte ihr den Rücken zu und nahm einen Anruf entgegen.
»Gratuliere!«, brüllte jemand.
»Ich bin so stolz auf dich!«
»Gut gemacht!«
Lauras Mund war ein schmaler weißer Strich, als sie zusah, wie sich Andrea durch die Menge bewegte. Ihre Augen waren feucht, aber diesmal waren es keine Tränen des Stolzes, wie sie sie nach Andreas erster Schulaufführung oder nach dem Gewinn des Kunstpreises vergossen hatte.
Ihre Mutter war zutiefst niedergeschlagen.
Einer der Ausbildungsleiter bot Andrea einen Becher Gatorade an. Sie schüttelte den Kopf und trabte mit zusammengebissenen Zähnen auf die Reihe der leuchtend blauen Dixi-Klos zu. Statt eins auszuwählen, lief sie zur Rückseite eines Toilettencontainers und kotzte sich die Seele aus dem Leib.
»Verdammter Mist«, brachte sie verärgert hervor. Da hatte sie nun gelernt, wie man einen Bösewicht mit Fäusten und Füßen kampfunfähig machte, aber ihren schwachen Magen hatte sie nicht unter Kontrolle. Sie wischte sich mit dem Handrücken über den Mund. Vor ihren Augen verschwamm alles. Sie hätte das Gatorade mitnehmen sollen. Eines hatte sie gelernt in Glynco: nämlich wie wichtig es war, immer genug Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Und außerdem nie jemanden sehen zu lassen, wie man sich übergab, denn hier bekam man seinen Spitznamen für das ganze Berufsleben verpasst. Sie hatte nicht vor, ihr Leben als Kotz Oliver zu bestreiten.
»Andy?«
Sie drehte sich um und war nicht überrascht, dass ihre Mutter ihr eine Flasche Wasser anbot. Wenn Laura etwas beherrschte, dann unaufgefordert zu Hilfe zu eilen.
»Andrea«, verbesserte Andrea sie.
Laura verdrehte die Augen, denn Andrea hatte ihr die letzten zwanzig Jahre erzählt, dass sie Andy genannt werden wollte. »Andrea. Alles okay mit dir?«
»Ja, Mom. Alles okay.« Die Wasserflasche war eiskalt. Andrea presste sie an ihren Nacken. »Du könntest wenigstens so tun, als würdest du dich für mich freuen.«
»Das könnte ich«, räumte Laura ein. »Wie ist das Verfahren bei Erbrechen? Warten die Kriminellen, bis du damit fertig bist, bevor sie dich vergewaltigen und ermorden?«
»Sei nicht so eklig. Sie tun es vorher.« Andrea schraubte die Flasche auf. »Weißt du noch, was du mir vor zwei Jahren gesagt hast?«
Laura antwortete nicht.
»An meinem Geburtstag?«
Laura antwortete noch immer nicht, obwohl keine von ihnen Andreas einunddreißigsten Geburtstag je vergessen würde.
»Mom, du hast gesagt, ich soll meinen Kram auf die Reihe kriegen, aus deiner Garage ausziehen und endlich mein eigenes Leben leben.« Andrea streckte die Arme aus. »Und so sieht das aus.«
Laura brach endlich ihr Schweigen. »Ich habe, verdammt noch mal, nicht gesagt, du sollst zum Feind überlaufen.«
Andrea stieß mit der Zungenspitze an die Innenseite ihrer Wange. Vom vielen Zähnezusammenbeißen hatte sich eine Wulst in ihrem Mund gebildet. Sie hatte sich nie vor irgendwem übergeben. Nicht ein einziges Mal. Sie war die zweitkleinste Teilnehmerin des Kurses, gerade mal zwei Zentimeter größer als Paisley mit ihren eins siebzig. Beide wogen fünfzig Pfund weniger als der leichteste von den Kerlen, aber sie gehörten beide zu den besten zehn Prozent und waren soeben der Hälfte des Kurses davongerannt.
»Schätzchen, ist dieser ganze Marshal-Blödsinn etwa eine Art Vergeltung?«, fragte Laura. »Willst du mich dafür bestrafen, dass ich dich nicht eingeweiht habe?«
Nicht eingeweiht war leicht untertrieben, denn immerhin hatte Laura einunddreißig Jahre lang vor Andrea verborgen, dass ihr leiblicher Vater ein zum Massenmord entschlossener psychopathischer Sektenführer war. Ihre Mutter war sogar so weit gegangen, sich einen imaginären leiblichen Vater auszudenken, der angeblich bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen war. Andrea würde ihre Lügen wahrscheinlich immer noch glauben, wäre Laura nicht vor zwei Jahren in die Enge getrieben worden und gezwungen gewesen, endlich die Wahrheit zu sagen.
»Nun?«, fragte Laura.
Andrea hatte in den letzten beiden Jahren eine sehr harte Lektion gelernt, nämlich dass nichts zu sagen genauso verletzend sein konnte, wie alles zu sagen.
Laura seufzte schwer. Sie war es nicht gewohnt, diejenige zu sein, die manipuliert wurde. Sie stemmte die Hände in die Hüften und warf einen Blick zurück zur Menschenmenge, dann sah sie zum Himmel und wandte sich schließlich wieder Andrea zu. »Mein Liebes, dein Verstand funktioniert wirklich erstaunlich.«
Andrea füllte den Mund mit kaltem Wasser.
»Die Willenskraft und der innere Antrieb, die du bewiesen hast, um an diesen Punkt zu kommen, zeigen mir, dass du so gut wie jeden Job machen könntest, wenn du es willst. Und das gefällt mir sehr. Ich liebe dich für deinen Mumm und deine Entschlossenheit. Ich will, dass du tust, wofür du eine Leidenschaft entwickelst. Aber es darf nicht das hier sein.«
Andrea ließ das Wasser durch ihren Mund schwappen, ehe sie es ausspuckte. »In der Clownschule haben sie gesagt, dass meine Füße nicht groß genug sind.«
»Andy.« Laura stampfte frustriert mit dem Fuß auf. »Du hättest wieder auf die Kunstschule gehen oder Lehrerin werden können oder von mir aus sogar im Notrufcallcenter bleiben.«
Andrea trank einen großen Schluck Wasser. Die einunddreißigjährige Andrea hätte alles, was ihre Mutter sagte, für bare Münze genommen. Jetzt hörte sie nur Ratschläge, die in die Irre führten. »Also noch mehr Schulden, von verzogenen Kids umgeben sein oder älteren Mitbürgern zuhören, die darüber jammern, dass ihr Müll nicht abgeholt wurde, und das für neun Dollar die Stunde?«
Laura ließ sich nicht beirren. »Was ist mit deiner Kunst?«
»Wahnsinnig lukrativ.«
»Du liebst es zu zeichnen.«
»Die Bank liebt es, wenn ich mein Studiendarlehen zurückzahle.«
»Dein Vater und ich könnten helfen …«
»Welcher Vater?«
Das Schweigen zwischen ihnen nahm die Konsistenz von Trockeneis an.
Andrea trank das Wasser aus, während ihre Mutter sich neu sortierte. Dieser letzte Seitenhieb tat ihr leid. Gordon war ein unglaublicher Vater gewesen – und war es noch. Bis vor Kurzem war er der einzige Vater gewesen, den Andrea gekannt hatte.
»Gut.« Laura drehte das Uhrenarmband an ihrem Handgelenk. »Du solltest dich frisch machen. Die Abschlusszeremonie ist in einer Stunde.«
»Ich bin beeindruckt, dass du den Zeitplan kennst.«
»Andy …« Laura hielt inne. »Andrea. Ich habe den Eindruck, du läufst vor dir selbst weg. Als meintest du, zu einem anderen Menschen zu werden, wenn du an einem fremden Ort lebst und diesen verrückten, gefährlichen Job ausübst.«
Andrea wünschte sich verzweifelt, dass die Strafpredigt aufhörte. Mehr als irgendwer sonst hätte ihre Mutter das Bedürfnis verstehen müssen, sein Leben in Schutt und Asche zu legen, um aus den Trümmern etwas Sinnvolleres aufzubauen. Laura hatte sich mit einundzwanzig nicht einer gewalttätigen Sekte angeschlossen, weil ihr Leben vollkommen im Gleichgewicht gewesen war. Sie hatte auch nicht Andreas Vater an die Polizei verraten, weil sie ein Erweckungserlebnis hatte. Aber vor zwei Jahren war sie bei dem bloßen Gedanken ausgerastet, dass Andreas Leben in Gefahr war.
»Mom«, sagte Andrea. »Du solltest froh sein, dass ich drin bin.«
Laura wirkte aufrichtig verwirrt. »Wo drin?«
»Im System«, sagte Andrea mangels einer besseren Beschreibung. »Falls er je aus dem Gefängnis kommt, falls er je wieder versucht, sein Spiel mit uns zu treiben, werde ich den gesamten US Marshal Service hinter mir haben.«
»Er wird nicht aus dem Gefängnis kommen.« Laura schüttelte den Kopf, bevor Andrea zu Ende gesprochen hatte. »Und selbst wenn – wir können auf uns selbst aufpassen.«
Du kannst es, dachte Andrea. Das war das Problem. Als die Kacke am Dampfen war, hatte sich Laura als knallhart erwiesen, während Andrea in der Ecke kauerte wie ein Kind beim Versteckspiel. Sie würde sich nicht noch einmal so hilflos fühlen, falls – wenn – ihr Vater seine todbringende Aufmerksamkeit wieder auf sie richtete.
»Mein Schatz«, versuchte es Laura noch einmal. »Ich mag dich so, wie du jetzt bist. Ich liebe mein sensibles, künstlerisch begabtes, freundliches kleines Mädchen.«
Andrea kaute auf ihrer Unterlippe. Sie hörte weitere Rufe, als die letzten Nachzügler die Ziellinie überquerten. Leute, mit denen Andrea trainiert hatte. Die sie um volle zehn Minuten geschlagen hatte.
»Andrea, lass mich dir denselben unerbetenen Rat geben, den meine Mutter mir gegeben hat.« Laura sprach nie über ihre Familie, geschweige denn ihre Vergangenheit. Andreas ungeteilte Aufmerksamkeit war ihr sofort gewiss. »Ich war jünger, aber genau so, wie du jetzt bist. Ich ging jede Herausforderung im Leben an, als wäre sie eine Klippe, von der ich mich ständig stürzen musste.«
Ungern gab Andrea zu, dass ihr das bekannt vorkam.
»Ich hielt mich für so tapfer, so wagemutig«, sagte Laura. »Ich brauchte Jahre, um herauszufinden, dass man vollkommen die Kontrolle verliert, wenn man fällt. Man gibt sie einfach an die Schwerkraft ab.«
Andrea zwang sich zu einem Achselzucken. »Mir haben große Höhen nie etwas ausgemacht.«
»Fast genau dasselbe habe ich zu meiner Mutter gesagt.« Laura lächelte bei der Erinnerung. »Sie wusste, dass ich nicht auf etwas zulief. Ich lief vor etwas fort – hauptsächlich vor mir selbst. Und weißt du, was sie mir erwidert hat?«
»Ich denke, du wirst es mir gleich verraten.«
Laura lächelte immer noch, als sie Andreas Gesicht zärtlich mit beiden Händen umfasste. »Sie sagte: ›Wohin du auch gehst, du bist schon dort.‹«
Andrea konnte die Besorgnis in den Augen ihrer Mutter erkennen. Laura hatte Angst. Sie versuchte Andrea zu beschützen. Oder sie versuchte sie zu manipulieren – so wie sie es immer tat.
»Alle Achtung, Mom.« Andrea trat einen Schritt zurück. »Hört sich an, als hätte sie eine fantastische Großmutter abgegeben. Ich wünschte, ich hätte sie kennenlernen dürfen.«
Lauras gequälter Gesichtsausdruck zeigte an, dass der Hieb zu tief gegangen war. Das war neu für sie beide, dieses bösartige Hin und Her, das ihre Zungen in Rasierklingen verwandelte.
Andrea drückte leicht die Hand ihrer Mutter. Sie versöhnten sich nicht mehr mit Worten. Sie klatschten ein Pflaster auf die Wunde und ließen sie bis zum nächsten Mal schwären. »Ich geh mal besser Dad suchen.«
»Ja.« Laura kämpfte gegen die Tränen.