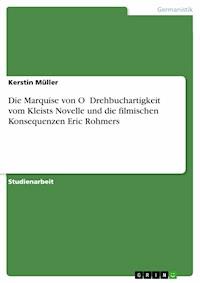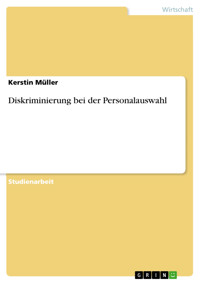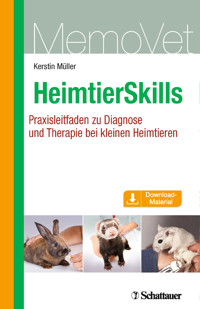Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit eigenen Erinnerungen und Anekdoten über die damaligen Verhältnisse begleitet man gern den Erzähler auf die Zeitreise zurück in die 70er Jahre. Geprägt war diese Zeit von der kommunistischen Ideologie und deren Umsetzung im sozialistischen Alltag. Die Autorin schreibt humorvoll und immer mit einem Augenzwinkern. Die Reise beginnt in einem alten maroden und herunter gekommenen Mietshaus. Nach Beschreibungen der einzelnen Mietparteien taucht man anschaulich in das damalige DDR-Leben ein um am Ende, nach vielen kleinen Alltagsgeschichten auch die politischen und marktwirtschaftlichen Probleme zu benennen. Die Autorin wählte absichtlich eine eher humorvolle Erzähl-weise um diesen Grau in Grau Ton, den viele Beschreibungen über das Leben der damaligen DDR vermitteln, eine wenig die Trostlosigkeit zu nehmen. Sie erinnert viel lieber an die schönen Erlebnisse dieser Zeit zurück denn jeder der dort aufgewachsen ist erkennt sich wieder. Aber auch Menschen die keinerlei Kenntnis über den sogenannten Arbeiter und Bauernstaat haben, können gut in die Geschichte mitgenommen werden und sich vielleicht sogar ein wenig amüsieren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 99
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kerstin Müller
Die verrückten 70er
Leben im Arbeiter- Bauernstaat von 1970 bis 1980
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Impressum neobooks
Kapitel 1
Karl-Marx-Stadt, Elisenstraße, 70er Jahre.
Meine Eltern und ich bewohnten eine kleine Zweiraumwohnung in der Elisenstraße.
Das Haus wirkte schon mit seiner maroden Außenfassade auf Mieter und Besucher bedrückend.
An fasst allen Mauerstellen nagte der Zerfall. Ständig lösten sich kleine Putzpartikel, die unaufhörlich auf dem Bürgersteig rieselten. So wurde dann allmählich immer mehr Ziegelwand sichtbar. Das große massive hölzerne Eingangstor schien der Einzige feste Halt dieser grauen Tristesse zu sein.
Im Hausflur wurde man erst einmal von einem ekelerregenden Gestank begrüßt, der von den zwei kleinen Holzbottichen für Essensabfälle herrührte. Auch die darauf befindlichen Deckel konnten den Geruch der Fäulnis nicht aufhalten. In den Sommermonaten war es ganz besonders schlimm,
weil dann ganze Scharen von Fliegen und Mücken um die Bottiche schwirrten.
Hatte man diese Hürde überwunden, befand man sich im Treppenhaus. Auch hier, nicht anders als draußen, bemerkte man wieder sofort den fortschreitenden Zerfall. Seit Anfang der 60er Jahre ist hier nicht viel gemacht worden. Man konnte aber noch eine gewisse Farbgestaltung alter Zeiten erahnen.
Solche heruntergekommenen Mietskasernen waren in der DDR keine Seltenheit. In den Stadtkernen wurde sich noch etwas Mühe gegeben denn schließlich wollte man die Touristen aus dem westlichen Ausland nicht abschrecken. Sie brachten harte Währung ins Land und waren wichtig für die Wirtschaft. Auch wenn das keiner zugeben wollte, schon gar nicht die Regierenden.
Die Vorzeigeobjekte wurden instand gehalten und das verursachte schon ungeheure Kosten. Da war es einfach nicht mehr möglich, an die vielen maroden Altbauten außerhalb der Stadtkerne zu denken. Dafür fehlte den Staat schlicht und ergreifend das Geld.
Außerdem mangelte es an allem Rohstoffe mussten mit harten Devisen eingekauft werden und dem zufolge,schlitterte das Land in eine katastrophale Misswirtschaft, die die Menschen immer unzufriedener werden ließ.
Unser Haus wurde von elf Mietparteien bewohnt, die ihre Toiletten jeweils eine Etage tiefer besuchen mussten, um ganz normalen menschlichen Bedürfnissen nachzugehen. Eine mittig gesetzte Wand aus Holzlatten trennte zwei Kabinen mit jeweils zwei winzig kleinen Fenstern ab. Die Mittelwand reichte nicht ganz bis zur Decke. Sie war nur ungefähr zwei Meter hoch. Wenn dann gleichzeitig zwei Nachbarn gerade die Toiletten benutzten, konnte es peinlich werden. Wer möchte schon gern die Furz-Geräusche eines Fremden neben sich hören.
Die einzelnen Wohnungen waren mit Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche und Flur ausgelegt. Kinderzimmer und Badezimmer gab es nicht. Entweder die Kinder schliefen zusammen mit ihren Eltern oder die Eltern stellten allabendlich ihre Bettstellen im Wohnzimmer auf.
Zum Baden wurden alte Zinkbadewannen vom Dachboden geholt und quer in die Küche gestellt. Dann postierte man mehrere riesige Töpfe mit randvoll Wasser auf dem Herd. Es konnte lange dauern, bis die Töpfe mit dem Wasser heiß waren. Der Herd war alt und gusseisern. Wenn Papa ihn anheizte, erzeugte das eine wunderbare, warme behagliche Atmosphäre.
Das Baden fand bei dem meisten Familien freitags abends statt. Als die Zinkbadewanne endlich mit heißen Wasser aufgefüllt war, stieg zuerst das Kind der Familie in die Wanne. Dann kam die Mutter an die Reihe und zuletzt der Vater. Natürlich alle im gleichem Wasser. Es wäre viel zu aufwendig gewesen, bei jedem Badegang neues heißes Wasser einzugießen. Außerdem hätte es zu lange gedauert, das alte Badewasser zu entsorgen. Dazu brauchte man nämlich einen kleineren Topf zum Abschöpfen. Das hieße wiederum Endloses in die Wanne bücken, schöpfen, sich zum Waschbecken drehen und das verbrauchte Wasser darin entsorgen. Man hätte ja Tage damit verbracht. Mit Hygiene hatte diese wöchentliche Reinigungsprozedur nichts zu tun aber wenigstens das erste Kind brauchte sich nicht vor dem verbrauchten bläulichen Seifenrestwasser zu ekeln.
Wir lebten in der ersten Etage rechts. Unsere Tür zierte der Namenszug Mehlhorn. Meine Mutter Irmgard, mein Vater Herbert und ich, Katrin, waren die Familie Mehlhorn. Unsere Nachbarin, die in der Mittelwohnung lebte, hieß Kurze. Als ich drei Jahre alt war, das war 1965, starb ihr Mann ganz plötzlich. Opa Kurze spielte sehr oft mit mir Verstecken. Am Tag seines Todes dachte ich auch das er wohl mit mir Verstecken spielt. Es war ganz eigenartig. Frau Kurze klingelte an der Tür und noch bevor ich als 3-jähriges kleines Mädchen ihren Gemütszustand realisieren konnte, sah ich Herrn Kurze hinter ihr im Treppenhaus auf dem Bauch liegen. Ich quietschte vor kindlicher Freude und war gerade im Begriff mich auf seinem Rücken zu setzen. Das Pferdchen-Spiel mit ihm hatte doch immer so viel Spaß gemacht. Als ich breitbeinig über seinem Hinterkopf stand um zum Sprung anzusetzen riss mich meine Mutter zurück. Später erklärte sie mir das er zu dem Zeitpunkt schon Tod gewesen sei. Ihm wurde plötzlich schlecht und er wollte hinunter zur Toilette. Dabei erlitt er einen tödlichen Herzinfarkt. Das war also meine erste Begegnung mit dem Tod, die mir im Nachgang überhaupt nicht dramatisch erschien. Meine Mutter hatte die Befürchtung, dass ich ein Trauma von diesem Erlebnis davon tragen könnte. Ich bekam dadurch eher das Bild vermittelt: Der Tod ist ein Spielgefährte, vor dem man keine Angst haben muss.
Seit dem Tod ihres Mannes heftete sich Frau Kurze penetrant an die Fersen meiner Eltern. Aus Mitleid lud meine Mutter sie zu jedem unserer Familienfeste ein. Jedoch konnte Tante Käthe, die Schwester meiner Mutter, Frau Kurze nicht leiden und zu einem meiner Geburtstage kam es dann zum Eklat.
Tante Käthe hatte in allem einen ungewöhnlich hässlichen Geschmack. Dazu gehörte auch ihre Vorliebe für Giftgrün. Sie liebte es, Mäntel und Hüte mit dieser Farbe zu tragen.
Meine Mutter sammelte schon seit vielen Jahren sogenannte Sammeltassen. Jede dieser Kostbarkeiten hatten alle verschiedene Farben und Designs. Eine Tasse war darunter die den ungewöhnlichen Geschmacksvorlieben von Tante Käthe entsprach. Tasse und Untertasse hatten die Farbe Giftgrün. Meine Mutter hielten einzig und allein nur die wunderschönen weißen Blätter darauf ab, das ungeliebte Geschirr in die Mülltonne zu befördern.
Mutter deckte den Tisch und stellte jedem Gast eine hübsche Sammeltasse vor die Nase. Ausgerechnet Frau Kurze bekam die Giftgrüne. Tante Käthe fühlte sich sofort persönlich angegriffen. Das fühlte sie sich eigentlich immer aber diesmal war es schlimmer denn schließlich sollte meine Mutter ihre Schwester kennen und genau wissen, das sie bei jedem ihrer Besuche diese giftgrüne Tasse bekam. Warum also diesmal nicht? Sofort bezog sie diese Handlung auf die Rangordnung einer Beliebtheitsskala zurück. Da nun Frau Kurze diese, von meiner Tante äußerst begehrte Tasse erhielt, fühlte sie sich ihr gegenüber minderwertiger. So als würde meine Mutter diese fremde Frau ihrer eigenen Schwester vorziehen. Was im Prinzip nicht verwunderlich gewesen wäre denn Käthe konnte nerven, vor allem meinen Vater und mich. Wir hielten uns dem lieben Frieden halber zurück aber das klappte auch nicht immer.
Unvermittelt begann Tante Käthe an der großen Kaffeetafel an herum zu keifen wie ein altes Marktweib. „Irmgard, was denkst du dir nur dabei? Willst du mich provozieren und mich vor deiner Nachbarin demütigen?“ Die schroffen Worte ließen meine Mutter aus allen Wolken fallen, zumal sie ihren vermeintlichen Fehler überhaupt nicht realisierte. Sie hatte alle Hände voll zu tun und wollte es den Gästen recht machen. Frau Kurze bot an die Tassen zu wechseln aber das lehnte Tante Käthe wiederum beleidigt ab. Daraufhin stand Frau Kurze auf, verabschiedete sich von allen Anwesenden und verließ gekränkt unsere Wohnung. Als sie dann verschwunden war, fand mein Vater ein paar gewichtige Worte: „Na Käthe hast du es wieder einmal geschafft? Musste das jetzt sein?“ „Na das war ja wiedermal klar Herbert, das du Partei für eine fremde Frau ergreifst!“ zischte Tante Käthe zu Tode gekränkt zurück, schnappte ihre giftgrüne Handtasche und verließ ebenfalls die Wohnung. Danach lehnte sich mein Vater bequem zurück und meinte zu den restlichen Gästen: „So meine Lieben, jetzt kommen wir zum gemütlichen Teil, die giftgrüne Giftspritze ist weg!“ Alle lachten und konnten nun die Feier ohne Zwischenfälle genießen.
Auf unserer Etage wohnte noch die Familie Peters. Simon Peters war ein fasst zwei Meter großes kräftiges Mannsbild. Ihn sah man nur selten, weil er in Schichtrhythmus im VEB-Webstuhlbau arbeitete. Eigentlich arbeiteten fasst alle aus unserem Mietshaus dort. Nur eben in verschiedenen Abteilungen, sodass sie sich nicht ständig über den Weg liefen. Das war auch besser denn so hätte man noch mehr Klatsch und Tratsch auf der Haustreppe weiter verbreiten können. Auch meine Mutter, Irmgard Mehlhorn, arbeitete dort halbtags in der Abteilung Urmik. Urmik..., bis heute weiß ich mit diesen ungewöhnlichen Begriff nichts anzufangen. Es war so eine Art Büro für manuelle Vervielfältigung. Computer und Kopierer gab es noch nicht. In den großen Sommerferien hab ich dort jedes Jahr zwei Wochen mein Feriengeld aufgebessert. Ich weiß nur das ich endlos Karteikarten mit irgendwelchen Nummern abstempeln musste.
Brigitte Peters war Russisch-Lehrerin. Sofort wurde sie unter Kategorie „Vorsicht Partei“ in die Mietergemeinschaft eingeordnet. So kam es das sich keiner großartig mit ihr abgab.
Sie war ebenfalls ziemlich groß, allerdings um das Dreifache dünner als ihr Mann. Sie war also extrem schlank und hatte sehr lange Beine die eine heftige X-Form aufwiesen. Als sie mit dem ersten Kind schwanger wurde, nahm diese auffällige Beinstellung immer mehr zu. Man gewann den Eindruck das der Oberkörper mit dem zunehmend dicken Bauch die Knie immer weiter in die Tiefe drückten. Auffällig war auch ihr außergewöhnlicher Gang. Es hatte etwas von einer Kreuzung zwischen Giraffe und Eierbecher. Wir wussten als Kinder, dass man schwangere Frauen nicht belächelt und ich fand, die werdenden Mütter sowieso immer wunderschön mit ihren dicken Kugelbäuchen, aber bei Frau Peters konnte sich wirklich niemand von uns zurückhalten. Es war einfach zu komisch.
Eine Wohnung unter uns, im Erdgeschoss wohnte Familie Mayer. Beide waren um die 50.
Herr Mayer war krankhaft eifersüchtig auf seine Frau. Ständig gab es Streitigkeiten wegen angeblicher Liebhaber, die sie empfing, während er seiner Arbeit nachging.
Also von Liebhabern hatten wir nie etwas mitbekommen. Uns verwunderte nur, dass sie oft und gern Fenster putzte. Vor allen Dingen dann, wenn wieder einmal die Straße vorm Haus, durch schicke Bauarbeiter geflickt wurde. Mit anmutigen Putzbewegungen, in einem extrem kurzen Mini, animierte sie so lange mit ihren Reizen, bis sie von einem der Sexpack-Jungs angesprochen wurde.
Wir Kinder beobachteten die ganze Szenerie, vom gegenüberliegenden Hauseingang aus, und wenn es soweit war, dass sich die Beiden angeregt unterhielten, setzten wir unsere Wetteinsätze.
West-Matchbox-Autos gegen glitzernde West-Stammbuch-Blümchen. Die Autos befürworteten die Tatsache, dass sie von ihrem Mann ertappt wird und die Stammbuch-Blümchen setzten dagegen. Sie hatte immer Glück und ich erhielt meine begehrten Glitzerbildchen.
Neben Familie Mayer lebte Frau Röder in einer Einraumwohnung. Sie hatte einen kleinen Pinscher. Der Hund zitterte bei jeder Begegnung mit Menschen wie Espenlaub. Er hatte vor allem und jedem Angst. Wenn Frau Röder ihre Wohnungstür öffnete und man sich zufällig in der Nähe befand, wehte einem ein widerlicher Moder-Gestank um die Nase. Da es aber gleich die erste Wohnung nach dem stinkendem Hauseingang war, konnte man sich antrainieren von der Haustür aus bis hin zum ersten Stock die Luft anzuhalten. Wenn man einigermaßen zügig lief, waren diese Hindernisse ganz gut zu bewältigen. Ich glaube so machte das jeder Bewohner unseres Hauses.
In der Wohnung über uns im 3. Stock thronte das Viermieterehepaar Gisela und Otto Nebel.
Frau Nebel hielt ihre Mieter durch eiserne Unnahbarkeit auf Distanz. Ihr Lächeln beim Grüßen wirkte erzwungen. Mit den kostbaren Pelzen, die heutzutage Tierschutz-Aktivisten auf den Plan rufen würden, stellte sie deutlich klar, in welcher privilegierten Position sie sich uns gegenüber befand. Otto Nebel hatte nicht viel zu melden.
Sie war die Erbin einer der letzten großen Dynastien in Sachsen. Ihren Eltern gehörten früher eine große Anzahl von Häusern, die nach und nach durch das kommunistische System enteignet wurden.
Dieses Haus war das letzte private Mietshaus was ihnen blieb um letztendlich, Anfang der 70iger, auch noch verstaatlicht zu werden. Sie blieben aber für uns das Vermieter-Ehepaar.