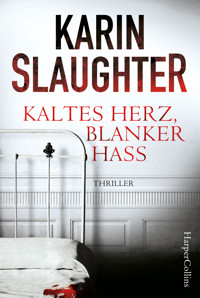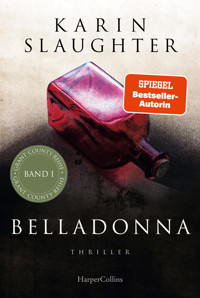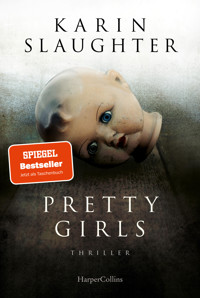9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Georgia-Serie
- Sprache: Deutsch
Der neue Fall für Will Trent und Sara Linton! Atlanta, Georgia: Eine junge Frau wird brutal attackiert und sterbend zurückgelassen. Alle Spuren verlaufen im Sande, bis Will Trent den Fall übernimmt. Die Ermittlungen führen ihn ins Staatsgefängnis. Ein Insasse behauptet, wichtige Informationen geben zu können. Der Angriff gleicht genau der Tat, für die er vor acht Jahren verurteilt worden ist. Bis heute beteuert er seine Unschuld. Will muss den ersten Fall lösen, um die ganze Wahrheit zu erfahren. Doch fast ein Jahrzehnt ist vergangen – Erinnerungen sind verblasst, Zeugen unauffindbar, Beweise verschwunden. Nur eine Person kann Will dabei helfen, den erbarmungslosen Killer zur Strecke zu bringen: seine Partnerin Sara. Aber sobald Vergangenheit und Gegenwart aufeinanderprallen, steht für Will alles, was er liebt, auf dem Spiel … »Jeder neue Thriller von Karin Slaughter ist ein Anlass zum Feiern!«Kathy Reichs »Slaughter weiß, wie sie auch Neueinsteiger mit ihrer Mischung aus knallharter Gewalt und Gefühlsverwirrungen bannen kann. Zudem blitzt immer wieder ihr unschlagbar trockener Humor auf, mit dem sie die expliziten Horrorszenarien der gekonnt hochdrehenden Thriller entschärft: ein albernes Codewort etwa, eine romantische Überraschung in einer Big-Mac-Schachtel oder die wirklich abgebrühteste Bestattung aller Zeiten.« kulturnews »Spannend!« Mein TV & Ich , 08.07.2021
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 845
Veröffentlichungsjahr: 2020
Sammlungen
Ähnliche
HarperCollins®
Copyright © 2020 für die deutsche Ausgabe by HarperCollins in der HarperCollins Germany GmbH, Hamburg
© 2020 by Karin Slaughter Originaltitel: »The Silent Wife« Erschienen bei: William Morrow, New York Published by arrangement with William Morrow, an imprint of HarperCollins Publishers, US Will Trent ist ein Markenzeichen der Karin Slaughter Publishing LLC.
Trouble Me geschrieben von Natalie Merchant und Dennis Drew © 1989 Christian Burial Music (ASCAP) All Rights Reserved. Used by Permission. International Copyright Secured.
Verwendete Songtexte: Whistle (geschrieben von Flo Rida, David Edward Glass, Marcus Killian, Justin Franks, Breyan Isaac, Antonio Mobley, Arthur Pingrey und Joshua Ralph) Can’t Take My Eyes Off You (geschrieben von Bob Crewe und Bob Gaudio) The Girl from Ipanema (geschrieben von Antônio Carlos Jobim, portugiesischer Text von Vinicius de Moraes, englischer Text von Norman Gimbel) My Kind of Town (geschrieben von Jimmy Van Heusen und Sammy Cahn) Funky Cold Medina (geschrieben von Young MC, Matt Dike und Michael Ross) Into the Unknown (geschrieben von Kristen Anderson-Lopez und Robert Lopez)
Covergestaltung und -abbildung von Hafen Werbeagentur, Hamburg Lektorat: Silvia Kuttny-Walser E-Book-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN E-Book 9783959675765
www.harpercollins.de
Werden Sie Fan von HarperCollins Germany auf Facebook!
Widmung
Für Wednesday
Motto
Speak to me.
Let me have a look inside these eyes while I’m learning. Please don’t hide them just because of tears.
Let me send you off to sleep with a »There, there, now stop your turning and tossing.«
Let me know where the hurt is and how to heal.
Spare me? Don’t spare me anything troubling.
Trouble me, disturb me with all your cares and your worries.
Speak to me and let our words build a shelter from the storm.
Trouble Me
von Natalie Merchant and Dennis Drew,
10,000 Maniacs
Hinweis
Dieser Roman ist ein fiktionales Werk. Ich habe mir einige Freiheiten hinsichtlich des zeitlichen Ablaufs genommen.
Prolog
PROLOG
Beckey Caterino spähte in die hintersten Ecken des Wohnheimkühlschranks und suchte wütend nach ihren hingekritzelten Initialen auf den Etiketten der Lebensmittel – Frischkäse, Fertigsnacks, Pizza-Bagels, vegane Hotdogs, Karottensticks.
KP – Kayleigh Pierce. DL – Deneshia Lachland. VS – Vanessa Sutter.
»Diese Miststücke!« Beckey knallte die Kühlschranktür so heftig zu, dass die Bierflaschen darin klirrten. Sie trat gegen den nächstbesten Gegenstand, der zufällig der Abfalleimer war.
Leere Joghurtbecher ergossen sich über den Boden. Zerknüllte Tüten von fettfreiem Popcorn. Ausgespülte Cola-light-Flaschen. Alles mit zwei Buchstaben in schwarzem Textmarker versehen.
BC.
Beckey starrte auf die Verpackungen der Lebensmittel, die sie von ihrem knappen Geld gekauft hatte und die diese Arschlöcher von Mitbewohnerinnen vertilgt hatten, während sie die ganze Nacht in der Bibliothek mit einer Seminararbeit beschäftigt gewesen war, die fünfzig Prozent zu ihrer Note in Organischer Chemie beitrug.
Ihr Blick ging zur Uhr.
4 Uhr 58.
»Ihr verdammten Dreckstücke!«, schrie sie zur Zimmerdecke hoch. Sie machte sämtliche Lichter an. Ihre nackten Füße sengten eine Spur in den Teppichboden im Flur. Sie war am Verhungern. Sie war erschöpft. Sie konnte kaum mehr aufrecht stehen. Ihr einziger Antrieb auf dem Weg von der Bibliothek zum Wohnheim war die Aussicht auf etwas zu essen gewesen.
»Steh auf, du miese Diebin!« Sie schlug so heftig mit der Faust an Kayleighs Tür, dass sie aufsprang.
Marihuanarauch waberte unter der Decke. Kayleigh blinzelte unter den Laken hervor. Der Typ neben ihr wälzte sich herum.
Es war Markus Powell, Vanessas Freund.
»Scheiße.« Kayleigh sprang aus dem Bett, nackt bis auf eine Socke am linken Fuß.
Beckey schlug auf dem Weg zu ihrem eigenen Zimmer mit den Fäusten an die Wände. Ihr Zimmer war das kleinste, und sie hatte es freiwillig genommen, weil sie ein Fußabstreifer war und nicht wusste, wie sie sich gegen drei Mädchen behaupten sollte, die zwar genauso alt waren wie sie, aber mit einem doppelt so dicken Bankkonto versehen.
»Du darfst es Nessa nicht sagen!« Kayleigh rauschte hinter ihr ins Zimmer, immer noch nackt. »Es war nichts. Wir waren betrunken und …«
Wir waren betrunken und …
Jede gottverdammte Geschichte dieser blöden Miststücke fing mit denselben vier Worten an. Als Vanessa dabei erwischt wurde, wie sie Deneshias Freund einen geblasen hatte. Als Kayleighs Bruder versehentlich in den Schrank gepinkelt hatte. Als Deneshia sich Beckeys Unterwäsche geborgt hatte. Sie waren immer betrunken oder bekifft oder vögelten herum oder betrogen einander, denn das war nicht das College hier, es war Big Brother, wo niemand hinausgewählt werden konnte und alle den Tripper hatten.
»Komm schon, Beck.« Kayleigh rieb sich die nackten Arme. »Sie wollte sowieso mit ihm Schluss machen.«
Beckey konnte entweder losschreien und nie mehr aufhören – oder so schnell wie möglich von hier verschwinden.
»Beck …«
»Ich gehe laufen.« Sie riss eine Schublade auf und suchte nach ihren Socken, aber natürlich passten keine zwei zusammen. Ihr liebster Sport-BH lag zerknüllt unter dem Bett. Sie fischte ihre schmutzige Laufhose aus dem Wäschekorb und entschied sich für zwei nicht zusammengehörende Socken, von denen einer ein Loch in der Ferse hatte, aber eine Blase war harmlos gegen die Vorstellung, hierzubleiben und alles kurz und klein zu schlagen, was nach einem lebenden Organismus aussah.
»Beckey, hör auf, dich wie ein Arschloch zu benehmen. Du verletzt meine Gefühle.«
Beckey hängte sich die Kopfhörer um den Hals. Sie war fast schockiert, als sie ihren iPod Shuffle genau dort fand, wo er sein sollte. Kayleigh war die Märtyrerin des Wohnheims, die alle ihre Verbrechen nur zum Wohl der Allgemeinheit beging. Sie hatte nur mit Markus geschlafen, weil Vanessa ihm das Herz gebrochen hatte. Von Deneshia hatte sie bei der Prüfung nur deshalb abgeschrieben, weil ihre Mutter am Boden zerstört wäre, wenn sie in noch einem Fach scheiterte. Und Beckeys Käsemakkaroni hatte sie aufgegessen, weil ihr Vater sich Sorgen machte, dass sie zu dünn war.
»Beck.« Kayleigh versuchte es mit Ablenkung. »Warum redest du nicht mit mir? Worum geht es in Wirklichkeit?«
Beckey griff nach ihrer Haarklammer und erkannte im selben Moment, dass sie nicht auf dem Nachttisch lag wie sonst immer.
Alle Luft wich aus ihren Lungen.
Kayleighs Hände flogen in einer Unschuldsgeste nach oben. »Ich habe sie ehrlich nicht genommen.«
Beckey war kurzfristig wie hypnotisiert von Kayleighs Brüsten mit den perfekt gerundeten Warzenhöfen, die wie ein zweites Augenpaar zu ihr hinaufstarrten.
»Okay«, sagte Kayleigh, »ich habe dein Zeug aus dem Kühlschrank aufgegessen, aber ich würde niemals deine Haarklammer anrühren. Das weißt du.«
In Beckeys Brust tat sich ein schwarzes Loch auf. Die Haarklammer war aus billigem Plastik, eines von den Dingern, die man im Drogeriemarkt kaufte, aber sie bedeutete ihr mehr als alles in der Welt, weil sie das Letzte war, was ihre Mutter ihr gegeben hatte, bevor sie in ihren Wagen stieg, um zur Arbeit zu fahren, und von einem betrunkenen Autofahrer getötet wurde, der auf der Interstate als Geisterfahrer unterwegs war.
»Hey, Blair und Dorota, tuschelt mal leiser.« Vanessas Zimmertür stand offen. Ihre Augen waren zwei Schlitze in dem vom Schlaf verquollenen Gesicht. Sie ignorierte Kayleighs Blöße und wandte sich direkt an Beckey. »Kleines, du kannst nicht um diese Zeit joggen gehen, wenn die Vergewaltiger unterwegs sind.«
Beckey begann zu laufen. An den beiden Miststücken vorbei. Den Flur entlang. Zurück in die Küche. Durch den Wohnraum. Aus der Tür. Noch ein Flur. Drei Treppenabsätze. Der Hauptaufenthaltsraum. Die gläserne Eingangstür, für die man eine Schlüsselkarte brauchte, aber scheiß drauf, denn sie musste unbedingt weg von diesen Ungeheuern. Weg von ihrer beiläufigen Bösartigkeit. Von ihren scharfen Zungen, ihren spitzen Brüsten und ihren schneidenden Blicken.
Tau benetzte ihre Beine, als sie über den grasbewachsenen Campushof rannte. Beckey lief um eine Betonschranke herum und gelangte auf die Hauptstraße. Die Luft war noch kühl. Die Straßenlampen verloschen eine nach der anderen im Dämmerlicht. Schatten schmiegten sich um die Bäume. In der Ferne hörte sie jemanden husten. Ein Schauder lief ihr plötzlich über den Rücken.
Wenn die Vergewaltiger unterwegs sind.
Als würde es die drei kümmern, ob Beckey vergewaltigt wurde. Als würde es sie interessieren, dass sie kaum Geld für Essen hatte, dass sie härter arbeiten musste als sie, fleißiger studieren, sich mehr anstrengen, schneller laufen und sich am Ende doch immer, immer zwei Schritte hinter der Stelle wiederfand, wo alle anderen starten durften. Egal, wie sehr sie sich auch antrieb.
Blair und Dorota. Das beliebte Mädchen und das kriecherische, fette Dienstmädchen aus Gossip Girl. Nicht schwer zu erraten, wer hier welche Rolle spielte.
Beckey setzte ihre Kopfhörer auf. Sie klickte an ihrem iPod auf Play, und Flo Rida ertönte.
Can you blow my whistle baby, whistle baby …
Ihre Füße stampften im Rhythmus des Songs auf den Boden. Sie lief durch das Eingangstor, das den Campus von der trostlosen kleinen Einkaufsstraße im Ortszentrum trennte. Es gab keine Bars oder Studentenkneipen, weil sich die Universität in einem »trockenen« County befand. Es war wie in Mayberry, aber irgendwie weißer und langweiliger. Der Baumarkt. Die Kinderklinik. Die Polizeistation. Der Kleiderladen.
Der alte Typ, dem der Diner gehörte, spritzte den Gehsteig mit einem Schlauch ab, als die Sonne gerade über den Horizont stieg. Das Licht tauchte die Umgebung in einen unheimlichen orangeroten Feuerschein. Der Alte tippte sich an seine Baseballmütze, als er Beckey sah. Sie stolperte über einen Sprung im Asphalt. Fing sich. Sah starr geradeaus und tat, als hätte sie nicht gesehen, wie er den Schlauch fallen ließ und Anstalten machte, ihr zu helfen, denn sie wollte sich unbedingt weiterhin von dem Gedanken beherrschen lassen, dass jeder einzelne Mensch auf Erden ein Arschloch und ihr eigenes Leben beschissen war.
»Beckey«, hatte ihre Mutter gesagt, als sie die Haarklammer aus ihrer Handtasche nahm. »Das ist mein Ernst jetzt. Ich will sie wiederhaben.«
Die Haarklammer. Zwei Kämme mit einem Scharnier dazwischen, einer der Zähne war abgebrochen. Schildpattmuster, wie bei einer Katze. Julia Stiles trug so eine in dem Film Zehn Dinge, die ich an dir hasse, den Beckey tausendmal mit ihrer Mutter gesehen hatte, weil es einer der wenigen Filme war, die beiden gefielen.
Kayleigh hatte die Haarklammer sicher nicht von ihrem Nachttisch gestohlen. Sie war ein gefühlloses Miststück, aber sie wusste, was die Klammer für Beckey bedeutete, seit die beiden sich eines Abends gemeinsam betrunken hatten und Beckey die ganze Geschichte ausgekotzt hatte. Wie der Direktor sie aus dem Englischunterricht geholt hatte. Wie der Schulpolizist draußen im Flur gewartet hatte und sie einen Mordsschreck bekam, weil sie noch nie in Schwierigkeiten gewesen war. Aber sie war gar nicht in Schwierigkeiten. Irgendwo tief in ihrem Innern musste Beckey gewusst haben, dass etwas Entsetzliches geschehen war, denn als der Polizist zu reden anfing, hatte ihr Gehör immer wieder ausgesetzt, wie bei einer schlechten Handyverbindung, und nur einzelne Worte waren durch das Rauschen zu ihr durchgedrungen.
Mutter … Interstate … betrunkener Fahrer …
Seltsamerweise hatte Beckey an die Haarklammer an ihrem Hinterkopf gefasst. Der letzte Gegenstand, den ihre Mutter berührt hatte, bevor sie das Haus verließ. Beckey hatte die Klammer geöffnet. Sie hatte mit den Fingern durch ihre Haare gestrichen, um sie zu lösen. Sie hatte die Plastikklammer in ihrer Handfläche so kräftig zusammengedrückt, dass ein Zahn abgebrochen war. Sie wusste noch, wie sie dachte, dass ihre Mutter sie umbringen würde … Ich will sie wiederhaben … Aber dann hatte ihr Bewusstsein die Tatsache aufgenommen, dass ihre Mutter sie niemals mehr würde umbringen können, weil ihre Mutter tot war.
Beckey wischte sich die Tränen ab, als sie ans Ende der Hauptstraße kam. Links oder rechts? Zum See, wo die Professoren und reichen Leute wohnten, oder zu dem ärmlicheren Viertel, wo Wohnwagen und Billighäuser auf winzigen Grundstücken standen.
Sie bog rechts ab, fort vom See. Auf ihrem iPod hatte Flo Rida jetzt Nicki Minaj Platz gemacht. Sie schaltete die Musik aus und ließ die Kopfhörer um ihren Hals baumeln. Ihre Lungen zeigten mit einem komischen Zittern an, dass sie genug hatten, aber sie ließ nicht locker und atmete schnell und tief mit offenem Mund, und ihre Augen brannten immer noch, wenn sie daran zurückdachte, wie sie und ihre Mutter auf der Couch gesessen hatten, Popcorn gemampft und zusammen mit Heath Ledger bei »Can’t Take My Eyes Off You« mitgesungen hatten.
You’re just too good, to be true …
Die Luft wurde schal, je tiefer sie in das trostlose Viertel vorstieß. Die Straßennamen orientierten sich seltsamerweise am Thema Frühstück: Omelet Road. Hashbrown Way. Beckey lief nie in diese Richtung, schon gar nicht um diese Uhrzeit. Das orangerote Licht hatte sich in ein schmutziges Braun verwandelt. Ausgebleichte Pick-ups und alte Schrottkarren sprenkelten die Straßen. Farbe blätterte von den Häusern. Viele Fenster waren mit Brettern vernagelt. Ihre Ferse begann, schmerzhaft zu pochen. Wer hätte das gedacht … Sie rieb sich eine Blase wegen des Lochs in ihrer Socke. Beckeys Erinnerung warf ein Bild aus: wie Kayleigh aus dem Bett sprang, mit nichts als einer Socke bekleidet.
Beckeys Socke.
Sie fiel ins Schritttempo. Dann blieb sie mitten auf der Straße stehen. Sie beugte sich vor und stützte die Hände auf die Knie, um zu Atem zu kommen. Ihr Fuß brannte jetzt, als wäre eine Hornisse in ihrem Schuh eingeschlossen. Sie würde es niemals zurück zum Campus schaffen, ohne dass es ihr die Haut von der Ferse schälte.
Kayleigh würde sie abholen müssen. Sie war ein erbärmlicher Mensch, aber man konnte sich immer darauf verlassen, dass sie auftauchte, wenn jemand in Schwierigkeiten war – und sei es nur um des Dramas willen. Beckey tastete nach ihrer Tasche, aber dann spuckte ihre Erinnerung einen neuen Satz Bilder aus: Beckey in der Bibliothek, wie sie ihr Telefon in den Rucksack gleiten ließ. Dann später im Wohnheim, wie sie den Rucksack auf den Küchenboden fallen ließ.
Kein Handy. Keine Kayleigh. Keine Hilfe.
Die Sonne stand jetzt höher über den Bäumen, aber Beckey fühlte sich trotzdem von Dunkelheit eingeschlossen. Niemand wusste, dass sie hier war. Niemand erwartete sie zurück. Sie war in einer fremden Gegend. Einer üblen fremden Gegend. An eine Tür zu klopfen, jemanden zu bitten, das Telefon benutzen zu dürfen, kam ihr wie der Anfang einer Folge von Aktenzeichen XY … ungelöst vor. Sie hörte förmlich die Erzählstimme in ihrem Kopf:
Beckeys Mitbewohnerinnen dachten, sie würde sich einfach Zeit lassen, um herunterzukommen. Dr. Adams nahm an, sie sei nicht in ihrem Kurs erschienen, weil sie mit ihrer Seminararbeit nicht fertig geworden war. Niemand ahnte, dass die wütende junge Studentin an die Tür eines kannibalischen Vergewaltigers geklopft hatte …
Ein beißender Fäulnisgeruch holte sie in die Realität zurück. Ein Lkw der Müllabfuhr rollte in die Kreuzung am Ende der Straße und blieb mit quietschenden Bremsen stehen. Ein Kerl in einem Overall sprang heraus, schob eine Tonne zum Fahrzeug, hakte sie an der Hebevorrichtung ein. Beckey sah die Zahnräder im Innern des Lkw mahlen. Der Overall-Typ hatte nicht in ihre Richtung geschaut, aber dennoch befiel sie plötzlich das beklemmende Gefühl, beobachtet zu werden.
Wenn die Vergewaltiger unterwegs sind.
Sie drehte sich um und versuchte, sich zu erinnern, ob sie in diese Straße links oder rechts abgebogen war. Es gab nicht einmal ein Straßenschild. Das Gefühl, ausgespäht zu werden, wurde stärker. Beckey suchte die Häuser mit den Blicken ab, das Innere von Trucks und Autos. Nichts starrte von dort zurück. Kein Vorhang bewegte sich in den Fenstern. Kein kannibalischer Vergewaltiger trat vor die Tür, um seine Hilfe anzubieten.
Ihr Kopf machte sofort das, was Frauen auf keinen Fall machen sollten: sich für ihre Angst tadeln, nicht auf ihr Bauchgefühl hören, sich einreden, dass man sich der Situation stellen müsse, die einen ängstigte, statt wegzulaufen wie ein kleines Kind.
Beckey konterte die Argumente: Geh weg von der Straßenmitte. Bleib nah an den Häusern, denn darin gibt es Leute. Brüll dir die Lunge aus dem Leib, wenn dir jemand nahe kommt. Lauf zurück zum Campus, denn dort bist du in Sicherheit.
Alles schön und gut, aber wo war der Campus?
Sie verdrückte sich seitlich zwischen zwei geparkte Autos und fand sich nicht auf einem Gehsteig wieder, sondern auf einem schmalen Streifen Unkraut zwischen zwei Häusern. In einer Stadt hätte man es eine Gasse genannt, aber hier war es mehr ein Stück Brache. Zigarettenkippen und zerbrochene Bierflaschen lagen im Gras. Beckey sah eine ordentlich gemähte Wiese hinter den Häusern, dann unmittelbar hinter dem Anstieg den Wald.
In den Wald zu gehen war nicht das, was die Intuition ihr riet, aber Beckey kannte sich gut aus auf den Trampelpfaden, die kreuz und quer darin verliefen. Wahrscheinlich würde sie auf andere Studenten treffen, die mit dem Rad fuhren oder ihr morgendliches Laufpensum absolvierten. Sie blickte auf, um sich an der Sonne zu orientieren. Wenn sie in Richtung Westen ging, käme sie zum Campus zurück. Blase hin oder her, sie musste irgendwann ins Wohnheim zurückkehren, weil sie es sich nicht leisten konnte, in Organischer Chemie durchzufallen.
Als sie zwischen den Häusern durchlief, verhärteten sich die Muskeln in ihren Schultern und ihre Zähne schlugen aufeinander. Sie erhöhte das Tempo. Es war noch nicht ganz Laufen, aber streng genommen auch nicht mehr Gehen. Die Blase fühlte sich bei jedem Auftreten an, als würde jemand sie in die Ferse kneifen. Zusammenzucken schien zu helfen. Dann biss sie die Zähne zusammen und joggte durch die Wiese, und ihr Rücken brannte von tausend Augen, die sie wahrscheinlich nicht beobachteten.
Wahrscheinlich.
Die Temperatur fiel, als sie die Grenze zum Wald überschritt. Aus den Augenwinkeln sah sie Schatten, die sich bewegten. Sie fand mühelos einen Pfad, wahrscheinlich war sie ihn schon tausendmal gelaufen. Ihre Hand ging zum iPod, aber sie überlegte es sich anders. Sie wollte lieber der Stille des Waldes lauschen. Nur gelegentlich fand ein Sonnenstrahl den Weg durch das dichte Blätterdach. Sie dachte an vorhin, als sie vor dem offenen Kühlschrank gestanden hatte. Die kalte Luft, die über ihre heißen Wangen strich. Die leeren Popcorntüten auf dem Boden. Sie würden ihr Geld geben für das Essen. Sie bezahlten es immer. Sie waren keine Diebinnen. Sie waren nur zu faul, um in den Laden zu gehen, und zu unorganisiert, um eine Liste zu machen, wenn Beckey anbot, für sie einzukaufen.
»Beckey?«
Beim Klang der Männerstimme wandte Beckey den Kopf, aber ihr Körper bewegte sich weiter vorwärts. Sie sah sein Gesicht in dem Sekundenbruchteil zwischen Stolpern und Fallen. Er sah freundlich aus, besorgt. Er streckte die Hand nach ihr aus, als sie fiel.
Ihr Kopf krachte gegen etwas Hartes. Ihr Mund füllte sich mit Blut. Vor ihren Augen verschwamm alles. Sie versuchte, sich herumzudrehen, schaffte es aber nur halb. Ihr Haar hatte sich in etwas verfangen. Es zog. Zerrte. Sie griff hinten an ihren Kopf und erwartete aus irgendeinem Grund, dort die Haarklammer ihrer Mutter zu finden. Was sie stattdessen ertastete, war Holz, dann Stahl, dann tauchte das Gesicht des Mannes in ihrem Blickfeld auf, und sie begriff, dass das Ding, das in ihrem Schädel steckte, ein Hammer war.
1
ATLANTA
1
Will Trent schob seine eins vierundneunzig zurecht, um eine erträgliche Sitzposition im Mini seiner Partnerin zu finden. Sein Scheitel passte prima in die Aussparung für das Schiebedach, aber der Kindersitz auf der Rückbank schränkte seine Beinfreiheit vorn erheblich ein. Er musste die Knie zusammendrücken, damit er den Schalthebel nicht versehentlich auf Leerlauf stellte. Wahrscheinlich wirkte er wie ein Schlangenmensch, aber Will sah sich eher als Schwimmer, der rhythmisch in die Unterhaltung tauchte, die Faith Mitchell offenbar mit sich selbst führte. Statt Armzug-Armzug-Atmen war es hier Ausblenden-Ausblenden-Was du nicht sagst.
»Da hocke ich also um drei Uhr morgens und poste eine vernichtende Ein-Stern-Beurteilung über diesen eindeutig defekten Bratenwender.« Faith nahm beide Hände vom Lenkrad, um pantomimisch darzustellen, wie sie tippte. »Und dann wird mir klar, dass ich Waschmittel in den Geschirrspüler gefüllt habe, was total bescheuert ist, weil der Wäscheraum im ersten Stock ist, und zehn Minuten später schaue ich aus dem Fenster und denke: Ist Mayonnaise wirklich ein Musikinstrument?«
Will hatte gehört, wie ihre Stimme nach oben ging, aber er wusste nicht zu sagen, ob sie eine Antwort erwartete oder nicht. Er versuchte, die Unterhaltung im Kopf zurückzuspulen. Doch die Übung brachte keine Klarheit. Sie saßen seit fast einer Stunde in diesem Auto, und Faith hatte ohne erkennbares System die exorbitant hohen Preise für Klebestifte und die Kindergeburtstagsindustrie einer Fast-Food-Kette angeschnitten sowie das, was sie Eltern-Folterpornos nannte, wenn Leute Fotos davon posteten, wie ihre Kinder nach den Ferien wieder zur Schule gingen, während ihr eigenes Kleinkind immer noch zu Hause war.
Er legte den Kopf schief und tauchte wieder in die Unterhaltung ein.
»Dann kommen wir zu der Stelle, wo Mufasa in den Tod stürzt.« Faith sprach jetzt offenbar von einem Film. »Emma fängt genauso zu plärren an, wie es Jeremy in ihrem Alter getan hat, und mir wird klar, dass ich es irgendwie geschafft habe, zwei Kinder zur Welt zu bringen, die exakt zwei Versionen von König der Löwen auseinander sind.«
Will blendete sich wieder aus der Unterhaltung aus. Bei der Erwähnung von Emma zog sich sein Magen zusammen, und die Schuldgefühle schmerzten wie eine Schrotladung in seiner Brust.
Er hätte Faiths zweijährige Tochter einmal beinahe getötet.
Das kam so: Will und seine Freundin Sara hatten auf Emma aufgepasst. Sara erledigte in der Küche irgendwelchen Papierkram, und Will saß mit Emma auf dem Wohnzimmerboden und zeigte ihr, wie man die winzige Knopfbatterie in einem HexBug, einem Spielzeugkrabbeltier, auswechselte. Das Spielzeug lag in Einzelteilen auf dem Kaffeetisch. Will balancierte die Batterie, die etwa so groß war wie ein TicTac, auf der Fingerspitze, damit Emma sie sehen konnte. Er erklärte ihr gerade, dass sie besonders sorgfältig darauf achten sollten, sie nicht irgendwo herumliegen zu lassen, damit Betty, sein Hund, sie nicht versehentlich fraß, als Emma sich plötzlich vorbeugte und die Batterie mit dem Mund einsaugte.
Will war Agent beim Georgia Bureau of Investigation. Er hatte sich in Krisensituationen bewährt, in denen es um Leben und Tod ging, und das Einzige, was gezählt hatte, seine schnelle Reaktionsfähigkeit war.
Aber als diese Batterie im Mund des kleinen Mädchens verschwand, war Will wie gelähmt.
Hilflos hielt er immer noch den Finger erhoben, sein Herz faltete sich zusammen wie ein Fahrrad um einen Telefonmast. Er konnte nichts weiter tun, als zusehen, wie sich Emma in Zeitlupe und mit einem triumphierenden Lächeln auf dem engelsgleichen Gesicht zurücklehnte und Anstalten machte, zu schlucken.
Das war der Moment, in dem Sara sie alle gerettet hatte. So schnell, wie Emma die Batterie von seinem Finger gelutscht hatte, stieß Sara nun wie ein Raubvogel herab, fuhr mit dem Zeigefinger in Saras Mund und fischte sie heraus.
»Jedenfalls schaue ich diesem Mädchen in der Kassenschlange über die Schulter, und sie macht ihren Freund in einer SMS zur Schnecke.« Faith war zur nächsten Geschichte übergegangen. »Dann ist sie weg, und jetzt werde ich mich ewig fragen, ob ihr Freund tatsächlich was mit ihrer Schwester angefangen hat.«
Wills Schulter bohrte sich in das Seitenfenster, als der Mini eine scharfe Kurve nahm. Sie waren fast beim Staatsgefängnis angelangt. Sara würde dort sein, ein Umstand, der Wills Schuldgefühle wegen Emma in Angst um Sara umschlagen ließ.
Er veränderte wieder seine Stellung. Sein Hemdrücken schälte sich vom Leder. Will schwitzte nicht vor Hitze – er schwitzte seine Beziehung zu Sara aus.
Alles lief großartig, aber irgendwie lief es auch sehr, sehr schlecht.
Von außen betrachtet hatte sich nichts verändert. Sie verbrachten immer noch die meisten Nächte zusammen. Am vergangenen Wochenende hatten sie Saras Lieblingsmahlzeit genossen: ein Sonntagsfrühstück nackt im Bett. Und später seine Lieblingsmahlzeit: ein zweites Sonntagsfrühstück nackt im Bett. Sara küsste ihn wie immer. Es fühlte sich an, als liebte sie ihn auch wie immer. Sie ließ ihre Schmutzwäsche noch immer knapp neben den Wäschekorb fallen und bestellte noch immer nur einen Salat, um dann die Hälfte seiner Fritten zu futtern. Aber irgendetwas stimmte ganz und gar nicht.
Die Frau, die Will in den letzten zwei Jahren praktisch dazu gezwungen hatte, über Dinge zu reden, über die er nicht reden wollte, erklärte plötzlich ein bestimmtes Gesprächsthema für tabu.
Folgendes war vorgefallen: Vor sechs Wochen war Will von Besorgungen nach Hause zurückgekehrt. Sara saß am Küchentisch. Plötzlich hatte sie davon gesprochen, sein Haus zu renovieren. Nicht nur zu renovieren, sondern es mehr oder weniger abzureißen, damit sie mehr Platz zur Verfügung hätten, was eine verquere Art war, ihm mitzuteilen, dass sie zusammenziehen sollten. Also hatte Will beschlossen, ihr auf eine ebenso verquere Art einen Heiratsantrag zu machen, indem er sagte, sie sollten doch in einer Kirche heiraten, weil es ihre Mutter glücklich machen würde.
Und dann hatte er ein Knacken gehört, als würde die Erde unter seinen Füßen gefrieren, als wäre jede Oberfläche im Raum von Eis bedeckt, als käme Saras Atem in kleinen Wölkchen aus ihrem Mund. Und sie sagte nicht etwa: »O ja, Liebster, ich möchte dich von Herzen gern heiraten«, sondern fragte mit einer Stimme, die frostiger war als die Eiszapfen, die von der Decke herabwuchsen: »Was zum Teufel hat meine Mutter damit zu tun?«
Sie hatten gestritten, was Will in eine schwierige Lage brachte, weil er nicht wusste, worüber genau sie stritten. Er hatte ein wenig gestichelt, dass sein Haus wohl nicht gut genug für sie sei, und daraus war ein Streit über ihre Finanzen geworden, was ihm eine bessere Position verlieh, denn Will war ein armer Staatsbediensteter, und Sara … nun ja, Sara war im Moment ebenfalls eine arme Staatsbedienstete, doch davor war sie eine reiche Ärztin gewesen.
Der Streit war hin und her gegangen, bis es Zeit war, Saras Eltern zum Brunch zu treffen, und Sara hatte für drei Stunden ein Moratorium über alle Gespräche zum Thema Heiraten oder Zusammenziehen verhängt. Diese drei Stunden hatten sich bis zum Rest des Tages ausgedehnt und dann bis zum Rest der Woche; inzwischen waren anderthalb Monate vergangen, und Will lebte mit einer echt scharfen Mitbewohnerin zusammen, die zwar weiter mit ihm schlafen, sich aber über nichts anderes unterhalten wollte als darüber, was sie zum Abendessen bestellen wollten, über ihre kleine Schwester, die sich sehr entschlossen ihr Leben versaute, und darüber, wie leicht es war, die zwanzig Algorithmen zu lernen, die Rubiks Zauberwürfel lösten.
Faith fuhr auf den Gefängnisparkplatz und sagte gerade: »Und natürlich – es kann ja nicht anders sein bei mir – bekomme ich genau in diesem Moment endlich meine Periode.«
Sie verstummte, während sie auf einen freien Platz rollte. Ihr letzter Satz hatte nichts Abschließendes an sich gehabt. Erwartete sie eine Antwort? Sie erwartete definitiv eine Antwort.
Will entschied sich für: »Das ist natürlich beschissen.«
Faith sah erschrocken aus, als wäre ihr soeben bewusst geworden, dass er mit im Auto saß. »Was ist beschissen?«
Er konnte jetzt deutlich sehen, dass sie keine Antwort erwartet hatte.
»Himmel noch mal, Will!« Wütend stellte sie den Schalthebel auf Parken. »Das nächste Mal solltest du mich vorwarnen, wenn du tatsächlich zuhörst.«
Faith stieg aus und stapfte zum Angestellteneingang. Sie hatte Will den Rücken zugekehrt, aber er stellte sich vor, dass sie bei jedem Schritt vor sich hin grummelte. Sie hielt ihren Ausweis in die Kamera vor dem Tor. Will rieb sich übers Gesicht. Er atmete die heiße Luft im Wagen ein. Hatten alle Frauen in seinem Leben den Verstand verloren, oder war er der Idiot?
Nur ein Idiot stellte sich diese Frage.
Er öffnete die Tür und schaffte es, den Mini abzustreifen und auszusteigen. Seine Kopfhaut juckte vom Schweiß. Es waren die letzten Oktoberwochen, und die Hitze außerhalb des Wagens war nicht viel besser als im Innern. Er fand sein Jackett zwischen Emmas Kindersitz und einer Tüte abgestandenem Goldfischli-Knabberzeug. Er verputzte den gesamten Inhalt und schielte zu einem Gefangenentransportbus, der in die Straße einbog und mit Karacho in ein Schlagloch fuhr. Die Gesichter der Insassen hinter den vergitterten Fenstern zeigten verschiedene Schattierungen von Elend.
Will warf die leere Goldfischli-Tüte auf den Rücksitz. Dann holte er sie wieder hervor und nahm sie mit zum Angestellteneingang. Er sah zu dem gedrungenen, deprimierenden Gebäude hinauf. Das Phillips State Prison war eine Einrichtung der mittleren Sicherheitsstufe in Buford, rund eine Fahrtstunde außerhalb von Atlanta. Fast tausend Männer waren in zehn Wohneinheiten mit jeweils zwei Schlaftrakten untergebracht. In sieben der Einheiten gab es Zweimannzellen. Der Rest setzte sich aus Einzel-, Doppel- und Isolationszellen für die sogenannten MP und SH zusammen. MP stand für Insassen mit mentalen Problemen. SH stand für Schutzhaft, zumeist für Cops und Pädophile, die beiden meistgehassten Typen von Insassen in jedem Gefängnis.
Es gab einen Grund, warum MP und SH zusammengefasst waren. Für einen Außenstehenden hörte sich eine Einzelzelle nach Luxus an. Für einen Insassen in Isolationshaft bedeutete es, zwanzig Stunden am Tag allein in einem fensterlosen Betonkasten von zwei mal vier Metern eingesperrt zu sein. Und das nach einem bahnbrechenden Prozess, in dem die Regeln, die vorher für eine Isolationshaft in Georgia galten, als unmenschlich eingestuft worden waren.
Vor vier Jahren war der Phillips-Knast zusammen mit neun anderen Staatsgefängnissen Georgias von einer FBI-Razzia durchsucht worden, bei der siebenundvierzig korrupten Vollzugsbeamten das Handwerk gelegt wurde. Alle restlichen Vollzugsbeamten hatte man innerhalb des Systems versetzt. Der neue Direktor ließ sich nicht für dumm verkaufen, was sowohl gut als auch schlecht war, je nachdem, wie man die ausgehenden Gefahren von wütenden, isolierten Männern einschätzte, die zusammengepfercht auf engstem Raum lebten. Das Gefängnis befand sich derzeit nach zwei Tagen voller Unruhen im Lockdown, das hieß, die Gefangenen blieben den ganzen Tag in ihren Zellen. Sechs Vollzugsbeamte und drei Insassen waren schwer verletzt worden. Einen weiteren Häftling hatte man in der Cafeteria ermordet.
Und dieser Mord hatte Faith und Will hierhergeführt.
Nach dem Gesetz war das GBI für die Untersuchung aller Todesfälle in Haft zuständig. Die Insassen, die das Gefängnis in dem Transportbus verließen, würden nicht direkt mit dem Mord in Verbindung gebracht werden, aber sie hatten vermutlich eine Rolle bei den Aufständen gespielt. Sie erhielten das, was man die Diesel-Therapie nannte. Der Direktor ließ die Großmäuler, die Aufrührer, die Schachfiguren bei den Bandenkämpfen wegbringen. Sich der Unruhestifter zu entledigen war gut für das Gefängnis, aber es war nicht gerade toll für die Männer, die weggeschickt wurden. Sie verloren den einzigen Ort, den sie als eine Art Zuhause betrachten konnten, und sie waren auf dem Weg zu einer Einrichtung, die weitaus gefährlicher war als die, die sie gerade verließen. Es war, als ob man an eine neue Schule wechselte, nur dass es dort statt fieser Mädchen und Schlägertypen Vergewaltiger und Mörder gab.
Ein Metallschild war am Eingangstor befestigt: GDOC. Georgia Department of Corrections. Will warf die leere Goldfischli-Tüte in den Abfalleimer an der Tür. Er wischte die Hände an der Hose ab, um die gelblichen Krümel loszuwerden. Anschließend musste er an den Fettspuren herumrubbeln, bis sie nicht mehr ganz so schlimm aussahen.
Die Kamera befand sich fünf Zentimeter über Wills Kopf. Er musste einen Schritt zurücktreten, um seinen Ausweis zu zeigen. Ein lautes Summen und ein Klicken, dann war er im Gebäude. Er verstaute seine Waffe in einem Spind und steckte den Schlüssel ein, nur um ihn gleich darauf zusammen mit allem anderen wieder herauszunehmen, als er durch den Scanner musste. Ein schweigsamer Vollzugsbeamter führte ihn durch die Sicherheitsschleuse und kommunizierte mithilfe seines Kinns: Deine Partnerin ist da hinten im Flur, Bro. Mir nach.
Der Vollzugsbeamte schlurfte, statt zu gehen, eine Gewohnheit, die der Job mit sich brachte. Es gab keinen Grund, sich zu beeilen, wenn es dort, wo man hinging, exakt so aussah wie dort, wo man herkam.
Das Gefängnis klang wie ein Gefängnis. Insassen brüllten, schlugen an die Gitter, protestierten gegen den Ausnahmezustand oder die allgemeine Ungerechtigkeit auf der Welt. Will lockerte seine Krawatte, als sie tiefer ins Innere der Einrichtung vordrangen. Schweiß lief ihm in den Kragen. Gefängnisse waren aufgrund ihrer Bauart schwer zu kühlen und zu heizen. Wegen der breiten, langen Flure und scharfen Winkel. Wegen der Betonwände und Linoleumböden. Weil jede Zelle ein offenes Kanalisationsrohr als Toilette hatte und weil die Männer in ihnen genügend Angstschweiß produzierten, um den sanften Fluss des Chattahoochee River in reißende Stromschnellen zu verwandeln.
Faith wartete vor einer geschlossenen Tür auf ihn. Sie hielt den Kopf gesenkt und schrieb in ihr Notizbuch. Ihre Gesprächigkeit war eine sehr nützliche Eigenschaft in diesem Job. Sie hatte bereits fleißig Informationen gesammelt, während Will seine Hose mit Goldfischli-Krümeln eingesaut hatte.
Nun nickte sie dem schweigsamen Vollzugsbeamten zu, der seinen Platz auf der anderen Seite der Tür einnahm, und sagte zu Will: »Der ermordete Insasse ist in der Kantine. Amanda ist gerade vorgefahren. Sie will den Tatort sehen, bevor sie mit dem Direktor spricht. Sechs Agents des Außenbüros Nord durchleuchten seit drei Stunden mögliche Tatverdächtige. Wir geben alles zum Saubermachen frei, sobald wir eine brauchbare Liste mit Verdächtigen haben. Sara sagt, sie ist fertig, wenn wir es sind.«
Will schaute durch das Fenster in der Tür.
Sara Linton stand in einem weißen Schutzanzug in der Mitte der Kantine. Ihr kastanienrotes Haar steckte unter einer blauen Baseballkappe. Sie war Rechtsmedizinerin beim GBI. Diese jüngste Entwicklung hatte Will bis vor etwa sechs Wochen äußerst beglückend gefunden. Sie sprach mit Charlie Reed, dem leitenden Kriminaltechniker des GBI. Er kniete nieder, um einen blutigen Schuhabdruck zu fotografieren. Gary Quintana, Saras Assistent, hielt ein Lineal neben den Abdruck, um einen Größenbezug herzustellen.
Sara sah müde aus. Sie bearbeitete den Tatort schon seit vier Stunden. Will war bei seiner morgendlichen Joggingrunde gewesen, als der Anruf Sara aus dem Bett geholt hatte. Sie hatte ihm einen Zettel mit einem Herz in der Ecke hinterlassen.
Er hatte dieses kleine Herz länger angestarrt, als er es je zugeben würde.
»Okay«, sagte Faith. »Die Revolte fing also vor zwei Tagen an, am Samstag um elf Uhr achtundfünfzig.«
Will riss sich von Saras Anblick los und wartete darauf, dass Faith fortfuhr.
»Zwei Häftlinge gingen mit den Fäusten aufeinander los. Der erste Vollzugsbeamte, der versucht hat, sie zu trennen, wurde ausgeknockt. Ellbogen an den Kopf, Kopf auf den Boden, see ya later alligator. Nachdem der Beamte zu Boden gegangen war, fing es erst richtig an. Der zweite Vollzugsbeamte wurde bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt. Ein dritter, der zu Hilfe eilte, wurde mit einem Schlag niedergestreckt. Dann schnappte sich jemand die Elektroschocker, und ein anderer schnappte sich die Schlüssel, und schon war der ganze Laden in hellem Aufruhr. Der Mörder war eindeutig vorbereitet.«
Will nickte, denn Gefängnisunruhen fingen meistens wie ein Hautausschlag an. Es gab immer ein verräterisches Jucken, und es gab immer einen Kerl oder eine Gruppe von Kerlen, die dieses Jucken spürten und zu überlegen anfingen, wie sie den Aufruhr zu ihrem Vorteil nutzen konnten. Den Gefängnisladen plündern? Ein paar Wärter in ihre Schranken verweisen? Einen Rivalen ausschalten?
Die Frage war, ob das Opfer ein Kollateralschaden gewesen war oder ob es jemand gezielt auf ihn abgesehen hatte. Das war von außerhalb der Kantine schwer zu beurteilen. Er zählte dreißig Tische, alle mit Sitzplätzen für jeweils zwölf Personen, alle im Boden festgeschraubt. Tabletts lagen überall im Raum herum. Papierservietten. Faulendes Essen. Jede Menge eingetrocknete Flüssigkeiten, das meiste davon Blut. Ein paar Zähne. Will konnte eine erstarrte Hand unter einem der Tische sehen, und er nahm an, dass sie ihrem Opfer gehörte. Die Leiche des Mannes lag unter einem anderen Tisch in der Nähe der Küche, sie kehrte der Tür den Rücken zu. Die ausgeblichene Gefängnisuniform mit den blauen Streifenakzenten verlieh dem Tatort die Atmosphäre eines Massakers in einer Eisdiele.
»Hör zu«, sagte Faith, »wenn du noch wegen Emma und der Batterie aus dem Häuschen bist, lass es sein. Es ist nicht deine Schuld, dass sie so lecker aussehen.«
Will nahm an, dass er bei Saras Anblick ein Signal aussandte, das Faith aufgefangen hatte.
»Kleinkinder sind wie die schlimmsten Gefängnisinsassen«, fuhr sie fort. »Wenn sie dir nicht ins Gesicht lügen und dein Zeug kaputtmachen, schlafen sie, pupsen oder denken sich sonst irgendwas aus, wie sie dich verarschen können.«
Der Vollzugsbeamte hob das Kinn. Stimmt.
»Können Sie unseren Leuten Bescheid geben, dass wir hier sind?«, fragte Faith den Mann.
Der Typ nickte à la Klar, Lady, stets zu Diensten, bevor er davonschlurfte.
Will beobachtete Sara wieder durch das Fenster, wie sie etwas auf einem Clipboard notierte. Sie hatte den Reißverschluss ihres Overalls geöffnet und die Ärmel um die Taille geknotet. Die Baseballkappe hatte sie abgesetzt und trug das Haar jetzt zu einem lockeren Pferdeschwanz gebunden.
»Ist es wegen Sara?«, fragte Faith.
Will sah auf seine Partnerin hinunter. Oft vergaß er, wie winzig sie war. Blondes Haar. Blaue Augen. Grenzenlose Enttäuschung im Blick. Wie sie da so stand, die Hände in die Hüften gestemmt und den Kopf so weit hochgereckt, dass ihr Kinn sich auf Höhe seiner Brust befand, erinnerte sie ihn an die Zeichentrickfigur Pearl Pureheart, die Freundin von Mighty Mouse – sofern Pearl mit fünfzehn schwanger geworden wäre und dann mit zweiunddreißig noch einmal.
Was der primäre Grund war, warum Will nicht mit ihr über Sara reden wollte. Faith zwangsbemutterte jeden in ihrer Umlaufbahn, ob es nun ein Verdächtiger in U-Haft oder die Kassiererin im Supermarkt war. Wills Kindheit war ziemlich hart gewesen. Er hatte eine Menge Dinge über die Welt gelernt, mit denen die meisten Kinder nie in Berührung kamen, aber er wusste definitiv nicht, wie es war, bemuttert zu werden.
Der zweite Grund für sein Schweigen war, dass Faith eine verdammt gute Polizistin war. Sie würde nur ungefähr zwei Sekunden brauchen, um den Fall der plötzlich verstummten Freundin zu lösen.
Hinweis Nummer eins: Sara war ein äußerst logisch denkender und konsequenter Mensch. Anders als Wills psychotische Ex-Frau war Sara nicht vom Höllenschlund einer Geisterbahn ausgespien worden. Wenn Sara böse, gereizt, verärgert oder auch glücklich war, dann konnte Will sich darauf verlassen, von ihr die Gründe dafür zu erfahren – und was sie gegebenenfalls dagegen zu unternehmen gedachte.
Hinweis Nummer zwei: Sara spielte keine Spielchen. Es gab kein Schweigen, Schmollen oder schnippisches Getue, das es zu interpretieren galt. Will musste nie erraten, was sie dachte, weil sie es ihm sagte.
Hinweis Nummer drei: Sara war eindeutig gern verheiratet. In ihrem früheren Leben war sie zweimal verheiratet gewesen, beide Male mit demselben Mann. Sie wäre in diesem Augenblick wohl noch immer mit Jeffrey Tolliver verheiratet, wenn man ihn nicht vor fünf Jahren ermordet hätte.
Schlussfolgerung: Sara hatte nichts gegen eine Ehe und auch nichts gegen verquere Heiratsanträge.
Sie hatte nur etwas dagegen, Will zu heiraten.
»Voldemort«, sagte Faith genau in dem Moment, in dem das Klackediklack der High Heels von Deputy Director Amanda Wagner an Wills Ohr drang.
Amanda hatte ihr Telefon in der Hand, während sie den Flur entlangging. Sie schrieb ständig Kurznachrichten oder telefonierte, um Informationen über ihr Freundinnennetzwerk einzuholen, einer Furcht einflößenden Gruppe von Frauen, von denen die meisten schon im Ruhestand waren und die in Wills Fantasie in einer geheimen Höhle herumsaßen und Handgranatenwärmer strickten, bis sie aktiviert wurden.
Faiths Mutter war eine von ihnen.
»So.« Amanda machte Wills fettfleckige Hose schon aus zehn Metern Entfernung aus. »Agent Trent, sind Sie der einzige Landstreicher, der vom Güterzug gefallen ist, oder sollen wir noch weitersuchen?«
Will räusperte sich.
»Okay.« Faith blätterte in ihrem Notizbuch und kam sofort zur Sache. »Das Opfer heißt Jesus Rodrigo Vasquez, ist achtunddreißig und Hispano, hatte sechs von zehn Jahren wegen Angriffs mit einer tödlichen Waffe abgerissen. Nachdem er vor drei Monaten nach seiner vorzeitigen Entlassung den Drogentest nicht bestanden hat, wurde er ins Gefängnis zurückgeschickt, um den Rest seiner Strafe abzusitzen.«
»Zugehörigkeit?«, fragte Amanda.
War er Mitglied einer Bande? übersetzte sich Will lautlos.
»Schweiz«, antwortete Faith. Neutral sollte das heißen. »Wurde mehrmals erwischt, wie er Handys im Arsch geschmuggelt hat. Der Kerl wühlte anscheinend ständig irgendeinen Dreck auf. Ich vermute, er wurde umgelegt, weil er den Mund nicht halten konnte.«
»Problem gelöst.« Amanda klopfte an die Glastür, um sich bemerkbar zu machen. »Dr. Linton?«
Sara hielt inne, um etwas aufzuheben, ehe sie die Tür öffnete. »Wir sind fertig mit der Bearbeitung des Tatorts. Sie brauchen keine Anzüge, aber hier gibt’s eine Menge Blut und andere Flüssigkeiten.«
Sie gab Schuhschoner und Gesichtsmasken aus. Sie drückte Wills Finger, als er an der Reihe war.
»Die Leichenstarre ist vorbei, der Körper beginnt zu verwesen«, sagte sie. »Zusammen mit der Lebertemperatur des Opfers und der höheren Umgebungstemperatur kommen wir damit auf eine physiologische Todeszeit, die mit den Berichten übereinstimmt, dass Vasquez vor rund achtundvierzig Stunden angegriffen wurde. Der Todeszeitpunkt dürfte also am Beginn der Unruhen liegen.«
»In den ersten Minuten oder den ersten Stunden?«, fragte Amanda nach.
»Grob geschätzt zwischen Mittag und vier Uhr nachmittags am Samstag. Wenn Sie es genauer eingrenzen wollen, werden Sie sich auf Zeugenaussagen verlassen müssen.« Sara rückte Wills Maske zurecht und rief Amanda ins Gedächtnis: »Die Wissenschaft allein kann den exakten Todeszeitpunkt natürlich nicht bestimmen.«
»Natürlich«, erwiderte Amanda, die kein Fan grober Schätzungen war.
Sara verdrehte die Augen in Wills Richtung. Sie wiederum war kein Fan von Amandas Tonfall. »Der Tatort umfasst drei verschiedene Punkte: zwei hier im Hauptbereich, einen in der Küche. Vasquez hat sich gewehrt.«
Will griff hinter Sara, um die Tür aufzuhalten. Der Geruch nach Scheiße und Urin, die Visitenkarte der randalierenden Insassen, durchdrang jedes Molekül im Raum.
»Großer Gott.« Faith presste den Handrücken auf ihre Gesichtsmaske. Tatorte waren generell nicht ihre Stärke, aber der Geruch war so beißend, dass selbst Wills Augen tränten.
Sara wandte sich an ihren Assistenten. »Gary, könnten Sie bitte die kleinere Wasserpumpenzange aus dem Wagen holen? Wir werden den Tisch abschrauben müssen, bevor wir die Leiche entfernen können.«
Garys Pferdeschwanz hüpfte unter dem Haarnetz, als er beglückt einen schnellen Abgang machte. Er war seit weniger als einem halben Jahr beim GBI. Dies hier war nicht der schlimmste Tatort, den er bearbeitet hatte, aber in einem Gefängnis wirkte alles viel bedrückender.
Der Blitz an Charlies Kamera flammte auf. Will blinzelte gegen das Licht.
»Ich konnte einen Blick auf die Bilder der Überwachungskamera werfen«, sagte Sara zu Amanda. »Es gibt neun Sekunden Material, die den Beginn des Streits einfangen, und man sieht, wie die Situation sofort kippt und in den Tumult übergeht. An diesem Punkt hat dann eine unbekannte Person, die nicht auf dem Bild zu sehen ist, die Aufzeichnung unterbrochen.«
»Keine verwertbaren Fingerabdrücke an der Wand, dem Kabel oder der Kamera«, ergänzte Charlie.
Sara fuhr fort. »Der Streit fing im vorderen Teil des Raums an, bei der Servicetheke. Er kochte sehr schnell hoch. Sechs Insassen von einer rivalisierenden Gang stürzten sich in den Kampf. Vasquez blieb an dem Ecktisch dort drüben sitzen. Die elf anderen Männer an seinem Tisch rannten nach vorn, um einen besseren Blick auf die Auseinandersetzung zu haben. Dann endet die Aufzeichnung.«
Will schätzte die Entfernungen ab. Die Kamera befand sich an der Rückwand, keiner der elf Männer konnte sich also zurückgeschlichen haben, ohne erfasst zu werden.
»Hier entlang.« Sara führte sie zu einem Tisch in der Ecke. Zwölf Essenstabletts standen vor zwölf Plastikstühlen. Das Essen war verdorben. Saure Milch hatte sich über den Tisch ergossen. »Vasquez wurde von hinten angegriffen. Einwirkung stumpfer Gewalt führte zu einem Schädelbruch. Die Waffe war wahrscheinlich ein kleiner, schwerer Gegenstand, der mit hoher Geschwindigkeit geschwungen wurde. Die Wucht des Schlags ließ seinen Kopf nach vorn schnellen. In dem Tablett stecken Fragmente, die offenbar von Vasquez’ Vorderzähnen stammen.«
Will warf einen Blick zur Kamera zurück. Das Ganze sah nach einer Zwei-Mann-Unternehmung aus – einer, der die Aufzeichnung unterbrach, und einer, der die Zielperson ausschaltete.
Faiths Maske wölbte sich vor und zurück, da sie durch den Mund atmete. »Sollte der erste Schlag töten oder nur kampfunfähig machen?«
»Zur Absicht kann ich nichts sagen«, erwiderte Sara. »Der Schlag war erheblich. Ich konnte keine Platzwunde feststellen, aber es sieht nach einer eingedrückten Fraktur aus – der zertrümmerte Knochen drückt auf das Gehirn.«
»Wie lange war er bei Bewusstsein?«, fragte Amanda.
»Wir können aus den Spuren folgern, dass er bis zu seinem Tod bei Bewusstsein war. Zu seinem Zustand kann ich nichts sagen. War ihm übel? Mit Sicherheit. Sah er verschwommen? Wahrscheinlich. Wie viel hat er noch mitbekommen? Unmöglich zu sagen. Jeder Mensch reagiert anders auf ein Schädeltrauma. Aus medizinischer Sicht ist es so, dass wir bei Gehirnverletzungen immer nur wissen, dass wir nichts wissen.«
»Natürlich.« Amanda hatte die Arme verschränkt.
Will verschränkte ebenfalls die Arme. Jeder Muskel in seinem Körper zog sich zurück. Seine Haut fühlte sich unnatürlich straff an. Egal, wie viele Tatorte er untersuchte, sein Körper würde nie akzeptieren, dass es eine natürliche Situation war, sich in der Nähe eines gewaltsam ums Leben gekommenen Menschen aufzuhalten. Er kam mit dem Gestank von verdorbenem Essen und Exkrementen zurecht. Aber der metallische Geschmack von Blut, wenn das Eisen oxidierte, würde noch eine Woche lang hinten in seinem Gaumen haften.
»Vasquez wurde niedergeschlagen«, sagte Sara. »Drei linksseitige Backenzähne sind an der Wurzel abgebrochen. Außerdem Fraktur des Kiefer- und Augenhöhlenknochens auf der linken Seite. Man sieht, dass die Blutspritzer an der Wand und der Decke ein halbkreisförmiges Muster aufweisen. Es gibt drei verschiedene Fußabdrücke; Sie suchen also nach zwei Angreifern, beide wahrscheinlich Rechtshänder. Ich vermute, dass ein Sockenschloss verwendet wurde, es wird also keine erkennbaren Tatspuren an den Händen des Angreifers geben.«
Ein Sockenschloss war ziemlich genau das, wonach es sich anhörte – ein Vorhängeschloss in einer Socke.
Sara fuhr fort. »Vasquez war aus irgendeinem Grund barfuß nach dem ursprünglichen Angriff, wir haben seine Schuhe und Socken nirgendwo in der Kantine gefunden. Seine Angreifer trugen die Turnschuhe, die an die Gefangenen ausgegeben werden, beide Paare mit identischem Waffelmuster an der Sohle. Wir konnten aus den Schuh- und Fußabdrücken eine ganze Menge folgern: Der nächste Ort, an den sie ihn brachten, war die Küche.«
»Was ist mit dieser Tätowierung?« Amanda war auf der anderen Seite des Raums und sah auf die abgetrennte Hand hinunter. »Ist das ein Tiger? Eine Katze?«
»Die Tattoo-Datenbank sagt, ein Tiger kann Hass auf die Polizei symbolisieren, eine Katze versinnbildlicht einen Dieb, einen Fassadenkletterer.«
»Ein Sträfling, der die Polizei hasst. Bemerkenswert.« Amanda machte eine rollende Handbewegung in Richtung Sara. »Lassen Sie uns rasch weitermachen, Dr. Linton.«
Sara bedeutete ihnen, ihr in den vorderen Teil der Kantine zu folgen. Auf dem Förderband standen leere Tabletts, zumindest einige Insassen hatten ihr Mittagessen also bereits beendet, als der Tumult losbrach.
»Vasquez war rund eins fünfundsiebzig groß und siebzig Kilo schwer«, sagte Sara. »Unterernährt, aber das ist nicht überraschend, da er starker Drogenkonsument war. Es gibt Einstiche am linken Arm, zwischen den Zehen des linken Fußes und an seiner rechten Halsschlagader. Wir können also davon ausgehen, dass er Rechtshänder war. Im Küchenbereich haben wir ein Fleischerbeil und eine Menge Blut gefunden, was darauf hinweist, dass ihm die linke Hand dort abgetrennt wurde.«
»Er hat sie sich nicht selbst abgehackt?«, fragte Amanda.
Sara schüttelte den Kopf. »Unwahrscheinlich. Schuh- und Fußabdrücke weisen darauf hin, dass er festgehalten wurde.«
Charlie ergänzte: »Die Waffelmuster der Sneakersohlen weisen keine Unterscheidungsmerkmale auf. Wie Sara schon sagte, sind sie hier Standard. Jeder Insasse hat ein Paar.«
Sara hatte Vasquez’ letzten Ruheort erreicht. Sie ging vor einem weiteren Tisch in die Hocke. Alle außer Amanda folgten ihr.
Will blähte die Nasenlöcher. Die Leiche hatte fast zwei volle Tage in der Hitze gelegen. Die Verwesung war weit fortgeschritten, das Fleisch löste sich von den Knochen. Man hatte Vasquez’ Körper offenbar mit den Füßen unter den Tisch geschoben, so wie man schmutzige Socken unters Bett kickt, damit sie aus dem Weg sind. Blutige Streifen auf dem Boden und Schuhabdrücke zeigten, wie ihn mindestens zwei Männer dorthin verfrachtet hatten, wo er nun lag.
Verkrustetes Blut bedeckte Vasquez’ nackte Füße. Er lag auf der Seite, in der Hüfte eingeknickt. Die verbliebene Hand war nach vorn ausgestreckt. Der blutige Stumpf am anderen Arm steckte buchstäblich in seinem Bauch. Vasquez’ Mörder hatten so oft auf ihn eingestochen, dass sich seine Eingeweide wie eine groteske Blüte geöffnet hatten. Den Armstumpf hatte man ihm wie einen Stängel in die Bauchhöhle gerammt.
»Mangels gegenteiliger Hinweise ist die Todesursache wahrscheinlich Verbluten oder Schock.«
Der Mann sah weiß Gott geschockt aus. Seine Augen standen weit offen. Die Lippen waren leicht geöffnet. Er hatte ein gewöhnliches Gesicht, wenn man davon absah, dass es aufgedunsen war und sich ein dunkler Halbmond gebildet hatte, wo sich das Blut an der tiefsten Stelle des Schädels gesammelt hatte. Kahl geschorener Kopf. Pornobalken-Schnauzbart. Ein Kreuz hing an einer dünnen goldenen Kette um seinen Hals, was die Gefängnisleitung gestattete, da es ein religiöses Symbol war. Die Kette war sehr feingliedrig. Vielleicht ein Geschenk seiner Mutter, Tochter oder Freundin. Es hatte für Will etwas zu bedeuten, dass die Mörder Vasquez’ Schuhe und Socken mitgenommen, aber die Halskette zurückgelassen hatten.
»Scheiße. Das ist Scheiße.« Faith presste beide Hände auf die Gesichtsmaske und würgte. Vasquez’ Eingeweide hingen wie rohe Würste aus dem Unterleib. Fäkalien hatten sich auf dem Boden gesammelt und waren zu einer schwarzen Masse von der Größe eines Basketballs, dem die Luft ausgegangen war, eingetrocknet.
»Schau nach, ob sie Vasquez’ Zelle schon auf den Kopf gestellt haben«, sagte Amanda zu Faith. »Falls ja, will ich wissen, wer es getan hat und was sie gefunden haben. Falls nicht, dann hast du die Ehre.«
Man musste Faith nicht zweimal sagen, dass sie sich nicht weiter mit der Leiche beschäftigen sollte.
»Will.« Amanda tippte schon wieder in ihr Handy. »Schließen Sie das hier ab, dann starten Sie die zweite Runde der Befragungen. Diese Männer hatten genug Zeit, sich ihre Geschichten zurechtzulegen. Ich möchte, dass die Sache schnell aufgeklärt wird. Wir suchen hier nicht nach einer Nadel im Heuhaufen.«
Nach Wills Dafürhalten taten sie genau das. Es gab rund tausend Verdächtige, samt und sonders überführte Kriminelle. »Ja, Ma’am.«
Sara bedeutete ihm mit einem Kopfnicken, ihr in die Küche zu folgen. Sie zog ihre Maske herunter. »Faith hat länger durchgehalten, als ich gedacht hätte.«
Will entledigte sich ebenfalls seiner Maske. In der Küche herrschte das gleiche Durcheinander wie draußen. Überall Tabletts, Essen, Blut. Gelbe Plastikmarkierungen auf der Schneidefläche zeigten an, wo man Vasquez’ Hand abgehackt hatte. Ein Fleischerbeil lag auf dem Boden. Blut hatte sich wie ein Wasserfall von der Anrichte ergossen.
»Keine Fingerabdrücke auf dem Messer«, sagte Sara. »Sie haben den Griff mit Plastikfolie umwickelt, die sie dann in den Ausguss gestopft haben.«
Will sah, dass der Abfluss unter der Spüle zerlegt worden war. Saras Vater war Installateur – sie kannte sich mit einem Siphon aus.
»Alle meine Befunde zeigen, dass sie die Geistesgegenwart besessen haben, ihre Spuren zu verwischen«, sagte Sara.
»Wieso haben sie die Hand in die Kantine gebracht?«
»Ich vermute, sie haben sie einfach durch den Raum geschleudert.«
Will versuchte, eine brauchbare Theorie zu der Tat aufzustellen. »Als der Streit anfing, blieb Vasquez am Tisch sitzen. Er stand nicht auf, weil er neutral war.« Gefängnisinsassen hatten ihre eigene Art NATO. Ein Angriff auf einen Verbündeten bedeutete, dass man mitkämpfte. »Nur zwei Kerle sind auf ihn losgegangen, keine Bande.«
»Engt das den Kreis deiner Verdächtigen ein?«, fragte Sara.
»Insassen neigen dazu, Rassentrennung zu praktizieren. Vasquez wird sich vermutlich nicht offen mit Insassen anderer Herkunft verbrüdert haben.« Der Heuhaufen war geringfügig kleiner geworden. »Ich vermute, das Verbrechen war abhängig von einer passenden Gelegenheit geplant: Wenn es zu einem Aufruhr kommt, töten wir ihn folgendermaßen …«
»Chaos erzeugt Möglichkeiten.«
Will rieb sich das Kinn und studierte die blutigen Schuh- und Fußabdrücke auf dem Boden. Vasquez hatte sich nach Leibeskräften gewehrt. »Er muss über Informationen verfügt haben, die sie aus ihm herausquetschen wollten, oder? Man hackt nicht jemandem einfach so die Hand ab. Man hält ihn fest, man droht ihm, und wenn er einem dann noch immer nicht gibt, was man haben will, nimmt man ein Fleischerbeil und hackt ihm die Hand ab.«
»So würde ich es machen.«
Will lächelte.
Sara lächelte zurück.
Wills Handy summte in seiner Tasche. Er ignorierte den Anruf. »Vasquez war dafür bekannt, dass er Telefone im Körper versteckt hat. Haben sie ihn vielleicht deshalb ausgeweidet?«
»Ich weiß nicht, ob sie ihn wirklich ausgeweidet oder nicht eher wiederholt auf ihn eingestochen haben. Wenn sie nach einem Telefon gesucht haben, dürfte das Einprügeln mit dem Sockenschloss auf die Rippen wahrscheinlich zu einer Art Valsalva-Effekt geführt haben. Es hat ja einen Grund, warum Gefängniswärter einen husten lassen, wenn man vornübergebeugt steht. Der erhöhte Unterleibsdruck verringert die Kraft des Schließmuskels. Das Telefon wäre schon beim ersten Schlag herausgerutscht«, sagte Sara. »Außerdem ergibt es nicht viel Sinn, durch den Bauch zu schneiden. Wenn ich nach einem Telefon in deinem Arsch suche, sehe ich doch genau in deinem Arsch nach.«
Faiths Timing war perfekt. »Wollt ihr ungestört sein?«
Will nahm sein Handy aus der Tasche. Der verpasste Anruf vorhin war von Faith gekommen. »Wir glauben, dass Vasquez’ Mörder nach etwas gesucht haben. Informationen. Vielleicht ein Versteck.«
»Vasquez’ Zelle war sauber«, sagte Faith. »Keine Schmuggelware. Seiner Kunstsammlung nach zu schließen war er ein Freund nackter Damen und unseres Herrn Jesus Christus.« Sie winkte Sara zum Abschied und führte Will durch die Kantine zurück. Ihre Hand hatte sie zum Schutz vor dem Gestank auf die Nase gelegt. »Nick und Rasheed haben unsere Liste der Verdächtigen auf achtzehn Kandidaten eingegrenzt. Keiner wegen Mordes vorbestraft, aber wir haben zwei Totschläger und einen Fingerbeißer.«
»Sein eigener Finger oder der von jemand anderem?«
»Von jemand anderem«, sagte Faith. »Überraschenderweise gibt es keine zuverlässigen Zeugenaussagen, aber jede Menge Verräter haben idiotische Verschwörungstheorien ausgeplaudert. Wusstest du, dass der Schattenstaat über das System der Gefängnisbibliotheken einen Pädophilenring unterhält?«
»Ja«, sagte Will. »Denkst du, hinter dem Mord steckt ein persönlicher Aspekt?«
»Ganz sicher. Wir suchen nach zwei Hispanos, etwa in Vasquez’ Alter und aus dem engeren Kreis seines sozialen Umfelds?«
Will nickte. »Wann wurde Vasquez’ Zelle das letzte Mal gründlich durchsucht?«
»Es gab vor sechzehn Tagen eine Durchsuchung im gesamten Gefängnis. Der Direktor hat acht CERT-Teams hinzugezogen, um die Zellen auf den Kopf zu stellen. Das Sheriffbüro hat zwölf Deputys zur Verfügung gestellt. Shock and awe – die klassische Taktik von Schrecken und Furcht. Niemand hat es kommen sehen. Mehr als vierhundert Telefone wurden konfisziert, vielleicht zweihundert Ladegeräte, dazu die üblichen Drogen und Waffen, aber die Telefone waren natürlich das eigentliche Problem.«
Will wusste, was sie meinte. In einem Gefängnis konnten Mobiltelefone sehr gefährlich sein, auch wenn nicht alle Insassen sie für strafbare Zwecke nutzten. Der Staat sahnte bei allen Festnetzgesprächen ab, indem er ein Minimum von fünfzig Dollar für den Erwerb einer Telefonkarte verlangte, dann rund fünf Dollar für ein fünfzehnminütiges Gespräch und fast noch einmal fünf, wenn man sein Guthaben aufstockte. Ein Handy von einem anderen Insassen konnte man hingegen für etwa fünfundzwanzig Dollar die Stunde mieten.
Dann gab es die strafbare Verwendung. Smartphones konnte man dazu benutzen, um persönliche Informationen über Vollzugsbeamte zu sammeln, kriminelle Organisationen über verschlüsselte Nachrichten zu überwachen, Schutzgelderpressungen bei Familien von Mithäftlingen zu organisieren und – am wichtigsten – Geld einzusammeln. Apps wie PayPal und Venmo hatten Zigaretten und irgendwelche Geräte als Gefängniswährung abgelöst. Die anspruchsvolleren Gangs benutzten Bitcoins. Die Aryan Brotherhood, die Irish Mob Gang und die United Blood Nation strichen Millionen über das staatliche Strafvollzugssystem ein.
Handysignale zu blockieren war in den Vereinigten Staaten verboten.
Will hielt Faith die Tür auf, als sie das Gebäude verließen. Die Sonne brannte auf den leeren Gefängnishof hinunter. Er sah Schatten hinter den schmalen Fenstern der Zellen. Ein paar Männer brüllten. Der Druck aufgrund des Lockdowns war beinahe mit Händen zu greifen.
»Die Verwaltung.« Faith deutete auf ein einstöckiges Gebäude mit Flachdach. Sie nahmen den langen Weg um den Hof herum, statt quer über den gewalzten roten Sandplatz zu gehen.
Dort kamen sie an drei Vollzugsbeamten vorbei, die am Zaun lehnten und ins Leere starrten. Es gab nichts zu bewachen. Sie schienen genauso gelangweilt wie die Insassen. Oder vielleicht ließen sie sich nur Zeit. Sechs ihrer Kollegen waren bei dem Aufruhr verletzt worden. Als eingeschworene Gruppe waren Vollzugsbeamte nicht gerade dafür bekannt, dass sie leicht vergaben und vergaßen.
Faith sprach mit gesenkter Stimme. »Der Direktor ist total ausgerastet wegen der Telefone. Rassentrennung galt bereits bei voller Belegung. Er hat alle Hofgänge ausgesetzt, den Gefängnisladen geschlossen, Besuchszeiten gestrichen, Computer und Fernseher abgestellt und sogar die Bibliothek geschlossen. Zwei Wochen lang konnten die Typen hier drin nichts weiter tun, als sich gegenseitig hochzuschaukeln.«
»Klingt nach einer schlauen Methode, um einen Tumult auszulösen.« Will öffnete eine weitere Tür. Sie gingen an Büros mit Sichtfenstern zum Flur vorbei. Alle Stühle waren leer. Statt Schreibtischen gab es Klapptische, damit niemand etwas verstecken konnte. Die meisten Verwaltungsjobs wurden von Insassen erledigt. Ihr Stundenlohn von drei Cent war schwer zu unterbieten.
Das Büro des Direktors hatte kein Fenster zum Gang, aber Will erkannte Amandas täuschend ruhigen Tonfall hinter der geschlossenen Tür. Er stellte sich vor, dass der Mann schäumte. Direktoren mochten es nicht, überprüft zu werden. Ein weiterer Grund, warum der Mann wegen der vielen konfiszierten Telefone ausgeflippt war: Nichts war demütigender, als einen deiner Insassen live aus deiner eigenen Anstalt mit einem Fernsehsender sprechen zu hören.
»Wie viele Anrufe gingen während der Unruhen raus?«, wollte Will von Faith wissen.
»Einer zu CNN und einer zu 11Alive, aber es gab gerade eine Wahlskandalgeschichte, deshalb achtete niemand darauf.«
Sie hatten einen langen, breiten Flur mit einer noch längeren Schlange von Insassen erreicht. Es waren ihre achtzehn Mordverdächtigen, nahm Will an. Die Männer waren wie traurige gleichschenklige Dreiecke aufgestellt. Ihre Oberkörper waren nach vorn geneigt, die Beine gerade, und ihr ganzes Gewicht ruhte auf ihrer Stirn an der Wand, weil die beiden für sie zuständigen Vollzugsbeamten offenbar Riesenarschlöcher waren.
Die Regeln bei einem Lockdown schrieben vor, dass jeder Insasse außerhalb seiner Zelle auf eine Weise gefesselt wurde, die sich vierteiliger Anzug nannte. Die Hände mit Handschellen gesichert und die Handschellen vor dem Bauch an einer Kette befestigt. Die Fußknöchel waren mit einer dreißig Zentimeter langen Kette verbunden, was die Männer zu einem tänzelnden Gang zwang. Wenn man so gefesselt war und gezwungen wurde, sich mit der Stirn an eine Betonwand zu lehnen, lastete eine Menge Druck auf dem Hals und den Schultern. Die Bauchkette belastete das Kreuz zusätzlich, da die Hände durch die Schwerkraft nach vorn gezogen wurden. Offenbar standen die Männer schon eine ganze Weile so. Schweiß lief an den Wänden hinab. Will sah zitternde Gliedmaßen. Ketten rasselten wie Münzen in einem Wäschetrockner.
»Du lieber Himmel«, murmelte Faith.
Während Will ihr die Reihe entlang folgte, sah er eine Phalanx von Tätowierungen, allesamt im üblichen wackligen Gefängnisstil. Die Insassen schienen alle über dreißig zu sein, was logisch war. Will wusste aus Erfahrung, dass Männer unter dreißig eine Menge Dummheiten machten. Wenn ein Mann nach seiner dritten Lebensdekade immer noch im Gefängnis war, dann hatte er entweder richtig Scheiße gebaut, oder er war richtig verscheißert worden, oder aber er traf bewusst die Art von schlechten Entscheidungen, die ihn in dem Kreislauf festhielten.
Faith machte sich nicht die Mühe, an die geschlossene Tür des Vernehmungszimmers zu klopfen. Die Special Agents Nick Shelton und Rasheed Littrell saßen mit einem Stapel Akten vor sich am Tisch.
»… sag dir, die Kleine hatte einen Hintern wie ein Zentaur.« Rasheed unterbrach seine Geschichte, als Faith eintrat. »Sorry, Mitchell.«
Faith machte ein finsteres Gesicht, als sie die Tür schloss. »Ich bin doch kein halbes Pferd!«
»Scheiße, bedeutet es das etwa?« Rasheed lachte gutmütig. »Was läuft, Trent?«
Will hob zur Begrüßung kurz das Kinn.
Faith blätterte durch die Akten auf dem Tisch. »Sind das alle Dossiers?«
Das Dossier eines Insassen war praktisch ein Tagebuch seines Lebens – Berichte über Festnahmen, Verurteilungen, Einzelheiten zu Verlegungen, Krankenblätter, Beurteilung des geistigen Zustands, Einschätzung seiner Gefährlichkeit, Bildungsniveau, Behandlungsprogramme, Aufzeichnungen seiner Besuche, Disziplinarstrafen, religiöse Orientierung, sexuelle Präferenz.
»Sieht irgendwer verheißungsvoll aus?«, fragte Faith.
Rasheed klärte sie über die achtzehn Gefangenen im Flur auf. Will hatte dem Special Agent die ganze Zeit das Gesicht zugewandt, als würde er genau zuhören, aber in Wirklichkeit überlegte er, was er zu Nick Shelton sagen sollte.
Vor etlichen Jahren, als Nick dem südöstlichen Außenbüro des GBI zugeteilt war, hatte er sehr eng mit Jeffrey Tolliver, Saras totem Ehemann, zusammengearbeitet, dem Polizeichef von Grant County. Er hatte auf dem College Football gespielt, und nach allem, was man hörte, war er ein toller Hecht. Manche von Nicks Zusammenfassungen ihrer Fälle lasen sich wie ein Filmdrehbuch. Jeffrey Tolliver war der Lone Ranger, und Nick war sein Tonto gewesen – ein Tonto, der so lässig wie Barry Gibb von den Bee Gees mit Goldkettchen und viel zu engen Jeans daherkam. Die beiden Cops hatten Pädophilenringe, Drogenhändler und Mörder zur Strecke gebracht. Jeffrey hätte seine Verdienste in einen wesentlich höheren Gehaltsscheck in einer größeren Stadt ummünzen können, aber er hatte auf Ruhm und Ehre verzichtet, um Grant County zu dienen.
Wahrscheinlich hätte Sara ihn auch ein drittes Mal geheiratet, wenn er nicht während der zweiten Runde ums Leben gekommen wäre.
»Damit kann man arbeiten«, sagte Faith. Anders als Will hatte sie bei Rasheeds Zusammenfassung tatsächlich aufgepasst. »Sonst noch etwas?«, fragte sie.
»Nö.« Nick kratzte sich seinen Barry-Gibb-Bart. »Ihr könnt den Raum hier übernehmen. Rash und ich müssen noch mal ein paar Zeugen befragen.«
Faith setzte sich auf Rasheeds frei gewordenen Platz und griff sofort nach den Disziplinarberichten. Sie glaubte fest daran, dass sich Geschichte immer wiederholte.
Nick fragte Will: »Was treibt Sara so?«
Will hetzte in Gedanken durch eine Reihe demütigender Antworten, dann entschied er sich für: »Sie ist in der Kantine. Du solltest ihr Hallo sagen.«