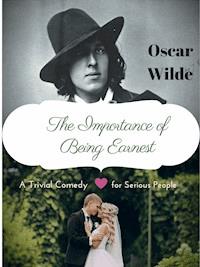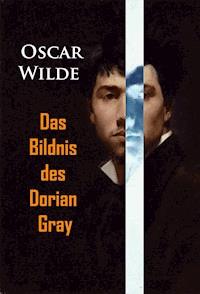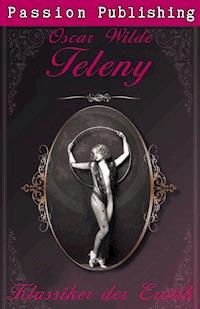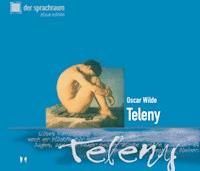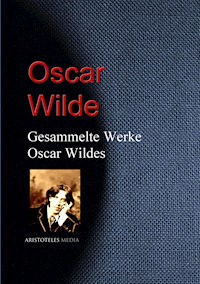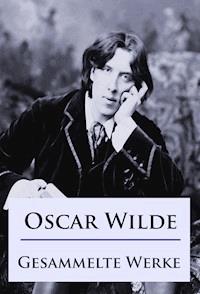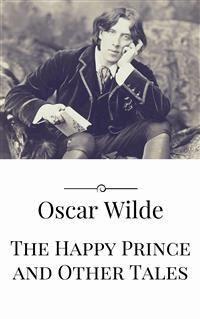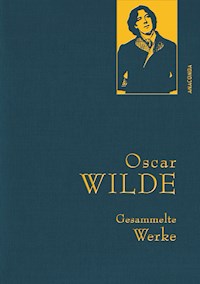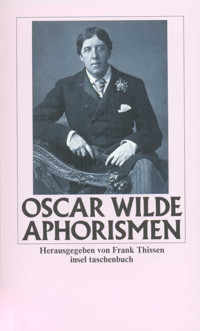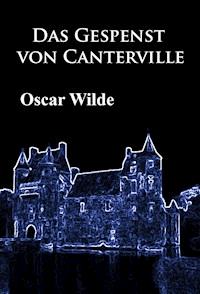12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Männerschwarm Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In seinen Essays legt Oscar Wilde die philosophischen Grundlagen für seine Theaterstücke. Die Bewertung von Schein und Sein, von Kritik und Kunst, von Schönheit und Emotionalität steht hier im Zentrum seines Denkens. Mit eleganten Formulierungen führt Wilde seine Leser zu Einsichten, die zunächst oft paradox klingen, deren Tragweite sich jedoch unaufhaltsam vermittelt. Vielleicht war es gut gemeint, Wilde nach seinen Prozessen als gebildeten Clown zu rehabilitieren, aber die Unsitte, aus dem Zusammenhang gerissene Formulierungen als "Aphorismen" zu zitieren, steht der Rezeption seiner klugen Überlegungen seit langem im Weg. Die Ausgabe enthält die drei Dialoge "The Truth of Masks", "The Critic as Artist" und "The Portrait of Mr. W. H." in Übersetzungen von Joachim Bartholomae bzw. Volker Oldenburg; außerdem Auszüge aus den Prozessakten, die allesamt der Frage nachgehen: Was bleibt, und was ist vergänglich im Leben?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 240
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
OSCAR WILDE
DIE WAHRHEIT VON MASKEN
Drei Essaysaus dem Englischen von Joachim Bartholomae und Volker Oldenburg
Männerschwarm Verlag Hamburg 2013
VORWORT
Dieser Band möchte die Aufmerksamkeit auf eine Facette der Persönlichkeit Oscar Wildes lenken, die ihm selbst besonders wichtig war: seine Rolle als homme de lettres, als literarischer Vortragsredner und Aufsatzschreiber, eine Rolle, in der er bereits internationale Bekanntheit erlangt hatte, bevor seine Hauptwerke erschienen.
Nach der Veröffentlichung eines ersten Gedichtbands begibt sich Wilde Ende 1881 im Alter von 27 Jahren auf eine einjährige Vortragsreise durch die USA, lebt danach für kurze Zeit in Paris und kehrt dann nach London zurück, wo er bald heiratet und für einige Jahre ein beschauliches Familienleben führt. In den Jahren 1886 bis 1889 veröffentlicht er mehrere kunstkritische und politische Essays, 1890 erscheint Das Bildnis des Dorian Gray, in den Jahren 1892 bis 1895 dann seine berühmten Theaterstücke. 1895 kommt sein öffentliches Leben zu einem abrupten Ende. Als ihn der Vater seines Freundes als Homosexuellen «outet», strengt Wilde einen Verleumdungsprozess an, den er jedoch verliert. Er wird nun seinerseits als Homosexueller angeklagt und verurteilt. Wilde stirbt fünf Jahre später im Pariser Exil.
Die Texte dieses Bandes zeigen das frühe philosophischphilologische Werk in seiner ganzen Vielfalt: Der älteste von ihnen, Die Wahrheit von Masken aus dem Jahr 1885, ist eine geradezu akademische Untersuchung der Bedeutung, die Shakespeare der Ausstattung seiner Theaterstücke beigemessen hat. Wilde bricht hier eine Lanze für die historische Aufführungspraxis und gelangt zu der Auffassung, dass historisches Fachwissen nur durch die Verwendung als Rohstoff von Kunstwerken welcher Gattung auch immer angemessen «aufbewahrt» und den Menschen späterer Zeiten zugänglich gemacht werden kann.
Vier Jahre später veröffentlicht Wilde mit der Erzählung Das Porträt des Mr W. H. eine zweite Arbeit zu Shakespeare; jetzt geht es um die Sonette. Nicht zuletzt deshalb, weil gut die Hälfte dieser Liebesgedichte zweifellos an einen Mann gerichtet sind, haben sich viele kluge Köpfe Gedanken darüber gemacht, wer sich wohl hinter den Initialen «W. H.» verbergen mag, mit denen Shakespeare den Namen des Widmungsträgers der Sonette abkürzte. In Wildes Erzählung vertiefen sich drei junge Männer nacheinander geradezu mit Besessenheit in den Nachweis der These, es handele sich um den jugendlichen Schauspieler Willie Hughes, ein Mitglied von Shakespeares Theatertruppe. Mit Bezug auf Die Wahrheit von Masken könnte man sagen, dass auch hier keine akademische Forschung betrieben, sondern historisches Material in den Händen des Künstlers zu einer höheren «Wahrheit» verarbeitet wird, wobei die Wahrheit von diesen jungen Leuten allerdings nach Bedarf zurechtgebogen wird. Offensichtlich hat es Wilde ein großes Vergnügen bereitet zu zeigen, wie sich eine wirklich faszinierende kleine Geschichte auf einem Fundament von Lügen und Spekulationen errichten lässt.
Auch der dritte und umfangreichste Text stellt die Frage nach dem Verhältnis von Kunst und Wirklichkeit. 1890, also im gleichen Jahr wie die Erzählung Das Bildnis des Dorian Gray, erschien Wildes gewissermaßen sokratischer Dialog Der Kritiker als Künstler. Die Parallelen von Erzählung und Essay sind frappierend: Basil Hallwards Gemälde zeigt stets das «wahre» Gesicht Dorian Grays, indem es sich allen Naturgesetzen zum Trotz an dessen seelische Entwicklung anpasst; dagegen «lügt» die Wirklichkeit, hier das reale Erscheinungsbild des Porträtierten. Die Behauptung einer größeren Wahrheit (und Lebendigkeit!) der Kunst gegenüber dem Leben ist die zentrale These auch des Essays, wobei Wilde diesen Gedanken hier noch einmal steigert, indem er der Kritik die gleiche Überlegenheit über die Kunst bescheinigt wie der Kunst gegenüber dem Leben. Nach seinem Verständnis ist Kritik gewissermaßen eine Kunst zweiter Ordnung, die sich kreativer Kunstwerke als ihres Materials bedient. Natürlich redet Wilde hier nicht von einer rezensierenden Kritik; die «höchste» Kritik ist vielmehr die literarische Beschreibung der eigenen Eindrücke beim Erleben von Kunstwerken. Damit behauptet er die ästhetische Überlegenheit des (kritischen) Eindrucks gegenüber dem (kreativen) Ausdruck.
Wilde definiert die wahre Kritik als «die einzige zivilisierte Form der Autobiografie, denn sie schildert keine Ereignisse, sondern Gedanken, nicht die Taten und Zufälligkeiten des physischen Lebens, sondern die geistigen Stimmungen und die Leidenschaften der Fantasie». So kommt es, dass Der Kritiker als Künstler als eines der persönlichsten Werke Wildes gelten kann, in dem er anhand der unterschiedlichsten historischen, philosophischen und ästhetischen Beispiele in erster Linie das eigene Lebensgefühl und die eigene Weltanschauung beschreibt. Insofern ist es kein Zufall, dass sich einige Formulierungen dieses Essays fast wörtlich im Protokoll der Gerichtsverhandlung wiederfinden, in deren Verlauf Oscar Wilde vom Kläger zum Beklagten wurde und dem Anwalt des Marquess von Queensberry (der ihn im Rahmen seiner bescheidenen Orthografiekenntnisse als «posing Somdomite» bezeichnet hatte) über seine moralischen Wertvorstellungen Rede und Antwort stehen musste. Ein kurzer Auszug aus dem Verhör vor Gericht ist dieser Sammlung deshalb als eine Art Prolog vorangestellt.
Oscar Wilde propagiert in diesen Texten die Erkenntnis und Verehrung der Schönheit als einzigen Weg der persönlichen Reifung und zeigt sich damit als rückhaltloser Idealist im eigentlichen Wortsinn. In Deutschland zog sich sechzig Jahre zuvor August von Platen wegen ebenderselben Haltung den Spott und die Verachtung Heinrich Heines zu. Anders als Platen suchte Oscar Wilde keinen Streit mit seinen Dichterkollegen. Seine Geringschätzung verwandelte er in oft boshafte Aphorismen. Wie ernst es ihm mit diesen nur vermeintlich paradoxen und selbstverliebten Formulierungen war, ist in Der Kritiker als Künstler nachzulesen.
Joachim Bartholomae
STRAFGERICHTSVERHANDLUNG
Old Bailey, 3. bis 5. April 1895 Die Königin (aufgrund einer Anzeige von Oscar Wilde) vs. John Douglas (Marquess von Queensberry), angeklagt der üblen Nachrede
3. April 1895, Nachmittag: Oscar Wilde als Zeuge der Anklage im Kreuzverhör durch den Anwalt der Verteidigung (Auszug)
CARSON: Dies hier steht in Ihrer Einleitung zu Dorian Gray: «Es gibt keine moralischen oder unmoralischen Bücher. Bücher sind entweder gut oder schlecht geschrieben.» Ist das Ihre Ansicht?
WILDE: Meine Ansicht der Kunst, ja.
CARSON: Dann ist also ein Buch, so unmoralisch es auch sein mag, Ihrer Meinung nach ein gutes Buch, solange es gut geschrieben ist?
WILDE: Ja, wenn es insofern gut geschrieben ist, als es ein Gefühl von Schönheit erzeugt, das höchste Gefühl, das ein Mensch zu empfinden vermag. Wäre es schlecht geschrieben, würde es Abscheu hervorrufen.
CARSON: Dann kann ein gut geschriebenes Buch, das abartige Ansichten von Moral verbreitet, ein gutes Buch sein?
WILDE: Kein Kunstwerk verbreitet irgendwelche Ansichten. Ansichten sind etwas für Menschen, die keine Künstler sind.
CARSON: Dann sagen wir also, Ihrer Meinung nach könnte ein sodomitischer Roman ein gutes Buch sein.
WILDE: Ich weiß nicht, was Sie unter einem sodomitischen Roman verstehen.
CARSON: Nehmen wir Dorian Gray. Könnte man das als ein sodomitisches Buch auffassen?
WILDE: Nur ein roher, ungebildeter Mensch könnte es so verstehen.
CARSON: Ein ungebildeter Mensch, der Dorian Gray liest, könnte es für ein sodomitisches Buch halten?
WILDE: Das Kunstverständnis ungebildeter Menschen tut nichts zur Sache. Ihre Dummheit ist unberechenbar. Sie können mich nicht danach fragen, auf welche Weise unwissende, ungebildete, närrische Menschen meinen Roman missverstehen könnten. Das geht mich nichts an. Mir geht es in meiner Kunst um meine Sichtweise, meine Gefühle und mein Anliegen. Was andere Menschen davon halten, interessiert mich nicht für fünf Pfennig.
CARSON: Sie würden wohl die Mehrheit der Menschen als Philister und Ungebildete bezeichnen?
WILDE: Oh, ich bin wunderbaren Ausnahmen begegnet.
CARSON: Glauben Sie, dass die Mehrheit der Menschen sich darum bemüht, ebenfalls eine solche Pose einzunehmen, wie Sie sie uns vorführen? Oder dass sie dazu erzogen werden?
WILDE: Ich befürchte, dazu sind sie nicht kultiviert genug. (Gelächter)
CARSON: Nicht kultiviert genug, um auf Ihre Weise zwischen einem guten und einem schlechten Buch zu unterscheiden?
WILDE: Mit Sicherheit nicht.
DER KRITIKERALS KüNSTLER
Ein Dialog
Personen: Gilbert und Ernest Ort: Die Bibliothek eines Hauses in Piccadilly mit Blick auf den Green Park
Teil I
Mit einigen Bemerkungen
über die Notwendigkeit des Nichtstuns
GILBERT (am Klavier): Mein lieber Ernest, worüber lachst du?
ERNEST (blickt auf): In der Sammlung von Memoiren, die hier auf dem Tisch lag, bin ich auf eine wunderbare Geschichte gestoßen.
GILBERT: Welches Buch? Ah! Ich verstehe. Das habe ich noch nicht gelesen. Ist es gut?
ERNEST: Nun, ich habe darin geblättert, während du gespielt hast, und fand es ganz amüsant, obwohl ich moderne Memoiren im Grunde nicht mag. Entweder haben die Verfasser bereits alles vergessen, was von Bedeutung war, oder sie haben niemals etwas Bedeutendes erlebt. Darauf beruht natürlich ihr Erfolg – das englische Publikum fühlt sich im Mittelmaß am wohlsten.
GILBERT: Ja, das Publikum ist erstaunlich tolerant. Es kann alles verzeihen, nur nicht das Genie. Ich muss jedoch gestehen, dass ich sehr gerne Memoiren lese. Mir gefällt ihre Form genauso wie ihr Inhalt. Reiner Egoismus in der Literatur ist ein Genuss. Wenn wir die Briefe so unterschiedlicher Persönlichkeiten wie Cicero und Balzac, Flaubert und Berlioz, Byron und Madame de Sévigné lesen, dann ist es der Egoismus, der uns fasziniert. Wann immer wir ihm begegnen, was erstaunlicherweise recht selten geschieht, können wir nicht anders, als ihn dankbar willkommen zu heißen, und wir vergessen ihn nicht so leicht. Die Menschen werden Rousseau ewig lieben, weil er seine Sünden gebeichtet hat, und zwar nicht einem Priester, sondern der ganzen Welt, und weder die Nymphen, die Cellini für König Franz I. schmiedete, noch der grüngoldene Perseus, der in den florentinischen Arkaden dem Mond das tote Schreckbild entgegenhält, das einst Leben in Stein verwandelte, haben ihnen mehr Freude bereitet als die Autobiografie, in der dieser größte Schurke der Renaissance von seinem Glanz und seiner Schande berichtet. Die Ansichten, der Charakter und die Erfolge dieses Mannes spielen dabei keine Rolle. Er könnte ein Skeptiker sein wie der sanfte Herr von Montaigne oder ein Heiliger wie der bittere Sohn der Monika1 – unsere Ohren sind verzaubert und unsre Lippen verstummen, sobald er uns von seinen Sünden erzählt. Das Gedankengebäude des Kardinal Newman – wenn sich der Versuch, intellektuelle Probleme durch die Verleugnung des Intellekts zu lösen, als Gedankengebäude bezeichnen lässt – kann und wird nicht überleben. Doch der Weg dieser gequälten Seele von Dunkelheit zu Dunkelheit wird die Welt zu allen Zeiten in Bann schlagen. Die einsame Kirche in Littlemore, wo «der Morgenhauch feucht, und die Zahl der Gläubigen klein ist», wird den Menschen stets teuer sein, und wenn das gelbe Löwenmaul an der Mauer des Trinity College erblüht, werden sie des liebenswürdigen Studenten gedenken, der im Werden und Vergehen dieser Blume die Prophezeiung erkannte, dass er sein ganzes Leben bei der gütigen Alma Mater verbringen werde – eine Prophezeiung, deren Erfüllung der Glaube in seiner Weisheit oder seinem Wahn nicht duldete. Ja, Autobiografien sind unwiderstehlich. Der arme, einfältige, aufgeblasene Mr Pepys plapperte sich in den Kreis der Unsterblichen, und in dem Glauben, Leichtsinn sei die Mutter der Porzellankiste, wuselt er in diesem «Talar aus dickem Purpursamt mit Goldknöpfen und Tressen», den er uns so genau beschrieben hat, zwischen ihnen herum und fühlt sich pudelwohl. Dabei brabbelt er vom blauen indischen Unterrock, den er seiner Frau gekauft hat, dem «guten Hackbraten» und dem leckeren «französischen Kalbsfrikassee», das ihm so gut geschmeckt hat, vom Kegeln mit Will Joyce und seiner «Jagd auf Schönheiten», dass er am Sonntag Hamlet rezitiert und wochentags Geige spielt, und viele verdorbene und banale Dinge mehr. Selbst heutzutage hat Egoismus noch seine Reize. Was die Menschen über andere erzählen, ist meistens dümmlich; wenn sie dagegen über sich selber reden, wird es fast immer interessant, und wenn man ihnen den Mund verbieten könnte, sobald sie langweilig werden, so wie man ein Buch zuklappt, dann wäre das einfach perfekt.
ERNEST: Im Wenn liegt ungemeine Kraft, wie Probstein sagen würde. Schlägst du denn ernsthaft vor, ein jeder sollte sein eigener Boswell2 werden? Wovon sollen dann all die fleißigen Schreiberlinge leben, die unsere Lebensgeschichten und Erinnerungen zusammentragen?
GILBERT: Wer braucht denn die? Sie sind die Pest unserer Zeit, nicht mehr und nicht weniger. Jeder große Mann hat seine Schleppenträger, und am Ende schreibt immer der Judas die Biografie.
ERNEST: Mein lieber Freund!
GILBERT: Leider verhält es sich so. Früher haben wir unsere Helden emporgehoben; heutzutage zerrt man sie in den Dreck. Große Werke im Preis herabzusetzen mag verdienstvoll sein, aber große Männer herabzusetzen ist abscheulich.
ERNEST: Sagst du mir, auf wen du dich beziehst, Gilbert?
GILBERT: Oh! Auf all diese zweitrangigen Skribenten! Täglich werden sie mehr. Nach dem Tod eines Dichters oder Malers erscheinen sie schon mit dem Bestatter im Trauerhaus, und sie haben vergessen, dass ihre einzige Pflicht darin besteht, den Toten zu beklagen. Lass uns nicht mehr davon reden. Sie sind nichts als die Grabräuber der Literatur – der eine nimmt den Staub, der andere die Asche, doch die Seele entwischt ihnen. Aber jetzt will ich Chopin für dich spielen, oder Dvorak. Soll ich eine Fantasie von Dvorak spielen? Er schreibt so leidenschaftliche, merkwürdig farbige Gebilde.
ERNEST: Nein; mir ist nicht nach Musik. Sie ist so unbestimmt. Außerdem saß ich gestern mit Baroness Bernstein zu Tisch, und obwohl sie ansonsten ganz zauberhaft war, bestand sie darauf, in einer Weise über Musik zu reden, als sei sie in deutscher Sprache geschrieben. Nun, wie Musik auch immer klingen mag, ich bin so froh, dass sie nicht im Geringsten wie Deutsch klingt. Manche Formen des Patriotismus sind ganz einfach entwürdigend. Nein, Gilbert, spiel jetzt nicht mehr. Dreh dich herum und rede mit mir, bis der weiß gehörnte Tag den Raum betritt. Etwas in deiner Stimme ist so wundervoll.
GILBERT (erhebt sich vom Klavier): Heute Abend ist mir nicht nach Reden zumute. Was gibt es da zu lächeln! Es ist wirklich so. Wo sind die Zigaretten? Danke. Wie exquisit diese Blüten doch sind! Sie scheinen aus Bernstein und kühlem Elfenbein gemacht, wie griechische Kunstwerke der besten Epoche. Was war es, worüber du eben lachen musstest, als du die Bekenntnisse dieses reuigen Akademiekünstlers gelesen hast? Erzähl es mir. Wenn ich Chopin gespielt habe, ist mir, als hätte ich über Sünden geweint, die ich nicht begangen habe, und über Schicksale getrauert, die mir nie widerfahren sind. Musik ruft bei mir stets diese Wirkung hervor. Sie beschwört eine Vergangenheit, von der man nichts wusste, und erfüllt die Seele mit Kümmernissen, die vor den Tränen verborgen waren. So kann es geschehen, dass ein Mann, der ein ganz gewöhnliches Leben führt, durch Zufall ein Musikstück hört und entdeckt, welche furchtbaren Erfahrungen seine Seele gesammelt hat, ängstliche Freuden, wilde, romantische Liebe oder großen Verzicht, ohne dass er je davon wusste. Erzähl mir also die Geschichte, Ernest, und heitere mich auf.
ERNEST: Oh! Sie ist bestimmt nicht wichtig. Mir schien sie jedoch ein bewundernswertes Beispiel für den Wert der gewöhnlichen Kunstkritik zu sein. Der reuige Akademiekünstler, wie du ihn nennst, wurde eines Tages ernsthaft von einer Dame gefragt, ob sein berühmtes Bild «A Spring-Day at Whiteley’s», vielleicht auch «Waiting for the Last Omnibus» oder dergleichen, vollständig von Hand gezeichnet sei.
GILBERT: Und, war es das?
ERNEST: Du bist wirklich unverbesserlich. Aber im Ernst, wozu brauchen wir die Kunstkritik? Warum lassen wir den Künstler nicht in Ruhe eine neue Welt erschaffen, wenn er das möchte, oder, wenn nicht, die Schatten der Welt abzeichnen, wie wir sie kennen? Wir wären wohl beide, denke ich, diese Welt herzlich leid, würde die Kunst mit ihrem zarten Sinn und feinen Instinkt für Wahl und Auswahl sie nicht für uns reinigen und ihr einen Augenblick der Vollkommenheit schenken. Mir scheint, die Fantasie sucht die Einsamkeit, oder sie sollte es tun, und sie verrichtet ihr Werk am besten in Schweigen und Abgeschiedenheit. Was nützt es, den Künstler mit dem schrillen Zetern der Kritik zu stören? Warum maßen Menschen, die selbst nichts erschaffen können, sich an, den Wert kreativer Arbeit zu beurteilen? Was können sie davon schon verstehen? Denn das, was leicht verständlich ist, braucht keine Erklärung …
GILBERT: Und das Unverständliche zu erklären wäre niederträchtig.
ERNEST: Das habe ich nicht gesagt.
GILBERT: Ah! Das solltest du aber. Es sind uns heute so wenige Geheimnisse geblieben, dass wir uns nicht erlauben können, auch nur ein einziges davon zu verlieren. Die Mitglieder der Browning Society zum Beispiel tun anscheinend ihr Bestes, die Göttlichkeit des Geheimnisses zu zerreden, als wären sie Autoren einer Edition wie Mr Walter Scott’s Great Writers oder Theologen der Broad Church Party. Denen, die Browning3 für geheimnisvoll hielten, erklären sie, dass er sich lediglich schlecht auszudrücken weiß. Denen, die meinten, er habe etwas zu verbergen, erwidern sie, er habe wenig zu enthüllen. Ich spreche hier nur von seinen rätselhaften Werken. Der Mann selbst war bedeutend. Zwar war er kein Olympier und so bedürftig wie ein Titan. Er sah nicht über die Dinge hinaus und fand selten eine Melodie. Sein Werk ist von Anstrengung, Gewalt und Mühe gezeichnet, statt vom Gefühl zur Form gelangte er nur vom Gedanken ins Chaos. Trotzdem war er groß. Man nannte ihn einen Denker, und gewiss hing er stets seinen Gedanken nach und sprach aus, was er dachte; doch ihn interessierte nicht der Gedanke, sondern der Vorgang, in dem sich Gedanken verändern. Er liebte die Maschine, nicht ihr Produkt. Die Narrheit des Narren war ihm von gleicher Bedeutung wie die größte Weisheit der Weisen. Der subtile Mechanismus des Geistes faszinierte ihn so sehr, dass er die Sprache verachtete oder doch für ein unzureichendes Ausdrucksmittel hielt. Der Reim, dieses wundervolle Echo, das in den Höhlen der Muse erklingt und der eigenen Stimme Antwort gibt; der Reim, der für den wahren Künstler nicht nur der Stoff ist, aus dem er metrische Schönheit erschafft, sondern auch Inspiration für Gedanken und Leidenschaft, der neue Stimmungen zu wecken und neue Ideen zu erzeugen vermag und vielleicht durch seinen Liebreiz und die Verlockung des Klangs das goldene Tor aufschließt, an das die Fantasie zuvor vergebens klopfte; der Reim, der menschliche Laute in die Sprache der Götter verwandelt; der Reim, diese eine Saite, die wir der griechischen Lyra hinzugefügt haben, dieser Reim wurde in Robert Brownings Händen ein groteskes, unförmiges Ding, mit dem er zu Zeiten im Reich der Poesie wie ein verkleideter Komödiant erschien, der Pegasus zu oft als Zirkuspferd missbrauchte. Manchmal verwundet er uns mit seiner monströsen Musik. Jawohl, wenn er die Saiten des Instruments zerreißen muss, um Töne zu erzeugen, dann tut er es, und sie peitschen im Missklang die Luft; keine griechische Grille setzt sich nieder auf seiner Laute, um mit der Melodie ihrer zitternden Flügel die Dissonanz zu versöhnen. Und doch, er war groß: Auch wenn er die Sprache in wertlosen Ton verwandelte, so knetete er daraus doch lebendige Männer und Frauen. Niemand glich Shakespeare jemals so wie er. Wo Shakespeare mit Myriaden von Lippen singt, stammelt er mit Tausenden von Mündern. Selbst jetzt, wo ich über ihn spreche, und zwar für und nicht gegen ihn, schwebt der Festzug seiner Gestalten durch den Raum. Hier kriecht Fra Lippo Lippi, die Wangen noch glühend vom heißen Kuss eines Mädchens, dort steht der Furcht einflößende Saul mit juwelenfunkelndem Turban. Mildred Tresham ist da und der spanische Mönch, gelb vor Hass, auch Blougram, Ben Ezra und der Bischof von St. Praxed. In der Ecke brabbelt die Brut des Setebos, und Sebald hört Pippas Schritt, schaut in Ottimas verhärmtes Gesicht und ekelt sich vor ihr und ihren Sünden, und vor sich selbst. Bleich wie die weiße Seide seines Wamses verfolgt der melancholische König mit verträumten Verräteraugen den allzu treuen Strafford auf seinem Weg ins Verderben, Andrea erschauert, als er die Cousins im Garten pfeifen hört, und bittet seine wundervolle Frau, hinauszugehen. Ja, Browning war groß. Und wie wird er uns im Gedächtnis bleiben? Als Dichter etwa? Nein, nicht als ein Dichter! Man wird sich an ihn als einen Schriftsteller erinnern, vielleicht den besten Schriftsteller, den wir je hatten. Sein Gespür für dramatische Situationen ist unerreicht, und wenn er auch keine Antworten auf seine Fragen fand, so gelang es ihm doch, diese Fragen aufzuwerfen, und was kann man von einem Künstler mehr verlangen? Als Schöpfer von Charakteren rangiert er direkt nach dem Erschaffer von Hamlet. Wäre ihm die Kunst des Ausdrucks gegeben, so säßen sie vielleicht Seite an Seite. Der Einzige, der den Saum seines Gewandes berühren darf, ist George Meredith. Meredith ist ein Browning in Prosa – genau wie Browning selbst. Er bediente sich der Dichtung, um Prosa zu schreiben.
ERNEST: Es ist etwas dran an dem, was du sagst, doch nicht genug. In manchem tust du ihm unrecht.
GILBERT: Es ist schwierig, dem, was man liebt, gerecht zu werden. Aber lass uns zu unserem Thema zurückkehren. Was sagtest du doch gleich?
ERNEST: Ganz einfach, in den besten Tagen der Kunst habe es keine Kunstkritiker gegeben.
GILBERT: Ich glaube, ich höre diese Behauptung nicht zum ersten Mal. Sie ist so kraftvoll, wie Irrtümer nun einmal sind, doch auch so langweilig wie ein alter Freund. ERNEST: Und doch ist es so. Ja: Du brauchst den Kopf nicht so gereizt zurückzuwerfen. Es ist die Wahrheit. In den besten Tagen der Kunst gab es keine Kritiker. Der Bildhauer schlug aus dem Marmorblock den großen, weißgliedrigen Hermes heraus, der darin schlummerte. Mit Wachs und Gold wurde der Statue Farbe und Leben verliehen, und die Welt, die sie sah, verehrte sie und blieb stumm. Der Künstler goss die glühende Bronze in eine Form aus Sand, und der Fluss aus rotem Metall erkaltete in edlen Formen und nahm die Gestalt eines Gottes an. Glaskugeln oder polierte Juwelen verliehen den blinden Augen Sehkraft. Wie Hyazinthen kräuselten sich die Locken unter seinem Stichel hervor. Wenn dann der Sohn der Leto4 auf seinem Sockel stand, in einem dunklen, ausgemalten Gotteshaus oder einer sonnendurchfluteten Säulenhalle, wurden alle, die vorbeigingen, 5, sich eines neuen Einflusses bewusst, der über ihr Leben gekommen war; und traumverloren, oder voll fremdartiger, belebender Freude gingen sie zu ihrer Arbeit oder in ihr Heim, vielleicht wanderten sie auch hinaus aus den Toren der Stadt zu jener von Nymphen bevölkerten Wiese, auf der der junge Phaedrus die Füße badete, und dort, ausgestreckt im weichen Gras, unter den großen Platanen, wo der Wind flüstert und der Keuschbaum blüht, sinnierten sie über das Wunder der Schönheit und verstummten in unbekannter Ehrfurcht. In jenen Tagen war der Künstler frei. Aus dem Flussbett nahm er frischen Ton, und mit einem kleinen Stab aus Knochen oder Holz formte er daraus so entzückende Gebilde, dass man sie den Toten als Spielzeug in den Sarg legte, sodass wir sie noch heute in den staubigen Gräbern auf den Hügeln von Tanagra finden, auf Lippen, Haar und Kleidung die verblassten Reste von Gold und Purpur. Er zeichnete in den frischen Putz der Wand, aus hellem Bleirot oder einem Gemisch aus Safran und Milch, eine Gestalt, die müde über den purpurnen, weiß besternten Asphodeliengrund schreitet, «den ganzen Krieg von Troja in den Augen» – Polyxena, die Tochter des Priamos; oder er zeichnete Odysseus, den weisen und listenreichen, mit starken Seilen an den Mast gebunden, um ohne Schaden den Sirenen zu lauschen, oder er wanderte am klaren Wasser des Acheron, wo die Geister der Fische über die Kiesel im Flussbett huschen; oder er malte die Perser, in Mitra und Strumpfhosen, bei ihrer Flucht vor den Griechen bei Marathon, oder das Aufeinanderprallen der Galeeren in der kleinen Bucht von Salamis. Mit Silber und Holzkohle zeichnete er auf Pergament und geglättetes Zedernholz. Auf Elfenbein und rosenfarbenem Terrakotta malte er mit Wachs, den er mit Olivenöl geschmeidig machte und mit heißem Eisen fixierte. Flächen aus Marmor, Holz und Leinwand wurden zu Wunderwelten, wenn sein Pinsel hinüberstrich. Das Leben erblickte sein Abbild, war still und wagte nicht zu sprechen. Alles Leben gehörte ihm, von den Händlern auf dem Markt bis zu den Hirten auf den Hügeln, von den Nymphen, die sich im Lorbeer verstecken, und dem Faun, der am Mittag sein Horn bläst, bis hin zum König in grün verhängter Sänfte, getragen auf ölglänzenden Schultern von seinen Sklaven, während Pfauenfedern ihm frische Luft zufächern. Männer und Frauen, mit fröhlichen und sorgenvollen Gesichtern, zogen an ihm vorbei. Er sah sie an, und er verstand ihr Geheimnis. Mit Form und Farbe schuf er ein zweites Mal die Welt.
Auch die feineren Künste standen ihm zu Gebot. Er hielt die Gemme an eine rotierende Scheibe, und der Amethyst wurde zum purpurfarbenen Lager des Adonis, und über den geäderten Sardonys eilte Artemis mit ihren Hunden dahin. Aus Gold hämmerte er Rosen und flocht sie zusammen zu Halskette und Reif, er formte daraus den Kranz für den Helm des Siegers, den Schmuck für tyrische Roben oder die Totenmaske des Königs. In die Rückseite des Silberspiegels gravierte er Thetis und die Nereiden oder die liebeskranke Phaedra mit ihrer Amme, oder Persephone, der Erinnerung müde, mit Mohnblumen im Haar. Der Töpfer saß in seiner Hütte, und wie eine Blume wuchs die Vase in seinen Händen empor von der lautlosen Scheibe. Er schmückte Fuß, Rundung und Henkel mit einem Muster aus Olivenblättern, dem Laub des Acanthus oder geschwungenen Linien. In Schwarz oder Rot malte er Männer darauf, im Zweikampf oder beim Rennen, Ritter in voller Rüstung, mit seltsamen Wappenschilden und rätselhaften Helmen, in muschelförmigen Streitwagen über feurige Rosse gebeugt, auch Götter beim Fest oder beim Wirken von Wundern und Helden, siegreich oder von Schmerzen gebeugt. Oder er ätzte in feinen roten Linien auf weißem Grund den harrenden Bräutigam und seine Braut, umschwebt von Eros wie einem Engelchen von Donatello, ein kleines, lachendes Wesen mit goldenen oder azurnen Flügeln. Auf die Wölbung schrieb er dann den Namen seines Freundes. Kalos Alkibiades oder Kalos Charmenides erzählen uns die Geschichte seiner Zeit. Und auf den Rand einer großen flachen Schale zeichnete er einen äsenden Hirsch oder den ruhenden Löwen, was immer die Fantasie ihm gebot. Von der kleinen Parfümflasche lachte eine sich putzende Aphrodite, und Dionysos tanzte vom Most beschmutzt um einen Weinbecher, Mänaden mit nackten Beinen in seinem Gefolge, und Silen, der alte Satyr, rekelte sich auf den prallen Schläuchen oder schüttelte seinen magischen Stab, umwunden mit dunklem Efeu und von einem Tannenzapfen gekrönt. Niemand störte den Künstler bei seiner Arbeit. Kein dummes Gerede lenkte ihn ab. Meinungen bereiteten ihm keine Sorge. Am Ilyssos gab es keinen Higginbotham6. Am Ilyssos, mein lieber Gilbert, gab es keine dümmlichen Kunstkongresse, die provinzielle Kunst im Land verbreiten und die Mittelmäßigkeit sprechen lehren. Am Ilyssos gab es keine langweiligen Kunstzeitschriften, in denen eifrige Menschen über Dinge redeten, von denen sie nichts verstanden. An den schilfbewachsenen Ufern des kleinen Flusses stolzierten keine lächerlichen Journalisten herum, die den Richterstuhl für sich beanspruchten, obwohl sie einen Platz auf der Anklagebank verdienten. Die Griechen hatten keine Kunstkritiker.
GILBERT: Ernest, du bist wirklich entzückend, aber deine Ansichten sind furchtbar unvernünftig. Kann es sein, dass du die Gespräche von älteren Menschen belauscht hast? Das ist gefährlich, und wenn es zur Gewohnheit wird, kann es der geistigen Entwicklung ernsthaft schaden. Modernen Journalismus will ich nicht verteidigen; seine Existenz rechtfertigt sich durch das berühmte Darwin’sche Gesetz, dass die Vulgärsten überleben. Meine Sache ist allein die Literatur.
ERNEST: Worin besteht denn der Unterschied zwischen Literatur und Journalismus?
GILBERT: Oh! Journalismus kann man nicht lesen, und Literatur wird nicht gelesen. Das ist alles. Doch ich muss sagen, die Behauptung, die Griechen hätten keine Kunstkritik gehabt, ist völlig falsch. Eher könnte man sagen, die Griechen seien ein Volk von Kunstkritikern gewesen.
ERNEST: Wirklich?
GILBERT: Jawohl, ein Volk von Kunstkritikern. Du beschreibst die Beziehung der griechischen Künstler zur geistigen Sphäre ihrer Zeit auf so entzückend wirklichkeitsferne Weise, dass ich dieses Bild auf keinen Fall zerstören will. Dinge genau zu beschreiben, die niemals geschehen sind, ist die vornehmste Aufgabe der Historiker, jedoch auch das unbestreitbare Recht des kultivierten Menschen. Umso weniger liegt mir an einem gelehrten Gespräch. Solche Gespräche sind entweder Heucheleien von Ahnungslosen oder die Beschäftigung geistig unterforderter Menschen. Belehrende Gespräche wiederum sind nur der närrische Versuch des noch närrischeren Philanthropen, den gerechten Hass der kriminellen Klassen zu zähmen. Nein, viel lieber möchte ich ein wildes, verruchtes Stück von Dvorak für dich spielen. Die blassen Gestalten auf der Tapete lächeln uns zu, und mein bronzener Narziss hat die schweren Lider zum Schlaf geschlossen. Wir wollen nichts Ernsthaftes reden. Ich weiß nur allzu gut, dass wir in einer Zeit leben, in der der Stumpfsinn das Wort führt; deshalb fürchte ich mich davor, nicht missverstanden zu werden. Bring mich nicht in die peinliche Lage, dir nützliche Informationen zu geben. Erziehung ist etwas Wunderbares, aber von Zeit zu Zeit sollte man sich erinnern, dass man nichts, das zu wissen sich lohnt, von anderen lernen kann. Durch den Spalt zwischen den Vorhängen sehe ich den Mond, er hat die Form einer zerbrochenen Silbermünze. Wie vergoldete Bienen scharen sich die Sterne um ihn herum. Der Himmel ist ein fester, gewölbter Saphir. Lass uns hinausgehen in die Nacht. Gedanken sind wundervoll, aber Abenteuer sind noch wundervoller. Wer weiß, vielleicht begegnet uns Prinz Florizel von Böhmen, oder wir lauschen der schönen Kubanerin, die uns ihr Geheimnis verrät?
ERNEST: Du bist furchtbar stur. Ich verlange, dass du weiter mit mir redest. Du hast gesagt, die Griechen seien ein Volk von Kunstkritikern. Welche Kunstkritik haben sie uns denn hinterlassen?
GILBERT: Mein lieber Ernest, selbst wenn nicht das kleinste Fragment eines kritischen Texts aus hellenischer oder hellenistischer Zeit erhalten geblieben wäre, bestünde dennoch kein Zweifel, dass die Griechen ein Volk von Kunstkritikern gewesen sind, dass sie die Kunstkritik erfunden haben, genauso wie jede andere Art von Kritik. Denn was ist das Wichtigste, das wir den Griechen verdanken? Es ist der kritische Geist. Und dieser Geist, den sie an allem erprobten, an Religion und Wissenschaft, an Ethik und Metaphysik, an Politik und Erziehung, er bestimmte auch ihre Haltung zur Kunst, und, o ja, gerade bezüglich der beiden höchsten und erlesensten Künste haben sie uns ein System der Kritik hinterlassen, das so makellos dasteht wie kein anderes auf der Welt.
ERNEST: Und welche sind die beiden höchsten und erlesensten Künste?
GILBERT: Das Leben und die Literatur, das Leben und der vollkommene Ausdruck des Lebens. Die Prinzipien des Lebens, die die Griechen aufgestellt haben, wagen wir in einer Zeit, die so sehr unter falschen Idealen leidet, kaum zu beherzigen. Die Prinzipien der Literatur, die sie erkannten, sind in vielerlei Hinsicht so subtil, dass wir sie kaum verstehen. Da sie wussten, dass die vollkommene Kunst den Menschen in seiner endlosen Vielfalt widerspiegeln muss, entwickelten sie eine Kritik der Sprache, des Materials dieser Kunst, und führten sie in Höhen, die wir mit unserer Beschränkung auf sinn- oder gefühlsgemäße Betonung kaum je erreichen werden; so untersuchten sie zum Beispiel die metrische Gestalt der Prosa mit einer Akribie wie der moderne Musiker Harmonie und Kontrapunkt, jedoch, das brauche ich kaum zu sagen, mit deutlich stärkerem ästhetischem Instinkt. Das erwies sich als richtig, so, wie sie in allem recht behielten. Seitdem der Druck erfunden wurde und die fatale Angewohnheit des Lesens in den mittleren und unteren Klassen dieses Landes um sich greift, bemüht die Literatur sich mehr und mehr dem Auge und nicht dem Ohr zu gefallen, obwohl das Gehör der Sinn ist, an den sich die kunstvolle Sprache zuallererst wenden und dessen Anforderungen sie sich allezeit unterwerfen sollte. Selbst die Werke von Mr Pater, der alles in allem von den heutigen Autoren die perfekteste englische Prosa verfasst, wirken gelegentlich eher wie ein Mosaik als ein Musikstück, und es scheint, sie verfehlten, hier und dort, die wahre rhythmische Natur der Worte und damit Freiheit und Reichtum des Effekts, die diese rhythmische Natur hervorbringt. Wir Heutigen betrachten die Schrift als reifste Methode der künstlerischen Kreativität und behandeln sie deshalb als hoch verfeinerte Gestalt. Die Griechen sahen die Schrift dagegen lediglich als Methode, um Worte aufzuzeichnen. Ihr Urteil galt dem gesprochenen Wort und seinen musikalischen und metrischen Qualitäten. Das Medium war die Stimme und das Ohr der Kritiker. Manchmal denke ich, die Blindheit Homers könnte durchaus ein erfundener Mythos sein, um uns in Zeiten der Krise zu erinnern, dass große Dichter immer auch Seher sind, die mit den Augen der Seele und nicht des Körpers sehen, und dass Homer vor allem ein Sänger war, der sein Gedicht aus der Musik schöpfte und jeden Vers wieder und wieder vortrug, bis er das Geheimnis seiner Melodie gefunden hatte. So sang er im Dunkel die hellen, geflügelten Worte. Sei sie ein Anlass, sei sie der Grund – auch Englands großer Dichter verdankte es seiner Blindheit, so viel steht fest, dass seine späten Verse ein solches majestätisches Maß und solche klangvolle Pracht entfalten. Als Milton nicht mehr schreiben konnte, begann er zu singen. Was ist schon die Metrik von Comus verglichen mit Samson Agonistes oder Das verlorene und Das wiedergefundene Paradies? Als Milton erblindete, komponierte er, so wie jeder das tun sollte, allein mit der Stimme, und aus der Flöte oder dem Halm der früheren Tage wurde diese machtvolle, vielstimmige Orgel, deren so vielfach nachhallende Musik alle Pracht – und auch alle Behändigkeit – der homerischen Verse aufweist und als unvergängliches Erbe der englischen Literatur durch die Jahrhunderte braust, denn sie schwebt über den Zeiten und bleibt für immer bei uns, weil ihre Form unsterblich ist. Ja, das Schreiben hat den Schreibenden großen Schaden zugefügt. Wir müssen zu unserer Stimme zurückfinden, an ihr wollen wir uns messen, und vielleicht werden wir dann einige der Feinheiten der griechischen Kunstkritik zu schätzen wissen.
Heute können wir das nicht. Manchmal, wenn ich einen Prosatext geschrieben habe, an dem ich in aller Bescheidenheit keine Fehler finde, überfällt mich der grauenvolle Gedanke, ich könnte mich der verwerflichen Effeminiertheit schuldig gemacht haben, einen Trochäus oder Tribrachys zu verwenden7, ein Verbrechen, dessen ein gelehrter Kritiker aus der Zeit des Augustus mit nur allzu berechtigter Strenge den glänzenden, wenn auch zuweilen paradoxen Hegesias beschuldigte. Ich erschauere bei dem Gedanken und habe mich schon gefragt, ob der bewundernswerte ethische Nutzen der Prosa jenes bezaubernden Schriftstellers8 – der in einem Augenblick grenzenlosen Großmuts dem unkultivierten Teil unserer Gesellschaft gegenüber das ungeheure Dogma verkündete, Benehmen mache drei Fünftel des Lebens aus – nicht eines Tages gänzlich zunichtewird, falls sich erweisen sollte, dass die Päone9 falsch gebildet wurden.
ERNEST: Ah! Jetzt wirst du schnippisch.
GILBERT: Wer würde nicht schnippisch, wenn man ihm sagte, die Griechen kannten keine Kunstkritik? Ich könnte verstehen, wenn es hieße, dass sich das konstruktive Genie der Griechen im Kritizismus verloren habe, doch nicht, jenes Volk, dem wir den kritischen Geist verdanken, habe nicht kritisiert. Verlang nicht von mir, dir einen Überblick über griechische Kunstkritik von Plato bis Plotin zu geben. Die Nacht ist dazu viel zu schön, und der Mond, könnte er uns hören, würde sein Gesicht mit noch mehr Asche bestreuen, als ohnehin darauf liegt. Denk nur an dieses perfekte kleine Werk der Kunstkritik, die Poetik des Aristoteles. Als Text ist es nichts Besonderes, denn es ist schlecht geschrieben, vielleicht sind es ganz einfach nur Notizen, hingekritzelt für einen Vortrag, oder die Fragmente eines größeren Buchs. Aber in Tonfall und Herangehensweise ist es absolut perfekt. Die ethische Wirkung der Kunst, ihre Bedeutung für die Kultur und ihr Stellenwert in der Entwicklung des Charakters sind ein für alle Mal von Plato beschrieben worden, doch Aristoteles betrachtet die Kunst nicht in moralischer, sondern ausschließlich in ästhetischer Hinsicht. Auch Plato hatte sich natürlich mit einigen methodischen Aspekten befasst, wie der unerlässlichen Einheit eines Kunstwerks, den Anforderungen an Klang und Harmonie, dem ästhetischen Wert der Erscheinungen, dem Verhältnis der bildenden Kunst zur äußeren Welt und den Beziehungen zwischen Fiktion und Realität. Er hat vielleicht als Erster in der Seele der Menschen das Bedürfnis geweckt, den Zusammenhang zwischen Schönheit und Wahrheit zu begreifen und zu erfahren, welcher Platz der Schönheit im moralischen und intellektuellen Kosmos gebührt, ein Bedürfnis, das bis heute keine Befriedigung finden konnte. Seine Art, die Probleme von Idealismus und Realismus zu erörtern, mag vielen in der metaphysischen Sphäre der reinen Ideen, in der er sie verortet, reichlich unfruchtbar erscheinen, doch übertrage sie in die Sphäre der Kunst, und du wirst sehen, wie lebendig und bedeutsam sie sind. Vielleicht war es Platos Bestimmung, eine Kritik der Schönheit zu verfassen, und wenn wir seine Spekulationen in diesem Lichte betrachten, gewinnen wir eine neue Philosophie. Aristoteles dagegen beschäftigt sich wie auch Goethe mit den konkreten Erscheinungsformen der Kunst, zum Beispiel der Tragödie, und erforscht ihr Material, nämlich die Sprache, ihren Gegenstand, das Leben, die Methode, nach der sie verfährt, nämlich das Schauspiel, die Bedingungen, unter denen sie in Erscheinung tritt, nämlich die Aufführung im Theater, ihre logische Struktur, den Handlungsverlauf, und die Art und Weise, in der sie ihre ästhetische Wirkung entfaltet – indem sie durch die Erregung von Mitleid und Ehrfurcht den Schönheitssinn anspricht. Diese Reinigung und Vergeistigung der Natur, die er Katharsis nennt, bedient sich, wie Goethe erkannt hat, ausschließlich der Ästhetik und nicht der Moral, wie Lessing meinte. In erster Linie befasst Aristoteles sich mit dem Eindruck, den das Kunstwerk hinterlässt, denn ihm geht es darum, diesen Eindruck zu analysieren, seinen Ursprung zu erforschen und herauszufinden, wie man ihn hervorruft. Als Physiologe und Psychologe weiß er, dass es die Energie ist, die die Lebensfunktionen gesund erhält. Wer die Fähigkeit zu leidenschaftlichen Empfindungen besitzt und sie nicht ausleben kann, fühlt sich unvollständig und eingeschränkt. Die Zurschaustellung des Lebens, die die Tragödie uns bietet, befreit die Brust von «verdorbenem Zeug», und durch die Vorstellung erhabener und wertvoller Gegenstände, an denen sich die Gefühle erproben lassen, reinigt und vergeistigt sie den Menschen; sie vergeistigt ihn nicht nur, sondern führt ihn an edle Gefühle heran, die ihm sonst vielleicht ganz unbekannt geblieben wären. Manchmal scheint es mir, als liege im Wort Katharsis eine deutliche Anspielung auf die Riten der Initiation, und von Mal zu Mal überkommt mich die Vermutung, dass genau das seine eigentliche Bedeutung sei. Dies ist natürlich nicht mehr als eine Kurzfassung des Buches, aber du siehst, um was für einen wichtigen Beitrag zur Kunstkritik es sich dabei handelt. Wer sonst als ein Grieche hätte die Kunst wohl so gut zu analysieren vermocht? Nach der Lektüre wundert man sich nicht länger, dass Alexandria ein so bedeutendes Zentrum der Kunstkritik wurde, wo die kunstsinnigen Menschen jener Zeit sich so ausführlich mit Stilfragen befassten. Man diskutierte die Arbeiten der großen Kunstakademien, wie zum Beispiel die Schule von Sikyon, die für die Bewahrung der ehrwürdigen Traditionen des alten Stils eintrat, und auch die realistischen und impressionistischen Schulen, die das Alltagsleben wiederzugeben versuchten; die Rolle der Idealisierung im Porträt, den künstlerischen Wert epischer Formen in einer so modernen Zeit, und mit welchen Gegenständen sich ein Künstler befassen solle. Ich fürchte sogar, dass auch Menschen ohne Kunstverstand sich zu Fragen von Literatur und Kunst äußerten, denn die Plagiatsvorwürfe schossen ins Kraut, und ihr Ursprung sind zumeist entweder die dünnen, farblosen Lippen der Impotenz oder die groben Mäuler derer, die selbst nichts besitzen und um ein wenig Beachtung buhlen, indem sie verkünden, man habe sie beraubt. Glaub mir, Ernest, zur Zeit der Griechen zerriss man sich über die Maler den Mund beinah genau wie heute, es gab Vernissagen und schäbige Ausstellungen, Zünfte der Handwerker und Künstler, präraphaelitische Tendenzen und Realismus, Vorträge und Essays über Kunst, Kunstgeschichte und alles andere auch. Ja, die Leiter umherziehender Theatertruppen hatten ihre eigenen Kritiker im Gefolge und bezahlten sie recht gut dafür, dass sie lobende Besprechungen veröffentlichten. Alles Moderne in unserem Leben verdanken wir den Griechen, alles Anachronistische entstammt dem Mittelalter. Die Griechen haben uns das gesamte Instrumentarium der Kunstkritik hinterlassen, und wie präzise ihr kritischer Instinkt gewesen ist, ersieht man daraus, dass es – wie ich schon sagte – die Sprache war, der sie die größte Aufmerksamkeit schenkten. Denn das Material der Maler oder Bildhauer ist kümmerlich, verglichen mit dem der Worte. Worte entfalten Musik, die so lieblich ist wie die Klänge von Geige und Laute, und Farbe, so reich und lebendig wie auf den Leinwänden der Venezianer und Spanier, die wir so lieben; als plastische Formen sind sie von der gleichen Beständigkeit wie Marmor oder Bronze; darüber hinaus verfügen sie über Gedanken, Leidenschaft und Geist, und diese drei sind ihr alleiniges Eigentum. Hätten die Griechen nichts anderes als die Sprache kritisiert, sie wären dennoch groß unter den Kunstkritikern dieser Welt. Wer die Grundsätze der höchsten Kunst versteht, versteht die Grundsätze aller Künste.
Doch ich sehe, dass der Mond sich hinter einer schwefelfarbenen Wolke versteckt. Aus dieser gelblichen Mähne, diesem Gestöber heraus funkelt er wie das Auge des Löwen. Er sorgt sich, ich könnte dir von Lukian und Longinus erzählen, von Quinctilian und Dionysius, von Plinius, Fronto und Pausanias, all denen, die in der alten Welt über Kunst geschrieben oder gesprochen haben. Doch keine Angst, mein Ausflug in den trüben, langweiligen Abgrund der Fakten hat mich ermüdet. Ich sehne mich lediglich nach dem himmlischen, aber 10 einer weiteren Zigarette. Zigaretten sind immerhin so zauberhaft, keine Befriedigung zu verschaffen.
ERNEST: Probiere eine von meinen. Sie sind recht gut, ich bekomme sie direkt aus Kairo. Unsere Attachés sind insofern von einem gewissen Nutzen, als sie ihre Freunde mit hervorragendem Tabak versorgen. Da der Mond sich gerade versteckt, lass uns weiterreden. Ich gebe gern zu, dass es ein Irrtum war, was ich über die Griechen sagte. Wie du gezeigt hast, waren sie ein Volk von Kunstkritikern. Ich gebe das zu, und sie tun mir deshalb ein wenig leid. Das Vermögen, Kunst zu erschaffen, steht höher als das der Kritik; im Grunde kann man beide gar nicht miteinander vergleichen.
GILBERT: Es ist willkürlich, einen Gegensatz zwischen diesen beiden zu behaupten. Ohne die Kritik gäbe es keine künstlerischen Schöpfungen, die diesen Namen verdienen. Du sprachst eben noch vom zarten Sinn und feinen Instinkt für Wahl und Auswahl, womit der Künstler uns das Leben erschließt und ihm für einen Augenblick Perfektion verleiht. Nun, dieser Geist der Wahl, das feine Taktgefühl des Verschweigens ist Ausdruck der charakteristischsten Erscheinungsform von Kritik, und nur wer diese kritische Fähigkeit besitzt, ist zu schöpferischer Arbeit imstande. Arnolds Definition von Literatur als Kritik des Lebens ist nicht sehr glücklich in der Form, doch sie zeigt, wie präzise er die Bedeutung des kritischen Geistes für die kreative Arbeit erkannt hat.
ERNEST: Ich wollte sagen, dass große Künstler ihr Werk unbewusst vollbringen, dass sie «weiser sind, als sie wissen», wie Emerson es wohl einmal bemerkt.
GILBERT: Das trifft jedoch nicht zu, Ernest. Jedes hervorragende Werk der Fantasie ist eine bewusste und durchdachte Schöpfung. Kein Dichter singt, weil er singen muss. Zumindest tut das kein großer Dichter. Ein großer Dichter singt, weil er es will, das ist heute so und war es schon immer. Wir stellen uns gern vor, die Stimmen, die in den Morgenstunden der Dichtung erklangen, wären einfacher, frischer und natürlicher gewesen als unsere, und dass die Welt, die der frühe Dichter erblickte und die er durchwanderte, ihre eigene Poesie verströmte, die man ohne großes Zutun in Lieder fassen konnte. Der Schnee liegt heute hoch auf dem Olymp, und die steilen, abschüssigen Hänge sind kahl und öde. Früher jedoch, so meinen wir, streiften die weißen Füße der Musen des Morgens den Tau von den Anemonen, und abends sang Apollo den Hirten im Tal ein Lied. Damit verlegen wir lediglich unsere eigenen Wünsche oder das, was wir dafür halten, in ein vergangenes Zeitalter; unser Geschichtssinn ist gestört. Jedes Jahrhundert, in dem Dichtung geschaffen wird, ist ein Jahrhundert der Kunst, und jedes Kunstwerk, wenn es uns auch natürlich und einfach erscheint, ist in gleichem Maß das Resultat bewusster Arbeit; Selbstbewusstsein und kritischer Geist sind ein und dasselbe.
ERNEST: Ich verstehe, was du meinst, und in vielem hast du recht. Du wirst jedoch einräumen, dass die großen Gedichte der Frühzeit, die primitiven, anonymen, gemeinschaftlichen Gedichte, der Fantasie der Rassen und nicht von Einzelnen entsprungen sind?
GILBERT: Nicht, wenn sie in eine schöne Form gebracht wurden und es sich um wirkliche Dichtung handelt. Denn es gibt keine Kunst ohne Stil, und keinen Stil ohne Einheit, und Einheit verleiht ihr der Einzelne. Ohne Frage konnte Homer auf alte Balladen und Geschichten zurückgreifen, genau wie Shakespeare über Chroniken, Theaterstücke und Romane verfügte, doch all das war nur Rohmaterial, das er verwendete und zu seinem Lied formte. Jetzt gehört es ihm, denn er hat ihm Liebreiz verliehen. Erschaffen wurde sein Lied aus der Musik,
So schwebt es körperlos
Und wird nicht untergehn.
Je länger man sich mit dem Studium von Leben und Literatur befasst, desto deutlicher spürt man, dass hinter dem Wunderbaren stets der Einzelne steht, dass also nicht der Augenblick den Menschen prägt, sondern der Mensch sein Zeitalter erschafft. Ja, ich möchte meinen, dass jede Mythologie und jede Legende, die doch aus dem Wunder hervorzugehen scheint, aus dem Schrecken oder den Wünschen eines Stammes oder Volkes, in ihrem Ursprung die Erfindung eines einzelnen Geistes war. Die erstaunlich geringe Zahl von Mythen legt diese Schlussfolgerung nahe. Aber wir wollen uns nicht in Fragen der vergleichenden Mythologie verlieren, sondern am Thema der Kritik festhalten. Mein Standpunkt dazu ist dieser: Eine Zeit ohne Kritik kann nur eine unbewegliche, in festen Regeln gefangene Kunst hervorbringen, die zur ständigen Wiederholung der immer gleichen Muster verdammt ist, oder überhaupt keine Kunst. Es hat Zeiten gegeben, die kritisch waren, ohne im üblichen Sinn kreativ zu sein, in denen die Menschen ihren Geist darauf richteten, die vorhandenen Schätze zu ordnen, das Gold vom Silber zu trennen und das Silber vom Blei, die Juwelen zu zählen und den Perlen Namen zu geben. Doch niemals gab es eine kreative Zeit, die nicht gleichfalls kritisch gewesen wäre. Denn neue Formen entstehen aus der Fähigkeit zur Kritik. Schöpferisches Handeln neigt dazu, sich zu wiederholen. Jede neue Schule, die entsteht, verdanken wir dem kritischen Instinkt, so wie auch jede neue Technik, der sich die Kunst bedienen kann. Tatsächlich ist heute keine einzige Form im Gebrauch, die nicht dem kritischen Geist Alexandrias entsprungen ist, aus dem heraus Formen erfunden, vollendet oder dem allgemeinen Gebrauch zugänglich gemacht wurden. Ich sage Alexandria, und das nicht nur, weil dort der griechische Geist sich seiner selbst am klarsten bewusst wurde, bevor er schließlich in Skeptizismus und Religion versank, sondern weil Rom von dort, und nicht aus Athen, seine Vorbilder bezog; dass schließlich die lateinische Sprache mehr schlecht als recht überlebte, sicherte der Kunst das Überleben. Als in der Renaissance die griechische Literatur über Europa dämmerte, war der Boden dafür bereitet. Doch wir wollen uns dieser Details der Geschichte entledigen, die immer öde und meistens unzutreffend sind, und sagen, dass wir die Formen der Kunst ganz allgemein dem griechischen Geist verdanken. Ihm verdanken wir Epik, Lyrik und das Drama in jeder seiner Entwicklungsstufen einschließlich der Burleske, das Idyll, den Liebesroman, den Abenteuerroman, den Essay, den Dialog, die Rede, den Vortrag – was wir ihnen vielleicht nicht vergeben sollten – und das Epigramm im allerweitesten Sinne. Wir verdanken ihm tatsächlich alles, mit Ausnahme des Sonetts – zu dem sich allerdings hinsichtlich der Gedankenbewegung einige verblüffende Parallelen in der Anthologie finden lassen –, des amerikanischen Journalismus, zu dem es nirgends irgendwelche Parallelen gibt, und der Ballade im imitierten schottischen Dialekt, die nach Meinung eines unserer fleißigsten Schriftsteller11 allen zweitrangigen Dichtern als Ausgangspunkt dienen könnte, um in einer letzten gemeinsamen Anstrengung zum wahren Romantizismus vorzudringen. Jede neue Schule, so scheint es, beschwert sich lauthals über die Kritik, dabei ist es das kritische Vermögen des Menschen, dem sie ihren Ursprung verdankt. Der rein schöpferische Instinkt bringt keine Neuerungen hervor, er ahmt nach.
ERNEST: Du sprichst von Kritik als treibender Kraft des kreativen Geistes, und dieser Auffassung kann ich voll und ganz zustimmen. Doch wie verhält es sich mit Kritik außerhalb der schöpferischen Arbeit? Ich habe die dumme Angewohnheit, Zeitschriften zu lesen, und mir scheint, die moderne Kritik ist fast vollständig wertlos.
GILBERT: Das kann man von moderner Kunst genauso sagen. Mittelmaß erwägt den Ertrag des Mittelmaßes, und Inkompetenz applaudiert ihresgleichen – dieses Schauspiel bietet uns der englische Kunstbetrieb von Zeit zu Zeit. Doch vielleicht ist es ein wenig unfair, das so zu sagen. In der Regel sind die Kritiker – und damit meine ich natürlich die erste Garde, diejenigen, die für die Sixpenny-Blätter schreiben – weit kultivierter als diejenigen, deren Werk zu rezensieren sie aufgefordert wurden. Zumindest sollte man das erwarten, denn Kritik setzt unendlich mehr Bildung voraus als Kreativität.
ERNEST: Wirklich?
GILBERT: Gewiss. Jeder kann einen dreibändigen Roman schreiben. Es braucht dazu nicht mehr als vollkommene Ahnungslosigkeit in den Dingen des Lebens wie der Literatur. Die Schwierigkeit, mit der der Rezensent sich meiner Meinung nach herumschlagen muss, besteht darin, irgendwelche Kriterien zu entwickeln. Wenn kein Stil vorhanden ist, kann es keine Kriterien geben. Die armen Rezensenten werden deshalb zu literarischen Gerichtsreportern herabgestuft, die über die Taten der Gewohnheitsverbrecher im Reich der Kunst berichten müssen. Man behauptet, sie würden die Bücher, die sie besprechen sollen, oft nicht zu Ende lesen. Sie tun es nicht, zumindest sollten sie es nicht. Wenn sie es täten, würden sie für den Rest ihres Lebens zu erbitterten Misanthropen, oder falls ich die Formulierung einer der hübschen Newnham-Absolventinnen12 gebrauchen darf, zu erbitterten Womanthropen. Zudem ist es gar nicht erforderlich. Um den Jahrgang und die Qualität eines Weins zu beurteilen, braucht man nicht das ganze Fass zu leeren. Ob ein Buch irgendeinen oder gar keinen Wert besitzt, lässt sich in einer halben Stunde leicht herausfinden. Wer über Instinkt für Formen verfügt, braucht dafür nicht länger als zehn Minuten. Wer will denn durch ein dümmliches Machwerk waten? Man nimmt eine Probe, und das ist genug – mehr als genug, stelle ich mir vor. Mir ist bewusst, dass viele ehrbare Arbeiter auf dem Feld der Malerei und auch der Literatur jede Kritik zurückweisen. Sie sind vollkommen im Recht. Ihr Werk steht in keinerlei geistiger Beziehung zu ihrem Zeitalter; es bereitet uns keine neuen Genüsse und gibt weder Gedanken, Leidenschaften noch Schönheit neue Impulse. Man soll wirklich nicht darüber reden, sondern es dem Vergessen überantworten, das es verdient.
ERNEST: Verzeih mir, wenn ich unterbreche, mein lieber Freund, aber mir scheint, als würde dich deine Begeisterung für die Kritik ein gutes Stück über das Ziel hinaustragen. Denn selbst du wirst doch wohl zugestehen, dass es sehr viel schwieriger ist, etwas zu tun, als darüber zu reden.
GILBERT: Viel schwieriger, etwas zu tun, als darüber zu reden? Aber keinesfalls. Dabei handelt es sich um einen verbreiteten, schwerwiegenden Fehler. Es ist sehr viel schwieriger, über etwas zu reden, als es zu tun. In der Sphäre des wirklichen Lebens ist das ganz offensichtlich. Ein jeder kann Geschichte machen, aber nur ein großer Mann kann Geschichte schreiben. Es gibt keine Technik des Handelns, keine Form der Gefühle, die wir nicht mit den niederen Tieren teilen. Nur durch die Sprache sind wir ihnen überlegen, so wie auch unseren Mitmenschen – durch die Sprache, die der Vater und nicht das Kind des Gedankens ist. Tätigkeit ist dagegen stets einfach, und wenn wir ihr in ihrer zugespitzten und dauerhaftesten Form begegnen, wie sie zweifellos im Gewerbe anzutreffen ist, so erweist sie sich als Zuflucht all derer, die sonst überhaupt nichts zu tun haben. Nein, Ernest, sprich nicht vom tätigen Leben. Es folgt Einflüssen und wird durch Impulse getrieben, deren Natur es nicht begreift. Die Beschränkungen, denen es unterliegt, ergeben sich zufällig, und es kennt nicht die Richtung, in die es strebt. Seinem tiefsten Wesen nach ist es unvollständig, und es gerät stets aufs Neue in Widerspruch zu seinen Zielen. Sein Ursprung ist Mangel an Fantasie; es ist die letzte Rettung derer, die nicht zu träumen wissen.
ERNEST: Gilbert, du tust so, als sei die Welt eine Kristallkugel. Du hältst sie in der Hand und drehst sie nach Lust und Laune hin und her. Damit stellst du die Geschichte auf den Kopf.
GILBERT: Das Einzige, was wir der Geschichte wirklich schulden, ist, sie auf den Kopf zu stellen. Es ist nicht die geringste Aufgabe, die der kritische Geist zu bewältigen hat. Wenn wir eines Tages die wissenschaftlichen Gesetze entdecken, denen das Leben gehorcht, werden wir erkennen, dass es nur einen gibt, der größeren Illusionen folgt als der Träumer, und zwar den Mann der Tat. Denn er kennt weder das Motiv seiner Taten noch ihre Resultate. Dort, wo er Dornen zu säen meinte, ernten wir Wein, und der Feigenbaum, den er für uns pflanzte, ist unfruchtbar wie der Schoß einer Greisin, und weitaus härter. Nur weil die Menschheit niemals wusste, wohin ihr Weg sie führte, ist sie so weit gekommen.
ERNEST: Du meinst also, bewusste Ziele seien im Reich des Handelns nur Trug?
GILBERT: Sie sind schlimmer als Trugbilder. Lebten wir lang genug, um die Folgen unserer Taten zu sehen, würden wahrscheinlich jene, die sich selbst gute Menschen nennen, von finsterer Reue gequält, und wer in den Augen der Welt als böse galt, würde von stolzer Freude ergriffen. Was immer wir tun, fällt in die große Maschine des Lebens; wenn sie will, zermahlt sie unsere Tugenden zu wertlosem Pulver, so wie sie unsere Sünden in die Keime einer neuen Zivilisation zu verwandeln vermag, die alle ihre Vorgängerinnen an Glanz und Größe übertrifft. Doch die Menschen sind Sklaven ihrer Worte. Sie wüten gegen den Materialismus, wie sie es nennen, ohne zu bedenken, dass jede materielle Errungenschaft die Welt auch geistig bereichert, wogegen geistige Erweckungen fast immer den Reichtum der Welt vergeudet und gegen armselige Hoffnungen, nutzlose Sehnsucht und leere oder einengende Glaubenssätze eingetauscht haben. Was man Sünde nennt, ist ein wesentliches Element des Fortschritts. Ohne sie würde die Welt zum Stillstand kommen und alt und farblos werden. Die Sünde bereichert durch ihre Neugier den Erfahrungsschatz einer Rasse. Weil sie mit Nachdruck für Individualismus eintritt, bewahrt sie uns vor monotonem Einerlei, und indem sie die geltende Moral verwirft, steigt sie auf ins Reich einer höheren Ethik. Und schließlich die Tugend! Was ist denn die Tugend? Die Natur, so sagt uns Ernest Renan13, kümmert sich nicht um Keuschheit, und wenn die Lukrezias unserer Zeit unbefleckt bleiben, so verdanken sie das eher der Existenz sündiger Magdalenen als ihrer eigenen Reinheit. Nächstenliebe ist die Ursache vieler Übel, wie selbst jene eingestehen, deren Religion sie verlangt. Und dass wir über ein Bewusstsein verfügen, wovon neuerdings so viel Aufhebens gemacht wird und worauf ein jeder stolz ist, ohne es zu begreifen, zeigt unmissverständlich, dass das Ende unserer Entwicklung noch nicht erreicht ist. Erst wenn dieses Bewusstsein sich in Instinkt verwandelt, sind wir vollendet. Selbstverleugnung dient nur dazu, den Entwicklungsprozess des Menschen anzuhalten, und in der Selbstaufgabe lebt die Selbstverstümmelung der Wilden weiter, ein Teil der alten Verehrung des Schmerzes, die in der Weltgeschichte so viel Unheil angerichtet hat und noch heute Tag für Tag ihre Opfer bringt, auf den Altären überall im Land. Tugenden! Wer weiß, was Tugenden sind? Du nicht. Ich nicht. Niemand weiß es. Es schmeichelt unserer Eitelkeit, wenn wir den Verbrecher töten, denn ließen wir ihn am Leben, würden wir sehen, welchen Lohn er durch sein Verbrechen davonträgt. Und dass der Heilige das Martyrium auf sich nimmt, dient seinem Seelenfrieden, denn es erspart ihm zu erleben, welche Gräuel seine guten Taten bewirkten.
ERNEST: Gilbert, dein Ton wird zu schroff. Lass uns zu den liebenswürdigeren Bereichen der Literatur zurückkehren. Was sagtest du eben? Es sei schwieriger, über etwas zu reden, als es zu tun?
GILBERT (nach einer Pause): Ja, ich wagte es wohl, diese simple Wahrheit auszusprechen. Du hast inzwischen verstanden, dass ich recht habe? Ein Mensch, der handelt, ist eine Puppe. Ein Mensch, der beschreibt, ist ein Dichter. Darin liegt das ganze Geheimnis. Es war leicht, auf den sandigen Ebenen des windigen Ilion den gekerbten Pfeil mit gemaltem Bogen zu schießen, oder den langen Speer mit seinem Griff aus Eschenholz gegen Schilde und flammende Bronze zu schleudern. Der ehebrecherischen Königin fiel es leicht, ihrem Herrn die tyrischen Teppiche auszubreiten und das purpurne Netz auf ihn zu werfen, als er im marmornen Bade lag, und ihrem sanftgesichtigen Liebhaber fiel es leicht, durch dieses Netz das Herz zu durchbohren, das bei Aulis hätte brechen sollen. Selbst für Antigone, die den Tod zum Bräutigam erwählte, war es leicht, durch die brütende Luft des Mittags zu gehen, den Hügel zu erklimmen und wohltuende Erde auf die elende nackte Leiche zu streuen, die nicht beerdigt wurde. Doch was ist mit jenen, die über all das geschrieben haben? Was ist mit jenen, die diesen Helden ein Leben verliehen, das niemals vergehen wird? Sind sie nicht größer als die Männer und Frauen, von denen sie singen? «Hektor, der süße Ritter ist tot», und Lukian erzählt, wie Menippus im Zwielicht der Unterwelt den bleichenden Schädel Helenas fand und sinnierte, dass um einer so makabren Gunst willen all die gehörnten Schiffe in See stachen, all diese schönen gepanzerten Männer niedergestreckt wurden und all die getürmten Städte in Staub versanken. Und doch erscheint jeden Tag die schwanengleiche Tochter der Leda auf den Mauern und blickt hinab auf die Gezeiten des Krieges. Sie steht an des Königs Seite, und die Graubärte bewundern ihre Schönheit. In seiner Kammer aus gebeiztem Elfenbein ruht ihr Geliebter. Er poliert seine anmutige Rüstung und glättet die roten Federn. Mit Knappe und Page schreitet ihr Gatte von Zelt zu Zelt. Sie sieht sein helles Haar und hört seine klare, kalte Stimme, sie meint es zumindest. Unten im Hof gürtet der Sohn des Priamos seinen Kürass, die weißen Arme der Andromache liegen um seinen Hals. Er setzt den Helm auf den Boden, um das Baby nicht zu erschrecken. Hinter dem bestickten Vorhang seines Zeltes sitzt Achilles in duftenden Gewändern, während der Freund seiner Seele sich den Harnisch aus Gold und Silber schnürt, um zu kämpfen. Aus einer merkwürdig geschnitzten Lade, die seine Mutter Thetis ihm zu den Schiffen brachte, nimmt der Herr der Myrmidonen den mystischen Kelch, den noch nie die Lippe eines Menschen berührte; er reinigt ihn mit Schwefel, kühlt ihn mit frischem Wasser, dann wäscht er seine Hände und füllt den schwarzen Wein in die polierte Mulde. Er schüttet das schwere Rebenblut zu Boden, IHM zu Ehren, den in Dodona barfüßige Propheten verehren, und betet zu IHM, und er weiß nicht, dass es vergebens ist, denn durch die Hände zweier trojanischer Ritter, des Euphorbos mit golddurchwirkten Stirnlocken, Sohn des Panthoos, und des löwenherzigen Priamiden, fand Patroklos, der beste aller Kameraden, sein Verderben. Sind dies Phantome? Helden umnebelter Berge? Schatten in einem Lied? Nein, sie sind wirklich. Taten! Was sind Taten? Sie sterben auf dem Höhepunkt ihrer Kraft. Sie sind nur ein unwürdiges Zugeständnis an die Wirklichkeit. Die Welt wird vom Sänger für den Träumer erschaffen.
ERNEST: Während du sprichst, scheint es so zu sein.
GILBERT: Es ist wahrhaftig so. Auf der zerfallenen Zitadelle von Troja sitzt eine Eidechse wie aus grüner Bronze gegossen. Die Eule hat ihr Nest im Palast des Priamos gebaut. Über die weite Ebene wandern Hirten mit ihren Schafen und Ziegen, und dort, auf einem Meer wie Wein und Öl, 14