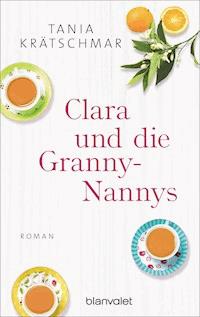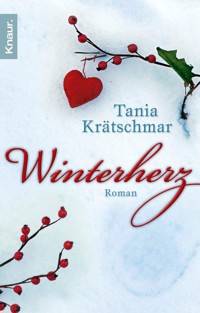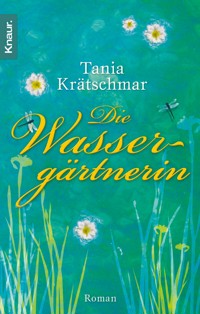
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nie wieder Erde, Dünger und Strandhafer, schwört sich Tinke, als sie die Gärtnerei ihres Vaters auf Langeoog verlässt. Bittere Erinnerungen an das Verschwinden ihrer Mutter verbinden sie mit dem Gärtnern und dieser Nordseeinsel. Deshalb zieht sie zu ihrer quirligen Freundin ins turbulente Berlin-Kreuzberg, um herauszufinden, was sie vom Leben will. Als Tinke sich dort in den Bildhauer Florian verliebt, ist sie zunächst überglücklich. Doch dann stößt sie auf das Geheimnis ihrer Mutter, und ihre Liebe wird auf eine harte Probe gestellt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 366
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Tania Krätschmar
Die Wassergärtnerin
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Nie wieder Erde, Dünger und Strandhafer, schwört sich Tinke, als sie die Gärtnerei ihres Vaters auf Langeoog verlässt. Seit dem rätselhaften Verschwinden ihrer Mutter lösen die kleine Nordseeinsel und die vielen Blumen nur noch bittere Erinnerungen in ihr aus. Um endlich herauszufinden, was sie vom Leben will, zieht Tinke zu einer Freundin ins turbulente Berlin-Kreuzberg. Sie schwebt im siebten Himmel, als sie sich dort neu verliebt. Doch dann macht sie eine unerwartete Entdeckung und plötzlich ist nichts mehr so, wie es schien …
Ein wunderschöner Roman über die Liebe, das Leben und eine große Leidenschaft.
Inhaltsübersicht
Motto
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
Besten Dank an …
Pullin’ weeds and pickin’ stones,
we are made of dreams and bones.
I feel the need to grow my own,
’cause the time is close at hand.
Grain for grain, sun and rain,
I’ll find my way in nature’s chain.
Tune my body and my brain
to the music of the land.
Dave Mallett
Prolog
Wahrscheinlich waren es Radieschensamen: Klein, glatt und braun lagen sie auf ihrer Handfläche. Aber es war nicht im Ladenbereich der elterlichen Gärtnerei. Es war auch nicht in einem der beiden Gewächshäuser. Und auch nicht auf dem angrenzenden Gelände, wo hartes, blaugraues Strandgras in langen Reihen vor sich hin wuchs. Es war im Kindergarten.
»Tinke kann auch mitkommen«, sagte jemand und nahm sie an die Hand.
»Sie ist doch noch so klein«, entgegnete eine zweite Stimme.
»Ja, aber sie kann das schon«, antwortete die erste.
Zusammen traten sie nach draußen, heraus aus dem kleinen Speisesaal, in dem gerade die Tische abgeräumt wurden. Blechkannen mit Resten von Hagebuttentee und kleine schmutzige Porzellanteller wurden auf Rollwagen gestellt und dann scheppernd in die Küche gefahren.
Von der überdachten Terrasse, von wo aus zwei Erzieherinnen die Kinder sonst beim Spielen beaufsichtigten, ging die kleine Gruppe zu einem Schuppen. Dort bekamen alle einen Spaten in die Hand gedrückt, passend in Kindergröße. Anschließend liefen sie in den Garten, wo sie gemeinsam ein kleines Stück umgruben. Jemand harkte es glatt und zog dann mit dem Harkenstiel kerzengerade Reihen. Schließlich durfte Tinke die Samen, die man ihr in die Hand gestreut hatte, in gleichmäßigen Abständen in den Rillen verteilen. Als sie sich hinkniete, stieg ihr ein feuchter, frischer Duft in die Nase. Vorsichtig und regelmäßig gab sie die Samen in den krümeligen Boden. Dann wurden die Reihen mit Erde bedeckt. Mit kleinen grünen Gießkannen gossen die Kinder das neu angelegte Beet. Nur Tinke nicht. Sie blieb am Rand stehen und starrte auf die Abdrücke, die ihre Knie in dem weichen Boden hinterlassen hatten.
Ein Wunder war geschehen. Sie hatte etwas gesät, direkt aus ihrer Hand in die Erde, etwas winzig Kleines. Es hatte ein Eigenleben, lag in der Erde, quoll auf, würde wachsen, wenn man nur dafür sorgte, dass es genug Wasser hatte.
Vielleicht war es aber auch nur ein Traum gewesen. Denn so deutlich war dieser unerhörte Vorfall, dass Tinke sich bestimmt an eine Fortsetzung erinnert hätte. Doch die gab es nicht. Niemals wieder wurde sie zu diesem Beet gebracht. Es gab kein erstauntes »Schau mal, wie schnell sie wachsen, und du hast sie gesät«, kein stolzes »Die ersten Blättchen sind schon da«. Keiner zeigte ihr ein winziges Radieschen, an dem man schon die rötlich-weiße, verdickte Wurzel sah, die später mal eine scharfe, runde Kugel werden würde.
Wenn Tinke manchmal beim Spielen nach dem Beet suchte, konnte sie es nicht finden. Es war wie vom Erdboden verschluckt. Schließlich vergaß sie diesen erstaunlichen Moment, dieses kleine Wunder, das Gefühl jäher Freude. Wie ein nicht aufgegangener Samen blieb diese kostbare Erinnerung tief in ihrem Gedächtnis vergraben.
Bis viele Jahre später die salzige Nässe von Tränen und die strahlende Sonne der Freude sie berührten. Die Erinnerung begann sich zu regen, dehnte sich aus, wurde stärker und kräftiger und machte sich aus ihrem dunklen Versteck langsam, aber unaufhaltsam auf den Weg ans Licht des Bewusstseins.
1. Kapitel
Tinke, Tinke! Komm schnell, er stirbt schon wieder!« Amelies Ruf schallte hoch ins Büro, wo Tinke saß, Rechnungen abheftete und Einnahmen verbuchte. Wie jeden Monatsanfang. Seit neuestem musste sie die Umsatzsteuer-Voranmeldungen auch noch auf dem Computer machen. Wobei das Finanzamt erstaunlicherweise so etwas Ähnliches wie Humor bewies: Das Softwareprogramm dafür hieß »Elster«. Wie der diebische Vogel in den Dünen von Langeoog, der zwar vergeblich nach Geschmeide suchte, um es in seinen Hort hoch oben in den Pappeln zu schleppen, dafür aber die Nester der Kiebitze ausräuberte.
Bei Amelies aufgeregtem Ruf sah Tinke seufzend auf. Immer dieselbe Leier. Die wüste Zettelwirtschaft, die vor ihr lag, würde warten müssen. In einer unbewussten Geste strich sie sich die hellblonden, halblangen Haare zurück, schob die Ärmel ihres seegrünen Pullovers hoch, der dieselbe Farbe wie ihre Augen hatte, stand auf und ging über den abgenutzten blauen Flickenteppich, der den Dielenboden vor schmutzigen Fußabdrücken schützen sollte, zu der niedrigen Tür. »Wo ist er?«, rief sie laut.
»Wir sind beide hier unten, in der Stube!«, schallte es herauf.
Langsam stieg Tinke die steile Treppe hinunter. Leicht und zart wie sie war, knarrten die alten Holzstufen kaum unter ihrem Gewicht. Sie warf einen kurzen Blick aus dem Flurfenster. Von hier, der Rückseite des Hauses, sah sie direkt auf den grünen Deich, der in einer schnurgeraden Linie den blauen Himmel darüber abgrenzte. Kleine weiße Schäfchenwolken segelten vor höher schwebenden zarten Wolkengespinsten.
Ein perfekter Frühlingstag für einen schönen langen Spaziergang am Strand, dachte Tinke. Daraus würde nun garantiert nichts werden.
Sie trat in das Wohnzimmer, in dem seit fünfzehn Jahren nichts mehr geändert worden war. Kleine Nippes aus Holland standen überall herum: zwei winzige Vasen in Delfter Blau, in die höchstens je ein Gänseblümchen passte, eine kleine verstaubte Windmühle, deren Flügel sich, wie sie aus ihrer Kindheit wusste, sogar drehten, ein Miniatur-Holzschuh an einem Haken an der Wand.
Und da lag er – Eikboom Wiesgrund. Der Name war Programm: Tinkes Vater war ein Baum von einem Kerl. Jetzt allerdings erinnerte er mehr an eine gefällte Eiche. Die beigefarbene Couch war fast zu kurz für ihn. Amelie, die nervös neben ihm stand, hatte ihm offensichtlich ein paar Kissen in den Rücken gestopft. Tinke bot sich ein Bild des Jammers: Blass, schwer atmend und mit angstvoll aufgerissenen Augen blickte ihr Vater ihr entgegen. Sein graues Haar, sonst immer streng nach hinten gekämmt, hing ihm links und rechts wirr ins Gesicht und war schweißnass. Mit seiner rechten Hand fühlte er fahrig den Puls an seinem linken Handgelenk. Immer wieder hustete er stoßweise.
»Es ist wieder das Herz. Diesmal ist es bestimmt das Ende«, sagte er tonlos. »Es will nicht mehr. Ich spüre es genau.«
Tinke sah Amelie an. Diese verdrehte die Augen. Aus langen Gesprächen, die sich um die eingebildeten Krankheiten ihres Vaters drehten, wusste Tinke, dass Amelie, die seit fünfzehn Jahren als Haushälterin bei den Wiesgrunds arbeitete, ähnlich wie sie selbst dachte: Je weniger man auf die Ausbrüche einging, desto eher würde Boom sich wieder einkriegen. Aber was das Beste war, war nicht gleichzeitig das Einfachste.
Amelie war nicht vorsichtig genug gewesen. Boom hatte ihren Blick aufgefangen. »Was schaut ihr euch so an? Habt ihr mich jetzt endlich da, wo ihr wollt?«, fragte er bitter und kurzatmig. »Ich weiß genau, dass ihr mich nicht ernst nehmt. Euch ist es doch völlig egal, ob ich hier verrecke. Aber eins sage ich dir, Tinke«, fügte er auffahrend hinzu, »du musst nicht glauben, dass du auch nur einen Cent erbst, wenn ich sterbe und die Gärtnerei verkauft wird.« Schließlich kam er zu dem üblichen verletzenden Ende: »Du bist genauso eine Enttäuschung wie deine Mutter. Glaubst du, ich weiß nicht genau, dass du wegwillst, immer nur weg, als ob es woanders besser wäre? Genau wie sie. Wenn ich in deine Augen sehe, dann ist da dieselbe Sehnsucht. Pfui Teufel.« Er schnaubte verächtlich, Amelie runzelte entrüstet die Stirn, und müde ahnte Tinke bereits, wie diese wütende Litanei weitergehen würde: »Aber ich weiß genau, was es war. Ein anderer Kerl war es. Ich war ihr nicht genug. Und dann kam dieser Anruf aus Berlin. Ich wusste sofort, dass er es war. Sie hat wohl geglaubt, dass ich ihr verzeihen würde, wenn sie tot ist. Aber da hat sie sich getäuscht. Ich wollte sie nicht mehr hier haben. ›Verscharr du sie doch‹, hab ich ihm gesagt. ›Ich bin mit ihr fertig!‹« Vor lauter Rage atemlos, musste Boom tief Luft holen. »Wenn nur Severin da wäre. Auf deinen Bruder ist wenigstens Verlass.« Aufgebracht hatte er sich aus den Kissen aufgerichtet. Jetzt sank er ermattet zurück.
Das war der Moment, in dem in Tinke normalerweise eine Welle von Hass aufstieg, sie sich auf der Stelle umdrehte und den Raum verließ. Nur mit äußerster Beherrschung gelang es ihr jetzt, den alten Mann nicht alleinzulassen. Natürlich kannte sie die Hintergründe des sich ewig wiederholenden makaberen Theaters, das ihr Vater veranstaltete, wenn etwas nicht nach seinem Kopf ging: Er steigerte sich in eine Herzattacke hinein, die angeblich immer gerade dann aufgehört hatte, wenn sie zu dem alten Inselarzt Dr. Lensing geradelt war und er mit seinem Arztköfferchen eilig zur Gärtnerei gekeucht kam. Aber dass sie die Ursache kannte, machte es nicht leichter, seine verletzenden Bemerkungen zu überhören.
Allerdings fragte Tinke sich, was diesmal der Auslöser war. Sie hatte nicht vorgehabt zu verreisen – ein beliebter Grund aus der Zeit, als sie noch mit spontanen Ausflügen aufs Festland gegen ihren Vater und ihre aussichtslose Situation rebelliert hatte. Schon lange war diese Phase vorbei. Sie hatte mit Booms Verachtung und seinen Anfällen zu teuer dafür bezahlen müssen.
Auch ein Freund, mit dem sie heimlich Zukunftspläne schmiedete, konnte es nicht sein: Es gab niemanden mehr auf Langeoog, der in Betracht kam. Alle waren entweder weggezogen, hatten jemand anderen gefunden oder sich von Booms ablehnendem Auftreten und seiner zur Schau getragenen Kaltschnäuzigkeit abschrecken lassen.
Und auch Existenzangst konnte dank eines verheerenden Frühlingssturms, der vor einem Monat über die Insel gefegt war, nicht der Auslöser für das Elend auf der Couch sein: Boom Wiesgrund zog in der weitläufigen Gärtnerei unendliche Mengen von Strandhafer, den sogenannten Helm, der bei den Neuanlagen der Vordünen dringend benötigt wurde. Seit frühester Kindheit kannte Tinke das zufriedene Händereiben ihres Vaters, wenn in den Nachrichten vor Orkanstürmen an der Nordsee gewarnt wurde. Alle anderen Inselbewohner schauten besorgt aus den Fenstern ihrer Reetdachhäuser, warteten angstvoll auf das Eintreffen der Fischkutter ihrer Männer, Brüder und Freunde, konnten erst wieder ruhig schlafen, wenn auch der letzte von ihnen sicher in dem kleinen Hafenbecken angelegt hatte.
Für Tinke dagegen gehörte zu einem heulenden Sturm Booms fröhliches Pfeifen, das sie zu hassen gelernt hatte. Schon als kleines Mädchen hatte sie nicht verstanden, warum er sich über das schlechte Wetter freute. Aber seit ihre Freundin Babette bei einem Unwetter vor der Küste ihren Vater verloren hatte, verabscheute Tinke die unverhohlene Begeisterung ihres Vaters für Frühlings- und Herbststürme.
Hand in Hand hatte sie damals mit ihrer Mutter Heleen bei der Trauerzeremonie am Meer gestanden, als sie erfahren hatten, dass Bill Brod über Bord gegangen war und auf seiner buntbemalten BeBe nicht mehr zurückkommen würde. An diesem Tag, als Babettes Mutter nach der Trauerrede des Pfarrers den Kranz mit der Schleife vorsichtig auf die leise schlagenden Wellen gelegt hatte und alle Einwohner von Langeoog düster in Richtung Horizont blickten, war das Meer ruhig gewesen. Vergeblich hatte Tinke versucht, die schluchzende Freundin zu beruhigen, hatte Heleen Babettes Mutter den Arm um die Schultern gelegt.
Nach der Zeremonie waren sie über den Deich nach Hause geradelt, wo Boom sie selbstzufrieden mit Geschäftsneuigkeiten begrüßt hatte: Per Fax hatte der Landkreis ihm soeben einen besonders großen Auftrag zur Neubepflanzung der verwüsteten Dünenanlage geschickt.
Gerade noch bis ins Bad hatte Tinke es geschafft, bevor sie sich würgend hatte übergeben müssen. Heleen hatte geschwiegen.
Wenn aber alle diese Gründe nicht in Frage kamen, was war dann diesmal der Auslöser für Booms Anfall? Tinke versuchte, seine verletzenden Worte zu ignorieren, und ging auf ihren Vater zu. »Papa, beruhige dich doch. Wenn du dich aufregst, ist das für dein Herz nur noch schlimmer.«
»Du hast gut reden«, antwortete Boom. »Dein Herz schlägt ruhig und zufrieden vor sich hin. Aber meins rast wie eine Möwe im Sturm.«
Tinke verkniff sich eine schnippische Antwort, die sich auf seine Vorliebe für stürmisches Wetter bezog. »Soll ich mal deinen Puls fühlen?« Sie war sich sicher, dass sein Herzschlag genau wie immer sein würde: Regelmäßig wie ein Uhrwerk, wenn auch wegen des Stresses, den ihr Vater sich selbst zufügte, etwas schneller.
Ergeben und gnädig zugleich reckte Boom ihr den Arm entgegen. Tinke ergriff seine Hand und spürte dem Puls nach. Sie runzelte die Stirn. Denn das, was sie unter ihren Fingerspitzen fühlte, erinnerte nicht an eine Möwe im Sturm, sondern eher an einen flatternden Kiebitz, auf den sich gerade ein Seeadler stürzte: fliegend, hastig, völlig unregelmäßig, mit Doppelschlägen und sekundenlangen Aussetzern. Tinke sah erst Amelie an, dann ihren Vater und sagte: »Ich hole Dr. Lensing.«
Das Geräusch der Rotoren, die durch die Frühlingsluft schnitten, war ohrenbetäubend. Wie bei den meisten ärztlichen Notfällen auf der Insel landete der Rettungshubschrauber auf dem rotgeklinkerten Dorfplatz von Langeoog. Die Touristen, die wegen des schönen Wetters auf dem Weg zum Strand waren, um den frühen, angenehm warmen Maitag in einem Strandkorb zu verbringen, blieben stehen. Sie warfen neugierige Blicke auf die beiden Sanitäter, die mit einer Krankenbahre herauskletterten und auf den alten Mann zugingen, der mit aschfahlem Gesicht auf einem Stuhl vor einem Café saß und auf sie wartete. Neben ihm stand eine zierliche, blonde Frau in einer dunkelblauen Jacke und Jeans, daneben ein grauhaariger Mann mit einer Arzttasche.
Die Schaulustigen beobachteten, wie der Mann sich unbeholfen auf der Bahre niederließ, wie die Sanitäter eine Decke über ihm ausbreiteten, Gurte festzogen und den Kranken in den Hubschrauber schoben. Bevor der Helikopter wieder abhob, erhaschten sie noch einen flüchtigen Blick durch das kleine Fenster. Ein Arzt beugte sich über den Mann.
Das Letzte, was sie sahen, war das Blitzen von Metall, vielleicht eines Stethoskops oder eines EKG-Geräts. Dann stieg der Hubschrauber wie eine gigantische Libelle senkrecht in den Himmel auf und schwang sich in Richtung Festland.
2. Kapitel
Tinke saß mit Amelie in der Küche des Gärtnerhauses. Beide Frauen hatten einen Pott mit starkem schwarzen Tee vor sich. Ein kleines Kännchen mit frischer Sahne und eine Schale mit grobem weißem Kandiszucker standen auf dem Tisch.
Mit einem kleinen silbernen Löffel rührte Tinke geistesabwesend in ihrer Tasse. »Amelie, ich kann das alles nicht glauben. Als du mich vorhin nach unten gerufen hast, war ich so sicher, dass Boom wieder seine übliche Show abzieht.«
»Ja, Kind, diesmal ist es passiert. Diesmal hat’s den alten Mann wirklich erwischt. Aber hab keine Angst, das muss ja nicht das Ende sein. Die Medizin schafft heute so viel.«
Tinke blickte der Frau, die in den langen Jahren vergeblich versucht hatte, ihr die Mutter zu ersetzen, hart in die Augen. »Ehrlich gesagt, das Gegenteil ist der Fall.«
Amelie begriff sofort, was sie meinte. Schockiert sagte sie: »Aber Tinke, so etwas darfst du nicht mal denken, geschweige denn dir wünschen! Er ist doch dein Vater.«
»Er hat sich nicht wie ein liebender Vater benommen, sondern wie ein Feind, der mich hasst, seit Mutter tot ist.« Wieder fühlte Tinke die Woge der Frustration in sich aufsteigen, wenn sie daran dachte, wie früh ihre Mutter sie mit Boom alleingelassen hatte und wie schrecklich diese Jahre für sie gewesen waren. Aber noch bitterer war es, dass sie sich nie von ihrer Mutter hatte verabschieden können. »Lieber heute als morgen würde ich weggehen, wenn ich könnte und er mich ließe. Aber er hat ja gründlich dafür gesorgt, dass ich hier wie angekettet bin. Wer nimmt denn schon eine Achtundzwanzigjährige, die einen Realschulabschluss und sonst gar nichts hat, immer in dieser Bude hockt und nur ein bisschen Buchführung kann: ›Ausgabe Stickstoff, zwei Sack à dreißig Pfund, Einnahme Dünengras tausend Stück, Ausgabe Telefon, Einnahme Geranien Komma drei, Komma rot‹? Und was würde dann aus ihm werden?«, fragte Tinke resigniert. »Gott, wie ich diese Gärtnerei verabscheue, diese kaputten, kalten Treibhäuser, diese blöden Stiefmütterchen und Geranien im Frühling, dieses harte Gras, das die Finger zerschneidet, die salzige Erde, die endlosen Stapel von Bestellkatalogen im Winter! Wenn ich mir jetzt auch noch vorstelle, dass Boom mich von nun an mit echten Krankheiten statt mit eingebildeten tyrannisiert – das halte ich nicht aus. Ich will weder seine Buchhalterin noch seine Krankenpflegerin sein, die er ständig beschimpft.«
Amelie schwieg. Dann sagte sie: »Aber er war doch nicht immer so. Weißt du nicht mehr, wie er früher war? Alle fanden, dass Eikboom Wiesgrund der beste Vater auf der Insel war. Jede freie Minute hat er sich mit dir und Severin beschäftigt.«
Das passte mal wieder zu Amelies Warmherzigkeit. Außerdem hatte Tinke immer vermutet, dass Amelie für Boom gern mehr gewesen wäre als die Haushälterin, die seit fünfzehn Jahren das Essen auf den Tisch brachte, sich um die Wäsche und vor allem um Tinke kümmerte. Severin war damals schon auf einem Internat gewesen, das einem Gymnasium angeschlossen war, denn in der kleinen Inselschule war nach zehn Jahren Schluss mit Bildung.
Wahrscheinlich, mutmaßte Tinke, hatte sich auch in Amelie das Bild des starken, gutaussehenden Mannes eingeprägt, der seine Frau Heleen, die von einer kleinen holländischen Insel kam, vergötterte.
Nur den Wunsch nach einem anderen Leben, das Heleen bei der Arbeit in der Gärtnerei auf der kleinen Insel nicht fand, ihre große Sehnsucht nach Kunst, nach Zeichnen und Malen, konnte und wollte er ihr nicht erfüllen. Es wäre ihm ein Leichtes gewesen, ihre Leidenschaft, selbst wenn er sie nicht teilen konnte, zumindest zu tolerieren. Aber er war eifersüchtig auf ihr Interesse auf etwas, das sich nicht auf ihn, auf ihr gemeinsames Leben bezog. Und so wurden ihre autodidaktischen Versuche, den Ausdruck ihrer Bilder zu verdeutlichen und zu verbessern, zu einem ständigen Streitthema zwischen ihnen. Boom hatte getobt und geschimpft, hämische Bemerkungen über Heleens Leidenschaft gemacht, über ihre kleinen Skizzen, auf denen sie die Landschaft, die Dünen, das Meer einfing. Immer stiller war Heleen geworden, hatte nicht mehr mit Boom über ihre Bilder gesprochen und schließlich nur noch im Verborgenen gemalt.
Dann, als Tinke zehn Jahre alt war, war Heleen eines Tages nach einem Streit verschwunden. Am nächsten Tag hatte Boom bei ihren Eltern auf Ameland angerufen. Ja, Heleen war bei ihnen auf der holländischen Insel gewesen, aber heute morgen wieder weggefahren. Wohin? Sie wussten es nicht.
Eine Woche später war Heleen wieder nach Langeoog zurückgekehrt. Sie hatte ihre Gartenschuhe angezogen und auf dem Gräserfeld mit angepackt, als sei nichts gewesen. Aber ein strahlendes Leuchten hatte sie in den Augen gehabt, das für Boom nur einen Schluss erlaubte: Die Frau, die ihm vor Jahren in der Inselkirche von Langeoog Treue geschworen hatte, musste die Zeit, in der er sich um sie sorgte, mit einem anderen Mann verbracht haben.
Doch statt zu fragen, wo sie gewesen war, hatte er eisern geschwiegen. So, als ob die Wahrheit nicht existierte, wenn sie nicht ausgesprochen wurde. Seine Wortlosigkeit war der Nährboden für Misstrauen, Verdacht und Beschuldigungen, die andere Gefühle erstickten – diejenigen, die bis jetzt die Grundlage ihrer Ehe gebildet hatten und auf die sie sich nach jedem Streit zurückbesonnen hatten.
Eine Weile gingen sie beide ihren Pflichten nach, fanden sich vielleicht auch in einer stummen nächtlichen Umarmung. Doch irgendwann hatte es wieder von vorn angefangen. Über die nächsten drei, vier Jahre hatte es im Haus Wiesgrund immer wieder dieselbe Szene gegeben: Streit, wann immer Boom ein Bild, eine Zeichnung, ein kleines Gemälde entdeckte, sein Gebrüll, Heleens Schweigen, ihr rätselhaftes Verschwinden, zwei oder drei Mal im Jahr.
Dabei war es gerade Heleens zerbrechliche Andersartigkeit gewesen, mit der sie das Herz dieses rauhbeinigen, sturen Gärtners erobert hatte. Boom war vierzig, als er, der ewige Junggeselle, sich Hals über Kopf in die zarte, verletzliche Holländerin verliebt hatte, die dreizehn Jahre jünger war als er und aus Liebe zu ihm die Insel wechselte.
Inzwischen war Tinke überzeugt, dass der ständig schwelende Konflikt ihre Mutter hatte krank werden lassen. Aber Dr. Lensing meinte, eine nicht auskurierte Grippe sei an ihrer Herzschwäche schuld gewesen.
Und eines schönen Sommertages, als sie schon sehr schwach war und schnell außer Atem geriet, hatten sie und Boom sich wieder heftig gestritten. Krank und blass war sie von der Insel geflüchtet. Einige Tage später hatte das Telefon im Arbeitszimmer geklingelt, dort, wo Tinke jetzt jeden Monat die Buchführung machte. Ein fremder Mann aus Berlin hatte angerufen und mitgeteilt, dass Heleen an Herzversagen schnell, leise und über Nacht gestorben sei. Boom hatte ihn in ohnmächtiger Wut angezischt, dass er auf die Überführung seiner toten Frau verzichtete, und den Hörer aufgeschmissen.
Nie würde Tinke vergessen, wie er nach diesem Anruf, brüllend wie ein verwundeter Stier, durchs Haus gerannt, von Zimmer zu Zimmer getobt und schließlich ins Freie geflohen war. Ins nächste Gewächshaus war er gestürzt, hatte die Tür krachend zugeworfen und von innen verriegelt. Auf Tinkes flehendes Bitten hatte er nicht reagiert. Zwei Tage lang hatte sie gesehen, wie er hinter den beschlagenen Scheiben ruhelos hin- und hergelaufen war, hatte beobachtet, wie er sich auf dem Boden zusammengerollt hatte. Dann war er herausgekommen: verdreckt, das Gesicht schmutzig, als hätte er versucht, in die Erde zu kriechen, in die unbekannte Menschen, ein fremder Mann, Heleens leblosen Körper in Berlin hinabsenken würden. Er war ein gebrochener Mann.
So abgöttisch er Heleen einst geliebt hatte, so sehr hasste er sie jetzt. Und weil Tinke ihrer Mutter außergewöhnlich ähnlich sah, hatte er alle Vorwürfe, die er Heleen jahrelang, unversöhnlich und völlig fruchtlos gemacht hatte, an Tinke weitergegeben. Wann immer er in die grünen Augen seiner Tochter gesehen hatte, erblickte er dort das Antlitz der Frau, die sein Vertrauen zerstört, seine Liebe mit Füßen getreten hatte. Bis genau das eingetreten war, was Boom am meisten fürchtete: Tinke wollte so schnell wie möglich von der Insel weg, weg von dem Haus, der Gärtnerei, weg von ihm.
Nie hatte sie ihm vergeben, dass er ihr durch sein Verhalten versagt hatte, von ihrer Mutter Abschied zu nehmen. Nie wieder kam ein Anruf aus Berlin, der verraten hätte, wo Heleen ihre letzte Ruhe gefunden hatte. Niemals hatte Tinke ihrem Vater verziehen, dass sie nicht bei dem Begräbnis dabei sein konnte – wo immer es auch stattfand.
Wahrscheinlich hätte er gut daran getan, jemanden wie Amelie zu heiraten, überlegte Tinke. Und sie glaubte, dass Amelie gern diesen unverhofft freigewordenen Platz in seinem Leben eingenommen hätte. Aber mit Heleen war auch Booms Fähigkeit verschwunden, jemanden zu lieben – nicht einmal mehr sich selbst. Vielleicht lag darin der Grund für seinen Wahn, bald sterben zu müssen. An einer Herzkrankheit, die eigentlich Heleen gehabt hatte, dachte Tinke.
Und so war Amelie nicht wegen Boom Wiesgrund, sondern wegen ihr, Tinke, geblieben. Plötzlich fiel ihr auf, wie müde ihre mütterliche Freundin aussah.
Tinke wandte den Blick ab und schaute aus dem Küchenfenster. Aber sie sah nicht das Meer, das an dieser schmalen Stelle der Insel bis an das Grundstück der Gärtnerei reichte. Vor ihrem inneren Auge stieg ein anderes Bild auf: Sie sah ein kleines blondes Mädchen, das an seinem achten Geburtstag von seinem Vater den schönsten, größten und buntesten Drachen geschenkt bekommen hatte, den er in dem kleinen Inselgeschäft hatte finden können. Ein leuchtendes Ungeheuer mit einem fröhlichen Gesicht, zusammengesetzt aus unzähligen farbenprächtigen Rhomben, einer langen roten Zunge und wilden, schwarz-weißen Augen, die von dem hellblauen Himmel herunterleuchteten. Am Strand hatten sie ihn gemeinsam steigen lassen. Tinke hatte gebettelt und gefleht: Sie wollte ihn so gern allein halten. Schließlich hatte Boom nachgegeben. Doch der Wind war so heftig, dass der Drachen sie, zierlich wie sie war, hochgerissen hatte. In letzter Sekunde hatte Boom sie erwischt. Erschrocken hatte er Tinke in seinen Armen gehalten, sein Gesicht in ihr helles Haar gepresst und gesagt: »Meine kleine Windprinzessin, du darfst nicht mit dem Sturm übers Meer wegziehen, du musst doch bei deinem alten Vater bleiben.«
»Du bist doch nicht alt, Papa«, hatte sie gelacht, sich losgemacht und war davongehüpft.
»Du hast recht, Amelie«, sagte Tinke. »Er war nicht immer so. Aber seit fünfzehn Jahren ist er so, und seit fünfzehn Jahren leide ich darunter. Etwas muss sich ändern. Vielleicht ist dieser Zeitpunkt jetzt gekommen. Ich rufe im Krankenhaus an und höre erst einmal, was sie sagen und wie es ihm geht. Und dann spreche ich mit Severin.«
3. Kapitel
Severin Wiesgrund beugte sich über die Pumpe. Auf der Plattform der Ölbohrinsel, fast vierzig Kilometer vom holländischen Festland entfernt, wehte an diesem Frühlingstag ein frischer Wind, aber im Maschinenraum herrschte unerträgliche Hitze. Er fluchte, als der Schraubenzieher, mit dem er an einer defekten Manschette geschraubt hatte, ihm aus den Händen glitt und um ein Haar durch den grob gerasterten Gitterboden eine Etage tiefer gefallen wäre. Schnell stellte er seinen schweren Arbeitsstiefel darauf und bückte sich, um das Werkzeug aufzuheben. Er steckte den Schraubendreher in die extra dafür vorgesehene Tasche an seinem grauen Overall, wischte sich seine verschwitzten Hände an den Oberschenkeln ab, fuhr sich durch das dunkelblonde Haar, das durch das Öl an seinen Händen strähnig wurde, und machte sich wieder an die Arbeit.
Eigentlich hätte er heute Außendienst gehabt. Aber der zweite Ingenieur, mit dem er zusammen auf der kleinen Ölplattform Schicht hatte, war erkältet und überzeugt, dass ihm das Reizklima, wie er es grinsend nannte, besser tat als die stickige Luft in dem nach Öl riechenden Maschinenraum. Weil Severin den hageren, dunkelhaarigen Bas de Boer mochte, hatte er sich bereit erklärt, zu tauschen. Aber kaum hatte er den Raum betreten, in dem die großen Maschinen dafür sorgten, dass das vom Meeresgrund hochgepumpte Erdöl in die Rohre geleitet wurde, die das schwarze Gold zum Festland bringen würden, war alles schiefgegangen.
Ein Blick auf die Uhr verriet, dass er bereits seit über einer Stunde mit der kaputten Metallmanschette beschäftigt war. In letzter Zeit ging ihm die Arbeit nicht mehr so leicht von der Hand. Und er glaubte auch zu wissen, was der Grund dafür war: Er war jetzt zweiunddreißig, und nach acht Jahren auf verschiedenen Bohrinseln, immer im Auftrag der niederländisch-englischen Ölgesellschaft, hatte er die Nase voll. Er verdiente sehr gut, hatte jedoch keine Ahnung, was er mit diesem Geld mal machen wollte. Direkt nach seinem Maschinenbaustudium hatte er bei der Ölgesellschaft angefangen. Das Angebot, das die Firma ihm gemacht hatte, war einfach zu verlockend gewesen.
Doch die Jahre vergingen erschreckend schnell, und seine ganze Freizeit schien er damit zu verbringen, mit den anderen Ingenieuren Karten zu spielen und sich Videos anzuschauen. Zwischen Actionfilmen, Romantikkomödien und Pornostreifen würde er ein alter Mann werden, wenn nicht bald etwas geschah.
Er beugte sich erneut über die Anlage. Die neue Manschette saß jetzt endlich fest. Der Zubringerschlauch führte in die Maschine, die …
Ein donnerndes Geräusch unterbrach seine Gedanken. Was war das gewesen – eine Explosion? Severin drehte sich um und kletterte so schnell wie möglich die schmale Treppe nach oben, wobei er sich mit beiden Händen links und rechts am Stahlgeländer festhielt.
Aus dem lärmenden Bauch des runden Gebäudekorpus trat er auf die Plattform. Von hier war der Knall gekommen. Er rannte zu dem einzigen Ort, der in Frage kam: Ein Auffangbehälter für Öl aus neuen Sandschichten, das in dem kleinen Labor auf eine mögliche Eignung hin untersucht wurde. Der Behälter stand unter Druck. Vielleicht war er ja – Severin bog um die Ecke und blieb wie angewurzelt stehen. Ja, er hatte recht gehabt. Das musste die Quelle der Explosion gewesen sein. Der Auffangbehälter hing in seinen zerfledderten Teilen brennend in der Befestigung, in einem Umkreis von schätzungsweise zehn Metern waren Bruchstücke verstreut. Es roch stechend nach brennendem Plastik. Und mittendrin in dem schwelenden Chaos lag Bas. Der Idiot – hatte er etwa wieder geraucht, was hier strengstens verboten war? Die Druckwelle musste ihn umgeworfen haben.
Severin lief zu ihm hin und kniete sich neben ihn. »Bas, hörst du mich?«
Der Holländer öffnete die Augen und blickte sich verwirrt um. »Sev, wat bedoel je? Is er iets gebeurd?«
Erleichtert wollte Severin seine Hand nehmen und fuhr entsetzt zurück: Bas’ Arm war über und über blutig und aufgerissen.
»Du bist verletzt. Ich hol den Sanitätskoffer. Rühr dich nicht von der Stelle.«
Ergeben schloss Bas die Augen. Nicht für immer, hoffte Severin inständig, während er zum Erste-Hilfe-Raum rannte.
Zögernd griff Tinke zum Telefon. Sie musste Severin anrufen. Er sollte wissen, was mit Boom passiert war. Aber sie telefonierte nur ungern mit ihm. Hätte sie jemand nach dem Warum gefragt, hätte sie zwei Gründe genannt: Es war lästig, dass Severin immer erst auf der Bohrinsel ausgerufen werden musste und sie nie wusste, ob er nicht gerade eine Nachtschicht gehabt hatte und sie ihn aus irgendwelchen technischen Träumen aufscheuchte. Der zweite Grund war die schlechte Verbindung. Wann immer sie miteinander sprachen, rauschte und hallte es in der Leitung, als ob das Meer mit aller Macht versuchte, ihren Anruf so schnell wie möglich zu unterbrechen.
In Wirklichkeit waren allerdings weder Zeit noch Meer der Grund dafür, dass sie Severin lieber nicht anrief. Trotzdem, es half nichts. Sie wählte die Nummer und hörte schließlich die Stimme ihres Bruders, der ihr früher der vertrauteste Mensch auf der Welt gewesen war.
»Hallo, Severin, hörst du mich?«
Knacken, Knistern, Rauschen, dann: »Ja, hallo, Tinke, ich hör dich. Aber nicht gut. Was gibt es? Ist was passiert?«
»Ja, Boom ist krank. Wir mussten ihn heute mit dem Hubschrauber abholen lassen.«
Stille am anderen Ende. Dann fragte Severin: »Du meinst, ernsthaft krank? Nichts Eingebildetes?«
»Dann würde ich dich nicht anrufen«, entgegnete Tinke schnippisch.
»Ist ja schon gut, kleine Schwester. Was hat er denn?«
»Herzrhythmusstörungen. Der Arzt sagt, dass das nicht ungewöhnlich für einen Dreiundsiebzigjährigen ist und dass man ihn mit Medikamenten behandeln kann. Es besteht keine Lebensgefahr. Aber er soll ein blutverdünnendes Mittel nehmen, und damit kann er nicht mehr so schwer arbeiten.«
Wieder herrschte am anderen Ende der Leitung Stille.
Warum schwieg Severin heute so viel?, fragte sich Tinke. Dann hörte sie ihren Bruder sagen: »Und was wird aus der Gärtnerei? Den Aufträgen?«
»Genau das wollte ich mit dir besprechen. In letzter Zeit war Boom noch unausstehlicher als sonst. Unmöglich, dass ich hier alles allein manage.« Tinke wartete auf Severins übliche Antwort, wenn sie ihm über Booms Ausfälle ihr gegenüber berichtete: Er würde abwiegeln, würde sagen, dass es bestimmt nicht so schlimm sei, sie ermuntern, mehr auf der Insel zu unternehmen – ha, dachte Tinke dann, was, mit wem und wie? –, würde sie beschwichtigen, weil das für ihn ein Garant war, sein eigenes Leben weiterzuleben.
Und wie recht sie hatte. Denn in diesem Moment sagte Severin auch schon: »Du übertreibst, Tinke. So schlimm kann es nicht sein. Du hast doch auch Amelie, die dir immer hilft.«
»Du weißt genau, dass Amelie den Haushalt macht, aber nicht in der Gärtnerei hilft. Sicher finde ich irgendeinen Gelegenheitsarbeiter, der das Gras in die Reihen stopft und gießt. Aber das hält Boom auch nicht davon ab, seine Launen an mir auszulassen und mir Vorwürfe über etwas zu machen, das ich niemals getan habe«, erwiderte Tinke hitzig. Sie hasste es, dass ihr Bruder niemals auch nur in Erwägung zog, etwas zu tun, das ihre Situation ändern könnte. »Aber ehrlich, ich erwarte nicht, dass du mich verstehst. Es wäre auch das erste Mal.«
Ganz kurz hörte sie noch seine Stimme, aber da hatte sie das Gespräch auch schon abgebrochen. Sie stellte den Hörer wütend in die Station zurück und ging wieder in die Küche.
Amelie, die gerade die Teepötte abwusch, drehte sich um. »Und, was hat er gesagt?«
»Was schon! Das Gleiche wie immer.« Tinke setzte sich an den Küchentisch.
Amelie sah sie mitleidig an. »Ist es für dich wirklich so schlimm, auf der Insel zu sein?«
»Ja«, sagte Tinke, und jetzt stiegen ihr die Tränen in die Augen. Sie stützte den Kopf in die Hände. »Ich habe immer das Gefühl, dass mein Leben an einem anderen Ort stattfindet, den ich nicht mal kenne. Und wenn Papa aus dem Krankenhaus kommt, kann es einfach nicht besser werden, das weißt du genau.«
Amelie nickte. Sie hatte die Szenen, die Boom seiner Tochter machte, lang genug miterlebt, um zu wissen, dass sie recht hatte. Tinke wischte sich mit der Hand die Tränen weg, stand dann abrupt auf und sagte: »Ich muss raus, sonst werde ich noch verrückt.«
»Tu das, Kind. Die Meeresluft kann nur helfen.«
Tinke lachte bitter auf. »Ich fürchte, Meeresluft allein wird es nicht richten.« Sie nahm ihre Jacke, öffnete die Tür und ging in raschem Schritt in Richtung Deich. Immer weiter lief sie, geradeaus, ohne nach dem Weg zu schauen, weg von der Gärtnerei, die ihr zu einem Gefängnis geworden war. Ihr Blick suchte das frische Grün des Grases, dahinter den Horizont, die weißen Wolkenformationen, die helle Gischt auf den sich brechenden Wellenkämmen. Aber ihre Gedanken waren bei dem Telefonat mit ihrem Bruder, bei ihrem Zorn auf Severin, auf ihren Vater, auf die ewig gleiche Ausweglosigkeit, die ihre Träume für immer zu ersticken drohte.
Und absolut nichts an ihrer Verzweiflung hatte sich geändert, als sie nach einer Weile umkehrte und zurück ins Haus ging.
Amelie sah sie aufmerksam an, als Tinke schweigend ihre Jacke aufhängte und sich zur Treppe wandte. »Ich muss noch die Ablage beenden.«
»Und ich gehe nach Hause«, antwortete Amelie. »Im Ofen ist noch der Rest von dem Auflauf. Wenn du Hunger hast, wärme ihn dir auf.«
Tinke nickte müde und nahm die erste Stufe. In diesem Moment klingelte das Telefon. Sie sah zu Amelie. »Ich geh nicht ran.«
»Mach lieber, Kind. Vielleicht ist es das Krankenhaus.«
Widerwillig ging Tinke in das Nachbarzimmer und nahm den Hörer ab. Amelie hatte sich getäuscht: Es war Severin.
Doch diesmal sagte er etwas völlig Unerwartetes: »Tinke, hör mal, ich habe mir gerade etwas überlegt, das ich mit dir besprechen will. Aber nicht am Telefon. Ich nehme mir ein paar Tage Urlaub und komme nach Langeoog. Dann machen wir einen Plan, ja? Bis dann, und grüß Papa von mir. Gute Besserung.« Damit legte er auf, und diesmal stellte Tinke den Hörer sehr langsam, sehr vorsichtig zurück, bevor sie sich mit einem Ausdruck hoffnungsvoller Ungläubigkeit zu Amelie umdrehte, die in Hut und Jacke im Türrahmen stand und sie erwartungsvoll ansah.
4. Kapitel
Von diesem Augenblick hatte Tinke geträumt, solange sie denken konnte. Mal lag in ihren Träumen auf dem gepflasterten Weg frischer Schnee, den sie mit jedem Schritt aufwirbelte, mal blies ihr ein scharfer Nordseewind ins Gesicht. Manchmal schien die Sonne gleißend hell auf das bleigraue Wasser. Oder die Möwen schrien gellend laut und flogen im Sturzflug so knapp an ihr vorbei, dass sie unwillkürlich eine Hand nach oben riss, um sich gegen ihre scharfen Schnäbel zu schützen. Manchmal herrschte auch Totenstille, und sie ging mühsam wie durch einen dicken Nebel aus grauer Watte.
Aber immer hatte sie in ihrem Traum einen Koffer in der Hand. Wenn sie dann die Fähre betrat, spürte sie eine grenzenlose Erleichterung und gleichzeitig eine Vorfreude, die sie innerlich zittern ließ. Brummend sprangen die Motoren an, während sie an Deck stand. Alles in ihr weigerte sich, zurückzuschauen. Sie wandte dem Hafen, der kleinen Inselbahnstation den Rücken zu und blickte voller Erwartung auf das Wattenmeer. Irgendwo dort, zwischen Tang und Sand befand sich die Fahrrinne, in der die Fähre mit ihr sicher zum Festland fahren würde.
In diesem Moment dachte sie jedes Mal: Es ist vorbei, ich bin frei.
Das war dann der Augenblick, in dem sie erwachte und eine Welle der Enttäuschung über sie hereinbrach. Darüber, dass sie immer noch in ihrem kleinen Zimmer in dem alten Wohnhaus war, das zur Inselgärtnerei gehörte. Darüber, dass sie sich noch immer in diesem Leben befand, das so gar keine Ähnlichkeit mit ihren Träumen hatte.
Doch diesmal war es kein Traum, aus dem sie enttäuscht erwachen würde. Es war Wirklichkeit, und sie wusste es. Der Frühlingswind, nicht schneidend, sondern mild, blies ihr die Haare aus dem Gesicht. Sie trug nicht nur einen Koffer, sondern zog auch einen Trolley hinter sich her und hatte sich ihre große, weiche Lederhandtasche um die Schulter gehängt.
»Hey, Tinke«, sagte Nils, der die Fahrkarten der wenigen Gäste kontrollierte, die an diesem Dienstagvormittag die Insel mit der Fähre verließen. Er winkte ab, als sie in die Tasche greifen wollte, um ihm ihr Ticket zu zeigen. »Ist der große Tag für dich endlich gekommen?«
Sie und Nils kannten sich schon seit ihrer gemeinsamen Schulzeit auf der Insel. Diesen einen Sommer lang, als Heleen von der Insel gegangen und aus Tinkes Leben verschwunden war, hatte Nils sie getröstet, wie es nur ein guter Freund konnte. Später hatten sich ihre Wege wieder getrennt, soweit man auf der Insel überhaupt davon sprechen kann, aber wann immer Tinke ihn sah, herrschte eine vage Vertrautheit zwischen ihnen. Ein leises Echo der Abende, als sie in den Dünen ein kleines Feuer gemacht hatten, auf einer Decke saßen und sich darüber unterhielten, was sie später machen würden.
Nils wollte am liebsten Meeresbiologie studieren und Wissenschaftler werden, träumte heimlich davon, später einmal eine Robbenaufzuchtstation auf der Insel zu gründen. Pläne, aus denen nichts geworden war. Aber mit seinen Wattführungen, die er für die Touristen veranstaltete, schien er etwas gefunden zu haben, was ihm gefiel. Er wirkte zufrieden, fand Tinke.
Tinkes Zukunftsträume waren damals wie heute unbestimmter. Bloß eines wusste sie genau: Weg von der Insel wollte sie, und was immer sie machen würde – es durfte nichts mit Pflanzen, Erde, Sand und dreckigen Fingernägeln zu tun haben.
»Ja«, sagte sie. »Jetzt ist hier Schluss für mich. Severin will sich von nun an um die Gärtnerei kümmern. Erst ein Jahr lang, aber wer weiß – vielleicht gefällt es ihm ja so gut, dass er für immer bleibt! Mich hat die Insel jedenfalls die längste Zeit in den Klauen gehabt.«
»Hoffentlich kannst du es ohne Wölkchen-Tee, Strandspaziergänge und unseren Shanty-Chor aushalten. Das haben die nämlich bestimmt nicht in Berlin. Warum willst du da überhaupt hin? Da kennst du doch niemanden.«
»Ja, das mit dem Shanty-Chor wird wirklich hart.« Tinke lachte. »Aber Ostfriesentee mit Sahne wird sich wohl auftreiben lassen. Wahrscheinlich sogar eine Tasse mit Zwiebelmuster. Und außerdem: Natürlich kenne ich jemanden in Berlin«, verkündete sie. »Babette.«
»Babette Brod? Meinst du Brödchen, das verrückte Huhn?«, fragte Nils grinsend. Sein kleiner Ohrstecker glitzerte im Sonnenlicht.
»Genau die«, antwortete sie gelassen, aber innerlich auch ein bisschen verärgert. Was fiel Nils ein, sich über Babette lustig zu machen! Selbst wenn es zugegebenermaßen stimmte, dass Babette nach dem Tod ihres Vaters etwas ausgeflippt war. Auf Langeoog erinnerten sich noch viele kopfschüttelnd daran, wie sie sich den Jungen, die auf dem Campingplatz gezeltet hatten, an den Hals geschmissen hatte – das kollektive Inselgedächtnis war ziemlich gut.
Babettes besondere Vorliebe hatte damals denjenigen gegolten, die so wenig angepasst wie möglich waren. Sie konnten ihr nicht wild genug sein. Und dann war sie eines Tages mit ihrer Mutter weggezogen, nach Berlin, wo sie Verwandte hatten und die Mauer gerade gefallen war. So weit weg war Babette plötzlich, dass die Mauerspechte, von denen sie Tinke am Telefon erzählte, während sie zum Beweis den Hörer aus dem Fenster hielt, auch an der Chinesischen Mauer hätten hämmern können.
Überhaupt: Nils musste gerade reden. Tinke wusste genau, dass er damals von einem Motorrad, einer richtig schweren Karre geträumt hatte, von einem ausgeflippten Leben mit harter Rockmusik, Tattoos und viel Bier. Wahrscheinlich war er immer noch sauer, dass Babette ihn damals, obwohl er sie klasse fand und sie nicht gerade wählerisch gewesen war, keines Blickes gewürdigt hatte!
»Aber du kommst uns doch mal besuchen?«, fragte er neugierig, vielleicht auch ein bisschen besorgt.
»Mal sehen. Irgendwann«, antwortete Tinke kühl.
»Na dann, alles Gute«, wünschte er und wandte sich ab, um die Fähre zu verlassen. Dann drehte er sich noch einmal um. »Schade«, sagte er. »Die Berliner Männer sind wirklich zu beneiden.«
Und dann ging er wirklich, und Tinke fragte sich, ob ihr in den letzten Jahren etwas entgangen war.
Noch etwas war anders in ihrem Traum gewesen, fiel ihr ein, als die schweren Schiffsmotoren vibrierend zum Leben erwachten: Sie weigerte sich nicht, einen letzten Blick auf die Insel zu werfen. Stattdessen stand sie an Deck und sah sie immer kleiner, immer flacher werden, bis sie schließlich mit der Linie des Horizonts verschwamm. Dann erst drehte Tinke sich um. Allmählich rückte der Fährhafen vom gegenüberliegenden Festland näher. Links und rechts von ihm erstreckten sich Deiche, auf denen Schafe grasten, kleine helle Flecken. Jetzt, Anfang Mai, waren sie bereits geschoren. Sollte es noch einmal kalt werden, würden sie frieren – die Zeit der Schafskälte.
Im Hintergrund konnte Tinke bereits den Parkplatz von Bensersiel erkennen, auf dem die Autos standen, die die Touristen nicht auf die Insel mitnehmen durften. Für Boom war das allein schon Grund genug gewesen, ihr nicht zu erlauben, den Führerschein zu machen. Als ob die Welt am Hafen zu Ende wäre.
Eine Welle der Erleichterung spülte über sie hinweg, als ihr klar wurde, dass sie diesmal nicht in wenigen Stunden nach hastigen Einkäufen auf dem Festland wieder in der Fähre sitzen würde, die sie nach Langeoog zurückbrachte. Und falls sie daran zweifelte, brauchte sie nur auf den Berg Gepäck zu sehen, den sie um sich herum aufgebaut hatte.
5. Kapitel
Sehr geehrte Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Berlin-Hauptbahnhof. Wir bitten Sie, die Verspätung von dreiundvierzigeinhalb Minuten zu entschuldigen. Weiterreisende haben von hier aus in einer Minute den Anschluss an den ICE nach München, drei Etagen tiefer. Den heutigen Zug nach Paris werden Sie leider nicht mehr erreichen. Wir bitten Sie, zwecks einer Hotelbuchung auf eigene Kosten mit dem Informationsstand im Eingangsbereich Kontakt aufzunehmen …«
Na, da kann ich ja von Glück sagen, dass ich nicht nach Paris will, dachte Tinke. Sie blickte interessiert aus dem Fenster. Häuserreihen, eine Autobahn, eine verlassene Hafenanlage – nichts, was sie an die Fotos von Berlin erinnerte, die sie sich auf den Touristenseiten im Internet angeschaut hatte –, zogen an ihr vorüber.
Dann fuhr der Zug in einen unterirdischen Tunnel. Um sie herum standen etliche Reisende auf, und Tinke folgte ihrem Beispiel. Sie zog ihre Jacke an und schob die Gepäckstücke zum Ausgang. Die Bremsen kreischten, als der Zug zum Halten kam. Tinke stieg aus, und helfende Hände reichten ihr Koffer, Trolley und Tasche auf den Bahnsteig.
Einen Moment lang blieb sie wie angewurzelt stehen und starrte nach oben. Was für ein monumentaler Bau! Unendlich hoch erstreckte sich über ihr die durchsichtige Decke aus Glasplatten, die sich in einem sanften Schwung links und rechts der vielen Gleise zur Straße senkte. Wie eine Muschel aus Kristall, dachte Tinke, bevor sie jemand zur Seite stieß. Sie fuhr herum.
»Sorry, aber Sie stehen wirklich direkt im Weg«, sagte ein großer, dunkelhaariger Mann ungehalten und blitzte sie durch seine schmale Hornbrille hindurch an. Er trug eine Leinenhose und ein dunkelblaues Hemd, das er bis zu den Ellbogen hochgerollt hatte und das dieselbe Farbe wie seine Augen besaß. Unter dem einen Arm trug er eine lange Papierrolle, unter dem anderen eine große Mappe, in der er scheinbar Poster oder Ähnliches transportierte. »Das ist kein Grund, mich anzurempeln«, gab sie böse zurück. Aber da war er schon vorbei und schoss auf die Rolltreppe zu. Tinke, die langsam hinter ihm herging, hätte schwören können, dass er im Vorübergehen etwas wie »Tussi« oder »Touri« gemurmelt hatte.
Das musste der typische Berliner sein, wie Babette ihn ihr warnend beschrieben hatte: unfreundlich, ungeduldig und immer in Hetze. Wenigstens hatte er nicht das Handy am Ohr, was Babette als weiteres Merkmal genannt hatte. In diesem Moment klingelte es jedoch, und Tinke sah, wie der dunkelhaarige Mann, bereits auf der Treppe, so gut es mit keiner freien Hand ging, zu telefonieren versuchte. Der Versuch ging gründlich daneben: Beim letzten Schritt von der Rolltreppe rutschte ihm die große Mappe unterm Arm weg. Sie flog auf den Boden, öffnete sich, und eine Flut von Zeichnungen flatterte heraus. Tinke, die ebenfalls die Rolltreppe genommen hatte, schaute sich die Skizzen interessiert an: nackt, nackt, nackt! Lauter posierende Frauen waren zu sehen. Kniend. Liegend. Stehend. Hockend. Große Brüste, knackige Pos und dralle Schenkel, wohin sie blickte.