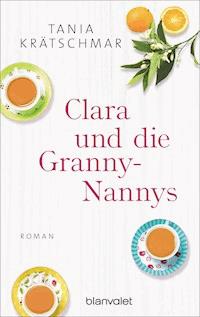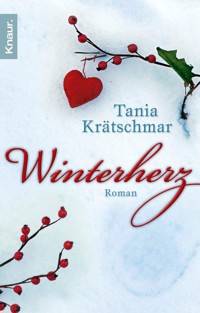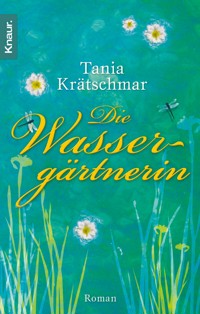6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dana van Aken hat ihr Leben im Griff: Ihre drei Töchter sind fast erwachsen, und ihr Hotelschiff entwickelt sich zum Geheimtipp. Die Liebe ist nach dem Tod ihres Mannes kein Thema mehr. Doch dann lernt sie den deutlich jüngeren Maler Antonius kennen und beginnt eine heimliche Affäre mit ihm – bis ihre Töchter die beiden im Bett erwischen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 497
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Tania Krätschmar
Die Wellentänzerin
Roman
Knaur e-books
… Und die Passagiere, bunt gemengt,
am Bugspriet stehn sie zusammengedrängt,
am Bugspriet vorn ist noch Luft und Licht,
am Steuer aber lagert sich’s dicht,
und ein Jammern wird laut: »Wo sind wir? wo?«
Und noch fünfzehn Minuten bis Buffalo …
THEODOR FONTANE
Für Menschen, die lieben, ist sogar das Wasser süß.
CHINESISCHES SPRICHWORT
1. Kapitel
Antonius sah Rosa. Und es gefiel ihm nicht. Überhaupt nicht.
Flüchtig überlegte er, ob er einfach Gas geben sollte. Nein, entschied er dann. Er hatte an diese Stelle an der Alten Oder gewollt, also würde er auch hierbleiben. Außerdem lohnte es sich nicht mehr, woanders hinzufahren. Er war später losgekommen als geplant, und nun war es bereits Nachmittag. Wenn er das helle Licht nutzen wollte, konnte er es sich nicht leisten, jetzt noch weiterzufahren.
Er parkte den klapprigen Golf am Randstreifen, griff sich alles, was er brauchte, und stieg aus. Die Mühe, den Wagen abzuschließen, machte er sich nicht. Selbst wenn er ein paar Meter weiterging, um einen ungestörten Blick auf den Fluss und den Oderberger See zu haben, würde er jeden sehen, der sich dem Auto näherte. Außerdem war jemand, der diese Karre klaute, selbst schuld.
Während er den mit Unkraut überwucherten Uferweg entlangschlenderte, fuhren einige Boote an ihm vorbei: ein Segelschiff mit gelegtem Mast, zwei Kajakfahrer und das blau-weiße Boot der Wasserschutzpolizei.
Anfang Juli war er zum letzten Mal hier gewesen. Aber damals hatte nicht dieses auffällige Schiff vor Anker gelegen. Dieses Teil, das wie ein riesiges Erdbeereis auf den Wellen dümpelte. Knalliges Rosarot vor vergissmeinnichtblauem Sommerhimmel.
Er stellte den Klapphocker und die Staffelei im Schatten einer Trauerweide auf und plazierte die Leinwand darauf. Während er Farben, Palette und Pinsel auspackte und neben sich ins Gras legte, sah er sich das Schiff genauer an.
Es war nicht so lang wie die Frachtlastkähne, die sonst die Alte Oder befuhren, vielleicht fünfunddreißig, maximal vierzig Meter lang. Dafür zog sich ein ungewöhnlicher Aufbau aus Glas und Holz das Deck entlang, mit großen Fenstern, von denen einige nach oben hin geöffnet waren. Es gab der ansonsten plumpen, schmucklosen Form etwas Luftiges. Dem Schriftzug nach kam es aus Deutschland und nicht wie die meisten Schiffe aus Polen: »Drei Töchter«, las er auf dem klobigen Bug. Ein seltsamer Name.
Er setzte sich und griff nach einer Farbtube. Doch noch bevor er den Verschluss aufgeschraubt hatte, hörte er eine laute Stimme ungeduldig sagen: »Nun bring mir doch mal die Wäscheklammern hoch! Ich muss den Kram hier aufhängen! Siehst du das denn nicht?«
»Wie denn! Kann ich durch Metall schauen, oder was?«, rief eine zweite Stimme gedämpft, aber unüberhörbar hitzig zurück. Antonius ließ die Tube sinken und blickte in Richtung Schiff. Eine junge, blonde Frau war mit einem Berg nasser Wäsche auf dem Arm auf das Deck getreten. Sie hatte den Kopf gesenkt und schaute nach unten – wo gerade ein roter Haarschopf auftauchte. Eine zweite sehr junge Frau, fast noch ein Mädchen, kletterte die Schiffstreppe hoch. Sie hatte einen Beutel in der Hand und schwenkte ihn direkt vor der Nase der anderen hin und her. »Hier. Nimm.«
Die Blonde sah so wütend aus, als würde sie der Rothaarigen am liebsten eine runterhauen. Was genauso unmöglich war, wie nach dem Beutel zu greifen, denn dann wäre die Wäsche auf dem Boden gelandet. Stattdessen zischte sie: »Hilf mir jetzt auf der Stelle, Katharina. Wenn nicht, schmeiß ich deinen Laptop über Bord und dich gleich hinterher!«
Das schien die Rothaarige nun doch zu beunruhigen. Sie griff nach dem Wäschestück, das obenauf lag – ein türkisfarbener BH –, und klammerte ihn an der Wäscheleine fest, die zwischen Reling und Kapitänsbrücke festgemacht war.
»Krieg dich ein«, sagte sie halblaut und nahm das nächste Wäschestück. Diesmal war es ein knallroter BH, wie Antonius feststellte.
»Ich begreif nicht, warum du immer so transusig bist, wenn ich dich um was bitte«, ereiferte sich die Blonde wieder.
»Weil es dein Job ist, hier zu kochen und den Haushalt zu schmeißen, vielleicht?«, meinte die Rothaarige schnippisch. »Weil ich fürs Technische zuständig bin? Weil ich mir nichts aus diesem Hausfrauen-Kram mache?«
»Jetzt ist es aber gut! Es sind doch keine Passagiere an Bord! Ich glaube, du bist einfach nur stinkfaul!«
»Wenn du nicht aufhörst, mich hier anzuzicken, gehe ich auf der Stelle wieder runter, Franziska. Dann kannst du die blöde Wäsche allein aufhängen. Du nervst echt, weißt du das? Der Download müsste längst fertig sein. Frag doch nächstes Mal Emma. Immer willst du was von mir.«
»Emma!« Die Blonde schien von dieser Idee nicht besonders angetan zu sein. »Die klammert glatt ihr Buch an die Leine, damit sie beim Arbeiten weiterlesen kann!«
Darüber musste die Rothaarige lachen, und damit schien der Frieden zwischen ihnen halbwegs hergestellt. Rasch hängten sie den Rest auf und verschwanden wieder unter Deck. Die Wäschestücke – ausschließlich BHs und Slips in allen Regenbogenfarben – flatterten wie frivole Fähnchen im Wind. Es herrschte Stille, nur unterbrochen vom sanften Rauschen der Blätter in den Bäumen und dem gelegentlichen Schnattern einer Ente.
Antonius konzentrierte sich wieder auf die Tube, die er noch immer in der Hand hatte. Er drückte etwas Farbe heraus, legte sie weg, griff nach der nächsten. Kobaltgrün. Buntingblau. Und etwas Masalabraun.
Auf der Palette mischte er die Farben, bis das Ergebnis dem entsprach, was er sich vorgestellt hatte. Vom jahrelangen Gebrauch war sie von so vielen Farbschichten bedeckt, dass man das dünne Holz, aus dem sie bestand, längst nicht mehr sah.
Es gab Maler, die ihre Paletten nach jedem Gebrauch sorgfältig reinigten. Antonius gehörte nicht dazu. Er mochte diese Überlagerungen von Blau-, Grün-, Grau- und Brauntönen, diesen Mix aus seinen Herzfarben. Andere Farben wie Rot und Gelb waren dagegen kaum unter den Ölschichten zu entdecken. Er verwendete sie bestenfalls in homöopathischen Dosierungen.
Und Rosa? Niemals.
Wie aufs Stichwort erschien plötzlich ein drittes Mädchen an Deck. Es hatte sehr langes, dunkelbraunes, leicht welliges Haar, war aber bei weitem nicht so zierlich wie die anderen beiden. Die Brünette trug einen Minirock, der ihre stämmigen Beine zeigte, und ein weißes Flatterhemd. Langsam ging sie zu einem Liegestuhl auf dem hinteren Deck und ließ sich hineinplumpsen. Sie streckte die gebräunten Beine aus, zauberte von irgendwoher ein Buch hervor und schlug es auf.
Antonius beobachtete sie noch einen Moment, aber sie rührte sich nicht mehr. Entschlossen wandte er den Blick von der Lesenden und dem rosa Schiff ab und fuhr mit dem Pinsel über die weiße Leinwand, locker, kraftvoll und vorsichtig zugleich. Dann sah er kritisch auf den breiten Strich, der nun die helle Fläche teilte. Eigentlich bedeutete er nichts, konnte hundertmal und mehr verändert werden. Aber aus Erfahrung wusste Antonius, dass manchmal der erste Ansatz über das Schicksal eines Bildes entschied. Ob es letztendlich so werden würde, wie er es sich vorstellte, oder ob er so unzufrieden damit war, dass er es schließlich wieder übermalte. Er wusste selbst nicht, woher dieses Wissen kam.
Einmal hatte er sich mit seinem Vater darüber unterhalten. Der wusste immer vom ersten Pinselstrich an, wie sein Bild zum Schluss aussehen sollte. Aber der malte ja auch völlig anders als er. Dekorativ, mit einem immer wiederkehrenden Motiv: Schafe. Antonius dagegen versuchte auszudrücken, was unter der Oberfläche dessen lag, was er mit dem Pinsel darstellte. Es war ein Relikt aus Uni-Zeiten und wurde in der hochgestochenen Sprache der Kunstanalytiker und -kenner gern »Assoziationsraum« genannt.
Aber im Grunde war es bei den Bildern wie mit Menschen: Manchmal entschieden die ersten Sekunden, ob man sich sympathisch war. Ob es was werden würde, eine Freundschaft, eine Liebe. Es gab Menschen, die oberflächlich und bestenfalls dekorativ waren, und andere, bei denen es sich lohnte, zu verweilen und sie tiefer zu ergründen, und so war es bei seinen Bildern auch. Was dieses Bild hier anging, war der Beginn vielversprechend. Also malte er weiter.
Der Fluss strömte träge dahin, schlängelte sich zwischen Schilfrändern hindurch, verschwand unter einer Metallbrücke und tauchte auf der anderen Seite wieder auf. Wellen schwappten ans Ufer, wenn ein beladener Frachter – Steinkohle, Sand, Kies, Metall –, von Stettin aus kommend, Richtung Berlin vorbeiglitt.
Es war ein schwüler Sommertag. Die Mücken witterten Blut und umschwirrten ihn. Geistesabwesend schlug Antonius eine tot, die sich hoffnungsvoll auf seinem Unterarm niedergelassen hatte, dann eine zweite, die gerade versuchte, ihn am nackten Schienbein zu stechen. Er wischte sich den Schweiß aus dem Nacken. Wie meistens hatte er sein Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden. Trotzdem war die Haut darunter feucht, bekam kaum einen Lufthauch ab.
Versunken in die Arbeit, war er in Gedanken beim Wasser. Was es für ihn bedeutete. Sein Thema. Sein Leitmotiv. Seine Sehnsucht. Seine Vergangenheit. Sein Verlust.
Eigentlich hätte er genauso gut im Atelier sitzen können. Es war ja schließlich nicht so, als ob er nicht wüsste, wie Wasser aussah. Theoretisch würden Fotos genügen, Aufnahmen, die den Charakter des jeweiligen Gewässers wiedergaben.
Aber das war für ihn nicht das Richtige, hatte Antonius herausgefunden. Er brauchte zum Malen die unmittelbare Nähe von Wasser. Der Blick auf ein manchmal stilles, manchmal bewegtes Gewässer. Die wechselnden Gerüche – brackig, schlammig, fischig, salzig. Er fühlte sich unruhig, wenn er nicht in der Nähe von Wasser war. Dann fehlte ihm etwas. Richtig gut ging es ihm nur, wenn er an einem Teich, einem Fluss, einem See oder am Meer malte. Andere Maler hatten menschliche Musen, er hatte das Wasser …
Eine Bewegung auf dem Schiff erregte erneut seine Aufmerksamkeit. Er schaute über die Leinwand hinweg in Richtung der »Drei Töchter«. Wieder die beiden von eben? Oder hatte sich die Brünette geregt?
Nein. Diesmal sah er an Deck eine ältere Frau. Sie hatte kurzes, präzise geschnittenes Haar, das früher sicher blond gewesen, jetzt aber mit viel Grau durchzogen war. Der Wind drückte ihr blaues Kleid gegen ihren schlanken, fast mageren Körper. Langsam ging sie die Reling entlang, blieb stehen und lehnte sich dagegen. In der Hand hielt sie etwas Kleines, Dunkles. Sie legte den Kopf schief, während sie konzentriert darauf blickte. Er konnte nicht erkennen, was es war. Ein Taschenbuch vielleicht. Oder ein Fotoapparat?
Ein leises Piepsgeräusch ertönte, das Antonius nur hörte, weil es so still war. Und dann geschah es: Obwohl das Schiff vollkommen ruhig lag, strauchelte die Frau. Sie schwankte, und einen Moment lang sah es so aus, als ob sie stürzen würde. In letzter Sekunde konnte sie sich mit beiden Händen an der Reling festhalten. Was nur möglich war, weil sie das, was sie festgehalten hatte, losließ.
Es fiel aufs Deck, wurde von dem Schwung wieder hochgeschleudert, prallte an einer Strebe der Reling ab und segelte dann im hohen Bogen ins Wasser. »Oh nein! Nicht!«, rief die alte Dame bestürzt und blickte dem kleinen Gegenstand hinterher. Einen kurzen Moment schwamm er auf dem Wasser, dann sank er und hinterließ nichts als konzentrische Ringe, die sich rasch ausbreiteten.
Antonius dachte nicht lange nach. Noch bevor die alte Dame oder das junge Mädchen, das ihr zur Seite geeilt war, etwas unternehmen konnten, war er schon aus den ausgetretenen Turnschuhen geschlüpft und hatte sich das T-Shirt über den Kopf gerissen. Ohne zu zögern, watete er ins Wasser, und als es endlich tief genug war, hechtete er hinein und tauchte dem kleinen Gerät hinterher. Mit kräftigen Zügen schwamm Antonius die wenigen Meter, geleitet von der Dunkelheit des Schiffsrumpfs, bis er endlich die Stelle erreichte, wo etwas Kleines, von der sanften Strömung wie ein Blatt im Wind bewegt, dem Grund der Alten Oder entgegensank. Er tauchte hinterher, bekam es zu fassen, machte dann zwei entschlossene Bewegungen mit Armen und Beinen und durchbrach, tief Atem holend, die Wasseroberfläche, die Hand mit dem Gegenstand nach oben gereckt.
Als er zu der Frau schaute, fürchtete er, dass er gleich wieder tauchen musste, diesmal, um sie zu retten. Sie hatte sich gefährlich weit über die Reling gebeugt, und so wacklig, wie sie auf den Beinen war, fürchtete er, sie würde im nächsten Moment ins Wasser stürzen. Doch seine Sorge war unbegründet: Die stämmige Brünette hakte sie unter, während die Ältere ihm zuwinkte und erleichtert rief: »Sie haben es! Das ist ja wunderbar! Sie sind ja sehr fix, junger Mann! Hoffentlich funktioniert es noch! Warten Sie, ich komme runter.«
»Ist schon gut, ich bring es Ihnen«, antwortete Antonius. Das fehlte noch, dass diese Frau irgendwelche steilen Leitern hoch- und wieder herunterkletterte!
Gegen den Wasserwiderstand und die leichte Strömung strebte er dem Ufer entgegen, wobei er das Teil in seiner Hand anschaute. Was war das bloß? Irgendwo hatte er so etwas schon mal gesehen, aber ihm fiel beim besten Willen nicht ein, wo.
Triefendnass, wie er war, ging er um das Schiff herum, bis er zu der Gangway kam, die es mit dem Land verband. Auf dem warmen Holz hinterließen seine nassen Füße unregelmäßige Abdrücke. Auf dem Schiff warteten bereits die beiden Frauen auf ihn. Er streckte der Älteren das Gerät entgegen. Sie nahm es, trocknete es notdürftig an ihrem Kleid ab und lächelte ihn an. Trotz ihres einfachen Sommerkleides und den schlichten Sandalen hatte sie etwas Damenhaftes, vielleicht weil sie so grazil war. »Vielen Dank! Das war wirklich nett von Ihnen. Das ist mein Blutzuckermessgerät. Ohne bin ich aufgeschmissen, wissen Sie. Und die Apotheken haben ja heute alle zu. Ich hätte auf die Schnelle kein Neues herbekommen.«
»Ah so«, sagte Antonius. Jetzt erinnerte er sich, dass er so ein Gerät schon mal in einer der Apothekenzeitungen gesehen hatte, die sein Vater gelegentlich anschleppte. »Auf jeden Fall gern geschehen.« Er wandte sich zum Gehen.
»Moment mal! Sie können doch nicht einfach so verschwinden! Haben Sie denn überhaupt trockene Sachen dabei?«
Antonius drehte sich um und zuckte mit den Achseln. Nein, hatte er nicht. »Ist doch egal. Bei der Hitze trocknet die Hose in null Komma nix.«
»Nein, nein«, meinte die Frau energisch. »Den Mädchen sag ich auch immer: ›Zieht euch nach dem Baden immer um.‹ Stimmt’s, Emma?«
Emma neben ihr nickte stumm.
»Und das gilt für junge Männer schließlich auch. Da fühle ich mich verantwortlich.«
»Das muss wirklich nicht sein.« Antonius mochte es nicht, bemuttert zu werden. Auch wenn es sicher nett gemeint war. Er wollte sich weder mit der Älteren noch mit dem Mädchen unterhalten, das ihn anstarrte und noch kein Wort gesagt hatte. Er wollte zurück zu seinem ruhigen Platz unter der Trauerweide.
»Doch, muss es. Schließlich ist es meine Schuld, dass Sie hier so vor sich hin triefen. Franziska!«, rief sie die Treppe hinunter, die ins Schiffsinnere führte.
»Ja? Was denn?«, schallte es fragend zurück.
»Bring mal schnell ein Handtuch hoch.«
Einen Augenblick später kam die Blonde, die er beim Wäscheaufhängen beobachtet hatte, mit einem hellblauen Handtuch an Deck. Er schätzte sie auf ungefähr zwanzig, vielleicht zweiundzwanzig, ein paar Jahre älter als die andere Tochter Emma. Sie war sehr zierlich, hatte ihre langen blonden Haare zu einem losen Zopf geflochten, trug abgeschnittene Jeans und ein rotes Bikinioberteil. »Wofür brauchst du das denn, Groma … oh. Hallo. Was ist denn los?«, fragte sie, als sie Antonius bemerkte.
»Mir ist mein Messgerät ins Wasser gefallen. Er ist danach getaucht.« Die alte Dame deutete freundlich auf ihn.
»Das ist aber nett.« Die Blonde lächelte ihn an und reichte ihm das Handtuch. Er faltete es auseinander. Das Logo »Drei Töchter« fiel ihm ins Auge. Flüchtig trocknete er sich das Gesicht ab, strich sich übers Haar, fuhr sich dann über den Oberkörper, die Arme und Beine.
»Jetzt gehe ich aber wirklich«, sagte er zu der Älteren und hielt ihr das Handtuch hin, das sie ihm jedoch nicht abnahm. Stattdessen hatte sie die Arme verschränkt und betrachtete ihn prüfend. Offensichtlich war sie nicht zufrieden mit dem, was sie sah. Die interessierten Blicke Franziskas versuchte er ebenso zu ignorieren wie die Emmas, die genauso gut ein Standbild hätte sein können. Ein hübsches, etwas pummeliges Standbild.
»Ich hab unten noch Ersatzjeans von Mark«, meinte Franziska zu ihrer Großmutter. »Er hat sie letztes Mal hier vergessen. Sie könnten passen. Ich heiße Franziska.« Den letzten Satz sagte sie zu Antonius.
»Ich denke wirklich, es ist das Beste, wenn Sie sich umziehen«, antwortete ihre Großmutter. »Charlotte Hagedorn.« Sie hielt ihm die Hand hin.
»Antonius Merano«, antwortete er, ergriff flüchtig die Hand und nickte allen dreien zu. »Und ich würde jetzt wirklich lieber gehen. Meine Staffelei wartet.« Er zeigte mit dem Daumen hinter sich. Und begriff zu spät, dass er genau das Falsche gesagt hatte.
»In nassen Hosen malen? Das geht doch nicht«, sagte Charlotte Hagedorn kopfschüttelnd. »Bring ihn nach unten, Franziska. Und dann, Antonius, lassen wir Sie gehen. Vorher leider nicht.« Ihr Lächeln nahm ihren bestimmten Worten die Schärfe.
Antonius resignierte. Mit einem Schulterzucken folgte er Franziska. Sie stiegen die Treppe in den Schiffsrumpf hinunter, die in einem weitläufigen Raum endete, der wohl als Wohn- und Esszimmer diente.
Sie gingen den verglasten Gang entlang, den er vorhin von oben gesehen hatte. »Hier sind unsere Kabinen. Und die der Gäste«, sagte Franziska, obwohl er sie nicht danach gefragt hatte. In diesem Moment wurde am Ende des Gangs eine Tür aufgerissen: Das rothaarige Mädchen – Katharina? – von vorhin erschien. Die Sonne fiel auf ihr lila Sommerkleidchen, das einen dramatischen Gegensatz zu ihrem Haar bildete. »Was ist denn oben los gewesen? Alles okay mit Groma?«, wollte sie wissen. Ihr Blick blieb an Antonius hängen. Sie hob die blassen Augenbrauen. »Was will der denn hier, Franziska?«
»Das ist Antonius. Er hat Gromas Messgerät aus dem Wasser gefischt«, erklärte Franziska kurz. Das schien der anderen an Erklärung zu reichen. Sie verschwand wieder und knallte die Tür hinter sich zu.
Franziska blieb vor einem Wandschrank stehen und öffnete ihn. Hellblaue Handtücher und Bettwäsche lagen ordentlich gestapelt darin. Sie bückte sich, zog aus dem untersten Fach abgetragene Jeans und drückte sie Antonius in die Hand.
»Hier kannst du dich umziehen«, sagte sie und machte eine Kajüte auf. Sie war höchstens drei mal vier Meter groß, hatte einen Holzfußboden in warmem, dunklem Braun und Wände, die im hellsten aller Hellblaus gestrichen waren. Der Raum hatte ein überdimensionales, in Messing gefasstes Bullauge, durch das die Nachmittagssonne hineinfiel. Davor standen zwei schilfgrüne Korbstühle.
Antonius war noch nie auf einem vergleichbaren Schiff gewesen, geschweige denn in einer Kajüte. Aber hätte man ihn gefragt – so hätte er es sich nicht vorgestellt. Es war … edel. Geschmackvoll. Sinnlich.
Er ließ den Blick über das breite Bett schweifen, das mit der Stirnseite zur Wand stand. Es war nicht gemacht, die Decke nachlässig zurückgeschlagen, als ob es jemand gerade erst noch schlaftrunken verlassen hatte und mit nackten Füßen über den warmen Holzboden getappt war. Die Bezüge der Decke und der gemütlichen Kissen waren grün-blau und sahen wie gebatikt aus. Ein blumig-zarter Duft hing in der Luft. Keine Frage: Dies war die Kajüte einer Frau.
Antonius trat über die Holzschwelle. Hinter ihm zog Franziska die Tür ins Schloss. Er war allein.
2. Kapitel
Das Abendbrot war vorbereitet, aber es war noch nicht mal sechs. Zu früh, um zu essen, fand Dana, als sie zu ihrer Kabine ging. Sie hörte Gemurmel, die Stimmen ihrer Mutter und ihrer Töchter, die durch die geöffneten Flurfenster nach unten drangen. Bei dem traumhaften Wetter waren sie natürlich alle an Deck. Hier unten war es dagegen ein bisschen stickig.
Dana strich sich das glatte, halblange Haar aus dem Gesicht und beschloss, Badesachen anzuziehen und auch nach oben zu gehen. Da war es sicher kühler. Sie würde noch eine Runde schwimmen, vielleicht kämen die Mädchen ja mit …
Sie stieß die Tür zu ihrer Kabine auf – und blieb wie angewurzelt stehen. Das Erste, was sie sah, waren schmale Hüften und ein nackter Po. Ein wunderschöner Po. Ein männlicher Po. Die beiden sanft gerundeten, aber muskulösen Backen verrieten, dass der Gluteus maximus gut trainiert war. Er war deutlich blasser als der gebräunte, schlanke Rücken darüber und die langen Beine darunter. Keine Frage: Ihr bot sich das, was ihre Töchter anerkennend als Knackarsch bezeichneten. Eine Augenweide. Es war sehr lange her, dass sie so einen Hintern zu Gesicht bekommen, geschweige denn, das Spiel der Muskeln unter ihren Fingern gefühlt hatte … Irgendwann in einem anderen Leben musste das gewesen sein.
Blieb nur die Frage: Wem gehörte dieser ansprechende Hintern?
»Wer sind Sie?«, fragte sie scharf. Sie hatte keine Angst, aber es war dennoch eine durchaus berechtigte Frage. Schließlich befand er, ein Wildfremder, sich in ihrer Kabine auf ihrem Hotelschiff, das sie nur mit ihren drei Töchtern und ihrer Mutter teilte. Jedenfalls so lange, bis sie in Berlin die nächsten Passagiere an Bord nehmen würden, mit denen sie dann über Havel, Müritz und die Elde hoch bis nach Schwerin schippern würde.
Bis jetzt hatte kein Mann diese Kabine betreten, mal abgesehen von den Handwerkern, die sie umgebaut hatten. Und die waren, im Gegensatz zu diesem hier, immer angezogen gewesen. Und zwar vollständig.
Der Fremde drehte sich langsam zu ihr um. Zu seinen Füßen lagen eine nasse Hose und ein feuchtes Frotteetuch. Ein bordeigenes, wie Dana an dem Logo erkannte. In der Hand hielt er verwaschene Jeans. Offensichtlich hatte er sie gerade anziehen wollen. Jetzt bedeckte er damit seine Blöße, aber er schien nicht im Geringsten peinlich berührt zu sein. Er schien jedenfalls keine falsche Scham zu kennen. »Oh. Hallo«, sagte er und ließ die Hose sinken, um hineinzuschlüpfen.
Rasch wandte Dana den Kopf ab und schaute erst wieder hin, als sie hörte, wie ein Reißverschluss zugezogen wurde. Mit den Jeans, dem nackten Oberkörper und der kaum behaarten, aber muskulösen Brust erinnerte der Fremde vage an eine Werbung für verschiedene Lifes-Styleprodukte, deren Zielgruppe Frauen um die zwanzig, dreißig waren. Also nicht direkt ihre Altersgruppe.
Der Mann hatte offensichtlich beobachtet, dass sie den Kopf abgewandt hatte, denn jetzt lächelte er sie an, irgendwo zwischen jungenhaft verlegen und männlich amüsiert. »Ich heiße Antonius Merano. Frau Hagedorn wollte unbedingt, dass ich mich umziehe. Ich nicht, aber ganz ehrlich, ich hatte keine Chance. Keine Sorge, ich verschwinde gleich wieder.« Er bückte sich und hob die nassen Shorts auf. Aus ihnen tropfte es auf den Holzboden. »Sorry. Haben Sie einen Lappen? Dann wische ich das auf.«
»Das ist schon okay«, sagte Dana automatisch, unfähig, den Blick von dem Fremden zu lösen. Sein dunkles Haar war schulterlang, lockig und sehr nass. Er hatte es zu einem Pferdeschwanz gebunden, aber einige Strähnen hatten sich daraus befreit. Wassertropfen rannen seinen nackten Oberkörper herunter. Er sah aus, als sei er gerade der Alten Oder entstiegen, ein mysteriöser Fremder in geheimer Mission, mit der er von Neptun persönlich betraut worden war und von der sie nicht die leiseste Ahnung hatte.
»Aber warum hat meine Mutter Sie in meine Kabine gelassen? Und warum sind Sie so nass?« Irritiert blickte Dana jetzt in olivfarbene Augen, die von dichten, dunklen Wimpern umkränzt waren. Der Mann sah gut aus. Er erinnerte sie an diesen jungen Stargeiger, für den viele Frauen schwärmten, dessen langes Haar sich im Laufe seines temperamentvollen Spiels aus der Spange löste und dramatisch um sein schönes Gesicht wehte.
Aber dieser Mann hier hatte zugleich eine rauhe Ausstrahlung, die das Gefällige seines Gesichts minderte: Seine Züge waren scharf geschnitten, das schmale Gesicht wurde von hohen Wangenknochen und einer sehr ausgeprägten Nase dominiert. Die Lippen waren von einem dunklen Rot und die Unterlippe etwas voller als die Oberlippe. Seine linke Augenbraue war durch eine zarte Narbe zweigeteilt. Er trug einen Drei-Tage-Bart, wahrscheinlich nicht aus modischem Kalkül, sondern weil er keine Lust hatte, sich öfter zu rasieren. An seinen schlanken Fingern schimmerten zwei breite silberne Ringe, aber trotz allem wirkte er wie jemand, der sich nicht übermäßig viel um sein Aussehen kümmerte.
Dana fragte sich, wie alt er wohl sein mochte. Sechsundzwanzig, schätzte sie. Vielleicht drei, vier Jahre älter als Franziska. Jedenfalls jung. Direkt ein bisschen zu jung, um ihren abschätzenden Blick so dermaßen kühn zu erwidern. Wäre er Franziskas Freund gewesen, hätte sie sich als Mutter ernsthaft Gedanken gemacht.
»Nein, in diese Kabine hat mich nicht Frau Hagedorn gelassen«, verbesserte er sie. »Das war Franziska. Ich wusste nicht, dass es Ihre ist.«
Irgendwas ist mir hier entgangen, entschied Dana. Dafür, dass sie ihn noch nie vorher gesehen hatte, schien er mit ihrer Familie recht vertraut zu sein. In diesem Moment wurde die Tür aufgerissen, und Katharina erschien. »Ist der Typ noch hier …? Ach ja. Da ist er ja. Groma sagt, er soll mit uns essen.«
Jetzt kam Franziska herein. »Katharina, du bist unhöflich. Groma lässt fragen, ob du mit uns essen möchtest, Antonius. Als Dank für deinen Einsatz möchte sie dich einladen.«
Jetzt drängelte sich auch noch Emma in die Kabine. »Was gibt es denn zu essen, Mama?«, fragte sie, ohne Antonius anzuschauen, der neben Dana stand.
Die Kabine wirkte auf einmal beengend klein. »Nun geht doch mal raus«, sagte Dana energisch. »Das können wir doch alles oben besprechen.« Ihre Töchter verließen den Raum, und Antonius folgte ihnen. Dana blieb unentschlossen zurück und starrte auf die kleine Wasserlache auf dem Holzboden. Plötzlich war ihr der Gedanke, sich jetzt umzuziehen, unangenehm, ohne dass sie hätte sagen können, warum. Also blieb sie, wie sie war, in ihrem beigefarbenen Jeanshemd und ihrer blauen Leinenhose, und ging den anderen langsam hinterher.
An Deck standen ihre Töchter in ungewöhnlicher Eintracht zusammen und tuschelten. Etwas abseits davon entdeckte Dana ihre Mutter, die zum Ufer schaute. Von Antonius keine Spur. Sie ging zu Charlotte. »Was war denn eben hier los?«, fragte sie.
»Er hat es gerettet«, antwortete ihre Mutter. »Und es funktioniert sogar noch.« Sie hielt ihr Blutzuckermessgerät hoch und erzählte, was geschehen war.
»Warum ist es dir denn überhaupt ins Wasser gefallen?«, wollte Dana wissen.
Charlotte zuckte mit den Schultern. »Ich bin gestolpert.«
Dana sah sie aufmerksam an. Ihre Mutter sah müde aus, fand sie. »Mit deinem Diabetes ist doch alles in Ordnung, Mutti?«
»Jaja. Natürlich. Und, wie findest du diesen jungen Mann?« Sie machte eine Kopfbewegung zum Ufer hin. Jetzt erst entdeckte Dana ihn hinter einem Vorhang aus Weidenzweigen. Sie hatte gar nicht bemerkt, dass er das Schiff verlassen hatte, und so beobachteten sie nun beide, wie er sich ein T-Shirt überzog.
»Wie soll ich ihn denn schon finden?«, fragte Dana und dachte flüchtig an den nackten Po.
»Den Mädchen gefällt er«, sagte Charlotte. »Er malt«, fügte sie überflüssigerweise hinzu, denn Antonius hatte sich inzwischen hinter seine Staffelei gesetzt.
»Schön für ihn«, meinte Dana, mit den Gedanken bereits bei etwas ganz anderem. Wenn sie nicht schwimmen ging, könnte sie genauso gut die Liste mit den Dingen fertigstellen, die sie für die nächste Tour nach Schwerin brauchen würde. Zwar stand das Konzept ihrer Touren fest und hatte sich in diesem Sommer wie auch in den vergangenen zwei Jahren bewährt. Aber bei jeder Reise gab es einige Besonderheiten, auf die sie achten musste. Gelegentlich machten die Passagiere bei den Buchungen im Vorfeld schon Vorschläge, auf die sie gern einging. Dafür standen die Binnenkreuzfahrten auf der »Drei Töchter« schließlich – für ein hohes Maß an Individualität. Auch diesmal war wieder jemand dabei gewesen, der bestimmte Vorstellungen hatte. Ein Rechtsanwalt.
»Na, nachher werden wir mehr über ihn erfahren«, unterbrach Charlotte ihre Überlegung.
»Wieso das denn?«
»Er isst mit uns zu Abend. Um sieben kommt er hoch. Und bis dahin ist sie sicher auch trocken.« Sie deutete hinter sich zu der Leine, wo neben bunten Seidendessous eine helle, nicht besonders saubere Bermudashorts träge in der Brise wehte.
»Ich finde ihn süß«, sagte Franziska und spähte in Richtung Trauerweide. »Ob er hier in der Gegend wohnt?«
»Keine Ahnung. So wie er aussieht, findet den sicher jede süß«, meinte Katharina. Emma sagte nichts. Sie kratzte nervös am Schorf einer alten Wunde an ihrem Zeigefinger und zuckte zusammen, als er abging und die Wunde erneut zu bluten anfing. Hastig steckte sie den Finger in den Mund und schmeckte den metallischen Geschmack von Blut.
»Glaubst du, er verdient mit dem Malen sein Geld?«, überlegte Franziska laut.
»Keine Ahnung. Nein, wahrscheinlich nicht. So was ist eher ein Hobby, oder?« Katharina fand das Interesse ihrer älteren Schwester an Antonius seltsam. »Wie läuft es eigentlich mit Mark?«
»Ach, der. Er hat mir vorhin gesimst. Will mich sehen, wenn ich wieder in Berlin bin.«
»Und, was hast du geantwortet?«
»Noch gar nichts.«
Katharina nickte, mäßig interessiert. Typisch Franziska. Ihre On- und Off-Beziehung mit Mark kapierte keiner in der Familie so richtig. Wenn er wollte, wollte sie nicht, und wenn sie wollte, wollte er nicht. Aber ohne einander ging es offensichtlich auch nicht.
»Ich zieh mich zum Abendessen um«, verkündete Emma und ging in Richtung Treppe.
»Seit wann ziehst du dich denn zum Essen um? Wir sind doch nicht auf dem Traumschiff beim Kapitänsdinner. Sieht doch gut aus, was du anhast«, rief Franziska ihr hinterher, erhielt aber keine Antwort. Katharina deutete grinsend zu Antonius beziehungsweise zu seinem Rücken. Seit er wieder malte, hatte er die Staffelei so herum gerückt, dass die »Drei Töchter« nicht mehr in seinem Blickfeld lag. »Ich schätze, du bist nicht die Einzige, die ihn süß findet.«
»Wohnst du in Oderberg?«, wollte Franziska wissen. Sie lächelte Antonius an und nahm einen Schluck von der Weißweinschorle, die sie allen eingeschenkt hatte. Nur Emma trank lieber Orangensaft.
»Nein. Wir wohnen auf einem Hof in der Schorfheide«, antwortete Antonius. »Gut dreißig Kilometer von hier entfernt.«
Die Frauen hatten den Tisch draußen gedeckt. Er hatte das Klappern des Geschirrs gehört, während er mit sehr mäßigem Erfolg versucht hatte, sich wieder auf sein Bild zu konzentrieren. Irgendwann hatte er es aufgegeben, seine Sachen im Wagen verstaut und war dann an Bord gekommen. Um seine Hose abzuholen. Und mit ihnen Abendbrot zu essen. Danach würde Frau Hagedorn ihn hoffentlich endgültig gehen lassen.
Inzwischen waren nur noch wenige Motorboote unterwegs. Antonius warf einen flüchtigen Blick auf den Oderberger See. Von der erhöhten Position war die Aussicht aufs Wasser ganz anders als vom Ufer aus. Noch schöner, wenn das überhaupt möglich war.
»Wir?«, fragte Franziska. Er wandte den Blick vom See ab und zu ihr hin, quer über den Tisch hinweg. Das Licht hatte nicht mehr das Strahlen des Tages, sondern kündete bereits den Dämmerhauch des Abends an. Franziska schien die Wortführerin der drei Mädchen zu sein. Sie gab sich am selbstbewusstesten, vielleicht war sie aber auch einfach nur am neugierigsten. Außerdem versuchte sie, subtil mit ihm zu flirten. Er fragte sich, ob die anderen es auch merkten.
»Mein Vater und ich. Aber ich bin auch oft in Berlin«, antwortete er.
»Wir auch«, sagte Emma und malte mit der Gabel auf der Tischplatte herum. »Da liegt die ›Drei Töchter‹, wenn sie nicht unterwegs ist. Außerdem haben wir da eine Wohnung. Wir gehen in Berlin in die Schule.«
»Du gehst in Berlin zur Schule«, sagte Katharina. »Ich bin nämlich fertig. Endlich.«
»Katharina hat gerade ihr Abi gemacht«, erklärte Charlotte. »Die Hagedorns leben schon seit Generationen in Berlin«, fügte sie dann hinzu. »Vor vier Jahren ist Dana mit den Mädchen zu mir in die Wohnung gezogen, in der mein Mann und ich unser ganzes Leben lang gewohnt haben und in der auch Dana und ihre Schwester aufgewachsen sind.«
»Wo denn in Berlin?«, fragte Antonius.
»In Moabit. Essener Straße.«
In diesem Moment erschien Dana mit einem großen Teller Tomaten und Mozzarella. Sie stellte ihn auf den Tisch, auf dem bereits ein anderer mit italienischer Mortadella und Parmaschinken und ein weiterer mit aufgeschnittener Melone standen, und setzte sich. »Guten Appetit. Bitte bedienen Sie sich, Antonius«, forderte Dana ihn auf, während Charlotte ihren Blutzucker maß und sich dann Insulin spritzte.
Antonius nahm von allem etwas und begann zu essen. Franziska neben ihm tat es ihm gleich. »Was ist das eigentlich für ein Passagierschiff?«, fragte er kauend. »So was habe ich auf der Alten Oder noch nie gesehen. Ich kenne wohl Ausflugsdampfer, aber das ist hier ist irgendwie anders.«
»Die ›Drei Töchter‹ ist ein Hotelschiff. Früher war es ein Frachter«, erklärte Dana.
Antonius hob fragend die Augenbrauen. »Und wie sind Sie dazu gekommen?«
»Mein Mann war Partikulier. So nennt man Frachtschiffer mit eigenen Schiffen. Zum Schluss hatte er sogar vier. Nach seinem Tod musste ich mich entscheiden, was ich tun wollte. Ich besaß ja bereits das Binnenschifffahrtspatent, aber ich hatte keine Lust, mich mit Ladungen herumzuärgern, mit Zoll und dem ganzen Handelskram. Dann schon lieber mit Passagieren.« Sie lachte, und er sah, dass die Zähne ihres Oberkiefers weiß und regelmäßig waren, im Unterkiefer dagegen ein Zahn aus der Reihe tanzte. »Aber ganz im Ernst: Wir haben viel Spaß mit ihnen. Obwohl es auch immer wieder nett ist, wenn sie von Bord gehen.«
»Und die ›Drei Töchter‹ ist eines der alten Frachtschiffe?«, fragte Antonius weiter. Dana hatte das Kinn in die Hand gestützt und sah ihn jetzt quer über den Tisch direkt an. Ihr Gesicht war ein ebenmäßiges Oval, ihre Haut von einem hellen, fast britischen Porzellanton, die Sorte, die sich in der Sonne rötet, aber niemals braun wird. Sie hatte eine gerade Nase, schmalrückig und elegant, das genaue Gegenteil von stupsig. Von den drei Mädchen kam am ehesten Franziska nach ihr. Aber nur, weil sie auch blond war. Antonius verstand zwar, woher Katharina ihren hellen Teint hatte. Ansonsten war der Genpool ausnehmend gut gemixt worden. Keine der drei ähnelte ihrer Mutter besonders.
Dass Dana dagegen die Tochter von Frau Hagedorn war, sah man auf den ersten Blick. Zwar war die ältere etwas hagerer, die jüngere etwas kurviger, aber sie waren gleich groß, knapp über eins siebzig, schätzte er. Beide Frauen waren nicht das, was man schön nennen würde, definitiv aber das, was man als apart bezeichnete. Unverwechselbar. Wiedererkennbar. Ein bisschen wie … Meryl Streep, einmal in einer jüngeren, einmal in einer älteren Variante. Wäre er ein Porträtmaler gewesen, hätte er alles dafür gegeben, eine von ihnen zu malen. Am meisten ähnelten sich ihre Augen. Sie standen relativ weit auseinander, was ihren Blicken etwas Weitwinkliges gab. Auch ihre Augenfarbe war identisch, ein dunkles Blau, von dem Antonius nicht wusste, wie er es benennen sollte. Aus irgendwelchen Gründen betonte das Beige von Danas hellem Hemd und der Fall ihres dunkelblonden Haars genau dieses ungewöhnliche Blau. Vielleicht, weil sich direkt an der Schläfe eine Locke in Richtung Augenbrauen ringelte, wie eine widerspenstige Gegenbewegung zu ihren wiederholten Versuchen, das Haar hinter die Ohren zu verbannen. Es war eine auffällige Geste, die sie gerade in diesem Moment wiederholte. Chambray, dachte Antonius. So hieß sie, die Augenfarbe der Kapitänin. Er war sich ziemlich sicher, dass er irgendwo eine Tube davon hatte. Er musste direkt mal danach suchen.
»Ja, ich habe es umbauen lassen. Nach eigenen Vorgaben. Wenn ich nicht so früh geheiratet und Kinder bekommen hätte, hätte ich Innenarchitektur studiert. So war es eine späte Selbstverwirklichung, und es hat mir großen Spaß gemacht. Die Kabinen habe ich auch eingerichtet. Mir waren die Farben und die Materialien wichtig, Holz, Glas, viel Blau und Grün.« Emma reichte ihrer Mutter den Tomaten-Mozzarella-Teller. Sie nahm sich und gab ihn dann an Charlotte weiter.
»Dieser Glasgang war Ihre Idee?«, frage Antonius.
»Ja. Dadurch konnten wir die ganze Länge des Schiffs für Kabinen nutzen. Irgendwie muss es sich ja rechnen.«
Antonius blickte in die Runde. »Sie sind doch schon zu fünft. Wie viele Kabinen hat das Boot denn?«
Dana machte eine abwehrende Handbewegung. »Oh nein, wir sind im Moment nur alle unterwegs, weil wir ein bisschen Urlaub gemacht haben. Während der Schulzeit sind meine Mutter, Emma und Katharina bis jetzt zu Hause geblieben. Bei den nächsten zwei Fahrten wird Katharina noch dabei sein. Ab Herbst werde ich aber wohl einen Maat einstellen müssen. Zum Glück bleibt Franziska auf der ›Drei Töchter‹. Sie ist Hotelfachfrau, das passt prima. Sie kümmert sich ums Hauswirtschaftliche, Katharina macht das Mädchen für alles und den Schiffsjungen. Dann haben wir noch sechs Gästekabinen.«
»Rechnet sich das?«, fragte Antonius.
»Kommt drauf an, wie viele Fahrten wir machen. Im Großen und Ganzen ja. Noch ein Tickchen mehr Buchungen wäre gut, dann wären wir aus dem Schneider. Aber ich denke, das entwickelt sich mit der Zeit. Wir sind ja erst zwei Jahre dabei. Und Sie, Antonius? Was machen Sie? Studieren Sie?«
Er schaute in die Runde und stellte fest, dass er die ungeteilte Aufmerksamkeit aller Frauen hatte. »Nein, damit bin ich seit vier Jahren fertig«, sagte er.
»Wirklich? Wie alt sind Sie denn?«
»Fast dreißig.«
Dana schien eine Bemerkung auf der Zunge zu liegen, die sie aber nicht aussprach. »Was haben Sie denn studiert?«, fragte sie stattdessen.
»Kunst auf Lehramt.« Er griff nach dem Glas und nahm einen großen Schluck Schorle. »Aber Unterrichten war nicht meins, habe ich im Referendariat bemerkt.«
»Und nun?«
»Nun schlage ich mich als freier Künstler durch.«
»Das stelle ich mir nicht leicht vor«, sagte Charlotte. »Vielleicht überlegen Sie es sich noch mal. Lehrer sind doch im Moment gesucht. In den Ferien hätten Sie ja genug Zeit für Ihr Hobby.«
»Nein, das überlege ich mir bestimmt nicht.« Antonius’ Miene war ausdruckslos. »Die Malerei ist für mich auch mehr als ein Hobby. Pädagogik dagegen – das war überhaupt nichts. Ab nächster Woche gibt es eine Sammelausstellung in Berlin, in der auch einige meiner Bilder zu sehen sein werden. Das sind die Momente, die Hoffnung machen. Wer weiß, vielleicht ist das ja mal der Durchbruch.«
Er lachte, wenn auch etwas freudlos. Er hatte keine Lust zu erzählen, dass es sich dabei um eine selbstorganisierte Ausstellung in den Räumen eines ehemals besetzten Hauses handelte und nicht etwa um eine Galerie von Rang und Namen.
Einen Moment lang herrschte Stille, dann fragte Emma: »Was malst du denn?«
»Wasser.«
»Wasser?«
»Ja. Gewässer aller Art. Meere, Flüsse, Seen. Teiche, Pfützen. Willst du mal sehen?«
Emma nickte. Antonius zog sein Handy aus der Hosentasche und schaltete in den Fotomodus. »Hier«, sagte er und reichte es ihr.
»Woran erkenne ich denn, ob es ein Meer oder eine Pfütze ist?«, wollte Emma wissen, während sie sich durch die Fotos klickte. »Und woran, dass es überhaupt Wasser ist? Es könnte genauso gut der Himmel oder die Erde sein.«
»Erkennen tust du es wahrscheinlich nicht. Jedenfalls nicht an Wellen oder Schaumkrönchen oder so. Ich male nicht gegenständlich. Ich versuche darzustellen, wie man sich beim Betrachten von Wasser fühlt. Wie ich mich beim Betrachten von Wasser fühle. Was es für mich bedeutet. Wo es mich hinbringt. Es ist ja das Element, mit dem alles anfing. Und mit dem es für manche von uns auch endet.«
Jetzt schauten auch Dana und Charlotte auf das kleine Display. »Für uns auch«, sagte Dana. »Bei uns dreht sich alles ums Wasser. Unsere ganze Existenz hängt davon ab.«
»Wie groß sind Ihre Bilder, Antonius?«, fragte Charlotte.
»Unterschiedlich. Aber weil ich am liebsten draußen male, nur so groß, dass sie auch ins Auto passen.«
Emma gab das Handy zurück, und er steckte es wieder ein. Dana griff nach einem Feuerzeug und machte die Windlichter an, die auf dem Tisch standen. Inzwischen war die Sonne hinter den Uferbäumen verschwunden, aber noch nicht untergegangen.
»Mama.«
»Was denn, Franziska?«
»Ich habe eine Idee.«
»Und die wäre?«
»Warum stellen wir denn unten im Gang nicht ein paar von Antonius’ Wasserbildern aus? Das würde doch supergut passen!« Sie war Feuer und Flamme.
Dana zögerte. »Du weißt doch gar nicht, ob Antonius das möchte«, sagte sie abwägend.
Jetzt sahen alle ihn an. Vier Augenpaare fragend, eins voller Zurückhaltung.
»Das Licht ist sehr schön«, sagte er vorsichtig. »Und natürlich wäre es für mich gute PR.«
»Ich weiß nicht so recht«, meinte Dana. »Das müssen wir uns noch mal gut überlegen, Franziska. So etwas muss vorbereitet werden, und dazu haben wir jetzt in der Hochsaison eigentlich keine Zeit. Dazu kommen ja auch wirtschaftliche Aspekte, versicherungstechnische. Und wenn die Leute dann etwas über die Bilder wissen wollen, müssten wir dazu auch etwas sagen können …« In ihrer Stimme lag etwas Warnendes. Du gehst da gerade ein bisschen weit, mein Schatz, bedeutete es.
»Ich kann ja mal meine Nummer dalassen«, sagte Antonius unverbindlich. »Soll ich Sie anrufen? Dann können Sie sie abspeichern.« Dana nickte. Er griff nach dem Handy und sah sie fragend an. »0172 …«, begann sie, und als ihre Mailbox ertönte, legte er auf.
Abrupt stand Katharina auf. »Ich bin fertig«, sagte sie. »Ich muss noch an einem Programm arbeiten.« Dana bemerkte Antonius’ fragende Blicke. »Katharina fängt im Herbst an, Informatik zu studieren. Sie denkt, lebt und atmet Computer«, erklärte sie und griff nach dem Tablett.
»Ah. Ein Job mit Einstellungsgarantie«, sagte er, stand auf und begann, die Teller zusammenzustellen. Die beiden anderen Mädchen griffen sich ihre leeren Gläser und gingen nach unten.
»Ich bleibe noch etwas sitzen«, verkündete Charlotte. »Es ist himmlisch hier. So ruhig haben wir es in Berlin bestimmt so schnell nicht mehr.« Sie goss sich ihr Weinglas zum zweiten Mal halb voll und lehnte sich gemütlich zurück.
»Lassen Sie, ich mach das schon«, sagte Dana, als Antonius das Tablett hochnahm.
»Kein Problem«, meinte er, und nacheinander stiegen sie die Treppe hinunter. »Hast du Lust, noch mal schwimmen zu gehen, Emma?«, hörten sie Franziskas Stimme. »Klar, ich zieh mich nur um«, antwortete Emma, als sie an ihnen vorbei aus der Küche in Richtung Kajüte entwischte.
Sie betraten die Kombüse. Das schwindende Abendlicht fiel durchs Fenster. Draußen färbte sich die Landschaft allmählich rot-orange, hier unten war es bereits schummrig. Antonius stellte das Tablett ab, und Dana bedankte sich.
»Ich muss jetzt aber mal endlich los«, sagte er. »Vielen Dank für die Essenseinladung.«
»Keine Ursache. Sie haben uns heute einen großen Gefallen getan«, antwortete sie. »Auf Wiedersehen, Antonius. Und viel Glück bei Ihrer Ausstellung!« Sie erwartete, dass er ging. Aber das tat er nicht. Er blieb vor ihr stehen und sah sie unverwandt an. Im schwachen Licht wirkten seine Züge schärfer, Licht und Schatten schufen Täler und Höhen, wo keine waren, der Abend wurde zum Zerrspiegel der Zeit. »Das Schiff heißt so, weil Sie drei Töchter haben?«, fragte er.
Dana lachte leise. »Das war nicht so schwer, oder? Burkard hat es so gewollt.«
»Ihr Mann.«
»Ja.«
Sie schwiegen, bis Dana unwillkürlich einen Schritt zurücktrat, denn sie meinte plötzlich, die Wärme seines Körpers zu spüren. Aber das musste sie sich eingebildet haben. Schließlich trennte sie mehr als ein Meter.
»Na dann. Tschüs.« Er drehte sich um und verschwand. Seine Turnschuhe machten kaum ein Geräusch auf der Treppe, als er nach oben ging, immer zwei Stufen auf einmal nehmend. Sie hörte, wie er sich von Charlotte verabschiedete. Einen Moment später beobachtete sie durchs Bullauge, wie er in seinen Wagen stieg und davonfuhr.
Dann begann sie, den Geschirrspüler einzuräumen.
Eine Stunde später wurde Katharinas Gesicht vom Schein des Monitors bläulich beleuchtet. Bei der Google Bildersuche hatte sie Antonius’ Namen eingegeben und war fündig geworden. Einige Fotos seiner Bilder waren ins Netz gestellt worden. Sie betrachtete sie genau. Vorhin, auf dem kleinen Display, hatte sie kaum was erkennen können. Hier schon.
Was sie sah, gefiel ihr nicht wirklich. Schon in der Schule hatte sie nicht gemocht, wenn ihre Lehrerin abstrakte Kunst in den Himmel hob und den gesamten Kurs zu Ausstellungen in den Hamburger Bahnhof abkommandierte. Sie hatte es lieber, wenn man erkannte, was da gemalt wurde. Dieser Gefühlskram, die Frage, was hinter den Bildern lag, war nichts für sie. Entweder man sah es, oder man sah es nicht. Basta. Letztere Sorte konnte ihr gestohlen bleiben.
Bloß schade, dass nicht mehr über Antonius im Netz stand. Sie war neugierig, was er für einer war. Und auch schade, dass es kein Foto von ihm gab. Sehr schade! Sie hätte es glatt in ihren Ordner »Eigene Bilder« kopiert und es sich von Zeit zu Zeit angeschaut. Sie war zwar nicht so emotional wie ihre beiden Schwestern, nicht so schwärmerisch veranlagt, nicht so gnadenlos subjektiv, aber dass Antonius ein heißer Typ war, war ja auch nicht subjektiv. Es war Fakt.
Eine Kabine weiter lag Franziska auf ihrem Bett und checkte ihr Handy. Schon wieder eine SMS von Mark!
»Wann kommst du? Want 2 c u«, schrieb er.
Franziska zögerte. Dann antwortete sie: »Übermorgen. Weiß noch nicht, ob ich Zeit habe. Nacht.«
Sie packte das Handy weg, legte sich auf den Rücken, verschränkte die Arme hinterm Kopf und starrte an die Decke. Sie kannte Mark schon seit ihrer Schulzeit, seit zwei Jahren waren sie zusammen. Manchmal liebte sie ihn wirklich, aber gelegentlich ging ihr seine Planerei auf die Nerven.
Er war immer so ultimativ verlässlich. Wenn er was sagte, dann tat er es auch. Eigentlich war das ja eine gute Eigenschaft. Aber im Moment hatte sie wirklich überhaupt keine Lust darauf! Ihre Gedanken wanderten zu Antonius, den sie geheimnisvoll fand, mit diesen langen dunklen Haaren und seinen Fingerringen. Leider hatte er ihre Flirtversuche vollkommen ignoriert, aber er war ja auch sechs Jahre älter als sie. Trotzdem – ein Künstler, wie cool! Antonius war eine ganz andere Nummer als Mark. Der arbeitete auf dem Flughafen Schönefeld in der Logistik-Abteilung.
Die jüngste der drei Schwestern, Emma, hatte in ihrer Kabine schon das Licht ausgemacht. Aber auch sie konnte nicht schlafen. Es war einfach zu heiß. Außerdem flitzten ihre Gedanken wie die Fledermäuse über der Alten Oder umher, machten immer dann scharf kehrt, wenn sie glaubte, sie greifen zu können. Sie knipste das Licht an und griff nach dem Buch, das sie vorhin angefangen hatte. Aber das war auch nicht das Richtige, und so schloss sie es wieder.
Nach ein paar weiteren unruhigen Minuten, in denen sie sich rastlos hin und her wälzte, stand sie schließlich auf und tappte zu dem Schreibtisch, der unter dem Bullauge stand. Sie schnappte sich ihr Tagebuch und einen Stift, ging zurück ins Bett, lehnte sich gegen die Wand und begann zu schreiben. Die Zeit verging, während sie versuchte, in ehrlichen Worten festzuhalten, was heute passiert war. Mit ihr passiert war. Beim Schreiben gelang es ihr, die Gedanken festzuhalten, und schon nach den ersten Sätzen fühlte sie sich besser. Sätze, die zum Glück kein anderer jemals lesen würde.
Während die drei Mädchen ihren eigenen Gedanken nachhingen, saß Charlotte noch immer an Deck und schaute auf die dunkle Wasseroberfläche. Sie trank genüsslich den letzten Schluck Wein, stellte das Glas wieder auf den Tisch und ging zur Treppe. Sie stieg vorsichtig die Stufen hinunter, sich am Geländer festhaltend. Wenn sie jetzt wieder so einen Schwindelanfall wie vorhin bekam, würde sie nichts mehr auf der Treppe halten können.
Sobald wir wieder in Berlin sind, muss ich dringend zum Arzt, dachte sie.
Als Dana die Kombüse verlassen hatte und ihre Kabine betrat, warf sie einen flüchtigen Blick auf den Holzfußboden. Er war trocken. Nicht der leiseste Fleck wies darauf hin, dass vor kurzem jemand an dieser Stelle gestanden und leise vor sich hin getropft hatte. Sie zog sich ihr Nachthemd an, schlug die Decke zurück und schlüpfte ins Bett. Dann drehte sie sich auf ihre Lieblingsschlafseite, dem Bullauge zu, seufzte einmal genüsslich und schlief ein.
3. Kapitel
Will wer ein Ei?«
Niemand antwortete, aber alle schüttelten die Köpfe. Also setzte sich Dana an den gedeckten Frühstückstisch.
Es war ein prachtvoller Morgen. Die Mücken surrten noch nicht umher, sondern versteckten sich in der Uferböschung. Über Nacht hatte sich die Luft abgekühlt und war nicht länger schwül, sondern hier, auf dem Wasser, herrlich frisch. Ihnen blieb noch ein ruhiger Sommertag, bevor sie morgen in aller Frühe in Richtung Berlin aufbrechen würden. Dann hatten sie noch genau eine Woche Zeit, um alles vorzubereiten, bevor die Passagiere für die nächste Kreuzfahrt an Bord kommen würden.
Die drei Mädchen trugen noch ihre Schlafshirts und wirkten alle vollkommen übermüdet. Unter Emmas Augen lagen dunkle Schatten, wozu sie immer neigte, wenn sie nicht genug schlief oder zu sehr im Stress war. Auf Katharinas heller Haut zeigten sich deutlich die Abdrücke des Kissens, auf ihrer weichen Wange sogar der eines Knopfes. Franziska sah abwesend aus und war offensichtlich mit ihren Gedanken ganz woanders.
Charlotte hingegen wirkte frisch und entspannt. Sie griff nach dem Kaffee, goss sich ein und verkündete gleichzeitig: »Ich habe mir etwas überlegt.«
»Was denn?«, fragte Franziska und nippte an ihrem Tee.
»Ich habe mir noch mal den Vorschlag durch den Kopf gehen lassen, den du gestern gemacht hast. Ich finde ihn sehr gut.«
»Welchen Vorschlag denn?«
»Dass wir an Bord Bilder ausstellen könnten.«
Dana stellte ihren Becher ab. »Warum das denn?«
»Weil das ungewöhnlich ist. Damit könntest du gut Werbung machen. Eine schwimmende Ausstellung – das würde die ›Drei Töchter‹ aus der Menge der anderen Anbieter hervorheben. Und Leute anziehen, die sich für Kunst auf einem Bootel interessieren.« Charlotte hatte die Angewohnheit, die Worte Boot und Hotel zusammenzuziehen, auch wenn Dana die »Drei Töchter« lieber als Hotelschiff bezeichnete.
»Eine Klientel, die bereit ist, für Kultur an Bord etwas mehr zu zahlen. Du könntest die Preise anheben. Katharina könnte es auf die Website stellen«, erklärte sie.
Dana beschlich ein ungutes Gefühl, während sie der Reihe nach ihre Töchter anschaute. Die Müdigkeit in ihren Gesichtern war wie weggeblasen. Charlottes Worte hatten sie offensichtlich munter gemacht.
»Der Gang scheint mir in der Tat perfekt dafür«, fuhr Charlotte fort. »Das Licht kommt von oben, die Bilder werden beleuchtet, ohne dass die Sonne direkt darauffällt. Jeder geht den Gang entlang, kann alles in Ruhe auf sich wirken lassen. Zwischen den Kabinen ist Holz, das würde den Bildern gleich den richtigen Rahmen geben. Es hätte so etwas … Stilvolles und Zeitgenössisches zugleich. Kunst an Bord, so etwas gibt es bis jetzt noch nicht.«
»Das mag ja alles so sein«, meinte Dana und griff nach einer Scheibe Brot mit dicken Sonnenblumenkernen. »Das Problem ist nur, dass wir alle von Kunst keine Ahnung haben. Nachher hängen wir etwas Kitschiges auf, und das würde uns mehr schaden als nützen.«
»Aber wir haben doch den perfekten Künstler an der Hand«, widersprach Charlotte. Bevor sie weitersprach, wusste Dana schon, was jetzt kommen würde. »Antonius. Er malt Wasserbilder, ich bitte dich! Besser kann es doch nicht passen!«
»Ich habe auf dem Handy kaum was sehen können. Vielleicht sind die Bilder ja schrecklich«, wandte Dana ein.
Katharina holte Luft, als ob sie etwas sagen wollte, schien es sich dann aber zu überlegen und schwieg.
»Ich finde die Idee klasse, Groma.« Franziskas Aufmerksamkeit war wieder voll im Hier und Jetzt. »Das Einzige, was wir machen müssen, ist, Antonius anzurufen. Warum schauen wir uns seine Bilder nicht einfach an und entscheiden dann, ob sie was für uns wären? Wir haben doch heute Zeit!«
»Ich bin auch dafür«, sagte Katharina und biss in die Schnitte, die sie dick mit Käse belegt und mit Marmeladentupfern verziert hatte. Sie hatte von den drei Schwestern den besten Appetit und gleichzeitig das Glück, dass nichts ansetzte. »Ich könnte gleich Fotos mit der Digicam machen und sie einstellen. Heute noch. Kein Problem.«
»Du hast doch seine Telefonnummer, oder, Mama? Musst du ja. Er hat dich extra angerufen«, fragte Emma. Die Schatten unter ihren Augen waren schlagartig verschwunden. Auf einmal strahlte sie wie der frische Morgen.
Warum habe ich das Gefühl, dass das bereits beschlossene Sache ist, fragte sich Dana, halb amüsiert, halb entnervt. Dass heute kein ganz entspannter Sommertag zu fünft wird? Dass es hier nicht nur um Bilder geht?
»Moment mal. Ihr könnt das nicht so einfach über meinen Kopf hinweg entscheiden«, sagte sie. »Warum bin ich überhaupt die Kapitänin, wenn ich sowieso nicht das Sagen habe? Selbst wenn es euch gefallen würde, wenn die Bilder hier hingen. Aber es hat schließlich auch was mit Wirtschaftlichkeit, mit dem Gesamtkonzept zu tun.«
»Aber eine Überlegung ist es doch wert, Mama. Hatten wir nicht neulich erst das Gespräch, wie wichtig es ist, in dem Hotelbereich mal was Neues auszuprobieren?«, warf Franziska ein.
Nun musste Dana allerdings nicken.
»Na siehst du. Nur deshalb wäre es eine Überlegung wert.«
»Wir können es doch mal versuchen. Vielleicht ist es ja eine Pleite, aber verlieren können wir nix«, fügte Katharina schnell hinzu.
Dana wurde das unbestimmte Gefühl nicht los, dass sie gerade manipuliert wurde. Auf der anderen Seite konnte sie nicht bestreiten, dass die vier ein paar gute Argumente hatten. Es stimmte, andere Anbieter schliefen nicht, und alles, was die ›Drei Töchter‹ aus der Masse der Kreuzfahrtschiffe heraushob, war gut fürs Geschäft. Sie unterdrückte einen Seufzer, als sie sagte: »Na gut. Wahrscheinlich habt ihr recht.«
»Meinst du, er würde uns abholen?«, fragte Emma weiter.
»Das muss er wohl, wenn er seine Bilder hier aufhängen will. Wir haben ja kein Auto an Bord«, sagte Katharina. »Komm, ruf ihn mal an, Mama.«
»Es ist noch nicht mal halb neun«, widersprach Dana energisch. »Jetzt will ich erst mal in Ruhe zu Ende frühstücken. Und wir wissen überhaupt nicht, ob Antonius heute Zeit hat. Hat er nicht gesagt, dass er oft in Berlin ist? Und selbst wenn wir uns die Bilder anschauen, heißt auch das noch lange nicht, dass wir demnächst eine schwimmende Ausstellung haben.« Trotzdem sahen alle plötzlich sehr zufrieden aus. Sogar Charlotte.
Eine halbe Stunde später setzte Dana den Plan ihrer Töchter in die Tat um und rief Antonius an. Er antwortete schon nach dem zweiten Klingeln.
»Ja?«, sagte er.
Dana erkannte seine Stimme sofort. Komisch, dass die Stimme, wenn wir erst mal erwachsen sind, so unveränderbar ist, dachte sie. Gesichter werden älter, Stimmen nicht. Sie lief mit dem Handy in der Hand das Deck entlang, weg von den Blicken und den gespitzten Ohren ihrer Töchter.
»Hallo Antonius. Ich bin’s, Dana van Aken. Von der ›Drei Töchter‹.«
»Oh, hallo Dana. Warum rufen Sie an? Habe ich was bei Ihnen vergessen?« Er klang überrascht.
Dana lachte. »Nein, nicht dass ich wüsste. Es geht um was anderes. Gestern beim Abendessen hat meine Tochter Franziska den Vorschlag gemacht, dass wir Bilder an Bord ausstellen könnten. Heute Morgen kam das Thema noch einmal auf. Die Möglichkeit, Ihre Wasserbilder im Glasgang aufzuhängen.«
»Oh!« Jetzt klang seine Stimme noch überraschter. »Das klingt interessant.«
»Ja, schon. Aber ehrlich gesagt, ist das für mich komplettes Neuland. Ich habe keine Ahnung, wie man so etwas organisiert. Ich habe auch keine Ahnung, was so etwas überhaupt kostet. Und zuallererst möchte ich mir Ihre Bilder ansehen. Von unserer Seite ist es zunächst mal nur eine Überlegung. Nicht mehr.« Jedenfalls nicht von meiner, fügte sie im Stillen hinzu.
»Natürlich.«
»Außerdem fahren wir morgen zurück nach Berlin. Wir könnten einen Termin ausmachen, vielleicht so in drei Wochen, wenn ich von der nächsten Fahrt wieder zurück bin? Wahrscheinlich haben Sie vorher sowieso keine Zeit, wegen Ihrer anderen Ausstellung.«
Am anderen Ende schwieg Antonius einen Moment. Dann sagte er: »Doch, ich habe Zeit. Für die Ausstellung ist bereits alles vorbereitet. Ich könnte sogar heute. Haben Sie Zeit?«
»Doch, heute ginge bei uns auch. Da gibt es aber noch ein Problem. Wenn wir mit der ›Drei Töchter‹ unterwegs sind, haben wir kein Auto dabei. In Berlin schon, aber hier nicht …«
»Auch kein Problem«, meinte Antonius. »Ich hole Sie ab. Passt es so in einer Stunde?«
»Das passt«, sagte Dana, und sie beendeten das Gespräch.
Er würde in ungefähr einer Stunde da sein – kaum hatte sie es ausgesprochen, verschwanden die Mädchen nach unten. Türen gingen auf und wurden hektisch wieder geschlossen. Franziskas empörte Rufe drangen nach oben, als sie Katharina beschuldigte, sie hätte sich unerlaubt ihr nagelneues, hellgelbes Top ausgeliehen, was Katharina nicht weniger empört damit rechtfertigte, dass Franziska ihre weißen Turnschuhe genommen hätte, ohne um Erlaubnis zu fragen. Emma fuhr dazwischen, weil sie offensichtlich nach ihrem Lipgloss mit Erdbeergeschmack suchte, das unauffindbar war.
Dana setzte sich neben Charlotte, griff nach der Thermoskanne und goss sich noch einen Kaffee ein. Sie sah zu ihrer Mutter und verdrehte die Augen.
»Ich bin mir nicht sicher, ob das klug ist«, sagte sie halblaut. »Antonius bringt mir ein bisschen zu viel Aufregung in die Truppe. Wenn wir jetzt noch seine Bilder an Bord haben, heißt das zwangsläufig, dass wir ihn öfter sehen. Mindestens zwei Mal. Wenn er die Bilder bringt, und wenn er sie wieder abholt.«
»Ich kann sie verstehen. Er ist ein interessanter junger Mann«, antwortete Charlotte. »Sie schmeißen sich alle drei ganz schön ins Zeug. Besonders Franziska. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass er ein Filou ist. Sonst hätte ich das vorhin auch nie vorgeschlagen. Er wirkte eher nachdenklich. Zurückhaltend. Und er hat auch mit keiner geflirtet. Im Gegenteil. Er war zwar bei Franziska nicht direkt abweisend, aber doch sehr sachlich.«
»Das wäre ja auch noch schöner, wenn wir alle daneben sitzen! Trotzdem, wir wissen nichts über ihn«, gab Dana zurück. »Aber heute Abend werde ich mehr über ihn wissen, das kannst du mir glauben. Und wenn er mir nicht passt, dann lass ich das mit der schwimmenden Ausstellung. Egal, was die Mädchen wollen und wie gut ihnen die Bilder gefallen. Macht es dir was aus, wenn du heute allein hierbleibst?«, fragte sie ihre Mutter.
»Aber nein, natürlich nicht. Es passen ja nur fünf Leute in den Wagen.«
»Genau.« Dana nippte an ihrem Kaffee. »Ich lass dir mein Handy da. Wenn irgendwas ist, rufst du sofort an, ja? Die Nummern der Mädchen sind abgespeichert.«
»Ich weiß.«
»Na, dann mach ich mich auch mal fertig.«
»Lipgloss und ein hellgelbes Top?«, fragte Charlotte milde.
Dana zog die Augenbrauen hoch und verzichtete auf eine Antwort.
Als eine halbe Stunde später ein Motorrad den Uferweg entlanggebraust kam, dachten sich weder Dana noch ihre Töchter etwas dabei. Auch nicht, als es exakt an der Stelle hielt, an der Antonius gestern seinen Wagen geparkt hatte. Erst als der Motorradfahrer abstieg, schaute Dana aufmerksamer in seine Richtung. Die schlanke Figur in Jeans und Lederjacke kam ihr vage bekannt vor, auch wenn sie das Gesicht hinter dem dunklen Visier des Integralhelms nicht erkennen konnte. Noch nicht – was sich änderte, als er den Helm abnahm. Neben ihr holte Franziska tief Luft. »Oh nein«, hörte sie ihre Tochter leise sagen.
Katharina schien zu begreifen, was Franziska meinte. Sie drehte sich auf der Stelle um und verschwand nach unten.
Bei Dana dauerte es einen Moment länger, bis der Groschen fiel.
»Ich dachte, Antonius kommt mit dem Auto«, sagte sie erstaunt.
»Das dachten wir alle«, gab Franziska zurück. Die Enttäuschung in ihrer Stimme war unüberhörbar. Ungehalten schmiss sie ihr langes blondes, sorgfältig gekämmtes Haar nach hinten, als Antonius die Gangway hinauf zum Schiff kam.
»Hallo. Ich bin mit dem Motorrad gekommen«, erklärte er überflüssigerweise in Danas Richtung. »Das Wetter ist so schön. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen?«
Das letzte Mal war Dana in der Schulzeit auf einem Motorrad gefahren, was rund fünfundzwanzig Jahre her war. Es war keine schwere Maschine gewesen wie diese hier, sondern eine, für die ein Führerschein reichte, den man mit sechzehn machen konnte. An die Havelchaussee waren sie gefahren, spätabends, in einer Gruppe. Sie hatte hinter einem Jungen gesessen, an dessen Namen sie sich nicht einmal mehr erinnerte – und es war großartig gewesen. Trotzdem zögerte sie einen Moment. »Aber nein, das ist okay«, antwortete sie dann. »Sehr sogar.«
»Aber Sie sollten sich lange Hosen anziehen und andere Schuhe«, meinte Antonius und zeigte auf Danas Sommerrock und die Flipflops, die sie trug. Sie nickte. »Moment. Ich bin gleich wieder da.« Sie eilte zurück in ihre Kabine und ließ den Rock zu Boden gleiten. Dann fiel ihr Blick auf den Spiegel an der Wand.
»Du willst Motorrad fahren?«, fragte sie ihr Spiegelbild, und es nickte. Prüfend betrachtete Dana sich. Sie sah die Fältchen rund um ihre Augen, die meisten eher vom Lachen als vom Weinen, die feinen Linien, die sich von ihren Nasenflügeln in Richtung Mundwinkel herabzogen. Ihre helle Haut war zart, aber längst nicht mehr so samtig glatt wie die ihrer Töchter. Im Gegensatz zu ihnen war sie ungeschminkt, bis auf einen Hauch Wimperntusche, die sie grundsätzlich auftrug.
Und ansonsten … sah sie haargenau so aus wie immer. Vielleicht ein bisschen aufgeregter, mit einem ungewöhnlichen Glanz in ihren Augen.
Sie trat noch näher, bis die Oberfläche des Spiegels von ihrem Atem beschlug und sie sich nicht mehr erkennen konnte. Sie hatte keine Ahnung, wo der Trip mit Antonius hinging. Wo er sein Atelier hatte. Wie lange sie unterwegs sein und was sie an ihrem Ziel erwarten würde.
Aber natürlich machte diese Ungewissheit auch den Reiz aus.
Sie schlüpfte in ihre Lieblingsjeans, die zum einen gut saßen, zum anderen aber, speziell an Taille und Hüfte, gemütlich waren. Mit ihrer Größe 40 war sie schlank genug, wenn auch nicht mehr so zierlich wie damals, als sie Burkard kennengelernt hatte. Ihr rotes T-Shirt behielt sie an, fuhr in ihre roten Stoffschuhe und griff nach einem schwarzen Blouson, den sie häufig an Bord trug. Dann ging sie wieder nach oben. Antonius sah sie prüfend an, dann nickte er.