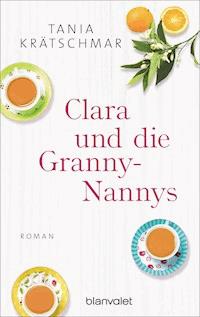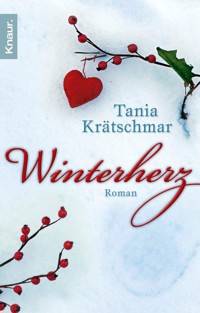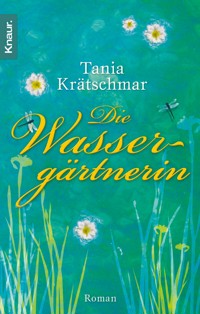6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Man nehme: 1 Flasche eisgekühlten Champagner, 2 zarte Kristallgläser, 1 Frau, 1 Mann, 1 Sommer, 1 See, 1 Vollmond, 30 Frösche. Alle Zutaten vorsichtig mischen und sich diskret entfernen.« Kann man die große Liebe zweimal finden? Eigentlich ist Josephine nach dem Tod ihres Mannes fest davon überzeugt, dass ihre beiden Söhne von nun an die einzigen Männer in ihrem Leben sind. Als sie jedoch im Sommer darauf in eine alte Villa an der Müritz zieht, umdort ein Restaurant zu eröffnen, ist siesich plötzlich gar nicht mehr so sicher. Denn da ist Severin, dessen Augen soblau sind wie der Sommerhimmel.Doch ist sie wirklich schon bereit für eine neue Liebe? Seerosensommer von Tania Krätschmar als eBook erhältlich!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 410
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Tania Krätschmar
Seerosensommer
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Inhaltsübersicht
Winternacht
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
Winternacht
Nicht ein Flügelschlag ging durch die Welt,
Still und blendend lag der weiße Schnee.
Nicht ein Wölklein hing am Sternenzelt,
Keine Welle schlug im starren See.
Aus der Tiefe stieg der Seebaum auf,
Bis sein Wipfel in dem Eis gefror;
An den Ästen klomm die Nix’ herauf,
Schaute durch das grüne Eis empor.
Auf dem dünnen Glase stand ich da,
Das die schwarze Tiefe von mir schied;
Dicht ich unter meinen Füßen sah
Ihre weiße Schönheit Glied für Glied.
Mit ersticktem Jammer tastet sie
An der harten Decke her und hin.
Ich vergaß das dunkle Antlitz nie,
Immer, immer liegt es mir im Sinn.
Gottfried Keller
Prolog
Wo blieb er nur? Josephine Gill sah auf die Uhr über der doppelflügeligen, rotgebeizten Holztür, die von der Küche des Restaurants in den Gastraum führte. Es war schon nach vier, die Dämmerung setzte ein, und die Zeit wurde allmählich knapp. Heute Morgen, gleich nach dem Frühstück in ihrer Altbauwohnung über dem »Gill’s«, war Johann aufgebrochen. Der Weg nach Wittstock hin und zurück konnte doch nicht so lange dauern! Sie wusste, dass ihr Mann sich gern mit dem Biobauern, von dem er das Rindfleisch bezog, unterhielt. Er schwor, dass dieser Bauer genau merkte, was sich in den Köpfen seiner Rinder abspielte, und deshalb auch erraten konnte, was sie am liebsten fraßen. Was der Grund dafür war, dass gerade dieses Fleisch den weiten Weg wert war. »Wenn ich nicht japanisches Kobe-Beef haben kann, ist das die nächstbeste Wahl«, sagte Johann gern.
Aber Josephine wusste auch, dass Johann stets sorgfältig darauf achtete, seinen Zeitplan einzuhalten. Als Chefkoch war ihm sonnenklar, wie lange es dauerte, das Fünf-Gänge-Menü für achtundzwanzig Personen herzustellen – in diesem Fall für die Angestellten einer großen, erfolgreichen Berliner Werbeagentur, die sich heute Abend im Gill’s zu einer kulinarischen Betriebsfeier einfinden würden. Diese Reservierung bestand schon lange: Vor knapp einem Jahr war Johann als Küchenchef im Gill’s mit seinem ersten Michelin-Stern ausgezeichnet worden. Am nächsten Tag hatte »WV-Ads«, stets am Puls der Berliner Szene-Zeit, angerufen und für heute, den 30. Oktober, gebucht. Dieser Anruf war erst der Auftakt gewesen: Seitdem hatte das Telefon praktisch nicht mehr stillgestanden. Über Nacht war das Gill’s eines der angesagtesten Restaurants der Stadt geworden. Nach der Bekanntgabe der Auszeichnung hatten Johann, Josephine und ihr Team mit Rosé-Champagner angestoßen, hatten gefeiert und furchtbar gelacht, als sie über Johanns möglichen Auftritt bei einer Fernsehkochshow spekulierten.
All die Mühe, die das Restaurant vorher bedeutet hatte, war es in diesem Moment wert gewesen. Die Arbeit hatte danach zwar nicht abgenommen, aber ihrem Konto war es gut bekommen.
Neuerdings hatte Johann sogar ein ziemlich kostspieliges Hobby für sich entdeckt: Er hatte eine alte Harley Davidson mit Beiwagen gekauft. Josephine hatte gelacht, aber auch verstanden: Er hatte so lange so hart gearbeitet, so sehr gehofft. Sie beide hatten so lange so hart gearbeitet. Obwohl ein Fahrrad vielleicht besser gewesen wäre, dachte sie manchmal. Das viele Kosten der Speisen, das Probieren und Experimentieren hatte auch dazu geführt, dass Johann um die Mitte herum längst nicht mehr der schlanke Mann war, den sie damals kennengelernt hatte. Seine Kochjacke spannte bedrohlich über seinem Bauch, und seine Rundlichkeit gab ihm etwas Bedächtiges, was gar nicht zu seinem Charakter passte.
Josephine hatte noch einen zweiten Grund, ungeduldig auf Johanns Rückkehr zu warten: Bevor er heute mit dem Motorrad losgefahren war, hatte er geheimnisvoll von einer Überraschung gesprochen. Was das wohl sein mochte? War er deshalb noch nicht zurück?
Inzwischen hatte sie als seine Souschefin alles, soweit es ging, vorbereitet. Auch der Chef Pâtissier war bereits da gewesen und hatte die Nachspeisen – frisches Himbeerrahmeis an Swiss Double Fudge Cookies im weihnachtlichen Karamell-Gespinst – zubereitet. Gegen neun Uhr würde er zurückkehren und alles zum Servieren anrichten.
Abwesend drehte Josephine die langen schwarzen Haare zu einem dicken Zopf zusammen und griff sich das Erstbeste, womit sie den am Hinterkopf entstandenen Knoten feststecken konnte – ein chinesisches Essstäbchen. Dann trat sie an das Fenster, das zur Straße hinausging. Sie drehte gedankenverloren an dem kleinen, altmodischen Radio, das auf dem Fensterbrett stand, und hörte flüchtig die Verkehrsansage – Vollsperrung der B 198 hinter Röbel nach einem schweren Verkehrsunfall. Gott sei Dank konnte Johann nicht im Stau stecken, denn bis zur Müritz wollte er nicht. Letzten Sommer hatten sie dort eine Woche Urlaub gemacht. Es war herrlich gewesen, stressfrei und idyllisch, und wenn es irgendwie ging, wollte Josephine auch die nächsten Sommerferien wieder in der ausgedehnten Seenlandschaft Mecklenburg-Vorpommerns verbringen. Aber bis dahin würde noch viel Wasser die Spree hinunterfließen.
Sie drehte den Knopf weiter, bis sie den Klassik-Sender gefunden hatte. Die Ouvertüre zur »Zauberflöte« erklang. Die Akustik in der leeren Küche war ausgezeichnet. Josephine sah aus dem Fenster.
Vor ihr lag der spätherbstliche Kollwitzplatz. Es war ein Tag grau in grau gewesen. Die Bäume standen kahl und dunkel zwischen Platz und Straße. Im Sommer tobte hier, fast rund um die Uhr und besonders an den Freitag- und Samstagabenden, das Leben. Dann hatte auch das Gill’s auf dem breiten Bürgersteig Sitzgelegenheiten, und wer wollte, konnte Johanns hochgepriesene Kochkunst an rosa eingedeckten Tischen genießen.
Der Spielplatz in der Mitte war das Herzstück des Platzes. Auch ihre eigenen Söhne spielten leidenschaftlich gern dort. Das hieß: Inzwischen turnte nur noch Gabriel auf dem Klettergerüst herum. Rafael, mittlerweile vierzehn, traf sich lieber mit seinen Freunden, die auch in Prenzlauer Berg wohnten.
Über fünfzehn Jahre lebte und arbeitete Josephine schon in diesem Haus. Damals war sie nach Berlin gekommen, um an der Humboldt-Universität mit dem BWL-Studium zu beginnen, und hatte sich im Gill’s als Kellnerin beworben. Als sie Johann zum ersten Mal gesehen hatte, mit seinen funkelnden dunklen Augen, die kurzen schwarzen Haare glatt aus dem Gesicht gekämmt, so voller Energie und Temperament, überzeugt davon, dass die Welt ein bisschen besser wäre, wenn die Menschen der Nahrung mehr Aufmerksamkeit, Wertschätzung und Genuss entgegenbrächten, war es um sie geschehen: Hals über Kopf hatte sie sich in ihn verliebt. Für sie war dieser Mann alles gewesen, wovon sie jemals geträumt hatte. Sie war kaum neunzehn, unerfahren und behütet, bis zu ihrem Umzug nach Berlin bei ihren Großeltern aufgewachsen; er war fünfunddreißig, brannte vor Ehrgeiz, sich zu beweisen, und wusste genau, was er wollte und wie er es bekommen konnte. Er verkörperte die Stadt, das Leben, die Zukunft für sie. Nur ein einziges Mal hatte er in ihre hellblauen Augen geschaut – jedenfalls hatte er das später behauptet, der alte Charmeur – und hatte sofort gewusst, dass sie die Richtige für ihn war. Schneewittchen, hatte er sie am Anfang genannt. Haare so schwarz wie Ebenholz, Haut so weiß wie Schnee, Lippen so rot wie Blut.
Er hatte ihr alles beigebracht, was sie über die Gastronomie wusste, und er war ein guter, strenger Lehrmeister gewesen. Ihr gemeinsames Leben drehte sich fast ausschließlich um das Restaurant, und inzwischen konnte Josephine es sich auch nicht mehr anders vorstellen. Selbst ihre Hochzeit, als Josephine mit Rafael hochschwanger war, und auch die Geburten beider Söhne passierten fast nebenbei. Denn das Gill’s war nun mal für sie beide die Hauptsache, würde es immer sein, und das gefiel ihr. Für Johann war Kochen die Philosophie seines Lebens, und die Philosophie seines Kochens war die ständige Suche nach neuen Kreationen, die der kulinarisch geschulten Gourmetzunge einen noch aufregenderen Kitzel versprachen. Nur so hatte er es an die Spitze der Berliner Gastronomie geschafft, behauptete er.
Umso unverständlicher war es, dass er immer noch nicht hier war. Josephine hatte eine doppelte Rinderbouillon mit Juliennegemüse und Dinkelflädl geplant, eine relativ bodenständige Suppe zwischen Johanns ungewöhnlichen Menübeiträgen. Inzwischen war nur noch eine einfache denkbar. Nun komm schon, Johann, dachte sie ungeduldig.
Und dann, endlich, hörte sie, wie die Eingangstür des Restaurants geöffnet wurde. Sie schaltete das Radio aus, ohne dass sie später sagen konnte, warum sie gerade das getan hatte. So als wollte sie in diesem Moment kein anderes Geräusch um sich herum hören. Als ob jetzt die Zeit des Schweigens gekommen wäre.
Mit raschen Schritten durchquerte sie die Küche, in der die Ablageflächen, die Rührschüsseln, die beiden großen Herde und alle anderen Gerätschaften sauber glänzten, bereit für den abendlichen Einsatz. Sie stieß gegen die Doppeltür, die sich federleicht nach außen hin öffnen ließ, damit die Kellner auch mit mehreren Tellern beladen ungehindert in den Gastraum eilen konnten – und stand unvermittelt zwei Polizisten gegenüber.
»Ja, bitte?«, fragte sie vorsichtig. Polizeibeamte in Uniform waren nicht die Standardgäste im Gill’s.
»Sind Sie Frau Gill?« Der jüngere der beiden nahm vorsichtig seine Mütze ab und hielt sie zwischen den Händen.
»Ja – wieso?« Ein unbehagliches Gefühl beschlich Josephine. Hatte Rafael etwas angestellt? Er wollte heute zu ihrer Schwester Ella. Gabriel war oben bei Edith, ihrer Kinderfrau, Ersatzoma und Vertrauten.
»Frau Gill, es gab einen Unfall, in den Ihr Mann verwickelt war. Nahe der Müritz.«
»Das ist nicht möglich«, antwortete Josephine erleichtert. »Er wollte heute nur bis nach Wittstock. Sie müssen sich irren.«
»Nun, wir konnten ihn bedauerlicherweise eindeutig anhand seiner Papiere identifizieren.« Er reichte ihr einen Führerschein. Automatisch nahm Josephine ihn in die Hand, starrte darauf. Er war zerknittert, an der einen Ecke war ein großer Fleck, der ihr früher nie aufgefallen war. Sie schlug das Dokument auf und sah Johanns Foto.
»Frau Gill, es tut uns leid. Ihr Mann ist mit seinem Motorrad tödlich verunglückt.«
Nein. Josephine schüttelte den Kopf. Nein. Nein. Nein. Ein Irrtum. Aber warum drehte sich plötzlich der Fußboden; warum wurde es auf einmal so dunkel um sie?
»Frau Gill? Frau Gill? Hallo, hören Sie mich?«
Der junge Polizist kniete sich besorgt neben Josephine, die auf dem Fußboden zusammengesackt war, und griff nach ihrem Handgelenk. Dann wandte er sich an seinen älteren Kollegen: »Klaus, ruf mal schnell einen Krankenwagen. Sie ist ohnmächtig geworden.«
Während der Angesprochene nach seinem Handy griff, blieb der Jüngere neben der Ohnmächtigen knien und hielt ihre Hand. Sie ist viel zu jung, um Witwe zu sein, dachte er traurig. Und viel zu schön ist sie auch. Das Leben ist nicht fair.
1. Kapitel
Trostkipferl Wien-Berlin-Valtzow
200 g weiche Butter, 80 g Zucker, 100 g geschälte, feingemahlene Mandeln und 280 g Mehl sorgfältig miteinander vermengen. Nicht zu heftig kneten!2 Teigrollen von 3 cm Durchmesser formen, 1 cm dicke Stückchen davon abschneiden und auf der Handfläche zu Kipferln formen. Auf ein gefettetes Backblech legen, im vorgeheizten Ofen bei 200 Grad circa 10 Minuten abbacken. Noch warm in Staubzucker wälzen, dem 2 Päckchen Vanillezucker beigegeben worden sind.
Manchmal spielte Josephine mit dem Gedanken, aufzugeben. Einfach Schluss zu machen. Die spitzesten, schärfsten Messer in der Küche glänzten lockend und verführerisch und flüsterten ihr zu: Ich steche schnell. Ich schneide roh. Es tut weh, aber dann ist alles vorbei. Du darfst vergessen.
Der Gasofen zischte: Leg die Wange auf das Blech und schalte mich an. Atme tief. Immer langsamer. Alles wird gut.
Die elektrischen Geräte surrten: Lass mich in das Wasserbecken fallen. Ein Moment der Schwäche, keiner wird wissen, dass es Absicht war. Ein kurzes Zucken, direkt in dein trauriges Herz, und dein Leben ist vorbei.
Aber dann sah sie in die Augen ihrer Söhne, Gabriels so hellblau wie ihre, Rafaels so dunkelbraun wie Johanns, und dann wusste sie, dass sie es niemals tun könnte. Genauso sicher wusste sie allerdings auch, dass sich etwas ändern musste. Denn auch wenn sie nicht aufgeben wollte – unverändert weiterleben wie bisher war ebenso ausgeschlossen.
Und deshalb waren sie jetzt, sieben Monate später, hier. Josephine streckte die Arme dem blauen Nachmittagshimmel entgegen und reckte sich. Es tat gut, die frische Luft zu atmen, den Duft von Gras und Wasser. Ein warmer Wind wehte und kühlte ihren schweißnassen Rücken. Es war ein heißer Tag Anfang Juni, und die blaue Bluse mit den halblangen Ärmeln war einfach zu warm für die Reise gewesen. Die Autofahrt in ihrem alten Benz von Berlin bis zur Müritz war problemlos verlaufen, wenn man davon absah, dass der Wagen bis unters Dach vollgepackt war mit den letzten Dingen, die sie nicht mehr in die Kisten der Umzugsfirma gepackt hatte. Dinge, die sie für ihr neues Haus, ihre neue Existenz in Valtzow brauchen würde. Für ihr neues Leben.
Auf der Beifahrerseite stieg Edith aus und öffnete die Rücktür. Gabriel machte sich aus seinem Kindersitz los und kletterte hinaus.
»Na, dann wollen wir mal schauen, welches dein Zimmer ist«, sagte Edith und nahm Gabriel, der stumm neben ihr stehen geblieben war, an die Hand.
Josephine schaute ihnen nach, dem kleinen Blondschopf und der zierlichen Frau, der man mit ihrem dunkelrot getönten, kinnlangem Haar, ihrer glatten Haut und dem offenen Lächeln ihre dreiundsechzig Jahre nicht ansah. Josephine wusste, dass sie das, was hinter ihr lag, niemals ohne Edith geschafft hätte. Nicht erst seit Johanns Tod war sie ihr zu einer unersetzbaren Freundin geworden, mütterliche Eingeweihte und patente Helferin in einem, dazu feinfühlig und verständnisvoll, aber auch immer bemüht, sich auf keinen Fall zwischen Josephine und ihre Söhne zu drängen. Das war vom ersten Tag an so gewesen, als sie den einjährigen Gabriel auf den Arm genommen hatte, und das hatte sich seitdem nie geändert.
Langsam folgte Josephine den beiden und blieb vor dem Gebäude stehen, das in zartem Gelb gestrichen war und von dem sich die tiefgrüne Tür, die Fensterrahmen und –läden dunkel abhoben.
Mehrere Monate anstrengender Umbau- und Renovierungsarbeiten lagen hinter ihr und Edith. Viel Arbeit, viel Mühe und viel Geld hatte es gekostet, aber sie hatten auch das Glück gehabt, Hilfe von unerwarteter Seite zu bekommen.
Für Josephine war es Liebe auf den ersten Blick gewesen, als sie das alte, zweistöckige Herrenhaus besichtigt hatte, das abseits vom Ortskern an einem kleinen See lag. Es war nicht schön, nicht gut erhalten, nicht neu und schon gar nicht sauber gewesen. Die Fenster im Parterre und im Stockwerk darüber waren verzogen gewesen, der Wind hatte hindurchgepfiffen. Der Fassadenputz war grau und zum Teil abgefallen, das Dach mit einer dicken grünen Moosschicht bedeckt gewesen. Einzelne Ziegel hatten ganz gefehlt. Von den Haustüren, an der Vorderseite eine und auf der Rückseite zwei, war die Farbe abgeblättert, und sie hatten gefährlich in ihren verrosteten Angeln geknarrt. Und doch hatte dieses vernachlässigte Gebäude sofort Josephines Herz berührt. Einsam und ein bisschen trotzig hatte es dagestanden, bereit, der Welt seine hässlichste Seite zu zeigen – oder auch seine schönste. Auf die hatte Josephine es abgesehen.
Während das alte Herrenhaus oben dicht an der wenig befahrenen Straße stand, reichte das abschüssige Grundstück direkt bis an den See – den Valtzower See. Neben dem Grundstück mit dem verwilderten Garten samt Apfel-, Pflaumen-, Birn- und Walnussbäumen, die jetzt trotz des ausgebliebenen Baumschnitts erstaunlich gut trugen, begann der Wald.
Von der Einfahrt aus, in der Josephine geparkt hatte, konnte sie den langen Steg sehen, der vom Ufer aus in tieferes Wasser führte und an dessen Ende eine Badeleiter befestigt war. An den Rändern des Sees blühten weiße und gelbe Seerosen, die wie kleine, grünblättrige Inseln aussahen. Von ihnen war bei ihrem ersten Besuch im Januar allerdings keine Spur gewesen: Eine massive Eisschicht hatte damals auf dem Teich gelegen, im Haus war es kalt gewesen, die verblichenen Tapeten hatten Blasen auf den unebenen Wänden geworfen, die Holzdielen waren verzogen gewesen, dick mit verschiedenen Farbschichten bemalt, die oberste ein tristes, fleckiges Rotbraun. Und trotzdem hatte Josephine sofort verstanden, dass dieses Haus nicht nur die Überraschung sein musste, von der Johann so geheimnisvoll gesprochen hatte, als er zu seiner letzten Fahrt an die Müritz aufgebrochen war – sondern noch etwas viel Wichtigeres, Größeres für sie bedeutete.
An jenem Unfalltag hatte Johann einen Kaufvertrag für das Haus abgeschlossen, und diesen unterzeichneten Vertrag hatte Josephine in seinen Unterlagen gefunden, die man ihr im Krankenhaus überreicht hatte. Damals war sie unfähig gewesen, sich Gedanken darüber zu machen. Aber inzwischen hatte sie sich oft gefragt, warum er es gekauft hatte: Wollte er für seine Familie ein Sommerhaus haben, in dem sie die seltenen freien Tage, an denen sie sich nicht um das Gill’s kümmern mussten, verbringen konnten? Oder hatte Johann an später gedacht, an eine Zukunft, in der ihre beiden Söhne ihr eigenes Leben lebten und Josephine und er hier allein ruhige Ferien verbringen konnten? Wollte er vielleicht sogar hier leben? Hatte das alte Haus auch zu Johann gesprochen, ihm in seiner Phantasie sein Potenzial offenbart? Was immer es auch war, was er genau vorgehabt hatte – sie würde es nie erfahren. Seine Zeit war abgelaufen, bevor er ihr seine Pläne erklären konnte.
Gleich bei ihrer ersten Fahrt nach Valtzow im Januar war Josephine ein zunächst völlig abwegiger Gedanke gekommen, der dann jedoch mehr und mehr Gestalt angenommen hatte, je unerträglicher die Situation in Berlin geworden war. Nach Johanns Tod hatte die Boulevardpresse sie und die Kinder sensationslüstern bestürmt, was zu Headlines geführt hatte wie: »Salzig wie Tränen, bitter wie der Tod – Johann Gills letzte Fahrt«, oder: »Schöne Kochwitwe gesteht: Allein bin ich verloren«.
Dann hatten diverse kulinarische Zeitschriften das Thema aufgegriffen, und als Josephine deren Überschriften gelesen hatte – »Ein Stern erlischt«, »Gill’s und Aus« und »Das Ende der Legende« –, wusste sie, dass ihre Zeit im Gill’s vorbei war. Dass sie sich etwas Neues aufbauen musste, fern von Berlin, wo der Schmerz allgegenwärtig war und kein Vergessen zulassen würde. Wo alles in der Wohnung, im Restaurant, in Prenzlauer Berg mit seinen Märkten und Geschäften sie an Johann erinnerte. An sein Lachen, sein Grübeln, sein Planen und seine Späße mit den Kindern, sogar an seine Ungeduld, wenn etwas in der Küche nicht so funktionierte, wie er es sich vorgestellt hatte. Seine Liebe, seine Küsse, seine Umarmungen, oft spät in der Nacht, wenn sie das Restaurant geschlossen hatten.
Und wo sie einer Zukunft entgegensah, in der die Messlatte einfach zu hoch hing. Wo jeder ihrer Schritte in die Selbständigkeit misstrauisch von anderen Küchenchefs und Restaurantkritikern beobachtet werden würde, jeder von ihnen mit einem »Nett, aber …« auf den Lippen. Im besten Fall. Im schlimmsten Fall dagegen lauerten unaufhaltsam zurückgehende Tischreservierungen, vernichtende Kritiken heimlich speisender Restaurantexperten und professionelle Demütigung auf ganzer Linie auf sie. Ganz zu schweigen von ihren eigenen Erwartungen, ihren ehrlichen Vergleichen mit Johanns Spezialitäten. Es war manchmal nicht leicht gewesen, immer in seinem Schatten zu stehen, und nur ihre tiefen Gefühle für ihn hatten ihr dabei geholfen. Der Schatten seines toten Kochgenies erschien ihr dagegen schwarz wie ein Grab, ein Gefängnis der Erinnerung, aus dem sie niemals entfliehen konnte. Nein, das wollte sie nicht.
Kurzentschlossen hatte sie das Restaurant verkauft. Glücklicherweise hatte der Interessent ihr einen sehr anständigen Preis geboten, der es ihr, zusammen mit Johanns Lebensversicherung, ermöglicht hatte, das Herrenhaus am Valtzower See so umzubauen, wie sie es wollte: Zu einem neuen Zuhause für sich und ihre Kinder – und für Edith, wie sich herausgestellt hatte, denn die hatte sofort klargestellt, dass sie nicht die Absicht hatte, Josephine und ihre Söhne allein von dannen ziehen zu lassen.
Aber Josephines Pläne gingen weiter und hatten mittlerweile einen Namen bekommen: »Seerose«. Sie hatte zwei Räume im Erdgeschoss des Hauses zusammengelegt und eine Profiküche einbauen lassen. Jetzt gab es einen Gastraum, zu dessen fertiger Einrichtung nicht mehr viel fehlte. Ein kleines Restaurant wollte sie hier führen, mit maximal zwanzig Sitzplätzen. Nicht Haute Cuisine hatte sie geplant, in der ständig mit teuersten Materialien extravagant getüftelt wurde, immer auf der Suche nach dem neuesten Gaumenkitzel, den innovativsten Geschmackszusammenstellungen. Und auch Nouvelle Cuisine wollte sie nicht denjenigen, die den Weg in ihre Seerose fanden, servieren. Ambitionen auf einen Stern von Michelin oder eine bei anderen Köchen so begehrte Haube von Gault-Millau hatte sie ebenfalls nicht. All das hatte nichts mehr mit ihr zu tun. Das war Johanns Welt gewesen, seine Philosophie. Sie dagegen wollte nicht auf dem Podest des Lukullus stehen und zum Beklatschtwerden am Ende des Abends aus der Küche treten.
Was Josephine vorschwebte, war eine schlichte Karte mit wenigen Gerichten, bestehend aus frischen, regionalen, saisonalen und, wann immer möglich, biologischen Produkten. Spontane Änderungen waren jederzeit vorstellbar, wenn es ihr gefiel, die Tafel, auf die sie die Tages-Specials schreiben würde, stand bereits im Flur. Mit viel Fisch aus der Müritz. Was machte es schon, dass in Mecklenburg-Vorpommern im Winter keine Tomaten wuchsen? Dann gab es eben Feldsalat. Oder Chicorée, rote Beete, Topinambur, frisches Wurzelgemüse. Die Öffnungszeiten wollte sie zunächst auf Freitag, Samstag und Sonntag beschränken, und ihre Pâtisserie-Chefin hatte sie bereits dabei: Edith mit ihren Wiener Backkünsten war in der Abteilung »Mehlspeis’ und Gebäck« unangefochtene Meisterin.
Der laute Ruf ihres Sohnes unterbrach Josephine in ihren Gedanken. »Mama, kann ich das Zimmer ganz oben haben? Kann ich? Ja? Bitte!« Gabriel kam aus dem Haus auf sie zugerannt und sah sie erwartungsvoll an.
Seit Johanns Tod war ihr Jüngster sehr still geworden. Das Wort Papa hatte er völlig aus seinem Wortschatz gestrichen, seinen Vater nie wieder erwähnt, wie Josephine mit Unbehagen festgestellt hatte. Wer wusste, wie sich das langfristig auf ihn auswirken würde? Sie hoffte deshalb aus ganzem Herzen, dass der Umzug ihm bei der Heilung seiner verletzten Kinderseele helfen würde. Schon deshalb tat es gut, ihn jetzt so aufgeregt zu sehen, sein enthusiastisches Grinsen mit der brandneuen Zahnlücke.
»Meinst du den kleinen Raum, der mitten in den Dachboden hineingebaut ist?«, fragte sie, um Zeit zu gewinnen. Ihr hatte eigentlich ein anderes Zimmer für ihn vorgeschwebt.
»Ja, das, in dem so viel Kram steht. Ein altes Pferd mit Stiel und so komische kleine Autos aus Blech, ein Schlitten und ein Regal mit Büchern und Büchsen und Schachteln«, zählte er auf.
»Willst du mit den Autos spielen? Die können wir auch in das große, helle Zimmer einen Stock tiefer bringen«, schlug Josephine vorsichtig und etwas manipulierend vor.
»Nein, ich will nicht damit spielen. Aber die schiefe Decke ist so schön, und vom Fenster aus kann ich über den ganzen See schauen. Wie auf einem Schiff hoch oben. Wie ein Pirat! Oder wie auf einem Leuchtturm! Das Zimmer neben dir ist langweilig«, fügte er hinzu.
Schlauer Junge, dachte Josephine. Er hatte sofort erkannt, dass sie vorgehabt hatte, ihn direkt neben ihrem Schlafzimmer einzuquartieren. »Ich weiß nicht, ob da oben überhaupt eine Heizung ist«, überlegte sie laut.
Gabriel nickte. »Doch, eine ganz alte. Sie steht unter dem Fenster. Mit komischen Füßen. So sehen die aus:« Er malte etwas in die Luft, das stark an eine Kreuzung aus Löwenpfote und Elefantenrüssel erinnerte.
»Na gut«, sagte Josephine. »Dann müssen wir das Zimmer aber noch ausräumen, damit deine Sachen reinpassen. Am besten, wir packen erst einmal alles auf den Dachboden nebenan.«
Das Haus war vollständig geräumt gewesen, als Josephine es übernommen hatte. Nur auf dem Dachboden und in dem kleinen Zimmer war noch einiges an Schachteln, Kartons und sonstigen Behältern vergessen worden, das sich jetzt unter den Schrägen stapelte.
»Super!«, sagte Gabriel und flitzte zum Haus zurück.
Josephine sah ihm hinterher. Es gab nichts, was sie nicht getan hätte, um ihn wieder etwas glücklicher zu sehen, um die schwere Last der Trauer zu mindern, die er auf seinen schmalen Schultern trug. Auch wenn es jetzt unerwarteterweise bedeutete, dass er eine andere Zimmerwahl traf als sie. Aber natürlich, sie hätte es wissen können. Es war ein kleines Abenteuer für ihn, da oben zu wohnen, fast in einer Rumpelkammer mitten auf dem Dachboden, mit der zugegebenermaßen schönsten Aussicht.
Rafael hatte sich, nicht weniger überraschend und ebenfalls schmerzlich für Josephine, ganz anders entschieden: Er wollte in Berlin bleiben und ging seit den Winterferien auf ein Internat. Bis jetzt war er an den Wochenenden zu Josephine und Gabriel nach Prenzlauer Berg gekommen, aber damit war es nun vorbei. Erst in sechs Wochen, in den Sommerferien, würde sie ihn wiedersehen, würde er sein neues Zuhause kennenlernen. Auch mit den spontanen Besuchen von Ella, ihrer jüngeren Schwester, die als Biologin an einem Institut der Freien Universität arbeitete und abends häufig noch ins Gill’s gekommen war, war vorerst Schluss. So viele Abschiede, dachte Josephine, als sie die Haustür aufdrückte. Kleine und große.
Drei Stunden später kamen sie und Edith die Holztreppe hinunter, die ins Erdgeschoss des Hauses führte. »Da denkt man immer, der Junge ist so sensibel, so zurückhaltend und verträumt. Aber wenn er etwas will, dann setzt er das auch durch«, sagte Edith erschöpft und öffnete die Tür, die in den zukünftigen Gastraum führte. Josephine nickte. »Ja, er kann erstaunlich unerbittlich sein, wenn er es will.« Insgeheim war sie stolz auf diesen Charakterzug von Gabriel. Er hatte darauf bestanden, dass sie sein erwähltes Zimmer sofort ausräumten und dann, mit seinen eigenen Sachen, wieder einräumten. Nun lag er in seinem Bett, hoffentlich glücklich und zufrieden, eine Nacht voller abenteuerlicher Piratenträume vor sich.
Josephine setzte sich mit Edith an einen der sechs Tische aus hellem Ahornholz, die sie in Berlin bei einem Tischler hatte anfertigen lassen. Dieser Raum sollte in nicht allzu langer Zeit der Gastraum werden, das Herzstück ihrer Seerose. Die Wände, von denen die schäbigen Tapeten entfernt worden waren, waren frisch verputzt und in einem sanften Maisgelb gestrichen worden. Die breiten, abgezogenen Holzdielen glänzten honiggelb. Josephine hatte sie ölen statt lacken lassen. An den Wänden waren in regelmäßigen Abständen alte italienische Dachfliesen befestigt, hinter denen sich elektrische Kerzen versteckten, die gedämpft, aber ausreichend Licht gaben – eine ebenso raffinierte wie preiswerte Lösung. Hinter der relativ kleinen Theke, in der sich die Zapfanlage und ein spezieller Kühlschrank zur Weinlagerung befanden, war der Eingang zum Küchenbereich. Ein Großteil der Küchengerätschaften, die sie im Laufe der letzten Wochen aus Berlin mitgebracht hatten, war bereits eingeräumt. Nur wenig stapelte sich noch in den Umzugskartons, die in dem Raum mit den weißgestrichenen Sprossenfenstern standen. Dazu gehörte auch das Geschirr aus dem Gill’s, das Josephine weiterhin benutzen wollte. »Ohne Angelika hätten wir das niemals geschafft«, sagte Edith jetzt, schaute sich sehr zufrieden um und lehnte sich dann in dem hochlehnigen Rattanstuhl mit den hellen Kissen zurück.
»Das kannst du laut sagen«, bestätigte Josephine. »Wir haben den Umbau unterschätzt und hatten dabei ein Riesenglück. Dieses ewige Hin- und Herfahren, die Bauarbeiten, das Schlüsselproblem. Nein«, sie korrigierte sich, »du hattest ein Riesenglück.«
Edith nickte. »Es war reiner Zufall, dass ich Angelika gleich am zweiten Tag beim Bäcker getroffen habe.«
»Ja, und dass ihr euch eine Stunde lang unterhalten habt, dass sie und ihr Mann früher in den Ferien immer nach Österreich gefahren sind, dass sie am liebsten in Grinzing wohnten, in der Himmelsstraße, um die Ecke von deinem Elternhaus, und dass sie jeden Heurigen kannte, den du genannt hast.« Josephine lachte und stand auf. »Sag, soll ich uns eine Weinschorle machen? Wir haben etwas zu feiern, und bei dieser Hitze …«
»Gern«, erwiderte Edith.
Josephine trat hinter die Theke, nahm eine Flasche Sancerre aus dem Kühlschrank, öffnete sie und goss den Wein in zwei Gläser, bevor sie Mineralwasser hinzugab. »Alles Zufälle. Aber sehr hilfreiche.« Mit den Gläsern in der Hand kam sie zurück zu dem Tisch, an dem Edith saß.
»Freilich. Manchmal muss man Glück haben. Es ist nie falsch, die Frau des Bürgermeisters zu kennen. Wobei …«, Edith beugte sich vertraulich vor, »… manchmal kommt es mir so vor, als ob der Gemeinderat hier Hans Zechlin nur gewählt hat, weil alle wissen, dass Angelika bei den wichtigen Entscheidungen das letzte Wort hat.«
»Ja, den Eindruck habe ich auch. Ich dachte, wir bewirten sie und ihren Hans, bevor wir die Seerose eröffnen. Außerdem kann sie dann gleich ein bisschen die Werbetrommel für uns rühren. Sie kennt ja wirklich alle in und um Valtzow.«
»Wann genau wollen wir denn jetzt eröffnen?«, fragte Edith, nachdem sie einen Schluck der kühlen Schorle getrunken hatte.
»Ich denke, kurz nachdem die Sommerferien in Berlin begonnen haben. Mitte Juli. Dann werden von der Müritz bestimmt häufiger Besucher nach Valtzow kommen. Außerdem ist Rafael dann da und kann sich etwas um Gabriel kümmern, wenn wir beide beschäftigt sind. Also noch knapp sechs Wochen.« Josephine sah aus dem Fenster, das den Blick in den abendlichen Garten bis zum See hinunter freigab. »Was wir jetzt noch bräuchten, wäre eine Terrasse zum Garten hin. Dann könnten die Gäste bei schönem Wetter draußen sitzen und aufs Wasser schauen.«
Edith seufzte. »Schon wieder ein Bauprojekt? Ich dachte, wir haben die Phase erst einmal abgeschlossen.«
»Es muss nicht sofort sein. Aber auf jeden Fall will ich das im Auge behalten.« Josephine bemerkte, dass Edith ein Gähnen unterdrückte. »Es war ein anstrengender Tag. Gehst du ins Bett?«
»Ja.« Edith trank den letzten Schluck aus und stand auf. Sie nahm die beiden Gläser und brachte sie zur Spüle hinter dem Tresen. Schnell spülte sie sie, trocknete sie ab und stellte sie dann auf das praktische Regal, das der Tischler in eine kleine Wandnische gebaut hatte. Neben den Gläsern stand die große, buntbemalte Porzellandose, in der Edith immer Vanillekipferl aufbewahrte – nicht nur zur Weihnachtszeit backte sie die köstlichen Plätzchen. Bei ihren Eltern zu Hause hatte immer eine Schale mit dem mürben Gebäck auf der Anrichte gestanden, hatte sie Josephine einmal erzählt. Wenn sich ein Kind verletzte, gab es zum Trost ein Kipferl, weshalb sie in ihrer Familie auch »Trostkipferl« genannt wurden. Das Backen der Naschereien hatte sie auch beibehalten, als sie ihren Mann geheiratet hatte und nach Berlin gezogen war. Zwanzig Jahre war ihr Peppi jetzt schon tot, aber sie beabsichtigte, auch weiterhin Vanillekipferl auf Vorrat zu backen. Es gab keinen Grund, gute Sitten aufzugeben, hatte sie erklärt. Auch nicht in Valtzow.
Edith verabschiedete sich von Josephine und verließ den Raum. Die zwei Zimmer, in denen ihre Möbel aus Berlin Platz gefunden hatten, befanden sich im ersten Stock des rechten Hausflügels, zu dem eine zweite Treppe führte. Sie hatte nicht nur einen abgeschlossenen Bereich, sondern auch einen eigenen Eingang, der in den Garten führte. Denn sie hatten es beide wichtig gefunden, dass Edith separat wohnte. In Berlin hatte sie schließlich auch ihre kleine Wohnung auf der anderen Seite des Kollwitzplatzes gehabt.
»Gute Nacht!«, rief Josephine ihr hinterher und stieg die Treppe in den ersten Stock hoch, wo ihr eigenes Schlafzimmer lag. Sie knipste die Nachttischlampe mit dem hellgelben Schirm an. Auch hier waren die Dielen abgezogen, die Wände allerdings in einem zarten Rosé gestrichen. Einen Teil der Dielen bedeckte ein antiker Kelimteppich in warmen Farben, den sie und Johann vor Jahren auf dem Flohmarkt am Boxhagener Platz entdeckt und sofort gekauft hatten. Auf einer flachen Liege, die ihr als Bett diente, lagen viele Kissen, mit naturfarbenem Nesselstoff bezogen. Josephine stopfte sie sich gern in den Rücken, wenn sie im Bett las. Dieses Bett, das sie nach Johanns Tod gekauft hatte. Ein jungfräuliches Bett, das, davon war sie überzeugt, auch immer jungfräulich bleiben würde. Denn Josephine konnte sich durchaus vorstellen, dass die Seerose ein bescheidener Erfolg werden würde, dass sie viel Arbeit und sicherlich auch Spaß haben und ihre Trauer darüber allmählich in den Hintergrund rücken würde. Dass mit dem heutigen Tag ihr Leben wieder etwas bunter wurde. Aber dass sie hier mit einem anderen Mann liegen würde? Nein. Ausgeschlossen.
Sie öffnete das Fenster. Aus der Richtung des Sees hörte sie das Gequake von Fröschen. Ihr seid sicher, dachte sie. In der Seerose wird es keine Froschschenkel geben!
Inzwischen war es schon so dunkel, dass sie den See eher ahnte als sah. Sie ließ das Fenster offen und zog sich ihr gemütliches Schlafshirt an. Dann ging sie ins Bad, das nebenan lag, putzte sich die Zähne, flocht ihre langen Haare zu einem losen Zopf, damit sie morgen früh nicht völlig durcheinander waren, und schlüpfte schließlich in ihr Bett.
Bevor sie das Licht ausknipste, schaute sie auf ein Foto in einem breiten silbernen Rahmen, das an den Lampenfuß gelehnt war. Es zeigte den strahlenden Johann, der gerade im Begriff war, in der Küche des Gill’s in seine Kochjacke zu schlüpfen. Josephine hatte es Minuten vor der kleinen festlichen Zeremonie anlässlich der Verleihung des Michelin-Sterns aufgenommen, vor über einem Jahr. Sie selbst hatte sich damals für den Anlass extra ein neues Kleid gekauft, rot wie die Farbe der Liebe und des Feuers. Stolz und sexy hatte sie sich gefühlt, wollte für Johann schön sein.
Seine Augen funkelten und strahlten, als sei das Licht des Sterns darin festgehalten worden, seine Haare, an den Schläfen bereits etwas grau, hatte er zu diesem Anlass mit etwas Gel zurückgekämmt. Er lachte ausgelassen, als könne ihn nichts verletzen, als sei er auf dem besten Weg, unsterblich zu werden. Ein Irrtum.
Sie nahm den Rahmen in die Hand, legte die Wange an das kühle Glas und schloss für einen Moment die Augen. Wie ruhig es hier war, ohne die ewig rauschende Geräuschkulisse Berlins im Hintergrund. Eine ländliche Stille wie im letzten Sommer, als sie Urlaub gemacht hatten und sie und Johann endlich mal Zeit für sich und die Kinder gehabt hatten. Eine Stille, in die sie von nun an jede Nacht allein hineinlauschen würde.
Josephine küsste die Spitze ihres Zeigefingers und berührte damit die Glasscheibe. Dann stellte sie das Foto zurück an den Lampenfuß. »Gute Nacht«, flüsterte sie schließlich und löschte das Licht. Sie wischte sich ihre Tränen fort und blickte aus dem Fenster, direkt in den dunklen Himmel.
2. Kapitel
Holländischer »Stampot special« von Bas de Boer
1 kg Kartoffeln, Salz, 500 g Champignons, 100 g Butter, 100 ml Schlagsahne, wenn möglich 2 Teelöffel Trüffelöl, 3 Esslöffel gehackten Schnittlauch. Kartoffeln schälen und kochen, Pilze braten, dann alles zusammenmengen und stampen, stampen, stampen! Smaakt herlijk zu Fleisch und Fisch. Beeindruckt alle Meisjes!
»Na, Jong, willst du heut Abend mit mir nach Röbel fahren? Lecker Meisjes schauen?«
Severin Wiesgrund grinste, als sein Freund ihm die Frage vom Steg aus zurief. Mit verschränkten Armen lehnte er sich an die Reling seines Bootes und schaute zu dem hageren, dunkelhaarigen Mann hinüber. Das deutsch-holländische Gemisch, das Bas de Boer sprach, amüsierte ihn immer wieder. Bas öffnete den Mund, und Severin musste lachen. Das Vorurteil vieler Deutschen, dass Holländisch eine Art Dialekt der deutschen Sprache und deshalb leicht zu sprechen sei, hatte Bas einfach umgedreht. Er warf ein paar deutsche Worte, die er kannte, in sein Holländisch und erwartete, dass man ihn verstand. Das Lustigste war, dass es tatsächlich funktionierte. Dabei hätte Bas mit ihm ruhig Holländisch reden können: Severins Mutter stammte ursprünglich von der holländischen Insel Ameland, und deshalb war ihm die Sprache sehr vertraut. Auch Englisch wäre eine Option der Verständigung mit Bas gewesen. Sie kannten sich schon sechs Jahre, waren beide Ingenieure und hatten zusammen auf einer Ölbohrinsel vor der holländischen Küste gearbeitet, und die Arbeitssprache, mit der sie sich dort alle untereinander verständigt hatten, war Englisch. Aber Bas, der bei einer Explosion eines Erdöltanks schwer verletzt worden war und mit einer beträchtlichen Entschädigung in der Tasche gekündigt hatte, schien überhaupt nicht einzusehen, warum er sein Holländisch aufgeben sollte. Und der Erfolg gab ihm recht: Die »lecker Meisjes« schienen das Sprachkuddelmuddel unwiderstehlich zu finden. Längst hatte Severin sich daran gewöhnt, dass häufig wechselnde, aber immer sehr attraktive junge Frauen mit einem durchaus zufriedenen Gesichtsausdruck morgens leichtfüßig von Bas’ Hausboot sprangen – eines von denen, die er und Severin aus Holland hier an den kleinen Hafen an der südwestlichen Seite der Müritz importierten, um sie dann zu verkaufen oder auch an Touristen zu vermieten. Es war Bas’ Geschäftsidee gewesen, nachdem er auf der Ölbohrinsel aufgehört hatte. Severin, der zu diesem Zeitpunkt bereits ein halbes Jahr die Gärtnerei seines Vaters auf Langeoog geleitet hatte, wollte von dort wieder weg: Pflanzen waren nicht seine Sache. Aber da er auf keinen Fall mehr einen Job auf der Ölbohrinsel anstrebte, war er vor einem Dreivierteljahr bei Bas mit eingestiegen, und es war ein Arrangement, das ihnen beiden gefiel. Das Geschäft mit Verkauf und Vermietung boomte; sie konnten, was ihnen beiden lag, viel Zeit an der frischen Luft verbringen, die ausgedehnte Seenlandschaft der Müritzgewässer war immer noch urwüchsig und das Klima nicht so rauh wie vor der Nordseeküste. Trotzdem – Severin hatte heute Abend etwas anderes vor. Und so rief er Bas, der ihn erwartungsvoll ansah, zu: »Ne, fahr allein nach Röbel. Ich will noch mal nach Valtzow.«
»Ah, wieder deine Idee mit den Häusern verfolgen?«, fragte Bas interessiert, während er auf den schmalen Planken langsam näher kam.
Severin nickte. Er hatte den Freund in seine Pläne eingeweiht, mit ihm viele der technischen Schwierigkeiten durchgesprochen und hoffte, dass er auf seine Unterstützung zählen konnte, wenn es so weit war.
»Na dann, viel Erfolg!«, wünschte Bas und verschwand in dem Boot, das neben Severins lag.
Wahrscheinlich macht er sich hübsch, dachte Severin lächelnd. Der Holländer liebte alle Sorten von Duftwässerchen und konnte an keiner Parfümerie vorbeigehen, ohne sich ein neues zu kaufen. Und ebenso wahrscheinlich war, dass Bas sein T-Shirt, in dem er gearbeitet hatte, mit einem langärmeligen Hemd vertauschte. Um die schweren Brandnarben zu verbergen, die er von der Explosion auf der Bohrinsel zurückbehalten hatte.
Auch Severin zog sich um. An Bord gab es zwei Einbauschränke. In dem einen befand sich seine Arbeitskleidung, blaue Jacken und T-Shirts mit dem Aufdruck »Boatsmen« – so hieß ihre Firma –, blaue Hosen und Bootsschuhe. In dem anderen war Freizeitkleidung und alles, was er zum Motorradfahren brauchte: Motorradstiefel, Lederjacke, Nierengurt und vor allem sein Sturzhelm und der Ersatzhelm, den er nahm, wenn er mal einen Beifahrer hatte. Manchmal begleitete ihn Bas, der eigentlich einen alten Volvo fuhr, auf seinen Spritztouren durch die mecklenburgische Landschaft.
Bevor Severin das Boot verließ, nahm er noch die Mappe mit den Unterlagen mit. Er hatte Hans Zechlin, dem Bürgermeister von Valtzow, zwar schon zwei Mal genau erläutert, wie er sich seinen Plan vorstellte, aber diesmal hatte er auch Fotokopien von seinen Unterlagen gemacht, die er ihm dalassen wollte. Als Entscheidungshilfe.
Er schloss das Boot ab, ging über den Steg und durchquerte das Hafengelände. Dabei winkte er kurz Jasmin zu, der Tochter des Hafenverwalters, die ihrem Vater gelegentlich bei der Arbeit half.
Schließlich kam er zu dem Parkplatz, wo er seine Moto Guzzi parkte. Dieses Motorrad war ein langgehegter Traum, den er sich weder auf der autofreien Insel Langeoog noch auf der Ölbohrinsel hatte erfüllen können. Klar, dass das eine der ersten Anschaffungen gewesen war, als er endgültig aufs Festland gezogen war.
Er packte die Mappe in das Topcase, schwang ein Bein über den Sitz, ließ die Maschine an, lauschte einen Moment fasziniert auf das satte Geräusch und fuhr los. In Richtung Valtzow, keine zehn Kilometer entfernt, wo er eine Verabredung mit Hans Zechlin hatte, der nur ja zu sagen brauchte, um mit Severins fabelhaftem Plan den Tourismus in seiner Ortschaft entscheidend voranzutreiben.
»Mein Mann ist in seinem Büro«, wurde er von Frau Zechlin freundlich empfangen. Es war schade, dass er nicht mit ihr diese Verhandlungen führen konnte, fand Severin. Bei ihren kurzen Begegnungen kam sie ihm strukturiert, überlegt und gleichzeitig sehr warmherzig vor, ihr Mann dagegen eher wankelmütig, unentschlossen und reichlich kühl.
Er ging hinter ihr her, bis sie das private Büro von Hans Zechlin im hinteren Teil des adretten Einfamilienhauses erreichten. Bereits bei seinem Eintreten musterte ihn der hagere Bürgermeister mit dem grauen Haar, den tiefen senkrechten Falten um seine Mundwinkel und den dunkelbraunen Augen misstrauisch.
Eine halbe Stunde später musste Severin sich energisch zusammennehmen, um Hans Zechlin nicht zu sagen, was er von ihm hielt: Dass er ihn wenig flexibel fand und nicht verstand, was er an seinem Plan auszusetzen hatte. Es war ihr drittes Treffen, seit Severin das Stück Land entdeckt hatte, nach dem er rund um die Müritz Ausschau gehalten hatte. Das Grundstück lag genau am Valtzower See, der eine direkte Verbindung zur Müritz hatte. Das Gelände war gut 10.000 Quadratmeter groß, befand sich jedoch außerhalb des Nationalparks, was für sein Vorhaben wichtig war.
Vom Ufer aus hatte man einen traumhaften Blick aufs Wasser – und auf ein malerisches altes Herrenhaus, das auf der anderen Seite des Sees lag und in dem in letzter Zeit anscheinend Umbauarbeiten stattgefunden hatten. Es war ihm aufgefallen, als er das letzte Mal das Grundstück am Ufer aufgesucht hatte.
»Spricht denn etwas dagegen, dass ich nach einer Firma suche, die das Gelände vermessen und erschließen könnte?«, fragte er schließlich.
»Warten Sie damit bitte noch«, antwortete Hans Zechlin wortkarg.
»Haben Sie sich denn inzwischen schon entschlossen, ob Sie sich für das Projekt und das Bauvorhaben im Gemeinderat einsetzen würden?«, fragte Severin erneut.
»Nein, ich habe mich noch nicht entschlossen. Lassen Sie Ihre Unterlagen hier. Ich muss sie mir erneut anschauen. Aber ich finde Ihren Plan recht interessant.«
Höflich, höflich, höflich, ermahnte sich Severin. »Wann darf ich mich denn wieder bei Ihnen melden?«, wollte er wissen.
»Frühestens in zehn Wochen. Besser noch zwölf. Der Gemeinderat tagt erst wieder im September nach der Sommerpause«, entgegnete Hans Zechlin und stand auf, so dass für Severin nicht der leiseste Zweifel bestand, dass er entlassen war.
Er erhob sich. »Gern überlasse ich Ihnen die Unterlagen. Wenn Sie irgendwelche Fragen dazu haben, können Sie mich jederzeit anrufen. Meine Handynummer haben Sie?«
Zechlin nickte und öffnete die Mappe. »Ja, Ihre Karte haben Sie hier ja angepinnt.« Er öffnete die Tür und ließ Severin den Vortritt.
Noch ein kurzer Gruß, und Severin verließ das Haus, ganz und gar nicht zufrieden mit dem Verlauf des Gesprächs. Blödmann, dachte er, insgeheim verärgert. Als ob du nicht längst meine Visitenkarte hättest. Jedes Mal habe ich sie dir bis jetzt gegeben. Hast du sie in die Rundablage geworfen, oder was?
Draußen blieb er einen Moment auf dem Motorrad sitzen. Er hatte keine Lust, sofort zum Hafen zurückzukehren. Stattdessen zog es ihn, wieder einmal, zu dem Ufergelände, das ihm ideal für sein Vorhaben erschien. Er fuhr bis zum Ortsende und bog dann in eine kleine Seitenstraße ein, die zum See hinunterführte. Dort angekommen, bockte er die Moto Guzzi auf, nahm den Helm ab und strich sich das dunkelblonde Haar aus dem Gesicht. Er musste wirklich dringend nach Röbel. Nicht zu den Meisjes, sondern zum Friseur.
Severin ging zum Wasser, wo er sich auf einen umgestürzten Baumstamm setzte, der nah am Ufer lag. Jetzt am Abend war der See menschenleer. Nachmittags hatte er jedes Mal, wenn er an diese Stelle gekommen war, einen Angler entdeckt. Tag für Tag schien er hier oder in dem Kanal, der in den See mündete, seine Rute auszuwerfen.
Genau hier sollte sie entstehen, seine umweltfreundliche Ferienhaussiedlung, für die er sich ein ausgeklügeltes Energiesystem ausgedacht hatte. Er schaute sich um und sah sie in seiner Phantasie bereits fix und fertig vor sich.
Severin hatte von fossilen Energien wie dem Erdöl, für das Kriege geführt und ganze Völker ins Unglück gestürzt wurden, während sich die Spekulanten in den Welthäfen und an den Börsen eine goldene Nase verdienten, gründlich genug. Wozu war er eigentlich Ingenieur geworden, hatte er sich in den letzten Jahren immer häufiger gefragt. Sicher nicht, um sein Wissen den Konzernen zur Verfügung zu stellen, die diese Energiemachenschaften aus Gründen der eigenen Selbstbereicherung und der ihrer Aktionäre vorantrieben, hatte er sich diese Frage dann selbst beantwortet. Viel zu lange war er auf der Ölbohrinsel gewesen. Auch wenn er dabei, zugegebenermaßen, sehr gut verdient hatte. Aber jetzt hatte er ein neues Kapitel in seinem Leben aufgeschlagen und sich entschlossen, sein technisches Know-how für etwas Sinnvolleres einzusetzen. Er hatte überlegt und gegrübelt, gelesen und getüftelt, Skizzen ent- und verworfen, bevor er sich auf dem richtigen Weg glaubte: Dieses Grundstück an der Südseite des Valtzower Sees war ideal für eine Siedlung von Ferienhäusern, die ihren Energiebedarf aus Erdwärme und Solarenergie deckten. Zusätzlich hatte er sich über Passivhäuser schlaugemacht, die ganz ohne klassische Heizung auskamen, indem sie mit Wärmeaustauschern arbeiteten und bei denen zusätzlich extradicke Wandisolierungen, kleinere Fenster nach Norden und größere Fenster nach Süden hin eine entscheidende Rolle spielten. An sehr kalten Tagen könnte man auch mit einem Kamin oder einer Holzpelletheizung nachhelfen, auf jeden Fall aber entweder auf innovative, alternative Technologien oder auf nachwachsende, erneuerbare Energie setzen. Oder auf beides. Bas und er fanden die Idee absolut überzeugend. Die Zeit war reif. Sie passte in die Landschaft, in das Konzept des sanften Tourismus, des Naturschutzes. Aber dafür brauchte er das Engagement und die Genehmigung dieses verknöcherten, unflexiblen Bürgermeisters.
Plötzlich erregte etwas auf der anderen Seite des Sees seine Aufmerksamkeit. Severin kniff die Augen zusammen. Auf dem Grundstück des Herrenhauses kam jemand zum Ufer hinunter. Die Entfernung war etwas zu weit, um die Person genau zu erkennen, aber dann trat sie auf den Steg und ging ihn bis zum Ende. Jetzt hatte Severin einen besseren Blick. Es war eine Frau. Sie hatte ein Handtuch um sich gewickelt. Arme, Beine, Gesicht, Hals und Dekolleté leuchteten hell gegen den dunkleren Hintergrund des Grundstücks. Er konnte nicht sagen, ob sie kurze oder lange Haare hatte. Als ob sie seine wortlose Frage beantworten wollte, griff sie sich an den Hinterkopf, löste etwas – vielleicht eine Spange oder eine Klammer –, und eine Flut schwarzer Haare fiel ihr über die Schultern. Dann ließ sie das Handtuch fallen, das sie mit der anderen Hand zusammengehalten hatte. Sie trug einen hellen Bikini, und einen glorreichen Moment sah Severin sie in ihrer ganzen Schönheit: lange Beine, schmale Taille, ein relativ voller Busen, alles weiß und zart schimmernd und in einem atemberaubenden Kontrast zu ihrem Haar. Er duckte sich vorsichtig in den dunklen Blätterschatten des Baumes, unter dem der umgekippte Stamm lag, auf dem er saß.
Es war nicht richtig, die Nichtsahnende wie ein feiger Spanner aus dem Versteck heraus zu beobachten, aber jetzt aufstehen und weggehen? Unmöglich.
Die Frau drehte sich um, so dass sie ihm ihren Rücken, auf den das lange Haar herunterfiel, und ihre runden Hüften zuwandte. Nach Topmodel-Standard war sie etwas zu üppig, zu feminin in ihren Kurven, dachte Severin, aber sie hatte definitiv eine äußerst weibliche Gestalt.
Jetzt begann sie, rückwärts die Badeleiter hinunterzusteigen. Als sie ganz im Wasser war, stieß sie sich von einer Stufe ab. Durch die Abendstille konnte Severin das Geräusch, das die Badende machte, deutlich hören – ein kleiner Aufschrei des kühlen Schreckens, gepaart mit wohliger Erfüllung. Diese Frau war auffallend schön, keine Frage. Aber es war dieser in aller Unschuld ausgestoßene laute Seufzer des Losgelöstseins, der Befreiung, der Severin mitten ins Herz traf. Fasziniert und immer noch unfähig, sich zu bewegen, beobachtete er, wie die Frau quer über den See schwamm, direkt auf ihn zu. Ihre dunklen Haare wehten wie seidige Fäden um ihre Schultern, und wenn sie ihre Arme bewegte, blitzte das helle Weiß ihrer Haut auf, fast wie bei einem Fisch, der sich jäh im Wasser dreht und für den Bruchteil einer Sekunde seinen weißen Bauch zeigt, bevor er wieder in der Tiefe verschwindet.
Inzwischen schwamm sie zwischen blättrigen Inseln von blühenden Seerosen hindurch, und immer geringer wurde die Entfernung zwischen ihr und Severin. Sie kam ihm unwirklich vor, wie eine feenhafte Erscheinung, eine Gestalt aus dem Märchen – eine Seerosenprinzessin. Erst als sie sich umdrehte und wieder zurückschwamm, merkte er, dass er, als sie näher gekommen war, den Atem angehalten hatte.
Er holte tief Luft, blieb aber auf dem Baumstamm sitzen und sah ihr nach, bis sie wieder auf dem Steg stand, sich in ihr Badelaken hüllte und in Richtung Haus verschwand.
Jetzt stand auch Severin auf und griff sich behutsam seinen Sturzhelm. Er ging zu seinem Motorrad, schwang ein Bein über den Sattel und setzte sich. Doch er brachte es nicht über sich, den Zauber des Abends sofort zu durchbrechen. Stattdessen wartete er auf eine Bewegung, auf ein Türenschlagen oder ein jäh angehendes Licht auf der anderen Seite. Aber nichts passierte. Endlich ließ er den Motor an. Das laute Geräusch durchbrach die Stille. Aber lauter noch klang der märchenhafte Anblick der geheimnisvollen Badenden in ihm nach. Er fuhr langsamer als sonst, spürte die Vibrationen der Maschine deutlicher in seinem Körper, fühlte den Fahrtwind auf seiner warmen Haut kühler, frischer.
Als er wenig später über den Steg zu seinem Boot ging, hielt er einen Moment vor Bas’ Tür an. Bei ihm brannte Licht. Sollte er noch auf ein Bier bei ihm vorbeischauen, mit ihm reden? Lieber nicht, entschied Severin. Vielleicht war er nicht allein, und selbst wenn, konnte er ihm schlecht beschreiben, was diese Fremde in ihm ausgelöst hatte. Bas war ein Mann der Tat – »Du findest sie schön? Dann musst du sie haben!« –, und das traf nicht ganz das, was er in diesem Moment empfand. Zwar auch, aber nicht nur.
Er setzte sich an Deck und starrte in die Dämmerung. So überwältigend hatte er eine Frau zum letzten Mal gefunden, als er fünfzehn war. Sie war auf dasselbe Internat gegangen wie er. Wie hieß dieses Mädchen noch? Caroline? Richtig, »sweet Caroline«.
Unbewusst summte er die ersten Takte des Oldies von Neil Diamond.
Wochenlang war sie ihm nicht aus dem Kopf gegangen. Ihr Bild war das erste, das er morgens vor Augen hatte, und das letzte, wenn er abends schlafen ging, und das in dem gewaltigen Auf und Ab der Pubertät. Schwierig, schwierig. Er hatte geduldig und völlig umsonst gewartet.
Hoffentlich ging es ihm mit dieser Seerosenprinzessin nicht genauso. Schließlich war er nicht mehr fünfzehn, sondern inzwischen dreiunddreißig. Anfang September sogar vierunddreißig. Irgendwie war es allmählich an der Zeit, gefühlsmäßig anzukommen, fand er. Die Beziehungen, die er in den letzten Jahren zwischen Bohrinsel und Festland gehabt hatte, hatten ihn emotional längst nicht so berührt, wie sie es hätten tun sollen.