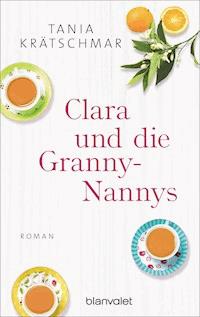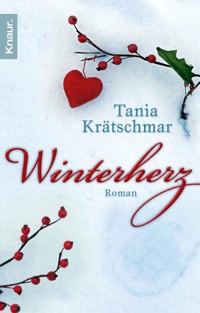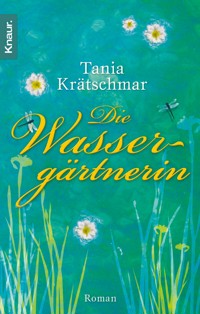5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Duft von weißen Rosen, eine alte Gärtnerei und ein schicksalhaftes Erbe …
Als Nora und ihre drei Freunde eine verlassene Gärtnerei in der Mark Brandenburg entdecken, beschließen sie: Sie werden die verkrauteten Beete beackern, die maroden Gewächshäuser bepflanzen und sich hier ihr eigenes Paradies schaffen. Doch die Verwaltung findet das nicht akzeptabel und sperrt die vier aus. Ist der Traum verblüht? Keineswegs: Kurzerhand besetzen Nora und die Novemberrosen die alte Gärtnerei. Plötzlich sprießen Schlagzeilen, die Zahl ihrer Unterstützer wuchert – auch wenn das verwunschene Grundstück das Geheimnis seiner Vergangenheit noch längst nicht preisgegeben hat …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 412
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Buch
Berlin im April. Nora und ihre drei Freunde Udo, Ellie und Margarete entdecken bei einem Ausflug durch Zufall eine verfallene Gärtnerei in der Mark Brandenburg: Zwei Gewächshäuser, bei denen die meisten Scheiben fehlen, ein Backsteingebäude, ein Brunnen, eine Heizungsanlage, auf deren Schornstein Störche nisten. Sie können sich dem Charme der Lage, des romantischen Verfalls und vergangenen gärtnerischen Flairs nicht entziehen, besonders Fanny, Noras siebenjährige Tochter, ist restlos begeistert. Was sehr seltsam ist: Es gibt in den Ämtern keine Unterlagen, wem das Gelände gehört. An einem maibowleseligen Abend wird plötzlich ein tollkühner Gedanke geboren: Wenn die Gärtnerei niemandem gehört, dann gehört sie doch auch allen, oder? Sie machen sich zusammen ans Werk, der Gärtnerei zu neuem Glanz zu verhelfen – doch natürlich stoßen sie auf Widerstände, und auch das verwunschene Grundstück birgt noch das eine oder andere Geheimnis aus seiner Vergangenheit …
Autorin
Tania Krätschmar wurde 1960 in Berlin geboren. Nach ihrem Germanistikstudium in Berlin, Florida und New York arbeitete sie als Bookscout in Manhattan. Heute ist sie als Texterin, Übersetzerin, Rezensentin und Autorin tätig. Sie hat einen Sohn und lebt in Berlin.
Von Tania Krätschmar bei Blanvalet bereits erschienen:
Eva und die Apfelfrauen ∙ Clara und die Granny-Nannys
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvaletund www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Tania Krätschmar
Nora und die Novemberrosen
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2016 by Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de
Umschlagmotiv: living4media/Peter Raider; living4media/IBL Bildbyra AB/Angelica Söderberg; www.buerosued.de
Redaktion: Margit von Cossart
LH ∙ Herstellung: kw
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-16673-1V002
www.blanvalet.de
Es gibt Augenblicke,
in denen eine Rose wichtiger ist
als ein Stück Brot.
RAINER MARIA RILKE
Prolog
»Lilianne! Komm endlich!«
Scharf schnitt die Stimme der Mutter durch den grauen Novembermorgen. Aber Lilianne hörte es nicht. Weil sie es nicht hören wollte. Sah ihre Mutter nicht, was sie gerade tat?
Vorsichtig trat sie die Rose fest, die sie gepflanzt hatte. Der Vater hatte ihr erklärt, wie sie es machen musste. Wie tief das Loch sein sollte und dass die Veredelungsstelle – das war die, wo die Rose dick und knotig war – fünf Zentimeter unter der Erdoberfläche liegen musste. Als ob sie das nicht schon wüsste! Schließlich hatte sie ihn oft genug dabei beobachtet, wie er Rosen pflanzte.
Das Loch zu graben war anstrengend gewesen. Trotz der Kälte war ihr ganz heiß. Aber nun stand die Rose da, wo sie hingehörte – hinter den beiden Gewächshäusern, deren Glasscheiben beschlagen waren. Nicht weit von der hohen Ligusterhecke, die mit ihren immergrünen Blättern eine dunkle Wand in die neblige Landschaft zeichnete.
Neben Lilianne lag ihr Spaten, den der Vater ihr zum siebten Geburtstag geschenkt hatte. Fast ein Jahr war das nun schon her. Das Spatenblatt war kleiner und der Stiel kürzer als bei den schweren Spaten, mit denen die Arbeiter in der Gärtnerei werkelten. Seit Lilianne ihr eigenes Gartenwerkzeug besaß, durfte sie dem Vater helfen.
Sie wanderte gern mit ihm zwischen den Beeten umher und durch die Gewächshäuser. In einem war es immer so warm und feucht, dass dort die allerschönsten Blumen wuchsen – Callas, Orchideen und Lilien. Tropische Pflanzen waren das.
Im zweiten Gewächshaus war es ein bisschen kühler, es war allein für die Rosen ihres Vaters reserviert. Nicht für Rosen, die nackt und sparrig waren wie die, die sie gerade gepflanzt hatte, sondern für edle langstielige Teerosen, die gehegt, gepflegt und unter künstlichem Licht gezogen wurden. Wenn die Blüten groß, aber noch fest geschlossen waren, kam Frau Fritsch. Sie schnitt sie sorgfältig und band sie zu wunderschönen Sträußen. Dann wurden sie nach Berlin gefahren, zu diesen großen, lauten Veranstaltungen, die ihr Vater manchmal im Radio verfolgte. »Damit die Leute wenigstens etwas Schönes sehen, wenn sie schon diesen Brüllaffen hören müssen«, hatte er einmal gesagt.
Ob dieser Brüllaffe auch schuld war an den vielen Glasscherben in der Stadt? Lilianne fand es gemein, nachts die Schaufenster zu zerschlagen. Nicht auszudenken, wenn das mit ihren Gewächshäusern passieren würde! Zum Glück waren sie weit von Berlin entfernt.
Wenn Lilianne mit ihrem Vater zusammen durch die Gärtnerei ging, brüllte niemand. Im Frühling und Sommer hörte man die Vögel zwitschern. Manchmal riefen die Arbeiter einander etwas zu, ein Tontopf schepperte, und die Pumpen surrten. Im Herbst und Winter kam noch das Knacken der Heizungsrohre in den Gewächshäusern hinzu. Aber brüllen, nein, brüllen tat keiner.
Tag für Tag lauschte Lilianne den leise gemurmelten Kommentaren des Vaters und versuchte, sich so viel wie möglich davon zu merken. Alles, was er ihr über Pflanzen, Stauden und Gewächse beibrachte, interessierte sie. Sie sog das Wissen auf und hütete es wie einen Schatz. Manchmal sagte der Vater, in ihren Adern fließe kein Blut, sondern Pflanzensaft. Wie bei einer der zarten Birken, die hinter dem Zaun wuchsen. Dann lächelte er und drückte ihre Hand.
Und heute Morgen, nach dem Frühstück, hatte er etwas sehr Seltsames getan. Er hatte sie gefragt, ob sie eine Rose pflanzen wolle, sie ganz allein! Sie kenne sich damit doch schon aus, sie sei schließlich seine kleine große Gärtnerin, hatte er sie ermutigt. Seine Stimme hatte ein bisschen rau geklungen, als er ihr die kahle Pflanze gegeben und gesagt hatte: »Sie ist wurzelnackt, aber stämmig und gesund. Sie hat viele Augen, und im nächsten Sommer wird sie schneeweiß blühen. Sie ist robust, viel kräftiger als die Rosen im Gewächshaus. Du wirst sehen, Lilianne, das wird eine Schönheit, die uns alle überlebt! Eine Schönheit wie du eine bist, mein Mädchen.« Dann hatte er sie an sich gezogen und ihr mit einem schwieligen Finger über die Wange gestrichen.
Die Rose würde Triebe haben und irgendwann ihren Platz vor der dunklen Hecke erhellen wie ein vom Himmel gefallener Stern. Lilianne konnte es kaum erwarten, aber sie wusste, dass eine Gärtnerin Geduld haben musste.
»Wachse schön«, flüsterte sie dem kleinen Rosenstock zu und berührte rasch, wie zur Bestätigung, den Anhänger an der feinen goldenen Kette, die sie um den Hals trug.
Das Schmuckstück hatte ihrer Großmama Ava gehört. Als sie vor zwei Jahren gestorben war, hatte ihre Mutter es ihr, Lilianne, angelegt, und seitdem trug sie es jeden Tag. Nur neulich, als ihre Eltern so ernst mit ihr gesprochen hatten, hatte sie es ablegen wollen. Aber dann hatte sie es sich anders überlegt. Wenn jemand darauf starrte, was in der letzten Zeit ein paarmal passiert war, ließ sie es rasch unter der Bluse verschwinden.
Lilianne griff nach ihrer kleinen Zinkgießkanne und begann, die Rose zu gießen. Während sie beobachtete, wie das Wasser in der Erde versickerte, warf sie gedankenverloren ihre dicken, dunklen Zöpfe zurück. Der eine verfing sich an der Kette. Lilianne zerrte ein bisschen daran, dann war er befreit.
»Kind, hörst du nicht? Ich habe gesagt, du sollst endlich kommen!«
Sie zuckte zusammen. Sie hatte ihre Mutter nicht kommen hören. Jetzt stand sie direkt hinter ihr und schloss ihre Hand so fest um Liliannes Handgelenk, dass sie die Gießkanne fallen ließ.
»Mutti, ich bin noch nicht ganz fertig«, protestierte sie, aber die Mutter zog sie einfach fort, kümmerte sich nicht um Spaten und Gießkanne, die im abgestorbenen Gras liegen blieben.
»Wir müssen los«, erklärte sie kurz angebunden.
Lilianne stolperte in ihren Holzpantinen neben ihr her. Kasimir sauste an ihnen vorbei – der dicke Kater hatte sicher wieder im Gewächshaus auf Mäuse gelauert. Sie schaute ihm nach, wie er in Richtung Haus rannte. Er durfte nicht hinein, oder? Fragend schaute sie die Mutter an.
Da erst sah sie, dass die Mutter nicht wie üblich ihre grüne Küchenschürze, sondern ihren Wintermantel trug. Und Handschuhe. Und ihren grauen Hut, den mit der hochgeklappten Krempe und der Filzblume an der Seite.
»Wohin gehen wir denn?«, fragte Lilianne und wusch sich an dem Wasserhahn neben der Terrasse gebückt die Hände.
Die Kälte biss. Schnell trocknete sie sich an dem groben Handtuch ab, das danebenhing, dann zog sie die gestrickten Strümpfe hoch, die immer rutschten. Sofort musste sie sich kratzen. Die Wolle juckte immer so unangenehm. Der Tag im Frühling, ab dem sie endlich wieder mit nackten Beinen gehen durfte, war einer der schönsten im ganzen Jahr.
»Wir fahren zum Bahnhof«, sagte die Mutter und deutete auf Liliannes braune Schuhe, die in der geöffneten Terrassentür standen.
Gehorsam schlüpfte sie aus den Holzpantinen und in die Schuhe hinein, band die Schnürsenkel, nahm ihren Mantel, den dunkelblauen mit dem kleinen Samtkragen. Er lag auf einer gepackten Reisetasche. Sie war so voll, dass das schwere Tuch sich nach außen wölbte.
»Verreisen wir denn? Ihr habt gar nichts gesagt«, fragte Lilianne verwundert.
Die Mutter antwortete nicht, schüttelte nur den Kopf, nahm die Reisetasche und griff nach Liliannes Hand. Zusammen gingen sie um das Haus herum zur Einfahrt, wo die dunkle Limousine stand.
Im ersten Stock wurde ein Fenster geöffnet. Hinter der Gardine war schemenhaft eine Person zu sehen. Sie regte sich nicht.
Der Motor des Wagens lief bereits. Hans, einer der Arbeiter der Gärtnerei, schnallte gerade einen braunen Lederkoffer hinten auf der Kofferbrücke fest. Er hievte auch die Reisetasche hinauf, dann stieg er ein und setzte sich hinter das Lenkrad. Sonst brachte er Lilianne immer mit seinen Scherzen zum Kichern, heute drehte er sich nicht mal zu ihr um, als sie in den Fond des Wagens kletterte. Wortlos starrte er durch die Windschutzscheibe.
»Wo ist denn Vati? Kommt er nicht mit?«, fragte Lilianne. Sie hatte noch nie erlebt, dass jemand anderes als ihr Vater den Horch fuhr.
Wieder erhielt sie keine Antwort von der Mutter, die jetzt neben Hans Platz nahm.
»Ich will zu Vati! Er hat meine Rose noch gar nicht gesehen!«
Unruhig griff Lilianne nach ihrer Kette, ließ die zarten Goldglieder durch die Finger gleiten und suchte nach ihrem Anhänger, um ihn fest mit der Faust zu umschließen – wie sie es häufig tat, wenn sie über etwas nachdachte oder wenn sie Trost brauchte. Wenn Fräulein von Maltzahn ihr beim Klavierüben auf die Finger schlug, weil sie die falsche Taste erwischt hatte. Oder wenn ihre Freundinnen nicht mehr mit ihr spielen wollten, wie es in letzter Zeit manchmal passiert war.
Aber der Anhänger war nicht da, wo er hätte sein sollen.
»Mutti, er ist weg! Mein Anhänger, er ist weg! Vorhin hatte ich ihn noch! Ich geh und such ihn!«
Lilianne stieß die Tür wieder auf und wollte aus dem Wagen schlüpfen, die Mutter hingegen drehte sich um und hielt sie zurück.
»Das geht nicht, Lilianne. Schließ die Tür. Wir sind spät dran«, sagte sie mit gepresster Stimme.
»Aber Mutti«, jammerte Lilianne. »Es ist mein Glücksanhänger! Ich habe ihn bestimmt beim Pflanzen verloren.«
»Mach sofort die Tür zu!«, befahl die Mutter. »Fahren Sie, Hans«, sagte sie dann zu dem Mann am Steuer, ohne weiter auf Lilianne einzugehen.
Erschrocken schloss Lilianne die Wagentür. Warum war ihre Mutter heute so streng zu ihr? Warum durfte sie ihren Anhänger nicht suchen?
Sie verstand nicht, was das alles bedeutete, und spürte, wie ihr die Tränen in die Augen stiegen. Aber sie wollte nicht weinen. Sie war fast acht Jahre alt, sie hatte allein eine Rose gepflanzt!
Lilianne versuchte, die Tränen herunterzuschlucken, und schaute wie zum Trost aus dem Rückfenster des Wagens. Dort, hinter den Gewächshäusern, stand ihre Rose, irgendwo da musste sie ihren Stern verloren haben. Wenn sie zurückkam, würde sie sofort danach suchen. Sie würde es nicht vergessen. Egal, wie lange diese Reise dauerte.
Langsam rollte der Wagen los. Die Räder drückten sich schwer in den hellen Kiesweg der Auffahrt. Kein Unkraut duldete Vater dort. Ein Arbeiter öffnete das Tor, legte die Hand grüßend an die Mütze, als sie ihn passierten. Sie fuhren den Weg entlang, auch er peinlich akkurat von Wildwuchs befreit. Er ist unser Weg in die Zivilisation, sagte Liliannes Vater immer. Wir dürfen nicht riskieren, dass er uns verloren geht.
Sie fuhren weiter, und hinter ihnen verschwand die Gärtnerei im Novembergrau.
Stille herrschte. Einen Moment lang rührte sich nichts im Haus. Dann bewegte sich der Schatten des Mannes, der im ersten Stock am Fenster stand. Er verlor sich in der Dunkelheit des Hauses.
1. Kapitel
Es gab Tage, an denen Nora ihren Job mochte, und Tage, an denen sie ihn hasste. Aber nie war er für sie etwas anderes als ein Brotjob, der sie und Fanny mehr recht als schlecht ernährte. Als Gärtnerin hatte sie einen anderen Traum, als in der Blumenabteilung eines kleinen Baumarktes schnell hochgezogene Pflanzware zu verkaufen wie lebende Wegwerfprodukte.
Gelegentlich beriet Nora Kunden, die echtes Interesse an Pflanzen hatten. Das war dann ein guter Tag für sie. Der heutige dagegen schien ein ausgesprochen schlechter Tag zu werden. Was an der üppigen, stark geschminkten Blondine lag, die vor ihr stand und auf sie einredete, die Arme in die Hüften gestemmt, sodass sie in ihrem Leopardenprintmantel aussah wie ein umgedrehter Ethnoregenschirm.
»Haben Sie nicht verstanden, was ich will?«, fragte sie herausfordernd.
Nora nickte und steckte die Hände tief in die Taschen ihrer grünen Arbeitsweste, um der Versuchung zu widerstehen, sich die kurzen dunklen Locken zu raufen. Sie hatte sich das während ihrer Lehre angewöhnt, nachdem der Chef öfter mal kritisch ihre Hände gemustert und gutmütig »Vielleicht mal die Nägel bürsten, Dittbrenner …« gesagt hatte.
»Doch, ich habe genau verstanden, was Sie wollen. Sie möchten für Ihren Balkon Pflanzen, die jetzt, im März, blühen, die auch im Sommer und im Herbst blühen und im nächsten Frühjahr immer noch. Oder schon wieder.«
Die Frau nickte. »Genau. Und warum sind Sie nicht in der Lage, mir so etwas zu verkaufen? Warum arbeiten Sie hier eigentlich? Kennen Sie sich nicht aus, oder was?«
»Doch, ich kenne mich aus. Deshalb kann ich nur wiederholen: So eine Pflanze werden Sie nicht finden! Wenn Sie noch etwas warten, können Sie Geranien oder Petunien oder Husarenknöpfchen pflanzen. Oder etwas Ähnliches. Sommerblüher, jedenfalls. Damit haben Sie zumindest von Mai bis zum Frost Spaß.«
»Warum verkaufen Sie sie mir nicht?«
»Wir haben sie noch nicht geliefert bekommen. Und selbst wenn, wäre es jetzt nicht das Richtige für Ihren Balkon, der, wie Sie erklärt haben, ungeschützt im siebten Stock liegt. Wenn es noch Nachtfröste gibt, dann sind die Blumen gleich hin. Oder Sie müssen sie mit einer Folie abdecken, um sie zu schützen.«
Die Kundin sah sie an, als wäre jede Form von Nachtfrost Noras persönliche Schuld. »Und was ist das Gelbe und Blaue hier? Das blüht doch sehr hübsch! Warum bieten Sie mir die denn nicht an?«
Sie wies auf die großen Holztische im Freibereich, auf denen Töpfe mit Primeln und Narzissen, Stiefmütterchen, Vergissmeinnicht und Bellis dicht an dicht standen.
Nora atmete tief durch. »Das sind Frühlingsblüher. Die sehen im Sommer nach gar nichts mehr aus. Jedenfalls nicht gut. Die möchten Sie nicht, wenn Sie länger als Juni etwas davon haben wollen. Das können Sie mir glauben.«
»Schön.« Die Frau nickte resolut. »Dann möchte ich Rosen. Die blühen doch das ganze Jahr, oder? Sonst würde man sie ja nicht noch im Winter in den Blumengeschäften bekommen.«
Nora hörte irgendetwas knacken. Wahrscheinlich war es der Zweig, an dem ihre Geduld hing. »Rosen möchten Sie also? Was denn für Rosen? Strauchrosen? Teerosen? Historische Rosen? Kletterrosen? Moosröschen? Hundsrosen oder lieber Essigrosen?«
Einen Moment lang sah die Kundin sie unsicher an, dann zuckte sie blasiert mit den Schultern.
»Rosafarbene Rosen«, erwiderte sie. »Nun stellen Sie sich doch nicht so dumm an. Sie werden ja wohl wissen, was eine rosa Rose ist!«
»Na, dann kommen Sie mal mit«, sagte Nora zu der Kundin, wandte sich ab und lief zügigen Schrittes quer durch den Baumarkt. Es war ihr völlig egal, ob die Leopardenkuh Schritt halten konnte. Als sie an ihrem Ziel angekommen war und sich umdrehte, war sie leider noch da. »Hier. Bitte bedienen Sie sich.« Nora wies auf bunt blühende Pflanzen und Grüngewächse, die ohne ersichtliche Ordnung auf einem hohen Regal standen – Orchideen, Callas, Tulpen, Efeu, Lilien und … Rosen. »Das ist das Richtige für Sie! Die Blumen hier blühen das ganze Jahr über, und pflegeleicht sind sie auch. Da stehen Rosen. Sogar rosafarbene! Und so prächtige! Schauen Sie nur!«
Die Kundin sah sie ungläubig an. Sie trat auf die Blumenpracht zu und befühlte ein Blütenblatt, dann wandte sie sich wieder Nora zu und funkelte sie wütend an.
»Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? So eine Unverschämtheit! Das sind doch Seidenblumen! Ich will etwas Natürliches auf meinem Balkon! Wie soll ich denn sonst im Einklang mit der Natur leben?«, protestierte sie.
»Ich habe keine Ahnung, mit wem Sie im Einklang leben«, schnappte Nora. »Aber mit der Natur bestimmt nicht.«
Sie drehte sich auf ihren grünen Birkenstockschlappen um und ging zurück in den Freibereich des Gartencenters. Ungehalten begann sie, die Balkonerden, die gerade geliefert worden waren, auf die Paletten zu wuchten – ordentlich nach der Größe gestapelt: fünf Liter, zehn Liter, zwanzig Liter … Nur einmal unterbrach Nora sich schwer atmend und warf einen raschen Blick in Richtung Innenraum, zur Kasse. Die Frau war nirgends zu sehen. Wahrscheinlich war sie beleidigt rausgerauscht. Es hätte Nora nicht gleichgültiger sein können. Sie war geduldig, bestimmt. Aber sie ließ ihre Gärtnerseele nicht mit Füßen treten!
Als sie kurz nach sechs im Bus in Richtung Schmargendorf saß – sie hatte die erste Schicht gehabt, der Kollege musste bis zur Schließung um neun Uhr bleiben –, dachte sie noch einmal an die unmögliche Kundin, und warum sie sich von deren idiotischen Antworten so hatte reizen lassen.
Der Bus überquerte gerade die Halenseebrücke, unter der eine S-Bahn in Richtung Westkreuz rauschte, als Nora die Erleuchtung hatte. Diese Frau verkörperte alles, was in ihrem Leben nicht stimmte. Sie wollte im Freien arbeiten, wollte kreativ sein, wollte sich um Pflanzen kümmern, wollte interessierten Menschen den Wert des Wachsens und Gedeihens vermitteln, wollte Respekt für ihre Tätigkeit und Respekt für die Pflanzen. Stattdessen verkaufte sie Tag für Tag, was immer es gerade billig auf dem Markt gab, egal, wie lange die Pflanzen überleben würden.
Sie hasste es, und sie sah keinen Ausweg. Doch es gab einen Menschen auf der Welt, für den sie das tat. Für Fanny.
»Mama, ich und Ellie haben vorhin Wiener Schnitzel gemacht. Erst das Fleisch plattgeklopft, dann in Mehl gewendet, dann in Ei, dann in Bröseln. Dann gebraten, in ganz viel Fett. Und dann haben wir noch ein Kinderschnitzel für mich gemacht, nur aus dem Rest Ei und Semmelbrösel«, plapperte Fanny los, kaum dass Margarete die Tür geöffnet hatte. Temperamentvoll hüpfte die Kleine auf und ab. »Ellie hat gesagt, du bekommst was ab. Zum Abendbrot. Hast du Hunger?«
Mit Begrüßungen hielt Noras siebenjährige Tochter sich nicht lange auf. Das war so typisch für sie. Sie tat alles im Hier und Jetzt, wollte alles sofort und gleich und unterstrich das mit ihrer gesamten zierlichen Körperlichkeit.
Nora schüttelte den Kopf und strich ihr über das Haar, das lockig und kurz wie ihr eigenes war, nur ein paar Schattierungen heller. »Hi, meine Süße. Nein, ich möchte jetzt nichts essen. Lieber nachher. Oben.«
»Gib deiner Mutter fünf Minuten zum Verschnaufen«, sagte Margarete. »Na, einen anstrengenden Tag gehabt?«, fragte sie Nora.
Auf ihrem runden, für eine Frau in den Siebzigern erstaunlich faltenfreien Gesicht, erschien ein prüfender Ausdruck, während sie sich das glatte mahagonifarbene Haar hinters Ohr strich. Ein Besuch in Chris’ Frisierstube gehörte für sie alle sechs Wochen zum Programm: Färben und Schneiden, bitte.
»Das kann man wohl sagen. Ich sollte froh sein, dass die Gartensaison bald wieder losgeht, aber ich … Ach, ich weiß auch nicht.«
Margarete mit ihren Selbstzweifeln zu belasten war das Letzte, was Nora wollte. Es verging kein Tag, an dem sie nicht dankbar für die kleine Hausgemeinschaft war, die sich um Fanny kümmerte. Ohne die drei hätte sie ihr Leben als Alleinerziehende nicht geschafft. Bis vor zwei Jahren war auch noch Udos Frau Anne dabei gewesen, die liebevollste Ersatzomi, die man sich hatte vorstellen können. Aber dann war Anne überraschend gestorben. Lungenkrebs.
Sie alle hatte das Tempo ihres Verfalls erschrocken, für Udo war es natürlich am schlimmsten gewesen. Zuerst hatte er sich völlig von ihnen zurückgezogen, aber das war in einem Haus, in dem es nur vier Parteien gab, schwierig. Und er hatte sie auch gebraucht, gerade in der Anfangszeit seines neuen Alleinseins. Inzwischen trauerte er etwas weniger, aber noch immer ging er jeden Tag auf den Friedhof. Anne besuchen, wie er es nannte.
Am Anfang hatte er Fanny gelegentlich dorthin mitgenommen. Nora hatte es nicht gern gesehen. Denn danach hatte Fanny immer die merkwürdigsten Fragen gestellt: Wie sieht man aus, wenn man lange in der Erde gelegen hat? Was geht eher kaputt, Knochen oder Holz? Wie lange dauert es, bis die Würmer einen aufgefressen haben? Essen sie das Weiche zuerst? Wie lange wirst du leben, Mama?
Sie hatte die Fragen interessiert und ganz unemotional gestellt. Aber jedes Mal wurde Nora daran erinnert, dass sie die beiden Letzten der Familie Dittbrenner waren. Dass Udo, seit Fanny in die Schule ging, Anne immer allein besuchte, empfand sie als Erleichterung.
»Morgen wieder?«, fragte Margarete. Sie wussten beide, dass es eine Routinefrage war. Was sonst hätte Nora mit ihrer Tochter machen sollen.
»Ja, bitte. Morgen habe ich ja Samstagsdienst.«
Margarete nickte. »Fein! Fanny, holst du mal das Schnitzel für deine Mama?« Fanny flitzte in die Küche. »Wir haben gedacht, wir könnten mit unserer Kleinen mal einen Ausflug machen«, wisperte Margarete. »In das Dorf in der Mark Brandenburg, in dem Anne geboren wurde. Udo hat es vorgeschlagen. Ist das okay für dich?«
Nora zögerte einen Moment. Dann gab sie sich einen Ruck. »Natürlich. Da wird sie sich freuen!«
Margarete strahlte. »Wir haben so viel Spaß mit ihr! Udo fährt. Er ist manchmal ein bisschen … Aber wir passen auf. Mach dir keine Sorgen. Wir sagen ihm, wann er überholen darf. Und wann er bremsen soll. Ah, da bist du ja, Schatz. Hör mal, Fanny, wir machen morgen einen Ausflug.«
Fanny quietschte begeistert auf. »Wohin denn?«
»Ins Umland von Berlin.«
»Mit einem Picknick?«
»Aber natürlich! Sonst wäre es doch kein Ausflug. Du kommst morgen früh runter, und dann packen wir alles zusammen ein. So toll, wie du das Schnitzel eingewickelt hast!«
Fanny hatte mindestens eine halbe Rolle Küchenpapier um das Schnitzel gewickelt, sie trug das weiße Paket unter den Arm geklemmt.
»Kommst du auch mit, Mama?«, fragte sie.
Nora schüttelte den Kopf. »Nein, ich muss arbeiten. Aber ihr habt sicher eine wunderbare Zeit. Tschüs, Margarete. Bis morgen.«
Fanny bekam von Margarete einen raschen Abschiedskuss, dann schloss sich die Tür.
Was Fanny tat, machte sie gründlich. Das galt fürs Einwickeln. Das galt für ihr größtes Hobby, das Sachensuchen auf der Straße, in Parks und im Wald, wo sie merkwürdige Dinge auflas, die nur für sie Bedeutung hatten. Und ganz offensichtlich galt es seit Neuestem auch fürs Schnitzelbraten unter Ellies Anleitung.
Ellie war eine begnadete Köchin. Seit wann brachte sie wohl auch Fanny das Kochen bei? Nora stieg müde die Treppe hoch. Neben ihr hüpfte Fanny über die Stufen. Hatte sie da wieder etwas verpasst? Wie so oft in Fannys Entwicklung?
Als sie gut acht Jahre zuvor schwanger geworden war, hatte sie gewusst, dass sie ihr Kind allein großziehen und dass das nicht leicht sein würde. Es war eine Sommerliebe gewesen, eine flüchtige Beziehung mit einem charmanten Mann. Der nur noch flüchtig und überhaupt nicht mehr charmant war, als Nora auf Unterhalt für Fanny bestanden hatte.
Mittlerweile waren die monatlichen Zahlungen das Einzige, was sie noch von ihm bekam. Für Fanny war er praktisch nicht existent und für Nora nur eine monatliche Zahl auf ihrem Kontoauszug. Wenn auch eine sehr willkommene, die ihrer Tochter ja auch zustand.
Sie schloss die Tür auf, und Fanny sauste mit dem Schnitzelpäckchen in die Küche. Dann verschwand sie in ihrem Zimmer.
»Kann ich noch spielen?«, rief sie, aber Nora bezweifelte, dass sie ihr Ja noch hörte. Sie setzte die Tasche ab, hängte ihre Jacke auf und schlüpfte aus den Schuhen.
Ah, zu Hause zu sein! Das Haus, in dem sie wohnte, war nicht groß. Und schön war es auch nicht. Eingeklemmt stand es zwischen den repräsentativen sanierten Altbauten, schmal und niedrig, ein vergessener Sechzigerjahre-Bau, hellhörig und feucht, wenn nicht ständig gründlich gelüftet wurde. Längst schon hätte die Heizungsanlage ausgewechselt werden müssen – ihre drei Zimmer wurden im Winter selten richtig warm.
Aber das Haus lag in einer schönen, ruhigen Straße im bürgerlichen Bezirk Schmargendorf. Es war ein Stückchen heile Welt, und das war genau das, was Nora für sich und Fanny brauchte. Der Grunewald, in dem sie am Wochenende oft spazieren gingen und Sachen suchten (Fanny), war nicht weit, die Grundschule, wo Fanny die zweite Klasse besuchte, lag um die Ecke, und die Miete war erschwinglich. Besitzer Stegemann, ein älterer Herr aus Süddeutschland, machte sich offenbar nicht allzu viel aus Geld. Sie konnte nur hoffen, dass das so blieb.
Es war ein Glücksfall gewesen, dass Nora die Wohnung vor sechs Jahren bekommen hatte. Und noch ein größerer Glücksfall, dass Margarete, Ellie, Udo und Anne sie und die damals einjährige Fanny, die mehr Temperament als eine ganze Zirkustruppe hatte, mit offenen Armen aufgenommen hatten. Ja, da hatte sie tatsächlich einmal Glück gehabt. Fanny entwickelte sich prächtig und hatte Menschen um sich herum, die sie liebten und die sich um sie kümmerten. Sie selbst war Mitte dreißig und gesund. Sie hatte ein Nest für sich und ihre Tochter. Und wenn nichts Außergewöhnliches passierte, reichte das Geld für sie beide, jeden Monat wieder.
Nora nahm Teller und Besteck aus dem Küchenschrank. Sie stellte alles auf den Küchentisch, wickelte das Schnitzel aus – ein Berg von weißem Küchenpapier blieb zurück –, setzte sich hin und begann zu essen.
Manchmal war das Leben als Singlemutter allerdings furchtbar anstrengend. Neben Job und Fanny blieb ihr fast nur der Kontakt zu den Leuten im Haus. Sie hatte keinen Freund. Einen zu finden war nicht leicht. Nora hatte überhaupt keine Lust, sich auf Singlebörsen im Netz herumzutreiben und ihr bisschen Freizeit auf Dates mit Fremden zu verschwenden.
Und selbst wenn eines Tages jemand in den Gartenmarkt kommen, sie strahlend ansehen und erklären würde, dass sie die Richtige für ihn sei und er der Richtige für sie: Eine Beziehung zu pflegen erschien ihr viel schwieriger, als das bisschen Einsamkeit auszuhalten. Es hatte bisher einfach noch nie funktioniert.
Was Noras Job anging … Als sie die Lehre begonnen hatte, hatte sie von einem selbstbestimmten Leben mit dem Geruch von Erde und viel Grün geträumt. Ihre Eltern waren pikiert gewesen. Sie habe doch Abitur, warum sie nicht wenigstens Biologie studiere, hatten sie, beide Lehrer, gefragt.
Doch das wollte Nora nicht. Sie wollte nicht studieren, sie wollte alles über Pflanzen lernen und es umsetzen, wollte mit den Händen arbeiten, wollte den Spaten in die Erde rammen und sich das verlorene Paradies zurückerobern. Sie hatte vorgehabt zu sparen, den Meister zu machen und dann ihre eigene Gärtnerei zu eröffnen. Das war der Plan gewesen. Damals war Nora jung gewesen. Und vielleicht gehörte das auch zum Erwachsenwerden – sich von seinen Träumen für immer zu verabschieden.
Denn dann hatte sie Fanny bekommen, und damit war es mit diesen Plänen erst mal vorbei. Wir haben es dir ja gleich gesagt, hatten ihre Eltern ihr wortlos zu verstehen gegeben, wenn sie sich mal gesehen hatten. Oft war es nicht gewesen. Die beiden waren früh pensioniert worden und hatten auf La Palma gelebt, bis ein betrunkener Busfahrer ihren Wagen zu spät gesehen hatte. Fünf Jahre war das her.
Nora war Selbstmitleid fremd. Jammern half nicht. Worüber auch? Aber manchmal hatte sie das Gefühl, dass sie diejenige war, die beim Lotto immer zielsicher die Zahlen direkt neben den Gewinnerzahlen tippte. Eine, vor der der Schalter gerade geschlossen wurde, auch wenn sie schon eine Stunde gewartet hatte. Die sich immer in den falschen Mann verguckte. Die zu spät kam. Oder sogar am falschen Tag, weil die Mail mit dem veränderten Datum in einem Junk-Ordner gelandet war, auf dem ihr Name stand.
2. Kapitel
Es war ein strahlend schöner frischer Märztag, wie gemacht für eine Landpartie. Nur der Fahrer fehlte.
»Wo bleibt Udo denn? Wir wollen doch los«, sagte Ellie.
Ungeduldig strich sie sich die Locken zurück. Ihr ganzes Leben lang hatte sie mit ihrer krausen Mähne gekämpft, hatte die Leute gehasst, die sie »aufgeplatztes Sofakissen« genannt hatten. Es hatte sie viele Jahre gekostet, sich mit der Unmöglichkeit anzufreunden, ihre Frisur zu bändigen. So richtig war ihr das erst im Alter gelungen, vielleicht, weil ihr Haar jetzt dieselbe Farbe wie ihre Augen hatte – silbergrau.
Trotz der Sonne war es empfindlich kühl, der Märzwind pfiff durch die Straße. Ellie schlug sich den Kragen ihrer dunkelblauen Windjacke hoch.
Margarete hatte ebenfalls auf praktische Kleidung gesetzt, wenn auch mehr in ihren Farben Beige und Braun, registrierte sie mit einem raschen Blick auf ihre beste Freundin.
Margarete war immer schon die damenhaftere von ihnen gewesen. Sie trug grundsätzlich bis Mitte Mai Lederhandschuhe in derselben Farbe wie ihre Schuhe. So auch heute. Sie war bildungsbeflissen, perfekt organisiert und mit der guten Rente ihres verstorbenen Mannes gesegnet.
Am ersten Tag seines Ruhestandes hatte Harald die Augen für immer geschlossen, als wäre sein Lebenssinn mit dem Ende seiner Arbeitstätigkeit hinfällig. Damals war Margarete achtundfünfzig gewesen und bis zu diesem Zeitpunkt hauptberuflich Ehefrau. Sie hatte es zwar Harald persönlich übel genommen, dass er sich so plötzlich sang- und klanglos aus dem Staub gemacht hatte, aber ihre Trauer hatte sich in Grenzen gehalten. Jetzt sei sie hauptberuflich eine Wilmersdorfer Witwe, sagte Udo manchmal, wenn er sie aufziehen wollte, frei nach dem Musical Linie 1.
Margarete war vor allem eines, fand Ellie: pingelig. Ihre Vorliebe für Ordnung zeigte sich auch im Vorgarten, den sie aufopferungsvoll pflegte. Kein Unkrauthälmchen schaffte es dort mehr als ein paar Millimeter aus dem Boden. Die Hecke zur Straße hin beschnitt Margarete exakt, die winzig kleine dunkelgrüne Rasenfläche vor ihrem Fenster düngte sie jedes Jahr pünktlich am 1. April. Bald war es wieder so weit. Die Gänseblümchen, die versuchten, darauf zu wachsen, wurden konsequent ausgestochen.
Einmal, an einem heißen Tag im letzten Jahr, hatte Margarete einen Stuhl in den Vorgarten gebracht, dort gesessen, etwas gelesen und hin und wieder an einem Glas Wasser genippt. Aber inmitten des Perfektionismus, den sie selbst geschaffen hatte, wirkte sie wie ein unordentlicher Fremdkörper. Die anderen hatten es nicht kommentiert, aber Margarete schien es gespürt zu haben. Nie wieder hatte sie im Vorgarten gesessen.
Aber von Margaretes penibler Vorgartenpflege durfte man sich nicht irritieren lassen. Sie hatte nichts Versnobtes an sich und war ausgesprochen patent. Klar, sonst könnte Ellie ja unmöglich mit ihr befreundet sein! Und das war sie seit vielen Jahren. Seit sie von Margarete das erste Mal ein Ei ausgeliehen hatte. Für eine selbst geschlagene Mayonnaise, wenn sie sich recht erinnerte. An Essen konnte sie sich gut erinnern, schließlich hatte sie bis zur Rente als Köchin gearbeitet. Beziehungsweise bis zur Grundsicherung.
Sie, Margarete und Fanny hatten am Morgen alles vorbereitet. Der Picknickkorb war gepackt, auch wenn Ellie ein schlechtes Gewissen bekam, wenn sie an den Inhalt dachte. War der Krabbensalat ein bisschen übertrieben? Es gab nämlich außerdem noch Hühnerbeinchen und Kirsch-Brownies. Sonst achtete sie immer sehr darauf, nicht zu viel auszugeben. Aber an diesem Tag war ihr das egal. Der Krabbensalat hatte sie bei Butter Lindner angelacht, und da hatte sie eben zugeschlagen – mit ganzen zweihundert Gramm.
Auf dem Picknickkorb lag ein sorgfältig zusammengefaltetes rot-weißes Tischtuch. Vier Klappstühle und ein Tisch, den sie aus Margaretes Keller geholt hatten, warteten darauf, in Udos Passat verstaut zu werden. Sie waren alle drei fertig angezogen – Fanny trug ihren roten Dufflecoat und Gummistiefel. Ihre Wangen glühten. Sie sah jetzt schon aus, als wäre ihr zu warm.
»Udo wollte noch mal auf den Friedhof«, sagte Margarete.
Ellie verdrehte die Augen. »Mein Gott. Ich möchte den Tag erleben, an dem er nicht auf den Friedhof geht! Davon hat Anne doch nun wirklich nichts mehr.«
»Ach, Ellie. Sie waren fast fünfundvierzig Jahre verheiratet. Da ist es doch normal, dass er sie vermisst.«
»Ja, schon. Aber ich kannte die beiden ewig und kann mich beim besten Willen nicht daran erinnern, dass er Anne jemals Blumen geschenkt hat. Und jetzt legt er jeden Tag eine Rose auf ihr Grab. Das hätte er lieber früher tun sollen!«, ereiferte sich Ellie.
»Hast du bemerkt, dass sich im Laufe der Zeit die Farben der Rosen verändert haben? Vor zwei Jahren waren es weiße, dann waren es gelbe Teerosen, dann orangefarbene Buschrosen. Inzwischen ist er bei den teuren, langstieligen Dunkelroten angekommen. Was das kostet!«
»Für Anne würde er seinen letzten Euro geben«, sagte Ellie.
»Das tut er jetzt schon! Viel Rente bekommt er ja nicht. Auf der anderen Seite … Was soll’s, wenn ihm das Ritual guttut. Wahrscheinlich gibt es ihm das Gefühl, gebraucht zu werden, wenn er eine Rose auf ihr Grab legt und mit Anne Zwiesprache hält«, erwiderte Margarete.
»Er kann doch mit uns sprechen! Wir brauchen ihn nämlich wirklich!«
»Ja. Zum Glühbirnen einschrauben und wenn die Spülmaschine kaputt ist, für all diesen Männerkram … Ah, da ist er ja endlich.«
Udo war gerade um die Ecke gebogen und hielt im Sturmschritt auf sie zu. Wie immer war er glatt rasiert, sein weißes Haar war sorgfältig gescheitelt, die dunklen Augen hinter der randlosen Brille blitzten. Seine Wangen waren gerötet, und er atmete ein bisschen bemüht. Für einen Mann Ende sechzig strahlte er erstaunlich viel Energie aus.
»Es hat heute ein bisschen länger gedauert. Entschuldigung. Ich bin nicht eher losgekommen«, sagte er.
Margarete war einsichtig. Gelegentlich kam sie selbst aus dem Plaudern mit Harald nicht raus, auch wenn es eine sehr einseitige Unterhaltung war. »Ist schon gut. Das musst du uns nicht erklären, wir verstehen das. Wir können los. Fanny, noch mal Pipi?«
Fanny schüttelte den Kopf. »War schon.«
»Na dann.«
Sie luden gerade die Stühle in den Wagen, als der Briefträger die Straße entlanggeradelt kam. Vor ihrem Haus stieg er ab und lehnte das Rad gegen den Zaun. Dann griff er einen Packen Briefe aus seiner Tasche, grüßte und verschwand im Haus.
»Willst du noch mal nach der Post schauen?«, fragte Margarete.
Ellie winkte ab. »Ach was. Ist bestimmt nichts für mich dabei. Dabei hab ich Magnus neulich fünfzig Euro zum Geburtstag geschickt. Nicht gerade wenig, oder? Aber du musst nicht glauben, dass er sich dafür mal bei seiner Oma bedanken würde. Ich weiß wirklich nicht, wie Stefan und Katja den Jungen erziehen. Gehört das heute nicht mehr dazu, dass man als junger Mensch Danke und Bitte sagt?«
»Danke und bitte«, sagte Fanny, die neben ihnen auf der Erde kauerte und einen winzigen rosafarbenen Stein für ihre Sachensammlung untersuchte.
Ellie lachte. »Ja, du weißt das!«
Und dann stiegen sie in Udos Passat und fuhren los.
Obwohl Udo konzentriert am Steuer saß, schien er mit seinen Gedanken ganz woanders zu sein.
Margarete musterte ihn von der Seite. »Alles okay mit dir, Udo?«
Er warf ihr einen kurzen Blick zu und schaute dann wieder auf die Straße. »Och, mir geht Verschiedenes im Kopf rum.«
Margarete sah in den Spiegel der Sonnenblende und traf auf Ellies fragenden Blick. Anne, formte Ellie stumm mit dem Mund.
Margarete nickte. Schließlich waren sie auf dem Weg in die Gegend in der Mark Brandenburg, aus der Anne stammte. Da wurden in Udo sicher Erinnerungen an ihre gemeinsamen Ausflüge wach. An damals, die Zeit nach der Wende, als Anne und er dorthin gefahren waren und Anne empört und erleichtert zugleich der Hausgemeinschaft berichtet hatte, dass sie niemanden im Dorf angetroffen habe, den sie von früher kannte. Es war ein sehr kleines Dorf gewesen.
Im Löwenberger Land bogen sie von der viel befahrenen B96 auf eine kleine Teerstraße ab. Die Straße führte durch einen Kiefernwald, dann zwischen Feldern hindurch, auf denen das Saatgut schon zu sprießen begann. Der hellblaue Himmel, gelegentlich getupft von Wölkchen, schien heute besonders hoch. Hin und wieder sah man einen Vogelschwarm.
»Da vorn gab es früher einen kleinen Blumenladen und daneben einen wirklich guten Fleischer«, erklärte Udo, als sie in ein Straßendorf fuhren. Auf dem Anger, der die Hauptstraße unterteilte, stand die Kirche. »Ah, schaut, die gibt es immer noch! Da ist Fritschs Floristik, seht ihr? Und daneben ist die Fleischerei Kanitz. Wartet, ich nehme was für zu Hause mit.«
Er parkte und stieg aus. Die anderen folgten ihm. Fanny rannte zu Udo und ergriff seine Hand. Zu viert betraten sie die Dorfschlachterei.
»Das sprengt wieder mal mein Budget«, murmelte Ellie mit dem Blick auf die Hausmacher-Spezialitäten.
»Es ist hier doch preiswerter als in Berlin.« Margarete studierte die Preisschilder.
»Ja, aber ich werde zu viel kaufen, weil ich alles kosten will! Und das wird teuer.«
»Wir können ja zusammenlegen«, schlug Margarete, die um Ellies prekäre Finanzlage wusste, vor. »Und dann heute Abend mit Nora zusammen essen. Dann hat sie auch was von unserem Ausflug.«
»Mama mag am liebsten Salami«, sagte Fanny, die offensichtlich mal wieder kein Wort vom Gespräch der Erwachsenen verpasst hatte.
Fleischermeister Kanitz bediente sie persönlich, und mit zwei vollen Tüten verließen sie den Laden. Udo verstaute sie im Kofferraum, und weiter ging es.
»Wie weit ist es noch?«, fragte Margarete.
»Zwei Landstraßen, drei Dörfer.«
»Kaum zu glauben, wie weit weg Berlin sich anfühlt, obwohl wir nur eine gute Stunde davon entfernt sind. So viel Natur. So viel weiter Himmel«, schwärmte Margarete, als sie das Straßendorf hinter sich gelassen hatten.
»Ich muss mal«, sagte Fanny unvermittelt.
»Da hast du deine unverfälschte Natur, Margarete. Kannst du hier halten, Udo?«, fragte Ellie.
»Klar.« Er blinkte, fuhr rechts ran und blieb am Rand eines großen Feldes stehen. Weit, braun und öd erstreckte es sich, ohne eine Spur von Bewuchs. »Dann mal los, Fanny.«
Fanny blieb, wo sie war, und schaute aus dem Fenster. »Nein«, sagte sie schmollend. »Hier geh ich nicht Pipi machen. Hier sieht mich ja jeder.«
»Aber hier ist doch niemand, der dich sehen könnte. Die Straße ist leer, bis auf uns. Und wir schauen in eine andere Richtung, versprochen.«
»Nein.« Fanny schüttelte den Kopf. »Nachher schummelt ihr. Hier geh ich nicht.«
»Also gut. Dann eben hier nicht. Fahr weiter, Udo«, sagte Ellie. Udo gab Gas, und sie rollten wieder auf die Teerstraße, entlang des Feldes.
»Kannst du noch ein bisschen warten, Fanny?«, fragte er mit einem Blick in den Rückspiegel. »Höchstens eine Viertelstunde, okay? Dann sind wir da. Im Dorf gibt es eine Kneipe, da kannst du gehen.« Fanny nickte, obwohl sie noch nicht die Uhr lesen konnte.
Das Feld schien kein Ende zu nehmen. Im Wagen herrschte Stille, bis …
»Ich muss aber ganz doll«, jammerte Fanny. »Jetzt sofort!«
Udo seufzte leise und warf einen Blick in den Rückspiegel. Weil er wohl um seinen Autositz fürchtete, beschleunigte er rasant. Sie schossen hinein in einen Buchenwald.
Ellie, die angestrengt nach einem geeigneten Platz Ausschau hielt, sagte: »Schau mal, dahinten ist dichtes Unterholz. Da traust du dich, Fanny, oder?«
Fanny nickte mit zitternder Unterlippe.
Udo bremste und bog ab. Sie fuhren zwischen Bäumen und Gebüsch hindurch, bis die Straße hinter ihnen nicht mehr zu sehen war. Dann hielt Udo. Fanny riss die Tür auf und verschwand wie ein Blitz hinter einem großen Busch. Ihre roten Gummistiefel leuchteten durch das sparrige Astwerk, als sie sich hinkauerte.
Margarete lachte. »Das war knapp.« Dann sah sie sich um. »Hübsch ist es hier. Ich vertrete mir auch mal kurz die Beine.« Sie öffnete die Beifahrertür, stieg aus und ging einige Schritte. Tief atmete sie ein. In der Luft lag ein Hauch von warmem Frühling. Sie roch vermoderndes Laub, frisches Grün und umgebrochene Erde. Dann ging sie einige Schritte einen kaum erkennbaren Pfad entlang, der von Wildwuchs überwuchert war. »Das muss früher mal ein Weg gewesen sein«, rief sie.
»Warte, ich komme mit«, sagte Ellie.
Udo zog den Autoschlüssel ab und stieg ebenfalls aus.
Fanny kam mit offenem Dufflecoat zurück. »Schaut mal, was ich gefunden habe. Das hat bestimmt eine Waldfee geschrieben.« Sie hob ein Stück Borke hoch, groß wie eine Männerhand. Die Außenseite war grau und rau, aber die Innenseite glatt. Würmer hatten auf ihrem Weg durch die Innenborke gekerbte, ineinander verschlungene Linien hinterlassen, die mit viel Fantasie an Buchstaben erinnerten. Fanny hatte viel Fantasie.
»Natursütterlin«, sagte Margarete.
»Was ist Sütterlin?«, fragte Fanny.
»Eine alte deutsche Schrift. So hat man früher geschrieben.«
»Können Elfen das denn?«
»Offensichtlich«, sagte Ellie.
»Was steht da?«
Ellie griff nach der Borke und las vor: »›Wenn der Nachtfürst die Lichtung betritt, tanzen wir mit ihm Sternenwalzer. Zieh dein bestes Seidenspinnenkleid an. Das grüne mit der Raupenschleppe. Wir treffen uns eine Stunde vor Vollmond.‹ Das ist eine Balleinladung von einer Waldfee, die du da gefunden hast, Fanny.«
Margarete verdrehte die Augen. Ellie hatte auch erschreckend viel Fantasie.
Fanny sah sie aufgeregt an. »Können wir bis eine Stunde vor Vollmond bleiben?«, fragte sie, während sie sich zu viert durch das wuchernde Buschwerk kämpften.
Niemand antwortete ihr, denn unvermittelt war der Weg versperrt. Sie standen vor dem Tor eines Zaunes, der gefährlich schief im Unterholz stand. Eine rostige Kette hielt die beiden Torflügel zusammen.
»Da stand nirgends, dass das ein Privatweg ist«, sagte Udo und sah sich um.
»Wer wohnt denn bloß in dieser Einsamkeit?« Ellie lugte über den Zaun.
»Niemand. Das sieht vollkommen verwildert aus«, bemerkte Margarete kritisch.
Sie schien recht zu haben. Graues Wintergras stand hüfthoch jenseits des Zaunes. Eine wilde Hecke und hohe Bäume – Obstbäume? – versperrten ihnen den Blick. Etwas Dunkelrotes schimmerte durch das dichte Gestrüpp.
Fanny rüttelte probeweise an der Kette. Ein rostiges Glied gab nach, die Kette fiel klirrend zu Boden, einer der Torflügel öffnete sich knarrend und gab einen kleinen Durchgang frei.
Bevor irgendwer etwas sagen konnte, drängte sich Fanny schon durch die Lücke. »Ich schau nur mal!«
»Da gehe ich lieber mit. Nicht, dass ihr was passiert«, sagte Ellie und stieß das Tor weiter auf.
Margarete und Udo folgten ihnen, und zu viert betraten sie das Grundstück.
Margarete sah sich um. Vielleicht war hier mal eine Einfahrt gewesen, aber davon sah man nichts mehr. Gelegentlich knirschte es unter den Füßen, als ob sie über verborgene Kiesschichten gingen. Aber man sah nur Moos, Gras, frisches Wildkraut, Birken- und Ahornschösslinge.
Die Zufahrt endete an einem dunkelroten zweistöckigen Backsteinbau. Von den verzogenen Fensterrahmen war die Farbe abgeblättert, man konnte erahnen, dass sie früher hell gestrichen waren. Im Erdgeschoss waren die Scheiben heil, wenn auch so schmutzig, dass man von außen nicht hineinsehen konnte. Im oberen Stockwerk waren zwei Scheiben kaputt. Die hölzerne Eingangstür war zwar geschlossen, wirkte aber verzogen.
Fanny und Ellie waren um das Haus herum gegangen. Margarete stand neben Udo und überlegte, ob sie das alte Gebäude betreten sollten, als sie Fanny begeistert kreischen hörte. Dann kam das Mädchen um die Ecke gerannt.
»Kommt mal, schnell, das müsst ihr sehen!«
»Was denn?«, fragte Margarete, aber da war Fanny schon wieder verschwunden.
Margarete folgte ihr. Als sie die Hausecke umrundete, sah sie, was Fanny so entzückt hatte. Aus einem kleinen Backsteinhaus ragte ein gemauerter Schornstein empor. Und auf dem Schornstein war ein großes Nest, in dem zwei Störche standen. Der eine bog seinen langen Hals nach hinten und begann, lautstark mit dem Schnabel zu klappern. Der zweite Storch stand am Nestrand und schaute misstrauisch zu ihnen hinunter. Er hob die Flügel und senkte sie, als ob er sich nicht entscheiden könnte, ob er bleiben oder fluchtartig abheben sollte. Er blieb.
»Störche!«, rief Fanny und klatschte vor Begeisterung.
»Wenn du ein bisschen leiser bist, Fanny, dann haben sie keine Angst«, wisperte Ellie.
Fanny nickte verzückt, ohne den Blick von den Vögeln zu wenden.
Margarete schaute sich um. Warum stand hier eigentlich ein Schornstein? Was wollte man denn hier heizen? Sie kämpfte sich durch das Dickicht hinter dem Schornstein. Getrocknete Disteln, kleine Birken, Haselnuss, Holunder von wildem Hopfen überwuchert, bildete eine krautige Wand. Unwillkürlich musste sie an Dornröschen denken.
Hinter diesem Dickicht blitzte etwas durch, das Margarete noch nicht genau erkennen konnte. Etwas Hohes, Sparriges. Sie bog einen Ast zur Seite und kletterte hinüber. Schließlich stand sie schwer atmend vor einem Gerippe aus rostigem dunklem Metall, umgeben von einer niedrigen Mauer. Margarete hatte nicht die leiseste Ahnung, was das mal gewesen sein mochte.
Hinter sich hörte sie ein Rascheln. Sie drehte sich um. Ellie und Fanny hatten sich ebenfalls durchs Gebüsch gekämpft. Ellie hatte welke Blätter im krausen Haar, aus Fannys Locken ragte ein kleiner Zweig mit einer Buchecker.
»Was ist das denn?«, fragte Ellie.
»Keine Ahnung. Ein Baugerüst. Etwas, das vielleicht nie zu Ende gebaut worden ist. Wer um alles in der Welt mag hier bloß gewohnt haben?«
»Jemand, der die Einsamkeit mochte«, sagte Ellie und wandte sich ab. »Kommt, wir gehen zurück.«
»Auf jeden Fall hat hier jemand gewohnt, der Kinder mochte. Oder sich um Kinder gekümmert hat«, fügte Udo hinzu, der inzwischen neben ihnen stand.
»Wie kommst du denn darauf, Udo?«, fragte Margarete.
»Ich hab mir das Haus mal genauer angeschaut. Durch die Terrassenfenster.«
»Welche Terrasse meinst du?«
»Na, die hinter dem Haus. Hast du die nicht gesehen?« Margarete schüttelte den Kopf.
»Drinnen stehen Stühle und Tischchen. Vielleicht war es ein Kindergarten oder ein Ferienheim. Alles ist ziemlich heruntergekommen. Ich meine, es ist verfallen, aber es sieht nicht so aus, als hätte dort jemand randaliert. Wahrscheinlich ist es selbst dafür zu abgelegen.«
»Schlau kombiniert, Udo.« Margarete war beeindruckt. »Hast du schon geschaut, ob es Strom gibt?«
Udo hatte früher eine kleine Elektrofirma besessen, die bankrottgegangen war, was ihm aber den Spaß an Basteleien nicht verdorben hatte. Statt einer Antwort auf die Frage grinste er nur.
»Auf jeden Fall sieht es aus, als ob hier jahrelang kein Mensch gewesen wäre«, sagte er dann.
»Vielleicht tanzen die Waldfeen hier eine Stunde vor Mitternacht?«, fragte Fanny hoffnungsvoll.
Margarete lachte, aber sie verstand, was Fanny meinte. Das stille Haus und der verwilderte, verlorene Garten, der hohe Schornstein, die kleine Backsteinhütte und die Störche – all das hatte etwas Märchenhaftes, etwas Verwunschenes, das die Existenz von Feen nicht völlig ausschloss.
»Ich finde, jetzt ist die perfekte Zeit für unser Picknick«, sagte Ellie resolut. Ihr war anscheinend der Krabbensalat eingefallen. Und die Brownies. Und die Hühnerbeine. »Wer hilft, die Stühle und den Tisch aus dem Wagen zu holen? Ich schlage vor, wir essen auf der Terrasse.«
»Oder was man so Terrasse nennt«, murmelte Margarete und bog einen dicken Haselnussast zur Seite.
Gut, dass sie Lederhandschuhe angezogen hatte. Dieses Gestrüpp war ganz offensichtlich entschieden zu lange ungestört gewachsen, um sich den Eindringlingen aus Berlin kampflos zu ergeben.
3. Kapitel
»Frau Dittbrenner. Bitte ins Büro«, plärrte es durch die Lautsprecheranlange.
Nora, die gerade eine frische Lieferung Stiefmütterchen nach Farben sortierte, warf ihrem Kollegen einen fragenden Blick zu. Der zuckte mit den Schultern. Keine Ahnung, was die von dir wollen, hieß das wohl.
Sie zog die Gartenhandschuhe aus und verstaute sie unter der Kassentheke. Noch nie in den letzten zwei Jahren war sie mitten am Tag ins Büro gerufen worden. Die Gespräche, die sie mit dem Chef hatte, fanden sonst immer mit Voranmeldung statt. Oder nach Schichtende, wenn es darum ging, was von den Lieferanten geordert werden sollte. Was Nora zuvor sorgfältig in Excel-Tabellen aufgelistet hatte.
Auf ihrem Weg zum Büro kam sie an der Damentoilette vorbei. Sie überlegte, ob sie noch Zeit hatte, sich zu kämmen und zu schminken, aber nein, sie wollte den Chef nicht warten lassen. Dann kam ihr ein schrecklicher Gedanke … Vielleicht war etwas passiert? O Gott, hoffentlich hatte Udo keinen Unfall bei der Landpartie gebaut!
Die Tür zum Bürotrakt war, für die Kunden fast unsichtbar, in eine graue Wand eingelassen. Ernsthaft beunruhigt, betrat Nora das Sekretariat. Als sie die Tür hinter sich schloss, schaute Frau Weber nur flüchtig von einer Akte hoch.
»Sie können gleich reingehen. Der Chef erwartet Sie«, sagte sie gleichmütig.
Nora atmete tief durch. Ihre Unruhe legte sich – ein wenig. Das klang nicht nach einem alarmierenden Anruf, nach einem tragischen Autounglück, nach der Anwesenheit von zwei Polizisten, die ihr etwas Schreckliches übermitteln sollten.
Höflich klopfte sie an.
»Herein«, erklang die Stimme des Chef.
Nora öffnete die Tür, und da saß er, wie festgewachsen hinter seinem klobigen, geschmacklosen Schreibtisch aus Holzimitat. Ein Mann in Grau. Das Jackett, die Haare, die Augen hinter den Brillengläsern. Weil alle Angestellten ihn immer nur »Chef« nannten, musste Nora einen Moment überlegen, wie er hieß. Dann fiel es ihr ein. Müller. Helmut Müller. Kein Name, sondern ein Sammelbegriff.
»Hallo, Herr Müller«, sagte sie und lächelte.
Er lächelte nicht zurück, sondern wies auf den unbequemen Stuhl, der vor seinem Schreibtisch stand. Sie setzte sich.
»Frau Dittbrenner«, hob er an und musterte sie, als sähe er sie zum ersten Mal. »Wie lange sind Sie jetzt bei uns?«
»Ungefähr zwei Jahre«, sagte Nora.
»Und Sie sind damals aus der Arbeitslosigkeit zu uns gekommen, richtig?« Er nahm seine Brille ab und drehte sie zwischen zwei Fingern.
»Ja. Ich war ein knappes Jahr arbeitslos, weil meine kleine Tochter in die Vorschule kam und ich nicht einen neuen Job anfangen wollte, als sie …«
»Warum sind Sie eigentlich arbeitslos geworden?«, unterbrach er sie.
»Der Gartengrossist, für den ich gearbeitet hatte, musste Konkurs anmelden.«
»In dieser Firma hatten Sie nur mit Aufträgen und deren Versand zu tun, richtig?«
Nora nickte.
Er beugte sich etwas vor. »Kundengespräche gehörten nicht zu Ihrer Kompetenz?«
Nora schüttelte den Kopf. »Mit den Kunden hatte ich kaum etwas zu tun. Ganz selten gab es mal Rückrufe wegen Bestellungen, wenn zum Beispiel versehentlich ein holländisches Gartengerät statt eines englischen oder so ausgeliefert wurde. Die Kunden waren dann ungehalten, aber dafür konnte ich nichts …« Sie hatte immer noch keinen Schimmer, worauf diese Unterhaltung hinauslief.
»Ah! Sie konnten nichts dafür! Wissen Sie, wie oft ich das höre?« Ungehalten warf er die Brille auf die hässliche rostbraune Schreibtischunterlage.
»Nein«, sagte Nora höflich.
»Aber wenn bei uns Kunden unzufrieden sind, dann können Sie etwas dafür!«, bellte er.