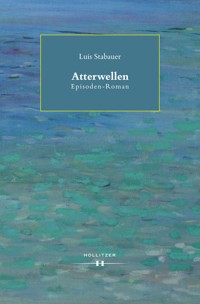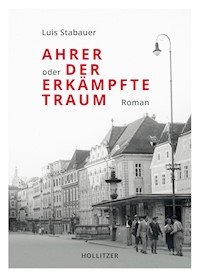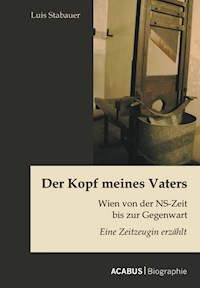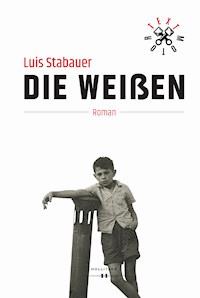
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: HOLLITZER Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach der Ermordung seiner Eltern durch die Austrofaschisten wird der elfjährige Ernst von der Familie Patosek aufgenommen. Er wird Teil der von Toni Patosek geleiteten Wiener Widerstandsgruppe "Die Weißen" und zum Vertrauten der kleinen Franzi Patosek. Als die Gruppe auffliegt und ein Großteil der Mitglieder, darunter auch Toni, hingerichtet wird, verlieren sich Franzi und Ernst aus den Augen. In der Klinik "Am Spiegelgrund" entkommt Ernst 1944 nur knapp dem berüchtigten NS-Arzt Heinrich Gross und damit seinem sicheren Tod. 65 Jahre nachdem sich ihre Lebenswege so abrupt trennten, begegnen sich Ernst und seine Wahlschwester Franzi wieder.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 486
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DIE WEIßEN
LUIS STABAUER
DIE WEIßEN
Roman
Literaturgruppe Textmotor
Lektorat: Teresa Profanter
Umschlaggestaltung: Nikola Stevanović
Satz: Daniela Seiler
Hergestellt in der EU
Luis Stabauer: Die Weißen
Literaturgruppe Textmotor
Gedruckt mit freundlicher Unterstützung von:
MA 7 – Kulturabteilung der Stadt Wien
Land Oberösterreich
Alle Rechte vorbehalten
© HOLLITZER Verlag, Wien 2018
www.hollitzer.at
KINDERLIEDER
Wenn die Mutter das dicke Buch hervorholte, wusste der Bub, es war Zeit, sich den Pyjama anzuziehen. Zähneputzen musste er in der Küche. Danach las sie ihm ein kurzes oder ein halbes langes Märchen vor. Oft erklärte sie am Ende, was dieses Märchen mit dem Leben zu tun hatte. Obwohl Ernsti nicht alles verstand, fragte er selten nach. Er wollte sich den Prinzen, den glücklichen Kater oder das Schneewittchen in den Schlaf mitnehmen.
Jeden zweiten oder dritten Tag brachte ihn sein Vater ins Bett und erzählte ihm Geschichten. Von hungernden Jung-Elefanten, die von Ottakring nach Spanien wanderten und vergessen hatten, ihre von der Elefantenmama hergerichteten Jausenbrote einzupacken. Von Tintenfischen, die mit ihren Kindern in einer Höhle wohnten und immer, wenn Haie vorbeischwammen, ihre Tinte verspritzten, damit sie für die Haie unsichtbar wurden. Oder von jungen Krokodilen, die sich beim Schwimmenlernen im Nil zu weit vom Elternstrand entfernt hatten und eines Tages im großen Wasser ankamen, wo sie ganz furchtbar spucken mussten, weil das Wasser dort so salzig war. Aber auch vom kleinen Vladimir, der verkleidet als Heizer mit dem geheimnisvollen Zug und dem Gold vom Deutschen Kaiser in das riesige Land im Osten kam, wo er mit dem Geld des Kaisers die Hungersnot beenden und den Zar verjagen wollte. Vor allem diese Geschichte hatte viele Fortsetzungen und beim Erzählen leuchteten die Augen seines Vaters.
„Das ist aber kein Märchen?“, fragte der Bub. „Ist es dem Heizer gelungen, den grausamen Zar zu verjagen?“ Sein Vater lächelte, strich Ernsti über die Stirn und küsste ihn auf die Nase.
„Ja, mein G’scheiter, sie haben es geschafft, aber schlaf jetzt. Das nächste Mal erzähle ich dir mehr. Außerdem darfst du im Herbst in die Schule gehen, dann kannst du bald selbst Märchen und spannende Geschichten lesen.“
„Papa, gehst du heute noch weg?“
„Nein, ich bleibe bei dir. Mutti kommt vom Frauentag sicher erst später heim.“
„Dann singst du mir aber noch ein Lied vor, bitte, bitte.“
Sein Vater ließ sich erweichen und holte die Gitarre. Schon bei den ersten Takten wusste Ernsti, es war sein Lieblingslied, Die Arbeiter von Wien. Den Refrain konnte er mitsingen:
So flieg’ du flammende, du rote Fahne,
Voran dem Wege, den wir ziehn.
Wir sind der Zukunft getreue Kämpfer.
Wir sind die Arbeiter von Wien.
„Aber jetzt wird geschlafen“, sagte Papa und streichelte ihm noch einmal über den Kopf. „Morgen darfst du bei Oma bleiben, ich bringe dich nach dem Kindergarten zu ihr.“
Im Sommer durfte er immer wieder in Omas Schrebergartenhaus schlafen. Ernsti mochte sie und ihren Garten. Obwohl: Ihre ständigen Fragen fand er manchmal ärgerlich. Ob er einmal Lokführer werden wolle, oder Rennfahrer, oder vielleicht sogar ein Pfarrer. Er schaute seine Oma dann nur verständnislos an. Lokführer war trotz Papas Zuggeschichte nicht sein Traumberuf. Fuhren doch die Züge auf ihrem Weg zum Wiener Westbahnhof beinahe durch den großmütterlichen Schrebergarten in Penzing. Das Bild der nur mit einer Latzhose bedeckten, rußigen Oberkörper der Dampflok-Eisenbahner gefiel ihm. Fast immer winkten sie freundlich in den Garten herein.
Die Schrebergartenzeit war vor allem von gutem Essen geprägt. Ribisel, Erdbeeren und Stachelbeeren konnte er pflücken und in den Mund stecken. Dazwischen spielte er mit Omas Hasen, die sie für ihn aus dem Stall herausnahm. Weniger Freude hatte er mit dem Putzen der Fisolen. Das Entfernen der Enden und der Fäden war ihm jahrelang ein Gräuel. Erst viel später sollten Bohnenschoten zu seinem Lieblingsgemüse werden. Oft musste er dann an Oma denken. Und an ihre Geschichte, die sie ihm und allen Besuchern erzählt hatte. Immer wieder.
Dass Hansl ihr versprochen habe heimzukommen, und dass es vom Isonzo bis nach Wien gar nicht so weit sei. Ob das ein Berg, ein Fluss oder eine Landschaft war, wusste er nicht, er verstand nur, dass Oma von seinem Opa sprach. Allerdings waren auch die Kommentare der Nachbarn nicht zu überhören: „Die spinnt ja, die Alte, jetzt glaubt die immer noch, dass ihr Mann vom Isonzo zurückkommt.“ Oder: „Die Schwachsinnige und ihr Kriegszitterer. Die wird man noch einmal in Steinhof finden.“ Ernsti tat so, als hätte er die Kommentare nicht gehört. Dass sie aber zum Essen ein Besteck für Opa auf den freien Platz am Tisch legte, war schon recht eigenartig. „Der Hansl kann mit jedem Zug kommen und dann will er etwas Warmes zu essen haben“, waren ihre Worte beim Aufdecken.
Opa tauchte nicht auf. Dafür kam oft ein feiner Herr zu seiner Oma in den Garten und erzählte von anderen Ländern und über das Leben in Wien in vergangenen Jahren. Er konnte in seiner Arbeit den ganzen Tag Geschichten von früher lesen und die Stadt Wien bezahlte ihn noch dafür. Ernsti hörte aufmerksam zu. Damals entstand sein Traumberuf: Geschichtenleser oder Buchhändler, das stellte er sich spannend vor. Der feine Herr brachte auch seine in der Zeitung abgedruckten Gedichte mit. Er setzte sich ganz nahe zu Ernsti, legte seine Hand auf Ernstis nackten Oberschenkel und las ihm ganz langsam ein Gedicht nach dem anderen vor. Die Nähe des Herrn Dichters, wie Oma sagte, war ihm unangenehm. Aber die Gedichte erinnerten ihn an die Lieder seines Vaters. Wie diese reimten sie sich. Trotzdem war er immer froh, wenn der Herr Dichter seine Oberschenkel wieder losließ. Nach dem Kaffee verschwand der Gast meist mit Oma in der Schrebergartenhütte.
„Du wartest, bis wir wieder aufmachen, ich muss mit dem Herrn Dichter etwas besprechen.“ Der Gast verschwand mit Oma in der Schrebergartenhütte. Manchmal hatte er eine Hand auf Omas Brust, wenn sich die Tür wieder öffnete.
„Schau, mein Junge“, sagte der Herr Dichter dann, „stramme deutsche Titten, die eine heißt Franz, die andere Carl.“
„Dass du mir davon ja nichts weitererzählst“, sagte Oma, wenn der Herr Dichter gegangen war. „Er ist kein Sozi und er unterstützt mich, aber das würden deine Eltern nie verstehen.“
Mit dem Schuleintritt wuchs Ernsts Hoffnung, bald viele Bücher lesen zu können. Nach dem ersten Jahr durfte er die Gedichte von Omas Gast schon selber lesen. Der Herr Dichter setzte sich wieder ganz nahe zu ihm. Damit er sehen könne, ob Ernsti auch richtig lese, sagte er zu Oma. Vorsorglich trug Ernst lange Hosen, denn auch das Handauflegen ließ der Herr Dichter nicht bleiben. Einmal lud er Ernsti ein, mit ihm ins Café Ritter zu gehen, da könne er auch andere Dichter kennenlernen. Unsicher blickte Ernsti zu Boden und gab keine Antwort.
Seine Eltern waren nun fast jeden Tag bei den Sozialisten. Eines Nachmittags rollte sein kleiner Ball unter das Bett der Eltern. Er kroch darunter und entdeckte ein Gewehr. Es war im doppelten Drahteinsatz des Bettes so befestigt, dass man es nicht sehen konnte, wenn man nur unter das Bett schaute. Seine Mutter erklärte ihm, dass die Zeiten gefährlicher würden und dass sich die Hahnenschwanzler1 längst bewaffnet hätten. Sie müssten daher auch Waffen haben, wenn es ernst werden sollte. „Sag ja nichts zu deiner Oma, die würde sich nur Sorgen machen.“ Das verstand Ernsti. Gute-Nacht-Geschichten und Papas Lieder hörte er nun nur mehr selten.
In den ersten Schuljahren war Ernsti fast täglich bei seiner Oma im Gartenhaus in Penzing. Sie umsorgte ihn, aber er wäre doch gerne öfter bei seinen Eltern gewesen. Oma war die Einzige, die ihn noch Burli nannte, das ärgerte ihn. Der Herr Dichter kam nach wie vor ins Gartenhaus und befasste sich bei seinen Besuchen immer intensiver mit ihm. Währenddessen saß Oma auf der Gartenbank und ließ den Kopf hängen.
Bald durfte Ernsti an den Wochenenden alleine mit der Straßenbahn zu Papa und Mama nach Ottakring heimfahren. Er traf Freunde und manchmal spielten sie im Negerdörfl2 „Räuber und Gendarm“. Gemeinsam mit den Eltern machte er Ausflüge in die Lobau, oder sie fuhren mit anderen Familien zuerst mit dem Zug nach Krems und dann mit Faltbooten auf der Donau nach Wien zurück.
Bei diesen Zusammenkünften hörte er auch erstmals, dass die Zeiten für die Juden gefährlich würden. Anscheinend waren unter den Freunden seiner Eltern auch Juden. Er wusste nicht, woran man sie erkannte.
„Papa, bin ich auch ein Jude?“, fragte Ernsti. „Nein, mein Lieber, wir sind keine Juden, es wäre aber auch egal. Für die Faschisten sind Juden Untermenschen, aber mit dem Judenhass begonnen haben die sogenannten Christlichsozialen in Österreich. Du bist jetzt schon so groß: Wie wäre es, wenn wir den Ernsti begraben und dafür den Ernst auferstehen lassen?“
Ernst grinste übers ganze Gesicht. Seine Mutter lächelte und nickte.
„Wir müssen aufpassen, dass es uns nicht wie den Juden geht, auch uns wollen sie aus allen Ämtern draußen haben“, fuhr sein Vater fort. „Womöglich gibt es die Sozialdemokratische Arbeiterpartei bald nicht mehr. Aber wir werden uns das nicht gefallen lassen. Die Nationalsozialisten sind keine Sozialisten, das sind Faschisten, genau wie der Dollfuß und die Heimwehr. Auch wenn sie sich derzeit noch bekämpfen.“
Ernst sah die angespannten Gesichter seiner Eltern und nickte. Bevor er wieder mit der Straßenbahn zu Oma fahren musste, kam sein Vater noch mit der Gitarre in die Küche. Er schloss das Fenster und sie sangen zu dritt Arbeiterlieder. Eines kannte Ernst noch nicht, Wir sind des Geyers schwarzer Haufen, ein Lied mit vielen Strophen. Sein Papa erklärte ihm, dass Florian Geyer ein Aufständischer aus den Bauernkriegen vor vierhundert Jahren gewesen war. Der rote Hahn, der im Lied vorkam, sei eine Aufforderung, die Kirche anzuzünden. Vierhundert Jahre und der rote Hahn, das wollte sich Ernst merken.
Als Ernst in der 3.Klasse war, hatten seine Eltern auch an den Wochenenden kaum mehr Zeit für ihn. In den ersten beiden Schuljahren war er vom Religionsunterricht abgemeldet gewesen, jetzt musste er teilnehmen. Wer Religion nicht besuchte, konnte weder die Matura machen noch studieren. Eines Tages riss der Pfarrer die Tür auf:
„Stramm stehen und singen“, befahl er und die Klasse sang: „Sei gesegnet ohne Ende, Heimaterde wunderhold! …“
Ernst bewegte nur die Lippen, danach nahm er all seinen Mut zusammen und fragte den Pfarrer nach dem Singen, ob er wisse, was es bedeute, den roten Hahn aufs Dach zu setzen.
„Du vaterlandsloser Geselle!“, schrie der Mann im schwarzen Talar. „In die Ecke, sofort, und sag deinen Eltern, sie haben innerhalb einer Woche hier in der Schule zu erscheinen.“
Ernst fuhr an diesem Tag allerdings zu seiner Oma. Die Elternmitteilung ließ er sie zwar unterschreiben, aber die mündliche Vorladung wollte er ihr nicht gestehen. „Vielleicht vergisst es der Pfarrer“, hoffte er.
Nach und nach bemerkte Ernst in der Schule Veränderungen. Der Religionsunterricht und das Schulgebet wurden für alle verpflichtend. Obwohl er ein sehr guter Schüler war, sollte er für die Aufnahme in das Gymnasium eine Aufnahmeprüfung machen. Sowohl die sittlich-religiöse als auch die vaterländische Erziehung sind die Grundfesten unserer Schule stand eines Tages auf der Tafel. Der Satz durfte drei Tage lang nicht gelöscht werden.
„Wer kein Treuegelöbnis zum Vaterland ablegt, braucht nicht an eine Matura denken“, ergänzte die Klassenlehrerin.
Ernst hätte so gerne studieren wollen. Aber er bekam von der Schulleitung keine Erlaubnis ins Gymnasium zu gehen.
Draußen war es noch winterlich kalt, als Ernsts Vater an einem Samstagvormittag zu Oma kam und erklärte, dass er und Martha unbedingt im 11.Bezirk helfen müssten, einen Verbandplatz aufzubauen, weil die Hahnenschwanzler planten, auf die Arbeiterwohnungen zu schießen.
„Unser Hof ist nicht in Gefahr und das Negerdörfl auch nicht, aber in Simmering glauben sie losschlagen zu können“, sagte er zu Ernst gewandt und zeigte ihm das unter dem Mantel versteckte Gewehr.
„Nein!“, schrie Oma. „Ohne Martha! Lass meine Tochter nicht mitgehen!“
Noch nie hatte Ernst einen Menschen derart schreien gehört. Er musste sich die Ohren zuhalten. Der Vater ließ sich nicht beirren, schloss die Tür und ließ die beiden alleine.
Omas Schreien ging zuerst in heftiges Weinen über, dann begann sie mit der flachen Hand auf den Tisch zu schlagen. Ernst fürchtete sich und begann ebenfalls zu weinen. Irgendwann fing Oma an, unruhig im Zimmer herumzugehen. Mit der rechten Faust schlug sie in die geöffnete linke Hand, ihre Augen waren weit aufgerissen. Immer wieder öffnete sie die Tür und spähte hinaus.
An diesem Abend kochte Oma nicht, Ernst bekam nur trockenes Schwarzbrot zu essen. Zwar hatte sie sich ein wenig beruhigt, aber sie sprach kein Wort. Dafür drehte sie das Radio auf. Wieder musste Ernst dieses Lied hören. „Sei gesegnet ohne Ende, Heimaterde wunderhold!“, tönte aus dem Lautsprecher, dann meldete sich Engelbert Dollfuß:
„Liebe Landsleute! Ein herzliches Grüß Gott an alle, die daheim an den Radiogeräten sitzen! Mit Weitblick hat unser Minister Kurt Schuschnigg vor vier Jahren die Ostmärkischen Sturmscharen gegründet. Die OSS, als katholische Erneuerungs- und Schutzbewegung, brauchen wir jetzt mehr denn je. Sie stehen bereit. Im ganzen Land rotten sich vaterlandslose Gesellen zusammen, die unser schönes Österreich in verbrecherischer Absicht in den Abgrund führen wollen. Wir werden es nicht zulassen. Rot-Weiß-Rot, bis in den Tod!“
Am nächsten Tag wollte Ernst seine Eltern suchen. Oma ließ ihn nicht weggehen. Sie wollte auch nicht mit ihm gemeinsam suchen. Ernst wollte nicht mehr bei seiner Oma bleiben. Wenn seine Eltern nur wieder gesund heimkämen, er würde nicht mehr von daheim weggehen.
„Und wenn ich dich einsperren muss“, schrie sie. „Dein Vater war schon dabei, wie sie den Justizpalast angezündet haben. Jetzt bringt er mein Mädchen in Gefahr. Wenn ihr etwas zustößt, bringe ich ihn eigenhändig um.“
Am Montag durfte Ernst nicht in die Schule gehen, das sei viel zu gefährlich, wiederholte seine Oma alle paar Minuten. Sie ging ohne ihn einkaufen und sperrte die Tür von außen zu. Ernst schaute ihr nach, bis sie hinter der Hecke verschwand.
In der Nacht wälzte er sich von einer Seite zur anderen, er konnte kaum schlafen. Am nächsten Morgen saß Oma noch früher als sonst vor dem Radiogerät. Wieder sprach Dollfuß: über die schwarzen Faschingstage dieses Jahres, über die verbrecherischen Anstifter und über die erhabenen Kampfverbände der christlich-sozialen Bundesregierung. Das verbrecherische Unternehmen sei von Linz ausgegangen, sagte er und kam dann auch auf Wien zu sprechen:
„Die bewaffneten Gewaltmaßnahmen haben jedoch leider in Wien und anderen Städten Blutopfer und Menschenleben gefordert.“
Die weiteren Worte aus dem Radio waren nicht mehr zu verstehen, denn Oma begann zu schreien und mit dem Kopf gegen die Wand zu schlagen. Ernst umschlang sie von hinten und zog sie von der Wand weg. Nach bangen Minuten verstummte sie, setzte sich auf den Diwan und starrte vor sich hin.
Ernst wusste nicht, was er tun sollte. Er holte einige Speisereste aus dem Eisschrank, sie hatten noch gar nicht gefrühstückt. Oma rührte sich nicht. Er wärmte sich seinen Kakao, aß ein Marmeladebrot und beobachtete sie. Bis Mittag saß sie nur da. Dann klopfte es an der Tür. Die Umrisse des Herrn Dichters waren durch das gerippte Glas zu sehen. Ernst wollte öffnen, aber Oma war schneller an der Tür.
„Weißt du etwas?“, fragte sie.
KLEIDERKASTEN MIT PISTOLE
„Wenn du so viel Wasser trinkst, werden Frösche in deinem Bauch wachsen“, hatte meine Mutter im Traum zu mir gesagt. Mit dem wohligen Gefühl, in unserer alten Wohnung im 16.Bezirk zu sein, wachte ich auf.
„Da fahre ich heute hin“, beschloss ich.
Wien-Ottakring, Rankgasse28. Der graue Putz hat viele Sprünge, an manchen Stellen sind die Ziegel zu sehen. Anscheinend ist es das einzige Haus, das nie renoviert wurde. Die Klingelschilder sind neu, aber sie tragen keine Namen. Ob mich jemand reinlässt?
Ich schaue hinauf zum ersten Stock, wo unsere Wohnung war. Die Fenster sind getauscht worden, sonst sieht alles aus wie damals. Ich drücke auf die sechste Taste von unten, das könnte passen. Eine Frauenstimme meldet sich. Ich erkläre ihr, warum ich hier bin, sie scheint mich nicht zu verstehen und spricht in einer Sprache, die ich nicht einordnen kann. Nach dem Drücken der Taste unterhalb meldet sich eine Frau mit „Hallo, Avdujeva“ oder so ähnlich. Erneut trage ich mein Anliegen vor:
„Patosek, ich habe vor mehr als sechzig Jahren hier gewohnt und würde gerne noch einmal das Stiegenhaus und den Hof sehen. Darf ich hineinkommen?“
„Ich kommen, Toroffener kaputt“, sagt sie.
Schritte nähern sich, eine Frau öffnet die Haustür. Sie ist um die vierzig und trägt ein Kopftuch, ich kann allerdings Haare sehen. Sie streckt mir an der Eingangstür ihre Hand entgegen und spricht besser Deutsch, als ich nach der Namensnennung erwartet habe. Ich bemühe mich dennoch langsam zu sprechen und erkläre ihr, warum ich hier bin. Sie lächelt und lädt mich mit einer Handbewegung ein, hereinzukommen.
„Kommen Sie mit, ich haben Kaffee fertig. Ich Madina. Ich sehr interessiert, wer wohnt hier früher“, sagt die Frau und geht vor mir die Stiegen hinauf. Ich wollte zwar nur das Haus sehen, folge ihr nun aber zu ihrer Wohnung. Vor dem Eintreten bleibe ich erstaunt stehen. Es ist tatsächlich unsere alte Wohnung. Jener Teil des Flurs, den meine Eltern als Vorraum zur Wohnung dazugenommen haben, sieht immer noch gleich aus. Die beiden Türen haben meine Eltern nur geschlossen, wenn die Weißen in unserer Küche ihre Geheimtreffen abgehalten haben. Und da, der Wasserhahn am Gang. Offensichtlich gibt es in der Wohnung immer noch kein Fließwasser, die Kübel stehen neben dem Eingang. Mit jedem Schritt, den ich vorwärtsgehe, erwachen Bilder aus Kindheitstagen.
„Ich Madina“, wiederholt die Frau, „wie dein Name? Darf ich Kaffee geben?“ „Nicht gleich Freundschaft schließen“, denke ich noch, aber für einen Rückzug ist es bereits zu spät.
„Ich heiße Franzi. Ist ein Bubenname, mein Vater hat mich so genannt.“
„Franzi“, sage ich noch einmal und strecke ihr meinerseits die Hand entgegen. Madina lächelt mich breit an, zwei Zahnlücken werden sichtbar.
„Bub ist junger Mann?“, fragt sie.
„Genau.“
Unser alter Küchenherd steht noch da. Unglaublich!
„Das ist die Wohnung meiner Kindheit, darf ich mich umsehen?“, frage ich.
Madina öffnet die Tür zum Schlafzimmer. Auf dem Platz des Ehebettes meiner Eltern steht jetzt eine ausziehbare Couch. Und da, wo ein klappriges Ikea-Bett steht, stand mein Himmelbett. Vati hatte alle Betten selber gemacht. Den Himmel hatte Mutti genäht. Auch wenn das Bett nicht groß war, durften Freundinnen bei mir übernachten, wenn deren Eltern es erlaubten. Alle aus dem Kindergarten und später aus meiner Klasse wollten einmal in einem Himmelbett schlafen.
Unser alter Kleiderkasten fällt mir ein. In dem hatte Vati mit einem doppelten Boden ein Geheimfach eingebaut. Nur meiner besten Freundin, der Hannerl, zeigte ich es einmal, als wir alleine zu Hause waren. Dass darin manchmal Flugblätter und eine Pistole aufbewahrt wurden, sagte ich ihr aber nicht.
„Seit wann sind Sie hier und woher kommen Sie?“, frage ich. „Tschetschenien“, sagt sie nur, dann läutet die Türglocke.
Madina lässt mich alleine im Zimmer. Ich sehe mich auf dem Bett sitzen, wie ich Weinen und Nichtweinen üben muss. Die Erinnerungen an die Verhaftung meines Vaters und an das, was danach geschehen ist, werden lebendig. Ich halte kurz den Atem an, schließe die Augen, Traurigkeit breitet sich aus.
Ein Bub und ein Mädchen unterbrechen meine Gedanken. Sie kommen ins Zimmer, offensichtlich in ihres, die Schultaschen noch umgehängt. Ich will ihnen die Hand geben. Sie ignorieren mich, werfen ihre Taschen auf den Boden.
„Uch“, sagt Madina, „noch nichts gekocht. Bitte kommen Sie anderes Tag wieder, dann ich kann erzählen von tschetschenischen Krieg und von unsere Flucht. Ja?“
„‚An einem anderen Tag‘ heißt das“, korrigiert das Mädchen.
„Ja gerne“, sage ich, „darüber weiß ich viel zu wenig.“
Tschetschenen sind brutal. Ich wundere mich über mein Vorurteil. Diese Frau strahlt Wärme aus. Ich möchte mehr wissen, gleichzeitig habe ich ein wenig Angst. Wovor? Ich weiß es nicht. Wir vereinbaren ein Treffen für übermorgen, zeitig, damit ich sie nicht vom Kochen abhalte. Nachdenklich schaue ich von der Straße aus noch einmal hinauf zur Wohnung, dann fahre ich heim.
Zwei Tage später stehe ich wieder vor dem Haus meiner Kindheit. Wie immer komme ich einige Minuten vor der vereinbarten Zeit, aber Madina winkt mir schon vom offenen Fenster aus zu.
„Ich kommen, bitte warten“, ruft sie.
Ich nehme mir vor, den Besuch kurz zu halten. Die Begrüßung ist herzlich, sie umschließt meine Hand mit ihren beiden Händen und bittet mich vorauszugehen. Wieder bietet sie mir Kaffee an, diesmal stehen auch Kekse auf dem Tisch. Auf meine Fragen zu Tschetschenien und zu ihrer Flucht holt sie ihre Tagebücher hervor und zeigt mir eine Zeichnung darin.
„Madina mit elf“, sagt sie und übersetzt mir das Gedicht darunter, blättert weiter und erzählt von ihrer Mutter und ihrer Großmutter. Offensichtlich wurde sie in der Schule geschlagen, weil sie eine russische Mutter hatte, und in der kleinen Wohnung lebten sie ständig unter Angst vor tschetschenischen Soldaten. Auch ihre Mutter verprügelte sie öfters.
„Mutter viel Sorgen“, sagt sie und deutet auf ein Foto an der Wand. Ich tauche in ihre Vergangenheit ein. Sie zeigt mir weitere Zeichnungen, die sie als Kind angefertigt hat, stolz fügt sie hinzu: „Für Babuschka gemacht.“
Ihre Eintragungen berühren mich. Gleichzeitig fällt mir wieder Vatis Verhaftung ein. Mit Mutti musste ich auf der Küchenbank warten, während die Gestapo-Leute diese Wohnung durchsucht haben.
„Soldaten sind Schweine“, sage ich und Madina nickt.
Wie oft habe ich die Briefe meiner Eltern gelesen, wie oft die Kassiberl meines Vaters, seine auf kleine Zettel gekritzelten Geheimbotschaften aus dem Gefängnis? Sie sind fest in meiner Erinnerung verankert. Werden sie mit meinem Tod verschwinden? Erstmals wünsche ich mir, auch ein Tagebuch geschrieben zu haben. Madina steht auf und beginnt zu kochen, ich blättere noch einmal in ihren Tagebüchern. Sowohl in den Zeichnungen als auch im Schriftbild kann ich ihre Entwicklung zur jungen Frau erkennen. Jetzt scheint sie sich wohlzufühlen, in Ottakring.
Schon in der Straßenbahn nehme ich mir fest vor, auch meine Erinnerungen zu sammeln. Viele Briefe, Fotos, Artikel und Dokumente liegen in Schachteln. Ich werde alles Vorhandene neu ordnen. Vielleicht schreibe ich das nichtgeschriebene Tagebuch? Jetzt sind meine Erinnerungen noch sehr lebendig, aber was ist, wenn ich einmal nicht mehr bin. Sollte das nicht auch für meine Kinder und Enkelkinder niedergeschrieben werden?
Ich kaufe ein dickes, leeres Buch. Franzis Erinnerungen
EINGEBUNKERT
„Dein feiner Herr Schwiegersohn war wieder bei den Aufständischen, er wurde verhaftet. Deine Tochter war auch dabei“, sagte der Herr Dichter.
Ernst erwartete einen neuerlichen Gefühlsausbruch, aber Oma schloss die Haustür vor der Nase des Dichters, ging wieder zum Diwan und starrte ins Leere wie zuvor. Er drehte das Radio lauter. Dollfuß’ Rede wurde wiederholt. Jetzt erfuhren sie auch, dass die Regierung das Standrecht eingeführt hatte und dass die ersten Todesurteile vollstreckt worden waren. Ernst zog sich an, nahm die Schlüssel und verließ das Schrebergartenhaus, seine Oma saß immer noch unbeweglich im Zimmer.
Ernst kannte einige Freunde seiner Eltern. Zuerst ging er in die Rankgasse zu den Patoseks, dem Toni und der Hedi. Mit ihnen hatten sie einige Ausflüge gemacht, außerdem gab es in ihrer Wohnung immer wieder Treffen, an denen zumindest sein Vater teilgenommen hatte.
Hedi öffnete. Sie hatte rote Augen. Mit der Schürze wischte sie sich die Tränen aus dem Gesicht.
„Toni auch?“, fragte Ernst.
„Ja, sie verdächtigen ihn. Vier Hahnenschwanzler haben ihn heute abgeholt. Weißt du etwas von deinen Eltern?“
„Nein. Omas Dichter hat nur gesagt, dass Mama auch bei den Aufständischen gewesen ist und Papa verhaftet worden ist. Oma sitzt im Schrebergartenhaus, sie ist irgendwie komisch.“
Hedi bot Ernst einen Stuhl an. Die kleine Franzi war ebenfalls in der Küche, sie spielte mit dem Puppenwagen. Ernst erzählte, was passiert war, und Hedi versprach ihm, sich bei der Polizei nach dem Verbleib seiner Eltern zu erkundigen.
Erst am Rückweg bemerkte Ernst die vielen Polizisten und das Militär in den Straßen. Sie beachteten ihn nicht.
Oma hatte sich inzwischen hingelegt. Als Ernst eintrat, hob sie nur den Kopf. Ernst berichtete ihr, sie fragte nicht nach. Er wolle am Abend noch einmal nach Ottakring gehen, vielleicht könne er erfahren, wo seine Eltern seien, ergänzte er. Oma sagte nichts.
Auf dem Weg in die Rankgasse begann sein Herz heftig zu schlagen. Hedi und Toni führten eine Wäscherei und Putzerei. Vorübergehend geschlossen stand auf einem Zettel, der im Fenster der Wäscherei hing. Was konnte das heißen? Sollte er wieder umkehren? Nein, er musste wissen, was mit seinen Eltern war. Langsam stieg er die Stufen hinauf, schon am Gang hörte er Franzi in der Wohnung plappern. Er klopfte an.
Hedi nahm ihn bei der Hand und führte ihn zum Tisch. Sie ließ seine Hand nicht los.
„Deinen Papa haben sie nach Wöllersdorf ins Anhaltelager gebracht, mehr haben sie auf der Polizei nicht gesagt.“
„Und?“
„Leider, laut Auskunft eines Genossen aus dem 3.Bezirk sind einige durch die Kanonenkugeln der Vaterländischen gestorben. Ob deine Mutter auch dabei war, wusste er nicht.“
Ernst sagte nichts, schob nur Hedis Hand weg. Franzi wurde ruhig, als hätte sie alles verstanden. Dann sackte Ernsts Kopf auf den Tisch. Bald schien er vor lauter Weinen zu wenig Luft zu bekommen. Er ließ es zu, dass Hedi ihren Arm um ihn legte, das beängstigende Weinen wurde zum Schluchzen. Hedi hob ihn hoch und drückte ihn an sich. Franzi stellte sich dazu und umarmte sein Bein.
„Du kannst hierbleiben“, sagte Hedi nach einer Weile.
„Das geht nicht, die Oma“, antwortete er. Sein Schluchzen ebbte langsam ab und er löste sich aus der Umarmung. Er stand auf und wollte gehen. Hedi bot ihm ihre Begleitung an. Ernst schüttelte den Kopf.
„Und was ist mit Toni?“, fragte er an der Tür.
„Sie halten ihn in der Liesl, dem Polizeigefangenenhaus, fest, aber ich glaube, sie können ihm nichts nachweisen.“
Daheim erzählte er Oma, was er von Hedi erfahren hatte, ohne deren Namen zu erwähnen. Sie begann wieder mit dem Kopf gegen die Wand zu stoßen. Ernst konnte sie wieder beruhigen.
Eine Woche später wusste er immer noch nicht, wo seine Mutter war. Vielleicht konnte er seinen Vater in Wöllersdorf suchen. Hedi riet ihm allerdings zu warten.
An einem Nachmittag war es mit Oma wieder einmal sehr schlimm. Schon lange bevor er heimgekommen war, musste sie begonnen haben sich den Kopf zu stoßen. Diesmal ließ sie sich nicht beruhigen. Sie begann zu bluten. Ernst musste schreien, um zu ihr durchzudringen. Seine Oma starrte ihn an, wischte sich das Blut von der Stirn und zog sich zurück. Ernst richtete sich sein Bett im kleinen Wohnzimmer des Schrebergartenhauses. Es war kalt.
„Morgen ziehen wir wieder nach Ottakring, vielleicht ist Hansl schon daheim“, sagte Oma eines Tages. Wie Ernsts Eltern hatte sie eine Wohnung im Sandleitenhof.
Ernst sagte nichts darauf. Er hatte Hedi gefragt und wusste, dass sein Opa nicht mehr heimkommen konnte. Die meisten Soldaten aus den Isonzoschlachten hatten ihr Leben in den Bergen gelassen. Die wenigen Überlebenden waren längst wieder zu Hause.
Sträucher und Bäume zeigten erste grüne Blätter, der Kirschbaum im Schrebergarten öffnete seine Blüten. Der Umzug dauerte doch länger als geplant. Seit drei Tagen packte Oma alles in Schachteln, Taschen und in ihren großen Lederkoffer. Der Herr Dichter war nicht mehr gekommen. Ihn hätte Ernst gerne gefragt, wie er ins Gymnasium kommen könnte.
Die Ottakringer Wohnung verließ seine Oma nicht mehr, er musste sie versorgen. An den Wochenenden besuchte er Freunde im Negerdörfl, auch zu Hedi konnte er jederzeit gehen. Sie war froh, wenn ihre Kleine jemanden zum Spielen hatte.
Nach einigen Monaten kam Toni wieder heim, sie hatten ihm nichts nachweisen können. Ernst wusste, dass sich Genossen von den Sozialisten nach wie vor in der Wohnung der Patoseks trafen. Die meisten von ihnen waren inzwischen zu den Kommunisten gegangen.
Oma hatte verlernt zu lächeln. Ernst konnte sich nicht mehr an seine fröhliche Großmutter erinnern. Sie aß immer weniger. So schaute sie auch aus. Zwei Jahre lebte Ernst schon mit seiner Oma in der Ottakringer Wohnung und immer noch musste er sie mit Lebensmitteln versorgen. Sie fragte nie, woher er sie hatte. Sie wusste nicht, dass er manchmal von Hedi und Toni etwas Geld bekam, und er sagte ihr auch nicht, was er alles anstellen musste, um das Essen zu organisieren.
Seit einem halben Jahr stand sie morgens nicht mehr auf, bevor Ernst zur Schule ging. Irgendwann machte sie sich Tee und aß ihren Zwieback dazu, das sah er an den Tassen und an den Bröseln auf der Kredenz. Das Kochen hatte sie eingestellt und auch von Hansl hatte sie seit Langem nicht mehr gesprochen. Nur die Wäsche, die machte sie noch für Ernst.
Wieder einmal war er im Negerdörfl. Schon vor einigen Monaten hatte sich ein kleinerer Freundeskreis gebildet. Von den meisten wusste Ernst, dass ihre Eltern Sozialisten waren, nur einer erzählte nichts von seiner Familie, wollte aber auch mitmachen. Zu siebt hatten sie sich in einem Erdloch einen Bunker eingerichtet. Er wurde ihr geheimer Treffpunkt, auch ihre Namen sollten verdeckt bleiben. Ernst wollte Erich Mühsam sein, die anderen überlegten noch. Er wickelte sechs Zigaretten aus einem Taschentuch und erntete Applaus. Rosa wollte nicht rauchen, das wusste er. Sie las aus einer Broschüre über die Sozialistenprozesse vor. „Katholen-Faschisten“ nannten sie die Vertreter des Austrofaschismus, und die wollten tatsächlich die Führung der Revolutionären Sozialisten3 wegen Hochverrates zum Tode verurteilen. Rosa erklärte auch, dass nur die internationale Aufmerksamkeit diese Todesurteile verhindert hatte. Eingesperrt wurden sie trotzdem.
Anschließend diskutierten sie noch lange über die Nationalsozialisten und über den Österreicher Hitler, der seit drei Jahren Reichskanzler in Deutschland war. Sie waren sich nicht einig, ob die Austrofaschisten oder die Nationalsozialisten gefährlicher waren.
„Die Nationalsozialisten sind ja auch Sozialisten“, sagte einer. Ernst widersprach heftig. Seine Eltern hatten immer gesagt, dass mit den Nazis auch ein Krieg kommen würde. Seine Meinung wurde ernst genommen.
„Vielleicht lassen sie deinen Vater bald frei“, sagte Rosa zum Abschied zu Ernst. „Es könnte helfen, dass die faschistische Regierung von europäischen Regierungen beobachtet wird.“
Die Dämmerung kroch in die Stadt. Die Fenster des Sandleitenhofs waren erleuchtet, nur in Omas Wohnung brannte kein Licht. Ernst beschleunigte die Schritte, nahm jeweils zwei Stufen hinauf in den dritten Stock. Die Wohnungstür war nur angelehnt. Seine Oma lag mit einer blutigen Kopfwunde in der Küche. Sie brummte monoton vor sich hin. Ernst kniete sich zu ihr auf den Boden, tätschelte ihre Wangen und wollte ihr das Blut von der Stirn wischen. Es war bereits eingetrocknet. Oma reagierte nicht, starrte zur Decke. Ernst füllte ein Glas mit Wasser und goss es ihr über das Gesicht. Nichts. Nur ihr Brummen war weiter zu hören. Er hob einen ihrer Arme hoch und ließ ihn wieder los. Ohne Widerstand fiel er zu Boden.
Ernst zog die Tür von außen zu und lief, so schnell er konnte, zu Toni und Hedi. Nur langsam beruhigte sich sein Atem. Stockend berichtete er.
„Komm“, sagte Toni, „ich gehe mit. Unser Hausarzt wohnt oben in der Maroltingergasse, den nehmen wir gleich mit.“
Der Arzt war daheim. Er nahm seine lederne Tasche und folgte ihnen. Oma lag immer noch auf dem Küchenboden, jetzt hatte sie etwas Schaum vor dem Mund. Der Doktor nahm sein Stethoskop aus der Tasche, öffnete Omas Bluse und horchte sie ab. Danach leuchtete er mit einer Taschenlampe in ihre Augen. Beinahe unmerklich zuckte er mit den Schultern. Als Nächstes suchte er unter seinen Werkzeugen einen kleinen Hammer. Mit dem schlug er leicht auf Omas Knie. Weder das Knie noch Oma bewegten sich.
„Bleiben Sie bei ihr. Es könnte sein, dass sie beim Aufwachen herumschlägt. Ich rufe von daheim aus in Steinhof an, sie muss dringend behandelt werden.“ Er packte seine Sachen ein und verschwand.
„In die Irrenanstalt nach Steinhof?“, fragte Ernst. Toni nickte. Ungefähr nach einer halben Stunde begann Oma sich zu bewegen.
„Martha, Martha“, jammerte sie jetzt und wollte sich aufsetzen. Toni kniete sich zu Oma, hob sie auf und trug sie zum Diwan.
„Hansl, Hansl“, flüsterte sie. „Du bist da, ich wusste, du kommst zurück, du musst mir helfen, wir müssen Martha suchen. Martha, Martha, Martha!“
Danach verstummte sie wieder. Toni nahm ihre Hand, aber sie reagierte nicht. Nach einer weiteren halben Stunde hörten sie ein Auto vorfahren, es war die Rettung. Zwei große Männer in grauer Anstaltskleidung traten ein. Auf der Tragbahre lag ein kleines Paket. Es entpuppte sich als Jacke, die Oma angezogen wurde. Am Rücken wurden die verlängerten Ärmel zusammengebunden. So legten sie Oma auf die Bahre, schnallten sie fest und trugen sie hinaus. Sie ließ es geschehen.
Nachdem die Wohnungstür ins Schloss gefallen war, konnte Ernst sich nicht mehr zurückhalten und brach in Tränen aus.
„Jetzt bin ich ganz allein“, stieß er zwischen seinem Schluchzen hervor.
„Du wirst niemals allein sein“, sagte Toni und nahm ihn in den Arm. „Für heute Nacht gehst du mit zu uns. Wir haben in der Werkstätte ein Gästebett für dich. Morgen fragen wir nach, was mit deiner Oma ist, und danach schauen wir weiter.“
„Sie haben sie auf den Lemoniberg gebracht“, sagte Toni daheim zu Hedi. Ernst ließ sich erklären, dass die „Heil- und Pflegeanstalt für Geistes- und Nervenkranke“ wegen der goldenen Kirchenkuppel auch Spiegelgrund oder Lemoniberg genannt wurde. Es sei die größte Irrenanstalt Europas, ergänzte Hedi, da würden sie schon gut für seine Oma sorgen.
Es war spät geworden. Hedi zeigte Ernst das Bett in der Werkstätte hinter dem Geschäftslokal der Wäscherei. Wie seine Mutter legte sie zum Einschlafen ihre Hand auf seinen Kopf.
„Gut geschlafen?“, weckte ihn Toni am nächsten Morgen. Die Kleine war auch mit dabei. Sie schien sich über seine Anwesenheit zu freuen. Beim Frühstück schlug Toni vor, gleich nach dem Kakao mit dem Motorrad in die Steinhofgründe hinaufzufahren, um nach Oma zu fragen.
Der Ledersturzhelm passte, der musste von Hedi sein. Ernst umklammerte Toni fest, schaute aber trotzdem nach links und rechts, ob ihn jemand von seinen Freunden sehen konnte. Immerhin fuhr er zum ersten Mal auf einem Motorrad. Er war noch nie in den Steinhofgründen gewesen, obwohl das gar nicht so weit von Ottakring entfernt war. Toni fragte beim Portier. Sie durften einfahren. Ernst hatte ein großes, vergittertes Haus erwartet, wo Verrückte an den Fenstern rüttelten und schrien. Dazu noch Ärzte in weißen Mänteln sowie Schwestern und Pfleger in diesen grauen Anzügen, wie er sie bei Omas Abtransport gesehen hatte. Aber hier waren Wiesen und Büsche zwischen Gebäuden, die der Portier Pavillons nannte. Sie fuhren direkt zum angegebenen Haus und läuteten. Innen war es dann doch so, wie Ernst befürchtet hatte.
Ein Pfleger führte die beiden in ein Zimmer, in dem zehn Betten standen. Ernsts Oma lag in einem davon. Sie hatte noch immer diese Jacke an und starrte zur Decke. Toni fragte den Pfleger, wann sie ansprechbar sein würde.
„Vielleicht in zwei Tagen. Wir haben sie einmal ruhiggestellt, das tut ihr sicher gut. Und kennen Sie eine Martha, nach der hat sie bei der Einlieferung geschrien?“
„Das ist meine Mutter“, sagte Ernst und Toni machte dem Pfleger ein Zeichen, nicht mehr zu sagen.
Sie stiegen wieder aufs Motorrad. Bereits nach einigen Kurven hielt Toni neben einer großen Wiese bei einer Bank an. Die Wälder des Wienerwaldes lagen vor ihnen. Toni erklärte Ernst, dass er bisher nicht offen geredet hatte, weil er von der Beziehung seiner Oma zum Nazi-Dichter wusste, und da wollte er nichts riskieren. Er fragte Ernst, was er über seine Eltern erfahren hatte und ob er Vermutungen habe.
„Sie werden wohl von den Faschisten ermordet worden sein“, sagte Ernst und blickte zu Boden. Toni legte den Arm um seine Schultern.
„Du bist jetzt fast zwölf und sollst die Wahrheit erfahren. Die Schweine haben den Karl-Höger-Hof im Elften mit Kanonen beschossen, obwohl sie wussten, dass dort die allermeisten unbewaffnet waren. Eine Kugel hat deine Mutter tödlich getroffen. Deinen Vater haben sie verhaftet und zwei Tage später in Wöllersdorf hingerichtet. Ohne Gerichtsverfahren, einfach erschossen.“
Ernst war geschockt. Er ballte die Fäuste.
„Irgendwann werde ich meine Eltern rächen“, sagte er mit zittriger Stimme.
Lange saßen sie oben in den Steinhofgründen, während Toni erzählte, wie es ihm ergangen war, nachdem er von den Hahnenschwanzlern eingesperrt worden war. Ernst hörte aufmerksam zu. Toni erklärte auch Näheres zur Untergrundgruppe, die sich bei ihnen treffe und zu der ja auch sein Papa manchmal gekommen sei.
„Ich habe gestern noch mit Hedi geredet, du kannst ganz bei uns bleiben, solange du möchtest. Wir freuen uns auf dich.“ Ernst wollte Toni umarmen, beließ es aber bei heftigem Nicken.
„Wir werden Die Weißen genannt“, setzte Toni fort. „Vielleicht magst du für deinen Papa bei uns mitmachen? Für diesen Fall bekommst du einen Decknamen. Du wirst dann weder der Ernst noch der Ernsti sein. Lass dich überraschen, die Decknamen sucht bei uns Hedi aus. Du darfst mit niemanden über unsere Gruppe reden.“
„Und die Wohnung?“, fragte Ernst.
„Wir holen heute noch deine wichtigsten Sachen für die Schule und deine Kleidung. Dann warten wir ab, wie schnell deine Oma wieder gesund wird. Wenn sie zurückkommt, kannst du entscheiden, wo du bleiben willst. Für Nachrichten, die Gruppenfremde nicht verstehen sollen, haben wir eine Geheimschrift entwickelt, die wird dir Hedi erklären, auch das darfst du niemanden sagen.“
„Versprochen! Außerdem weiß ich jetzt schon, wo ich wohnen möchte, Oma wird sicher einige Zeit im Krankenhaus bleiben müssen.“
Danach war die Stimmung gelöster, sie setzten die Helme auf und stiegen aufs Motorrad.
„Wir haben Zuwachs bekommen“, sagte Toni daheim. Hedi drückte Ernst fest an sich. Er ließ die Arme hängen, aber es fühlte sich gut an.
„Morgen haben wir unser Treffen, da stellen wir dich vor. Alle gehen durch das Geschäft und dann über die Werkstatt zu uns herauf, also schreck dich nicht. Dann verrate ich dir auch deinen neuen Namen.“
„Was soll ich in der Schule sagen?“
„Ja, das hätte ich beinahe vergessen“, setzte Hedi fort. „Für heute habe ich dir eine Entschuldigung geschrieben, weil deine Oma ins Krankenhaus musste. Und morgen gehe ich in deine Schule und erkläre dem Direktor, dass ich künftig deine Schularbeiten unterschreibe und er mich verständigen soll, wenn er etwas von mir braucht.“
„Danke. Ist es in Ordnung, wenn ich noch zu meinen Freunden ins Negerdörfl gehe?“, fragte Ernst.
Es fiel ihm unsagbar schwer, im Bunker nichts über die Weißen
IHR JUNGEN, SCHLIESST DIE REIHEN
Es war im Sommer, nachdem ich vier geworden war. Ich erinnere mich noch ganz genau. Wieder einmal kamen die Freunde meiner Eltern zu uns.
„Die Weißen kommen heute“, sagte Mutti. „Bleib im Zimmer.“
Die Tür blieb aber wie immer einen Spalt offen und ich lauschte den Gesprächen in der Küche. Über Herbert und Martha Peter, die Eltern von Ernst, redeten sie auch heute wieder. Warum sie sterben mussten, dass der Dollfuß und die Katholen dafür verantwortlich waren, warum sie von den Sozialisten im Stich gelassen wurden, wo es genau passierte und wie sie starben – ich verstand nicht alles, aber dass es viel Böses gab, das war mir klar. Auch diesmal fragte Mutti am Ende der Zusammenkunft, wer diese Woche Blumen auf das Grab von Herbert und Martha legen würde.
Einige Wochen später waren die Weißen wieder da und saßen bei meinen Eltern. Wieder wurde über die beiden Toten diskutiert. Ich wollte auch etwas tun und nahm mir vor, Blumen auf das Grab von Herbert und Martha zu legen. Mit Mutti war ich schon öfter am Ottakringer Friedhof gewesen, den Gandhi besuchen. Er war einer von den Weißen und arbeitete mit seiner Frau in der Friedhofsgärtnerei.
„Ich gehe kurz in den Hof“, sagte ich zu Vati und er nickte.
Auf dem Weg zum Friedhof musste ich die Maroltingergasse überqueren. Die wenigen Autos hörte man schon von weitem und die Straßenbahnen waren ohnehin nicht zu übersehen. Auf der anderen Straßenseite gab es eine Wiese mit Blumen, das wusste ich, denn dort hatte ich für Mutti schon manchmal Blumen gepflückt. Ich rupfte gelbe, weiße und lilafarbene Blumen sowie einige Gräser aus. Bis zum Friedhof musste ich noch einmal nach links und einmal nach rechts abbiegen.
Gandhis Frau sah mich von der Gärtnerei aus. Zuerst fragte sie mich, ob die Weißen noch bei uns seien, woraufhin ich nur leicht nickte, darüber durfte ich ja nicht reden. Sie wird wohl gewusst haben, dass der Gandhi bei uns in der Küche saß, zog die Augenbrauen hoch und bückte sich wieder zu ihren Pflanzen. Dann hob sie den Kopf noch einmal.
„Und du bist ganz alleine?“
„Ja“, sagte ich voller Stolz, „ich bringe Blumen zu Herbert und Martha.“
Das Grab war leicht zu finden. Es war das Einzige mit kleinen roten Fahnen. Ich machte es wie Mutti. Die alten Blumen nahm ich aus der Vase und steckte meinen Strauß hinein.
Den Weg hinaus zum Friedhofstor fand ich nicht gleich. Plötzlich stand Gandhis Frau neben mir. Sie musste mich von der Friedhofsgärtnerei aus beobachtet haben.
„Na, Franzi“, sagte sie, „bist du vielleicht doch noch ein bisserl zu klein für einen Friedhofsbesuch, so ganz alleine? Weiß deine Mutter, wo du bist?“
Ich schaute zu Boden, daraufhin nahm sie mich an der Hand und führte mich heim. Wir waren noch nicht einmal in die Rankgasse eingebogen, da sah ich den Gandhi und Mutti von Weitem aufgeregt winken. Inge und der 7er-Fritzl kamen auf uns zugelaufen, dahinter Vati, im Schlepptau Wilma und Gustl. Alle, die davor noch bei uns in der Küche gesessen waren, riefen aufgeregt durcheinander, konnten sich gar nicht beruhigen.
„Wo warst du? Wir haben dich überall gesucht!“, schrie mich Mutti an. Ich wollte doch nur Blumen aufs Grab legen.
An diesem Abend brachte mich Vati ins Bett. Oft erzählte er mir dabei lustige Geschichten, diesmal war er ernster.
„Wie wäre es, wenn du einen Bruder bekommst?“, fragte er. „Du kennst ihn, wir wollen den Sohn von Herbert und Martha zu uns nehmen.“
Ich setzte mich auf und umarmte ihn. Einen Bruder wollte ich immer schon haben.
„Ich habe jetzt einen Bruder, der ist schon zwölf“, sagte ich zur Kindergartentante, nachdem wir uns in der Morgenreihe aufgestellt hatten.
„Die Franzi fantasiert schon wieder“, wollte es die Tante mit einer wegwerfenden Handbewegung abtun und lachte blöd.
„Wirklich!“, sagte ich und stampfte mit dem Fuß auf. „Er heißt Tscheri und wohnt jetzt bei uns.“
Als die Tante wissen wollte, wo er vorher gelebt habe und warum er plötzlich zu uns gekommen sei, erinnerte ich mich an die Worte meiner Mutter. Ich sollte von daheim nichts erzählen. Ich schwieg.
„Seht ihr, Kinder, Lügen haben kurze Beine“, sagte die Tante jetzt zu den anderen Kindern. Und sie forderte alle auf, ihr drei Mal nachzusprechen:
„Lügen haben kurze Beine, Franzi.“
Die Kinder mussten diesen Satz noch zwei Mal wiederholen.
„Lauter“, schrie sie dazwischen. Danach mussten wir wieder dieses Lied für Dollfuß singen. Ich verstand den Text nicht und bewegte nur die Lippen, damit die Tante glaubte, ich sänge. Der Dollfuß hatte meinen Vater einsperren lassen und Vati hätte bei so einem Lied sicher auch nicht mitgesungen. Bei der Textstelle Ihr Jungen, schließt die Reihen gut, ein Toter führt uns an dachte ich mir: „Recht geschieht’s ihm.“
Warum Lügen kurze Beine haben sollten, verstand ich auch nicht, aber damals beschloss ich, im Kindergarten nichts mehr zu erzählen. Vor dem Nachhausgehen steckte mir die Tante noch einen Zettel in die Kindergartentasche.
Daheim, in der Küche, setzte ich mich zum Tisch. Es roch gut.
„Was gibt es heute?“, fragte ich.
„Blaukraut mit Semmelknödel“, sagte Mutti und klopfte drei Mal mit dem Besenstiel an die Wand. Das war das Zeichen für Tscheri, zum Essen zu kommen. Es dauerte etwas, bis er über die hinteren Stiegen von der Werkstatt heraufkam. Mutti schaute inzwischen in die Kindergartentasche und entdeckte den Zettel.
„Was war los Franzi, warum soll ich morgen in den Kindergarten kommen?“, fragte sie.
„Ich habe nur gesagt, dass ich jetzt einen Bruder habe und dass er Tscheri heißt. Danach haben mich alle eine Lügnerin schimpfen müssen. Drei Mal sogar.“
„Was? Was genau hast du gesagt? Erzähl es mir, und auch, was die Tante gesagt hat.“
Ich erzählte alles. Beim Lied für den Dollfuß wurde Mutti wütend.
„Mit der werde ich morgen ein Wörtchen reden. Aber jetzt essen wir, Vati kommt heute zu Mittag nicht heim.“
Tscheri hatte die letzten Worte meiner Erzählung gehört und schaute mich komisch an. Bei Blaukraut und Knödel vergaß ich den Kindergarten. Ich wollte aufstehen, aber Mutti hielt mich zurück und bat auch Tscheri noch dazubleiben.
„Es ist wichtig, die Wahrheit zu sagen, aber manchmal ist es besser, nichts zu sagen. Vielleicht haben wir dir gestern zu wenig erklärt, warum der Tscheri bei uns ist.“
Ich war gespannt. Hatte ich wirklich gelogen? Mutti legte je eine Hand auf meinen und auf Tscheris Unterarm und erklärte:
„Franzi, du weißt, vor drei Jahren haben die Hahnenschwanzler deinen Vater abgeholt und eingesperrt. Das war die Heimwehr des Dollfuß-Regimes. Die Nazis haben Dollfuß dann umgebracht, aber seine katholischen Faschisten haben wir immer noch am Hals. Vati haben sie nach zwei Monaten wieder frei gelassen. Den Eltern von Tscheri, dem Herbert und der Martha, ist es aber noch viel schlimmer ergangen. Sie wurden von den Faschisten ermordet. Da warst du noch ein kleines Bauxerl. Aber das Grab kennst du ja.“
Muttis Blick verriet mir, sie war mir meines Ausflugs wegen immer noch böse.
„Tscheris Oma hat sich danach um ihn gekümmert, hat ihn zu sich genommen. Vor einer Woche musste sie allerdings in ein Krankenhaus gebracht werden. Vati hat die Tscheri-Oma auch nicht beruhigen können. Tscheri ist zwar schon fast ein Großer, aber er wäre ganz alleine gewesen, daher haben wir ihn bei uns aufgenommen. Er wird bei uns bleiben, obwohl er nicht dein Bruder ist. Du weißt schon, nur bei uns nennen wir ihn Tscheri, sonst wird er Ernst gerufen. Und Franzi, was wir daheim reden, geht niemanden etwas an, das ist ganz wichtig. Du brauchst nicht lügen, aber wenn jemand etwas wissen will von dir, kannst du sagen, dass sie mich oder Vati fragen sollen.“
Tscheri ließ den Kopf immer tiefer sinken, schließlich gab ihm Mutti ein Taschentuch. Er ballte die Faust.
„Ich werde mit niemandem über die Gespräche in unserer Wohnung reden“, versprach ich meiner Mutter und sie drückte mir einen Kuss auf die Stirn. Tscheris Familiennamen hatte ich schon gehört, aber ich nahm mir fest vor, den Namen zu vergessen, dann konnte ich ihn auch nicht verraten.
Am nächsten Morgen ging meine Mutter mit mir in den Kindergarten und sprach sofort mit der Tante. Zuerst klärte sie sie über Tscheri auf. Dass er nicht mein Bruder sei, aber dass er sehr wohl bei uns wohne, und dass es wunderschön sei, wenn ich ihn als Bruder bezeichne.
„Unser Ernst geht noch in die Schule und er hat keine Eltern mehr. Sie sind erschossen worden, von wem, werden sie sich denken können.“
Mutti schaute die Tante wütend an, dann legte sie erst richtig los:
„Wenn ich noch einmal höre, dass Sie die Kinder auffordern, die Franzi oder auch ein anderes Kind auszulachen oder sie gar eine Lügnerin zu nennen, dann werden Sie mich erst so richtig kennenlernen. Dann werde ich jeden Tag in den Kindergarten mitkommen und sowohl den Kindern als auch den Eltern erzählen, dass Sie gar keine Ausbildung als Kindergärtnerin haben. Sie können sich darauf verlassen, alle werden danach wissen, dass Sie offensichtlich nur wegen Ihrer Beziehung zu diesem Heimwehrführer hier arbeiten dürfen. Und die faschistischen Lieder haben im Kindergarten auch nichts verloren. Haben wir uns verstanden?“, fügte sie noch hinzu.
Die Tante sagte nichts. Ich wurde nie mehr ausgelacht. In den darauffolgenden Tagen wollten noch mehr Freundinnen bei mir übernachten. Niemand mochte die Tante und offensichtlich haben viele die Worte meiner Mutter gehört. Ich war stolz, wenn meine Freundinnen Mutti daheim bewundernd anschauten.
Tscheri war acht Jahre älter als ich, trotzdem spielte er mit mir, am öftesten „Mensch ärgere dich nicht“. Er half mir auch beim Basteln der Weihnachtsgeschenke für Mutti und Vati. Ich war gerne in seinem kleinen Zimmer, das meine Eltern für ihn eingerichtet hatten. Für den Weihnachtsabend hatte Mutti einen halben Truthahn organisiert, Tscheri durfte dem Braten unterschiedliche Früchte zugeben. Zu meiner Mutter sagte er Hedi, aber manchmal auch Mutti, das gefiel ihr, sie streichelte ihm dann meist über die Haare. Nach einiger Zeit nannte er meinen Vater den Weißen. Ich glaube, das war, nachdem er in die Gruppe aufgenommen worden war.
Jeden Montag trafen sich die Freunde meiner Eltern bei uns in der Küche. Ich blieb währenddessen entweder in Tscheris Zimmer oder ich spielte im Kabinett mit meiner Puppe, dann konnte ich gut verstehen, was in der Küche besprochen wurde. Im letzten Kindergartenjahr kamen die Mitglieder der Montagsrunde immer seltener zusammen. Kaum waren alle da, gingen die Ersten schon wieder.
„Damit niemand vermutet, dass sich hier eine Gruppe trifft“, erklärte mir Tscheri auf mein Nachfragen, bekräftigte noch einmal, dass er jetzt auch Mitglied der Weißen sei, und mahnte meine Schweigepflicht ein.
„Wir müssen noch vorsichtiger werden. Die Braunhemden werden immer mehr in den Straßen. Mit den Nazis wird es noch schlimmer als mit den Christlichsozialen“, hörte ich Mutti eines Abends sagen. Mein Vater versuchte sie zu beruhigen.
„Wir sollten uns wieder einer Organisation anschließen“, sagte Vati, „damit uns jemand hilft, wenn Gefahr besteht. Ich gehe morgen zu einem Geheimtreffen der Kommunisten.“ Ich wusste nicht, was Kommunisten waren, aber wenn Vati zu denen wollte, mussten sie gut sein.
„So heiß, wie gekocht wird, wird es nicht gegessen“, war einer seiner Lieblingssprüche. In unserer Küche redeten sie immer wieder über Flugblätter, wo sie gedruckt werden konnten und wer sie verteilen konnte. Vati wurde jetzt von allen „der Weiße“ genannt
„Ich bin zu den Kommunisten gegangen“, sagte er bei einem der nächsten Treffen. „Ich kann nicht vergessen, wie feig die Sozialisten 1934 waren. Sie haben uns alle im Stich gelassen und sind damit auch für den Tod von Herbert und Martha mitverantwortlich. Wir brauchen eine Organisation.“
Alle stimmten zu, der 7er-Fritzl und Wilma sagten, dass sie auch schon beigetreten seien. Nur Gandhi äußerte Bedenken.
„Ich weiß nicht, die Kommunisten. Sollten wir nicht Kontakt zu den Revolutionären Sozialisten aufnehmen?“
Gandhi blieb an diesem Abend noch da, er und Vati redeten lange. Am Ende umarmten sie sich, ich glaube, sie mochten sich besonders gerne.
Meinen Ausflug zum Ottakringer Friedhof hatten meine Eltern bald vergessen und ich durfte wieder alleine in der Gasse spielen. Am liebsten mit meinem Puppenwagen, den hatte mein Vater selbst gebaut. Er hatte Klappfenster an den Seiten und das Dach war abnehmbar. Niemand hatte damals so tolle Spielsachen, in Ottakring schon gar nicht, und ich war sehr stolz darauf. Einen Roller hatte ich auch. Er war aus zwei Brettern zusammengesetzt, eines davon war beweglich. Damit war ich die „Kaiserin“ in unserer Gasse. Ich ließ die anderen Kinder mit meinem Roller fahren. Sie standen Schlange und nacheinander durften sie einmal um den Häuserblock düsen.
Bei den Faltbootfahrten mit meinen Eltern saß auch Tscheri im Boot. Wenn ich einmal pinkeln musste, fuhren zwei Boote nebeneinander, ich stellte mich mit je einem Fuß in ein Boot und urinierte in die Donau.
Im Sommer war ich zwei oder drei Wochen mit den Freunden meines Vaters in der Lobau, einem Augebiet im Nordosten Wiens. Der Großteil von ihnen war arbeitslos und wir lebten im Zelt. Meine Eltern kamen samstags am späten Nachmittag zu uns, blieben den Sonntag über und fuhren am Abend wieder heim, weil sie ja im Geschäft arbeiten mussten. Ich blieb bei den Arbeitslosen. Die Frauen kochten abwechselnd für alle. Die Männer hatten Bänke und einen Tisch aus kleinen Baumstämmen und Brettern gebaut. Jeder legte sich zum Essen ein Handtuch auf die Bank, alle waren nackt. Ich konnte noch nicht schwimmen, durfte aber mit einem großen Reifen in den Lobaulacken herumpaddeln.
Im Herbst darauf wurde bei den Treffen der Weißen mehr über die Nazis als über die Unterdrückung durch die österreichische Regierung geredet. Ich wollte Mutti fragen, warum die Nazis so gefährlich seien, aber an diesem Abend wollte sie mir nichts erklären. Früh drehte sie mir das Licht ab, aber ich lag noch immer wach in meinem Himmelbett. Vati kam erst sehr spät heim und schon an der Tür schimpfte Mutti auf ihn ein. Sie war so wütend und sagte, dass sie mit mir weggehen würde und dass sie Vati nicht mehr liebhabe. Ich zog mir die Decke über den Kopf, damit sie mich nicht weinen hörten. Meine Eltern redeten noch lange in der Küche. Irgendwann schlief ich doch ein. Als ich von ihren Liebesgeräuschen aus dem Ehebett aufwachte, wusste ich, sie hatten sich wieder versöhnt. Erst viele Jahre danach, es war nach dem Krieg und wir lebten bereits in Hietzing, erzählte mir meine Mutter, dass sie Vati damals auf eine Beziehung mit einer anderen Frau draufgekommen war. Ich konnte es gar nicht glauben. Obwohl: Sogar die Kindergartentante hatte mich einmal gefragt, warum mich mein fescher Papa nie abholen komme.
Es war jedenfalls schon nach meinem sechsten Geburtstag, als mein Vater am frühen Abend heimkam und nur sagte:
„Schnell, das Radio aufdrehen, der Schuschnigg hält eine Ansprache.“
Ich verstand das allermeiste nicht. Über den Schuschnigg war in der Gruppe öfter gesprochen worden. Dass sie ihm zwar nicht trauten, wenn es aber stimme, dass er Österreich verteidigen würde, was er gesagt hatte, dann würden sie ihn auch unterstützen. Wenn es sein müsse auch mit Waffen, hatte Vati gesagt. Mir kam die Rede sehr lang vor. Am Ende begann Mutti zu weinen, da wusste ich, dieser Schuschnigg musste etwas Schreckliches gesagt haben.
„Jetzt geht’s los“, schluchzte meine Mutter und Vati nahm sie und mich in die Arme. Er versuchte uns zu trösten. Ich musste auch mitweinen.
Noch am selben Abend fuhr Vati mit dem Fahrrad weg, um alle aus der Gruppe für den nächsten Tag zu uns in die Küche einzuladen. Es war ein Sonntag. Noch nie hatte ich meinen Vater so bestimmt und laut reden gehört. Bis heute kann ich mich an seine Worte erinnern:
„Heute müssen wir uns nicht verstecken. Die Hahnenschwanzler sind abgetreten und die deutschen Nazis sind noch nicht da. Aber sie kommen und wir müssen uns vorbereiten.“
Ich hörte aufmerksam zu. Der 7er-Fritzl war als Jude besonders gefährdet. Er wollte nach Bolivien auswandern und gleich nächste Woche einen Ausreiseantrag stellen. Wir könnten auch nachkommen, sagte er. Das machte mir Angst. Musste ich von meinen Freundinnen weg, sollte ich sie nie mehr sehen? Dann redeten sie noch über Flugblätter und wer diese verteilen sollte, über andere jüdische Familien und wie sie ihnen helfen konnten, und über den Hitler, der eigentlich Österreicher war, aber jetzt als deutscher Reichskanzler Krieg führen wollte. Zum ersten Mal sah ich, wie am Ende alle aufstanden und sich die Hände reichten. Vati sprach sehr langsam:
„Wir müssen jetzt ganz stark sein. Behalten wir unsere Montagstreffen bei, aber ab sofort treffen wir uns zum Tarockieren, wenn jemand nachfragen sollte. Sollte jemand von uns verhaftet werden, gibt es nur eins: Schweigen! Wenn jemand auch die geringsten Informationen preisgibt, hören sie nicht auf zu foltern, bis der Tod eintritt. Schweigen ist für uns alle lebenswichtig.“
An Gandhi gerichtet sagte mein Vater noch, dass ich ihm am nächsten Tag noch etwas bringen würde und für Wilma, Gustl und Inge würden Hedi oder Tscheri spätestens am Montag die neuen Flugblätter bringen. Ich war stolz, mein neuer Bruder war ein gleichwertiges Mitglied bei den Weißen geworden.
Am Sonntag trug mein Vater den Puppenwagen vom Hof in die Wohnung. Ich beobachtete, wie er die Matratze herausnahm, die Pistole aus dem Geheimfach hineinlegte und die Matratze wieder draufgab.
„Fahr mit dem Puppenwagen hinauf zum Gandhi“, sagte er, „den Weg kennst du ja. Tscheri begleitet dich.“
Er lächelte mich an, gab mir einen Kuss auf die Stirn und ich machte mich sofort auf den Weg. Gandhi wartete schon auf mich. Obwohl er mich zu seiner Frau ins Friedhofsgärtnerhaus schickte, sah ich, wie er die Pistole aus dem Puppenwagen nahm und sie in ein vorbereitetes Erdloch legte.
Am Montag begleitete mich Mutti in den Kindergarten und das war gut. Die Tante war nicht erschienen und die Helferin schickte alle wieder nach Hause.
„Die Ratten verlassen das sinkende Schiff“, sagte meine Mutter und brachte mich zu Tante Erni in die Degengasse. Sie war wie eine Großmutter, obwohl wir gar nicht verwandt waren. Sie hatte Mutti schon ihre Hilfe in der Wäscherei angeboten, als Vati von den Austrofaschisten eingesperrt worden war.
Beim nächsten Treffen der Gruppe waren alle entsetzt. Niemand hätte gedacht, dass sich so viele Österreicher am Heldenplatz versammeln würden, um Hitler zu begrüßen.
„Ich habe mir das von Weitem angeschaut“, berichtete Gustl. „Zigtausende, wenn nicht sogar Hunderttausende haben die Hand zum Hitlergruß erhoben und bei seiner Rede ‚Sieg Heil‘ gebrüllt.“
Dann war es für eine ganze Weile still.
„In Ottakring ist niemand aufmarschiert“, sagte Gandhi, aber alle wussten, es war ein schwacher Trost.
Bald nach diesen Tagen kam eine Frau zu uns, die mit meinen Eltern, mit mir und Tscheri Spanisch lernte. Da wusste ich, meine Eltern planten wirklich, in dieses ferne Land auszuwandern. Der 7er-Fritzl bekam die Ausreisegenehmigung.
„Weil er Jude ist“, sagte mein Vater, „aber wir wurden abgelehnt, weil ich keine Begründung angeben konnte.“
Zum letzten Treffen vor seiner Ausreise kam der Fritzl mit einigem Schmuck, seinem Silberbesteck und zwei Uhren.
„Verwendet das für einen guten Zweck“, sagte er, „die nehmen mir ohnehin alles weg, bevor ich die Wohnung verlasse. Einer von diesen Gildemeester4 hat mich besucht und wollte alle Sachen notieren, damit nichts verloren geht. Ich wusste natürlich, dass das die Nazi-Räuber sind.“ Der 7er-Fritzl musste lachen. Die mitgebrachten Gegenstände hatte er bereits davor versteckt.
Ich war erleichtert, musste nicht mehr Spanisch lernen und konnte weiterhin mit meinen Freundinnen spielen.
Einige Monate später kam eine Karte aus La Paz. Fritzl schrieb, dass er dort als Uhrmacher arbeiten konnte und sogar für Tscheri einen Lehrplatz gefunden hätte. Vati las die Karte beim nächsten Treffen vor und legte sie dann in unser Geheimfach.
Im April, die ersten Palmkätzchen trieben bereits aus, sollte das österreichische Volk über die Vereinigung von Österreich und Deutschland abstimmen. Alle wussten, dass dies keine freie Abstimmung sein würde. Tante Erni kam nach der Abstimmung mit Tränen in den Augen in unsere Wohnung.
„Sie haben mir den Stimmzettel hingelegt und gesagt, ‚Sie können’s eh gleich hier machen, das ist ein Volksentscheid!‘ Vor denen habe ich mich nicht getraut ‚Nein‘ anzukreuzen. Das haben sie mit allen so gemacht“, erzählte sie und musste sich setzen. Mutti tröstete sie:
„Wir haben in der Wahlzelle mit Nein gestimmt und zumindest einige andere auch. Trotzdem haben sie gesagt, 99,75Prozent hätten mit Ja gestimmt. Das war alles geplant. Gegen diesen Betrug können wir nichts ausrichten.“
Mutti begann in der Volkshochschule im 6.Bezirk mit einem Buchhaltungskurs. So konnte sie unauffällig mit dem Rad durch die Stadt fahren und dabei Flugblätter zu den vereinbarten Plätzen bringen.
„Ich glaube, die Nazis verdächtigen uns. Wir müssen noch vorsichtiger sein“, sagte mein Vater ein anderes Mal. Warum Tscheri an manchen Abenden eine HJ-Uniform anzog und oft erst im Morgengrauen heimkam, verstand ich nicht.
BUCHHÄNDLER ODER TISCHLER