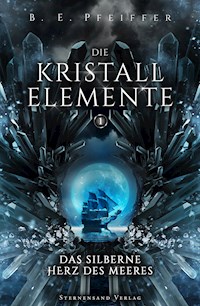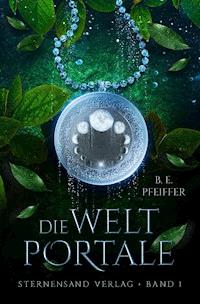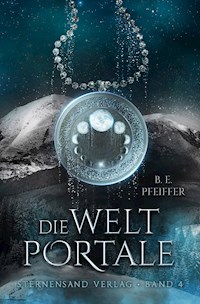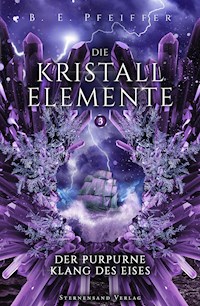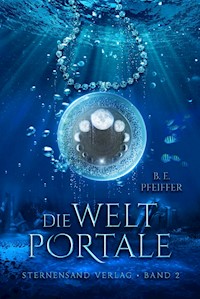
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Sternensand Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Weltportale
- Sprache: Deutsch
Auch nach dem Sieg über den Schatten findet Eleonora keine Ruhe. In ihren Träumen begegnet sie einer mysteriösen Frau, die sie vor etwas zu warnen versucht. Als auch noch die Magie zu erlöschen droht, besteht kein Zweifel mehr: Der Schatten ist nicht besiegt, sondern lauert auf seine Chance, seinem Gefängnis zu entfliehen. Nur die Lunara können den Verlust der Magie abwenden. Doch dieses mysteriöse Volk versteckt sich in den Tiefen des Meeres, verborgen vor den Augen der Menschen. Wird es Eleonora und ihren Freunden dennoch gelingen, sie zu finden, bevor es zu spät ist?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 537
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Titel
Informationen zum Buch
Impressum
Widmung
Landkarte
Kapitel 1 - Sarina
Kapitel 2
Kapitel 3 - Lucius
Kapitel 4
Kapitel 5 - Aestus
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15 - Lucius
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19 - Aestus
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40 - Lucius
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44 - Aestus
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50 - Aestus
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53 - Seratus
Kapitel 54
Kapitel 55 - Nina
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58 - Aestus
Kapitel 59
Kapitel 60
Epilog
Wie die Lunara ihre Unsterblichkeit erhielten
Dank
B. E. Pfeiffer
Die Weltportale
Band 2
Fantasy
Die Weltportale (Band 2)
Auch nach dem Sieg über den Schatten findet Eleonora keine Ruhe. In ihren Träumen begegnet sie einer mysteriösen Frau, die sie vor etwas zu warnen versucht. Als auch noch die Magie zu erlöschen droht, besteht kein Zweifel mehr: Der Schatten ist nicht besiegt, sondern lauert auf seine Chance, seinem Gefängnis zu entfliehen. Nur die Lunara können den Verlust der Magie abwenden. Doch dieses mysteriöse Volk versteckt sich in den Tiefen des Meeres, verborgen vor den Augen der Menschen. Wird es Eleonora und ihren Freunden dennoch gelingen, sie zu finden, bevor es zu spät ist?
Die Autorin
Bettina Pfeiffer wurde 1984 in Graz geboren und lebt heute mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern in Baden bei Wien.
Seit ihrer Kindheit liebt sie es, sich Geschichten auszudenken. Besonders als Ausgleich zu ihrem zahlenorientierten Hauptjob taucht sie gern in magische Welten ab und begann schließlich, diese aufzuschreiben. So entstand recht schnell die Idee für die ›Weltportale‹ und andere magische Geschichten im Genre Fan-tasy/Romantasy.
Inspiration dafür findet sie immer wieder durch ihre Kinder, mit denen sie gern auf abenteuerliche Entdeckungsreisen geht.
www.sternensand-verlag.ch
1. Auflage, Februar 2019
© Sternensand Verlag GmbH, Zürich 2019
Umschlaggestaltung: Alexander Kopainski | Kopainski Artwork
Lektorat: Martina König | Sternensand Verlag GmbH
Korrektorat: Jennifer Papendick | Sternensand Verlag GmbH
Satz: Corinne Spörri | Sternensand Verlag GmbH
ISBN (Taschenbuch): 978-3-03896-023-2
ISBN (epub): 978-3-03896-024-9
Alle Rechte, einschließlich dem des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten.
Dies ist eine fiktive Geschichte. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Für meine Großeltern, die mir gezeigt haben, dass es Wurzeln braucht, um zu fliegen.
Für meine Eltern, ohne die ich trotzdem nie den Mut gehabt hätte, meine Flügel auszubreiten.
Sind auch Welten zwischen uns, so trage ich euch immer in tiefer Dankbarkeit in meinem Herzen.
Das erste Licht der Güte gibt sein Leben für die Welt,
Bald vergessen wird dieser edle Held.
Das zweite Licht der Stärke wird die Völker zum Siege führen
Oder mit seinem Herzen die Dunkelheit berühren.
Das dritte Licht wird durch Liebe stärker als sie alle,
Unbesiegbar sogar, so sie der Dunkelheit verfalle.
Kapitel 1 - Sarina
Der Mond stand hoch am Himmel und schien auf den glitzernden Schnee, der sich hell von der Dunkelheit des Waldes abhob. Sarina saß auf einem einsamen Hügel und blickte auf die schneebedeckten Bäume, die still vor ihr lagen und den Weg in das Tal säumten. Sie fuhr sich durch ihr fast weißes Haar, das im blassen Licht silbern glänzte, und dachte nach.
Seit über fünfzig Erdenjahren verbrachte sie ihr Dasein in der Menschenwelt, doch sie hatte sich noch immer nicht an die Jahreszeiten gewöhnt. Den Winter mochte sie am wenigsten, obwohl die Welt, aus welcher ihr Volk stammte, angeblich aus Schnee und Eis bestand. Sie war eine Lunara, eine Nachkommin jenes sagenumwobenen Volkes, das den Menschen einst Prophezeiungen gebracht hatte. Aber ihr Volk schien in Vergessenheit geraten zu sein, so wie sie vergessen hatte, wie man mit dem Winter umging. Er war kalt und unfreundlich. Genau wie viele Menschen es waren. Deswegen hatte ihr Volk vor einigen Menschengenerationen entschieden, sich zurückzuziehen, auf eine verborgene Insel im tiefen Ozean. Nur an speziellen Tagen, an denen Rituale zu Ehren der Mondgöttin vollzogen wurden, kehrten sie an die Oberfläche zurück, und dann nur für kurze Zeit. Und natürlich, wenn sie Wächter des Urschattens wurden. So wie Sarina.
Tag und Nacht bewachte sie den Kristall, in dem das boshafte Wesen eingesperrt war. Die wenige freie Zeit, die ihr blieb, konnte sie im Winter kaum an der frischen Luft verbringen, weil die Kälte ihr trotz der dicken Mäntel fürchterlich zusetzte. Sie hasste den Winter wirklich, obwohl Lunara kaum zu Gefühlen fähig waren. Aber Sarina war schon immer anders gewesen.
Sie seufzte und blickte über das Tal. Im Schnee wirkte alles friedlich und still, als befände sie sich in einer anderen Welt. Ihre Visionen waren in der Kälte so viel stärker und klarer als sonst. Vielleicht verlieh der Winter ihr doch besondere Kraft.
Sarina hatte es in den Wintermonaten immer geschafft, ihre Tochter in ihren Visionen zu sehen. Fünfundvierzig Erdenjahre war es nun her, dass sie ihr Kind zuletzt in ihrer Nähe gefühlt hatte. Geschwächt von der Geburt, hatte sie das kleine Wesen nicht in den Arm nehmen, sondern nur kurz sehen dürfen, bevor es seinem Vater übergeben worden war. Sie war eine Wächterin, die das Kind eines anderen Wächters erwartet hatte. So etwas war noch niemals vorgekommen, denn die Regeln der Wächter erlaubten keine Beziehung untereinander. Sie hatten eine wichtige Aufgabe zu erfüllen und durften sich nicht von Romanzen ablenken lassen.
Aber Sarina hatte sich verliebt. In den jungen Elfenprinzen, der später ein Fürst wurde und vor rund drei Monden im Kampf gegen das Schattenwesen umgekommen war. Sie war in eine seltsame Trauer versunken. Sie hatte sich gewünscht, ihn noch einmal sehen zu dürfen, selbst wenn er nun stark gealtert war, während ihr Körper sich seit ihrer letzten Begegnung kaum verändert hatte.
Wäre es nach ihrem eigenen Volk und dessen Regeln gegangen, hätte sie dieses Kind nie bekommen dürfen. Doch Theodor, ihr Elfenprinz, und Dano, der alte Wächter der Auronen, der den neuen Wächter immer wieder aufsuchte, hatten sich für sie eingesetzt. So war es ihr erlaubt worden, ihre Tochter zu bekommen, jedoch nicht zu behalten.
Theodor war zu seinem Stamm zurückgerufen worden, da sein älterer Bruder unerwartet verstorben war und er seine Aufgabe als Wächter nun nicht mehr ausüben konnte. So durfte er seine Tochter mit zu sich nehmen. Sarina war darüber einerseits froh und andererseits betrübt. Sie wusste, ihre Tochter wäre bei ihm sicher, doch sie litt darunter, sie nicht aufwachsen gesehen zu haben.
Alles, was sie von ihr besaß, war eine winzige dunkle Locke, die Theodor ihr kurz nach der Geburt abgeschnitten hatte und die sie nun in einem Medaillon an ihrem Herzen trug. Die Kleine war so wunderschön gewesen, mit so herrlich dunklen Haaren wie ihr Vater. Sie hätte ihr Kind so gern gehalten. Doch sie wusste, es war besser gewesen, sie nicht in den Armen gehabt zu haben. Sie hätte sie vermutlich nie wieder hergegeben.
Sarina blickte hoch zum Mond. »Ach Athela«, flüsterte sie wehmütig.
Das war der Name, den sie ihrer Tochter gegeben hatte – angelehnt an eine Prinzessin aus einer alten Sage ihres Volkes. Sie war die Tochter des Morgensterns und verliebte sich vor vielen Millionen Monden in einen Mann aus dem Volk der Lunara, das damals noch sterblich war. Durch sie hatten die Lunara die Unsterblichkeit erlangt. Sarina fand den Namen für ihre wunderschöne Tochter passend.
Seufzend nahm sie ihr Medaillon in die Hand und öffnete es vorsichtig. Die kleine dunkle Haarsträhne schimmerte ganz sanft im Licht des vollen Mondes. Ihre Tochter war nun eine erwachsene Frau, vermählt mit einem Halb-Magier, Halb-Auronen und selbst Mutter einer Tochter. Eleonora. Sarina hatte sie und Athela immer wieder in ihren Visionen beobachten können. Sie waren wunderschön und liebten einander von Herzen. Es schmerzte sie, dass ihr eine solche Verbindung mit ihnen untersagt war.
Athela hatte kaum die Fähigkeiten der Lunara von ihr geerbt. Jedenfalls fühlte sie diese Kräfte nie in ihrer Tochter. Doch die kleine Eleonora … sie besaß die Gaben. Sarina hoffte, dass ihr jemand das Ritual der Lunara zeigen würde, damit ihre Kräfte wuchsen und ihr bei ihrer Aufgabe halfen.
Wie jede Lunara-Wächterin hatte Sarina die alten Prophezeiungen studiert. Sie wusste, was Eleonora bestimmt war. Sie wünschte, sie hätte ihr beistehen können, sie lehren können, wie sie ihre Fähigkeiten einsetzte, was sie stärker machte, was sie schwächte. Denn die Zeit drängte und die Dunkelheit nahm stetig zu.
Sarina schloss das Medaillon vorsichtig und schob es zurück unter den Stoff ihrer Kleidung. Die Kälte der Nacht hatte sich in das Metall gebrannt und ließ einen Schauer durch ihren Körper gehen. Aber in letzter Zeit schauderte sie ständig. Denn sie hatte eine düstere Vorahnung.
Vor einigen Monden hatte sich der Kristall, den sie und die anderen Wächter bewachten, verändert. Seine Energie war viel stärker geworden und Sarina wusste, dass dies der Beginn der Prophezeiung war. In ihren Visionen hatte sie Eleonora gesehen, die trotz ihrer Angst und Zweifel dem Splitter des Schattenwesens, der vor so vielen Menschengenerationen aus dem Kristall fliehen konnte, die Stirn geboten und ihn besiegt hatte.
Nachdem die Schlacht geschlagen war, schien der Kristall seine Energie wieder zurückzuziehen. Nur Sarina bemerkte, dass etwas nicht stimmte. Der Schatten in dem Kristall war lange sehr ruhig gewesen. Doch nun bewegte er sich, prüfte sein Gefängnis und schien hasserfüllter als jemals zuvor.
Allerdings belächelten die anderen Wächter sie und nannten sie zu feinfühlig. Ihnen war zwar nicht entgangen, dass es eine Bedrohung gab, doch anders als Sarina hielten sie nicht viel von der Prophezeiung der Lunara.
Die Wächterin fluchte innerlich, dass sie an diesem Ort festsaß. Sie wusste, dass ihre Tochter und Enkeltochter Hilfe brauchten. Denn ein weiterer Kampf stand kurz bevor. Alles, was ihr blieb, war, darauf zu hoffen, dass Dano, der alte Auronenwächter, sich an das Versprechen, das er ihr vor all den Jahren gegeben hatte, erinnerte. Ihm hatte sie ihre Spieluhr anvertraut, die mit ihrer Musik die verborgenen Kräfte der Lunara erwecken konnte. Ihm hatte sie die Prophezeiung wieder und wieder eingeschärft, damit er ihre Familie beschützen würde. Bisher hatte er seine Verantwortung erfüllt.
Sarina zeichnete einen Kreis in den frischen Schnee und hüllte sich in ihren Mantel und die drei Decken, die sie mitgebracht hatte. Trotzdem war ihr kalt. Doch sie brauchte den Schnee und die Kälte, denn sie wollte eine klare Vision empfangen, in der sie vielleicht sogar in der Lage war, mit Athela und Eleonora zu sprechen.
Anders als die Auronen hatten die Lunara zumeist nur Visionen über Dinge, die einst gewesen waren, oder Schatten der Dinge, die einst sein würden. Sie konnten über die verschiedenen Ebenen hinweg reisen, aber selten mit den Wesen dieser Ebenen sprechen.
Sarina musste lächeln, als sie daran dachte, dass Eleonora genau dies geschafft hatte, ohne jemals in die Fähigkeiten der Lunara unterwiesen worden zu sein. Vermutlich lag es daran, dass sie alle vier erdfremden Völker vereinte. Und daran, dass dieses Mädchen intuitiv die Magie verstand, die es umgab.
So oft hatte Sarina versucht, mit Eleonora oder Athela zu sprechen. Doch niemals hatten sie auch nur bemerkt, dass sie sich bei ihnen befand. Vermutlich würde sie auch dieses Mal keinen Erfolg haben. Aber welche Wahl hatte sie noch? Dano war schon lange nicht mehr bei Eleonora gewesen und die Zeit drängte. Vor allem, da die andere Aurone, Lady Graie, nun nicht mehr an der Seite ihrer Enkeltochter sein konnte. Auch um sie hatte Sarina getrauert, war sie doch eine weise Frau gewesen, die ihre Familie stets beschützt hatte und nun dem Schatten zum Opfer gefallen war.
Sie atmete tief ein, schloss ihre Augen und drehte ihr Gesicht in den Schein des Mondes. Ihre Haare glänzten ein wenig heller und sie fühlte, wie das Licht der Mondgöttin ihre Gaben verstärkte.
Der Schleier zwischen Raum und Zeit hob sich und sie ließ ihr Bewusstsein über die Täler und Berge, die Flüsse und Wälder reisen, bis hin zu einem kleinen Häuschen in der Nähe eines Sees. Dort saß Athela an einem Tisch über viele Zettel gebeugt. Sie war nach dem ersten großen Kampf gegen den Schatten in die Nähe der Akademie gezogen und unterrichtete nun Heilmagie. In ihrem Haus lebte eine Menschenfamilie, eine Mutter mit drei kleinen Kindern, die Sarina nicht kannte.
Die Wächterin blickte sich in dem Raum um, trat neben Athela und legte eine Hand auf ihre Schulter, doch die Elfe sah nicht auf. Sie konnte sie nicht spüren.
Es klopfte und Eleonora trat ein, ein Tablett mit zwei dampfenden Tassen in der Hand. Als sie zu ihrer Mutter blickte, hielt sie inne und starrte in Sarinas Richtung. Ihre Lippen bebten und das Tablett in ihren Händen zitterte.
»Kannst du mich hören?«, fragte Sarina, doch das Mädchen reagierte nicht. Es bewegte sich ganz langsam auf seine Mutter zu, ohne den Blick von Sarina abzuwenden. »Du hörst mich also nicht …«, bemerkte diese enttäuscht und machte einen Schritt zurück. »Aber du kannst mich sehen. Das ist ein Anfang. Vielleicht kann ich dich in deinen Träumen besuchen.«
Die Lunara zog sich aus ihrer Vision zurück in ihren Körper, der von der Kälte schmerzte und klamm geworden war. Sarina rieb ihre steifen Hände und überlegte, ob sie zurückgehen und später wiederkommen sollte. Sie musste mit Eleonora sprechen und in ihren Träumen konnte sie das Mädchen vielleicht besser erreichen. Aber wenn sie an ihrem Posten erschien, würde man ihr Fragen stellen. Fragen, die sie im Moment nicht beantworten wollte.
Seufzend zog sie die Decken enger um sich. Sie würde wohl noch einige Stunden ausharren müssen.
Kapitel 2
Eleonora keuchte schwer, als sie ihr Schwert erneut hob und zu einem Schlag ausholte, während sich ihre dunklen Strähnen aus dem Zopf lösten und um ihr Gesicht wehten. Der Schnee auf dem Boden erschwerte ihren Kampf und sie hatte Mühe, nicht auszurutschen. Aber sie wollte sich nicht so schnell geschlagen geben.
Lucius parierte ihre Angriffe ohne Mühe, entwaffnete sie dabei und hielt ihr seine Schwertspitze an die Kehle. Enttäuscht sah sie ihn an. Seine dunkelblauen Augen funkelten amüsiert.
»Das war schon sehr gut, du machst Fortschritte«, sagte er aufmunternd und senkte seine Waffe.
Eleonora seufzte und wollte nach ihrem Schwert greifen, doch der blonde Ritter hob es auf und hielt es ihr hin. »Danke«, knurrte sie und fasste nach dem Griff, ohne ihn anzusehen.
Lucius lachte und sie starrte ihn wütend an. »Vergib mir, aber dass du so ehrgeizig bist, hätte ich nicht erwartet. Bitte vergiss nicht, dass ich im Schwertkampf ausgebildet wurde, seit ich ein kleiner Junge war, und du erst vor Kurzem gelernt hast, mit dem Schwert umzugehen.«
Sie steckte ihre Waffe weg und schnaubte. »Ich verstehe ohnehin nicht, wieso ich lernen soll, mit einem gewöhnlichen Schwert zu kämpfen. Das Schwert der Lorana führt meine Schläge im Kampf sehr gut. Jetzt soll ich mit irgendeiner Waffe üben, obwohl ich viel eher an meiner Lichtmagie arbeiten sollte?«
»Du hast das Schattenwesen mit dem Schwert besiegt«, schmunzelte Lucius. »Auch wenn deine Waffe dir hilft, schadet es nicht, wenn du von mir einige Tricks lernst.« Er kam einen Schritt näher. »Abgesehen davon finde ich es schön, dass ich dir etwas beibringen kann. Bei der Lichtmagie bin ich dir keine Hilfe, aber ich kann dir zeigen, wie du dich in einem Kampf verteidigst, gleich, mit welcher Waffe. Ich werde immer versuchen, bei dir zu sein und dich zu beschützen. Aber wenn ich aus irgendeinem Grund nicht da sein kann, dann will ich, dass du weißt, wie du deinen Gegner bezwingen kannst.«
Er legte seine Hand an ihre Wange und sie fühlte, wie seine Wärme nicht nur die Kälte, sondern auch ihren Zorn wegschmolz.
»Schon gut. Ich weiß, es hat einen Grund, dass das Schwert mich erwählt hat«, seufzte sie und versuchte, sein Lächeln zu erwidern. »Aber der Schwertkampf ist bei Elfen nicht gern gesehen und ich fühle mich wie ein Kleinkind, das seine ersten Gehversuche unternimmt. Besonders, wenn ich gegen dich kämpfe.«
»Wie ich bereits sagte, du machst Fortschritte. Ich habe auch nicht vom ersten Tag an jeden Gegner bezwungen. Du musst deinen Stil erst finden. Und das gelingt dir am besten, wenn du nicht von einem magischen Schwert gelenkt wirst.«
Er brachte sein Gesicht näher an ihres heran und seine blonden Haare fielen ihm dabei in die Stirn. Eleonora schloss die Augen in freudiger Erwartung des Kusses, doch bevor seine Lippen ihre trafen, hörten sie ein genervtes »Hey!« und fuhren auseinander.
»Ihr wisst schon, dass wir hier sitzen und darauf warten, dass der Herr Ritter Zeit findet, uns auch etwas beizubringen? Es ist ziemlich kalt und ich würde das gern so schnell wie möglich hinter mich bringen«, rief Daphne gereizt.
Lachend drehte sich Eleonora um und sah ihre Freundinnen an. Daphne war eine Magierin, hatte kinnlanges zimtrotes Haar und war ein Jahr älter als Eleonora. Nina war Halbmagierin und in Eleonoras Klasse. Sie hatten ihr beigestanden, als sie von ihrer Herkunft erfuhr und gegen den Schatten kämpfen musste. Nun waren sie alle Mitglieder des Mondordens, der einst eine Gemeinschaft aller Völker dargestellt hatte, um gegen den Schatten zu kämpfen.
Die beiden Schülerinnen hatten dicke Decken um sich geschlungen und saßen auf einer Bank. Daphnes Blick wirkte düster, während Nina eher unbehaglich den Kopf zur Seite gedreht hatte. Sie wussten, dass Eleonora Gefühle für den Ritter hegte. Ebenso wie für Aestus, der sich zum Glück noch nicht auf dem Übungsplatz befand. Eleonora wollte ihn nicht mit ihrer Zuneigung zu dem Ritter quälen, so wie sie Lucius nicht mit ihrer Zuneigung zu Aestus konfrontieren wollte.
Der Ritter nahm ihre Hand und führte Eleonora über den Schulhof, auf dem sie übten, zu der Bank. Galant küsste er ihren Handrücken und verneigte sich vor Daphne. »Mylady, wenn Ihr mir die Ehre erweisen würdet?«
Die Magierin brach in ein amüsiertes Lachen aus, schlug die Decken zurück, fuhr sich durch ihr zimtrotes Haar und stand auf. »Dann bringt mir bei, wie ich einen Schatten bezwinge«, sagte sie übermütig.
Eleonora setzte sich neben Nina, die ihr heißen Tee reichte.
»Du hast gut gekämpft«, meinte sie freundlich, doch ihre Augen wirkten traurig. Sie führte ihren eigenen Becher zu ihren Lippen und nippte daran.
Einen Moment beobachtete die Schülerin ihre Freundin wortlos. Dann jedoch fragte sie: »Was ist los, Nina? Du bist seit einiger Zeit noch stiller als sonst. Und das will etwas bedeuten.«
Die Halbmagierin senkte den Blick und seufzte. »Es ist nichts …«
»Doch, da ist etwas«, meinte Eleonora und legte ihr eine Hand auf die Schulter. »Du weißt, du kannst mir alles anvertrauen. Ich bin für dich da, so wie du für mich da bist.«
»Ja, weißt du … ich fühle mich manchmal einsam.«
»Einsam?«
»Wenn ich dich und Lucius ansehe … oder dich und Aestus … dann wünschte ich, ich würde auch geliebt werden.«
»Ach Nina.« Eleonora legte einen Arm um sie und lächelte aufmunternd.
Die Halbmagierin war ein hübsches Mädchen mit aschblonden Haaren und wunderschönen blauen Augen. Doch im Gegensatz zu Daphne war sie nicht besonders auf ihr Äußeres bedacht und richtete sich nicht stundenlang her. Aber sie war herzensgut und Eleonora liebte sie für ihre zurückhaltende, fürsorgliche Art.
»Bestimmt findest du bald jemanden, mit dem du dich nicht mehr so einsam fühlst. Und in der Zwischenzeit hast du uns«, versuchte Eleonora, sie aufzumuntern. »Aber ich werde ab jetzt versuchen, nicht mehr zu viel Vertrautheit mit Aestus und Lucius zu zeigen. Was ich ohnehin nicht sollte, weil es immer noch seltsam ist, in beide verliebt zu sein …«
Nina rollte mit den Augen. »Eleonora, man muss nur deinen Namen sagen und die beiden strahlen. Und bei dir ist es nicht anders. Du kannst noch nicht mal über sie reden, ohne zu lächeln. Das ist auch in Ordnung. Aber …« Sie seufzte und schwieg, als Aestus zu ihnen kam und sich auf die Bank fallen ließ.
»Habe ich deinen Kampf verpasst?«, fragte er außer Atem und wischte sich eine seiner rabenschwarzen Haarsträhnen aus der Stirn.
Aestus war ein Mensch, der sich magische Fähigkeiten zu einem hohen Preis angeeignet hatte. Deswegen hatte er nicht die bunten Haare und Augen der Magier, obwohl seine Iriden eisblau und seine Haare dunkelblau schimmerten. Was wohl daran lag, dass er die Kräfte eines Eisdrachen in sich trug.
»Ja, aber es war kein besonders guter Kampf«, antwortete Eleonora schmollend.
Er legte seinen Arm um sie und lächelte sie an. Seine eisblauen Augen wirkten zufrieden, als er sie musterte. »Du bist zu streng mit dir. Ich bin sicher, du hast dich gut geschlagen.«
Eleonora zuckte mit den Schultern, doch als sie ihn ansah, musste sie gegen ihren Willen lächeln. Sie hatte ihn vermisst, obwohl er nicht lange von ihr getrennt gewesen war.
Aus Rücksicht auf Nina, die unbehaglich ihre Finger knetete, wandte sie sich von ihm ab, rutschte ein Stück weg und beobachtete, wie Lucius ihrer Freundin beibrachte, einen Schlag zu parieren.
Aestus knurrte und rutschte nach.
»Ihr übt sehr fleißig«, ertönte eine Stimme hinter ihnen.
Eleonora wandte den Kopf und nickte Valeria, der Direktorin der Akademie, zu, die beobachtete, wie die Magierin und der Ritter miteinander kämpften.
»Daphne hat wirklich Talent für den Schwertkampf. Vielleicht sollten wir ihr mehr Einzelunterricht angedeihen lassen.«
»Ja, sie ist wirklich gut«, pflichtete Eleonora ihr bei.
»Ich bin nicht hier, um euch zu stören, aber ich würde dich gern kurz unter vier Augen sprechen, Kind«, meinte die Direktorin und lächelte freundlich.
Eleonora reichte Aestus ihren Tee und stand auf. »Ihr entschuldigt mich?«, sagte sie und verließ den Hof mit der Magierin. Sie hörte noch, wie Aestus den Atem ausstieß und zu Nina meinte, es würde ihm nicht gefallen, wenn sie Geheimnisse vor ihm hatte oder Dinge ohne ihn machte. Mutlos schluckte sie den Kloß in ihrem Hals hinunter, denn sie wollte der Direktorin ihre Aufmerksamkeit schenken.
»Du siehst müde aus«, meinte die Magierin besorgt, nachdem sie ein Stück gegangen waren.
»Ich bin müde. Ich träume seltsam«, gestand Eleonora und Valeria musterte sie eindringlich.
»Vom Schatten?«
»Nein, von einer Frau. Sie sieht aus wie eine Lunara …«
»Und was träumst du von ihr?«
»Sie ist stumm in meinen Träumen, aber ich denke, sie will mir etwas zeigen.« Eleonora sah die Direktorin verwirrt an. »Manchmal habe ich das Gefühl, dass sie auch neben mir steht, wenn ich wach bin. Denken Sie, dass das möglich ist?«
»Ich kenne mich mit der Magie der Lunara nicht gut aus«, meinte Valeria nachdenklich. »Aber vielleicht hat es etwas mit dem Stab und deiner nächsten Aufgabe zu tun.«
Eleonora seufzte. Das Schattenwesen hatte einst einen Stab besessen, den es im Kampf geführt hatte. Nachdem der Schatten besiegt worden war, hatte Valeria ihr dieses Zepter überlassen wollen, aber Eleonora hatte sich geweigert, es zu führen, da es ihr viel zu mächtig erschien. »Die Lunara sind der Schlüssel«, murmelte sie schließlich.
Mara, eine Elfe, die wie sie von allen vier erdfremden Völkern abstammte, hatte ihr das gesagt, kurz bevor ihre Seele endlich erlöst worden war. Ob diese Frau in ihren Träumen versuchte, ihr den Weg zu zeigen?
»Sie sind aber bestimmt nicht hergekommen, um mich nach meinen Träumen zu befragen, oder?«
»Nein«, erwiderte die Direktorin und ließ die Schultern sinken. »Der Ring ist immer noch verschwunden. Du bist ganz sicher, dass der Schatten ihn hatte, als du gegen ihn gekämpft hast?«
»Ja, er trug ihn. Ich konnte seine Magie fühlen. Es war dieselbe wie in der Burg, bevor sie vom Fluch befreit wurde.«
»Ich verstehe«, flüsterte die Magierin und blickte zu Boden, wo unterschiedliche Schuhabdrücke im Schnee zu erkennen waren. »Hältst du es für klug, deine Freunde nicht in alles einzuweihen?«
Eleonora blieb stehen und warf der Direktorin einen Blick zu. »Ich weiß nicht, was der Ring mit meinen Freunden zu tun hat …«
»Kind, es ist nicht nur der Ring«, redete Valeria ruhig auf sie ein. »Seit dem Kampf gegen den Schatten gehst du ohne sie zu Treffen, trägst alles allein auf deinen Schultern. Ihr seid eine Gemeinschaft und ihr braucht einander.«
Eleonora schluckte. »Was ist … wenn ich sie damit in Gefahr bringe?«
»Du hast Angst, sie zu verlieren.« Die Direktorin legte ihr eine Hand auf die Schulter. »Hast du schon einmal daran gedacht, dass du sie verlieren könntest, wenn du sie von allem ausschließt und deine Geheimnisse für dich behältst?« Sie lächelte Eleonora schwach an. »Es wird ohnehin schwer, sie alle zusammenzuhalten. Lucius und Aestus kämpfen um dein Herz, und dann ist da Nina, die eifersüchtig ist …«
»Sie ist nicht eifersüchtig«, rief Eleonora, als müsste sie sich selbst überzeugen.
»Wie auch immer. Alles, was ich sagen will, ist, dass du deine Freunde miteinbeziehen solltest. Denn sie machen sich Sorgen.« Sie klopfte dem Mädchen auf die Schulter. »Denk darüber nach. Unser nächstes Treffen findet bald statt und vielleicht möchtest du doch alle Ritter des Ordens bei dir haben.«
»Ich werde es berücksichtigen«, erwiderte Eleonora.
»Gut. Wenn du Hilfe benötigst, lass es mich wissen. Ansonsten werde ich mich jetzt wieder unserem Problem mit dem Ring widmen. Sollte ich etwas herausfinden, melde ich mich.«
Die Direktorin lächelte noch einmal, dann eilte sie durch den Schnee davon.
Eleonora ging mit hängenden Schultern zurück und beobachtete, wie Nina und Aestus miteinander sprachen und gemeinsam lachten. Einen Moment überlegte sie, ob sie sich davonstehlen sollte, um in Ruhe nachzudenken, doch Aestus hatte sie bereits entdeckt und winkte ihr zu. Seufzend ging sie zu ihren Freunden und setzte sich schweigend auf die Bank. Plötzlich sprach niemand mehr.
Erst als ihr die Stille unangenehm wurde, deutete Eleonora mit dem Kinn auf den Kampf. »Daphne kämpft jetzt schon richtig lange, oder?«
Aestus musterte sie besorgt, fragte aber nicht, was in ihr vorging, sondern folgte ihrem Blick zu Daphne und Lucius.
»Ich glaube, sie hat etwas gefunden, das ihr besser gefällt, als Frisuren zu machen«, meinte Nina ernst.
Eleonora sah ihre Freundin überrascht an, dann lachte sie und Aestus stimmte mit ein. Selbst die Halbmagierin musste kichern.
»Wie soll man sich denn konzentrieren, wenn ihr nur Blödsinn im Sinn habt?«, rief Daphne zornig und unterbrach ihren Kampf mit finsterem Blick.
»Ich denke, es ist Zeit, den Nächsten an die Reihe zu lassen«, meinte Lucius und Nina stand widerwillig auf. Ihr lag der Schwertkampf überhaupt nicht.
Daphne setzte sich schnaubend neben Aestus. »Und, was war so lustig, dass ihr lachen musstet, während ich trainiert habe?«
»Nina hat nur einen Scherz gemacht. Er war ungewollt komisch«, meinte Eleonora beschwichtigend.
»Das soll sie sich das nächste Mal für unsere Pyjamaparty aufheben«, entgegnete ihre Freundin verletzt und wandte sich ab.
Aestus beugte sich zu Eleonora und flüsterte grinsend: »Ihr macht Pyjamapartys?«
Sie winkte ab. »Also, ja, wir nennen es so«, erklärte sie und versuchte, seinen Blick zu meiden.
»Redet ihr da über Jungs?«, bohrte er nach und grinste noch breiter.
»Das … geht dich nicht wirklich etwas an«, wehrte Eleonora ab.
Aestus lachte und legte seine Arme um sie.
»Hör auf, wir sind hier beim Training«, zischte sie und wehrte sich gegen die Berührung. Es war ihr unangenehm, so knapp vor Lucius mit Aestus zu turteln.
»Das stört mich nicht. Und der Ritter sieht es wohl kaum, denn er konzentriert sich darauf, Nina etwas beizubringen. Also lass mich dich kurz halten. Nur für einen Moment.«
Etwas Flehentliches lag in seiner Stimme und sie gab seufzend nach. Mit geschlossenen Augen genoss sie seine Wärme und als sie seine Lippen auf ihrem Scheitel fühlte, lächelte sie zufrieden. Dann war der Moment vorbei und Aestus löste sich von ihr. Unglücklich sah sie zu, wie Lucius und Nina ihre Übungen absolvierten.
Nina war weniger talentiert mit dem Schwert als Daphne, aber sie gab sich Mühe. Allerdings hatte sie nicht die Ausdauer ihrer Freundinnen oder ihre Stärke, Magie einzusetzen, und wurde schnell müde. Und auch Lucius schien nicht ganz bei der Sache zu sein.
Kapitel 3 - Lucius
»Lassen wir es für heute gut sein«, meinte der Ritter freundlich, obwohl er innerlich tobte, und führte Nina zu den anderen zurück. Er hatte gesehen, wie Aestus Eleonora umarmt hatte, und sein Herz zog sich allein bei dem Gedanken zusammen.
Seit drei Monden war er frei, nachdem ein mächtiger Zauber ihn über fünfhundert Jahre an seine Burg gefesselt und ihn gehindert hatte, zu altern. Die Burg um ihn herum war verfallen und nur wenige hatten sie finden können. Meist die Direktorinnen der Akademie. Und Eleonora. Sie war es auch, die ihn befreit hatte, und eigentlich war er sicher gewesen, dass sie beide zusammengehörten. Wäre da nicht Aestus, für den sie auch etwas empfand. Zwar hatte sie sich stets Mühe gegeben, keinem von beiden einen Grund zu geben, eifersüchtig zu werden, allerdings konnte er dieses Gefühl dennoch nicht unterdrücken.
Er wollte so nicht sein. Er selbst hatte ihr gesagt, dass er warten und um ihr Herz kämpfen würde. Aber immer wenn er Aestus sah, kam die Eifersucht hoch, fraß sich in sein Herz und vernebelte seine Gedanken. Der Ritter wollte Eleonora nicht aufgeben, aber er wusste nicht, wie lange er noch mit dieser Situation zurechtkommen würde.
Als er mit Nina bei der Bank ankam, musterte er den Schüler finster. »Ihr seid an der Reihe, Aestus«, meinte er höflich, aber selbst ihm fiel die Kälte in seiner Stimme auf.
Dieser erwiderte seinen Blick finster, als er das Übungsschwert von Nina entgegennahm und ihm schweigend über den Hof folgte. Als sie außer Hörweite waren, flüsterte Aestus dem Ritter zu: »Lass es uns heute ein wenig spannender machen. Der Gewinner dieses Duells darf den Abend mit Eleonora verbringen.«
Lucius zog die Augenbrauen hoch. Aestus war geschickt mit dem Schwert, das musste er zugeben. Aber seine Angriffe erwiesen sich oft als unüberlegt und es bereitete ihm kaum Mühe, ihn zu besiegen.
»Ich würde diese Entscheidung lieber Eleonora selbst überlassen, mit wem sie den heutigen Abend verbringt«, erwiderte er ebenfalls leise.
Aestus lachte höhnisch. »Hast du etwa Angst, dass ich gewinne?«
»Darum geht es nicht«, knurrte der Ritter. »Abgesehen davon hättet Ihr ohnehin keine Chance gegen mich, so wie Ihr kämpft.«
»Dann gibt es ja kein Problem«, meinte Aestus schulterzuckend. »Wenn du ohnehin gewinnst, kann Eleonora immer noch selbst entscheiden, mit wem sie den Abend verbringt.«
»Schön, wenn Ihr wollt, dann sollt Ihr die Aussicht auf einen Preis haben«, gab Lucius nach und schüttelte den Kopf. »Es wird aber nichts an dem Ausgang ändern.«
Aestus verzog seinen Mund zu einem spöttischen Grinsen. »Wir werden sehen.«
Die beiden nahmen Aufstellung und hoben ihre Schwerter. Lucius wartete, bis Aestus seinen ersten Angriff startete. Dieser hob seine Klinge noch höher und lief auf ihn zu. Sein Körper war angespannt und er schien alle Kraft in seinen Schlag zu legen, doch Lucius hatte keine Mühe, seinem Angriff auszuweichen und mit einem leichten Gegenschlag abzuwehren.
Aestus hatte so viel Kraft aufgenommen, dass er ungeschickt an Lucius vorbeisegelte, was dieser nutzte, um ihm mit dem Griff seines Schwertes einen leichten Stoß in den Rücken zu versetzen. Der Schüler landete fluchend auf seinem Bauch im Schnee. Er drehte sich auf den Rücken und schnaubte zornig.
Aus den Augenwinkeln bemerkte Lucius, wie Eleonora unruhig aufspringen wollte, aber von Daphne zurückgehalten wurde. Er konnte nicht hören, was sie flüsterten, und wandte sich wieder Aestus zu. »Ihr handelt zu unüberlegt«, meinte der Ritter und wollte ihm die Hand reichen, doch er schlug sie weg.
»Das ist noch nicht zu Ende«, fauchte Aestus und sprang wieder auf seine Beine.
»Wie Ihr meint«, seufzte der Ritter und hob sein Schwert.
Aestus machte einige Schritte auf ihn zu, hob seine Waffe erneut und platzierte seinen Schlag sehr hoch. Lucius riss sein Schwert hoch und parierte den Angriff. Die Klingen klirrten hell, als sie sich trafen. Aestus brachte seine zweite Hand an den Schwertgriff und legte all seine Kraft in den Versuch, den Ritter aus dem Gleichgewicht zu bringen.
Lucius hatte Schwierigkeiten, der Stärke seines Gegners etwas entgegenzusetzen, also musste er ihn mit Schnelligkeit überlisten. Er drehte das Schwert geschickt, sodass die Klinge von Aestus abglitt. Der Schüler verlor das Gleichgewicht und stolperte nach vorn, während der Ritter auswich. Im Fallen drehte Aestus sich herum und platzierte einen Schlag auf Lucius’ Beine. Das Schwert fügte ihm einen leichten Schnitt zu und der Ritter keuchte überrascht auf.
Wieder sah er aus den Augenwinkeln, wie Eleonora aufsprang und auf den Hof stürmen wollte. Ihre Freundinnen konnten sie gerade noch festhalten.
»Lass sie kämpfen. Sie müssen das jetzt austragen«, hörte er Daphne beruhigend auf sie einreden.
»Aber …«, begann Eleonora, doch ihre Freundin unterbrach sie und Lucius musste sich wieder Aestus zuwenden.
»Damit hast du nicht gerechnet, was?«, grinste der Schüler und kämpfte sich auf die Beine.
»In der Tat«, meinte Lucius und betrachtete den kleinen Schnitt. Ein wenig Blut sickerte aus der Wunde in den Stoff seiner Hose. Ein Lächeln stahl sich trotz der Schmerzen auf sein Gesicht. Diese Wunde bedeutete, dass er endlich wieder ein Mensch war. Denn bis vor Kurzem hatte ihn nichts verletzen können.
Er hob den Blick und musterte seinen Gegner aufmerksam. Aestus atmete schwer, was bedeutete, dass er müde wurde. Für gewöhnlich ließ der Schüler bei ihren Kämpfen nicht so schnell nach. Scheinbar hatte er vor diesem Training etwas anderes gemacht, das ihn ausgelaugt hatte. Das musste Lucius nutzen.
Er schwang sein Schwert über seinem Kopf, vollführte dabei eine halbe Drehung und versetzte Aestus einen gezielten Streich, den dieser nicht rechtzeitig parieren konnte und ihn stolpern ließ. Noch ehe Aestus sein Gleichgewicht wiedergefunden hatte, schwang Lucius seine Waffe erneut herum und traf ihn am Arm.
Stöhnend hielt Aestus sich die Wunde, hob das Schwert mit dem verletzten Arm und lief auf Lucius zu. Er war zu langsam und Lucius trat mühelos einen Schritt zur Seite. Der Schüler ging zu Boden und Lucius stellte sich über ihn, das Schwert an seiner Kehle.
»Ich würde sagen, es ist vorbei«, keuchte der Ritter. Dieser Kampf hatte ihm mehr abverlangt, als er gedacht hatte.
Aestus schlug sein Schwert mit seiner Klinge weg. »Nein, ist es nicht«, zischte er. »Ich werde dich niemals gewinnen lassen. Niemals!«
Als er aufstehen wollte, presste Lucius ihm das Knie auf die Wunde am Arm und drückte ihn nach unten. »Ihr habt keine Chance gegen mich«, knurrte er und funkelte seinen Gegner an.
Der Schüler stöhnte erneut und versuchte, den Ritter wegzuschieben, doch es gelang ihm nicht. Aestus fluchte und sank mit schmerzverzerrtem Gesicht auf den Boden zurück.
»Lucius, hör auf!«, rief Eleonora und lief auf den Kampfplatz. »Du tust ihm weh!« Ihre Stimme klang vorwurfsvoll und sie zog den Ritter gewaltsam von Aestus herunter.
Lucius wollte sich erklären, ließ es dann aber, als er ihren Blick bemerkte, und wandte sich ab. Er wusste, er war zu weit gegangen, hatte sich von seiner Eifersucht führen lassen. Er wollte Aestus nicht verletzen, aber …
Mit hängendem Kopf beobachtete er, wie Eleonora sich neben Aestus niederkniete und begann, seine Wunde mit ihrer Magie zu heilen. Es handelte sich um keine tiefe Wunde, doch sie schien in der Kälte dieses Winters sehr schmerzhaft zu sein. Zumindest nahm Lucius das an, denn auch seine Wunde fühlte sich mit einem Mal viel zu schmerzhaft an.
Aestus atmete angestrengt und ließ sich von Eleonora stützen, als er aufstand. Sie führte ihn zur Bank zurück und half ihm, sich zu setzen.
Lucius hörte ihre beruhigenden Worte und ballte die Fäuste. Er wollte nicht, dass sie sich so um Aestus kümmerte. Aber als sie zu ihm zurückkehrte und auch seine Wunde heilen wollte, wehrte er sie ab. »Das ist nur ein Kratzer«, murmelte er und wich ihrem Blick aus.
»Kratzer oder nicht, es tut bestimmt weh«, erwiderte sie versöhnlich und er wusste, dass sie lächelte.
»Nicht so weh wie andere Dinge«, meinte er leise zu sich selbst. Aber er wusste, dass sie ihn gehört hatte.
»Lucius, ich …«, flüsterte sie, räusperte sich jedoch nur, anstatt den Satz zu vollenden. Erst nach einigen Atemzügen fragte sie: »Lässt du mich bitte deine Wunde heilen?«
Der Ritter nickte, wich aber weiterhin ihrem Blick aus.
Eleonora legte ihre Hände über den Schnitt, der kaum noch blutete. Behutsam fuhr sie mit ihren Handflächen über die Wunde, bis sie verheilt war. Dann richtete sie sich auf und legte eine Hand an Lucius’ Wange. »Komm, wir gehen hinein. Du hast heute lange gekämpft, du solltest dich ausruhen.«
Der Ritter sah sie müde an. »Ich werde lieber zur Burg zurückgehen. Ich bin mir nicht sicher, wie gut die Stimmung dort ist.«
»Immer noch nicht besser?«, fragte sie.
Er schüttelte den Kopf. »Es wird dauern, bis Menschen, Magier und Elfen zueinanderfinden. Aber wir machen Fortschritte«, erklärte er und wandte sich ihr zu. Sie lächelte und er musste schlucken. Rasch fügte er hinzu: »Kleine Fortschritte. Aber immerhin.«
»Du bist ein guter Anführer, Lucius. Ich bin sicher, selbst wenn sie untereinander noch nicht ganz auskommen, werden sie dir folgen.«
»Das nutzt nur nicht viel, wenn sie keine Einheit sind. Denn dann sind sie für sich und andere eine Gefahr.« Er nahm ihre Hand und strich mit dem Daumen darüber. »Aber es wird schon werden. Lass das meine Sorge sein.«
Er hätte sie gern in alles eingeweiht, sie gebeten, mit ihm zu kommen. Denn wenn sie in der Burg war, verhielten sich seine Ritter anders. Eleonora hatte eine Ausstrahlung, die er nicht begreifen konnte und die ihn faszinierte. Es war ihr eigener Zauber und manchmal fragte er sich, ob er wohl auch dieser Macht erlegen war.
Er wollte sie bei sich haben. Aber er konnte sie nicht darum bitten. Nicht, solange Aestus ihnen zusah, mit diesem finsteren Blick und den zusammengepressten Lippen, aus denen jedes Blut gewichen war.
»Bitte komm doch kurz mit in das Haus meiner Mutter und wärm dich auf, bevor du zur Burg zurückgehst«, riss Eleonora ihn aus seinen Gedanken und er betrachtete ihr Gesicht. »Ich bin sicher, es gibt etwas zu essen und warmen Tee.«
Lucius dachte kurz darüber nach, seufzte dann aber und schüttelte den Kopf. »Ein anderes Mal.«
Er beugte sich über ihre Hand und hauchte einen Kuss darauf. Dann ließ er sie los und ging zu den anderen, um sich zu verabschieden. Mit schwerem Herzen und ohne Eleonora noch einmal angesehen zu haben, verließ er den Schulhof und schlug den Weg zu seiner Burg ein. Als er außer Hörweite war, wandte er sich einem Baum zu und versetzte ihm einige heftige Tritte, bis seine Füße schmerzten.
Ja, er war am Leben und er konnte wieder Schmerz empfinden. Aber das, was er in seinem Herzen fühlte, wollte er nicht mehr spüren. Er würde heute noch trainieren und erst damit aufhören, wenn sein Herz endlich schwieg.
Kapitel 4
Athela saß neben einem prasselnden Feuer und korrigierte Arbeiten, als Eleonora mit ihren Freunden das Haus betrat.
Da die Schulkrankenschwester bei dem Angriff des Schattens umgekommen war, half Eleonoras Mutter mit ihren Heilkräften gern aus und unterrichtete mittlerweile sogar einige wenige Schüler, die sich auf das Heilen spezialisieren wollten. So konnte sie in der Nähe ihrer Tochter sein und dazu beitragen, dass das Wissen der Elfen auch für andere Völker zugänglich wurde. Außerdem war nach dem Tod ihres Vaters nun Eleonoras Tante Ariadne Fürstin des Elfenstamms von Tingal. Obgleich die Schwestern immer ein gutes Verhältnis gehabt hatten, fühlte sich Tingal für Athela nicht mehr wie ihr Zuhause an. Die wenigen Dinge, die sie besaß, hatte sie nachkommen lassen.
Die Akademie und ihre Magier hatten ihr ein kleines Haus in der Nähe des Wohnheims direkt am See errichtet. Dort war sie zunächst allein eingezogen. Doch als sie von Aestus’ Familie erfahren hatte, die zur Akademie unterwegs gewesen war, um hier zu leben, hatte sie keinen Augenblick gezögert und angeboten, sie bei sich aufzunehmen. Dafür würde Eleonora ihr ewig dankbar sein.
Hilaria, Aestus’ Mutter, führte nun den Haushalt, obwohl sowohl Athela als auch Eleonora sie davon abhalten wollten. Allerdings schien sie sich verpflichtet zu fühlen, für ihre Unterkunft aufzukommen, und da die Elfe mit ihrer Lehrtätigkeit beschäftigt war, nahm sie es doch an.
Aestus’ jüngere Geschwister durften an der Akademie lernen, obwohl sie keine magischen Fähigkeiten besaßen. Direktorin Valeria hatte ihnen aber versichert, dass ihnen das Wissen dennoch nützen würde und es genug Möglichkeiten gäbe, sich in anderen Bereichen auszubilden. In der Schmiedekunst etwa oder der Pflege magischer Kreaturen oder aber in Geschichte und anderen Fächern, die sie ohne magische Kräfte selbst unterrichten konnten.
Eleonora mochte die kleinen Schwestern von Aestus sehr. Emilia war nun neun Erdenjahre alt und ein aufgewecktes, wissbegieriges Mädchen mit langen dunkelbraunen Haaren und eisblauen Augen wie ihr großer Bruder. Sie würde bestimmt eines Tages mit magischen Kreaturen arbeiten, denn kein Tier im ganzen Wald konnte ihrem Charme widerstehen. Aurora, ein liebes Mädchen mit hellbraunen Augen und dunklen Haaren, war gerade fünf Erdenjahre alt geworden. Sie war kurz vor dem Tod ihres Vaters geboren worden und himmelte ihren großen Bruder an.
Nerius, Aestus’ Bruder, der ihm wie aus dem Gesicht geschnitten war und ebenfalls schwarze, fast bläulich schimmernde Haare und eisblaue Augen besaß, war vierzehn Erdenjahre alt und recht verschlossen. Eleonora fand es schwer, mit ihm zu reden. Doch sie wusste natürlich nicht, welche Erfahrungen der Junge in Erzstadt hatte machen müssen. Darum versuchte sie, stets freundlich zu sein, auch wenn er sie oft schroff ansprach.
Obwohl genug Platz gewesen wäre, sie alle zu beherbergen, hatte Eleonora im Wohnheim bleiben wollen, wo sie sich mittlerweile mit Daphne und Nina ein größeres Zimmer teilte. Auch Aestus hatte es vorgezogen, in seinem Wohnheim zu bleiben. Er schien sich durch seine Drachengestalt noch immer unsicher zu fühlen und wollte seine Familie nicht unnötig in Gefahr bringen. Denn auch wenn sein Herz nun frei war von dem Zorn und dem Hass, den der Drache ihm als Prüfung auferlegt hatte, musste er sich immer noch regelmäßig in einen Drachen verwandeln, um seinem Jagdtrieb nachzugehen. So sehr er sich auch bemühte, in Drachenform hatte er noch immer kaum Kontrolle über das, was er tat.
Die Schüler hatten gerade das Haus betreten, als Hilaria aus der Küche stürmte und in eine tiefe Verbeugung fiel. »Willkommen, Prinzessin«, flüsterte sie, ohne den Blick zu heben.
»Hilaria, ich habe doch gesagt, ich bin keine Prinzessin. Ich bin Eleonora«, erwiderte diese freundlich, aber etwas gereizt. Aestus’ Mutter behandelte sie und Athela wie Adelige der Menschen und das gefiel keiner von beiden.
Hilaria sah sie unsicher an. »Aber … ich kann doch nicht …«
»Doch, bitte. Eleonora genügt. Keine Titel oder Höflichkeiten. Mir wäre es auch lieber, wenn du mich mit Du ansprichst.«
Die Schülerin wandte sich Aestus zu, der seine Mutter ein wenig verkniffen anstarrte. Er wurde nicht gern daran erinnert, dass er aus einer ganz anderen Welt stammte und in seiner Heimat niemals mit einem Mädchen wie Eleonora hätte sprechen können. Für sie machte es keinen Unterschied, doch ihm war es sichtlich unangenehm, besonders vor seiner Mutter.
Hilaria schluckte, bevor sie sagte: »Aber Ihr seid doch eine Prinzessin.«
»Ich bin aber nie so behandelt worden«, erklärte Eleonora zwinkernd. »Ich möchte jetzt auch nicht damit anfangen.«
Hilaria nickte und starrte dann zu Boden. Sie war recht groß und schmal, mit dunkelbraunen Haaren und Augen. Obwohl sie erst knapp über vierzig Erdenjahre alt war, wirkte sie durch ihr schmales, faltiges Gesicht deutlich älter. Es war nicht zu übersehen, dass ihr Leben von großen Entbehrungen und harter Arbeit geprägt gewesen war.
Eleonora nahm ihre Hände sanft zwischen ihre eigenen und lächelte ihr zu. »Auch wenn du den Haushalt meiner Mutter führst, sehe ich dich vielmehr als Freundin denn als Bedienstete an. Wäre es für dich in Ordnung, wenn wir freundschaftlich verbunden wären?«
Hilaria blickte sie verwirrt an und nickte kaum merklich.
»Gut«, schmunzelte Eleonora und legte ihren Mantel ab. Aestus half ihr dabei und hängte ihn für sie auf.
Daphne und Nina hatten inzwischen im Wohnzimmer auf einer bequemen gepolsterten Bank Platz genommen und mit Athela ein wenig geplaudert. Die Magierin ließ sich gerade erklären, wie man Schnittwunden am schnellsten heilte, als Eleonora auf ihre Mutter zuging, um sie zu begrüßen.
Athela schloss ihre Tochter lächelnd in die Arme, bevor sie auch Aestus umarmte, der diese Vertrautheit immer noch angespannt über sich ergehen ließ. »Ihr seid bestimmt hungrig nach euren Kampfübungen?«, fragte die Elfe und wandte sich an ihre Haushälterin. »Hilaria, würden Sie bitte etwas zu essen und Tee zubereiten?«
»Natürlich«, erwiderte diese, knickste und verließ den Raum.
Eleonora setzte sich auf ein Kissen vor dem Feuer und wärmte sich auf. Sie hatte den Winter immer gemocht, mit seinem wunderbaren Schnee und den Kunstwerken aus Eis, die er schuf. Doch seit geraumer Zeit fühlte sie die Kälte viel stärker und empfand sie als unangenehm. Außerdem musste sie an Lucius denken und das, was sie in seinen Augen zu sehen geglaubt hatte. Der Ritter ging mit der Situation offenbar schlechter um, als sie bisher angenommen hatte.
Sie seufzte und rieb sich über die Stirn. Was sollte sie nur machen?
Sie war so in Gedanken versunken, dass sie gar nicht bemerkte, wie Aestus sich neben sie setzte. Erst als er sie zum wiederholten Mal mit dem Finger anstupste und ihr eine Tasse Tee vor das Gesicht hielt, schreckte sie hoch. Müde lächelnd nahm sie ihm das Getränk ab und roch daran. Es erinnerte sie an jenen Tee, den Aestus ihr einmal zubereitet hatte. Damals, bevor sie zum ersten Mal gegen den Schatten gekämpft hatte. Es schien ihr vor einem halben Leben gewesen zu sein und war doch erst drei Monde her.
»Woran denkst du gerade?«, raunte Aestus und legte einen Arm um sie. Verlegen drehte sie sich um und sah nach ihrer Mutter, doch die war in ein Gespräch mit Daphne vertieft und schenkte ihr keine Beachtung.
Aestus kümmerte es nicht, ob ihnen jemand zusah, wenn sie vertraut miteinander waren. Darin unterschied er sich am meisten von Lucius, der sich immer zurückhaltend verhielt, besonders wenn andere Leute sie beobachteten.
»Ich musste an den Tee denken, den du mir einmal gemacht hast, als es mir nicht gut ging.«
»Du meinst, als du wegen des Schattens nachts fast nicht geschlafen hast und befürchten musstest, dass ich mit ihm unter einer Decke stecke?«
Eleonora nickte. Es war keine einfache Nacht für sie gewesen. Sie hatte damals so viele Visionen gehabt und war vollkommen erschöpft in die Schule gewankt. Dann machte das Gerücht die Runde, ein Drache hätte mit dem Schatten gemeinsam eine Magierin angegriffen. Doch zum Glück entsprach das nicht der Wahrheit.
»Ich wusste damals nicht, wie ich dir sonst hätte helfen sollen«, erwiderte er und strich ihr über die Wange. »Du hattest so viele Sorgen und Geheimnisse, die ich dir nicht abnehmen konnte. So wie jetzt auch.«
»Ich würde gern über vieles mit dir sprechen«, flüsterte sie und musste an ihre Unterhaltung mit Valeria denken. Konnte sie ihre Freunde wirklich einweihen und damit vielleicht in Gefahr bringen? »Aber … es sind Dinge, die ich teilweise selbst nicht verstehe und erst verarbeiten muss. Es liegt nicht daran, dass ich dir nicht vertraue …«
»Redest du mit ihm darüber?«, fragte Aestus plötzlich schroff.
Eleonora bemerkte, wie eifersüchtig und unsicher er sich wegen ihrer Gefühle für ihn war. Auch ihm ging das alles nahe, obwohl er es genauso zu verbergen suchte wie Lucius. »Nein, ich rede mit niemandem darüber«, versuchte sie ihn zu beruhigen. »Nicht, solange ich selbst nicht weiß, was das alles zu bedeuten hat.«
Aestus biss sich auf die Unterlippe und nickte, doch Eleonora wusste, dass ihm diese Antwort nicht genügte. Obwohl die beiden ihr Zeit zugestanden, sich über ihre Gefühle klar zu werden, fragte Aestus oft nach, ob sie Lucius mehr anvertraute als ihm. Ob er Angst hatte, dass sie insgeheim schon eine Entscheidung getroffen hatte?
Sie schob den Gedanken beiseite und nahm seine Hand, die so viel größer war als ihre eigene. Sanft fuhr sie über seine Finger.
Aestus gab einen gequälten Laut von sich und legte auch den zweiten Arm um sie. »Es ist nur … ich weiß, dass er mehr Führungsqualitäten hat als ich«, stammelte er.
»Ich will niemandem von euch etwas anvertrauen, was kein anderer wissen darf«, beruhigte Eleonora ihn. »Ihr wisst dasselbe wie Nina und Daphne. Und manche Dinge kann ich einfach noch nicht mit euch teilen.«
Er nickte, aber sie fühlte, dass er dennoch unruhig war. Fast erleichtert sah sie auf, als Hilaria zum Essen rief, und zuckte zusammen, als sie den finsteren Blick bemerkte, den Aestus’ Mutter ihnen zuwarf, als sie sah, wie nah sie zusammensaßen. Wortlos drehte diese sich um und ging.
Als Eleonora die Küche betrat, waren Aestus’ Geschwister bereits um den Esstisch versammelt und freuten sich, an diesem Tag in großer Gesellschaft zu essen. Die beiden Mädchen fragten neugierig nach dem Training und der Schule und berichteten ihrerseits, was sie gelernt hatten. Nerius und Hilaria blieben still und warfen Aestus seltsame Blicke zu, was diesen aber nicht zu stören schien.
Es wurde dennoch viel gelacht und die Stimmung war entspannt. Eleonora genoss die Ruhe und das Beisammensein. Sie würde ihre Kraft brauchen, denn sie fühlte, dass sich etwas veränderte.
Wieder kamen ihr die Worte von Valeria in den Sinn und sie überlegte, ob sie mit ihren Freunden sprechen sollte. Sie schüttelte den Kopf. Noch war es nur ein Gefühl und nicht mehr. Solange wollte sie niemanden unnötig in Gefahr bringen.
Kapitel 5 - Aestus
Nachdem Aestus die drei Schülerinnen zu ihrem Wohnheim begleitet hatte, machte er sich noch einmal auf den Weg zu seiner Mutter. Bevor er sich verabschiedet hatte, hatte sie ihm mitgeteilt, dass sie mit ihm sprechen wollte.
Ein seltsames Gefühl überkam ihn, als er das Haus in der Dunkelheit entdeckte, und er schluckte schwer. Seine Mutter war nicht mehr dieselbe wie vor einigen Jahren. Er erkannte in ihr nicht mehr die gütige, mitfühlende Frau, die alles getan hätte, um ihre Kinder zu beschützen. Auf ihn wirkte sie zornig und vor allem eines: hasserfüllt. Er wusste nicht, wie es ihr ergangen war, nachdem er gezwungen wurde, Erzstadt zu verlassen. Er wagte es auch nicht, sie danach zu fragen. Aber die Jahre hatten sie verändert.
Als er das Haus betrat, saß Athela wieder an ihrem Schreibtisch über Zettel gebeugt. Aestus grüßte sie kurz und sie winkte ihn freundlich zu sich.
»Ich bewundere dich, dass du es mit den drei Schnattergänsen aushältst«, bemerkte Eleonoras Mutter lächelnd, als er sich zu ihr setzte.
»Nun, die drei sind eben sehr eng befreundet. Was mich offen gestanden wundert, so unterschiedlich, wie sie sind.«
»Unterschiede sind oft etwas sehr Gutes«, schmunzelte Athela. »Lordor und ich etwa sind in so vielen Dingen unterschiedlich. Vielleicht passen wir deswegen so gut zusammen, weil wir einander ergänzen.«
Aestus senkte nachdenklich den Kopf und Athela sprach schnell weiter.
»Ich wollte dich nicht in Verlegenheit bringen.«
»Nein, das haben Sie nicht. Es ist nur …«
»Du bist dir unsicher, wie es weitergehen soll.« Die Elfe sah ihn mitfühlend an.
»Mir steht die Frage vermutlich nicht zu, aber … redet sie manchmal mit Ihnen über … ihn? Oder mich?«
Athela legte den Kopf schief und betrachtete ihn aus ihren hellgrünen Augen. »Natürlich reden wir über das, was sie fühlt. Aber ich kann ihr weder einen Rat geben, noch will ich sie beeinflussen. Ich kann dir nur versichern, dass sie sehr viel für dich empfindet.«
»Aber für ihn auch«, stellte er schnaubend fest.
Athela legte behutsam ihre zierliche Hand auf seine. »Es ist für euch alle drei nicht einfach«, seufzte sie. »Ich bewundere Lucius und dich sehr dafür, dass ihr versucht, sie selbst wählen zu lassen. Sie macht sich diese Entscheidung aber auch nicht leicht.« Sie versuchte, ihm aufmunternd zuzulächeln, doch es wirkte gezwungen. »Ich habe leider auch für dich keinen Rat. Denn ich weiß, dass sie dir sehr viel bedeutet. Sie hat mir gesagt, du hättest auf sie kampflos verzichtet, wenn sie das gewollt hätte. Das ehrt dich sehr, Aestus. Aber ich fürchte, nicht du kannst für sie entscheiden. Allerdings, wenn diese Situation für dich zu belastend wird, solltest du dir überlegen, ob du so weitermachen möchtest.«
Aestus hob überrascht die Augenbrauen und Athela sprach weiter.
»Natürlich merke ich, dass es dich quält. Anders als sie, aber es quält dich. Lass uns nicht mehr darüber sprechen. Ich denke, die Zeit wird weisen, wie es für euch weitergeht.«
Aestus nickte abwesend und starrte ins Feuer. Ja, er litt unter der Situation. Ihm war klar, dass Eleonora es sich auch nicht leicht machte und sich oft schuldig fühlte. Aber er war unsagbar eifersüchtig und es schmerzte ihn, zu wissen, dass sie manchmal an Lucius dachte, wenn sie mit ihm zusammen war.
So wie heute. Er hatte gesehen, dass sie an ihn dachte, während er ihre Hand gehalten hatte. Ob es umgekehrt auch der Fall war?
Athela beobachtete ihn besorgt. »Geht es dir nicht gut, Aestus?«
Er blickte benommen auf und verzog seine Mundwinkel zu einem schiefen Grinsen. Wie ähnlich ihr Gesicht dem von Eleonora war, wenn sie sich sorgte. »Ich war nur einen Moment in Gedanken versunken«, entgegnete er schnell und stand dann auf. »Wenn Sie mich entschuldigen würden, meine Mutter wollte noch mit mir sprechen.«
Athela nickte. »Dann wünsche ich dir eine gute Nacht.«
»Ich Ihnen auch«, erwiderte er und verneigte sich auf elfische Art, indem er den Kopf tief beugte, ehe er den Raum verließ und in die Küche ging.
Hilaria stand an der Spüle und wusch das Geschirr vom Abendessen. Nerius saß über seinen Hausaufgaben, während die Mädchen leise mit ihren Puppen spielten. Als Aestus eintrat, stürmten die Schwestern freudestrahlend auf ihn zu, während Nerius nur kurz aufsah. Er wirkte konzentriert, doch Aestus wusste, dass sein Bruder ihm grollte, seitdem er von Erzstadt fortgegangen war.
Hilaria hielt in ihrer Arbeit nicht inne, als sie leise sagte: »Kinder, seid bitte so nett und lasst euren Bruder und mich einen Augenblick allein.«
Nerius schnaubte. »Ich habe noch so viele Hausaufgaben zu erledigen. Wie soll ich das machen, wenn du mich ständig hin und her scheuchst?« Mürrisch nahm er seine Bücher und verließ die Küche.
Die beiden Mädchen ließen ihren älteren Bruder los und folgten Nerius mit hängenden Köpfen.
Aestus stellte sich neben seine Mutter und begann, das Geschirr zu trocknen, das sie abgewaschen hatte. Er hätte Magie nutzen können, aber er wusste, dass sie das nicht mochte.
Hilaria sagte lange nichts, also begann er zu sprechen.
»Nerius war noch nie ein Sonnenschein wie die Mädchen. Aber er kommt mir nun besonders griesgrämig vor.«
Seine Mutter hörte nicht mit ihrer Arbeit auf, als sie antwortete. »Was erwartest du denn? Als du davongelaufen bist, richtete sich der Zorn der Bürger für das, was du geworden warst, gegen uns. Du weißt, wie sehr man Magier in Erzstadt verachtet. Und dann hast du auch noch die Schafe gerissen. Anstatt dich zu stellen, bist du gegangen und hast uns zurückgelassen.« Ihr Ton war ruhig, aber ihre Hände zitterten vor Wut. »Kaum warst du weg, hat Justus dafür gesorgt, dass ich meine Anstellung als Näherin verliere. Du willst nicht wissen, was ich alles getan habe, um den Kindern Essen besorgen zu können.«
Aestus ließ das Geschirr stehen und wollte sie umarmen, doch sie hob abwehrend die Hand.
»Nerius hat es ebenso schlimm erwischt. Er sieht dir so ähnlich! Er wurde von den Menschen beschimpft und misshandelt, für etwas, das du getan hast.« Sie spie die letzten Worte fast aus und weinte dann leise.
»Warum hast du mir nie geschrieben?«, flüsterte Aestus mit zittriger Stimme und versuchte noch einmal, sie zu umarmen, doch sie wehrte ihn ab. Er seufzte und ließ den Kopf sinken. »Ich hätte dann viel eher versucht, euch hierherzubringen. Wir wären nicht reich gewesen, aber die Menschen hier sind viel freundlicher und die Magier hätten uns bestimmt geholfen.«
»Damit ich in deren Schuld stehe?«, zischte seine Mutter und funkelte ihn an. »Ich will keine Almosen. Irgendwann will jeder eine Gegenleistung für seine Hilfe. Darum war es mir lieber, zu arbeiten. Denkst du, es fällt mir leicht, einer Elfenprinzessin zu dienen?«
»Aber Athela …«
»Prinzessin Athela ist gewiss eine gütige Herrin, aber eine Herrin ist sie. Noch dazu eine Elfe. So wie Prinzessin Eleonora.«
Aestus hatte kein gutes Gefühl dabei, wie sich das Gespräch entwickelte.
»Es gefällt mir nicht, dass du mit ihr so vertraut bist. Denn sie ist außerhalb deiner Reichweite.« Hilaria kniff die Augen zusammen und verschränkte die Arme, als sie auf seine Antwort wartete.
Ein Grinsen schlich sich auf sein Gesicht. »Das sehen sie und ich aber anders.«
»Es ist mir gleich, wie ihr es seht«, schnaubte seine Mutter. »Sie ist eine Elfenprinzessin und du bist ein Mensch, der sich in ein Monster verwandelt hat, noch dazu einer aus der niedersten Schicht.«
»So siehst du mich? Ich bin in deinen Augen ein Monster?« Seine Stimme war nicht mehr als ein Flüstern und er schluckte den Schmerz hinunter.
»Was denn sonst? Ich habe dich nie als … Drache … gesehen, aber das bist du nun einmal.« Sie weinte wieder leise, während sie das Geschirr erneut zu säubern begann. Die ganze Zeit über hatte sie es vermieden, ihn anzusehen.
»Ich hatte damals keine Wahl. Wenn ich nicht zum Drachen gegangen wäre, um seine Magie zu stehlen, wärst du gestorben.«
»Das wäre vielleicht besser gewesen«, entgegnete sie emotionslos. »Dann wärst du nicht hier und hättest den Platz eingenommen, der dir bestimmt war.«
»Und der wäre? Bergarbeiter in einem der Erzwerke?«, fuhr Aestus sie an. Er schluckte und sprach dann ruhiger weiter. »Vater hat versucht, uns aus dieser Schicht zu führen, indem er mehr gearbeitet hat, um uns eine bessere Ausbildung zu ermöglichen.«
Bei diesen Worten sah sie auf und ihr Blick war hasserfüllt, als sie seinen traf. »Wohin hat ihn das gebracht? Er hat sich zu Tode gearbeitet, nur damit wir erst recht wissen, wo unser Platz ist«, fauchte sie. »Ich habe früher auch geträumt, dass wir eines Tages aufsteigen und auf den Bällen und Empfängen willkommen sind. Doch das war ein dummer Traum eines dummen Mädchens, das es nicht besser wusste. Nun weiß ich es besser. Das solltest du auch.«
Aestus musterte sie mitfühlend. »Es tut mir leid, dass ich euch nicht früher geholt habe. Ich hätte dir das Leid, das du erfahren hast, gern erspart. Du bist nicht mehr der Mensch, der du früher warst. Aber ich hoffe, dass du hier wieder glücklich werden kannst.«
Hilaria lachte verächtlich. »Glück ist ein Trugbild, Kind. Oder willst du mir sagen, deine Elfenprinzessin macht dich glücklich damit, dass sie mit einem zweiten Mann zusammen ist?«
Er ballte seine Fäuste und atmete tief aus, bevor er weitersprach. »Du weißt nicht, wie die Situation entstanden ist, also bilde dir bitte kein Urteil darüber.«
»Ich muss es auch gar nicht wissen. Denn in meinen Augen ist es klar, dass sie dich nicht als ernsthaften Partner sehen kann. Ihr kommt aus zu unterschiedlichen Welten.«
Aestus wollte etwas entgegnen, ihr erklären, wie falsch sie lag. Doch noch während er den Mund öffnete, bebte der Boden unter seinen Füßen und er hörte die Schreie seiner Schwestern.
Ohne zu zögern, lief er los, wich den herabfallenden Gegenständen aus und erreichte das Zimmer seiner Geschwister, wo die Mädchen einander hielten, während Nerius auf einen Riss starrte, der quer über den Boden lief. Aestus folgte seinem Blick und sein Blut gefror in seinen Adern. Aus der Spalte strömte dunkler Nebel.
Er kannte diese düsteren Schwaden. Genau so hatte es ausgesehen, als er gegen den Hirsch des Schattenwesens gekämpft hatte.
Erst ein Schrei seiner jüngsten Schwester riss ihn aus seinen Gedanken. Die Erde bebte immer noch, aber weniger stark. Doch der Nebel bewegte sich auf seine Geschwister zu, die in panischer Angst zurückwichen, bis die Wand ihres Zimmers ihnen den Weg versperrte.
Aestus lief zu ihnen, nahm sie in seinen Arm und hob abwehrend eine Hand. Er stellte sich einen Lichtstrahl vor, der dieses Etwas vor sich durchstoßen sollte. »Wage es nicht, meiner Familie zu nahe zu kommen!«, schrie er die Dunkelheit an und machte sich für den Kampf bereit.
Plötzlich zog der Nebel sich wieder in den Spalt im Boden zurück und die Erde hörte auf, zu beben. Das Zimmer lag vor ihnen, als wäre nichts gewesen, nur der Riss mitten auf dem Boden erinnerte an die Schrecken der letzten Augenblicke.
Emilia und Aurora schmiegten sich an ihren Bruder und wimmerten leise, während Nerius unsicher zu Aestus blickte. »Was um alles in der Welt war das?«, fragte er ihn ängstlich.
Aber es war nicht Aestus, der ihm antwortete.
»Der Schatten … er ist wieder hier …«