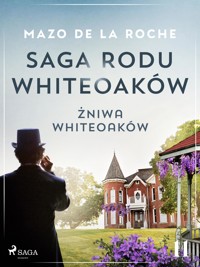3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jalna-Familiensaga
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Alayne hat sich von ihrem Ehemann Eden getrennt und genießt ihre neu gewonnene Freiheit. Aber die Geschicke der Whiteoak-Familie lassen die junge Frau nicht los - denn der junge Finch Whiteoak braucht Alaynes Hilfe. Sie kehrt nach Jalna zurück, wo schon bald ihr Verlangen nach Renny, dem Bruder ihres Mannes, aufflackert ... Wird die Leidenschaft über die Vernunft siegen?
Die epische Familiensaga schildert das Leben, die Liebschaften und die Intrigen der kanadischen Whiteoak-Dynastie, deren Herz das Jalna-Haus ist.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 507
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin:
Über dieses Buch
Über die Reihe
Über die Autorin
Titel
Impressum
1. Finch benimmt sich schlecht
2. Das Lotterielos
3. Das nächtliche Haus
4. Die Theaterprobe
5. Freunde
6. Finchs Triumph
7. Ein merkwürdiges Orchester
8. Finch muss beichten
9. Durchgebrannt
10. Die Reise nach New York
11. Heimweh
12. Unerwartete Begegnung
13. Die Brüder
14. Alayne sieht Jalna wieder
15. Minny Ware
16. Hilflose Liebe
17. Die chinesische Göttin
18. Eine Court und Angst?
19. Ein stiller Tag
20. Ist Finch mit einer Glückshaube geboren?
21. Sonnenaufgang
22. Renny und Alayne
23. Pläneschmieden
24. Finch und Eden werden Freunde
25. Brücke zu neuem Leben
26. Entwirrte Herzen
Weitere Titel der Autorin:
Stürmische Zeiten
Ein neues Leben
Über dieses Buch
Alayne hat sich von ihrem Ehemann Eden getrennt und genießt ihre neu gewonnene Freiheit. Aber die Geschicke der Whiteoak-Familie lassen die junge Frau nicht los – denn der junge Finch Whiteoak braucht Alaynes Hilfe. Sie kehrt nach Jalna zurück, wo schon bald ihr Verlangen nach Renny, dem Bruder ihres Mannes, aufflackert … Wird die Leidenschaft über die Vernunft siegen?
Über die Reihe
Die epische Familiensaga schildert das Leben, die Liebschaften und die Intrigen der kanadischen Whiteoak-Dynastie, deren Herz das Jalna-Haus ist.
Über die Autorin
Die kanadische Autorin Mazo de la Roche (1879 – 1961) schildert in ihrer insgesamt 16 Romane umfassenden Familiensaga die wechselhafte Geschichte der irisch-englischen Einwandererfamilie Whiteoak, die weltweit als Jalna-Saga bekannt wurde. Dank ihres fesselnden Stiles und der lebendig dargestellten Charaktere wurde die Romanreihe außergewöhnlich populär und in über zwanzig Sprachen übersetzt.
Mazo de la Roche
Das unerwartete Erbe
Die Whiteoak-Saga
Aus dem Englischen von Lulu von Strauß und Torney
Digitale Erstausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Titel der kanadischen Originalausgabe: »Whiteoaks of Jalna«Originalverlag: Little Brown, 1931.
Für die deutschsprachige Erstausgabe:
Copyright © der deutschen Übersetzung 1936 by Eugen Diederichs Verlag, Köln.
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2020 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat/Projektmanagement: Kathrin Kummer
Covergestaltung: Birgit Gitschier, Augsburg unter Verwendung von Motiven © Inrina Alexandrovna / shutterstock; Sareena Singh /shutterstock; helgafo/ shutterstock; Paladin12 /shutterstock
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Rimpar (www.3wplusp.de)
ISBN 978-3-7325-8789-6
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
1. Finch benimmt sich schlecht
Von dem Drehkreuz aus, wo es die Einlasskarten gab, führte ein mit rot-weiß gestreiften Zeltleinen gedeckter Gang zur Halle des Kolosseums. Der Zementboden dieses Ganges war nass von vielen schmutzigen Fußspuren, und ein eiskalter Zug fegte hindurch.
Nur noch einzelne Nachzügler kamen jetzt, und unter ihnen der achtzehnjährige Finch. Sein Regenmantel und sein weicher Filzhut trieften, selbst die glatte Haut seiner mageren Backen glänzte vor Nässe.
In einem Riemen trug er ein paar Schulbücher und ein zerfleddertes Schreibheft. Er war sich peinlich bewusst, dass sie ihn als Schüler kennzeichneten, und wünschte sich innerlich, dass er sie nicht mitgebracht hätte. Er versuchte sie unter seinem Mantel zu verstecken, aber sie bildeten dort einen so abscheulichen Auswuchs an seinem Körper, dass er sie verlegen wieder herausholte und ganz sichtbar trug.
Drinnen in der Halle fand er sich in einem Wirrwarr von Stimmen und lauten Fußtritten und mitten in einer großartigen Blumenschau. Ungeheure Chrysanthemen, deren gelockte Blütenkelche in fremdartigen Farben brannten, herrliche blassrote Rosen, die zart in ihrer eigenen Vollkommenheit zu ruhen schienen, hängende dunkelrote Rosen, schwer von Glut und Duft, drängten sich an allen Seiten.
Sein verlegenes Lächeln noch auf den Lippen, wanderte Finch zwischen den Blumen umher. Ihre vornehme Zartheit, vereint mit ihrer Farbenglut, erfüllten ihn mit einer Art zitternder Glückseligkeit. Er hätte nur gewünscht, dass nicht so viele Leute da wären. Ganz allein hätte er zwischen den Blumen umherstreifen mögen, ihren Duft mehr einsaugen als einatmen, ihre heitere Schönheit mehr eintrinken als betrachten. Eine hübsche junge Dame, reichlich zehn Jahre älter als er selbst, beugte sich über den riesigen Ball einer Chrysanthemumblüte, die in düster goldrotem Feuer brannte, und berührte sie mit der Wange. »Zum Anbeten!«, hauchte sie und warf einen lächelnden Blick auf den ungelenken langen Jungen neben sich. Finch grinste sie wieder an, aber er verdrückte sich. Doch als er sich vergewissert hatte, dass sie fort war, kehrte er zu der dunklen Blüte zurück und starrte hinein, als ob er darin irgendeine Essenz der weiblichen Anmut wiedersuchen wollte, die sie so zärtlich gestreift hatte.
Er wurde aufgeschreckt von dem Schall einer Männerstimme durch den Lautsprecher im inneren Teil des Gebäudes, wo die Pferdeschau im Gange war. Er sah auf seine Armbanduhr und entdeckte, dass es ein Viertel vor vier war. Mindestens die nächste halbe Stunde durfte er sich drinnen nicht zeigen. Er hatte die letzten paar Schulstunden geschwänzt, um noch etwas Zeit für die übrige Ausstellung zu haben, ehe die Nummern der Vorführung kamen, an denen Renny beteiligt war. Renny würde ihn dann ja erwarten, aber er würde ihm bestimmt aufs Dach steigen, wenn er merkte, dass er ein paar Stunden geschwänzt hätte. Finch war im vorigen Sommer durch die Reifeprüfung gefallen und er benahm sich jetzt Renny gegenüber äußerst demütig und bußfertig.
Er geriet in die Automobilausstellung. Wie er einen glänzend dunkelblauen Tourenwagen betrachtete, kam einer der Verkäufer herzu und fing an, dessen Vorzüge anzupreisen. Finch empfand es mit Verlegenheit und Vergnügen zugleich, so respektvoll behandelt und mit »Sir« angeredet zu werden. Ein paar Minuten stand er und sprach mit dem Mann, versuchte dabei so sachverständig wie möglich auszusehen und seinen Bücherpack außer Sicht zu halten. Als er schließlich weiterschlenderte, warf er sich in den Rücken und nahm eine Miene männlichen Gleichmuts an.
Für die Ausstellung von Äpfeln und die Goldfische in Aquarien hatte er nur einen halben Blick. Es fiel ihm ein, dass er die Käfige mit den Silberfüchsen ansehen könnte. Eine lange Treppe führte in diese Abteilung. Hier oben unter dem Dach war eine andere Welt, eine Welt, die nach Desinfektionsmitteln roch, eine Welt voll blanker Augen, spitzer Schnauzen, dichtem, gesträubtem Fell. Alle steckten sie hinter dem starken Draht ihrer Käfige. Aufgerollt zu rundem Ball, aus dem just ein wachsames Auge herausspähte; kratzend im reinen Stroh, einen Weg aus dieser trübseligen Gefangenschaft suchend; aufrecht auf den Hinterbeinen, mit hochmütigen kleinen Gesichtern, die durch das Drahtnetz schnupperten. Am liebsten hätte Finch die Türen all der Käfige geöffnet. Er stellte sich diese wilde Flucht, das rasende Jagen über die herbstlichen Felder vor, das wütende Graben des Baus, das Verstecken unter der schützenden Erde, wenn er sie befreit hätte. Oh, wenn er sie nur freilassen könnte, zu rennen, zu wühlen, Junge zu werfen unter der Erde, wozu sie geschaffen waren!
Von Käfig zu Käfig schien geheime Botschaft zu gehen, dass jemand gekommen war, ihnen zu helfen. Wohin er sah, schienen erwartungsvolle Augen auf ihn gerichtet. Die kleinen Füchse gähnten, streckten sich, zitterten vor Erwartung. Warteten ...
Ein Hornruf klang von unten herauf. Finch kam zu sich. Er trollte sich weg, kehrte den Gefangenen den Rücken und stolperte die Treppe hinab.
Oben an der Treppe lehnte trübselig ein älterer Mann vor einer Kanarienvogel-Ausstellung. Er hielt den Jungen an und bot ihm ein Los für die Lotterie an. Der Gewinn war ein schöner Vogel, ein guter Roller.
»Nur 25 Cents das Los«, sagte er, »und der Vogel ist 25 Dollar wert. Geradezu eine Schönheit. Hier sitzt er in seinem Käfig. Einen großartigeren Vogel habe ich nie gehabt. Sehen Sie bloß die Farbe und den Bau an. Und singen sollten Sie ihn hören. Was für ein Geschenk für Ihre Mutter, junger Mann, und in sechs Wochen schon Weihnachten!«
Finch dachte, wenn seine Mutter noch gelebt hätte, wäre das wirklich ein sehr hübsches Geschenk für sie gewesen. Er malte sich aus, wie er ihn in seinem glänzend vergoldeten Käfig einer schattenhaften, bezaubernden jungen Mutter von etwa fünfundzwanzig Jahren schenkte. Mit seinen hellen hungrigen Augen starrte er den Kanarienvogel an, der gut gefüttert, hübsch und schlank aussah, und murmelte etwas Undeutliches. Der Aussteller hielt ihm ein Los hin.
»Da, sehen Sie – Nummer 31. Es sollte mich gar nicht wundern, wenn das eine Glücksnummer wäre. Zwei möchten Sie wohl nicht nehmen? Eigentlich könnten Sie ebenso gut gleich zweie nehmen.«
Finch schüttelte den Kopf und holte die 25 Cents heraus. Wie er die Treppe hinunterging, fluchte er über seine eigene Schwäche. Er war gerade knapp genug bei Gelde gewesen und brauchte es nicht auch noch zum Fenster hinauszuwerfen. Er stellte sich Renny vor, wenn den einer beschwatzen wollte, ein Lotterielos für einen Kanarienvogel zu kaufen.
Nach dieser Ausgabe verzichtete er darauf, ein Programm für die Reihenfolge der Pferdeschau zu kaufen. Die billigeren Plätze waren schon so besetzt, dass er nur noch einen ganz weit hinten zwischen einem Gedränge von Männern und jungen Leuten bekam. Der Mann neben ihm war ziemlich angetrunken. Er hielt das dicke Heft des Wochenprogramms so nah vor sein Gesicht, dass er fast mit der Nase darauf stieß.
»Verdammt undeutlich, das Programm«, brummte er, »eine Seite noch schlimmer als die andere.«
Das Schiedsgericht war drinnen im Ring schon im Gange. Hier und da auf dem lohebestreuten Platz standen Männer mit ihren Pferden am Zügel. Drei Schiedsrichter mit Notizbüchern in der Hand gingen langsam von Pferd zu Pferd und berieten bisweilen miteinander. Die Pferde standen unbeweglich bis auf eines, das ungeduldig tänzelte. Ein kräftiger Geruch nach Lohe und nach Pferden hing in der Luft, die noch kühl war trotz des dichten Gedränges der Zuschauer.
Der Mann mit dem Megafon rief die Namen der Preisträger aus. Bänder wurden ihnen überreicht, und sie verschwanden ebenso wie die geschlagenen Rivalen in den hinteren Regionen. Die Musik setzte ein.
»Verdammt unnützes Programm!«, murmelte es dicht an Finchs Ohr. »Kann nichts damit anfangen.«
»Vielleicht kann ich es«, sagte der Junge, der gern einen Blick in das Programm geworfen hätte, aber doch nicht gern im Gespräch mit solch einem Menschen gesehen werden wollte.
»Kauf dir doch selber eins!«, gab der Mann laut zurück. »Bild dir nicht ein, dass du bei mir schmarotzen kannst.«
Unter den näheren Zuschauern brach ein Gelächter aus. Finch ließ sich in seinen Sitz fallen, dunkelrot und beschämt. Er war geradezu dankbar für den ausbrechenden Lärm der Kapelle, der das Musikreiten ankündigte.
Seine Stimmung hob sich, wie er die glänzenden Tiere, von Kavalleristen aus der Kaserne geritten, zierlich und hochmütig die schwierigen Wendungen ausführen sah. Er ließ sich von der schmeichelnden Harmonie von Ton, Bewegung und Farbe mitreißen. Die Lampen, die von der hohen Decke herunterhingen, von Flaggen und Fähnchen umgeben, schwankten in den vibrierenden Wellen der Luft.
Die nächste Nummer war das Preisgericht über Pferde unter Damensattel. Es gab fünfzehn Bewerber, darunter Silken Lady, geritten von Finchs Schwägerin Pheasant Whiteoak. Sie kam ganz am Ende der Reihe, mit einer großen 15 auf weißem Schild am Gürtel. In Finch stieg ein plötzlicher Stolz auf, wie er Silken Lady um den Ring traben sah, in jeder Bewegung ihr edles Blut und ihren Lebensmut zeigend. Und auch Pheasant selbst sah er mit einer Art Besitzerstolz an. Wie ein schlanker Junge sah sie aus in ihrem braunen Rock mit Kniehosen, mit ihrem bloßen, kurz geschnittenen Haar. Wunderlich, wie jung sie wirkte, nach allem was sie durchgemacht hatte. Dieser Geschichte mit Eden, die Piers und sie beinahe auseinandergebracht hatte. Jetzt schienen die beiden sehr glücklich. Piers lag mächtig daran, dass Pheasant beim Springen gut abschnitt. Ein richtiger Dickschädel, Piers – eine Weile mochte er ihr das Leben verdammt schwer gemacht haben. Ein wahres Glück, dass Eden jetzt sicher aus dem Wege war. Unheil genug hatte er angerichtet – für Piers ein schlechter Bruder, ein schlechter Ehemann für Alayne! Aber das war nun alles vorbei. Finch richtete seine Aufmerksamkeit ganz auf die Reiter.
Ein dicker Mann in Oberstuniform exerzierte sie durch die verschiedenen Gangarten und ließ sie in langer Reihe, bald schnell, bald langsam, um den Ring kreisen. Pheasant blasses Gesicht wurde rosig. Vor ihr ritt ein kurzes rundliches Mädchen in tadellosem englischen Reitkostüm, mit einem blanken kleinen Glockenhut und schneeweißem Reitstock. Ein junger Mann neben Finch erzählte ihm, dass sie aus Philadelphia kam. Sie hatte ein auffallend schönes Pferd. Die Preisrichter waren schon darauf aufmerksam geworden. Finch sank der Mut, als das amerikanische Pferd rhythmisch über die Lohe hintrabte. Als die Reiter absaßen und in lässiger Haltung neben ihren Pferden standen, hingen Finchs Augen wie gebannt an Pheasant und dem Mädchen aus Philadelphia.
Es kam, wie er fürchtete. Das blaue Band wurde dem Pferd des dicken Mädchens über den Zügel geheftet. Silken Lady bekam nicht einmal das zweite oder dritte. Sie fielen Pferden aus anderen Städten der Provinz zu. Pheasant ritt aus den Schranken mit dem Trupp der Besiegten, das kleine Gesicht unbewegt.
Jetzt kam das Damen-Jagdreiten an die Reihe. Eine heitere Erwartung klang aus den lustigen Trommelwirbeln. Die erste Reiterin trabte herein, die Tannenlohe stob unter den blanken Hufen ihres Pferdes mit dem kühn gebogenen Hals. Mit fröhlicher Sicherheit trabte es leicht auf das vier Fuß hohe Tor los. Aber im Augenblick, wo die Reiterin vor dem Sprung den Kopf vorbeugte, schwenkte es zur Seite und trabte friedlich um den Ring. Die Erwartung löste sich in Gelächter auf, das durch die Sperrsitze lief und in den hinteren Reihen laut ausbrach. Die Reiterin riss das Pferd scharf herum und ritt von Neuem auf das Tor los. Diesmal nahm das Pferd es ohne Schwierigkeit. Es kam auch glücklich über den Wall, dann die erste Hürde, aber als es über das Hindernis setzte, schlug es gegen die oberste Barre, dass sie krachend zur Erde polterte. Noch einen Versuch. Wieder das Scheuen am Tor, aber diesmal wurden zwei Barren mitgerissen. Ein Hornsignal klang. Reiterin und Pferd verschwanden, die erstere niedergeschlagen, das Tier sichtlich mit sich zufrieden.
Zwei weitere Bewerber kamen und verschwanden ohne Zwischenfall. Der nächste war das Mädchen aus Philadelphia. Das schöne Pferd wirkte zu groß für die rundliche Person in dem tadellosen Reitkostüm. Aber es verstand seine Sache. Es warf sich mit aller Kraft in den Sprung. Nur ein kleines Missgeschick in den zwei Runden – ein leichter Schlag über die Flanke. Sie trabte ab unter einem Sturm von Händeklatschen.
Dann kam Pheasant auf Soldier, dem Halbbruder von Silken Lady. Finch bekam Herzklopfen, als sie in die Arena trabte. Es war kein Spaß, Soldier zu regieren. Eigentlich kein Pferd für ein schmächtiges Mädel von Neunzehn. Er näherte sich dem Tor seitlings und zeigte dabei die Zähne in einem fatalen Grinsen. Pheasant ritt ihn zum Start zurück und lenkte ihn dann wieder mit sanfter Ermutigung auf das Tor zu. Wieder scheute das Tier vor dem Sprung. Wieder riss Pheasant ihn herum und machte einen neuen Anlauf, aber diesmal jagte ihn ein scharfer Hieb dicht vor dem Tor darüber hinweg wie auf Flügeln. Dann flog er über jedes der hohen weißen Tore, dass die weißen Socken seiner Hinterläufe blitzten und sein gelbbrauner Schweif flatterte.
Finch grinste glückselig. Gute kleine Pheasant. Braver Soldier. Heftig stimmte er in den Beifallssturm ein, der sie begleitete. Aber trotzdem wartete er mit ängstlichen Augen auf die zweite Runde. Diesmal gab es kein Scheuen, nur ein schnelles triumphierendes Hinwegfliegen über Tor, Hecke, doppelte Hürde. Aber man konnte nie wissen, was Soldier einfallen würde. Vor dem letzten Tor wich er plötzlich seitwärts aus, galoppierte vorbei und verschwand unter Händeklatschen und Gelächter.
Das Mädchen aus Philadelphia, Pheasant und drei andere wurden für den Hochsprung aufgerufen. Alle fünf machten ihre Sache gut, aber das amerikanische Pferd war das Beste. Betrübt sah Finch ein, dass der Preisrichter recht hatte, als er ihm das blaue Band verlieh und Soldier nur das rote. »Aber so reiten wie Pheasant kann das Mädchen doch nicht«, dachte er.
Jetzt kamen die Herrenreiter hereingestürmt, grau und fuchsfarben, braun und schwarz, einer dicht hinter dem anderen. Ah, da war Renny! Diese hagere kräftige Gestalt, die aussah, als wäre sie verwachsen mit dem hochbeinigen Rotschimmel. Eine Welle von Erregung lief durch die Menge, wie ein Windstoß über ein Kornfeld. Als die Musikkapelle plötzlich schwieg, nahm der Donner der Hufe den Rhythmus auf, mitreißender noch und stärker. Finch konnte es auf seinem Platz nicht mehr aushalten. Er schlüpfte zwischen den
Knien seiner Nachbarn durch bis zum Seitengang und die Stufen hinunter. Er drängte sich in die Reihe von Männern, die an der Barriere standen, welche die Rennbahn abschloss.
Hier sah die Lohe wie brauner Samt aus. Hier hörte man das Knarren des Leders, das Schnaufen und Schnarchen der glänzenden Tiere, ihr schweres Aufstöhnen, wie sie nach dem Sprung über die Hürde auf dem Boden landeten. Er starrte atemlos hinüber. Mit den Augen folgte er jedem Pferde, wie es hochflog, dem vorgebeugten Reiter, den beiden kraftvollen Geschöpfen, die wundervoll zu dem Bild eines Zentauren zusammenwuchsen.
Keine Weiber in diesem Wettkampf. Nur Männer. Männer und Pferde. Wie das Herz einem aufging!
Wie Rennys Pferd die Barriere nahm, die Hürde, durch die Luft flog, dumpf wieder auf die Hufe aufprallte und über den Lohgrund hindonnerte, die Nüstern weit, den Atem aus dem mächtigen Körper stoßend, schien es die Verkörperung wilder Urkraft. Und Renny mit seiner scharfen Nase, die Augen brennend in dem schmalen Fuchsgesicht, um die Lippen dies verkniffene Lächeln, das fast etwas Bösartiges hatte, schien auch wie besessen von dieser wilden Kraft.
Der Tumult der dahinjagenden Pferde, deren Schnauben im Vorbeirasen in warmen Stößen sein Gesicht streifte, reißt seine Einbildungskraft mit, dass sie wie ein fantastischer Nebel zwischen ihm und der Wirklichkeit des Bildes vor ihm aufsteigt. Er sieht Rennys Stute, die eben auf ihn zugaloppieren, auf sich selbst losrasen anstatt auf das Ziel. Er sieht sie über sich, ihn zertrampelnd, unter ihren Hufen ihn zerstampfend, ihn vernichtend ... Sieht seine Seele sich aus dem zerstampften Körper lösen, durchsichtig, schimmernd, seltsam gestaltet, wie sie auf das Pferd springt, hinter Renny, ihn mit Schattenarmen von wilder Kraft umklammert, sich mit ihm hoch über die im Ring herumjagenden Reiter hebt, über die beifallklatschenden Zuschauer, über die Lampen da oben, von denen farbige Wellen und düstern Himmel hinaufbranden. Die Trommeln wirbeln, die aufschwellende Musik der Hörner trägt sie ...
Er steht an das Geländer geklammert, ein hagerer Bursche mit hohlen Backen und hungrigen Augen, das eine knochige Schulterblatt unter dem Rock scharf vorstehend. Sein Ausdruck ist so merkwürdig, dass Renny, als er langsam auf seinem mit dem blauen Band geschmückten Rotschimmel durch die Bahn reitet und ihn dabei zufällig zu Gesicht bekommt, bei sich denkt: »Großer Gott, der Bengel sieht ja geradezu wie ein Idiot aus!«
Als Finch ihn unter den Gruppen von Männern und Pferden in der Einfriedung hinter der Arena aufsuchte, grüßte er ihn nur mit kurzem Kopfnicken. Er sprach weiter mit einem streng aussehenden Offizier in amerikanischer Leutnantsuniform. Finch war dieser Mann bei verschiedenen Hindernissprüngen aufgefallen. Er hatte den nächsten Preis nach Renny, das rote Band.
Finch stand bescheiden daneben und hörte ihrem Gespräch über Pferde und Jagd zu. Gegenseitige Bewunderung leuchtete beiden aus dem Gesicht. Schließlich sah Renny nach seiner Armbanduhr.
»Ich muss weiter. Übrigens, dies ist mein junger Bruder. Finch, Mr. Rogers.«
Der Amerikaner schüttelte dem jungen Menschen freundlich die Hand, sah ihn aber nicht gerade beifällig an.
»Scheint zu schnell zu wachsen«, bemerkte er zu dem älteren Bruder, als sie weitergingen.
»O ja«, antwortete Renny, »kein rechtes Mark in den Knochen«, und entschuldigend fügte er hinzu: »Er ist musikalisch.«
»Studiert er Musik?«
»Angefangen hat er. Ich habe aber Schluss damit gemacht, seit er vorigen Sommer durchs Examen gefallen ist. Ich weiß nicht, was ich mit ihm anfangen soll. Seit er die Musik nicht mehr hat, wirft er sich auf die Schauspielerei. Scheint, dass er alles andere lieber tut als arbeiten. Wird aber wohl noch zurechtkommen, denke ich. Die hässlichsten Füllen, wissen Sie, werden manchmal ...«
Sie überquerten nun einen offenen gepflasterten Platz, der nur spärlich von den Scheinwerfern eines Autos erhellt wurde, das vorsichtig zwischen den von Stallknechten zum Stall oder zur Bahnstation geführten Pferden seinen Weg suchte.
Renny Whiteoak und der Amerikaner trennten sich, und Finch, der hinterhergetrollt war, kam an seines Bruders Seite.
»Verdammt kalt jetzt!«, murmelte der Junge.
»Kalt!«, rief der Ältere verwundert aus. »Heiß ist mir! Das ist das Unglück mit dir, dass du nicht genug Bewegung hast. Sport müsstest du treiben, dann hättest du bessere Blutzirkulation. Ein eben geworfenes Fohlen könnte es nicht kalt finden heute!«
Aus dem Auto, dem sie sich eben näherten, rief eine Stimme: »Bist du da, Renny? Ich dachte, du kämst überhaupt nicht mehr. Ich bin eiskalt geworden.« Es war Pheasant. Renny stieg ein und machte Licht. Finch kletterte herein neben das Mädchen.
»Ihr seid mir ein Paar!«, sagte Renny und schaltete die Kuppelung ein. »Ich müsste euch in ein Nest von Watte setzen, was?«
»Jedenfalls«, beharrte sie kläglich, »ist es sehr schlecht für das Baby, wenn ich mich erkälte, und ich habe es schon viel zu lange allein gelassen. Kannst du den Wagen nicht anlassen?«
»Irgendwas ist mit seinen verdammten alten Eingeweiden nicht in Ordnung«, knurrte er, fügte dann aber hoffnungsvoll hinzu: »Vielleicht ist der Motor nur etwas kalt geworden.« Er hantierte heftig mit dem veralteten Mechanismus des Autos und machte zugleich in halblautem Schimpfen einem Hass von sieben Jahren Luft. Er liebte und verstand Pferde, aber die Launen eines Motors waren ihm unbegreiflich.
»Wie habe ich abgeschnitten?«, unterbrach ihn Pheasant.
Einen Augenblick kam keine Antwort, dann brummte er: »Ganz leidlich. Aber der Hieb für Soldier war nicht nötig. Ganz überflüssig.«
»Na, wenigstens hab ich den zweiten Preis.«
»Hättest den ersten kriegen können, ohne das. Himmel, ob ich diesen verdammten alten Kasten je nach Hause kriege!«
Pheasants Stimme klang entrüstet.
»Aber bedenk doch, das Pferd von dem amerikanischen Mädchen! Fabelhaft!«
»Ist Soldier auch!«, brummte ihr Schwager eigensinnig.
Finch lehnte in einer Ecke des Wagens, in niedergeschlagener Stimmung. Die dicke feuchte Dunkelheit der frühen Nacht, der Gedanke an die Arbeitsstunden in seinem kalten Schlafzimmer, die vor ihm lagen, fühlte er wie Hände, die aus schlammigem Grund nach ihm griffen und ihn herunterzerrten. Ausgehungert war er auch. Er hatte ein Stück Schokolade in der Tasche, und er überlegte, ob er es herausholen und in den Mund stecken könnte, ohne dass Pheasant es merkte. Er tastete danach, fand es und wickelte es vorsichtig aus dem zerrissenen Silberpapier, während ein wütender Ausbruch Rennys ihre Aufmerksamkeit abzog. Er stopfte es in den Mund, sankt tiefer in seine Wagenecke und schloss die Augen.
Eben fing er an, sich behaglich zu fühlen, als Pheasant ihm plötzlich ins Ohr zischte: »Widerliches kleines Schwein!«
Er hatte vergessen, mit ihrem scharfen Geruchssinn zu rechnen. Sie suchte in ihrer Tasche, holte eine Zigarettendose heraus, und im nächsten Augenblick erhellte der rasche Schein eines Zündhölzchens ihr kleines blasses Gesicht und zeigte den spöttischen Zug um ihre Lippen, die die Zigarette hielten. Süßlicher Rauch hing schwer in der feuchten Luft. Finch hatte am Nachmittag seine letzte Zigarette geraucht. Natürlich hätte er Renny um eine bitten können, aber solange der sich mit dem Auto herumärgerte, war es nicht gerade geraten, ihm mit einem Anliegen zu kommen. Jetzt warf sich der älteste Whiteoak mit verzweifelter Bewegung in seinen Sitz zurück.
»Wir können just so gut zu Fuß nach Hause gehen«, warf er kurz hin. Er zündete sich auch eine Zigarette an. Rauch und missmutiges Schweigen herrschten im Wagen. Der Regen schlug gegen die Scheiben, und mit jedem Schüttern der wackeligen Seitenfenster fegte ein kalter Zug herein. Die Lichter anderer Autos glitten verschwommen im Regen vorbei.
»Aber du warst famos, Renny«, sagte Pheasant, um die Stimmung etwas zu heben. »Und dass du das blaue Band gekriegt hast! Ich kam gerade dazu und sah das Ganze!«
»Kein Kunststück, zu gewinnen, mit dem Rotschimmel!«, sagte er. »Donnerwetter, das ist ein Gaul!« Und einen Augenblick darauf fügte er mit deutlicher Anspielung hinzu: »Freilich, wenn ich der Esel gewesen wäre, ihm eins überzuziehen, hätte ich wohl kaum mehr als den zweiten Preis gekriegt.«
»Oh, wie kalt ich bin!«, rief Pheasant aus, die den Anwurf unbeachtet ließ. »Und ich kann nichts denken als an mein armes kleines Baby!«
Finch ärgerte sich plötzlich heftig über die beiden, wie sie dasaßen und rauchten. Was hatten sie denn zu tun, wenn sie nach Hause kamen? Sich in einem Stall herumlümmeln und ein kleines Wurm zu säugen. Während er sein elendes Gehirn mit Trigonometrie abrackern musste. Er schluckte das letzte Stück Schokolade herunter und sagte heiser: »Du warst ja mächtig intim mit diesem dummen amerikanischen Leutnant. Wer war der Bursche?«
Die flegelhafte Unverschämtheit seiner Worte erschreckte ihn selbst, schon während er sie aussprach. Er hätte sich nicht gewundert, wenn Renny sich umgewandt und ihm eins an die Ohren gegeben hätte. Auch aus Pheasants Ecke spürte er ein entsetztes Zusammenzucken.
Aber Renny antwortete ganz ruhig. »Ich kenne ihn von Frankreich her. Ein famoser Kerl. Hat auch viel Geld.« Und neidisch setzte er hinzu: »Und einen der besten Rennställe in Amerika.«
Pheasant stöhnte. »O mein armer kleiner Mooey! Soll ich denn nie zu ihm zurückkommen?«
Ihres Schwagers Ton wurde gereizt. »Mach dir klar, mein Kind, dass du entweder das Reiten in einer Pferdeschau aufgeben musst oder das Kinderkriegen. Beides zusammen geht nicht.«
»Aber ich habe doch beides erst voriges Jahr angefangen«, klagte sie, »und beides ist so wundervoll, und Piers will beides so gerne.«
Finch knurrte. »Könntest zur Abwechslung mal jemand anderen zitieren?«
»Wie soll ich das machen? Er ist der einzige Mann, den ich habe!«
»Aber nicht der einzige Bruder, den ich habe, und ich habe es satt, seine Worte vorgepredigt zu kriegen, als ob er der liebe Gott selber wäre.«
Sie beugte sich vor, ihr Gesicht war ein weißlicher Schimmer gegen die Finsternis.
»Wer so allein mit sich selber beschäftigt ist wie du, der will natürlich von keinem anderen etwas wissen. Wer ein Stück Schokolade herunterschlingt, wenn eine junge Mutter ausgehungert neben ihm sitzt. Wer …«
»Sag noch einmal ›Wer‹ und ich springe aus dem Wagen«, schrie Finch sie an.
Der Zank wurde durch einen heftigen Ruck abgebrochen. Der Motor war losgegangen. Renny stieß ein befriedigtes Grunzen aus.
Er kauerte hinter dem Steuerrad und starrte geradeaus in die Novembernacht. Als sie aus der Vorstadt heraus waren, lag die Landstraße fast verödet. Selbst in den Dörfern, durch die sie hinflitzten, waren die Straßen fast leer. Die endlose Weite von See und Himmel zur Linken war eine schwarze Finsternis, nur der Schein vom Leuchtturm blitzte herüber, und zwei düsterrote Lichter zeigten einen Schoner an, der gegen den Wind ankämpfte.
Seine Gedanken flogen voraus in den Stall zu Haus in Jalna. Mike, ein hübscher Wallach, war heute Morgen schlimm am Bein verletzt worden durch den Hufschlag eines bösartigen neuen Pferdes. Er beunruhigte sich sehr um Mike. Der Tierarzt hatte gesagt, die Sache wäre nicht ungefährlich. Es lag ihm daran, schnell nach Haus zu kommen und zu hören, wie der Tag gewesen war. Er dachte an das neue Pferd, das das Unglück angerichtet hatte. Einer von Piers’ Käufen. Ihm selbst hatte gleich der Blick nicht gefallen, den das Biest in den Augen hatte, aber Piers waren die Anlagen bei einem Gaul völlig gleichgültig, wenn er nur gut gebaut war. Piers würde seine Anlagen schon, ziehen wie es ihm passte. Das schien so seine Idee zu sein. Na, er sollte diesem neuen Klepper seine Anlagen austreiben und ihn kurzhalten. Renny machte sein finsteres Gesicht, das seine Großmutter immer zu dem begeisterten Ausruf bewegte: »Ein Court von Kopf bis zu Füßen, der Junge! Richtig wütend kann er aussehen, wenn ihm danach ist!«
Er dachte an ein Fohlen, das eins der Ackerpferde den Morgen geworfen hatte. Merkwürdige Geschöpfe: Pferde – überhaupt die Natur an sich, merkwürdige Sache. Der Unterschied zwischen dem einen Gaul und dem anderen – einem Ackerpferd und einem Jagdpferd! Sonderbar, unbegreiflich auch die Verschiedenheit zwischen Gliedern derselben Familie. Seine jungen Stiefbrüder und er selbst. Viel schwieriger zu behandeln als Pferde, die Jungens, gar kein Vergleich. Eigentlich dürfte das nicht sein, sie waren doch das gleiche Fleisch und Blut, vom selben Vater gezeugt ... Aber gab es zwei Jungen, die ungleicher waren als der kleine Wakefield, so ein feinfühliges, zärtliches kluges Kerlchen, und der junge Finch, den man mit aller Gewalt weder zum Lernen noch zum Interesse für Sport bewegen konnte und der immer nur mit schläfrigem Gesicht herumträumte? In letzter Zeit war er wunderlicher und schlafmütziger denn je gewesen ... Und dann Piers. Piers war wieder ganz anders. Der derbe Piers mit seiner Liebe zu Pferden, zum Land. Darin verstanden sie sich gut, Piers und er, in der Passion für Pferde, der Anhänglichkeit an Jalna. Und Eden ... Er stieß einen Ton zwischen Knurren und einem Seufzer aus, wie er an Eden dachte. Nicht eine Zeile von ihm, seit er nach der Geschichte mit Pheasant verschwunden war, jetzt vor fast anderthalb Jahren. Das bewies so recht, was das Versemachen aus dem Menschen machen konnte – ließ ihn allen Anstand vergessen, einem Mädchen wie Alayne das Leben zu verderben. Was für ein schmähliches Durcheinander war das gewesen, diese Geschichte! Piers war seitdem viel stiller, viel mehr zu Verstimmung geneigt, obgleich die Geburt des Kindes viel dazugetan hatte, dass die Sache wieder in Ordnung kam. Armes Wurm, das heulte jetzt wohl schon längst nach seiner Abendmahlzeit.
Er fuhr schneller trotz des schlüpfrigen Weges und rief über die Schulter zurück: »In zehn Minuten zu Hause, also Kopf hoch, Pheasant! Hat einer von euch eine Zigarette? Ich habe meine letzte geraucht.«
»Ich auch, Renny. Oh, was bin ich froh, dass wir fast da sind! Du bist ordentlich zugefahren, wenn man bedenkt, wie dunkel es ist.«
»Hast du eine, Finch?«
»Ich?«, rief der Junge, der sein eines knochiges Knie rieb, das vom langen Sitzen in der gleichen Stellung eingeschlafen war. »Ich habe nie welche. Ich kann sie mir nicht leisten. Ich brauche mein ganzes Taschengeld, das kann ich dir sagen, für die Bahnfahrten und mein Frühstück, und Gebühren hier und Gebühren da. Für Zigaretten hab ich nichts übrig.«
»Ist dir in deinem Alter auch viel gesünder!«, gab sein Bruder kurz zurück.
»Schokolade ist viel besser für dich«, zischelte Pheasant dicht an seinem Ohr.
Renny spähte durchs Fenster. »Da ist der Bahnhof«, sagte er, »wahrscheinlich hast du dein Rad da gelassen. Willst du es holen? Oder willst du lieber bei uns im Wagen bleiben?«
»Es ist ein scheußliches Wetter. Ich glaube, ich bleibe im Wagen. Nein – ich will – Himmel, ich weiß nicht, was ich tun soll.« Er starrte ratlos in die Nacht. Renny brachte den Wagen mit einem Ruck zum Stehen. Über die Schulter fragte er zurück: »Was zum Teufel ist mit dir los?« Renny streckte seinen langen Arm rückwärts und machte die Tür neben dem Jungen auf. »So«, sagte er mit einem drohenden Brustton in der Stimme. »Jetzt steigst du aus!«
Finch kletterte heraus und tat einen lächerlichen Hopser, als sein tauber Fuß auf den Boden kam. Er stand mit hängendem Kopf, wie die Tür zuknallte und der Wagen losfuhr, der noch einen Sprühregen von Straßenschlamm gegen seine Hosenbeine spritzte.
Schwerfällig und ganz voll Mitleid mit sich selber trottete er zur Station. In dem Raum hinter der Bahnmeisterei fand er sein Rad gegen die Waage gelehnt. Eigentlich wäre es gar kein übler Gedanke, sich zu wiegen, dachte er. Die letzte Zeit hatte er täglich ein Glas Milch getrunken, in der Hoffnung, etwas Fett anzusetzen. Er stellte sich auf die Waage und suchte unsicher auf der Gewichtsskala. Ein Durcheinander von Männerstimmen kam aus dem inneren Zimmer, streitend und einander überschreiend. Die Waage bewegte sich, er spähte eifrig nach den Zahlen, dann strahlte er auf – glatt drei Pfund zugenommen. Ein kindliches Lächeln erhellte sein Gesicht. Die Milch tat ihm gut, das war klar. Er nahm zu. Das ließ sich hören, drei Pfund in vierzehn Tagen. Er musste noch mehr trinken. Er trat von der Waagfläche herunter und wollte eben sein Rad nehmen, als er merkte, dass das eine Pedal auf der Waage lehnte. Ein Verdacht verdüsterte sein Gesicht. Hatte das Pedal nicht vielleicht etwas mit seiner Gewichtszunahme zu tun? Er setzte das Rad beiseite und stellte sich wieder auf die Waage. Gespannt sah er auf die Gewichtsskala. Er bewegte den Messingzeiger. Vier Pfund weniger! Nicht zugenommen hatte er, sondern abgenommen! Verloren! Er wog ein Pfund weniger als vor vierzehn Tagen.
Düster nahm er sein Rad und führte es aus dem Bahngebäude. Er schwang sich in den Sattel und trat mit stumpfer Ausdauer die Pedale, den Radweg neben den Schienen entlang. »Verfluchte alte Karre! Verfluchter Regen! Vor allem verdammte Milch!« Er wollte nichts mehr davon wissen.
Die Auffahrt, die zum Haus führte, war ein schwarzer Tunnel. Tannen und Balsamfichten schlossen sie wie eine Mauer mit ihren harzduftenden Zweigen ein. Der schwere Duft, der Geruch der Pilze, die unter ihnen wuchsen, war durch die dauernde Nässe der letzten beiden Wochen so gesteigert, dass er fast wie eine fühlbare Essenz war, die aus dem dichten Gehänge der Zweige tropfte und aus der nassen Erde aufquoll. Es war ein Zugang, der zu einem verwunschenen Schloss hätte führen können oder zu der geheimen Zuflucht der Anbeter vergessener Götter. Als der junge Mensch durch die drückende, duftgeschwängerte Dunkelheit fuhr, bewegte er sich wie in einem Traum und fast als ob er nun ewig so dahingleiten müsste, ins Unbekannte hinein, aus dem ihm kein Licht, keine Wärme entgegengrüßte.
Eine Art Frieden kam über ihn. Er hätte unter diesen alten Bäumen immer weiterfahren mögen, bis ihre gelassen feierliche Würde auf ihn überging. Er stellte sich vor, wie er in das Zimmer zu der versammelten Familie eintrat, die ernste Würde eines dieser Bäume wie einen Mantel um sich geschlagen. Er malte sich aus, wie bei seinem Eintritt ein kühler Schauer sich über die freundlich rauen Geister dieser wenigen erhabenen Wesen legen würde.
Wie er den Kiesplatz vor dem Hause erreichte, fegte der Regen mit noch gesteigerter Heftigkeit ihm entgegen, im Ostwind ratterten die Läden und die dürren Zweige des Virginiaweins kratzten an der Mauer. Warmes Licht schien aus den Fenstern des Esszimmers.
Er schob sein Rad in einen dunklen Kellergang und ging in den kleinen Waschraum, sich die Hände zu waschen. Als er sie abtrocknete, warf er einen Blick auf sein Spiegelbild in dem kleinen fleckigen Glas über dem Becken: Eine dünne helle Locke hing ihm in die Stirn. Eine lange schmale Nase, hagere Wangen, von Wind und Regen leicht gerötet. Eigentlich sah er gar nicht so schlecht aus, fand er. Er fühlte sich etwas getröstet.
Als er an der Küche vorbeikam, hörte er die gequetschte Stimme von Rags, dem Hausmann, singen:
»Einmal wird dein Herz gebrochen sein ...
wie meins.
Warum soll ich denn weinen,
weinen über deins ...«
Er warf einen Blick auf den roten Backsteinfußboden, die niedere Decke, die rußig war vom Rauche vieler Jahre, in denen Rags’ rundliche Frau am Herd gestanden hatte. Er wurde plötzlich guter Dinge. Er sprang die Treppe hinauf, hing seinen nassen Mantel in der Halle auf und trat ins Esszimmer.
2. Das Lotterielos
Es gab den Abend ein besonderes Gericht zu Tisch. Finch spürte es, sogar ehe er es gerochen hatte, an dem heiter festlichen Ausdruck der Gesichter um die Tafel. Sicher hatte Tante Auguste es bestellt, weil sie wusste, dass Renny nach seinem langen Tag und den Anstrengungen der Pferdeschau ausgehungert sein würde. Finch sollte eigentlich in der Schule warmes Mittagessen bekommen, aber er sparte sein Taschengeld lieber, bestellte sich nur ein leichtes Frühstück und behielt so eine ganz anständige Summe für Zigaretten, Schokolade und sonstige Wünsche übrig. Infolgedessen hatte er abends immer einen gewaltigen Hunger, denn zum Tee konnte er nicht rechtzeitig zu Hause sein. Die Mengen von Nahrungsmitteln, die in seinem hageren Körper verschwanden, ohne Fleisch anzusetzen, waren eine Quelle des Erstaunens und fast der Sorge für seine Tante.
Das besondere Gericht war ein Käseomelett. Mrs. Rags besondere Stärke waren Käseomeletts. Finchs Blicke bohrten sich in die Schüssel von dem Augenblick an, wo er sich zwischen seinem Bruder Piers und dem kleinen Wakefield in seinen Stuhl fallen ließ. Es war nicht mehr viel davon übrig und schon so lange aus dem Ofen, dass es seine erste schmackhafte Lockerheit längst verloren hatte, aber er wünschte leidenschaftlich, dass er das letzte bisschen Käsekruste aus der silbernen Schüssel kratzen dürfte.
Renny, der sich ein großes Stück kaltes Fleisch genommen hatte, sah ihn durchdringend an und wies dann mit einem Kopfnicken nach dem Omelett hin: »Möchtest wohl die Schüssel auskratzen?«
Finch wurde rot und murmelte ein Ja.
Renny sah jedoch über den Tisch nach Lady Buckley hin: »Noch etwas Omelett, Tante Augusta?«
»Danke, lieber Junge. Ich habe überhaupt schon mehr gegessen, als ich durfte. Käse des Abends ist nicht gerade bekömmlich, aber in dieser Form schadet es vielleicht nichts, und ich dachte, dass du nach deiner ...«
Der Hausherr von Jalna ließ sie höflich ausreden, den Blick auf ihrem Gesicht, dann wandte er sich an seinen Onkel Nicholas.
»Noch einen Löffel voll, Onkel Nick?«
Nicholas wischte seinen hängenden grauen Schnurrbart mit einer ungeheuer großen Serviette und brummte: »Nicht einen Bissen mehr. Aber ich hätte gern noch eine Tasse Tee, Augusta, wenn du noch welchen hast.«
»Onkel Ernest, noch etwas von dieser Käsespeise?«
Ernest wehrte das Anerbieten mit einer feinen weißen Hand ab: »Bester Junge, nein! Ich hätte es überhaupt nicht anrühren sollen. Ich wollte, wir hätten nicht immer diese warmen Gerichte des Abends. Ich erliege der Versuchung, und dann leide ich.«
»Piers?«
Piers hatte sich schon zweimal genommen, aber mit einem spöttischen Blick aus dem Augenwinkel auf Finchs langes Gesicht sagte er: »Ich hätte nichts gegen einen Happen mehr.«
»Ich auch!«, rief Wake. »Ich möchte noch etwas!«
»Ich verbiete das!«, sagte Augusta und schenkte sich die dritte Tasse Tee ein.
»Du bist viel zu klein, um abends Käseomelett zu essen.«
»Und du«, warf ihr Bruder Nicholas ein, »bist eine viel zu alte Dame, um dir so spät am Abend einen solchen Topf voll Tee einzupumpen!«
Lady Buckleys gewohnte Miene beleidigter Würde verstärkte sich merklich. Auch ihre Stimme wurde tiefer. »Ich wollte, Nicholas, du gewöhntest dir die ordinären Ausdrücke ab. Ich weiß, es wird dir schwer, aber du solltest bedenken, was für ein schlechtes Beispiel es für die Jungen ist.«
Piers hatte sich inzwischen noch einmal Omelett genommen und schob dann Finch die Schüssel zu, der sie mit der einen hageren Hand festhielt und sie hastig mit dem großen silbernen Löffel auszukratzen anfing.
Wakefield betrachtete seine Tätigkeit mit dem gönnerhaften Staunen des Gesättigten, der die Schüssel heiß aus dem Ofen genossen hat. »Da sitzt noch ein bisschen, gerade am Griff«, sagte er und zeigte hilfsbereit auf das Bröckchen.
Finch hörte einen Augenblick mit dem Kratzen auf, um ihm mit dem Löffel einen derben Schlag auf die Finger zu geben.
Wake schrie laut »Au!« und wurde von Tante Augusta aus dem Zimmer geschickt.
Renny sah gereizt den Tisch entlang. »Bitte schick das Kind nicht hinaus, Tante. Wenn er gehauen wird, dann schreit er eben. Wenn jemand hinausgeschickt werden muss, ist es Finch.«
»Keiner hat Wakefield was getan«, sagte Augusta würdevoll, »er schreit los, wenn Finch ihn bloß ansieht.«
»Dann kann Finch ja anderswohin sehen.« Und Renny machte sich wieder an die Vertilgung seines Roastbeefs, als ob er die verlorene Zeit wieder einbringen und zugleich dieser Geschichte ein Ende machen wollte.
Nicholas beugte sich zu ihm herüber. »Was meinst du zu einer Flasche, Renny?«, brummte er.
Ernest unterbrach ihn und tippte ihn mit seiner nervösen weißen Hand auf den Arm: »Denk daran, Nick, dass Renny morgen im Hochsprung mitreitet. Er braucht einen kühlen Kopf.«
Renny fing laut zu lachen an.
»Donnerwetter, das ist gut! Tante Augusta, hörst du? Ernie hat Angst, dass mir ein Glas Alkohol den Kopf heiß macht! Sieh bloß, wie rot er jetzt selber schon ist!«
»Kann Rags ihn holen?«, fragte Nicholas.
»Natürlich. Und für sich selbst eine Flasche beiseitebringen, was? Den Weinkellerschlüssel, bitte, Tante!« Er ging um den Tisch zu Augusta und sah auf ihre Königin-Alexandra-Fransen und ihre lange, etwas fleckige Nase herunter. Sie nahm einen Schlüsselbund von einer Kette, die sie um die Taille trug.
Wakefield hopste auf seinem Stuhl. »Lass mich mit, bitte, bitte, Renny! Ich mag den Keller so gern, und ich komme fast nie herein. Darf ich mit in den Keller, zum Spaß, Renny?«
Renny wandte sich mit den Schlüsseln in der Hand an Nicholas.
»Was schlägst du vor, Onkel Nick?«
»Ein paar Flaschen Chianti!«, brummte er.
»Unsinn, ich meine es ernst.«
»Was hast du denn im Keller?«
»Neben dem Fass Bier und hiesigem Landwein sind nur ein paar Flaschen Jamaika-Rum da und etwas Schlehenschnaps. Und Whisky natürlich.«
Nicholas lächelte spöttisch: »Und das nennst du einen Weinkeller?«
»Himmel«, sagte sein Neffe ärgerlich, »er hat immer der Weinkeller geheißen, und wir können ihn nicht umtaufen, auch wenn nicht viel drin ist.«
»Tante?«
»Ich dachte«, sagte Ernest, »wir hätten noch eine halbe Flasche französischen Wermuth?«
»Der ist oben in meinem Zimmer«, antwortete Nicholas kurz, »etwas Rum und Wasser, mit einem Schuss Zitronensaft, wäre mir gerade recht, Renny.«
»Und du, Tante?«
»Ein Glas hiesigen Portwein. Und ich finde wirklich, Finch müsste auch eins haben, wo er so viel lernen muss.«
Ehe noch das Gelächter ausbrach, das auf diese Fürbitte folgte, kroch der arme Finch schon tiefer in seinen Stuhl zusammen, dunkelrot vor Verlegenheit, aber eine warme Aufwallung von Dankbarkeit gegen Augusta stieg in ihm auf. Sie wenigstens war nicht gegen ihn.
Renny ging auf die Tür der Halle zu, und wie er an Wakefields Stuhl vorbeikam, packte er den erwartungsvollen kleinen Kerl am Arm und schleifte ihn mit wie ein Paket.
Sie stiegen die Treppe in den Keller hinunter, wo Wakes Nase den geheimnisvollen Geruch schnupperte, den er so liebte. Hier waren die große Küche mit ihren mannigfaltigen Gerüchen, der Kohlekeller, der Obstkeller, der Weinkeller, die Speisekammer und die drei kleinen Dienstbotenstuben, von denen jetzt nur eine besetzt war. Hier lebten die Rags ihr wunderliches unterirdisches Leben voll Zänkereien, gegenseitigem Misstrauen und gelegentlicher Verliebtheit, bei der Wake sie einmal überrascht hatte.
Sowie Rags ihre Schritte unten hörte, erschien er in der Küchentür, einen Zigarettenstummel in seinem blassen Gesicht.
»Ja, Mr. Whiteoak?«, fragte er. »Soll ich etwas?«
»Bring eine Kerze, Rags. Ich will eine Flasche holen.«
Das Gesicht des durchtriebenen Burschen glänzte verständnisvoll auf.
»Jawohl, Sir!«, sagte er, warf den Zigarettenstummel auf den Backsteinboden, verschwand in der Küche und kam sofort mit einer Kerze in einem wackeligen Messingleuchter zurück. Durch die Küchentür sahen sie für einen Augenblick Mrs. Rags, die ehrerbietig von dem Tisch aufstand, an dem sie gegessen hatte, und gegen deren Vollmondgesicht das ihres Herrn und Gebieters wie der abnehmende Mond aussah.
Mit Rags an der Spitze gingen sie alle drei im Gänsemarsch einen schmalen Gang entlang, der vor einer Tür mit schwerem Vorhängeschloss endigte. Hier schloss Renny auf, und die störrisch widerstrebende Tür wurde aufgestoßen. Mit der eisigen Kälte drinnen mischte sich der Geruch von Bier und Alkohol. Das Kerzenlicht beleuchtete einen scheinbar wohlversehenen, wenn auch etwas unordentlichen Weinkeller, aber in Wirklichkeit waren es meist leere Flaschen und Weinkisten, die mit der in der Familie üblichen Nachlässigkeit nie zurückgeschickt worden waren.
Rennys rotbraune Augen glitten prüfend über die Flaschenlager. Mit dem Kopf hatte er ein Spinngewebe von einem Balken heruntergestreift, das ihm nun über das eine Ohr hing. Er pfiff durch die Zähne mit der zufriedenen Gelassenheit eines Stallknechts, der ein Pferd striegelte.
Wakefield hatte unterdessen einen alten weidenen Fischkorb unter dem niedrigsten Flaschenbord entdeckt. Er zerrte ihn hervor und sah im Kerzenschein drei dicke spinnwebbedeckte Flaschen, die aneinanderlehnten wie in einer heimlichen Verschwörung. Ein flüssiges Gluckern erhob sich darin, als sie herausgeholt wurden, und wie er die eine vorsichtig aufhob, spielte ein funkelnd dunkelrotes Licht unter dem staubigen Glas.
»Hallo, Renny!«, rief er begeistert. »Hier ist aber was Feines!«
Renny hatte seine Flaschen ausgesucht, setzte sie aber jetzt plötzlich auf ein Bord, riss Wake schnell seinen Schatz aus der Hand, stellte ihn zu den anderen beiden und schob den Korb eilig wieder in sein Versteck.
»Wenn du das hättest fallen lassen, junger Satansbraten du, ich hätte dich auf der Stelle umgebracht!« Und mit grinsendem Seitenblick auf seinen Diener fügte er hinzu: »Ein Geheimnis muss ein Mann in seinem Leben haben, was, Rags?«
»Ein Geheimnis in seinem Leben!« Der kleine Junge war begeistert bei dem Gedanken. Was für ein zauberhaftes Getränk hatte sich sein prachtvoller Bruder hier in diesem unterirdischen Winkel versteckt? Was für heimliche Besuche mochte er hier machen, was für Wunder und Hexerei? Oh, wenn Renny ihn nur auf diesen geheimen Wegen mitnehmen wollte!
Ihm wurde befohlen, die Kerze zu halten, während Rags die Tür verschloss. Er sah Rennys Augen scharf auf die schmutzigen Hände des Dieners gerichtet. Er sah die Augen schmal blinzeln; dann schob Renny die eine der beiden Flaschen, die er trug, unter den Arm, und rüttelte mit der nun freien Hand am Vorhängeschloss. Es glitt ihm in die Hand. »Versuch es noch einmal, Rags«, sagte er, und sein scharfes Gesicht mit der langen Nase der Courts sah so unheimlich aus wie das der Großmutter.
Während Rags diesmal mit Erfolg die Tür abschloss, bemerkte er: »Mein Lebtag hab ich nicht mit diesen verzwickten Schlössern fertigwerden können.« Er war völlig harmlos.
»Nicht, wenn ich zusehe, Rags. Da, nimm dem Bürschchen das Licht ab. Er lässt es seitwärts tropfen.«
»Ja, Sir. Aber lassen Sie mich vorher bitte das Spinngewebe von Ihrem Kopf nehmen.«
Renny bückte den Kopf herunter und Rags nahm es feierlich fort.
Sie bildeten eine wunderliche Prozession, die etwas von fremdartigen religiösen Riten hatte. Rags vorneweg hätte eine Art spukhafter Akoluth sein können, wie das grelle Kerzenlicht scharf seine knochigen Züge, die glatte Nase, das vorspringende Kinn, die unverschämt breiten Backenknochen beleuchtete; Wake in seiner leidenschaftlichen Versunkenheit ein junger Messknabe und Renny mit einer Flasche in jeder Hand der zelebrierende Priester. Der enge gemauerte Gang, durch den sie kamen, hätte in seiner Kälte ganz gut die Krypta einer Kirchenruine sein können, und aus der Küche, wo Mrs. Rags wie gewöhnlich irgendetwas auf dem Herdrost verbrannte, trieb ein dünner blauer Rauchschleier wie Weihrauch.
Am Fuß der Treppe blieb Rags stehen und hielt die Kerze hoch, um den andern beim Aufsteigen zu leuchten. »Einen vergnügten Abend, Sir«, sagte er, »und viel Glück für die Jalnaer Pferde. Wir werden hier unten auch darauf anstoßen – mit Tee, Herr!«
»Mach ihn recht schwach, Rags. Besser für deine Nerven!«, riet sein Herr gefühllos, wie er die schwere Tür oben an der Kellertreppe mit einem schweren Stiefel zustieß.
Im Esszimmer saß Nicholas wartend und strich sich mit der großen wohlgeformten Hand, an der ein schwerer Siegelring steckte, den hängenden Schnurrbart, einen Ausdruck humoristischer Zufriedenheit in den Augen. Ernest dagegen stand schon etwas von Bedauern und Reue im Gesicht geschrieben, denn er wusste, dass er trinken würde, und wusste ebenso genau, dass seine Verdauung dafür zu leiden haben würde. Trotzdem lag eine heitere Stimmung in der Luft. Er musste halb trübselig über die Gesichter um sich her lächeln und über das Vorgefühl seines eigenen Sündenfalls.
Augusta saß würdevoll aufrecht, ihre Kameenbrosche und die lange goldene Kette hob und senkte sich auf ihrer Brust, die weder zu voll noch zu flach war, sondern nach dem Vollkommenheitsideal ihrer Jugend straff in Korsettstangen eingepanzert. Sie hob den Kopf und sah ihrem Neffen erwartungsvoll entgegen. Er staubte die Portweinflasche ab und setzte sie ihr hin.
»Da, Tante ... den Korkenzieher, Wake ... Onkel Nick ... Jamaika-Rum ... Dieser Schurke, Rags, wollte eigentlich die Kellertür unverschlossen lassen, damit er sich einschleichen und etwas für sich beiseitebringen könnte. Aber ich fasste ihn dabei ab, Gott sei Dank.«
»Ein unverbesserlicher Schuft!«, sagte Nicholas.
»Er müsste lebendig geschunden werden!«, stimmte Ernest freundlich bei.
»Ich hätte es genauso gemacht!«, lachte Piers. Pheasant war heruntergekommen und hatte sich einen Stuhl neben seinen gezogen. Sie löffelte eine Schale Milch mit Brot, und der Anblick ihres darübergebeugten braunen, kurz geschorenen Kopfes und kindlichen Nackens brachte ein belustigtes, aber zärtliches Lächeln auf Piers’ Lippen. Er strich ihr mit seiner sonnengebräunten Hand über den Nacken und sagte: »Wie du diesen Papp essen kannst, begreife ich nicht.«
»Ich bin dabei groß geworden. Außerdem ist es wirklich gesund für Mooey.«
»Tu etwas Rum herein«, riet Nicholas. »Du brauchst etwas zum Wärmen nach der langen kalten Fahrt. Wahrscheinlich wäre es auch für den kleinen Maurice gut. Würde dazu helfen, dass er ein richtiger Whiteoak und ein Gentleman wird.«
»Das ist er schon beides«, sagte Pheasant trotzig, »und ich werde meine Nachkommen nicht zum Alkohol ermutigen, selbst nicht aus zweiter Hand.«
Jetzt erhob Finch seine Stimme: »Ich finde, ich könnte auch ein Glas kriegen. Wenn man nächstens neunzehn ist, kann man schon einen Schluck vertragen, meine ich.«
Renny beruhigte seine Hunde. »Was sagst du, Finch?«
Es war einen Augenblick Stille, in die Finchs Stimme sonderbar laut hereinklang, mit einem weinerlichen Ton darin: »Ich sage, dass ich achtzehn bin und nicht einsehe, warum ich nicht auch einen Schluck haben soll.«
Piers sagte: »Gib ihm einen Schluck von deinem Wein, schnell, Tante Augusta, sonst fängt er an zu weinen.«
Finch bezwang mit Mühe seinen Ärger und starrte den Rest Apfelkuchen an, der vom Familienessen für ihn aufgehoben war.
»Gebt dem Jungen ein Glas Rum«, sagte Nicholas, »wird ihm guttun.«
Renny streckte seinen langen Arm aus und schob die Portweinflasche zu Finch hinüber. »Nimm dir selber, Finch!«, sagte er mit plötzlich gönnerhafter Miene. Alle um den Tisch hatten angefangen zu sprechen. Nicht laut oder durcheinander, aber ganz vergnügt und gemeinsam. Lächeln ging hier und da über die Gesichter als Zeichen der inneren guten Stimmung.
Nach zwei Gläsern drehten sich Ernests Gedanken nur noch um eines: was er morgen bei der Pferdeschau anziehen sollte. Er besaß einen neuen Herbstmantel von teurem englischen Stoff und beim besten Schneider in der Stadt gemacht, ein Luxus, wie er ihn sich seit Jahren nicht geleistet hatte. Im Grunde hatte er ihn sich im Hinblick auf die Pferdeschau gekauft, aber das Wetter war so kalt und nass, dass Ernest mit seiner Neigung zu Erkältungen in einer fatalen Lage war. Der Schneider hatte ihm gesagt, dass er noch nie einen Mann in seinen Jahren von so schlanker und aufrechter Figur gesehen hätte: ganz anders als der arme alte Nick, dachte Ernest, der so schwerfällig geworden war und wegen seines gichtischen Knies meist am Stock gehen musste. Aber seine empfindliche Brust? Eine ernstliche Erkältung um diese Jahreszeit konnte die schlimmsten Folgen haben. »Sag mal, Renny«, fragte er, »wie ist es eigentlich im Kolosseum? War es heute außergewöhnlich kalt?«
»Kalt?«, rief Renny, den er in einem begeisterten Hymnus auf die Fähigkeiten des Pferdes unterbrach, das er anderen Tags im Hochsprung reiten wollte. »Kalt war es überhaupt nicht! Das reine Warmhaus! Ein Backfisch hätte in einem Sommerfähnchen kommen können und hätte nicht gefroren!«
Er zog Wake an sich und gab ihm einen Schluck aus seinem Glas. Der kleine Junge, der am liebsten immer im Mittelpunkt des Kreises war, hatte gefragt: »Renny, darf ich auf deinen Knien sitzen?«
Sein älterer Bruder fragte ihn: »Wie alt bist du?«
»Elf, Renny. Noch nicht schrecklich alt.«
»Zu alt, um verhätschelt zu werden. Ich darf dich nicht verpimpeln. Aber du kannst auf meiner Stuhllehne sitzen.«
Piers rief, als Renny das Kind an sich zog: »Na, wenn das nicht verhätscheln heißt!«
»Kein Gedanke daran«, warf Renny zurück. »Liebhaben heißt das. Ein gewaltiger Unterschied, was Wake? Frag nur die Mädchen!«
Piers saß nicht mehr. Er stand am Tisch und lächelte alle an. Er sah auffallend gut aus, wie er dastand, mit seiner kräftigen Gestalt, seinen strahlenden blauen Augen.
Pheasant dachte: Wie entzückend sieht er aus. Seine Augen glänzen genau wie Mooeys. Himmel, die riesige Flasche ist fast leer! Sonderbar, dass ich von einem Vater, der viel zu sehr an der Flasche hängt, zu einem Manne komme, der auch solche Neigungen hat, wo ich selber doch meiner ganzen Natur nach abstinent bin. Nie werde ich bei meinem Kleinen den Hang zum Alkohol unterstützen, wenn er groß wird.
Tante Augusta flüsterte Finch zu: »Du musst hinaufgehen und arbeiten, mein Junge. Heute Abend müsstest du gut lernen können nach den zwei schönen Gläsern Wein!«
»Hm, hm!«, nickte Finch und stand gehorsam vom Tische auf. Er nahm seine Bücher von dem Seitentisch, wo er sie hingelegt hatte, und seufzte bei dem Gedanken, diese heitere entspannende Atmosphäre verlassen zu müssen, um Mathematik zu büffeln. Als er sich umwandte, fiel das Lotterielos zwischen den Blättern seines Euklid heraus auf den Boden.
Wake sprang von Rennys Stuhllehne und hob es auf. Finch war schon in der Halle. »Er hat was verloren!« Und der kleine Junge besah es neugierig. »Ein Los! Sieh, Nummer 31. Hallo, Finch, du hast was fallen lassen, mein Junge!« Finch kehrte ärgerlich um. Eingebildetes kleines Biest, mit seinem frechen »Mein Junge«.
»Zeig her«, sagte Piers, nahm Wake das Los ab und untersuchte es. »Verdammt will ich sein, wenn das nicht ein Lotterielos ist! Was machst du für Geschichten, junger Finch? Hinterhältig bist du. Willst ein Vermögen machen, he, von dem die Familie nichts weiß? Bist noch ein Schuljunge, merk dir das« – das ging auf sein Durchfallen im Examen – »und Glücksspiel ist nichts für dich!«
»Was ist los?«, fragte Renny misstrauisch. »Gib her.«
Piers gab das Los seinem Besitzer zurück. »Gib es deinem großen Bruder«, riet er, »und dann lauf und hol ihm seinen Rasierriemen.«
Finch starrte ihn an, stopfte das Los in seine Tasche und schob sich nach der Halle.
»Hierher zurück!«, befahl Renny. »Jetzt sagst du sofort, was für ein Lotterielos das ist.«
»Himmel noch mal!«, schrie der gereizte Finch. »Kann ich nicht ein Lotterielos kaufen, wenn ich Lust habe? Ihr tut, als ob ich ein kleines Kind bin!«
»Meinetwegen kannst du dir ein Dutzend kaufen, wenn du Lust hast, aber es gefällt mir nicht, wie du dich bei diesem anstellst. Wofür ist es?«
»Für einen Kanarienvogel, wenn du es wissen musst!« Finchs Stimme war heiser vor Wut. »Wenn ich mir nicht ein Los für einen verdammten Kanarienvogel kaufen kann, ist das einfach verrückt!«
Der Heiterkeitsausbruch aus den Lungen seiner Onkel und Brüder hätte wohl in wenig Familien seinesgleichen an lärmendem Ungestüm gehabt. Nachdem das Gelächter endlich verebbte, drang Rennys metallische Stimme wieder durch. »Einen Kanarienvogel!«, wiederholte er. »Nächstens wird er einen Goldfisch und einen Gummibaum haben wollen!« Aber obgleich er lachte, schämte er sich innerlich tief für Finch. Er hatte den Jungen gern. Es war demütigend, dass er solch ein Waschlappen war – sich einen Kanarienvogel zu wünschen, um alles auf der Welt!
Ein heftiges Bumsen kam aus dem Schlafzimmer über der Halle.
»Da!«, rief Ernest, ärgerliche Besorgnis im Gesicht. »Hab ich es euch nicht gesagt? Ihr habt sie aufgeweckt. Ich hab es ja gewusst. Es ist sehr schlimm für sie in ihrem Alter, so aufgeweckt zu werden.«
Augusta sagte ohne Aufregung: »Wakefield, geh in Großmutters Zimmer. Mach leise die Tür auf und sag: ›Es ist nichts, Großmutter. Bitte beruhige dich!‹«
Bei dem Bild dieser Szene zwischen seinem kleinen Bruder und seiner uralten Großmutter, das Piers bei diesen Worten aufstieg, lachte er laut auf. Seine Tante und Onkel Ernest sahen ihn missbilligend an.
Ernest bemerkte: »Höflichkeit kann der Junge nie zu früh lernen, Piers.«
Wakefield ging durch die Halle, feierlich im Bewusstsein seiner eigenen Wichtigkeit. Er öffnete die Tür zum Zimmer seiner Großmutter und sah sich beim Hereinkommen fast ängstlich in dem halbdunklen Raum um, der nur undeutlich von einem Nachtlicht auf einem niedrigen Tisch am Kopfende des Bettes erhellt wurde. Es war ihm interessant, sich zu fürchten – nur ein klein wenig – vor dem Alleinsein mit der Großmutter in dieser unheimlichen Beleuchtung, während der Regen draußen vor den Fenstern von der Dachtraufe tropfte und im Kamin ein einzelnes rotes Auge glühte, als ob da ein böser Geist hockte und ihn belauerte. Er stand sehr still, horchte auf ihr schnaufendes Atmen und konnte in dem Halbdunkel eben ihr Gesicht auf den Kissen erkennen und die ruhelose Bewegung ihrer einen Hand auf der dunkelroten Steppdecke.
Die gemalten Blumen und Früchte auf der alten lederbezogenen Bettstelle, die sie aus dem Osten mitgebracht hatte, glühten undeutlich und matter als das Gefieder des Papageien, der da oben hockte. Ein Seufzer aus dem Bett zitterte in der Luft, die schwer war von dem Duft lange verwelkter Rosenblätter. Die längst vergangenen Erinnerungen stiegen mit diesem Seufzer empor. In diesem Bett waren Augusta, Nicholas, Ernest, der verstorbene Philip, der Vater all dieser stürmischen jungen Whiteoaks, geboren, in ihm alle vier Geschwister zur Welt gekommen. Hier war auch Philip, ihr Vater, gestorben. Was für Ängste und Schmerzen, wie viel Rausch, Seltsamkeiten und Träume hatte das Bett erlebt! Jetzt brachte Großmutter den größten Teil ihres Tages hier zu.
Ihre Hand hob sich und blieb über der Decke schweben. Ein kleines rotes Gefunkel sprang aus dem Rubinring, den sie immer trug. Sie tastete nach ihrem Stock. Ehe sie ihn fassen und wieder damit aufpochen konnte, trottete Wakefield zu ihr hinüber. Wie ein kleiner Papagei sagte er: »Es ist alles in Ordnung, Großmutter. Bitte beruhige dich.«
Er genoss geradezu die würdevollen Worte, die Tante Augusta ihm aufgetragen hatte. Am liebsten hätte er sie noch einmal gesagt. Und er wiederholte wirklich: »Bitte, beruhige dich.«
Sie starrte ihm ins Gesicht. Ihre Nachtmütze war schief gerutscht und ihr eines Auge war ganz davon bedeckt, aber das andere sah ihn sonderbar durchbohrend an.
»He?«, fragte sie. »Was soll das?«
»Beruhige dich«, wiederholte er ernsthaft und klopfte sacht auf die Bettdecke.
»Beruhigen? Ich? Ha! Denen will ich helfen sich beruhigen, der Familie da unten!«, sagte sie wütend. »Mit meinem Stock! Wo ist mein Stock?« Er schob ihn ihr in die Hand und zog sich etwas zurück.
Sie besann sich einen Augenblick und versuchte wiederzufinden, was sie gewollt hatte, dann erinnerte sie ein neu ausbrechendes Gelächter unten im Esszimmer daran.
»Was soll der Lärm heißen? Weshalb schreien sie so?«
»Wegen einem Kanarienvogel, Granny. Finch hat ein Lotterielos dafür.« Er kam ihr jetzt wieder ganz nah und sah ihr ins Gesicht, neugierig auf die Wirkung seiner Worte.
Die Wirkung war schauderhaft. Ihr Gesicht verzerrte sich vor Wut. Einen Augenblick starrte sie wortlos zu ihm auf, dann stammelte sie undeutlich: »Einen Kanarienvogel – einen Vogel – einen andern Vogel – hier im Haus! Ich will das nicht! Boney wird wütend! Das leidet er nicht! Er reißt ihn in Stücke!«
Boney, den der Klang seines Namens aufweckte, zog den Kopf unter den Flügeln heraus, streckte ihn vor und starrte von seinem Platz oben auf dem bemalten Kopfende der Bettstelle auf seine Herrin herunter.
»Haramzada!«, schrie er wild auf Hindostanisch. »Haramzada! Iflateon! Paji! Paji!« Er hob sich auf den Krallenzehen und schlug mit den Flügeln, dass ein kleiner Windstoß heißer Luft Wakefield über das Gesicht fuhr.
Die alte Mrs. Whiteoak richtete sich im Bett auf. Sie streckte ihre großen Füße in purpurroten Bettschuhen unter der Decke hervor und hinterher ihre langen Beine.
»Mein Schlafrock!«, stöhnte sie. »Da auf dem Stuhl! Gib ihn mir. Das will ich euch zeigen, ob ich einen piepsenden verflixten Kanarienvogel im Haus haben will!«
Wakefield wusste, dass er ins Esszimmer hinunterlaufen und die Großen rufen müsste. Noch nie war das passiert, was Großmutter da machte, dass sie aufstand, ohne dass Tante Augusta oder einer der Onkel ihr half. Aber seine Begeisterung für das Neue, für Aufregung war stärker als seine Vernunft. Er brachte den schweren purpurroten Schlafrock und half ihr hinein. Er schob ihr den Stock in die zittrig eifrige, wohlgeformte Hand.
Aber wie sie nun auf die Füße bringen! Das war ganz was anderes. Wenn er auch mit aller Kraft an ihrem Arm zerrte, er brachte sie nicht hoch.
»Ha!«, grunzte sie bei jeder neuen heroischen Anstrengung, und ihr Gesicht nahm mehr und mehr die Farbe ihres Schlafrocks an.
Schließlich legte sie den Stock hin. »Hilft nichts«, murmelte sie, »hilft nichts. Da, nimm meine beiden Hände, zieh mich hoch!«
Sie hielt ihm ihre beiden Hände hin, ungeduldige Erwartung in dem einen Auge, das die Nachtmütze nicht verdeckte. Sie hoffte augenscheinlich bestimmt, dass der kleine Junge die Sache fertigbrächte. Aber als er ihre Hände nahm und mit aller Kraft zog, war das Resultat nur, dass er auf dem Teppich ausrutschte und sein kleiner Körper ihr in die Arme fiel. Sie brach plötzlich in lautes Lachen aus und drückte ihn an sich, und er fing an, halb lachend über sein Missgeschick und halb weinerlich über seine Schwäche, mit den Bändern ihrer Nachtmütze zu spielen.
»Paji! Paji! Kuza Pusth!«, schrie Boney und schlug mit den scharlachbunten Flügeln. Mrs. Whiteoak schob Wakefield von sich weg.
»Was machen wir?«, fragte sie verdutzt.
»Ich versuchte dich hochzukriegen, Granny!«
»Wozu?« Ihr Auge funkelte misstrauisch.
»Wegen dem Kanarienvogel, Granny, Finchs Kanarienvogel, weißt du nicht mehr?«
Im Augenblick flammte ihr altes Gesicht auf vor Wut.
»Ob ich weiß! Natürlich weiß ich! Ein Kanarienvogel im Haus. Ich will das nicht. Ich schlage Lärm. Ich mache eine Szene. Ich will ins Esszimmer.«
»Soll ich Renny holen?«