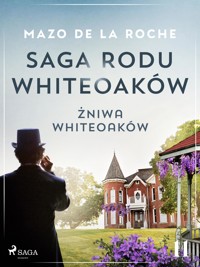3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jalna-Familiensaga
- Sprache: Deutsch
Finch Whiteoak feiert seinen einundzwanzigsten Geburtstag. Der sensible junge Mann kann damit endlich sein Erbe antreten, das ihm seine Großmutter Adeline hinterlassen hat. Auf einer Reise nach England lernt er die ungewöhnliche Sarah Court kennen und verliebt sich Hals über Kopf in sie. Aber auch sein bester Freund Arthur ist von der jungen Frau verzaubert ...
Die epische Familiensaga schildert das Leben, die Liebschaften und die Intrigen der kanadischen Whiteoak-Dynastie, deren Herz das Jalna-Haus ist.
"Ein neues Leben" ist der dritte Band der Saga, der in einer früheren Ausgabe unter dem Titel "Jalna-Saga. Finch im Glück" erschienen ist.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 588
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin:
Über dieses Buch
Über die Reihe
Über die Autorin
Titel
Impressum
1. Von gleichem Blut
2. Erinnerungen
3. Der Schatten der Eule
4. Der Held des Tages
5. Hinaus in die Welt
6. Unter feinen Leuten
7. Finch geht eigene Wege
8. Begegnung in Augustas Heim
9. Gedanken über Frauen
10. Träumerische Freuden
11. Antiquitäten
12. Eine seltsame Hochzeit
13. Sturmnacht
14. Flüchtiges Glück
15. Unruhe auf Jalna
16. Die Farm von Clara Lebraux
17. Verfehlte Wege
18. Gewitter
19. Einsamkeit
20. Wieder zu Hause
21. Alayne findet ihre Heimat
22. Das Torhaus ohne Gäste
23. Melancholie
24. Die Fuchsjagd
25. Finchs Bilanz
26. Pauline Lebraux
27. Ein neuer Whiteoak
Weitere Titel der Autorin:
Stürmische Zeiten
Das unerwartete Erbe
Über dieses Buch
Finch Whiteoak feiert seinen einundzwanzigsten Geburtstag. Der sensible junge Mann kann damit endlich sein Erbe antreten, das ihm seine Großmutter Adeline hinterlassen hat. Auf einer Reise nach England lernt er die ungewöhnliche Sarah Court kennen und verliebt sich Hals über Kopf in sie. Aber auch sein bester Freund Arthur ist von der jungen Frau verzaubert …
Über die Reihe
Die epische Familiensaga schildert das Leben, die Liebschaften und die Intrigen der kanadischen Whiteoak-Dynastie, deren Herz das Jalna-Haus ist.
Über die Autorin
Die kanadische Autorin Mazo de la Roche (1879 – 1961) schildert in ihrer insgesamt 16 Romane umfassenden Familiensaga die wechselhafte Geschichte der irisch-englischen Einwandererfamilie Whiteoak, die weltweit als Jalna-Saga bekannt wurde. Dank ihres fesselnden Stiles und der lebendig dargestellten Charaktere wurde die Romanreihe außergewöhnlich populär und in über zwanzig Sprachen übersetzt.
Mazo de la Roche
Ein neues Leben
Die Whiteoak-Saga
Aus dem Englischen von Lulu von Strauß und Torney
Digitale Erstausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Titel der kanadischen Originalausgabe: »Finch’s Fortune«
Originalverlag: Little Brown, 1929.
Titel der deutschen Erstausgabe „Finch im Glück“
Copyright © der deutschen Übersetzung 1937 by Eugen Diederichs Verlag, Köln.
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2020 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat/Projektmanagement: Kathrin Kummer
Covergestaltung Birgit Gitschier, Augsburg unter Verwendung von Motiven ©Vlasov Yevhenii / shutterstock; S. Nedev /shutterstock; helgafo/ shutterstock; Paladin12 /shutterstock
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Rimpar (www.3wplusp.de)
ISBN 978-3-7325-8790-2
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
1. Von gleichem Blut
Nicholas und Ernest Whiteoak tranken gemeinsam Tee in Ernests Zimmer. Ernest glaubte, dass eine seiner Erkältungen im Anzuge sei, und fürchtete die Zugluft der Treppen und der Halle unten bei solchem Wetter. So hatte er sich den Tee heraufbringen lassen und Nicholas gebeten, ihm dabei Gesellschaft zu leisten. Sie saßen vor dem offenen Feuer, den Teetisch zwischen sich. Ernests Katze dicht neben seinen Füßen, die Pfoten unter der Brust, die Augen ins Feuer blinzelnd. Und Nicholas’ Terrier Nip lag zusammengerollt neben ihm und zuckte im Traum. Die Brüder teilten ihre Aufmerksamkeit zwischen dem Tee und ihren Lieblingen.
»Er ist nicht ganz in Ordnung«, bemerkte Nicholas und sah auf Nip herunter. »Er hat nicht gebettelt.«
Ernest sah den kleinen Hund kritisch an. »Er hat nicht genug Bewegung. Er geht dir ja kaum von der Seite. Er wird fett. Das ist das Schlimmste bei Terriers. Sie werden immer fett. Wie alt ist er?«
»Sieben. In seinen besten Jahren. Ich finde nicht, dass er fett ist«, sagte Nicholas gereizt. »Es liegt nur daran, wie er daliegt. Vielleicht ist sein Magen etwas aufgebläht.«
»Es ist Mangel an Bewegung«, widersprach Ernest. »Sieh bloß Sascha an. Sie ist vierzehn. Sie ist so elegant wie nur je. Aber sie geht auch auf die Minute spazieren, selbst wenn es geschneit hat. Erst heute Morgen brachte sie eine Maus aus dem Stall. Warf sie sogar in die Luft und spielte damit.« Er reichte hinunter, und seine weißen Finger lagen einen Augenblick auf dem weichen Fell der Katze.
Nicholas antwortete ohne Begeisterung. »Ja. Katzen sind ebenso. Die würden sich beiseitedrücken und Mäuse fangen oder eine ekelhafte Liebesaffäre haben, selbst wenn ihr Herr im Sterben läge.«
»Sascha hat keine ekelhaften Liebesaffären«, antwortete sein Bruder hitzig.
»Na, und das letzte Junge, das sie gekriegt hat?«
»Daran war nichts Ekelhaftes.«
»Findest du? Sie kriegte es auf deiner Bettdecke.«
Ernest spürte, dass er zornig wurde, und das war schlimm für seine Verdauung. Die Erinnerung an den Morgen, wo Sascha mit einem Triumphmaunzen ihr Junges auf sein Bett geworfen hatte (und er lag noch darin), ging ihm auf die Nerven. Er zwang sich, kalt zu antworten. »Ich sehe nicht ein, was Saschas Junges damit zu tun hat, dass Nip fett wird.«
Nicholas hatte sein letztes Stück Zwieback in den Tee gebröckelt. Nun fischte er es mit seinem Teelöffel heraus und schluckte es sofort herunter. Warum tat er das nur, grübelte Ernest. Wie oft hatte ihre alte Mutter sie gerade durch diese Gewohnheit geärgert! Und nun machte es Nicholas genauso! Und er war sich dessen auch ganz bewusst. Um seinen Mund unter dem hängenden grauen Schnurrbart war ein halb humoristischer und halb beschämter Zug. Ernest hatte schon häufig bei Nicholas diese Neigung beobachtet, ihre Mutter nachzuahmen, seit sie vor anderthalb Jahren gestorben war. Und das reizte ihn jedes Mal. Es war etwas ganz anderes, wenn eine uralte Frau – tatsächlich über hundert, was man nie von ihr gedacht hätte – eingeweichtes Brot isst, als wenn ein großer kräftiger Mann, der mindestens noch ein Dutzend eigene Zähne im Mund hat, sich so unpassend benimmt. Wenn Nicholas nur Mamas prachtvolle Eigenschaften nachahmen wollte, die sie wirklich reichlich hatte – aber nein! Er musste immer nachmachen, was er selbst zu ihren Lebzeiten am meisten beklagt hatte. Und dabei hatte er genug Ähnlichkeit mit ihr – die struppigen Brauen, die lange Court-Nase –, um in Ernest ein merkwürdig quälendes Gefühl zu wecken.
Er sah seinen älteren Bruder streng an, um diesen heimlichen Schmerz zu verstecken. »Weißt du nicht, dass dir das sehr schadet?«
Nicholas knurrte: »Muss es tun – Zähne werden wackelig.«
»Unsinn.« Ernests Ton wurde scharf. »Ich sah dich gestern recht zähes Fleisch essen ohne irgendwelche Schwierigkeiten.«
»Würgte es mühsam herunter.«
Sie waren reichlich über siebzig, und der Schatten ihrer herrischen alten Mutter beherrschte sie noch. Schneeflocken trieben gegen die Fensterscheiben und blieben kleben. Sie schlossen die Welt aus und hingen wie dicke weiße Decken um das Haus. Eine Menge Schnee glitt vom Dach herunter und fiel mit weichem Plumpsen auf das Fenstersims.
Eine glühende Kohle rollte aus dem Kaminfeuer auf den Teppich. Ernest stieß sie mit dem Fuß weg, griff dann nach der Feuerzange und packte sie. Der kleine Hund sprang entsetzt aus dem Wege. Marschierte dann mit beleidigtem Gesicht auf Ernests Bett zu und sprang steifbeinig auf die Decke. Sascha jedoch stand nur auf mit einem gleichgültigen Seitenblick nach der Kohle und räkelte sich mit den Vorderpfoten an Ernests Stuhl empor. Ernest legte die Zange hin und kraute sie im Nacken.
»Die fragt gerade viel nach dir«, sagte Nicholas. »Sie lässt es sich nur gefallen, dass du ihr Sklave bist. Genauso gut ließe sie sich von mir den Nacken krauen.«
Ernest murmelte: »Sascha, Sascha!«, und kitzelte sie vertraulich hinter den Ohren.
»Pass auf! Du kriegst Haare an die Finger. Willst du dies Stück Pflaumenkuchen?«
»Sie haart nicht.« Er rieb seine Finger aneinander. »Nicht ein Haar. Nein. Nein. Nimm du den Pflaumenkuchen. Mir bekommt er nicht.« Aber trotzdem sah er verlangend nach dem Stück Kuchen.
Während Nicholas die äußere Ähnlichkeit mit der Mutter geerbt hatte und etwas von ihrem resoluten Eigenwillen, hatte Ernest nur ihre Vorliebe für gutes Essen geerbt, aber ohne ihre glänzende Verdauung.
Nicholas machte gierige Augen.
»Willst du die Hälfte essen?«
»Ja, ich nehme die Hälfte.« Ernest schnitt den Kuchen in zwei Teile. Er brach sein Teil in kleine Stücke. Aber Nicholas stopfte sich gleich ein großes Stück in den Mund und kauend murmelte er: »Die Katze reißt dein Stuhlpolster in Stücke, hör bloß, wie sie daran kratzt.«
Ernest sagte gereizt: »Ich wollte, du riefst Nip von meinem Bett herunter. Er liegt gerade auf meiner neuen Decke. Er könnte doch Flöhe haben.«
»Jedenfalls kriegt er da oben kein Junges.«
Ernest erhob die Stimme: »Ich mag das nicht, bitte, ruf ihn.«
Nips Herr brummelte: »Fang die Spinne, Nip!«
Der Terrier hob den Kopf, blinzelte skeptisch durch seine struppigen Haare und rührte sich nicht.
»Nützt nichts«, sagte Nicholas.
»Versuch’s mal mit Katzen.«
»Katzen!«, schrie Nicholas. »Stallkatzen!«
Nip ertrug Sascha. Aber Stallkatzen ertrug er nicht. In ein wütendes Haarbündel verwandelt, schoss er vom Bett hinunter auf den Fensterstuhl. Er sprang hoch und versuchte durch den Schnee zu sehen, der an den Scheiben klebte. Er sah oder er glaubte zu sehen, dass eine schwarze Gestalt auf dem Bauche über den weißen Hof schlich. Er schoss vom Fensterplatz hinunter und raste an die Tür. Er stieß ein ohrenzerreißendes Geheul aus. Nicholas kraspelte aus seinem Stuhl hoch und hinkte eilig durch das Zimmer. Nip wartete außer Atem, dass die Tür aufgemacht wurde, und attackierte den Türpfosten mit den Zähnen. Und schließlich, als die Tür sich öffnete, schoss er den Gang entlang und die Treppe hinunter.
Die Brüder hörten die Haustür zuschlagen. Jemand hatte ihn hinausgelassen. Sie horchten gespannt, ob es jemand war, der gerade durch die Halle ging, oder einer, der von draußen kam. An diesen langen Winternachmittagen, wo es so früh dunkel wurde, war ihnen das Kommen und Gehen der jüngeren Familienmitglieder von höchstem Interesse.
Sie hörten kräftige Schritte die Treppe heraufkommen. Nicholas, der noch an der Tür stand, sah erfreut der sich nähernden Gestalt entgegen. Es war der älteste der fünf Neffen, Renny Whiteoak, und er brachte eine Welle von so eisiger Luft mit sich, dass Ernest abwehrend die Hand hob.
»Bitte, Renny, komme mir nicht zu nah, eine von meinen Erkältungen ist im Anzug.«
»Soso. Das ist ja schlimm.« Er kam ins Zimmer, ließ zwei schneeige Fußspuren auf dem Teppich und stellte sich auf die andere Seite des Kamins. Er sah mitleidig zu seinem Onkel hinunter. »Wie hast du das nur gekriegt?«
»Ich habe nicht gesagt, dass ich es schon habe«, sagte Ernest gereizt. »Ich sagte nur, dass es im Anzug ist.«
»Was du brauchst, ist eine gute Dosis Rum und heißes Wasser.«
»Das sage ich ihm ja gerade«, stimmte Nicholas zu und ließ sich schwerfällig wieder in seinen Stuhl hinunter, der unter ihm knarrte. »Aber er macht immer mehr Gerede um seine Verdauung als um seine Gesundheit.«
»Meine Verdauung ist meine Gesundheit«, sagte sein Bruder. »Aber lass uns von was anderem sprechen. Du warst es, der Nip hinausgelassen hat, nicht wahr?«
»Ja. Ihr hättet sehen sollen, wie er durch die Schneewehen hinter einer von den Stallkatzen herjagte und dabei heulte wie irrsinnig.« Nicholas lächelte zufrieden. »Und Ernest meinte eben, dass er fett würde.«
Ernest fragte: »Hast du schon Tee getrunken, Renny?«
»Ja, in meinem Büro. Im Stall sollte ein neues Fohlen ankommen, und da wollte ich nicht gern weggehen.«
»Ach ja, ich weiß. Cora hat noch eins gekriegt. Wie geht es ihr?«
»Glänzend. So gut wie noch nie. Sie ist fabelhaft stolz auf sich. Als ich das letzte Mal zu ihr kam, versuchte sie, mir alles zu erzählen. Sie hörte auf, das Fohlen zu lecken, und rollte die Augen und machte Hohohoho – so ungefähr.« Renny gab eine gelungene Vorstellung, wie eine Stute ihren Herrn nach einem solch großen Ereignis begrüßt.
Die Onkel sahen ihn über die mehr als dreißig Jahre hinweg, die zwischen ihnen lagen, mit dem nachsichtigen Vergnügen und der Bewunderung an, die er immer in ihnen weckte. Er war so ganz anders, als sie in seinem Alter gewesen waren. Sie hatten wohl Freude an schönen Pferden gehabt, aber nicht diese Leidenschaft. Sie hatten damals in England gelebt und bei keinem Rennen gefehlt. Nicholas hatte ein Paar elegante Wagenpferde gehabt, die er selbst gefahren hatte, und einen schönen russischen Windhund, der neben den glänzend lackierten Wagenrädern herlief. Aber einen Winternachmittag im Stall zu verbringen, um eine fohlende Stute zu trösten, wäre ihnen nie eingefallen. Sie sahen Renny an, wie er so dastand. Hager, im derben Stallanzug, Schneematsch an den Stiefeln. Die Hände rot und aufgesprungen, wie er sie an das Feuer hielt. Das rote Haar in einem verwegenen Busch über dem hageren gebräunten Gesicht. Der Flammenschein, der über dieses kluge und leidenschaftliche Gesicht spielte, vertiefte und verschärfte seine Lebendigkeit.
»Soso«, brummte Nicholas. »Das sind ja gute Neuigkeiten.«
»Willst du wirklich nicht noch etwas Tee haben?«, fragte Ernest.
»Nein, danke. Rags brachte mir etwas Butterbrot und einen Topf Tee, der so stark war, dass einem die Haare zu Berge standen.«
Renny setzte sich und zündete eine Zigarette an. Nicholas holte seine Pfeife heraus. Klavierspiel klang dünn von unten herauf. Renny wandte den Kopf und lauschte. Dann sagte er mit einer Art Verlegenheit in der Stimme:
»Nächstens ist sein Geburtstag. Ich meine Finch.« Und er setzte hinzu und sah dabei gerade ins Feuer: »Er wird einundzwanzig.«
Nicholas drückte den Tabak mit dem Finger in seinen Pfeifenkopf. Er machte kleine saugende Geräusche mit den Lippen, obgleich er die Pfeife noch nicht angezündet hatte.
Ernest sagte eifrig: »Ja, ja. Wahrhaftig, das hatte ich vergessen! Wie die Zeit läuft! Natürlich, er wird einundzwanzig. Hm – ja. – Es kommt mir vor wie gestern, dass er ein kleiner Junge war. Gar nicht so lange her, dass er geboren wurde.«
»Mit einer Glückshaube geboren«, brummte sein Bruder. »Glück hat der Bursche!«
»Die ist bloß ein Schutz gegen Ertrinken«, sagte Ernest, nervös in Gedanken daran.
»Die bedeutet Glück überhaupt. Lieber Himmel, er hat doch Glück genug gehabt, was?«
Nicholas gab sich keine Mühe, den Ärger in seiner Stimme zu verstecken oder die nie überwundene Enttäuschung zu verbergen, die ihn immer wieder überfiel, seit er das Testament seiner Mutter gelesen hatte. Ihn brauchte keiner an das Datum von Finchs Volljährigkeit zu erinnern. Das stand vor ihm als ein Tag strahlender Erfüllung für den Jungen, für ihn eine Verdunkelung seines eigenen Lebens. »Dann kann er über sein Erbe verfügen, was?«
Ernest dachte: »Es gehört sich für mich, an seinem Geburtstag vergnügt zu sein. Wir dürfen nicht bitter oder neidisch sein. Aber Nicholas ist so egoistisch. Er tut genau so, als ob ihm das Geld von Rechts wegen zugekommen wäre, während in Wirklichkeit Mama es viel eher mir vermacht hätte. Oder auch Renny. Ich war ganz darauf gefasst, dass es Renny vermacht würde.«
Er sagte: »Natürlich müssen wir das irgendwie feiern. Eine Gesellschaft oder irgendein besonderer Spaß für Finch.« Er dachte noch immer an Finch wie an den Schuljungen.
»Na, ich sollte meinen, dass die Hunderttausend Spaß genug sind.«
Renny fuhr dazwischen, ohne auf die letzte Bemerkung zu achten.
»Das habe ich auch gedacht, Onkel Ernie. Wir müssten ihm zu Ehren ein Diner geben – die Familie und ein paar von seinen Freunden. Du weißt doch –« Er zog die roten Augenbrauen zusammen vor Anstrengung, das auszusprechen, was er innerlich dachte.
»Ich weiß«, fuhr Nicholas dazwischen, »das Piers keine Gesellschaft hatte, als er mündig wurde.«
»Er war um die Zeit oben im Norden und machte eine Kanufahrt.«
»Eden aber auch nicht.«
»Der war gerade sechs Wochen vorher von der Universität geschasst. Just Ursache, ihm eine Gesellschaft zu geben! Aber als Meggie und ich einundzwanzig waren, das war eine große Sache.«
»Meggie war die einzige Tochter, und du warst der älteste Sohn und Erbe von Jalna.«
»Onkel Nick, meinst du im Ernst, dass wir von dem Geburtstag des Jungen gar keine Notiz nehmen sollten?«
»H–m–m, n–ein. Aber – warum sollen wir denn tun, als ob wir uns darüber freuten, dass ihm jetzt das zufällt, worauf wir alle drei eigentlich mehr oder weniger gehofft haben?«
»Dann muss ich also annehmen, wenn ich Grans Geld gekriegt hätte, dass du auch –«
»Nein, bewahre. Ich wäre im Grunde sehr zufrieden gewesen, wenn du oder Ernest ...«
Ernest sagte mit einem erregten Zittern in der Stimme: »Nein, ich bin hierin ganz mit Renny einig. Ich finde, wir sollten wirklich etwas Nettes für Finch machen. Wir sind doch alle ziemlich hässlich zu ihm gewesen, als wir hörten, dass er alles geerbt hatte.«
Renny fuhr auf: »Ich nicht!«
Nicholas murmelte: »Ich kann mich nicht erinnern, dass du ihm gratuliert hättest.«
»Na, das konnte ich ja kaum, wenn die ganze übrige Familie sich auf die Hinterbeine stellte und sich die Haare raufte!«
Nach diesem kräftigen Ausbruch von Rennys Stimme, die eisenhart klang, trat kurzes Stillschweigen ein, durch das fern von unten her der Klang des Klavierspiels hinauftönte. Die drei sahen die Stunde vor sich, wo die Familie »auf den Hinterbeinen« eine denkwürdige Szene mit dem armen Klavierspieler als Mittelpunkt aufgeführt hatte.
Es klopfte an die Tür, Rags kam herein und holte das Teegeschirr weg. Er schloss die Tür nicht hinter sich, sondern ließ zwei vorbei, die gerade ins Zimmer wollten. Es war Piers und sein kleiner Sohn Maurice, der auf seiner Schulter ritt. Mooey, wie er genannt wurde, schrie denen am Kamin entgegen:
»Ich habe ein Ferdchen zum Reiten, feines Ferdchen!«
»Guter Junge«, sagte Nicholas und nahm den einen kleinen herunterhängenden Fuß in die Hand.
Ernest bemerkte: »Er spricht nicht so hübsch, wie damals in seinem Alter Wakefield sprach. Wakefield sprach immer besonders hübsch.«
»Weil er immer ein eingebildeter kleiner Bengel gewesen ist«, sagte Piers und setzte seinen kleinen Jungen auf die Armlehne von Nicholas’ Stuhl, von der aus er auf seines Großonkels Knie kletterte und wiederholte: »Ein Ferdchen zum Reiten!«
»Na, na«, meinte Piers, »nicht so viel Lärm.« Piers sah man ebenso wie Renny das Leben im Freien an. Aber seine Haut hatte die zarte Frische eines Jungen, seine vollen Lippen eine knabenhafte Linie, halb anmutig, halb eigensinnig, die sich aber in verächtliche Härte wandeln konnte, ohne den Ausdruck seiner kühnen blauen Augen zu verändern.
»Ich wollte«, sagte Ernest, »du machst die Tür zu, Piers. Bei all dem Lärm vom Klavier unten und von dem Kind und dem Zug auf der Treppe und dem Feuer, das fast ausgeht, fühle ich, dass meine Erkältung immer schlimmer wird.«
»Ich dachte, du hättest gesagt, sie wäre erst im Anzuge«, bemerkte Renny.
Ernest wurde etwas rot. »Sie w a r im Anzuge, jetzt ist sie da.« Er zog ein großes weißes seidenes Taschentuch heraus und schnaubte sich kräftig die Nase.
Das Klavier unten ging in einen stürmischen ungarischen Tanz über.
»Ich mache die Tür zu«, schrie Mooey, kletterte vom Stuhl herunter, rannte durch das Zimmer und schlug die Tür mit einem Knall zu.
Ernest hatte seinen Neffen Piers gern, er liebte seinen kleinen Großneffen, aber es wäre ihm lieber gewesen, sie hätten sich nicht gerade heute Abend ausgesucht, um sich in seinem Zimmer zu versammeln. Er dachte etwas gekränkt an die unzähligen Nachmittage, wo er allein saß, wenn er nicht ins Wohnzimmer hinunterging, und wo selbst Nicholas nicht kam, ihm Gesellschaft zu leisten. Jetzt nun, wo er sich gerade nicht wohlfühlte, kamen sie alle zusammen. Wenn einer kam, dann folgten ihm sehr bald die anderen nach. Und dann war da die fatale Frage von Finchs Geburtstagsgesellschaft. Er selbst fand, dass sie nicht viel Sinn hätte. Er dachte ebenso wie Nicholas, dass ein Vermögen von hunderttausend Dollar an sich schon Vergnügen genug wäre. Natürlich in Anbetracht der Art und Weise, wie der Bengel dazu gekommen war. Dass Mama ihm ihr Vermögen hinterlassen hatte, war eine solche Überraschung, ein solcher Schock gewesen, dass es fast grausam war, Finchs Volljährigkeit nun zu einer Festlichkeit zu machen. Aber schließlich konnte man es auch noch auf eine andere Weise ansehen. Konnte nicht solch eine aufregende Festlichkeit dazu beitragen, die Bitterkeit des Augenblicks für die ganze übrige Familie zu übertönen, ebenso wie die Aufregung eines Leichenbegängnisses die Trauer der Hinterbliebenen zurückdrängt? Er packte den Stier bei den Hörnern, wie er es gern tat, wenn es nicht anders ging, und sagte ruhig, die Augen auf Piers Gesicht gerichtet:
»Gerade überlegen wir, wie man nächstens Finchs Volljährigkeit feiern könnte. Was würdest du vorschlagen?«
Renny fing mit abwesendem Blick an, im Feuer zu stöckern. Nicholas wandte seinen mächtigen Kopf und sah seinen Bruder spöttisch an. Also auf die Weise wollte der alte Ernest sich aus der Schlinge ziehen! Na, sie würden ja sehen, was Piers dazu sagte. Piers war ein handfester Bursche, der gab sich nicht mit Sentimentalitäten ab.
Piers stand ganz still, die Hände in den Taschen, und überlegte die Wichtigkeit der Frage. Seine Gedanken drehten sich langsam um sie wie ein Pferd um ein verdächtiges Hindernis. Er sah genau an der Art, wie Renny die glühenden Kohlen im Kamin stöckerte, an Onkel Nicholas’ hängenden Schultern, an dem nervös erregten Ausdruck auf Ernests Gesicht, dass der Diskussion nicht nur ein liebevolles Interesse an der Sache zugrunde lag. Wie wäre das auch möglich? Er selbst hatte, trotzdem er es nie ausgesprochen hatte, sehr große Hoffnungen auf Großmutters Erbschaft gesetzt. Immer wieder hatte sie zu ihm gesagt: »Du bist der Einzige von allen, der wie mein Philipp aussieht. Du hast seine Augen und seinen Mund, seinen Rücken und seine Beine. Ich möchte gern, dass du mal im Leben vorankommst!« Lieber Himmel, das wäre etwas gewesen, voranzukommen, nicht wahr? Er hatte nachts wach gelegen und gegrübelt, wie weit er wohl Großvater ähnlich sei. Er hatte unter dem Ölporträt in der Uniform eines britischen Hauptmanns, das im Esszimmer hing, gestanden und versucht, noch mehr wie er auszusehen. Er hatte dagestanden, die Lippen vorgezogen, die Brauen zusammengezogen und zugleich seine Augen aufgerissen, bis sein Gesicht ganz starr wurde und es ihm war, als ob der alte Bursche da oben ihm zublinzelte, wie wenn sie ein gemeinsames Geheimnis hätten. Aber es hatte nichts geholfen. Finch mit seiner schlappen Gestalt, seinen hohlen Backen und der unordentlichen Locke auf seiner Stirn hatte sich irgendwie in Grans Liebe eingeschlichen, hatte das Geld gekriegt. Wie das zugegangen war, das war jetzt eine sozusagen tote Frage, und was hatte es für einen Zweck, sich noch damit herumzuschlagen? Die lebendige Tatsache war Finchs Geburtstag, sein Vermögen, das ihm an diesem Geburtstag wie eine reife Frucht in den Schoß fiel mitten unter der Familie.
Er sagte mit dieser frischen und warmen Stimme, um derentwillen die Farmarbeiter von ihm ein gut Teil Grobheit hinnahmen:
»Ich finde, das ist ein sehr guter Gedanke. Wir können es einrichten, wie wir wollen, Finch wird von allem begeistert sein. Bloß dass man den guten Willen zeigt, und all das –«
Renny freute sich über diese unerwartete Unterstützung durch Onkel Ernest und Piers. Er hätte auf alle Fälle ein Festessen gegeben, aber es war ihm lieber, dass die Gäste nicht widerstrebend kamen. Selbst Nicholas stieß eine Art Grunzen aus, das man für Zustimmung halten konnte. Renny dachte: Wir hängen doch viel mehr zusammen, als man denken sollte.
Piers wiegte sich etwas auf den Füßen, die Hände in den Taschen, und sagte: »Wir haben es Finch ja schließlich recht schwer gemacht nach der Testamentseröffnung. Wir haben ihm ziemlich zugesetzt. Er lief davon und wollte sich ertränken, was?«
»Nicht nötig, das wieder aufzuwärmen«, sagte Renny.
Ernest ballte die Hand und betrachtete seine weißen Knöchel. Nicholas zog Mooey an sich. Plötzlich sprangen Flammen aus dem Kamin hoch, füllten das Zimmer mit warmer Farbe und machten Sascha, die vor dem Feuer kauerte, zu einem leuchtend goldenen Ball.
»Na, eins ist aber nötig«, erwiderte Piers, »nämlich daran zu denken, dass es jetzt unsere Sache ist, ihm klarzumachen, dass wir ihm verziehen haben –«
Renny unterbrach: »Da ist nichts zu verzeihen.«
»Vielleicht nicht. Aber du weißt, was ich meine. Ich weiß, dass er diese ganzen anderthalb Jahre – oder wie lange es her ist – sich wie ein Erbschleicher vorgekommen ist –«
»Und war er denn kein Erbschleicher?«, fragte Nicholas.
»Ja. Wahrscheinlich. Aber er hat nun mal Geld, und er ist so schwach wie ein Grashalm. Wenn seine Familie nicht zu ihm hält, dann werden ja genug andere Leute da sein, die sich an ihn heranmachen. Ihr könnt mir glauben, er wird im Handumdrehen Grans Geld los sein und keinem Menschen damit nützen – nicht einmal sich selbst.«
»Der weise Salomo«, murmelte Nicholas.
Piers lächelte gelassen. »Du kannst so sarkastisch sein, wie du willst, Onkel Nick, aber du weißt genau, dass es Hand und Fuß hat, was ich sage. Finch kann gar nicht anders als ein Dummkopf sein, wenn es darauf ankommt, mit Geld umzugehen.«
Er brach ganz plötzlich ab vor dem Gesichtsausdruck der drei anderen, die die Tür hinter seinem Rücken sehen konnten. Die Tür hatte sich zögernd geöffnet, und Finchs langes Gesicht sah herein.
»Hallo Onkel Finch!«, schrie Mooey. »Hier bin ich!«
»Herein, herein und mach die Tür zu!«, sagte Ernest übertrieben herzlich.
»Wir sprachen gerade von dir«, sagte Piers freundlich.
Finch blieb, die Hand auf dem Türgriff, stehen, ein etwas schafsmäßiges Lächeln machte sein Gesicht noch weniger anziehend als gewöhnlich. »Ich glaube, dann komme ich lieber nicht herein.«
»Soll ich ihm sagen, was wir sprachen?«, fragte Piers.
Renny schüttelte den Kopf. »Ist noch Zeit genug.« Er rückte beiseite, um Finch auf der Kaminbank Platz zu machen.
Finch ließ sich neben ihn fallen, zog ein knochiges Knie hoch und umklammerte es mit seinen langen schmalen Händen. »Na«, sagte er, »schreckliches Wetter draußen, was? Ein Glück für mich, dass Sonnabend ist und ich nicht zur Universität hinfahren musste. Was macht deine Erkältung, Onkel Ernest?«
»Wird immer schlimmer.« Ernest schnäuzte hörbar die Nase in sein seidenes Taschentuch.
»Sie ist im Anzug gewesen, gekommen und immer schlimmer geworden, alles im Verlauf einer Stunde«, sagte Nicholas mit sanfter Stimme.
»Ich habe auch eine«, sagte Finch und hustete kräftig.
Renny sah um sich. Eine herzhafte Wärme kam über ihn, und plötzlich fühlte er, es war eine schöne Stunde. Er sah Onkel Nicholas an, der an seiner Pfeife sog, die tiefen Furchen seines Gesichtes in Zärtlichkeit gemildert, wie er – selbst nahe an achtzig – Mooeys zarten kleinen Körper auf den Knien hielt. Er sah Ernest an, der in den Feuerschein lächelte, die Fingerspitzen auf Saschas Nacken. Piers sah er an in seiner derben Frische, der immer noch stand, denn er machte es am liebsten wie seine Pferde, dass er entweder stand oder lag. Finch sah er dasitzen und vorgebeugt sein Knie streicheln. Und Mooey in seinem blauen Matrosenanzug mit den weißen bloßen Beinen, dem lockigen braunen Haar und den blauen Augen. Hier waren sie zusammen, sechs Männer, alle verbunden durch das gleiche Blut und durch gleiche Interessen. Er sagte zu Piers:
»Sage es ihm, wenn du willst?«
»Was soll ich sagen?«
»Das mit seinem Geburtstag.«
Wäre eine Bombe geworfen worden, Finch wäre vielleicht weniger erschrocken gewesen. Sein Geburtstag! Dieser Tag kam auf ihn zu wie ein Weltgericht. Der Tag, an dem ihm in die Hände kam, worauf er nie und nimmer ein Anrecht haben konnte. Der Tag, an dem er unter den Augen seiner Onkel und Brüder ihnen sozusagen das Brot vom Munde nahm. Obgleich ja in Wirklichkeit keiner von ihnen die ganzen dreißig Jahre, ehe sie starb, etwas vom Geld der alten Adeline gehabt hatte. Die ganze Zeit hatte sie ihren Schatz gespart und einfach auf Rennys Kosten gelebt und vorher auf dessen Vaters Kosten.
»Mein Geburtstag«, stotterte er. »Was ist damit los?«
Piers hatte Finchs Gesicht beobachtet. Er hatte darauf seine Gedanken gelesen wie die Schatten von erschreckten Vögeln. Er antwortete gelassen:
»Nichts, nur dass wir ihn feiern wollen, dir ein richtiges Fest geben. Das meinst du doch, Renny?«
Renny nickte, und Ernest sagte: »Ja, wir sprachen gerade davon, ehe du hereinkamst. Wir dachten an ein nettes kleines Festessen – ein paar von deinen Freunden – und Nicholas und ich, wenn wir dir nicht zu alt sind.«
»Champagner«, sagte Nicholas gewichtig dazwischen. »Ich werde den Champagner besorgen. Und auch welchen trinken, obgleich er ja für meine Gicht rein des Teufels ist.« Etwas in Finchs Gesicht hatte ihn gerührt. Er nickte dem Jungen zu mit einem Lächeln, in dem keine Bitterkeit war.
Sie zogen ihn nicht auf. Sie hielten ihn nicht zum Narren. Es war ihnen wirklich Ernst mit der Geburtstagsgesellschaft. Finch wurde die Kehle so eng, dass er einen Augenblick nicht sprechen konnte. Dann brachte er heraus:
»Nein – wirklich – das ist riesig nett von euch! Fein wäre das, natürlich. Aber hört mal, das macht so viel Mühe und Ausgaben. – Bitte, lasst das lieber sein. Aber natürlich, fein wäre es!«
Während er die Worte herausstotterte, kam ihm ein Zweifel. Konnte er wirklich die Aufregung eines solchen Festessens an d e m Geburtstag aushalten? Wäre es nicht besser, sich heimlich beiseitezudrücken, sodass das grelle Sonnenlicht nicht just auf ihn als den Mittelpunkt fiel?
»Nein, hört mal!«, rief er. »Ihr solltet das lieber sein lassen! Bitte, wirklich, macht das nicht!«
»Warum?« Vier kräftige Stimmen warfen ihm die Frage ins Gesicht.
»Warum, weil«, flüsterte er fast, »ich glaube wirklich, ich möchte lieber den Tag ganz still verleben.«
Jedenfalls war es ihm nicht möglich, die nächsten fünf Minuten still zu verleben. Lautes Gelächter überlärmte seine Stimme und umdrängte ihn, dass er darin unterging. Und als es endlich wieder verhältnismäßig still war, hörte er sich selbst mit feuerrotem Gesicht murmeln:
»Ja also, wenn ihr wirklich eine Geburtstagsgesellschaft für mich geben wollt, dann tut es meinetwegen. Mir liegt verwünscht wenig daran.«
2. Erinnerungen
Während die Mannsleute von Jalna unter der Lampe in Ernests Zimmer versammelt waren, saßen die beiden Frauen der Familie und der jüngste Bruder Wakefield, ein Junge von dreizehn, im Dämmerlicht des Wohnzimmers unten. Die Fenster dieses Zimmers gingen nach Südwesten, sodass ein verdämmerndes Tageslicht die Anwesenden einander noch eben sichtbar machte. Finch hatte ihnen auf dem Klavier vorgespielt, ehe er von dem Magneten nach oben gezogen wurde, zu dem eine Gruppe der Whiteoaks in gemeinsamem Gespräch stets für jeden von ihnen wurde, der nicht im Kreise saß.
»Ich sehe nicht ein, warum er weggehen musste«, bemerkte Pheasant. »Es war so nett, wie er uns in der Dämmerung vorspielte.« Sie hatte ihren Stuhl so nahe wie möglich ans Fenster gezogen, um das letzte Licht für die winzige Wolljacke zu bekommen, die sie für Mooey strickte. Sie fühlte jetzt die Maschen mehr, als dass sie sie sah, den braunen lockigen Kopf auf dem schlanken Hals tief über das Strickzeug gebeugt.
»Es ist eben immer dasselbe«, sagte Alayne ruhig. »Sie können nicht auseinander bleiben. Merkwürdige Anziehungskraft haben sie füreinander.« Dann, als ihr einfiel, dass Wakefield in einem Schaukelstuhl in der dämmerigen Zimmerecke eingekuschelt saß, fügte sie in etwas gezwungenem Ton hinzu: »Ich habe nie eine so eng verbundene Familie gekannt.«
Wakefield fragte mit der klaren selbstbewussten Stimme des frühreifen Kindes:
»Hast du denn viele Familien gekannt, Alayne? Du bist ein einziges Kind, und fast alle die Freunde, von denen du erzählst, sind auch einzige Kinder. Ich glaube, du kannst gar nicht verstehen, was große Familien wirklich sind.«
»Sei nicht so naseweis, Wake«, sagte Pheasant.
»Nein, aber wirklich«, beharrte er und hob sein Gesicht, einen kleinen weißen Kreis im Schatten des Stuhles. »Ich sehe nicht ein, woher Alayne wirklich wissen soll, was richtiges Familienleben ist.«
»Ich weiß alles, was ich zu wissen brauche«, sagte Alayne etwas scharf.
»Alles, was du zu wissen brauchst, wofür, Alayne?«
»Na, um diese Familie hier zu verstehen mit all ihren Eigenheiten und Stimmungen.«
Er saß mit gekreuzten Beinen, die Hände ineinandergelegt, und fing sachte an, sich im Stuhl zu wiegen. »Aber ich glaube nicht, dass die Eigenheiten einer Familie alles sind, was du zu verstehen brauchst, wenn du mit ihr leben musst wie jetzt, Alayne, nicht wahr?«
Pheasant stieß einen ungeduldigen Seufzer aus. Alayne unterdrückte den Anreiz, mit dem kleinen Schwager zu streiten. Sie sagte:
»Ja, vielleicht hast du recht. Aber was meinst du denn, was ich verstehen müsste, wenn ich mit euch allen zusammen lebe?«
Er wiegte sich weiter und antwortete: »Woher das kommt, dass wir so aneinander hängen, und warum wir immer zusammenstecken müssen. Das müsstest du verstehen!«
»Vielleicht bist du so gut und erklärst mir das.«
Er löste die Hände und spreizte die Finger. »Das kann ich unmöglich erklären. Ich fühle es, aber ich kann es nicht erklären. Wenn du das nicht von selber weißt.«
»Ich wundere mich«, sagte Alayne, der die dauernde Gegenwart des kleinen Jungen im Zimmer etwas lästig wurde, »dass du nicht hinaufgehst zu den anderen. Wie kannst du denn glücklich sein, ohne mit ihnen zusammen zu sein?«
»Ich bin nicht glücklich«, antwortete er traurig. »Ich schlage bloß die Zeit tot. Ich würde wie der Wind hinauflaufen, bloß bin ich jetzt gerade mit allen etwas verkracht.«
»Warum? Was ist denn passiert?«
»So allerlei. Ich hasse es, über Zänkereien zu reden. Aber jetzt ist mir doch schon versöhnlicher zumute. Ich glaube, ich gehe hinauf.« Aber er zögerte doch noch, denn er war sehr gern mit Frauen zusammen. In seiner besonderen, etwas kühlen Art hatte er seine beiden Schwägerinnen doch gern. Er hatte Respekt vor Alayne, aber es machte ihm Spaß, sie zu reizen. Gegen Pheasant war er gönnerhaft und nannte sie »mein gutes Mädchen«. Wegen seiner zarten Gesundheit musste er bei solchem rauen Wetter im Hause bleiben, und so verbrachte er seine Tage, indem er sich unter den verschiedenen Familienmitgliedern herumtrieb, um mit feinfühligen Nerven zu spüren, was vorging. Er war glücklich, aber er fühlte sich einsam. Er kam in das Alter, wo er sich unverstanden vorkam.
Die Dämmerung wurde zur Dunkelheit, und Pheasant stand auf, um die Lampe auf dem Mitteltisch anzuzünden.
»Zünde doch lieber die Kerzen an«, bat Alayne. »Lass es uns heute Abend irgendwie besonders nett machen!«
»O ja!«, rief Wakefield. »Das macht uns vielleicht bessere Laune.«
Ein lautes Gelächter tönte von Onkel Ernests Zimmer herunter.
»Hört doch bloß, wie die vergnügt sind«, sagte Wakefield vorwurfsvoll.
Alayne war auch aufgestanden. Sie trat zu ihm und strich ihm über den Kopf. »Bist du denn jetzt noch nicht versöhnlich genug, um hinaufzugehen?«, fragte sie.
»Noch nicht ganz. Außerdem habe ich Kerzen so gern.«
Das Kerzenlicht, dachte sie, stand ihm auch gut. Es spielte über die zarte Blässe seines Gesichts und die braunen Tiefen seiner Augen wie eine Liebkosung. Es stand auch Pheasant gut, wie sie da unter den silbernen Leuchterarmen saß, deren Flammen mit einer Art zitternder Wärme auf ihre schmalen jungen Hände herabschienen, die sich über der feuerroten kleinen Strickerei bewegten.
Alayne fing an, ruhelos im Zimmer herumzuwandern und all die Dinge eingehend zu betrachten, die sie schon auswendig kannte. Sie nahm eine kleine Porzellanfigur auf und hielt sie in beiden Händen, als ob die etwas von ihrer kühlen Glätte auf sie übertragen könnte. Sie sah ihr Bild in dem Spiegel über dem Kamin, betrachtete es im Vorbeigehen und fragte sich, ob sie seit diesem letzten Jahr nicht weniger gut aussähe. Manchmal kam es ihr so vor. Und wenn es so war, dann war das kein Wunder, dachte sie. Sie hatte genug durchgemacht, was der zarten Blüte eine Frau die Frische nehmen konnte. Ihre erste Heirat – diese unglückliche Ehe mit Eden. Seine Untreue. Die Qual ihrer unmöglichen Liebe zu Renny. Ihre Trennung von Eden. Ihre Rückkehr nach New York und die Anstrengungen ihrer Arbeit dort. Ihr zweiter Aufenthalt in Jalna, um Eden in seiner Krankheit zu pflegen ... Sein Abenteuer mit Minny Ware. Ihre Scheidung. Ihre Heirat mit Renny im vorigen Frühling. All dies in viereinhalb Jahren!
Wirklich kein Wunder, wenn sie sich verändert hätte! Und doch – war sie wirklich verändert? Das versuchte sie im Spiegel festzustellen. Aber bei Kerzenlicht sah man das nicht recht. Das schmeichelte immer. Wakefield zum Beispiel, der bei Tage so leicht eine schlechte Farbe hatte, schien in diesem Licht eine blütenweiße Haut zu haben, und auf Pheasants Wangen lagen wunderbar zarte Schatten ihrer Wimpern.
Sie tat einen Schritt näher zum Spiegel, scheinbar aus Interesse an Pheasants Arbeit, aber ihre Augen kehrten mit einem fast düster forschenden Blick zu ihrem eigenen Spiegelbild zurück. Sie sah den Kerzenschimmer auf dem Glanz ihres Haares, auf der weichen Rundung der Wangen und dem ausdrucksvollen Mund. Nein, sie war nicht weniger hübsch geworden, aber sie sah nun wirklich aus wie eine Frau. Es war nichts Mädchenhaftes mehr in diesem Gesicht, dessen Linien sie von den holländischen mütterlichen Vorfahren geerbt hatte. Sie fand, dass es hauptsächlich einen Ausdruck von Festigkeit hatte. Und sie entdeckte darin wohl Standhaftigkeit, Leidenschaft, aber nicht Geduld.
Sie war jetzt zehn Monate mit Renny verheiratet, und sie verstand heute ebenso wenig wie vor ihrer Heirat, was eigentlich sein Begriff vom Leben und von der Liebe war. Wie dachte er darüber? Oder ließ er sich nur vom Instinkt leiten? Und wie dachte er über sie selbst, nun er sie hatte? Er hatte keinerlei Neigung zur Selbstanalyse. Bis zum Grunde in seine eigenen Begierden und Gedanken einzutauchen und ihren Augen den Kern seines Egoismus aufzudecken, würde ihm heftig widerstreben. Und augenscheinlich hatte er auch ihr gegenüber keinerlei Neugierde über das Primitivste hinaus. Er war von seinem eigenen Leben vollkommen absorbiert. Erwartete er von ihr etwa, nun sie mit ihm eingespannt war, dass sie einfach ohne weitere Fragen durchs Leben galoppierte, die frische Luft atmete, auf behaglicher Weide graste und nur nachts in das dunkle Geheimnis ihrer gegenseitigen Leidenschaft zurückkehrte? Er hatte nichts von ihrem ruhelosen Begehren, alles klar zu sehen. Sein Begriff ihrer Verbundenheit war so einfach, dass es ihre feinfühlige Natur fast verletzte.
Sie kehrte rasch dem Spiegel den Rücken, denn sie spürte, dass Wakefield sie ansah. Sie fing noch einmal an, im Zimmer auf und ab zu wandern, die Hände auf dem Rücken, wie sie so oft ihren Vater in seinem Studierzimmer hatte wandern sehen. Sie lächelte ironisch und dachte, obwohl all diese Unruhe in ihr schließlich auf die alte weibliche Frage hinauslief: »Liebt er mich noch? Liebt er mich noch ebenso wie früher?«
Sie hörte ihn laut und eilig die Treppe herunterkommen, als ob er keinen Augenblick zu verlieren hätte. Er kam ihr vor wie der Winterwind, scharf, voll kalter Energie und immer vorbeibrausend. Er durfte nicht an der Wohnzimmertür vorbeigehen, vielleicht wieder nach draußen, ohne mit ihr zu sprechen! Sie ging rasch zur Tür, aber gerade als sie sie erreichte, öffnete er selbst sie weit. Er blieb stehen, überrascht und lächelnd, dass sie so dicht vor ihm stand.
»Ich wollte dich gerade suchen«, sagte er.
Sie sagte mit kindischem Vorwurf in der Stimme:
»Ich habe den ganzen Nachmittag hier gesessen. Ich hörte dich vor langer Zeit schon hinaufgehen.«
»So? Ich hörte das Klavier im Vorbeigehen und nahm an, dass Finch euch vorspielte. Du weißt, dass ich nicht mitten am Nachmittag sitzen und Musik hören kann.« Er legte den Arm um sie und zog die Augenbrauen hoch, als er die brennenden Kerzen sah. »Na, ihr seid ja ein Gespenstertrio! Was ist denn mit der Lampe los?«
Pheasant antwortete: »Wir haben das Kerzenlicht gern. Es ist so geheimnisvoll.«
Seine Augen blieben beiläufig auf der schlanken Linie ihres Nackens haften. »Jedenfalls ist es kleidsam. Ich wusste gar nicht, dass du einen so hübschen kleinen Hals hast, Pheasant.«
»Ich dachte gerade«, sagte Wakefield, »dass sie wie Anna Boleyn aussieht. Was für ein hübscher kleiner Hals für den Henker!« Er drehte sich und kam zu den beiden herüber, er warf das dunkle Haar aus der Stirn und lächelte zu Renny auf.
Pheasant ließ ihr Strickzeug fallen und fuhr mit den Händen nach ihrem Nacken. »O pfui, Wake, du machst mir Angst!«
Das war gerade, was ihm Spaß machte. »Du kannst auch Angst haben, mein Mädchen«, sagte er. »Du bist gerade von der Sorte, die damals den Kopf verloren hätte.«
Renny zog den Burschen an sich und küsste ihn. »Wie ist es dir heute gegangen, Junge?«, fragte er mit einem Interesse, das früher Alayne gerührt, sie aber in der letzten Zeit häufig gereizt hatte. Er selbst fühlte nichts von ihrer Reizbarkeit, aber Wakefield merkte sie. Er drängte sich dicht an seinen Bruder, legte den Arm um ihn und sah Alayne von der Seite an, als ob er sagen wollte: »Ich stehe ihm doch näher als du.« Er murmelte: »Danke, nicht sehr gut, Renny.«
Renny seufzte. »Schlimm, schlimm.« Er beugte sich nieder und küsste den kleinen Bruder. »Ich will dir etwas erzählen, was dir Spaß macht. Cora hat heute Nachmittag ein feines kleines Fohlen gekriegt, und es geht ihnen allen beiden sehr gut.« Er wandte sich zu Alayne: »Du weißt doch, von vier Fohlen hat sie zwei verloren, und die anderen waren jämmerlich. Aber dieses! Ein famoser Kerl!«
»Wie wundervoll«, sagte Alayne und versuchte interessiert zu sein. Ihre Stimme ging unter in der Begeisterung von Pheasant und Wakefield.
»Wirklich ein Füllen? Und wie ist es, wie die Stute oder wie der Hengst?«
»Das leibhaftige Ebenbild von Cora! Schon auf den Beinen! Ein Kerl von einem Fohlen!«
Sie redeten alle zugleich mit glänzenden Augen. Pheasants Strickzeug fiel auf die Erde. Renny machte sich von Alayne und Wakefield los, stand mitten im Zimmer und redete mit raschen Gesten, das rotbraune Gesicht strahlend.
Alayne beobachtete ihn, sie hörte kaum, was er sagte, ganz erfüllt von ihrer Liebe zu ihm und von dem Zauber, den seine Gegenwart immer für sie hatte. Sie wartete ungeduldig, dass er mit seinem Erzählen fertig wurde, um ihn mit hinaufzunehmen, wo sie ihn für sich hatte, fort von diesen anderen, die ewig zwischen sie kamen. Sie fasste ihn vorn am Rock, und in der ersten kurzen Pause zog sie ihn nach der Tür. »Komm hinauf«, sagte sie. »Ich habe etwas in meinem Zimmer, das ich dir zeigen muss.«
»Können wir das nicht später sehen?«, fragte er. »Wird es da oben nicht zu kalt für dich sein?«
»Das schadet nichts.«
»Ich komme mit!« Wakefield hängte sich an Rennys Arm.
»Nein«, sagte Alayne scharf. »Für dich ist es oben viel zu kalt.«
Aber er ging eigensinnig in die Halle und hinter ihnen die Treppe hinauf. Renny zögerte vor der Tür seines Zimmers.
»Wollen wir hier hineingehen?«, sagte er wie ein gehorsames, aber etwas widerwilliges Kind.
»Nein, in mein Zimmer.«
Sie stand, mit der Hand auf dem Türgriff, und ließ ihn vorangehen ins Zimmer, aber als Wakefield auch versuchte, hinterherzugehen, sah sie ihn so böse an, dass er zurückblieb und sich über das Treppengeländer lehnte, als ob er unten irgendetwas suchte, um seinen Kummer zu verbergen.
Sie schloss die Tür hinter sich und sah Renny mit einer plötzlichen bitteren Ironie an. Sie kam sich vor wie ein Gefangenenwärter.
Dieses Zimmer hatte seine Schwester vor ihrer Heirat bewohnt. Es trug keinerlei Spur mehr von der gepolsterten überladenen Behaglichkeit, die Megs Freude gewesen war. Es sah jetzt fast streng aus mit den mattlila Kretonnemöbeln und wenigen Bildern an den Wänden. Im Sommer, als sie es mit den Möbeln eingerichtet hatte, die ihrer Mutter gehört hatten, und eine einzelne Porzellanvase mit einem Blumenzweig auf dem Kamin stand, hatte es bezaubernd gewirkt. Das Fenster war offen gewesen, und durch die zurückgezogenen Vorhänge sah man in die warme Schönheit des Gartens. Aber jetzt in der Winterkälte, wo der Schnee sich gegen die Scheiben häufte, schien das Zimmer ihr selbst farblos und fremd. Renny wurde es darin eiskalt ums Herz. Sie machte sich klar, dass sie ihn nicht um diese Zeit und bei dieser Temperatur hätte hierherbringen sollen.
»Nun«, fragte er und sah suchend um sich, »was wolltest du mir zeigen?«
»Dies hier.« Sie zeigte auf eine gestickte blassviolette Bettdecke, die sie gearbeitet und die sie heute Nachmittag in ihrer zarten Schönheit über das Bett gebreitet hatte.
Er sah das Bett an und zog die Brauen zusammen. »Es sieht aus wie ein Bett auf der Bühne. Das ganze Zimmer kommt mir vor wie eine Bühnendekoration. Es ist unwirklich. Es ist gar nicht behaglich. Natürlich weiß ich, dass es fabelhaft guter Geschmack ist und all das, aber« – er verzog plötzlich den Mund in diesem Grinsen, das ihn seiner Großmutter so ähnlich machte – »es ist ein Glück, dass ich gewöhnlich im Dunkeln hierherkomme, es würde mich sonst geradezu bedrücken!«
Ihre Augen begegneten seinen mit einem strengen Blick, der sagte: »Nicht weiter!«, aber ihre Unterlippe zitterte.
Er setzte sich auf das Bett und zog sie auf das Knie. Er drückte sein Gesicht an ihre Schulter. Sie hätte sich in seine Arme sinken lassen, wenn sie nicht an die neue gestickte Bettdecke gedacht hätte. Sie sprang auf, fasste ihn an den Rockaufschlägen und zog daran.
»Hier darfst du nicht sitzen!«, rief sie aus. »Du zerdrückst sie schrecklich.«
Er stand auf und sah schuldbewusst zu, während sie die schwere Seide glatt strich. Er bewunderte immer die Anmut ihrer Handbewegungen, wenn sie rasch und geschickt hantierte. Sie hatte auch eine gute Zügelhand. Das war eins von den Dingen, die ihn zu ihr gezogen hatten.
Sie richtete sich auf und sah ihn halb liebevoll, halb vorwurfsvoll an. »Liebling, verzeih! Aber ich kann dich wirklich hier nicht sitzen lassen ... Und meinst du nicht, du solltest dich lieber umziehen? Du riechst ein ganz klein bisschen nach Stall.«
Er schnüffelte geräuschvoll an seinem Zeug. »Wirklich? Aber das tue ich doch immer. Das gehört eben zu mir. Ist dir das so widerwärtig?«
»Diesmal ist auch ein Desinfektionsgeruch dabei.«
»Ich habe mir die Hände im Büro abgeschrubbt.«
»Aber Liebster! Warum machst du denn das? Eisiges Wasser und ein grobes Handtuch, kein Wunder, dass deine Hände rau sind!« Sie nahm eine in ihre Hand und besah sie. »Und dabei sind es so schöne Hände!«
»Meinetwegen«, sagte er gottergeben, »wenn es sein muss, muss es sein. Also komm mit, während ich es tue.«
Als sie in sein Zimmer gingen, dachte sie an ihren ersten Tag zu Hause nach der Rückkehr von der Hochzeitsreise. Sie waren durch das ganze Haus gegangen, Arm in Arm, um es im neuen Glanz ihrer Verbundenheit zu sehen. Aber jedes Zimmer, in das sie hereinkamen, hatte ihnen als Gruß eine ganze Menge alter Erinnerungen entgegengeworfen. »Hier sind wir!«, hatten die Erinnerungen im Wohnzimmer geschrien; und da war Großmutter bei ihrem Schachspiel mit dem violetten Samtkleid, das im Feuerschein leuchtete, und den Ringen, die auf ihren starken alten Händen blitzten. Da waren Familienabende, Familiengezänke und zuletzt Großmutter, prächtig, in ihrem Sarg ausgestreckt, und Onkel Ernest in Tränen zu ihren Füßen. »Hier sind wir!«, hatten im Nebenzimmer Erinnerungen geflüstert. Da lag Eden bleich und elend auf dem Sofa, wie er ausgesehen hatte, als sie ihn krank von New York brachten. Und wieder war da die Szene der Testamentseröffnung, an die man nicht gern dachte. Sie selbst war ja nicht dabei gewesen, aber sie hatte davon gehört, und sie wusste, dass es lange dauern würde, ehe die Erinnerung daran in diesem Zimmer verblasste. »Hier sind wir«, hatten die Erinnerungen im Esszimmer geschrien. Nie, nie durfte sie das Esszimmer irgendwie ändern. Sie fühlte sich vor diesen massiven Möbeln, den schweren Vorhängen, den Familienporträts ebenso ohnmächtig wie eine aufgeregte Maus, die unten an einem kolossalen Käse nagte. Dieser Raum war die Grundlage der Tradition der Whiteoaks und würde es immer bleiben. Hier war heute und immer der Schatten der alten Adeline, die ärgerlich über jedes Wartenmüssen war, eifriger als alle anderen ihren Teller wieder neu füllen ließ, die feurigen braunen Augen unter den rostroten Brauen vor Befriedigung glänzend. Hier waren die unzerstörbaren Erinnerungen an schwere Mahlzeiten, denen nach jeder Streiterei umso herzhafter zugesprochen wurde. Und in dem Schlafzimmer der alten Adeline, wo ihr Papagei Boney noch immer auf dem Kopfende des gemalten Bettes hockte und von Erinnerungen an sie zehrte, hatte Renny zögernd gesagt: »Manchmal habe ich gedacht, ich würde hier gern schlafen. Du weißt doch, sie hat mir das Bett vermacht. Gott, was für fabelhafte Träume könnte man hier haben!«
Auch oben waren ihnen aus jedem Schlafzimmer Erinnerungen entgegengequollen. Als sie ihr neues Leben begannen, hatten sie viel zu viel Erinnerungen mitgeschleppt. Mit abgewandtem Blick waren sie an dem Zimmer vorbeigegangen, in dem sie mit Eden gewohnt hatte, und waren erleichtert in die offene Tür von Rennys Zimmer eingetreten. Wie sie sich umsah, hatte sie sich gefragt, ob sie sich hier zu Hause fühlen würde und was man tun könnte, um diese harte Männlichkeit des Zimmers etwas zu mildern. Zum Glück war es groß und luftig. Zwei neue Betten von Nussbaumholz mit geraden Linien müssten da stehen anstelle des hässlichen alten Eichenholzbettes, das in der Mitte eine eingelegene Kuhle hatte. Diese hässlichen Vorhänge, die sicher seine Schwester ausgesucht hatte und die er gewöhnlich zurückgezogen festknotete, damit sie ihm nicht Luft und Licht nahmen, müssten durch andere von irgendeinem sanften Ton ersetzt werden, lila vielleicht – nein, nicht lila. Lila würde hier verblassen von der Sonne. Bräunlich wäre besser oder grün ... Und die Tapete ... Und die Bilder auf der Tapete.
Er hatte ihre Gedanken plötzlich unterbrochen und etwas gezwungen gesagt:
»Ob es dir wohl sehr unangenehm wäre, Meggies Zimmer für dich zu nehmen? Es ist nebenan und würde mir die Möglichkeit lassen, nach Wake zu sehen, du weißt doch, er hat immer bei mir geschlafen.«
Sie war erschrocken gewesen, ja sogar verletzt durch dieses Ansinnen. Aber nach dem ersten Augenblick war plötzlich ein Gefühl der Befreiung in ihr aufgestiegen. Der Gedanke an ein eigenes kleines Reich, eine Zuflucht für ihren persönlichen Geschmack und ihren kleinen Besitz war ihr nicht unangenehm gewesen. Aber dass sie die Geborgenheit, den Anreiz seiner Gegenwart aufgeben sollte, ja, dass er selbst sogar vorschlug, klipp und klar vorschlug, ihre Gegenwart in seinem Zimmer aufzugeben. Nach allem, was sie in diesen drei Monaten einander gewesen waren! Nach allem, was er ihr von seinem fieberhaften Verlangen nach ihr, während sie als Edens Frau hier im Hause gewesen war, gebeichtet hatte! Hatte sein Verlangen sich in Gleichgültigkeit gegen diese süße Gemeinschaft verwandelt?
»Nun?«, hatte er mit einem Seitenblick auf sie gefragt.
Irgendein heimlicher Eigensinn in ihr zwang sie zu sagen:
»Ich glaube, für Wakefield wäre es viel besser, allein zu schlafen. Du störst ihn doch immer, wenn du spät kommst. Und dann dein ewiges Rauchen, wenn du dich ausziehst.«
»Ich störe ihn nicht annähernd so oft wie er mich.«
»Alle Kinder – besonders zart veranlagte – schlafen viel besser allein.«
»Wakefield nicht. Mit seinen Nerven und seinem Herzen!«
»Meinetwegen, Renny, aber – warum sagst du mir das jetzt erst?« Sie empfand Ärger und Demütigung, unglückliche Gefühle, die er so häufig allein durch einen Ton in seiner Stimme oder durch sein Stillschweigen in ihr aufstören konnte.
»Ich mochte nicht«, sagte er wie ein eigensinniges Kind und doch so kurz angebunden, dass sie nichts darauf antworten konnte.
Das war nun lange her, aber die Erinnerung daran kam ihr oft wieder, denn es zeigte ihr endgültig, dass ihr Kommen nichts in Jalna verändern konnte, dass Renny ihr Leben in Besitz genommen hatte, aber dass sie in seines nie weiter eindringen konnte als ein kleiner frischer Strom, der in die salzige See mündet.
Als sie jetzt zusammen in sein Zimmer hinübergingen, kamen sie an Wakefield vorüber, der noch in niedergeschlagener Haltung am Geländer lehnte. Er blieb abgewandt stehen und Renny sah ihn nicht an. Alayne spürte deutlich die Eifersucht des Jungen und sie fühlte, dass auch Renny sie spürte. Sie hatte das Gefühl, dass Wakefield ihr den freien Eintritt in Rennys Zimmer missgönnte, und dass er ihr am liebsten einen ebenso scharf abwehrenden Blick zugeworfen hätte, wie sie vorher ihm, und sie zu eben solchem trostlosen Herumhängen am Geländer gezwungen.
Sie schloss heftig die Tür. Renny setzte sich und fing an, seine Schuhe aufzuschnüren. Sie sah ihm gern zu, wenn er solche ganz einfachen Dinge machte. Sie hatte ihre Freude an ihm und hätte ihn gern ganz und gar zu eigen gehabt. Sie sagte: »Warum sind wir nicht öfter allein zusammen? Zwei Stunden habe ich heute Nachmittag im Wohnzimmer gesessen! Ich hoffte immer, du kämest.«
Eifrig begann er zu erklären, aber sie ließ ihn nicht weitersprechen. »Ja, ja, ich weiß von dem Füllen. Fein, dass es alles so gut gegangen ist. Aber da waren ja genug Menschen. Du hättest doch nicht nötig gehabt, die ganze Zeit dabei zu bleiben.«
Er sah sich unruhig nach seinen Hausschuhen um, als ob er in ihnen ihrem Angriff mehr gewachsen wäre. Ihre Stimme zitterte in Liebe und Gereiztheit: »Ob du es glaubst oder nicht, aber ich bin manchmal schrecklich einsam. Wenn ich an unsere Hochzeitsreise nach England denke – das Herumreisen – die Heimfahrt –, wie war das alles schön! Und nun hast du so viel anderes im Kopf!« Sie setzte sich mit trostlosem Gesicht auf das Bett. »Und du bist doch nicht so wie so viele andere amerikanische Ehemänner, ganz von großen Unternehmungen erfüllt, die Konzentration verlangen –.«
Der empörte Ausdruck in seinem Gesicht machte sie plötzlich stumm. Egoismus und verletzter Stolz brannten darin. Sie hatte gedacht, sein hageres Gesicht könnte nicht röter werden, aber es hatte sich noch mehr gerötet. Und tief in seinen Augen war ein Ausdruck von Traurigkeit.
»Aber – aber –«, fuhr er auf, »kannst du das denn nicht verstehen?«
»Nein, das kann ich nicht«, antwortete sie eigensinnig. »Wahrhaftig, ich glaube, sogar wenn ich ein Kind bekäme, würdest du dir nicht annähernd so viel daraus machen!«
»Du bist eifersüchtig«, rief er, »eifersüchtig auf eine Stute! So was habe ich noch nie gehört.«
Ihre Frauenwürde ging völlig unter in einem großen Verlangen, getröstet zu werden. Sie sagte mit dem weinerlichen Ton einer Fünfjährigen: »Einerlei. Es ist einfach wahr! Wenn ich in diesem Augenblick ein Kind haben sollte, du könntest dich nicht mehr darum kümmern als um sie!«
»Doch, bestimmt! Ich würde mich einfach in die Wälder retten, und wenn es mitten im Schneesturm wäre, und nicht wieder zum Vorschein kommen, als bis alles vorbei wäre!«
Er kam zu ihr herüber und setzte sich neben sie aufs Bett.
»Weißt du«, sagte er, wie er sie an sich zog, »dass du als eine verständige Frau, eine gescheite, fast übergescheite Person törichter sein kannst als irgendeine Frau, die ich je gekannt habe?«
Sie wusste, dass es wahr war, was er sagte. Sie wusste, dass ihn diese Albernheit zugleich überraschte und amüsierte. Aber sie hatte sich nun einmal in diesen Zustand hineingearbeitet und es war ihr ganz einerlei. Sie drängte sich enger an ihn und verkroch sich in seine Arme. Das Zimmer war grau und kalt.
Er machte eine Hand frei und zog eine Zigarette aus dem Etui. Er zündete sie an und warf das Zündholz auf den Fußboden. Der Rauch kräuselte sich um ihre Köpfe und stieg in ihre Nase. Sie hielten einander fest und wiegten sich sanft im Dämmerlicht. Er sagte:
»Ist das nicht fein, dass es einen Fußboden gibt, wohin man Zündhölzer werfen darf, und eine Bettdecke, die wir zerknittern können?«
Unten im Wohnzimmer wartete Pheasant auf Piers, der ihr den kleinen Maurice bringen sollte. Es war Zeit, dass das Kind ins Bett kam, aber sie hatte keine Eile, die behagliche Wärme des Feuers zu verlassen. Sie saß sehr aufrecht auf einem niedrigen Sessel davor und dachte an Alayne und Renny. Waren sie glücklich? War diese Heirat wirklich das Richtige? Sie grübelte öfter im Stillen über die Beziehungen zwischen Männern und Frauen nach. Sie hatte in ihrem kurzen Leben schon zu viel von der Angst und Grausamkeit erfahren, die in diesen Beziehungen möglich war. Sie hatte keine Mutter gehabt, die schützend zwischen ihr und ihrem Vater gestanden hätte. Sie beide waren allein zusammen gewesen – er unglücklich und unbefriedigt und seine Liebe zu ihr sehr fragwürdig und fast spöttisch. Ihre zu ihm halb abwehrend, halb herausfordernd. Er hatte sie völlig verwildern lassen ... bis sie geradewegs in die Heirat mit Piers hineinlief. Und sie beide hatten auch ihre Nöte gehabt. Und wenn sie Zeit hatte, ihre eigenen Angelegenheiten zu vergessen, dann beobachtete sie die Spannungen zwischen den anderen um sie herum ... Sie fühlte sich alt an Lebensweisheit. Sie empfand geradezu mütterlich Alayne gegenüber, die zehn Jahre älter als sie, verheiratet gewesen, geschieden und wiederverheiratet war. Und beide Male mit einem Whiteoak! Da steckte der Knoten! Die Whiteoaks! Alayne würde – konnte sie nie verstehen. Sie war ein Außenseiter, nicht so sehr ihrer Herkunft als ihrer Seele nach. Pheasant war der Familie von Jalna benachbart aufgewachsen. Sie hatte Renny gut gekannt, seit sie laufen konnte. Sie überlegte weise, ob es nicht einmal dazu kommen würde, dass sie Alayne guten Rat geben müsste. Sie ließ ihr Strickzeug im Schoß liegen und ihre Augen wurden groß, wie sie sich das vorstellte. Aber doch konnte sie sich nicht recht denken, was für eine Art Rat das sein sollte.
Piers und Mooey kamen die Treppe herunter, nicht in Sprüngen wie Renny, sondern langsam und vorsichtig. Den ganzen Weg die Treppe herunter schwatzte Mooey und wiederholte immer, dass er nicht bange wäre und dass er nicht fallen würde.
»Du musst das nicht immer wieder sagen«, hörte Pheasant Piers Stimme. »Das ist kindisch.«
»Bin kein Baby«, sagte Mooey trotzig und nach einem Augenblick des Nachdenkens fügte er hinzu: »Oh, Teufel, bin nicht bange.«
»Was höre ich mein Baby da sagen?«, fragte Pheasant.
»Bei ihm gibt es nichts anderes«, sagte Piers in der Tür, »als Gebabbel wie ein Armkind oder Fluchen wie ein Pferdeknecht.«
»Er hört zu viel, der arme Liebling!« Und Pheasant breitete die Arme nach ihm aus.
Er flog auf sie zu und versteckte sein Gesicht in ihrem Schoß. Im Feuerschein lag ein rötlicher Glanz auf seinem braunen Haar.
»Sieh doch!«, rief Pheasant, und strich darüber hin. »Ich glaube, er hat einen Schein von dem Court’schen Rot im Haar.«
»Hoffentlich nicht. Einer in der Familie ist gerade genug. Was strickst du da!«
»Eine neue Jacke für das Baby. Sieh, steht ihm die Farbe nicht gut?« Und sie hielt sie gegen sein helles Gesicht.
»Wo sind die anderen?«, fragte Piers und setzte sich ihr gegenüber ans Feuer.
»Renny und Alayne sind hinaufgegangen. Wake bummelte hinterher. Wirklich, Piers, manchmal denke ich, dass es ihr schrecklich über sein muss – nie hat sie ihn für sich selbst.«
»So, meinst du? Wozu will sie ihn denn für sich selbst haben?«
»Na, sie sind doch schließlich noch jung verheiratet. Und es gehen Tage hin, wo sie ihn kaum zu sehen bekommt, außer wenn sie durch den Schnee zum Stall läuft und ihn da findet. Und sie sagte mir, dass er sie selbst dann manchmal völlig übersieht und bloß irgendeinen alten Gaul anstarrt, als ob er ihn vorher noch nie gesehen hätte. Ich kann wohl sagen, ich habe viel Verständnis für sie.«
Piers hörte dies alles mit einem breiten Grinsen an. Er warf sich im Stuhl zurück, vergrub die Hände tief in den Taschen und sagte:
»Weißt du, was das Neueste ist? Ein Geburtstagsessen für Finch! Die ganze Familie, die Alten und das Baby tanzen um den Geburtstagskuchen, in dem mitten drin ein Scheck über hunderttausend steckt!«
3. Der Schatten der Eule
Finch fühlte, dass er heute Abend George Fennel sehen musste. Er hatte ihn länger als vierzehn Tage nicht gesehen und das Verlangen, sich mit seinem alten Freund auszusprechen, wurde immer stärker. Nicht gerade, dass George besonders empfänglich oder verständnisvoll gewesen wäre. Im Gegenteil, er starrte Finch unter seinem wirren dunklen Haarschopf an mit einem Ausdruck, in dem bloß eine vergnügte Überlegenheit sich mit der Verwunderung über Finchs Überschwänglichkeiten und Verzweiflungen mischte.
Bei George selbst gab es keinerlei Überschwänglichkeit oder gar Verzweiflung. Wie Finch liebte er Musik über alles, aber seine Freude an ihr war sehr ruhig. Wenn er kein Piano hatte, dann spielte er eben auf dem Banjo. Wenn das Banjo nicht in Ordnung war, dann gab er sich auch mit seines Bruders Mandoline zufrieden. Und wenn nichts anderes da war – gut, dann hatte er eben die Mundharmonika in der Tasche! Aus diesen verschiedenen Instrumenten zog er fast die gleiche Empfindung – etwas von inneren Frieden und fröhlicher Weltvergessenheit. Finchs Aufregungen waren ihm ebenso wie Finchs Verzweiflungen unerklärlich. Aber er liebte Finch, und er hatte eine Ahnung, dass sein Freund mit den hungrigen Augen irgendeine merkwürdige Begabung hatte, die ihn entweder berühmt machen oder ihm irgendwie Glück bringen würde.
Was Finch in George fand, das war der nie versagende Trost eines Freundes, der sich immer gleich blieb. George begegnete ihm immer mit derselben Wärme. Redete stundenlang und mit ruhiger Bereitschaft über die Dinge mit ihm, die ihn interessierten. Der einzige Gesprächsstoff, bei dem Georges Seelenruhe sich in Aufregung verwandelte, war die Möglichkeit, Geld zu haben wie Heu. Dann strahlten seine Augen und seine raschen Antworten schossen nur so heraus bei dem Gedanken an eine solche Glückseligkeit. Ihr Leben lang waren die Taschen der beiden Jungen fast leer gewesen. Es war Georges unbesiegbare Faulheit, die die Vorstellung von einem solchen Geldüberfluss so beglückend machte. Geld ohne Arbeit! Das war es, was Finch nun bekam, und diese glänzende Aussicht verklärte ihm schon Finchs hagere Gestalt.
Diese hagere Gestalt stand, als George seine Haustür aufmachte, als Silhouette gegen den mondhellen Schnee wie eine geheimnisvolle Erscheinung, das Gesicht im Dunkeln, denn das trübe Licht aus dem Flur ließ nur gerade seine Augen erkennen.
»O hallo, Finch!«, sagte George lakonisch.