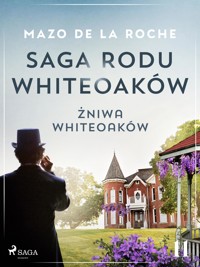3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jalna-Familiensaga
- Sprache: Deutsch
Kanada, 1924: Der junge Dichter Eden Whiteoak träumt davon, dem ländlichen Leben im Süden Ontarios zu entfliehen und verliebt sich auf einer Reise nach New York in die Amerikanerin Alayne Archer. Nach der Hochzeit zieht das Paar auf den Familiensitz der Whiteoaks, wo Edens älterer Bruder Renny nach dem Tod des Vaters den Gutshof leitet. Doch bald schon bemerkt Alayne, dass sie sich auf unwiderstehliche Weise zum Bruder ihres Mannes hingezogen fühlt, und die dramatischen Ereignisse nehmen ihren Lauf ...
Die epische Familiensaga schildert das Leben, die Liebschaften und die Intrigen der Whiteoak-Dynastie, deren Herz das Jalna-Haus ist. Dort lebt die Familie seit mehreren Generationen unter einem Dach, und die 100-jährige Großmutter Adeline hält die Familie zusammen.
"Stürmische Zeiten" ist der in sich geschlossene erste Band der Saga, der in einer früheren Ausgabe unter dem Titel "Jalna-Saga. Die Brüder und ihre Frauen" erschienen ist.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 499
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin
Über dieses Buch
Über die Reihe
Über die Autorin
Titel
Impressum
1. Wake schwänzt die Schule
2. Familie Whiteoak bei Tisch
3. Onkel Ernest und Katze Sascha
4. Onkel Nicholas und Hündchen Nip
5. Nächtliches Stelldichein
6. Pheasant brennt ihrem Vater durch
7. Eine heimliche Hochzeit
8. Willkommen auf Jalna
9. Liebe auf den ersten Blick
10. Alayne lernt das Leben kennen
11. Edens Glück
12. Noch ein Willkommen auf Jalna
13. Eine fremde Welt
14. Glaubst du an Gott, Finch?
15. Finch findet eine Freundin
16. Seinem Schicksal kann niemand entgehen
17. Sonntägliche Kirchfahrt
18. Das Leben geht seinen Gang
19. Renny, was macht das Fohlen?
20. Vergnügte Leute
21. Pheasant in Verwirrung
22. Wakefields Geburtstag
23. Juninacht
24. Pheasants Flucht
25. Einsame Menschen
26. Großmutters Geburtstag
Weitere Titel der Autorin
Das unerwartete Erbe
Ein neues Leben
Über dieses Buch
Kanada, 1924: Der junge Dichter Eden Whiteoak träumt davon, dem ländlichen Leben im Süden Ontarios zu entfliehen und verliebt sich auf einer Reise nach New York in die Amerikanerin Alayne Archer. Nach der Hochzeit zieht das Paar auf den Familiensitz der Whiteoaks, wo Edens älterer Bruder Renny nach dem Tod des Vaters den Gutshof leitet. Doch bald schon bemerkt Alayne, dass sie sich auf unwiderstehliche Weise zum Bruder ihres Mannes hingezogen fühlt, und die dramatischen Ereignisse nehmen ihren Lauf …
Über die Reihe
Über die Reihe: Die epische Familiensaga schildert das Leben, die Liebschaften und die Intrigen der Whiteoak-Dynastie, deren Herz das Jalna-Haus ist. Dort lebt die Familie seit mehreren Generationen unter einem Dach, und die 100-jährige Großmutter Adeline hält die Familie zusammen.
Über die Autorin
Die kanadische Autorin Mazo de la Roche (1879 – 1961) schildert in ihrer insgesamt 16 Romane umfassenden Familiensaga die wechselhafte Geschichte der irisch-englischen Einwandererfamilie Whiteoak, die weltweit als Jalna-Saga bekannt wurde. Dank ihres fesselnden Stiles und der lebendig dargestellten Charaktere wurde die Romanreihe außergewöhnlich populär und in über zwanzig Sprachen übersetzt.
Mazo de la Roche
Stürmische Zeiten
Die Whiteoak-Saga
Aus dem Englischen von Lulu von Strauß und Torney
Digitale Erstausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Titel der kanadischen Originalausgabe: »Jalna«
Originalverlag: Little Brown, 1927.
Titel der deutschsprachigen Erstausgabe: »Die Brüder und ihre Frauen«.
Copyright © der deutschen Übersetzung 1932 by Eugen Diederichs Verlag, Köln.
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2020 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat/Projektmanagement: Kathrin Kummer
Covergestaltung: Birgit Gitschier, Augsburg unter Verwendung von Motiven © Irina Alexandrovna / shutterstock; Kiev.Victor /shutterstock ; helgafo/ shutterstock; Paladin12 /shutterstock
E-Book-Produktion: 3w+p GmbH, Rimpar (www.3wplusp.de)
ISBN 978-3-7325-8453-6
www.luebbe.de
www.lesejury.de
1. Wake schwänzt die Schule
Wakefield Whiteoak rannte und rannte, schneller und immer schneller, bis er nicht mehr konnte. Er wusste nicht, warum er plötzlich schneller rennen musste. Er wusste nicht einmal, warum er rannte. Als er sich außer Atem, mit dem Gesicht nach unten, auf den frischen Frühlingsrasen der Wiese warf, vergaß er vollständig, dass er überhaupt gerannt war, und lag, die Backe gegen das zarte Gras gepresst, mit hämmerndem Herzen, ohne einen Gedanken im Kopf. Er war nicht glücklicher oder unglücklicher als der Aprilwind, der über seinen Körper fegte, oder das junge Gras, das unter ihm vor Leben zitterte. Er war einfach lebendig, jung und voll Verlangen nach heftiger Bewegung.
Als er zwischen die dichten Grasspitzen heruntersah, entdeckte er eine Ameise, die eilig lief und ein kleines weißes Ding trug. Er stellte seinen Finger vor sie und war neugierig, was sie wohl dachte, wenn sie den Weg durch diesen großen, gefährlichen Turm versperrt fand. Ameisen waren bekanntlich hartnäckig. Vielleicht würde sie seinen Finger hinaufklettern und über seine Hand laufen. Nein, ehe sie seinen Finger berührte, bog sie scharf zur Seite und lief in eine neue Richtung. Wieder versperrte er ihr den Weg, aber sie wollte nicht den Finger erklettern. Er wurde hartnäckig. Die Ameise blieb standhaft. Gequält, ängstlich, immer noch das kleine weiße Bündel umklammernd, ließ sie sich nicht verführen oder drängen, auf menschlichem Fleisch zu laufen. Und doch waren Ameisen so oft über ihn gelaufen, wenn er es am allerwenigsten gewollt hatte! Einmal war sogar eine in sein Ohr gelaufen und hatte ihn fast verrückt gemacht. In plötzlichem Ärger setzte er sich auf, fasste die Ameise zwischen Daumen und Zeigefinger und setzte sie fest auf seinen Handrücken. Die Ameise ließ ihr Bündel fallen und legte sich auf den Rücken, die Beine in der Luft und den Körper windend. Sie war sichtlich in höchster Angst. Er warf sie weg, halb in Ekel und halb in Scham. Er hatte der dummen alten Ameise den Tag verdorben. Vielleicht würde sie sterben.
Eifrig begann er nach ihr zu suchen. Weder der Körper noch das Bündel der Ameise war mehr zu sehen. Aber ein Rotkehlchen, das auf dem schwankenden Zweig eines wilden Kirschbaumes saß, brach in Gesang aus. Es füllte die Luft mit seinen reichen vollen Tönen, die es in den hellen Sonnenschein warf wie klingende Münzen. Wakefield hielt eine Fantasie-Flinte an seine Schulter und zielte.
»Bum!«, schrie er, aber das Rotkehlchen sang weiter, als ob es nicht geschossen worden wäre.
»Hör doch«, klagte Wakefield, »weißt du nicht, dass du tot bist? Tote Vögel singen nicht, sage ich dir.« Das Rotkehlchen flog von dem Kirschbaum fort und setzte sich auf den obersten Zweig einer Ulme, wo es lauter denn je sang, um zu zeigen, wie lebendig es war. Wakefield warf sich wieder hin, den Kopf auf dem Arm. Er atmete den feuchten süßen Duft der Erde; die Sonne lag warm auf seinem Rücken. Er überlegte jetzt, ob die große weiße Wolke, die er von Süden hatte heraufsegeln sehen, schon über ihm wäre. Er wollte still liegen und bis hundert zählen – nein, hundert war zu viel, eine zu große geistige Anstrengung an einem solchen Morgen; er wollte bis fünfzig zählen. Dann wollte er aufsehen, und wenn die Wolke über ihm wäre, wollte er – ja, er wusste nicht, was er tun wollte, aber jedenfalls irgendwas Gewaltiges. Vielleicht wollte er aus allen Kräften zum Bach rennen und hinüberspringen, selbst an der breitesten Stelle. Er schob eine Hand in seine Hosentasche und spielte mit seinen neuen Achatmarmeln, während er zählte. Eine köstliche Schläfrigkeit überkam ihn. Die angenehme Erinnerung an das herrliche warme Frühstück, das er gegessen hatte, füllte ihn mit Zufriedenheit. Ob es wohl noch in seinem Magen war? Oder ob es sich in Blut und Knochen und Muskeln verwandelt hatte? Solch ein Frühstück musste doch sehr guttun. Er ballte die Hand an dem Arm, der unter seinem Kopf lag, um die Muskeln zu prüfen. Ja, er war schon viel stärker – gar kein Zweifel. Wenn er immer solche Frühstücke aß, würde der Tag kommen, wo er sich keine Unverschämtheit von Finch oder irgendeinem seiner Brüder gefallen ließ, selbst bis zu Renny hinauf. Freilich, von Meg würde er sich immer ärgern lassen, aber Meg war eine Frau. Ein Junge konnte keine Frau schlagen, selbst wenn sie seine Schwester war.
Kein Laut eines Fußtritts hatte ihn gewarnt. Er fühlte sich plötzlich einfach hilflos in dem Griff von zwei eisernen Händen. Betäubt von einem Schütteln, wurde er derb auf seine Füße gesetzt, seinem ältesten Bruder gegenüber, der ihn streng musterte. Die beiden Spaniels an Rennys Fersen sprangen Wakefield an, leckten sein Gesicht und warfen ihn fast um in ihrer Freude, ihn gefunden zu haben.
Renny, noch den Griff um seine Schulter, fragte: »Warum strolchst du hier herum, wenn du bei Mr. Fennel sein solltest? Weißt du, wie viel Uhr es ist? Wo sind deine Bücher?«
Wakefield versuchte sich loszuwinden. Er überging die ersten zwei Fragen, da er instinktiv fühlte, dass die dritte auf einen etwas weniger gefährlichen Weg führte. »Gestern bei Mr. Fennel gelassen«, murmelte er.
»Bei Fennel gelassen? Wie wolltest du dann deine Hausarbeit machen?«
Wakefield dachte einen Augenblick nach. »Ich hatte ein altes Buch von Finch für das Latein. Das Gedicht konnte ich schon. Die Geschichtsaufgabe war genau dieselbe wie vorher. Ich hatte Zeit genug, meine Meinung über Cromwell zu überlegen. Das Bibelkapitel konnte ich natürlich in Megs Bibel zu Hause finden, und« – er wurde jetzt eifrig, seine großen dunklen Augen glänzten – »und das Rechnen machte ich gerade im Kopf, als du kamst.« Er sah ernsthaft in seines Bruders Gesicht auf.
»Das klingt sehr wahrscheinlich.« Aber Renny war doch etwas verblüfft über die Erklärung, was ja auch beabsichtigt war. »Nun hör mal, Wake, ich will nicht zu streng sein, aber du musst dir mehr Mühe geben. Glaubst du, ich bezahle Mr. Fennels Stunden für dich zum Spaß? Dass du zu schwächlich bist, um zur Schule zu gehen, ist keine Entschuldigung dafür, dass du ein faules kleines Tier bist, ohne einen Gedanken im Kopf als Spielen. Was hast du in deinen Taschen?«
»Marmeln – bloß ein paar, Renny.«
»Gib sie her.«
Renny hielt die Hand offen, während das Kind die Marmeln widerwillig aus der Tasche zog und auf die Hand aufhäufte. Es war Wakefield gar nicht nach Weinen zumute, aber sein Gefühl für dramatische Wirkung riet ihm zu weinen, als er seine Schätze abgab. Er konnte immer weinen, wenn er wollte. Er brauchte bloß seine Augen einen Moment fest zu schließen und sich selbst mehrmals zu sagen: »O wie schrecklich! Wie schrecklich!« – und die Tränen kamen im Augenblick. Wenn er sich vorgenommen hatte, nicht zu weinen, dann konnte keine schlechte Behandlung ihn dazu bringen. Jetzt, während er die Marmeln in Rennys Hand fallen ließ, stöhnte er heimlich die magische Formel: »O wie schrecklich! Wie schrecklich!« Seine Brust hob sich, seine Halsmuskeln spannten sich. Und schon liefen die Tränen seine Backen herunter.
Renny steckte die Marmeln ein. »Kein Heulen jetzt.« Aber er sagte es nicht unfreundlich. »Und sieh zu, dass du nicht zu spät zum Essen kommst.« Er schlenderte weg und rief seine Hunde.
Wakefield zog sein Taschentuch heraus, ein ganz reines, noch in ein kleines Viereck gefaltet, wie seine Schwester es ihm heute Morgen in die Tasche gesteckt hatte, und wischte seine Augen. Er sah Rennys großer entschwindender Gestalt nach, bis Renny sich über die Schulter nach ihm umsah. Und dann setzte er sich in kurzen Trab nach dem Pfarrhaus. Aber die Freiheit des Morgens freute ihn nicht mehr. Er war sorgenvoll, ein magerer blasser Junge von neun Jahren, dessen dunkelbraune Augen zu groß schienen für sein spitzes Gesicht, in grüner Sommerjacke und kurzen Hosen, mit grünen Strümpfen, die seine bloßen braunen Knie zeigten.
Er lief quer über das Feld, kletterte über einen hängenden Drahtzaun und trottete dann den Weg entlang, der neben der schmutzigen gewundenen Straße herführte. Bald erschien die Schmiede, laut und wohlbekannt zwischen zwei Ulmen. Ein Pirol flog hin und her zwischen den Ulmen, und wenn das Dröhnen des Hammers für einen Augenblick still war, floss sein süßer klarer Gesang herunter wie ein goldener Regen. Wakefield blieb in der Tür stehen.
»Guten Morgen, John«, sagte er zu John Chalk, dem Schmied, der einem riesigen Bauernpferd mit zottigen Beinen den Huf beschlug.
»Guten Morgen«, antwortete Chalk und sah lächelnd auf, denn er und Wake waren alte Freunde. »Ein schöner Tag.«
»Ein schöner Tag für die, die Zeit haben, sich dran zu freuen. Ich muss in meine eklige alte Stunde.«
»Was ich tue, das nennst du wohl nicht Arbeit, was?«, gab Chalk zurück.
»O ja, aber feine Arbeit. Interessante Arbeit. Nicht wie Geschichte und Comp.«
»Was ist Comp?«
»Aufsatz über Dinge schreiben, die einen nicht interessieren. Mein letztes Thema war ein Frühlingsspaziergang.«
»Na, das müsste doch leicht sein. Du hast ja gerade einen gemacht.«
»Oh, das ist ganz was anderes. Wenn du dich hinsetzt und willst drüber schreiben, dann kommt dir alles dumm vor. Du fängst an: Ich ging an einem schönen Frühlingsmorgen, und dann fällt dir nicht das kleinste Wort weiter ein.«
»Warum schreibst du nicht über mich?«
Wakefield lachte hell auf. »Wer wollte wohl von dir lesen! Dieses Aufsatzzeug wird gelesen, verstehst du?«
Für eine Weile war die Unterhaltung unmöglich, da der Schmied den Huf beschlug. Wakefield schnupperte den herrlichen Geruch von verbranntem Huf ein, der fast sichtbar in der Luft hing.
Chalk setzte den großen Huf, den er behandelt hatte, auf die Erde und bemerkte:
»Es gab mal einen Mann, der hatte ein Gedicht geschrieben über einen Schmied. ›Unter einem breiten Kastanienwipfel‹ fing es an. Je gelesen? Er muss es doch auch geschrieben haben zum Lesen. He?«
»Oh, das Stück kenne ich. Das ist schreckliches Zeug. Und außerdem war er nicht so ein Schmied wie du. Er betrank sich nicht, schlug seiner Frau kein blaues Auge und puffte seine Kinder nicht herum.«
»Hör mal!«, unterbrach Chalk ihn hitzig. »Lass sofort dieses freche Geschwätz sein, oder ich schmeiß’ den Hammer nach dir.«
Wakefield zog sich etwas zurück, sagte aber überlegen: »Da sieht man, das beweist gerade, was ich sage. Du bist nicht so ein Schmied, um Aufsätze oder Gedichte drüber zu schreiben. Du bist nicht schön. Mr. Fennel sagt, wir müssten über schöne Sachen schreiben.«
»Na, dass ich nicht schön bin, weiß ich«, stimmte Chalk widerwillig zu. »Aber so schlimm bin ich doch noch nicht.«
»Wie was?« Wakefield nahm sehr überzeugend Mr. Fennels Art an, schulmeisterlich zu fragen.
»Dass über mich nichts geschrieben werden kann.«
»Na, Chalk, wenn ich nun alles aufschreiben wollte, was ich über dich weiß, und es Mr. Fennel als Aufsatz geben! Würde dir das Freude machen?«
»Es wird mir Freude machen, einen Hammer nach dir zu schmeißen, wenn du nicht machst, dass du rauskommst«, schrie Chalk, der den schweren Gaul rücklings aus der Tür drängte.
Wakefield sprang schnell beiseite, als das große scheckige Hinterteil erschien. Dann lief er den Weg entlang, der plötzlich eine breite Straße wurde, weiter, und zwar mit großer Würde. Die Sorgenlast, die ihn gedrückt hatte, fiel plötzlich von ihm ab, und er fühlte sich leicht und beschwingt. Als er an einem Häuschen vorbeikam, das hinter einem hübschen Gitterzaun lag, sah er ein sechsjähriges Mädchen auf dem Tor schwingen.
»O Wakefield!«, quietschte es freudig. »Komm und schwing mich! Schwing mich!«
»Gut, kleiner Kerl!«, nickte Wakefield vergnügt. »Du sollst geschwungen werden, ad infinitum. Verbum sapienti.«
Er schwang das Tor hin und her. Das Kind lachte zuerst, dann schrie es, zuletzt schluchzte es stoßweise, wie das Schwingen wilder wurde und es den Halt verlor, während es wie eine Schnecke an dem Gitter klebte.
Die Tür des Häuschens öffnete sich, und die Mutter erschien.
»Lässt du das sein, du ungezogener Junge«, rief sie und lief ihrer Tochter zu Hilfe. »Pass auf, das sage ich deinem Bruder!«
»Welchem Bruder?«, fragte Wakefield, indem er sich zurückzog. »Ich habe vier, wissen Sie.«
»Na, natürlich dem ältesten, Mr. Whiteoak, dem dies Haus gehört.«
Wakefield sprach nun vertraulich. »Mrs. Wigle, ich würde das nicht tun, wenn ich Sie wäre. Es regt Renny schrecklich auf, wenn er mich bestrafen muss, wegen meines schwachen Herzens, ich kann ja deswegen nicht zur Schule gehen – und er muss mich natürlich bestrafen, wenn eine Dame sich über mich beklagt, wenn auch Muriel selbst mich gebeten hat, sie zu schwingen, und ich sie nie geschwungen hätte, wenn ich nicht gedacht hätte, sie wäre es gewohnt, und gesehen hätte, wie sie selber schwang, als ich die Straße herkam. Außerdem möchte Renny doch vielleicht denken, dass Muriel das Tor kaputtmachte durch das Schwingen, und daraufhin Ihre Miete erhöhen. Er ist ja ein merkwürdiger Mensch, und es kann leicht vorkommen, dass er sich gegen einen kehrt, wenn man es gar nicht erwartet.«
Mrs. Wigle sah ganz verwirrt aus. »Gut«, sagte sie und klopfte Muriel den Rücken, die noch in Stößen in ihre Schürze hineinschluchzte, »aber ich wollte bloß, er ließe mein Dach flicken, das Dach, durch das es jedes Mal wie verrückt in meine gute Stube durchleckt, wenn es regnet.«
»Ich will mit ihm drüber sprechen. Ich will dafür sorgen, dass es gleich geflickt wird. Verlassen Sie sich auf mich, Mrs. Wigle.« Er segelte davon, aufrecht und würdevoll.
Schon konnte er die Kirche auf ihrem steilen Hügel zwischen den Lebensbäumen sehen, mit dem viereckigen Steinturm, der fast drohend wie eine Festung gegen den Himmel ragte. Sein Großvater hatte sie vor 75 Jahren gebaut. Sein Großvater, sein Vater und seine Mutter schliefen daneben auf dem Kirchhof. Hinter der Kirche und noch von ihr versteckt lag das Pfarrhaus, wo er seine Stunden hatte.
Nun ging er plötzlich langsam. Er war vor dem Laden von Mrs. Braun, die nicht nur Süßigkeiten verkaufte, sondern auch Limonade, Kuchen, Pastetchen und Semmeln. Der Laden war einfach das Vorderzimmer ihres Häuschens, das mit Regalen und einem Ladentisch ausgestattet war, und ihre Waren stellte sie auf einem Tisch vor dem Fenster aus. Er fühlte sich auf einmal schwach und hinfällig. Seine Zunge klebte am Gaumen vor Durst. Er fühlte sich im Magen hohl und etwas übel. Es war klar, niemand hatte so sehr eine Erfrischung nötig wie er, und niemand hatte weniger Geld für solch eine kleine Nachhilfe. Er untersuchte den Inhalt seiner Taschen, aber obgleich viel darin war, was für ihn selbst großen Wert hatte, so war doch kein Cent in barer Münze darin, und das war das Einzige, woran Mrs. Braun wirklich lag. Er konnte ihr rotes Gesicht hinter dem Fenster sehen, und er lächelte einschmeichelnd, denn er schuldete ihr dreizehn Cents und hatte keine Ahnung, woher er jemals das Geld bekommen sollte, sie zu bezahlen. Sie kam an die Tür.
»Na, junger Herr, wie ist es mit dem Geld, das Sie mir schuldig sind?« Sie war wirklich recht geradezu.
»O Mrs. Braun, ich fühle mich heute Morgen gar nicht gut. Ich habe meine Anfälle. Wahrscheinlich haben Sie davon gehört. Ich möchte gern eine Flasche Zitronenlimonade, bitte. Und das Geld –« Er strich mit der Hand über seine Stirn und fuhr stockend fort: »Ich glaube, ich hätte nicht ohne Mütze in die Sonne gehen sollen, nicht wahr? Was sagte ich doch? Ach, wegen dem Geld. Na, sehen Sie, mein Geburtstag ist bald, und da kriege ich Geldgeschenke von der ganzen Familie. Dann ist es ganz egal, ob es achtzehn Cents sind oder dreizehn. Selbst ein Dollar wird dann gar nichts sein.«
»Wann ist dein Geburtstag?« Mrs. Braun schwankte schon.
Wieder fuhr er mit der Hand über die Stirn, dann legte er sie auf seinen Magen, wo er glaubte, dass das Herz wäre.
»Ich weiß nicht genau, weil so viele Geburtstage in der Familie sind, dass ich sie durcheinanderbringe. Zwischen Großmutters hohem Alter und meinen paar Jahren und mit all denen dazwischen ist das ein bisschen verworren, aber ich weiß, er ist sehr bald.« Indes er sprach, war er in den Laden gekommen und stand an den Ladentisch gelehnt. »Zitronenlimonade, bitte, und zwei Strohhalme«, murmelte er.
Friede überkam ihn, als Mrs. Braun die Flasche hervorholte, aufmachte und mit den Strohhalmen vor ihn hinsetzte.
»Wie geht’s der alten Dame?«, fragte sie.
»Sehr gut, danke. Wir hoffen, dass sie noch hundert wird. Sie versucht es mächtig. Weil sie doch das Fest mitmachen möchte, das wir dann geben. Eine Gesellschaft mit einem großen Feuer und Raketen. Sie sagt, es würde ihr leidtun, das zu versäumen, aber natürlich, wenn sie tot ist, würden wir es ja nicht geben, und was gar nicht passiert, das kann sie doch nicht versäumen, nicht wahr, selbst wenn es ihre eigene Geburtstagsgesellschaft ist?«
»Du hast ein fabelhaftes Mundwerk.« Mrs. Braun strahlte ihn bewundernd an.
»Ja, das habe ich«, gab er bescheiden zu. »Wenn ich das nicht hätte, dann würde ich aber auch gar nichts hermachen, weil ich doch der Jüngste von solch einer großen Familie bin. Großmutter und ich besorgen fast das ganze Reden, sie an ihrem Ende und ich an meinem. Wissen Sie, wir fühlen beide, dass wir nicht so ganz viele Jahre mehr zu leben haben, und so machen wir das Menschenmögliche aus allem, was uns in den Weg kommt.«
»Du liebe Güte, rede doch nicht so. Dir wird es schon ganz gut gehen.« Sie machte runde Augen vor Mitgefühl. »Mach dir keine Sorgen, lieber Junge.«
»Ich mache mir keine Sorgen, Mrs. Braun. Die Sorge macht sich meine Schwester. Die hat es recht schwer, mich hochzupäppeln, und natürlich bin ich noch nicht so weit.« Er lächelte traurig, und dann beugte er seinen kleinen dunklen Kopf über die Flasche und sog mit Begeisterung.
Mrs. Braun verschwand in die Küche hinter dem Laden. Eine mächtige Hitze kam von da und der verführerische Geruch von Kuchenbacken und der Ton von Frauenstimmen. Wie gut es Frauen doch hatten! Aber besonders Mrs. Braun mit dem roten Gesicht. Alle Kuchen backen, die sie wollte, und alle verkaufen, die sie nicht aufessen konnte, und noch dafür Geld verdienen! Wenn er doch einen Kuchen hätte. Bloß einen einzigen kleinen heißen Kuchen!
Während er das herrliche Getränk durch den Strohhalm aufsog, huschten seine Augen groß und glänzend über den Ladentisch. Dicht bei ihm stand ein kleiner Kasten mit Päckchen von Kaugummi. Ihm war verboten, es zu kauen, aber er sehnte sich danach, besonders nach dem ersten Augenblick des Kauens, wenn der dicke, süße, schmackhafte Saft die Kehle herunterrutschte und einen beinahe erstickte. Ehe er es wusste – na, fast ehe er es wusste –, hatte er ein Päckchen aus dem Kasten genommen und in seine Tasche fallen lassen und sog weiter, aber nun mit fest geschlossenen Augen.
Mrs. Braun kam zurück mit zwei kleinen heißen Biskuitkuchen auf dem Teller und setzte sie vor ihn hin. »Ich dachte, du äßest sie vielleicht gern frisch aus dem Backofen. Die sind ein Geschenk, die setze ich nicht auf Rechnung.«
Er war fast sprachlos vor Dankbarkeit. »O danke, danke«, war fast alles, was er zuerst sagen konnte. Und dann: »Was für eine Schande. Nun habe ich all meine Limonade ausgetrunken, und nun muss ich meine Kuchen trocken essen, außer wenn ich noch irgendeine andere Flasche kaufe.« Seine Augen flogen über die Regale. »Ich glaube, diesmal nehme ich Ingwerbier, Mrs. Braun, danke. Und die Strohhalme kann ich noch einmal brauchen.«
»Gut, gut!« Und Mrs. Braun öffnete eine neue Flasche und setzte sie vor ihn hin.
Die Kuchen hatten eine herrliche krosse Kruste und mitten in jedem begraben etwa sechs saftige Rosinen. Oh, sie waren köstlich!
Als er aus dem Laden schlenderte und dann die steilen Stufen zur Kirche hinaufstieg, grübelte er darüber nach, was die heutigen Tagesaufgaben gewesen waren. Und in welcher seiner beiden gewöhnlichen Stimmungen würde Mr. Fennel wohl sein? Streng, eifrig oder abwesend und schläfrig? Nun, wie seine Laune auch war, jetzt war er ihr preisgegeben, klein, hilflos und allein.
Er trollte durch den kühlen Schatten der Kirche, zwischen den Grabsteinen, und stand einen Augenblick neben dem Eisengitter, das die Gräber der Familie umschloss. Seine Augen blieben auf der Granitplatte mit dem Namen »Whiteoak« haften und dann traurig auf dem kleinen Stein mit dem Namen »Mary Whiteoak, Ehefrau von Philip Whiteoak«, seiner Mutter Grab. Sein Großvater lag da auch; sein Vater; seines Vaters erste Frau – die Mutter von Renny und Meg – und verschiedene kleine Whiteoaks. Er hatte dieses Stück Erde immer lieb gehabt. Er liebte das hübsche Eisengitter und die entzückenden kleinen Eisenkugeln, die daran herunterhingen. Wenn er nur heute Morgen dableiben und daneben spielen könnte! Er müsste eigentlich einen großen Strauß Butterblumen pflücken, die er gestern wie Gold den Fluss entlang verstreut gesehen hatte, und sie auf seiner Mutter Grab legen. Vielleicht könnte er der Mutter von Renny und Meg auch ein paar geben, aber den Männern natürlich keine, denen lag nichts daran; und auch den Babys keine, außer vielleicht »Gwynneth, fünf Monate alt«, weil ihm ihr Name so gefiel.
Er hatte gemerkt, dass Meg, wenn sie Blumen auf die Gräber brachte, ihrer Mutter immer die besten gab, »Margaret«, während »Mary« – seine Mutter und die von Eden und Piers und Finch – den viel kleineren, weniger hübschen Strauß bekam. Gut, dann würde er es ebenso machen. Margaret sollte auch ein paar haben, aber nicht so hübsche.
Das Pfarrhaus war ein freundliches Haus mit einem langen niedrigen Dach und hohem spitzem Giebel. Die Vordertür stand offen. Er brauchte nicht zu klopfen. So trat er ruhig ein und verwandelte den Ausdruck seines Gesichtes in sanfte Aufmerksamkeit. Die Bibliothek war leer. Da lagen seine Bücher auf dem kleinen Pult in der Ecke, wo er immer saß. Müde schlich er über den abgetretenen Teppich und sank in seinen gewohnten Stuhl, den Kopf in den Händen begrabend. Die große Uhr tickte schwer und sagte immerzu »Wake–field– Wake–field–Wake–Wake–Wake-Wake«. Und dann merkwürdigerweise »Schlaf-Schlaf-Schlaf-Schlaf ...«
Der Geruch von muffigen Möbeln und alten Büchern bedrückte ihn. Er hörte Spatenstiche vom Garten her. Mr. Fennel legte Kartoffeln. Wakefield dämmerte etwas, sein Kopf sank tiefer und tiefer auf das Pult. Zuletzt schlief er friedlich.
Er wurde durch Mr. Fennel geweckt, der sehr erdig, etwas verdutzt und schuldbewusst hereinkam.
»O lieber Junge«, stammelte er. »Ich habe dich warten lassen, fürchte ich. Ich wollte schnell nur meine Kartoffeln hereinkriegen vor dem Vollmond. Aberglauben, ich weiß, aber trotzdem –. Nun lass sehen, was war das Latein für heute?«
Die Uhr summte, schlug zwölf.
Mr. Fennel kam näher und beugte sich über den kleinen Jungen. »Wie bist du heute Morgen weitergekommen?« Er sah in das lateinische Textbuch, das Wakefield aufgeschlagen hatte.
»So gut es ging allein, danke.« Er sprach mit sanfter Würde und einem Schatten von Vorwurf.
Mr. Fennel beugte sich tiefer über die Seite. »Um–m, lass sehen. Etsi in his locis – maturae sunt hiemes –«
»Mr. Fennel«, unterbrach Wakefield.
»Ja, Wake?« Er wendete seinen struppigen Bart, an dem ein Strohhalm hing, dem Jungen zu.
»Renny meinte, ob Sie mich heute wohl pünktlich um 12 weglassen würden. Wissen Sie, gestern kam ich zu spät zu Tisch, und das regt Großmutter auf, und in ihrem Alter –«
»Gewiss, gewiss, natürlich lasse ich dich gehen. Das wäre ja zu schlimm, die liebe Mrs. Whiteoak aufzuregen. Das darf nicht wieder vorkommen. Wir müssen pünktlich sein, Wakefield, alle beide, du und ich. Also lauf, und ich will zu meinen Kartoffeln zurück.« Eilig bezeichnete er die Aufgaben für den nächsten Tag.
»Ob wohl Tom«, (Mr. Fennels Sohn) sagte Wakefield, »wenn er heute Nachmittag das Pony und den Wagen draußen hat, meine Bücher zu Hause für mich abgeben würde? Sehen Sie, ich brauche beide Lexikons und den Atlas. Sie sind ziemlich schwer, und weil es schon spät ist, muss ich den ganzen Weg laufen.«
Er trat wieder in die Mittagshelligkeit hinaus, leicht wie Luft, da für den Transport der Bücher gesorgt war, und sein Gehirn nicht durch Zusammenstöße mit Cäsar und Oliver Cromwell beschwert und sein Körper erfrischt durch zwei Biskuitkuchen und zwei Flaschen Limonade, bereit für neue erfreuliche Kraftanstrengungen.
Er ging den Weg zurück, den er gekommen war, und machte nur halt, um eine ungeduldige Sau, die sehr unzufrieden schien mit dem Hof, wo sie gefangen war, auf die Straße zu lassen. Sie trottete ein kurzes Stück neben ihm in vergnügtem Schritt, und als sie sich trennten, an einem offenen Gartentor, da versäumte sie nicht, ihm einen pfiffig dankbaren Blick zuzuwerfen.
Herrliches, herrliches Leben! Als er das Feld erreichte, wo der Fluss war, war der Windhauch ein Wind geworden, der sein Haar hochblies und ihm durch die Zähne pfiff, wenn er rannte. Ein Spielgefährte so gut wie nur einer, der mit ihm um die Wette lief, die Wolken über den Himmel fegte zu seinem Vergnügen und die Blüten der wilden Kirsche herunterschüttelte wie Schnee.
Während er lief, warf er seine Arme abwechselnd vor wie ein Schwimmer. Er sauste in plötzlichen Sprüngen wie ein scheuendes Pferd, jetzt mit wildem Gesicht und rollenden Augen, und jetzt wie ein spielendes Lämmchen.
Er machte ziemliche Umwege, und wie er durch sein gewohntes Loch in der Lebensbaumhecke kroch und auf den struppigen Rasen kam, fürchtete er schon, dass er nun doch wieder zu spät zum Essen käme. Er ging leise ins Haus und hörte das Klappern von Schüsseln und ein Gewirr von Stimmen im Esszimmer.
Das Mittagessen war schon im Gang, und die älteren Familienglieder waren versammelt, als der Jüngste – Faulpelz, Lügner, Dieb und Taugenichts, der er war! – in der Tür erschien.
2. Familie Whiteoak bei Tisch
Eine Menge Leute schienen um den Tisch zu sitzen, und alle redeten lebhaft auf einmal, doch versäumten sie während des Sprechens nicht das Essen, das in einer heißen dampfenden Mahlzeit bestand, denn die Schüsseln wurden fortwährend rundgereicht. Messer und Gabeln klapperten heftig, und gelegentlich verlor ein Sprecher den Zusammenhang, bis er mit einem Schluck heißen Tee den Bissen heruntergespült hatte, der ihn am Weiterreden hinderte. Niemand achtete auf Wakefield, als er an seinen gewohnten Platz zur Rechten seiner Halbschwester Meg schlüpfte. Von Anfang an, seit er mit am Tische aß, hatte er dort gesessen, zuerst in einem hohen Kinderstuhl, dann, als er größer wurde, auf einem dicken Band »Britische Dichter«, einer Anthologie, die kein Familienglied jemals las und die seit der Zeit, da sie zuerst unter ihm lag, als »Wakefields Buch« bekannt war.
Tatsächlich brauchte er jetzt die paar Zoll Erhöhung nicht mehr, um mit Messer und Gabel ordentlich umzugehen. Aber er hatte sich daran gewöhnt. Und an etwas gewöhnt sein hieß für einen Whiteoak, sich eigensinnig und hartnäckig daran zu klammern. Er hatte das Gefühl des harten Buches unter sich gern, obgleich gelegentlich nach schmerzlicher Bekanntschaft mit Rennys Rasierriemen oder Megs Pantoffel er wohl den Wunsch hatte, dass die »Britischen Dichter« gepolstert wären.
»Ich will mein Essen!« Er erhob seine Stimme in einem sehr anderen Ton als dem einschmeichelnden, den er gegen Mrs. Braun, Mrs. Wigle und den Rektor gebraucht hatte. »Mein Essen, bitte!«
»Still.« Meg nahm ihm die Gabel weg, mit der er in die Luft stach. »Renny, willst du dem Kind etwas Fleisch geben. Aber er isst kein Fett, denk daran, nur mageres.«
»Man sollte ihn zwingen, das Fett zu essen. Es ist gut für ihn.« Renny säbelte etwas Fleisch ab und tat ein Stückchen Fett dazu.
Großmutter sagte mit einer Stimme, die undeutlich aus dem vollen Mund kam: »Lass ihn Fett essen. Gut für ihn. Kinder sind heute alle verzogen. Gib ihm nichts als Fett. Ich esse Fett, und ich bin fast hundert.«
Wakefield starrte sie gekränkt über den Tisch an. »Esse das Fett nicht! Will gar nicht hundert werden!«
Großmutter lachte tief, ganz und gar nicht ärgerlich. »Keine Angst, Junge. Wirst es auch nicht. Keiner von euch wird hundert wie ich. Neunundneunzig, und nie eine Mahlzeit versäumt. Etwas Tunke, Renny, auf dies Stück Brot. Tunke, bitte.«
Sie hielt zittrig ihren Teller hoch. Onkel Nicolas, ihr ältester Sohn, der neben ihr saß, nahm ihn ihr ab und gab ihn Renny, der die Schüssel schräg hielt, bis der braune Saft sich an einem Ende in einer kleinen Pfütze sammelte. Er träufelte ein paar Teelöffel davon auf das Stück Brot. »Mehr, mehr«, befahl Großmutter. Und er tropfte einen dritten Teelöffel darauf. »Genug, genug«, flüsterte Nicolas.
Wakefield beobachtete sie wie gebannt, während sie aß. Sie hatte zwei Reihen künstlicher Zähne, wahrscheinlich die besten und täuschendsten, die je gemacht waren. Was nur irgend dazwischengeriet, das zermalmten sie unerbittlich in Brennstoff für ihre unverwüstliche Lebenskraft. Ihnen verdankte sie viele ihrer neunundneunzig Jahre. Sein eigener Teller, auf den Meg noch appetitliche kleine Häufchen von Kartoffelbrei und Rüben getan hatte, stand unberührt vor ihm, während er Großmutter anstarrte.
»Lass das Angaffen«, flüsterte Meg verweisend, »und iss dein Mittagessen.«
»Ja, aber dann nimm das Stück Fett weg«, flüsterte er zurück, ganz nahe an ihrem Ohr.
Sie nahm es auf ihren eigenen Teller.
Das Gespräch summte weiter wie vorher. Worüber redeten sie nur, überlegte sich Wake. Aber er war zu versunken in sein Essen, um sich groß darum zu kümmern. Sätze flogen über seinen Kopf. Worte sprangen auf. Wahrscheinlich war es eine der gewohnten alten Diskussionen, aus denen endloses Gerede sich ergab: was dieses Jahr gesät werden sollte; was aus Finch werden sollte, der in die Stadt zur Schule ging; welcher von Großmutters drei Söhnen das schlimmste Kuddelmuddel aus seinem Leben gemacht hatte – Nicolas, der ihr zur Linken saß und der den Erbteil in der Jugend durch lockeres Leben verschwendet hatte; Ernst, ihr zur Rechten, der sich durch zweifelhafte Spekulationen und durch Bürgschaften für seine Brüder und Freunde ruiniert hatte; oder Philip, der auf dem Kirchhof lag, der eine zweite Ehe geschlossen hatte (und die unter dem Stand!), aus der Eden, Piers, Finch und Wakefield hervorgegangen waren, als unnötige Vermehrung der schon allzu großen Familienlasten.
Das Esszimmer war ein großer Raum voll schweren Mobiliars, das eine schwächere Familie in den Schatten gestellt und bedrückt hätte. Die Anrichte, die Schränke türmten sich bis an die Decke. Schwere Gesimse drückten von oben. Läden und lange Vorhänge von gelbem Samt, von strickartigen Kordeln zurückgehalten, mit Quasten an den Enden, die wie die hölzernen menschlichen Gestalten in Noahs Arche geformt waren, schienen endgültig den Rest der Welt von der Welt der Whiteoaks auszuschließen, in der sie sich zankten, aßen, tranken und ihren eigenen Angelegenheiten nachgingen.
Die nicht von den Möbelstücken besetzten Wandflächen waren bedeckt von schwer gerahmten Familienporträts in Öl, nur an einer Stelle unterbrochen von einem bunten Weihnachtsbild einer englischen Zeitschrift, das die Mutter von Renny und Meg, als sie eine fröhliche junge Frau war, in roten Samt gerahmt hatte.
Das hauptsächlichste unter den Porträts war das des Kapitäns Philip Whiteoak in seiner englischen Offiziersuniform. Er war der Großvater, der, wenn er noch lebte, mehr als hundert Jahre alt sein würde, denn er war älter als Großmutter. Das Porträt zeigte einen stattlichen Herrn mit heller Gesichtsfarbe, welligem braunem Haar, kühnen blauen Augen und einem feinen eigensinnigen Mund.
Er war in Garnison in Jalna in Indien gewesen, wo er die hübsche Adeline Court kennenlernte, die zum Besuch einer verheirateten Schwester aus Irland gekommen war. Miss Court war nicht nur hübsch und aus guter Familie gewesen – sogar aus einer besseren als der Kapitän selbst, was sie ihm nie zu vergessen gestattete –, sondern sie hatte auch ein nettes kleines eigenes Vermögen, das ihr eine unverheiratete Großtante, die Tochter eines Grafen, hinterlassen hatte. Die beiden hatten sich sehr ineinander verliebt, sie in seinen feinen eigensinnigen Mund und er in ihre schlanke anmutige Gestalt, die noch anmutiger wurde durch umfangreiche Reifröcke, in ihren »Wasserfall« von üppigem dunkelrotem Haar und vor allem in ihre leidenschaftlichen goldbraunen Augen.
Sie hatten in Bombay 1848 geheiratet, in einer Zeit großer Unruhen und Kämpfe, die fast die ganze Welt erfüllten. Sie dachten an keine Unruhen und fürchteten keine Kämpfe, obgleich deren mehr als genug nachkamen, als die Feinheit seines Mundes sich allmählich in Eigensinn umwandelte und die holde Leidenschaft ihrer Augen durch Heftigkeit ausgebrannt war. Sie waren das schönste und glänzendste Paar in der Garnison. Eine gesellschaftliche Veranstaltung ohne sie bedeutete Langeweile und Enttäuschung. Sie hatten Verstand, Eleganz und mehr Geld als sonst irgendjemand ihres Alters und ihrer Stellung in Jalna. Alles ging gut, bis ein kleines Mädchen ankam, dem vergnügungssüchtigen Paar unerwünscht, ein zartes Kind, das mit seiner wimmernden Ankunft der jungen Mutter eine ganze Kette körperlicher Leiden mitbrachte, die sie trotz allen Bemühungen der Ärzte und einem langen und langweiligen Aufenthalt in den Bergen allmählich zu einem siechen Dasein zu verurteilen schienen. Etwa um dieselbe Zeit hatte Kapitän Whiteoak einen heftigen Streit mit seinem Oberst, und ihm war zu Sinn, als ob seine ganze Welt, sowohl die häusliche wie die militärische, irgendwie plötzlich verhext wäre.
Das Schicksal schien die Absicht zu haben, die Whiteoaks nach Kanada zu bringen, denn just in dem Augenblick, als der Arzt erklärte, dass die Frau, wenn sie überhaupt wieder gesund werden sollte, eine Weile in einem kühlen und erfrischenden Klima leben müsse, erhielt der Gatte die Nachricht, dass ein in Quebec lebender Onkel gestorben sei und ihm ein ansehnliches Vermögen hinterlassen habe.
Philip und Adeline hatten beide festgestellt – die einzige Augenblicksentscheidung außer ihrer Heirat, zu der sie ohne jeden Sturm und Streitigkeiten gekommen waren –, dass sie Indien völlig satthatten, ebenso das militärische Leben und die Versuche, beschränkten und reizbaren Vorgesetzten zu gefallen und engherzige, klatschsüchtige, mittelmäßige Menschen einzuladen. Sie waren für ein freieres und weniger konventionelles Leben geschaffen. Plötzlich drängte es sie stürmisch nach Quebec. Philip hatte Briefe von seinem Onkel erhalten, die die Schönheiten von Quebec rühmten, seine Annehmlichkeiten als Wohnort wegen seiner Freiheit den engen Vorurteilen der Alten Welt gegenüber, verbunden mit einer anmutigen, von den Franzosen überlieferten Lebensart.
Kapitän Whiteoak hatte keine hohe Meinung von den Franzosen – er war im Jahre von Waterloo geboren, und sein Vater war dort gefallen –, aber die Beschreibungen von Quebec gefielen ihm, und als er nun plötzlich Erbe der Besitzung dort war, mit einem guten Legat an Geld dazu, konnte er sich nichts Besseres vorstellen, als dort zu leben – wenigstens eine Zeit lang. Er machte sich ein bezauberndes Bild von sich selbst und seiner Adeline, Arm in Arm auf der Terrasse am Fluss nach der Sonntagmorgenkirche promenierend, er nicht mehr in einer unbequemen Uniform, sondern in knappen gut sitzenden Hosen, einem zweireihigen Rock und glänzendem Zylinder, alles von London, während Adeline sich buchstäblich zwischen Spitzen, Rüschen und Schleiern in heitersten Farben wiegte. Er hatte noch andere Visionen von sich selbst, in Gesellschaft von entzückenden französischen Mädchen, wenn Adeline möglicherweise durch eine zweite Niederkunft gefesselt sein würde, obgleich diese Visionen – um ihm kein Unrecht zu tun – nie über den Druck samtener kleiner Hände und einen bezauberten Blick in dunkel bewimperte Augen hinausgingen.
Er nahm also seinen Abschied, und die beiden segelten nach England, mit dem zarten Baby und einer eingeborenen Ayah. Die wenigen Verwandten, die sie in England noch hatten, boten ihnen gerade kein übermäßig warmes Willkommen, sodass ihr Aufenthalt dort kurz war, denn sie waren beide stolz und hochmütig. Jedoch fanden sie Zeit, ihre Porträts von einem wirklich erstklassigen Künstler malen zu lassen, er in der Uniform, die er eben abgelegt hatte, und sie in einem ausgeschnittenen gelben Abendkleid mit Camelien im Haar.
Mit diesen zwei Porträts und einer schönen Ausstattung an eingelegtem Mahagonimobiliar – denn ihre Stellung mussten sie in den Kolonien aufrechterhalten – machten sie die Überfahrt in einem großen Segelschiff. Zwei Monate der Kämpfe mit Sturm, Nebel und sogar mit Eisbergen gingen wie ein Albdruck über sie hin, bis die Wälle von Quebec in Sicht kamen.
Unterwegs starb die Ayah und wurde auf hoher See begraben, wo ihre dunkle Gestalt ergeben in den kalten westlichen Gewässern versank. Von da an gab es niemanden, der für das kleine Mädchen sorgte, als die jungen unerfahrenen Eltern. Adeline selbst war fast sterbenskrank. Kapitän Whiteoak hätte leichter einen rebellischen Bergstamm zur Ruhe gebracht als ein schreiendes Kind. Fluchend und schwitzend, während das Schiff rollte wie ein gequältes lebendiges Wesen und seine Frau Laute ausstieß, wie er es nie bei ihr auch nur geträumt hätte, versuchte er, die wunden gekrümmten Beinchen der Kleinen in ein flanellenes Tragkleidchen zu hüllen. Zuletzt stach er sie mit einer Sicherheitsnadel, und als er Blut aus der winzigen Wunde tropfen sah, konnte er es nicht länger aushalten; er trug das Kind in die gemeinschaftliche Kajüte, wo er es in den Schoß einer armen Frau legte, die schon fünf eigene zu versorgen hatte, und ihr befahl, so gut wie möglich sich um seine Tochter zu kümmern. Sie sorgte sehr gut für sie und vernachlässigte darüber sogar ihre eigenen derben Würmer, und der Kapitän bezahlte sie gut dafür. Das Wetter hellte sich auf, und sie segelten an einem schönen frischen Maimorgen in Quebec ein.
Aber sie lebten nur ein Jahr in dieser Stadt. Das Haus in der Rue St. Louis lag an der Straße – ein düsteres kaltes französisches Haus, trübe von Geistern der Vergangenheit. Nie verlor man den Klang von Kirchenglocken aus den Ohren, und als Philip entdeckte, dass Adeline manchmal heimlich in diese römischen Kirchen ging, begann er zu fürchten, dass sie unter diesem Einfluss vielleicht Papistin werden könnte. Aber wie sie sich in London lange genug aufgehalten hatten, um ihre Porträts malen zu lassen, so blieben sie in Quebec lange genug, um Eltern eines Sohnes zu werden. Anders als die kleine Augusta war dieser kräftig und gesund. Sie nannten ihn Nicolas nach dem Onkel, der Philip die Erbschaft hinterlassen hatte – er selbst nun »Onkel Nicolas«, der seiner Mutter zur Rechten saß, als Wakefield in das Esszimmer hereinkam.
Mit zwei kleinen Kindern in einem kalten zugigen Haus, bei Adelines Kränklichkeit, die immer eine Quelle der Sorge war, mit viel zu viel Franzosen in Quebec, als dass sich ein Engländer dort wohlfühlen könnte, und einer Wintertemperatur, die sich knapp um 20 Grad unter null herum hielt – fühlten die Whiteoaks endlich die Notwendigkeit, einen passenderen Wohnort zu suchen.
Kapitän Whiteoak hatte einen Freund, einen anglo-indischen Oberst a. D., der sich schon an dem fruchtbaren südlichen Ufer des Ontario niedergelassen hatte. Hier, schrieb er, sind die Winter mild. Wir haben wenig Schnee, und in dem langen fruchtbaren Sommer gibt das Land Korn und Früchte im Überfluss. Eine angenehme kleine Niederlassung von angesehenen Familien bildet sich schon. Du und deine begabte Frau, mein lieber Whiteoak, würdet hier ein Willkommen finden, wie es Leute eurer Art verdienen.
Die Besitzung in Quebec wurde verkauft. Die Mahagonimöbel, die Porträts, die zwei Kinder und ihre Amme wurden irgendwie nach der neuen Gegend verfrachtet. Oberst Vaughan, der Freund, nahm sie für fast ein Jahr in sein Haus auf, während ihr eigenes im Bau war.
Philip Whiteoak kaufte von der Regierung tausend Morgen fruchtbares Land, von einer tiefen Schlucht durchschnitten, durch die ein forellenreicher Bach strömte. Einiges von dem Land war schon urbar gemacht, aber der größte Teil lag noch in der jungfräulichen Majestät des Urwaldes. Große, unglaublich mächtige Tannen, Fichten, Rottannen, Balsamfichten, dazwischen Eichen, Eisenholzbäume und Ulmen waren die Zuflucht unzähliger Singvögel, wilder Tauben, Rebhühner und Wachteln. Kaninchen, Füchse und Igel gab es in Massen. Der Rand der Schlucht war von schönen silbernen Birken gekrönt, die Abhänge mit Zedern und Sumach besetzt, und den Bach entlang zog sich ein wildes duftendes Dickicht, das der Unterschlupf von Wasserratten, Wieseln, Waschbären und blauen Reihern war.
Arbeit war billig. Eine kleine Armee von Leuten wurde angestellt, in dem Wald eine Art englischen Park zu schaffen und ein Haus zu bauen, das alle anderen im Land in den Schatten stellen sollte. Fertig, eingerichtet und möbliert, war es das Wunder der Gegend. Es war ein viereckiges Haus von dunkelroten Ziegeln, mit einem breiten Steinportal, einem tiefen Erdgeschoss, wo die Küche und die Dienstbotenräume lagen, einem ungeheuren Wohnzimmer, einer Bibliothek (einer sogenannten, aber eigentlich mehr ein Besuchszimmer, da es nur wenig Bücher dort gab), einem Esszimmer und einem Schlafzimmer im unteren Stock, sechs großen Schlafzimmern im oberen Stock und einem langen niedrigen Dachgeschoss darüber, das in zwei Schlafzimmer geteilt war. Die Täfelungen waren alle von Nussbaumholz. Der Rauch von fünf Kaminen stieg aus malerischen Schornsteinen, die sich über die Baumwipfel erhoben.
In einem Anfall romantischen Gefühls nannten Philip und Adeline ihren Besitz Jalna nach der Garnison, wo sie einander zuerst begegnet waren. Jedermann fand das einen hübschen Namen, und Jalna wurde ein vergnüglicher Aufenthalt. Eine Atmosphäre von unerschütterlichem Wohlbehagen umgab es. Unter ihren hohen Schornsteinen, mitten in dem bescheidenen Park, mit seiner kurzen halbrunden Auffahrt, mit all ihren tausend Morgen Land wie ein grüner Mantel rings gebreitet, waren die Whiteoaks so glücklich, wie Menschenkinder nur sein können. Sie fühlten sich endgültig vom Mutterland losgelöst, obgleich sie ihre Kinder nach England zur Erziehung schickten. Zwei Söhne wurden ihnen in Jalna geboren. Einen nannten sie Ernst, weil Adeline gerade vor seiner Geburt von dem Roman Ernest Maltravers begeistert war. Der andere wurde nach seinem Vater Philip genannt. Nicolas, der älteste Sohn, verheiratete sich in England, aber nach einer kurzen und stürmischen Ehe verließ ihn sein Weib um eines jungen irischen Offiziers willen, und er kehrte nach Kanada zurück, um sie nie wiederzusehen. Ernst blieb unverheiratet und widmete sich mit fast mönchischer Versenkung dem Studium von Shakespeare und der Sorge für sich selbst. Er war immer der Zarteste gewesen. Philip, der Jüngste, heiratete zweimal. Zuerst die Tochter eines schottischen Arztes, der sich nahe bei Jalna niedergelassen und seinem künftigen Schwiegersohn ins Leben verholfen hatte. Sie hatte ihm Meg und Renny geschenkt. Seine zweite Frau war die hübsche junge Erzieherin seiner beiden Kinder, die früh mutterlos geworden waren. Die zweite Frau, von der ganzen Familie kalt behandelt, hatte vier Söhne und starb bei Wakefields Geburt. Eden, der älteste von diesen, war eben dreiundzwanzig Jahre; Piers war zwanzig; Finch sechzehn und der kleine Wake neun.
Der junge Philip war immer seines Vaters Liebling gewesen, und als der Kapitän starb, war es Philip, dem er Jalna und seine Morgen Land hinterließ – leider nicht mehr eintausend Morgen, denn es hatte Land verkauft werden müssen, um die Verschwendung von Nicolas und die törichte Gläubigkeit von Ernst mit seiner Neigung, für andere Leute zu bürgen, zu decken. »Sie haben ihren Teil gehabt, mehr als ihren Teil, bei Gott«, schwor Kapitän Whiteoak.
Für seine einzige Tochter, Augusta, hatte er nie viel Zuneigung gehabt. Vielleicht hatte er ihr nie die Mühe vergeben, die sie ihm auf der Überfahrt von England nach Kanada gemacht hatte. Aber wenn er sie auch nie geliebt hatte, so hatte er wenigstens nie Ursache gehabt, sich um sie Sorge zu machen. Sie hatte jung geheiratet – einen unbedeutenden jungen Engländer, Edwin Buckley, der sie alle damit überrascht hatte, dass er durch den plötzlichen Tod eines Onkels und Vetters eine Baronie erbte.
Wenn Augustas Vater ihr nie die Schwierigkeiten ihrer Toilette auf jener denkwürdigen Überfahrt hatte vergessen können, wie viel schwieriger noch war es für ihre Mutter, ihr die soziale Stellung über ihrer eigenen zu vergeben! Natürlich waren die Courts eine viel wichtigere Familie als die Buckleys; sie standen über dem Streben nach Titeln; und Sir Edwin war erst der vierte Baron; trotzdem war es hart, Augusta »Frau Baronin« nennen zu hören. Adeline war ungeheuchelt erfreut, als Sir Edwin starb und ein Neffe ihm folgte, sodass Augusta sozusagen beiseitegeschoben war.
All dies war vor langen Jahren geschehen. Kapitän Whiteoak war längst tot. Der junge Philip und seine beiden Frauen waren tot. Renny war der Herr von Jalna, und Renny selbst war achtunddreißig.
Die Zeit schien stillzustehen in Jalna. Rennys beide Onkel Nicolas und Ernst sahen in ihm nur einen unvernünftigen Jungen. Und die alte Mrs. Whiteoak dachte auch an ihre beiden Söhne als an bloße Jungens und an ihren gestorbenen Sohn Philip als an einen armen toten Jungen.
Sie hatte nun fast siebzig Jahre an diesem selben Tisch gesessen. An diesem Tisch hatte sie Nicolas auf den Knien gehalten und ihm kleine Schlucke aus ihrer Tasse gegeben. Nun saß er schlotterig neben ihr, ein schwerer Mann von zweiundsiebzig. An diesem Tisch hatte Ernst vor Schreck geschrien, als er zuerst einen Knallbonbon knallen hörte. Nun saß er an ihrer anderen Seite, weißhaarig – was sie selbst noch nicht war. Die innerste Kammer ihres Geistes verdämmerte. Ihre fernsten Winkel waren hell von strahlenden Lichtern der Erinnerung. Sie sah sie deutlicher als kleine Knaben, als wie sie ihr jetzt erschienen.
Zahllose Sonnen hatten golden durch die Jalousien auf Whiteoaks geschienen, die herzhaft aßen wie heute und ebenso laut redeten, zankten und Unmengen von starkem Tee tranken.
Die Familie saß in Rangordnung um den Tisch mit seinem schweren Silber und den großen Schüsseln, mit großen Kannen und schweren Bestecken. Wakefield hatte sein eigenes kleines Messer und seine Gabel und einen gehämmerten Silberbecher, der sich von Bruder zu Bruder vererbt hatte und manchmal in kindischen Zornanfällen durch das Zimmer geschleudert worden war. An einem Ende saß Renny, das Haupt des Hauses, lang, hager, mit einem kleinen, von dichtem rotem Haar bedeckten Kopf, einem schmalen Gesicht, mit einer fuchsartigen Schärfe darin und lebhaften braunen Augen. Ihm gegenüber Meg, die einzige Schwester. Sie war vierzig, sah aber älter aus durch ihren schweren Bau, der den Eindruck machte, als könne nichts sie von der Stelle bewegen, wenn sie einmal saß. Sie hatte ein farbloses, sehr rundes Gesicht, große blaue Augen und braunes Haar mit einem grauen Strang an jeder Schläfe. Der Hauptzug ihres Gesichtes war ihr Mund, den sie von Kapitän Whiteoak geerbt hatte. Im Vergleich zu dem Mund des Porträts schien jedoch der ihre all dessen Feinheit zu besitzen, aber ohne seinen Eigensinn. Bei ihr war es ein Mund von unaussprechlicher weiblicher Süßigkeit. Wenn sie ihre Wange in die Hand legte, ihren kurzen dicken Arm auf den Tisch gestützt, dann schien sie immer über etwas nachzudenken, was sie beglückte. Wenn sie den Kopf hob und einen ihrer Brüder ansah, waren ihre Augen kühl und gebietend, aber die Linie ihres Mundes war eine Liebkosung. Sie aß wenig bei Tisch, achtete immer auf die Wünsche der anderen, hielt die jüngeren Brüder in Ordnung, schnitt Großmutter das Fleisch und trank endlose Tassen chinesischen Tees. Zwischen den Mahlzeiten hielt sie aber immer kleine Einzelfrühstücke, die auf einem Tablett in ihr Zimmer getragen wurden – dicke Schnitten frisches Brot mit Butter und Marmelade, heiße Semmeln mit Honig oder sogar französische Kirschen und Kuchen. – Sie liebte all ihre Brüder, aber ihre eifersüchtige Liebe für Renny erschütterte ihre Ruhe bisweilen bis zu einer Art Ekstase.
Die Halbbrüder saßen nebeneinander in einer Reihe an einer Seite des Tisches dem Fenster gegenüber. Wakefield; dann Finch – dessen Platz bei Tisch aber immer leer war, weil er in der Stadt in einer Tagesschule war; darauf Piers, der auch Kapitän Whiteoak ähnlich sah, aber weniger von dessen Feinheit und mehr von Eigensinn in seinem Knabenmund zeigte; zuletzt Eden, schlank, hellblond, mit dem bezaubernden Blick der hübschen Erzieherin, seiner Mutter. Gegenüber am Tisch die Großmutter und die beiden Onkel; Ernst mit seiner Katze Sascha auf der Schulter, Nicolas mit seinem Yorkshire Terrier, Nip, auf den Knien. Rennys beide Spaniels lagen zu beiden Seiten seines Armstuhls. So saßen die Whiteoaks bei Tisch.
»Was ist angenommen?«, schrie die Großmutter.
»Gedichte«, erklärte Onkel Ernst sanft. »Edens Gedichte. Sie sind angenommen.«
»Das ist wohl, worüber ihr alle schwatzt?«
»Ja, Mama.«
»Wer ist sie?«
»Wer ist wer?«
»Das Mädchen, das sie angenommen hat.«
»Das ist kein Mädchen, Mama. Es ist ein Verleger.«
Eden fuhr dazwischen: »Um Gottes willen, versuch doch nicht ihr zu erklären!«
»Er soll mir erklären«, widersprach Großmutter und klopfte heftig mit der Gabel auf den Tisch. »Los, Ernst, Mund auf, was heißt dies alles?«
Onkel Ernst schluckte einen saftigen Bissen Rhabarberkuchen herunter, reichte seine Tasse hin um etwas mehr Tee und sagte dann: »Du weißt, dass Eden eine Anzahl Gedichte in der Universitätszeitschrift und in anderen Zeitschriften veröffentlicht hat. Nun will ein Verleger sie als Buch herausbringen. Verstehst du?«
Sie nickte, und die Bänder ihrer großen lila Haube schütterten. »Wann bringt er es heraus? Wann kommt er? Wenn er zum Tee kommt, will ich meine weiße Haube mit den lila Bändern. Wird er sie zum Tee herausbringen?«
»Mein Gott!«, stöhnte Eden halblaut. »Warum versuchst du, ihr solche Dinge zu erklären? Ich wusste, wie das gehen würde.«
Seine Großmutter starrte ihn böse an. Sie hatte jedes Wort gehört. Trotz ihres hohen Alters sah man ihr noch an, dass sie eine schöne Frau gewesen war. Ihre lebhaften Augen glänzten noch unter den struppigen rötlichen Brauen. Ihre Nase, der Zeit zum Trotz, sah aus, als ob ein Bildhauer sie geformt und sich Mühe gegeben hätte, den Schwung der Nüstern und den Bug des Nasenrückens vollkommen zu machen. Sie war so gebeugt, dass ihre Augen gerade auf die Speisen starrten, die sie liebte.
»Willst du mich wohl nicht ausschimpfen!« Sie wandte heftig das Gesicht nach Eden. »Nicolas, sag ihm, er soll mich nicht ausschimpfen.«
»Schimpf sie nicht aus«, brummte Nicolas mit seiner vollen tiefen Stimme.
»Noch Kuchen, Meggie, bitte.«
Großmutter nickte und grinste, ganz versunken in ihren Kuchen, den sie mit einem Teelöffel aß und kleine genüssliche Laute dabei ausstieß.
»Einerlei«, sagte Renny, die Unterhaltung fortsetzend, »mir passt das nicht. Keiner von uns hat je mit so was zu tun gehabt.«
»Ihr waret aber alle damit zufrieden, dass ich Verse schrieb, solange ich sie bloß in der Universitätszeitschrift drucken ließ. Jetzt, wo ich einen Verleger habe, der sie herausbringt –«
Großmutter fuhr auf. »Herausbringt! Bringt er sie heute? Wenn er kommt, will ich meine weiße Haube tragen, mit den lila –«
»Mama, noch etwas Kuchen?«, unterbrach Nicolas. »Noch ein klein bisschen Kuchen?«
Die alte Mrs. Whiteoak war leicht abgelenkt durch eine Erinnerung an ihren Gaumen. Sie hielt eifrig ihren Teller hin und ließ den Saft auf das Tischtuch tröpfeln, wo er eine kleine rote Pfütze bildete.
Eden, der mürrisch wartete, bis sie ihren Kuchen hatte, fuhr mit einem Stirnrunzeln fort:
»Du hast einfach keine Ahnung, Renny, wie schwierig es ist, ein Gedichtbuch zu veröffentlichen. Und noch dazu durch ein New Yorker Haus! Ich wollte, du könntest meine Freunde darüber reden hören. Die würden was darum geben, das in meinem Alter erreicht zu haben.«
»Es wäre wichtiger gewesen«, antwortete Renny verdrießlich, »dein Examen zu machen. Wenn ich an das Geld denke, das an deine Erziehung weggeworfen ist –«
»Weggeworfen! Hätte ich dies fertiggebracht, wenn ich nicht meine Erziehung gehabt hätte?«
»Du hast immer bloß Verse gekritzelt. Die Frage ist, kannst du davon leben?«
»Gib mir Zeit! Lieber Gott, noch ist mein Buch nicht in des Setzers Händen. Ich weiß nicht, wie weit ich damit komme. Wenn du oder irgendeiner von euch bloß anerkennen wollte, was ich wirklich geschafft habe.«
»Das tue ich, Lieber!«, rief seine Schwester. »Ich finde, es ist sehr viel von dir, und wie du sagst, es kann dich noch wer weiß wie weit bringen.«
»Mag sein, dass es mich dazu zwingt, in New York zu leben, wenn ich Schriftsteller werden sollte«, sagte Eden. »Man muss in der Nähe seines Verlegers sein.«
Piers, der Bruder neben ihm, warf ein: »Na, es wird spät. Ich muss zurück und Dünger streuen. – Niedrige Arbeit natürlich – tut mir leid, dass meine Arbeit nicht Verseschreiben ist.«
Eden steckte den beleidigenden Ton ein, aber antwortete: »Jedenfalls riechst du nach deiner Arbeit.«
Wakefield beugte sich im Stuhl zurück nach Piers zu. »Oh, ich rieche ihn!«, schrie er. »Stallgeruch ist sehr fein.«
»Dann wollte ich«, sagte Eden, »dass du mit mir den Platz tauschtest, mir nimmt er den Appetit.« Wakefield wollte im Eifer zu tauschen gleich herunterklettern, aber seine Schwester hielt ihn fest. »Bleib wo du bist, Wake. Du weißt, wie Piers dich quälen würde, wenn du neben ihm säßest. Aber wenn du nach New York gingest, Eden – du weißt, wie schwer mir das würde.« Tränen füllten ihre Augen.
Die Familie stand vom Tisch auf und bewegte sich in Gruppen nach den drei Türen zu. In der ersten Gruppe schleppte Großmutter schwer ihre Füße, an jeder Seite von einem Sohn gestützt, wobei Nicolas seinen Terrier unter einem Arm hatte und Ernst seine Katze auf der Schulter. Wie irgendeine wunderliche Menagerie in Parade schoben sie sich langsam über das verwelkte Muster des Teppichs nach der Tür zu, die Großmutters Zimmer gegenüber war. Renny, Piers und Wakefield gingen durch die Tür, die in einen hinteren Gang führte, wobei der kleine Junge versuchte, seinem Bruder Piers, der eine Zigarette anzündete, auf den Rücken zu klettern. Meg und Eden verschwanden durch die Doppeltür, die in die Bibliothek führte.
Gleich danach fing der Diener John Wragge, bekannt als »Rags«, an, den Tisch abzudecken, und stapelte die Schüsseln gefährlich auf ein ungeheures schwarzes, mit ausgeblichenen roten Rosen dekoriertes Teebrett, um sie die lange steile Treppe zu den Kellerräumen hinunterzutragen. Er und seine Frau bewohnten die unteren Regionen; sie besorgte das Kochen, und er trug, außer den unzähligen Tabletts, alle Kohlen und Wasser die steile Treppe herauf, putzte Messing und Fenster und bediente seine Frau zu jeder Zeit. Trotzdem beklagte sie sich, dass er alle Arbeit auf sie ablüde, während er erklärte, dass er seine eigene tue und ihre noch dazu. Die Kellerräume waren der Schauplatz fortwährenden Gezänks. Durch ihre unterirdischen Gänge verfolgten sie einander mit bitteren Vorwürfen, und gelegentlich polterte ein Stiefel auf das Ziegelpflaster, oder ein Kohlkopf flog wie eine Bombe durch den Gang. Jalna war so solid gebaut, dass nichts von diesen Ärgernissen oben zu hören war. In vollständiger Abgeschlossenheit lebten diese beiden ihr stürmisches Leben zusammen, wobei sie gelegentlich spät in der Nacht Versöhnung feierten, eine Kanne starken Tee auf dem Tisch zwischen sich.
Rags war ein geschwätziger kleiner Kerl mit einem grauen Gesicht, einer flachen Nase und einem Mund, der zum Zigarettenhalter gemacht schien. Er war oben an der Hintertreppe, als Renny, Piers und Wakefield den Gang entlangkamen. Wakefield wartete, bis seine Brüder vorbei waren, dann sprang er Rags auf den Rücken, kletterte an ihm hinauf, als ob er ein Baum wäre, und warf dabei sie beide und das beladene Tablett beinahe die Treppe herunter.
»Au!«, schrie Rags. »Da macht er’s wieder! Immer macht er’s so! Diesmal lag ich beinahe unten! Da fliegt die Zuckerschale! Da die Sauciere! Holen Sie ihn um Gottes willen runter, Mr. Whiteoak!«
Piers, der der Nächste war, zerrte Wakefield von Rags’ Rücken und lachte ausgelassen dabei. Aber Renny kam stirnrunzelnd zurück. »Er müsste Prügel haben«, sagte er streng. »Es ist just wie Rags sagt – er macht das immer.« Er sah auf der halbdunklen Treppe nach dem Diener, der die Trümmer aufsammelte. »Ich werde ihn auf den Kopf stellen«, sagte Piers.
»Nein, lass das, es ist schlecht für sein Herz.«
Aber Piers hatte es schon getan, und das Paket Kaugummi war aus Wakefields Tasche gefallen.
»Stell ihn auf die Füße«, befahl Renny. »Hier, was ist dies?« Und er hob das rosa Paket auf.
Wake hing erschrocken und verwirrt den Kopf. »Es ist G–Gummi«, sagte er ängstlich. »Mrs. Braun hat es mir geschenkt. Ich mochte sie nicht kränken und ihr sagen, dass ich es nicht kauen dürfte. Ich dachte, es wäre besser, sie nicht zu kränken, weil ich ihr doch eine kleine Rechnung schuldig bin. Aber du siehst, Renny« – er hob seine großen Augen beschwörend zu seines Bruders Gesicht – »du siehst, dass es gar nicht aufgemacht ist.«
»Na, diesmal will ich dich laufen lassen.« Renny warf das Päckchen die Treppe hinunter Rags zu. »Da, Rags, wirf dies weg!«
Rags prüfte es, und dann kam seine Stimme salbungsvoll die Treppe herauf: »O nein, Mr. Whiteoak, das werde ich meiner Frau geben. Ich sehe, das ist mit Vanillegeschmack, ihr Lieblingsgeschmack. Das wird ihr mächtig guttun, wenn einer von ihren Anfällen kommt.«
Renny wandte sich zu Wakefield. »Wie viel bist du Mrs. Braun schuldig?«
»Ich glaube, achtzehn Cents, Renny. Außer, wenn du meinst, ich müsste das Gummi bezahlen. In dem Fall wären es dreiundzwanzig.«
Renny nahm eine Handvoll Silber aus der Tasche und suchte einen Vierteldollar heraus. »Da, nimm dies und bezahle Mrs. Braun, und mach keine Schulden wieder.«
Großmutter hatte indes die Tür ihres Zimmers erreicht, aber da sie Laute hörte, die den Keim eines Zanks zu enthalten schienen, was sie nächst ihren Mahlzeiten am meisten liebte, so befahl sie ihren Söhnen, sie nach der Richtung der Hintertreppe zu dirigieren. Also kamen die drei herunter, eng zusammengedrängt in einer massigen überwältigenden Front, Wakefield Entsetzen einflößend wie ein indischer Götze. Die Sonne, die durch die bunten Glasfenster hinter ihnen schien, warf bunte Farbflecke auf ihre Körper. Großmutters Geschmack war für kräftige Farben. Sie war es, die das bunte Fenster hier hatte einsetzen lassen, um den düsteren Gang zu erhellen. Nun kam sie in ihrem rotsamtenen Schlafrock, den Ebenholzstock mit der Goldkrücke in der Hand, auf ihre Enkel los, langnasig und grellfarbig wie ein Papagei.
»Was ist los?«, fragte sie. »Was hat das Kind getan, Piers?«
»Rags’ Rücken heraufgeklettert, Oma. Er hat ihn fast die Treppe hinuntergeworfen. Renny hat ihm Prügel versprochen, wenn er das noch einmal tut, aber jetzt lässt er ihn laufen.«
Ihr Gesicht wurde purpurn vor Aufregung. Sie sah mehr denn je wie ein Papagei aus. »Laufen lassen, was!«, schrie sie. »Hier wird zu viel laufen gelassen. Das ist die Sache. Prügeln, sag’ ich! Hörst du, Renny? Ordentlich hauen! Ich will es selber sehen! Hol den Stock und hau ihn!«
Mit einem Entsetzensschrei warf Wakefield seine Arme um Renny und versteckte sein Gesicht gegen ihn. »Schlag mich nicht, Renny«, bettelte er.
»Ich tu es selber«, schrie sie. »Ich habe schon öfters Jungens gehauen. Ich habe Nicolas gehauen. Ich habe Ernst gehauen. Ich will diesen verzogenen kleinen Lümmel hauen. Her mit ihm!« Sie wackelte auf ihn zu.
»Komm, komm, Mama«, besänftigte Ernst, »diese Aufregung ist nichts für dich. Komm, du kriegst ein hübsches Pfefferminzplätzchen oder ein Glas Sherry.« Und sacht versuchte er, sie herumzudrehen.
»Nein, nein, nein!«, kreischte sie und wehrte sich, und Nip und Sascha fingen an zu bellen und zu jaulen.