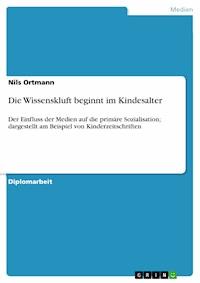
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Diplomarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich Medien / Kommunikation - Theorien, Modelle, Begriffe, Note: 1,3, Hochschule Bremen, Sprache: Deutsch, Abstract: Medieninformationen werden tendenziell effektiver von Mitgliedern höherer sozioökonomischer Schichten aufgenommen. Diese zentrale Aussage der Wissensklufthypothese wird in dieser Arbeit als Forschungsperspektive aufgegriffen und interdisziplinär untersucht. Es gibt keine konsentierte Definition von Wissen. Daher konzentriert sich die Arbeit auf die Entstehung von Wissen. Die Hirnforschung zeigt, wie Informationen, die Grundlage des Wissens, verarbeitet werden. Wichtigste Faktoren sind Emotion, Kognition und Motivation. Das Gehirn baut seine Funktionen während der Entwicklung aus. Piagets Phasenmodell zeigt, dass zuvor erlernte Schemata in höheren Phasen ausdifferenziert werden. Das Wissen von Erwachsenen basiert auf Informationen und Schemata der Kindheit. Wissen durch Medien ist auch vom Vorwissen abhängig. Eltern haben großen Einfluss auf den Wissenserwerb. In dem Bereich der Sozialisation ist daher der Haushaltstyp wichtig. Emotionale Haushalte - kombiniert mit der Zuneigung zu Printmedien - fördern frühzeitig die sprachliche Entwicklung des Kindes. So erlernt es schneller die Schriftsprache und wird gezielter Informationen aus Medien aufnehmen. Im zweiten Teil der Arbeit werden diese Annahmen empirisch überprüft. Fünf Kinderzeitschriften wurden untersucht, ob Machart und Inhalte Kinder zum informationsorientierten Lesen anregen können. Die Ergebnisse lassen befürchten, dass Kinderzeitschriften die Wissenskluft im Kindesalter eher verstärken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2008
Ähnliche
Page 1
Die Wissenskluft
beginnt im Kindesalter
Der Einfluss der Medien auf
die primäre Sozialisation; dargestellt am Beispiel der Kinderzeitschriften
Diplomarbeit von
Nils Ortmann
Internationaler Studiengang Fachjournalistik Hochschule Bremen
Abgabetermin:
15. Oktober 2004
Page 2
„Wie wenig wir wissen,
erkennen wir, wenn unsere
Kinder anfangen zu fragen“
Page 1
Einleitung
In einfachen Worten besagt die Wissensklufthypothese: Es gibt die Schlaumeier, die oberen Gesellschaftsschichten, die Bücher und Zeitschriften lesen und immer schlauer werden. Und es gibt die anderen, die untere Schichten, die sich lieber vom Fernsehen berieseln lassen und deshalb tendenziell weniger wissen als die Schlaumeier!
Ganz so einfach ist es natürlich nicht. In neueren Texten zur Wissenskluft wird immer wieder Heinz Bonfadelli zitiert, der den aktuellen Forschungstand als „dispers und disparat zugleich“ (Bonfadelli, 1994: 137) bezeichnet. Werner Wirth fasst die Wissenskluftforschung als Perspektive auf, die von mehreren Seiten eingekreist werden soll (vgl. Wirth, 1997: 304). Diesem Gedanken folgend werden in dieser Arbeit in der Kindheit gelagerte Ursachen für die Entstehung der Wissenskluft durchleuchtet.
Zunächst wird ein Blick in das menschliche Gehirn geworfen, dem Organ, in dem Wissen gespeichert wird. Durch die Hirnforschung ist mittlerweile zum großen Teil bekannt, wie Informationen vom Menschen aufgenommen und gespeichert werden und wie sich das Gehirn eines gesunden Kindes in den ersten Lebensjahren entwickelt.
Mit kognitiven Entwicklungen befassen sich seit Jahrzehnten auch Pädagogik und Psychologie. An einem Strang ziehen Pädagogik und Hirnforschung allerdings erst seit kurzer Zeit. Wie die Zeitschrift Stern Anfang September 2004 berichtete, arbeiten beide Wissenschaften derzeit zum ersten Mal gemeinsam an der Verbesserung des schulischen Lernens (vgl. Eissele, 2004: 145). Die Ergebnisse sind erst nach Abgabe dieser Diplomarbeit zu erwarten. Daher kann nur auf theoretischem Weg eine Verschmelzung der Erkenntnisse beider Bereiche stattfinden.
Die kognitive Entwicklung des Kindes findet nicht im ‚luftleeren Raum’ statt, sondern wird von verschiedenen Instanzen beeinflusst: Eltern, Schule, Peers und Medien. Sie verstärken, ob das Kind später zu den Schlaumeiern gehört oder nicht. Den größten Einfluss haben die Eltern. Sich allein auf Unterschiede der Schichten zu konzentrieren erscheint als ungenügend. Daher werden die verschiedenen Haushaltsformen und Erziehungsstile mit einbezogen, durch die das Mediennutzungsverhalten erklärbar, aber nicht vorhersagbar wird. Denn nicht nur die Institutionen entscheiden, welches Verhältnis die Heranwachsenden zu Medien haben, sondern auch das Individuum selbst.
Page 2
Einleitung ______________________________
Medien verändern und vergrößern das Wissen der Menschen. Allerdings haben nicht alle Medien den selben Informationsanteil. Das gedruckte Wort liegt weit vor den audiovisuellen Medien. Das Lesen und damit die Grundfähigkeit für die Benutzung von Printmedien wird während des Heranwachsens erlernt. Der Haupteinfluss liegt wieder bei den Eltern. Allerdings ist die Lesesozialisation in den elterliche Haushalten unterschiedlich. Einige Kinder können zum Beispiel durch kontinuierliches Vorlesen eine Sprache entwickeln, die ihnen einen einfacheren Zugang zu gedruckten Texten bietet.
Eins ist unstrittig: Durch Printmedien werden Wissensklüfte hervorgerufen. Andererseits können Printmedien Wissensunterschiede möglicherweise reduzieren, wenn sie denn gelesen werden. Um Wissensklüfte zu reduzieren müssen Kinder aus lesefernen Haushalten zum Lesen gebracht werden. Und zwar bevor das Gehirn die Fähigkeit des Lesenlernens mit zirka 15 Jahren abschließt. Doch wie soll dieses bewerkstelligt werden? Den Familienhaushalt zu ändern dürfte problematisch sein. Das Schulsystem kann das Problem kaum lösen. Im OECD-Vergleich im September 2004 fielen die deutsche Schulen wieder einmal negativ auf:
„Unterdurchschnittliche Ausgaben pro Primar- und Sekundar-I Schüler, verbunden mit deutlich überdurchschnittlichen Lehrergehältern werden in Deutschland durch ungünstige Schüler/Lehrer- Relationen und deutlich weniger Unterrichtszeit in den ersten Schuljahren, sowie vergleichsweise geringere Ausgaben für Sachaufwendungen, kompensiert“ (OECD, 2004: 2).
Medien haben großen Einfluss auf Heranwachsende. Aber können sie Kinder aus lesefernen Haushalten zum Lesen bringen? Anhand von fünf Kinderzeitschriften wird dieser Frage im empirischen Teil nachgegangen. Durch den Einsatz objektiver Kriterien wird geprüft, ob die meist knallbunten Hefte einerseits genügend Reize und andererseits genügend Informationen bieten, um Kinder aus lesefernen Haushalten zu gesteigertem Leseverhalten zu führen und dadurch Wissensklüfte abzubauen.
Page 3
1. Wissenskluft
In den meisten theoretischen Arbeiten zur Medienwirkung wird davon ausgegangen, dass die täglich verbreiteten Informationen zu einer allgemeinen Erhöhung des Wissenstandes bei den Menschen führt (vgl. Bonfadelli, 1987: 305). Dies wäre auch ideal, da die informierende Rolle der Massenmedien für Demokratien von großer Bedeutung ist. Empirische Befunde belegen allerdings, dass die Informiertheit der Bürger sehr unterschiedlich ist, obwohl in der heutigen Gesellschaft alle Medien prinzipiell allen Menschen zugänglich sind. Es besteht die Befürchtung, dass sich Massenkommunikation negativ auf die Gesellschaft auswirkt. Auf dieser Annahme basiert auch die Wissenskluftforschung.
1.1 Die ursprüngliche Wissensklufthypothese
In dem makrotheoretischen1Modell beschreibt die Minnesota Gruppe, Phillip J. Tichenor, George A. Donohue und Clarice N. Olien, dass Mediennutzung entgegen der allgemeinen Annahme nicht zur generellen Anhebung der Informiertheit und des Wissens in einer Gesellschaft führt, sondern im Sinne eines „Trendverstärkers bestehende Ungleichheiten sogar noch verstärkt“ (Bonfadelli, 1994: 41). Die Wissensklufthypothese, die 1970 formuliert wurde, besagt:
„As the infusion of mass media information into a social system increases, segments of the population with higher socio-economic status tend to acquire this information at a faster rate then the lower status segments, so that the gap in knowledge between these segments tends to increase rather than decrease” (Tichenor/Donohue/Olien, 1970: 159 f.).
„Mit dem Begriff ‚Wissenskluft’ wird also die Verteilung des Wissens in einem sozialen System bezeichnet“ (Bonfadelli, 1994: 88). Die Folge von Massenkommunikation ist keine homogenisierende Wirkung auf die Gesellschaft, sondern eine Verstärkung seiner Heterogenität und damit eine Verstärkung der Distanz zwischen sozialen Gruppen2. „Es
1Obwohl systemtheoretisch auf der Makroebene formuliert, spannt die Wissenskluftforschung gleichzeitig den Bogen zur Mikroebene, „indem sie Produktion, Distribution und Konsumption von medienvermittelten Informationen miteinander verbindet“ (Bonfadelli, 1994:42). So sind entsprechende empirische Überprüfungen der Hypothesen möglich.
2Die Wissenskluftforschung ist eine theoretische Weiterentwicklung der Diffusionstheorie. Diese fragt auf der Mikroebene, wann jemand von einem Ereignis erfahren hat. Dem entspricht auf der Makroebene die Frage, wie schnell ich eine Neuigkeit in einer Population verbreitet. Das Zusammenspiel von interpersoneller und Massenkommunikation bestimmt dabei die Diffusionsgeschwindigkeit, wobei ereignis- und empfängerbezogene Faktoren mit dem Mediensystem interagieren (vgl. Bonfadelli, 1994: 75ff.). In der empirischen Überprüfung hat die Diffusionstheorie nachgewiesen, dass mit steigender Bildung Nachrichten früher erfahren und umfassender aufgenommen werden. Damit bestätigt die Nachrichtendiffusionsforschung eindeutig die Hypothese der wachsenden Wissenskluft (vgl. ebd.: 177).
Page 4
1. Wissenskluft ______________ ________________
geht um Veränderungen in den Wissensstrukturen, die durch Medienberichterstattung induziert wird“ (Bonfadelli, 1987: 306).
Die Hypothese verweist auf ungleich verteilte Wissenskontingente in der Gesellschaft, darauf, dass einem bestimmten Teil der Gesellschaft Wissen ‚fehlt’. Anwachsende Wissensklüfte - so die Autoren - sind besonders in den Bereichen ‚Wissenschaft’ und ‚Politik’ zu erwarten, aber weniger in Bereichen wie ‚Hobbys’ und ‚praktische Alltagsfragen’3(vgl. Tichenor/Donohue/Olien, 1970: 160). Grafisch ausgerückt stellt sich die Wissenskluft so dar4:
„In ihrem ursprünglichen Kern besagt die Theorie, dass der Wissenserwerb aus den Massenmedien bei Gruppen aus höheren sozialen Schichten schneller vonstatten geht als bei unteren sozialen Gruppen“ (Pürer, 1998: 110). Somit hat die These einen zeitlichen Aspekt. Wissensklüfte können kurzfristig, aber auch über einen Zeitraum von mehren Jahren bestehen. Daher schlugen Tichenor et al. vor, die Veränderung des Wissenszuwachses sowohl in einem längeren, als auch zu einem beliebigen Zeitpunkt empirisch zu untersuchen (vgl. Tichenor/Donohue/Olien, 1970: 163).
3Werner Wirth bezeichnet diese Aufzählung wegen mangelnder konkreter Abgrenzung als einen zu interpretierenden Fokus. „Allgemein politische und wissenschaftliche Themen, die den Bürger nicht unmittelbar betreffen bzw. von ihm nicht direkt erlebbar sind, sind danach besonders gefährdet, Wissensklüfte hervorzubringen“ (Wirth, 1997: 19f.).
4Die Medienberichterstattung in dieser Grafik ist nicht rückläufig, sondern nimmt ebenfalls zu.
Page 5
Mit der Wissenskluft hat die Minnesota Gruppe zwei hypothetische Erfahrungsgesetze formuliert: 1. Wissen ist in der Gesellschaft heterogen verteilt. Es besteht ein Zusammenhang zwischen sozioökonomischen Status bzw. formaler Bildung und dem individuellen Wissensstand. 2. „Der Zusammenhang zwischen Wissen und Bildung ist vom externen Informationsfluss im Zeitablauf abhängig“ (Bonfadelli, 1994: 71). Massenkommunikation kann - so die Wissenskluftthese - dysfunktionale5Konsequenzen für eine Gesellschaft haben, da nicht alle Bevölkerungsschichten gleichermaßen von Medieninformationen profitieren, sondern bestehende Ungleichheiten verstärkt werden (vgl. Kunczik/Zipfel, 2001: 384).
„The ‚knowledge-gap’ hypothesis thus seems to suggest itself as a fundamental explanation for the apparent failure of mass publicity to inform the public at large“ (Tichenor/Donohue/Olien, 1970: 161). Die Relevanz dieser Aussage wird klar, wenn bedacht wird, dass gesellschaftliche Wissensverteilung mit sozialen Chancen verknüpft ist. „Der ständig anwachsenden Informationsflut zu Trotz hat sich die Chancengleichheit im Informationszugang, in der Informationsnutzung wie -verwendung kaum erhöht“ (Bonfadelli, 1994: 73).
Werner Wirth hat festgestellt, dass der demokratische Bürger umfassend informiert sein und Meinungen anderer kennen muss, damit er eine eigene Meinung zu bilden vermag und damit seine Kritik-, Kontroll-, und Partizipationsmöglichkeiten wahrnehmen kann. Politik ist jedoch kein direkt erfahrbares Feld, weshalb sich die Bürger über die Massenmedien informieren müssen (vgl. Wirth, 1997: 23f.). Massenmedien haben also eine wichtige Funktion6für die Gesellschaft. Diese Funktion ist dann erfüllt, wenn alle Menschen einer demokratischen Gesellschaft von den Informationen profitieren. Dieses wiederum wird von der Wissenskluftforschung bestritten.
1.2 Begründung der Hypothese
Die Minnesota Gruppe begründete ihre These damit, dass Höhergebildete es besser verstehen, Medieninhalte zu Nutzen und sich daraus Vorteile zu verschaffen, als niedrigere sozioökonomische Schichten. Die Medien haben dabei eine indirekte Rolle (vgl. Arnhold,
5Diese Dysfunktionalität der Massenmedien ist die Folge von Überproduktion von Information durch die Medien selber, die auf eine nicht homogene Gesellschaft trifft. Dysfunktionalitäten können aber auch auftreten, wenn Informationen keinerlei Gebrauchswert für die Rezipienten haben oder dieser mit dem Informationsangebot überfordert ist (vgl. Bonfadelli, 1994: 39).
6In Deutschland ist sie vom Gesetzgeber in Artikel 5 des Grundgesetzes festgeschrieben: „(1) Jeder hat das Recht [...] sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten“ (Deutscher Bundestag, 1998: 14).
Page 6
1. Wissenskluft ______________________________
2003: 87 ff.). Im Mittelpunkt der Wissenskluftforschung stehen die aufgenommenen Informationen des Mediennutzers. Allerdings ist der Mediennutzer nicht als einzelnes Individuum zu betrachten, sondern die soziale Dimension, „also die Wissensverteilung zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Segmenten“ (Bonfadelli, 1987: 306) steht im Vordergrund. Zur Bestätigung ihrer Hypothese führte die Minnesota Gruppe eine Diffusionsstudie, eine Trendstudie, ein Quasi-Experiment und ein Feldexperiment durch7. Die Untersuchungen ergaben: „Je stärker ein Thema publiziert wurde, desto größer war die Wissenskluft und umgekehrt“ (Holst, 2000: 24).
„Die Wissenskluftforschung konzentrierte sich darauf herauszufinden, warum Informations- und Kommunikationsprozesse in verschiedenen sozialen Schichten unterschiedlich verlaufen, und welche Faktoren für die Entstehung der Wissenskluft verantwortlich sind“ (ebd.: 20).
Fünf Faktoren, die mit dem Bildungsniveau zusammenhängen, sind nach Ansicht von Tichenor et al. für die Entstehung von Wissensklüften wichtig. Sie beeinflussen den Bildungsprozess auf psychologischen, sozialen und medialen Ebenen und sind mit steigender Bildung stärker ausgeprägt:
oKommunikationskompetenz:Lese- und Verstehensfertigkeiten, die für den Erwerb von politischem und wissenschaftlichem Wissen notwendig sind, sind bei Menschen mit höherer formaler Bildung besser ausgebildet.
oVorwissen:Bereits vorhandenes Wissen, durch Medien oder aus der Bildung stammend, erhöht die Aufmerksamkeit und erleichtert das Verstehen. Dies ist vor allem in höheren Schichten gegeben.
oRelevante soziale Kontakte:Höher Gebildete verfügen über mehr soziale Kontakte und damit über mehr interpersonelle Kommunikation, durch die der Informationsaustausch erhöht wird.
oSelektiver Umgang mit Informationen (selective exposure, acceptance and retention of information):Höhergebildete nutzen Medien zur Informationssuche freiwilliger und aktiver als untere Schichten. „Selective acceptance and retention, however, might be a joint result of attitude and educational differences“ (Tichenor/Donohue/Olien, 1970: 162).
7Generell äußert sich Kritik zu der empirischen Prüfung der Wissensklufthypothese. „Überwiegend wurden Querschnitt- und nicht Längsschnittsuntersuchungen durchgeführt. Dadurch waren Aussagen über langfristige Entwicklungen eher selten“ (Holst, 2000: 253).
Page 7
oMediensystem:Informationen werden vor allem durch Printmedien übermittelt, die sich an den Bedürfnissen höherer Schichten orientieren, die deshalb Printmedien stärker nutzen als untere Schichten. Die ursprüngliche Wissenskluftforschung hat sich vornehmlich mit den Auswirkungen der Printmedien befasst und nur am Ende der Ausführungen Fernsehen als ‚knowledge leveler’ erwähnt (vgl. Tichenor/Donohue/Olien, 1970: 162; Kunczik/Zipfel, 2001: 385; Bonfadelli, 1994: 72; Horstmann, 1991: 14; Holst, 2000: 25).
„One would expect the knowledge gap to be especially prominent when one or more of the contributory factors is operative“ (Tichenor/Donohue/Olien, 1970: 163). Je stärker diese Faktoren ausgeprägt sind, desto mehr öffnet sich die Schere zwischen der sozialen Ober-und Unterschicht (vgl. Horstmann, 1991: 14).
1.3 Basiskonzepte
In der ursprünglichen These werden vier Basiskonzepte genannt, die sich auf die Wissenskluft auswirken: Wissen, sozioökonomischer Status, Sozialsystem und Informationsfluss. Zum besseren Verständnis werden diese genauer erläutert.
1.3.1 Wissen
Die Begriffe Wissen und Information wurden in der ursprünglichen Formulierung unpräzise verwendet. „Eine eindeutige Wissensdefinition liegt der Wissenskluftforschung bisher nicht zugrunde“ (Holst, 2000: 39). Dies wäre allerdings eine Grundvoraussetzung, denn nicht bei jedem Themen- bzw. Wissensbereich sind Wissensklüfte zu erwarten (vgl. Wirth, 1997: 20).
Die Entwickler der Wissenskluft-Hypothese benutzen den englischen Begriff ‚Knowledge’, den sie in ‚Knowledge of’ und ‚Knowledge about’ aufteilten (vgl. Bonfadelli, 1994: 81). ‚Knowledge of’ bezeichnet alle Kenntnisse, die unbeabsichtigt, unbewusst, instinktiv oder ‚automatisch’ erlernt werden, es bezieht sich auf die Vertrautheit des Rezipienten mit dem Thema. „Im Gegensatz dazu umschließt ‚Knowledge about’ systematisches, formales, rationales, exaktes und präzises ‚Wissen’“ (vgl. Arnhold, 2003: 103). ‚Knowledge about’ beschreibt also das analytische Wissen.
„Dass Wissen nicht gleich Wissen ist“ (Bonfadelli, 1994: 81) hat Heinz Bonfadelli bei der Durchsicht der bisherigen empirischen Forschungsergebnisse festgestellt. Er schlägt vor,
Page 8
1. Wissenskluft ______________________________
Ergebnisse anderer Wissenschaftsdisziplinen in dieser zentralen Frage für die Wissenskluftforschung nutzbar zu machen (vgl. ebd.). Dies wird in Kapitel 2 dieser Arbeit erfolgen.
1.3.2 Sozioökonomischer Status
In der Wissenskluftforschung wird von der Prämisse ausgegangen, dass „die modernen Industriegesellschaften makrotheoretisch in soziökonomischen Schichten segmentiert sind, was sich mikrotheoretisch auf der Personenebene in der sozialen Position und dem damit verknüpften sozioökonomischen Status äußert“ (ebd.: 94). Obwohl das Konzept der sozialen Struktur für die Wissensklufthypothese wesentlich ist, hat die Minnesota Gruppe keine theoretisch umfassendere Auseinandersetzung gesucht, sondern hat den sozioökonomischen Status mit der formalen Bildung gleichgesetzt (vgl. Tichenor/Donohue/Olien, 1970: 160).
Laut Katja Arnhold ist der soziale Status aber ein mehrdimensionales Konstrukt, dass neben dem formalen Bildungsgrad auch Besitz, Beruf, Geld und Macht umfasst (vgl. Arnhold, 2003: 96). Horstmann wirft gegen den Entwurf des sozialen Status als Merkmal der Wissenskluft ein, dass mit Hilfe des Status nicht unterschiedliche Lernleistungen bei gleicher Nutzung erklärt werden können (vgl. Horstmann, 1991: 25).





























