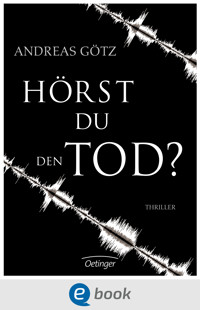9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Karl-Wieners-Reihe
- Sprache: Deutsch
München 1958. Zwischen Stadtjubiläum, alten Seilschaften und erstem Nazi-Prozess geraten zwei Freunde in ein erbittertes Katz-und-Maus-Spiel – der Abschlussband der 1950er-Jahre-Trilogie um den Journalisten Karl Wieners, seine Nichte Magda und Oberkommissar Ludwig Gruber Im Frühjahr 1958 sortiert Journalist Karl Wieners nach einem Herzinfarkt sein Leben neu. Dabei wird ihm eines immer klarer: Er kann nicht ohne Magda sein, die von ihrem Mann, dem Bauunternehmer Blohm, drei Jahre zuvor nach Amerika verbannt wurde. Karl weiß, dass er an Blohm nicht vorbeikommt. Und entschließt sich, bis zum Äußersten zu gehen. Als Blohm drei Monate später aus seiner Villa verschwindet, nimmt Oberkommissar Ludwig Gruber die Ermittlungen auf. Eine erste Spur führt ihn zu Nakam, einer Gruppe jüdischer Rächer. Und ein Tipp zu seinem Jugendfreund Karl Wieners. Ist Karl wirklich in die Sache verwickelt? Und wenn ja, wie weit ist Ludwig bereit zu gehen, um die Wahrheit ans Licht zu bringen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 528
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Andreas Götz
Die Zeit der Jäger
Kriminalroman
Kriminalroman
Über dieses Buch
München 1958. Zwischen Stadtjubiläum, alten Seilschaften und erstem Nazi-Prozess geraten zwei Freunde in ein erbittertes Katz-und-Maus-Spiel – der Abschlussband der 1950er-Jahre-Trilogie um den Journalisten Karl Wieners, seine Nichte Magda und Oberkommissar Ludwig Gruber
Im Frühjahr 1958 sortiert Journalist Karl Wieners nach einem Herzinfarkt sein Leben neu. Dabei wird ihm eines immer klarer: Er kann nicht ohne Magda sein, die von ihrem Mann, dem Bauunternehmer Blohm, drei Jahre zuvor nach Amerika verbannt wurde. Karl weiß, dass er an Blohm nicht vorbeikommt. Und entschließt sich, bis zum Äußersten zu gehen.
Als Blohm drei Monate später aus seiner Villa verschwindet, nimmt Oberkommissar Ludwig Gruber die Ermittlungen auf. Eine erste Spur führt ihn zu Nakam, einer Gruppe jüdischer Rächer. Und ein Tipp zu seinem Jugendfreund Karl Wieners. Ist Karl wirklich in die Sache verwickelt? Und wenn ja, wie weit ist Ludwig bereit zu gehen, um die Wahrheit ans Licht zu bringen?
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Ursprünglich wollte Andreas Götz seine Kriminalromane in der Nazi-Zeit ansiedeln. Doch bei der Recherche wurde ihm schnell klar, dass sich die 1950er Jahre viel besser eignen. Ein gesellschaftliches Klima von Schuld, Verdrängung und Selbstbetrug, wie es in dieser Zeit herrschte, bringt alle Voraussetzungen mit, die ein fesselnder Roman braucht. Der Handlungsort München hat sich nicht zuletzt deshalb aufgedrängt, weil Andreas Götz ganz in der Nähe als freier Autor lebt und arbeitet und daher Land und Leute gut kennt. »Die Zeit der Jäger« ist der abschließende Band der 1950er-Jahre-Trilogie um den Journalisten Karl Wieners, seine Nichte Magda und Oberkommissar Ludwig Gruber.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Inhalt
Die wichtigsten handelnden Personen
Donnerstag, 5. Juni 1958
Samstag, 15. März 1958
Sonntag, 16. März 1958
New York City
Dienstag, 25. März 1958
München
New York City
Freitag, 6. Juni 1958
Freitag, 28. März 1958
Sonntag, 30. März 1958
New York City
Karsamstag, 5. April 1958
München
Ostersonntag, 6. April 1958
Westberlin
New York City
Ostberlin
New York City
Ostermontag, 7. April 1958
Westberlin
Donnerstag, 12. Juni 1958
München
Freitag, 13. Juni 1958
Mittwoch, 25. Juni 1958
Donnerstag, 17. April 1958
New York City
Freitag, 18. April 1958
Sonntag, 20. April 1958
Dienstag, 22. April 1958
München
Donnerstag, 24. April 1958
Samstag, 26. April 1958
Mittwoch, 7. Mai 1958
Donnerstag, 5. Juni 1958
Freitag, 6. Juni 1958
Dienstag, 10. Juni 1958
New York City
Mittwoch, 11. Juni 1958
München
Donnerstag, 12. Juni 1958
Freitag, 13. Juni 1958
Mittwoch, 25. Juni 1958
Donnerstag, 26. Juni 1958
Freitag, 27. Juni 1958
Montag, 30. Juni 1958
Dienstag, 1. Juli 1958
Donnerstag, 3. Juli 1958
Freitag, 4. Juli 1958
Landshut
München
Samstag, 5. Juli 1958
Montag, 7. Juli 1958
Mittwoch, 9. Juli 1958
Am Ammersee
Nahe München
Am Ammersee
Donnerstag, 10. Juli 1958
Freitag, 11. Juli 1958
S. S. Conte Grande
Montag, 14. Juli 1958
München
Dienstag, 15. Juli 1958
Donnerstag, 17. Juli 1958
Samstag, 19. Juli 1958
Buenos Aires
Sonntag, 20. Juli 1958
München
Dienstag, 29. Juli 1958
Dienstag, 2. September 1958
Die wichtigsten handelnden Personen
Karl Wieners, Schriftsteller und Journalist, der nach einem Herzinfarkt zu allem bereit ist, um Magda wiederzusehen.
Magda Blohm, die Frau, die Karl liebt und von der er seit drei Jahren getrennt ist. Sie lebt in New York, allerdings mit sehr begrenzten Möglichkeiten.
Peter, genannt Peterle, Magdas siebenjähriger Sohn.
Walter Blohm, Magdas Ehemann, reicher Bauunternehmer mit einer dunklen Vergangenheit, die ihn nun einholt. Er tut alles, um zu verhindern, dass Karl und Magda glücklich werden.
Simon Herzberg, ein Jugendfreund Magdas, den Blohm zu ihrem Aufpasser in Amerika bestellt hat.
Andrew Aldrich, ein alter Bekannter Magdas, der ungute Erinnerungen weckt.
Agota Vanagaitė, eine junge Litauerin und Freundin Magdas, die in Amerika für einen östlichen Geheimdienst arbeitet.
Danuta Vanagaitė/Gerti Wieners, Zwillingsschwester Agotas, die als Karls tot geglaubte Tochter ein doppeltes Spiel spielt.
Veit Wieners, Karls jüngerer Bruder, Nachtclub-Besitzer und neuerdings Familienvater. Er teilt mit Magda mehr als nur ein Geheimnis.
Georg Borgmann, ein Jugendfreund von Karl und Redakteur beim Wochenmagazin Quick.
Ludwig Gruber, Oberkommissar in Gewissensnöten und Vater zweier Söhne und einer Tochter.
Traudl Gruber, Ludwigs zweite Frau und Mutter seiner kleinen Tochter Annerl.
Zöllner, ein Polizeikollege.
Breitsamer, ein Polizeikollege.
Kriminalrat Vranitzky, Ludwigs Chef in der Morddienststelle.
Donnerstag, 5. Juni 1958
(Fronleichnam)
Déjà-vu.
Für einen Moment fühlte Ludwig sich um Jahre zurückversetzt. Damals hatte er, genau wie jetzt, in einem Büro gestanden, mit einem offenen Tresor in der Wand und Blut auf dem Boden. Aber damit hörten die Gemeinsamkeiten auch schon auf, denn an jenem Tag hatten sie eine schrecklich zugerichtete Leiche gefunden. Hier und heute gab es nur Blut. Nicht annähernd so viel wie vor ein paar Jahren, aber doch einiges. Was fehlte, war eine Leiche.
Eine weitere, nicht unwesentliche Gemeinsamkeit gab es allerdings doch noch: In dem Fall vor acht Jahren hatten ein paar Ermittlungsfäden zu Walter Blohm geführt, seinerzeit ein ungekrönter Schwarzmarktkönig und Schmugglerboss, dem nie etwas nachzuweisen gewesen war. Heute, da Blohm angeblich nur noch legale Geschäfte machte, würde sein Name als der des Geschädigten in den Akten stehen, denn sie befanden sich in seinem privaten Büro, und das Blut auf dem Boden war vermutlich seines. Nur von ihm selbst fehlte jede Spur.
Das Leben ist keine Gerade, dachte Ludwig, es dreht sich im Kreis.
Müde schaute er auf die Uhr. Schon nach Mitternacht. Wieder so ein Tag, der einfach nicht enden wollte.
Er hörte einen Wagen vorfahren. Das musste Vranitzky sein. Dem hatte die Beförderung auf den Chefsessel der Morddienststelle charakterlich nicht gutgetan, er benahm sich wie der Gockel auf dem Hühnerhof und bestand sogar darauf, dass ihn die Kollegen, die ihn bisher geduzt hatten, wieder siezten. Angeblich nur wegen der Außenwirkung. Was dazu geführt hatte, dass man sich mal duzte und mal siezte. Und ungefähr so lief auch der Rest seiner Amtsführung. Nur auf eines war Verlass: Obwohl Ludwig schon fast ein Dreivierteljahr wieder im Dienst war, erinnerte Vranitzky ihn immer noch mindestens einmal die Woche daran, wie dankbar er ihm, Vranitzky, sein müsse, weil er sich für seine Wiedereinstellung starkgemacht habe.
Ludwig hörte Schritte auf der Treppe, und sofort stellten sich die feinen Härchen in seinem Nacken auf. Dann trat Vranitzky durch die Tür, der durchdringende Gestank seiner Pfeife eilte ihm voraus. Man nickte sich gegenseitig einen Gruß zu.
»Was haben wir?«
»Lässt sich so genau noch nicht sagen. Die Nachbarn haben ein Auto vorfahren gehört, später zwei Schüsse. Eine Kugel steckt dort in dem Bürosessel. Die andere …«
»… irgendwo in Herrn Blohm?« Vranitzky zog an der Pfeife.
»Anzunehmen. Wenn das dort Blohms Blut ist. Wovon man ausgehen muss.«
Vranitzky schaute sich im Raum um, wo die Kollegen von der Spurensicherung akribisch ihrem Handwerk nachgingen. Sie nahmen an verschiedenen Stellen Fingerabdrücke und Faserspuren ab, stellten Schildchen auf, fotografierten und dokumentierten alle Funde. Neben dem Blut fiel Vranitzky natürlich sofort der offene Tresor ins Auge.
»Darauf hat er es wohl abgesehen«, sagte er.
»Ich glaube, dass es mindestens zwei Täter waren«, wandte Ludwig ein. »Was in dem Tresor war, wissen wir natürlich nicht, vielleicht ging es um Bargeld, vielleicht um mehr. Geheime Papiere, zum Beispiel. Bleibt die Frage, warum sie Blohm verschleppt haben. Aus Gründen der Vertuschung? Oder haben sie hier nicht bekommen, was sie von ihm wollten?«
Vranitzky schaut auf. »Denken Sie an was Bestimmtes?«
»Nein. Aber jemand wie Blohm hat sicher einige Leichen im Keller. Vielleicht ist er jetzt schon auf dem Weg in eine Folterkammer, wo er letzte Geheimnisse verraten oder auch nur für ein paar Missetaten büßen soll, von denen wir nicht mal was ahnen.«
»Ich bitte Sie, Gruber. Jetzt geht die Phantasie mit Ihnen durch. In einem Punkt aber stimme ich Ihnen zu.« Er machte es spannend, in dem er tief an seiner scheußlichen Pfeife zog, ehe er fortfuhr: »Wenn wir in den nächsten achtundvierzig Stunden kein Lebenszeichen erhalten, können wir davon ausgehen, dass er tot ist.«
Das sah Ludwig genauso. Eine Entführung, um Lösegeld zu erpressen, kam kaum in Frage, denn Blohm war schließlich der Mann mit dem Geld. Wenn die Täter ihn einfach nur tot sehen wollten, hätten sie ihn nicht mitnehmen müssen. Irgendetwas musste er ihnen noch liefern, ehe sie ihn über den Jordan schickten.
»Wir müssen eine Sonderkommission einrichten«, unterbrach Vranitzky Ludwigs Überlegungen und klang dabei so forsch, als sei dies nicht die übliche Vorgehensweise, sondern eine kühne Idee. »Das Ganze ist natürlich Chefsache, aber Sie werden meine rechte Hand sein, Gruber. Gleich morgen früh gehen wir vor die Presse. Und Sie werden neben mir sitzen.« Damit war die Aufgabenverteilung klar. Er würde die Arbeit machen, Vranitzky die Lorbeeren einfahren. Und wenn sie es vermasselten, stand auch schon der Sündenbock zur Schlachtung bereit.
»Jetzt sind Sie froh, dass ich Sie wieder in den Schoß der Kripo zurückgebracht hab, was?« Vranitzky lächelte selbstgefällig. »So ein Fall ist doch um einiges besser, als der tausendsten untreuen Ehefrau nachzuschleichen, oder?«
Ludwig biss die Zähne zusammen. So lächerlich war seine Arbeit als Privatdetektiv auch wieder nicht gewesen. Aber diese Sprüche würde er sich wohl bis zu seiner Pensionierung anhören müssen.
Von der Treppe her wurden polternde Schritte hörbar. Wenig später stand einer von den Schutzpolizisten vor ihnen, ziemlich außer Atem und mit bleichem Gesicht. »Verzeihung«, keuchte er, »da ist was, das müssen Sie sehen.«
Ludwig und Vranitzky folgten ihm nach unten in einen kleinen Flur, der von der Eingangshalle abging. Neben einer Tür stand ein zweiter Schutzpolizist. Vranitzky ließ Ludwig den Vortritt. Bei dem Raum handelte es sich offensichtlich um die spartanische Unterkunft eines Angestellten. Auf dem Nachttisch lag griffbereit ein Revolver, im Bett, in dem die Decke ganz nach oben gezogen war, ein Mensch, wie man an den nackten Füßen erkennen konnte, die unten herausragten.
Ludwig wandte sich zu den beiden Schutzpolizisten um. »Sie haben nicht unter die Decke geschaut?« Beide verneinten. Da sie Lederhandschuhe trugen, wies Ludwig sie an: »Abdecken.«
Der Mutigste trat vor und schlug die Decke zurück. Der Körper eines Mannes in einem Schlafanzug kam zum Vorschein. In Brusthöhe befand sich ein großer roter Fleck. Ludwig betrachtete die Stelle näher. Ein gezielter Stich mit einer schmalen Klinge. Wer immer das getan hatte, war kein Anfänger.
»Sieht nicht so aus, als wäre er noch mal aufgewacht.« Vranitzky trat näher an den Nachttisch und betrachtete die Waffe darauf, ohne sie anzufassen. »Entsichert. Bestimmt der Leibwächter.«
»Da hat jemand genau gewusst, was er tut«, sagte Ludwig, »und das ohne Skrupel.«
Vranitzky nickte. »Der Fall ist eben noch interessanter geworden.«
Drei Monate davor …
Samstag, 15. März 1958
Der Schnee kam aus dem Nichts über sie und umhüllte sie wie ein hellgrauer Kokon aus flirrenden Flocken. Als Gisela abbremste, leuchteten auch die roten Rücklichter des Vordermanns auf. Vor seinem geistigen Auge nahm Karl vorweg, wie ihr Ford Taunus sich in den Wagen vor ihnen schob, er konnte sogar Metall knirschen und Glas zersplittern hören. Er hatte keine Angst, war völlig unbeteiligt. Das war so, wenn man Gevatter Tod eben erst von der Schippe gesprungen war. Man fühlte sich verletzlich und unverwundbar zugleich. So wie damals im Krieg, als einen jederzeit eine Kugel oder eine Granate treffen konnte. Und trotzdem war es anders. Damals hatte die Bedrohung einen Absender gehabt, und wenn es einen erwischte, war man eben nicht schnell genug oder nicht gut genug gewesen. Diesmal kam die Bedrohung aus dem Nichts, oder besser gesagt: Der Absender war er selbst, das eigene Herz, dieses untreue Stück Fleisch, das ihm beinahe den Dienst versagt hatte. Für diesmal aber ließ es ihn nicht im Stich, so wenig wie Gisela, die eine umsichtige Fahrerin war, so dass sie in sicherer Distanz zum Heck des Vordermanns blieben.
»Kaum zu glauben, dass wir Frühlingsanfang haben«, grummelte sie. »Sieh dir das nur an! Schneetreiben!«
Karl blieb stumm. Er hätte jetzt gern eine geraucht. Doch diese Zeiten waren vorbei. Zumindest wenn er seinen fünfzigsten Geburtstag erleben wolle, hatte der Arzt in Bad Aibling ihn ermahnt. Wollte er das, seinen fünfzigsten Geburtstag erleben? Offenbar, denn er hatte sich bis jetzt strikt an das Rauchverbot und die fettarme Diät gehalten. Karl holte ein Päckchen Wrigley’s Kaugummi aus der Jacketttasche, wickelte einen Streifen aus und schob ihn in den Mund.
Giselas Seitenblick bemerkte er wohl, doch er ignorierte ihn.
»Ist das die neue schlechte Angewohnheit?«, fragte sie, halb tadelnd, halb im Scherz.
»Irgendein Laster braucht der Mensch.«
»Wenigstens verpestest du nicht mehr die Luft.«
Der Schneeschauer hörte so plötzlich auf, wie er gekommen war, gerade noch rechtzeitig, damit Karl lesen konnte, was auf dem Schild am Rand der Autobahn stand: München 30 km.
München hatte sich in den Wochen, die er auf Kur gewesen war, wenig verändert. Nicht, dass Karl das erwartet hätte. Für eine Stadt, die sich anschickte, mit viel Brimborium ihren achthundertsten Geburtstag zu feiern, waren ein paar Wochen weniger als ein Fliegenschiss. Als der Wagen in der Nymphenburgerstraße anhielt, bekam Karl trotzdem weiche Knie.
»Wieder da«, sagte Gisela und stellte den Motor ab.
Karl sah sie an und legte kurz seine Hand auf die ihre. »Danke fürs Abholen. Ich hätte auch den Zug nehmen können.«
»Schmarrn!«
Sie stiegen aus, und sofort griff die Kälte sie an. Gisela sperrte eilig den Kofferraum auf. Er wollte den Koffer nehmen, doch sie wehrte ihn ab. Da er ihr zu schwer war, klingelte sie beim Hausmeister und bat ihn, das Gepäck nach oben zu tragen. Der Hausmeister zeigte sich hocherfreut, Karl wohlauf zu sehen, gut erholt, geradezu wie neugeboren.
»Neugeboren bin ich nicht«, widersprach Karl und ließ es wie einen Scherz klingen, »nur fast gestorben.«
Der Hausmeister winkte ab. »Geh’n S’ zu!«
Langsamer als eigentlich nötig stiegen sie die Treppe hinauf. »Frisch gebohnert«, sagte der Hausmeister, »nur zu Ihren Ehren. Aber Obacht! Ist glatt.«
Karl wusste natürlich, dass die Treppe jeden Mittwoch frisch gebohnert wurde, und gerade heute hätte er gern darauf verzichtet, denn der intensive Geruch des Bohnerwachses raubte ihm den Atem.
»Das neue Jahr hat für Sie nicht gut angefangen«, keuchte der Hausmeister auf halber Strecke, »aber vielleicht haben Sie das Schlimmste jetzt hinter sich, und von nun an wird es jeden Tag ein bisserl besser. – Was haben Sie denn da drin in dem Koffer? Ziegelsteine?«
»Bücher, hauptsächlich.«
»Ach so. Freilich.«
Oben angekommen, schloss Gisela die Tür auf. Der Hausmeister stellte den Koffer im Flur ab, sie gab ihm ein paar Groschen fürs Tragen; er wünschte noch einmal weiterhin gute Genesung und zog sich zurück. Karl war die ganze Fahrt über gespannt gewesen, mit welchen Gefühlen er hier stehen würde, und nun bestätigten sich all seine Erwartungen. Es war ein gutes Gefühl, aber auch ein falsches. Er gehörte nicht hierher. Nicht mehr. Oder vielleicht noch nie.
Gisela trat dicht an ihn heran, sah ihm in die Augen, küsste ihn. »Ich hab solche Sehnsucht nach dir gehabt«, flüsterte sie und schob ihre Hand über seinen Hintern. Er war kaum imstande, die Küsse zu erwidern, von mehr gar nicht zu reden.
»Wir sollten es langsam angehen.«
»Freilich. Nicht, dass ich unersättliches Luder dich am Ende noch umbringe.«
Verlegen wandte er den Blick ab. Er musste ihr sagen, dass ihre Gemeinsamkeiten aufgebraucht waren; dass es zu Ende ging. Sollte er es sofort tun? So wie man ein Pflaster am besten schnell abzog? Nein, dachte er, ein wenig Zeit musste er ihr und auch sich selbst schon noch geben, schließlich hatten sie fast fünf Jahre miteinander geteilt, und was ihn betraf, waren es beileibe nicht die schlechtesten fünf Jahre seines Lebens gewesen.
Ehe das Unvermögen, in die alte, alltägliche Nähe zurückzufinden, peinlich wurde, löste Gisela sich von ihm und wandte sich ab in Richtung Küche. »Ich mach uns Kaffee«, sagte sie, »setz dich schon mal ins Wohnzimmer. Ach, nein«, fiel ihr dann ein, »Kaffee darfst du ja keinen mehr trinken. Willst du Tee?«
»Irgendwas«, antwortete er nur, ging aber nicht ins Wohnzimmer, sondern in sein Arbeitszimmer.
Die Luft roch abgestanden. Gisela hatte vor seiner Abfahrt in die Kur den Schlüssel verlangt, damit sie ab und zu die Fenster öffnen und Staub wischen könne, aber er hatte ihn ihr verweigert, denn auch wenn es ihre Wohnung war, war das hier allein sein Reich. Jedes Ding lag noch genau an dem Platz, an den er es gelegt hatte. Der angefangene Drehbuch-Entwurf, die Schreibmaschine, der Korb mit der Post. Viele lose Zettel, auf die er Einfälle gekritzelt hatte. Sein Terminkalender, die zweite Januarwoche war noch aufgeschlagen. Am elften der Eintrag in Großbuchstaben: Gloria-Filmball.
Er öffnete das Fenster und blieb in der hereindrängenden Kälte stehen. Einzelne Schneeflocken irrten durch die Luft, im vergeblichen Versuch, sich der Schwerkraft zu entziehen.
An den Filmball erinnerte er sich gut. Den ganzen Abend über hatte er versucht, Romy Schneider abzupassen, um sie direkt auf die Rolle anzusprechen, die er ihr anbieten wollte: die Hauptrolle in dem Film Trümmermädchen. Noch nie war er einer Verfilmung seines Romans so nahe gewesen wie damals, und wenn ihm so ein Star auch nur vage zugesagt hätte, hätte das ihm und der Capitol Film, die den Streifen produzierte, weitere Türen zu einer gesicherten Finanzierung geöffnet. Dass Romy weg von ihrem Sissi-Image wollte, hin zu ernsten Gegenwartsstoffen, hatte sich herumgesprochen, das war das Pfund, mit dem er wuchern musste. Und dann hatte er sie wirklich erwischt, für einen Tanz, und er hatte all seinen Charme aufgeboten, obwohl er gleich gespürt hatte, dass Romy es nicht war: seine geliebte Magda, um die es im Roman und im Drehbuch ging, obwohl sie dort natürlich anders hieß. Romy war zu sehr das süße Mädel, ganz anders als Magda. Keine Schauspielerin, keine andere Frau würde ihr je gerecht werden. Doch egal, er wollte ohnehin nur Romys berühmten Namen auf der Liste. Sie allerdings verwies ihn an ihren Daddy: den Stiefpapa, der ihre Geschäfte regelte. Dieses Gespräch hätte er sich freilich sparen können. Daddy redete nur über Angebote aus Frankreich und Italien, ließ ihn, den unbedeutenden deutschen Autor, überdeutlich spüren, dass sein kleines Projekt längst unter Romys und damit auch unter seiner Würde war; und zum Schluss merkte er noch an, dass es auch Anfragen aus Hollywood für Romy gebe. Demnächst breche man zu einer Werbetour nach Amerika auf, um sein Goldstück drüben in den Staaten bekannt zu machen, vor allem New York sei dabei wichtig, weil dort die großen Fernsehsender ihre Studios hätten. New York … die Stadt, in der auch Magda mutmaßlich lebte. Das war der Moment gewesen, in dem Karl zum ersten Mal diesen stechenden Schmerz in der Brust gespürt hatte, einen Vorboten des Infarkts, wie er inzwischen wusste, den er damals aber nicht ernst genommen hatte. Und nun war alles anders, das Filmprojekt, überhaupt die Arbeit, ja, sein ganzes Leben, wie er es bis dahin geführt hatte, waren weit weg.
»Hier bist du.«
Karl drehte sich um. Gisela stand mit einer dampfenden Tasse in der Tür. Pfefferminztee, wie er im nächsten Moment roch. Er schloss das Fenster, nahm ihr die Tasse aus der Hand, stellte sie auf dem Schreibtisch ab und setzte sich.
»Kannst du mich noch kurz allein lassen?«, fragte er überfreundlich, weil ihm klar war, dass er sie damit vor den Kopf stieß – erneut, nachdem er schon die ganze Fahrt über wenig mit ihr geredet hatte. Sie sah ihn irritiert an, wahrscheinlich hatte sie erwartet, dass ihm nichts lieber war, als endlich wieder mit ihr auf dem Sofa zu sitzen oder gar im Bett zu liegen, und nun das. »Ich komm gleich«, fügte er rasch hinzu, »muss nur noch ein paar Sachen raussuchen, die schon zu lange liegen geblieben sind.«
Sie nickte nur und ging.
Erleichtert atmete er auf. Nein, lange würde er es hier nicht mehr aushalten. Ein paar Tage noch, mehr nicht. Es war nicht Giselas Schuld. Niemand hatte Schuld. Sie gehörten nur einfach nicht zusammen. Gisela hatte etwas Besseres verdient. Einen Mann, dem es wirklich um sie ging und für den sie mehr war als nur die Notlösung. Doch wie sollte er ihr das sagen? Es würde alles nach wohlfeilen Ausreden klingen, und vielleicht war es das ja auch. Zum Glück musste man sich ihretwegen keine größeren Sorgen machen. Sie war stark. Sie würde ihm vielleicht ein wenig Geschirr an den Kopf werfen, was er auch verdiente, aber sie würde darüber hinwegkommen. Außerdem hatte sie ja ihren Sprössling Benno, der zwar nach dem Abschluss der Mittelschule im Sommer seit Herbst beim Onkel in der Oberpfalz eine kaufmännische Lehre machte, aber er kam ja wieder zurück.
Und wie sollte es für ihn weitergehen? In den Tagen und Wochen im Krankenhaus und auf Kur hatte er mehr Zeit als nötig gehabt, um alles wieder und wieder durchzudenken. Der Herzinfarkt war ein Schuss vor den Bug gewesen und die Botschaft dahinter eindeutig: Du musst Magda wiedersehen, musst sie zurückgewinnen und mit ihr eins werden. Alles andere war unwichtig. Freilich, wie sollte er das anstellen, da ihr Gatte sie nach Amerika geschickt hatte und sie dort wie eine Gefangene hielt, während er selbst in München weiter seinen Geschäften nachging? Ob sie noch in New York weilte oder längst irgendwo anders auf dem Kontinent, das war ebenso ungewiss wie die Antwort auf die Frage, ob sie überhaupt noch lebte. Wie konnte man ein Scheusal vom Schlag eines Walter Blohm dazu bringen preiszugeben, was er auf keinen Fall preisgeben wollte? Solche Männer wichen, wenn überhaupt, nur der Gewalt. Also würde er mit vorgehaltener Waffe mit ihm sprechen. Dafür musste man aber erst an Blohm herankommen. Und davor an eine Waffe.
»Sie sollten für eine lange Zeit jede Aufregung meiden«, hatte der Arzt beim Entlassungsgespräch in Bad Aibling gemahnt. »Am besten für immer.« Das hatte Karl ihm nicht versprechen können. »Erst wenn ich tot bin«, hatte er erwidert. Daran musste Karl jetzt denken, als er in den Wagen stieg. Was er vorhatte, würde seinen Blutdruck garantiert in die Höhe treiben, und wenn sein Herz dabei explodierte, dann war es halt so.
Er ließ den Motor auf den ersten Metern aggressiv hochdrehen, ehe er in den nächsten Gang schaltete. Danach kramte er im Handschuhfach nach einem Eukalyptosbonbon, fand auch eines, und bis er in Obermenzing ankam, hatte er es fertig gelutscht. Die scharfe Mentholfrische in seinem Mund hielt noch an, als er auf das Gartentor zu einem Grundstück zuging, auf dem unter einer Gruppe hoher Tannen ein Einfamilienhaus herüberlächelte. Familie Veit Wieners stand auf dem Klingelschild zu lesen. Karl konnte sich ein süffisantes Grinsen nicht verkneifen. Sollte sein kleiner Bruder wirklich solide geworden sein? Schwer zu glauben. Obwohl das Geschäft angeblich brummte. Die beiden neuen Nachtclubs, die er in den letzten Jahren aufgemacht hatte, schienen gut zu laufen. Das mussten sie auch, damit die Rechnung aufging, denn erst einmal hatte er eine Menge Geld reingesteckt. Geliehenes Geld, vermutlich. Das hübsche Häuschen unter den Tannen gehörte wohl auch eher der Sparkasse und erst in vielen Jahren, wenn alles gut gegangen war, dem lieben Veit. Und wenn Veit die Wette auf die Zukunft gewann? Alle hatten stets Veit für den Versager in der Familie gehalten. Den, der es nie zu etwas bringen würde, weder geschäftlich noch im Leben. Nun stellte sich vielleicht heraus, dass er, Karl, der unsolide Charakter war, der sein Leben auf Sand gebaut hatte und nichts zu Ende brachte.
Karl folgte dem gepflasterten Weg, der zwischen Beeten, Ziersträuchern und grünem Rasen hindurch zur Haustür führte. Ehe er klingeln konnte, flog die Tür schon auf, und Veit stand vor ihm, mit dem Ausdruck überquellenden Besitzerstolzes im Gesicht.
»Na, so eine Überraschung! Hast du dich verlaufen? Oder wieso bist du hier?«
Karl hatte nicht damit gerechnet, ihn um diese Zeit zu Hause anzutreffen. Deshalb war er ja genau jetzt hergefahren.
»Wollte bloß mal schauen, wie es meinem kleinen Bruder in seinem neuen Heim geht«, log er. »Bin heute erst aus der Kur zurückgekommen.«
»Stimmt ja. Entschuldige, dass ich dich nicht besucht hab. Wo warst du überhaupt? Bad Griesbach?«
»Bad Aibling.«
»Richtig. Komm rein.«
Aus dem Wohnzimmer drangen Stimmen in den Flur. Ein Radio- oder Fernsehgerät. Veit ging voraus. »Schau, wer da ist«, sagte er.
Bei Karls letztem Besuch an Weihnachten war das Wohnzimmer noch mit dem Mobiliar der Vorbesitzer eingerichtet gewesen. Nun fand er es, ganz im modernen Stil, mit leichtfüßigen Sitzmöbeln, Tischen in Nierenform, Glasvitrinen und Lampen mit tütenförmigen Schirmen ausgestattet. Auf dem Sofa saß Marianne, die Veit im Frühjahr, wie er selbst grinsend sagte, eingefangen hatte. Im Unterschied zum letzten Mal waren ihre anderen Umstände mittlerweile unübersehbar. Mariannes Hand kreiste die ganze Zeit langsam auf ihrem gewölbten Bauch, während ihr Blick am Fernsehschirm haftete, wo gerade eine Kindersendung lief. Sie konnte sich nur so lange davon lösen, wie es dauerte, »Grüß dich, Karl« zu sagen, danach kehrte ihr Blick sofort wie hypnotisiert zurück.
»Du schaust dir wirklich jeden Schmarrn an«, sagte Veit zu ihr.
»Bloß weil ich zu müde zum Aufstehen bin«, verteidigte sie sich.
»Soll ich ausschalten?«
»Nein, lass an!«
Veit rollte grinsend mit den Augen, doch so, dass nur Karl es sah.
Sollten sie ein Mädchen bekommen, hatte Veit angeboten, könnten sie es Gundula nennen. Oder Gerlinde. Oder beides. Zu Ehren und zum Andenken an Karls verlorene Töchter. So hatte Veit sich ausgedrückt, beim gemeinsamen Weihnachtsessen letztes Jahr, als er Karl mit stolzgeschwellter Brust seine bevorstehende Vaterschaft verkündete. Die Worte klangen Karl jetzt wieder in den Ohren und ließen dieselbe Bitterkeit wie damals in ihm hochkommen. Verloren, hatte Veit gesagt, um nicht tot sagen zu müssen. Karl war wie vor den Kopf geschlagen gewesen. Am liebsten hätte er Veit für seine Taktlosigkeit gerüffelt, doch stattdessen hatte er nur dankend abgelehnt und Mariannes Gänsebraten gelobt.
Veit lotste Karl in die Küche und nahm zwei Helle aus dem Kühlschrank. Er holte auch zwei Gläser aus einem der blendend weißen Hängeschränke über der Anrichte, doch sie tranken beide aus der Flasche. Karl fragte sich, ob die Küchenuhr wirklich so laut tickte oder ob ihm das nur so vorkam. Es machte ihn jedenfalls unruhig.
»Du hast doch noch die Waffe von unserem alten Herrn«, sagte er ohne Umschweife, denn er wollte so schnell wie möglich wieder weg von hier. »Die alte Luger.« Zu Lebzeiten ihres Vaters war die Luger ein Art Familienheiligtum gewesen, ausgestellt in einer gläsernen Vitrine in der Stube. Angeblich war ihr Vater damit nicht nur beim Hitler-Putsch mitmarschiert, er hatte Hitler sogar das Leben gerettet, indem er auf einen Polizisten schoss, der Hitler aufs Korn genommen hatte. Wahrscheinlich stimmte das sogar. In den letzten Kriegstagen hatte der alte Narr versucht, das dumme Heldenstück zu wiederholen, indem er sich mit dem Volkssturm gegen den Einmarsch der Amerikaner stemmte. Dafür hatte er dann mit dem Leben bezahlt.
Veit sah Karl überrascht an. »Was willst du mit dem alten Ding?«
»Dasselbe, was du damit machst: auf den Schrank legen.«
»Im Ernst. Wirst du bedroht?«
»A wo! Ich will nur einfach mal in den Wald damit gehen und auf Blechbüchsen schießen. Nach dem Krieg wollte ich nie wieder eine Waffe anfassen. Aber jetzt, keine Ahnung, warum, ist mir einfach danach.« Veit wirkte zu Recht nicht überzeugt. Karl trank einen Schluck. »Keine Angst«, sagte er dann, »ich bring schon keinen um.«
»Da bin ich mir nicht so sicher. Wenn, wär’s mir auch wurscht, solange du dich nicht erwischen lässt. Ich hab keine Lust, dich jeden Sonntag in Stadelheim zu besuchen.«
»Du meinst, so wie du mich in Bad Aibling besucht hast? Oder davor im Krankenhaus?« Karl lächelte. »Keine Sorge«, beschwichtigte er dann erneut, »ich werde vielleicht jemandem ein bisschen Angst machen, mehr nicht.«
»Kann mir schon denken, wem. Pass bloß auf, dass du dich damit nicht verhebst. Blohm ist gleich mehrere Nummern zu groß für dich.«
»Weiß ich doch. Ich komme eh nicht an ihn ran. Aber ich will wenigstens das Gefühl haben, dass ich könnte, wenn’s drauf ankäme.«
Veit lächelte, als wäre er der Klügere von ihnen beiden, und schüttelte den Kopf. »Tu, was du nicht lassen kannst. Aber vorher trinken wir noch aus.«
Die Bierflaschen in der Hand, standen sie sich schweigend gegenüber. Das Ticken der Küchenuhr wurde ohrenbetäubend.
»Du denkst daran, dass nächste Woche Magdas Geburtstag ist, oder?«, brach Veit die Stille, so abrupt und hart wie eine Axt, die in einen vereisten See schlägt.
»Und wenn schon. Wir haben keinen Kontakt.«
»Wegen ihr ist es, oder? Das mit Vaters Waffe.«
Karl wich Veits Blick aus, setzte die Flasche an die Lippen und leerte sie in einem Zug. Nur damit er nichts mehr sagen musste. Dann stellte er die Flasche auf die Anrichte und wischte sich den Mund ab.
»Auf geht’s.«
Veit ging voraus ins Schlafzimmer, holte eine Blechkiste vom Kleiderschrank herunter und öffnete sie. Der vertraute Geruch von Waffenöl, Eisen und einer Spur Pulverschmauch stieg daraus auf. Auch ein paar Schachteln Munition lagen in der Kiste. Veit wickelte die Pistole aus dem Tuch, in das sie eingeschlagen war. Eine Luger neun Millimeter Parabellum aus dem Ersten Weltkrieg.
»Ob das alte Ding überhaupt noch schießt?«, fragte Karl.
»Probier’s aus.« Veit wickelte sie wieder ein, legte sie zurück in die Kiste, verschloss sie und drückte sie Karl in die Hand. »Sie gehört dir. Besser, sie ist weg. Ein Kind und eine Waffe – das verträgt sich nicht.«
Karl fand Veits verantwortungsbewusstes Getue ein wenig übertrieben. Er nahm die Blechkiste und verließ das Haus. Auf dem Weg zum Auto überlegte er, wo in der Umgebung eine Kiesgrube oder ein Waldstück war, in dem er später, wenn er die Luger gereinigt und auf Vordermann gebracht hatte, sein Schießtraining beginnen konnte.
Sonntag, 16. März 1958
New York City
Für ein paar Sekunden blieb Magdas Blick an der transparenten Spiegelung in der Kuchenvitrine hängen – lange genug, um sich zu fragen, ob die Frau mit der weißen Schürze und dem Häubchen im Haar wirklich sie war –, dann rief sie der helle Klingelton, auf den sie wie ein Hündchen dressiert war, schon wieder an die Durchreiche aus der Küche, um eine fertige Bestellung abzuholen. Eine halbe Stunde hatte sie noch vor sich. Eigentlich war die Sonntagmorgen-Schicht ein Kinderspiel. Keine Hafenarbeiter, die wie die Heuschrecken von den Docks herüberzogen und ihr billiges Menü alle gleichzeitig auf dem Tisch haben wollten, weil der Hunger groß und die Mittagspause kurz war. Stattdessen nur ein paar Familien, die es sich leisteten, auswärts zu frühstücken. Und das Trinkgeld saß ihnen auch etwas lockerer in der Tasche, während die Arbeiter mit ihren kargen Löhnen um jeden Cent knauserten. Trotzdem konnte sie es kaum erwarten, im Bus zu sitzen, wo sie auf der Fahrt nach Flatbush in ihrem zerfledderten Paperback lesen oder einfach nur aus dem Fenster starren konnte.
Wie aus dem Nichts stand plötzlich Simon vor ihr. Sie hatte gar nicht gehört, dass jemand hereingekommen war. »Happy birthday«, sagte er, während sie vier Teller mit einer Sicherheit an ihm vorbeibalancierte, als wären sie an ihren Händen festgeklebt. »Hast du an deinem Geburtstag wirklich nichts Besseres zu tun?«
»Eigentlich nicht.«
Sie verteilte die Teller, holte die Kaffeekanne von der Warmhalteplatte, schenkte einem Gast nach und stellte die Kanne zurück an ihren Platz. Als Simon immer noch an der gleichen Stelle verharrte, fragte sie: »Willst du etwas essen? Oder bist du nur zum Gratulieren gekommen?«
»Weder noch. Da ist jemand, der dich sehen will.«
Karl, dachte Magda sofort. Im nächsten Moment wunderte sie sich, dass das nach zweieinhalb Jahren Trennung immer noch ihr erster Gedanke war, vor allem, da die Chance, dass Karl sie hier fand, gleich null war. »Wer denn?«, fragte sie.
»Wirst du schon sehen. Hey, Jimmy«, rief er über den Tresen hinweg, wo Magdas Boss saß und Kreuzworträtsel löste, »Maggie macht für heute Schluss.«
»Und wer soll dann …«, brauste Jimmy auf.
»Hey, sie hat heute Geburtstag. Ihren dreißigsten.«
»Und was geht das mich an?« Jimmy kam Simons Gegenrede zuvor, indem er abwinkte. »Ach, meinetwegen, verpisst euch! Und Maggie, hey, alles Gute zum Geburtstag.«
Sie bedankte sich, doch Jimmy hatte sich schon wieder seinem Kreuzworträtsel zugewandt.
Simon zwinkerte ihr zu. Es gefiel ihm, dass er hier den Oberboss spielen konnte, auch wenn die Macht, die ihm das erlaubte, nur geliehen war von den Männern, für die er arbeitete. Den wahren Herren. Magda wollte gar nicht wissen, was das für Leute waren und was er für sie tat. Ihr reichte es zu sehen, wie ihn das bisschen Macht, das von dort zu ihm durchsickerte, verändert hatte. Sie verschwand hinter der Tür, auf der in Großbuchstaben STAFF ONLY stand, warf Schürze und Häubchen in den Korb für die Wäscherei, schlüpfte in ihren Mantel und nahm die Handtasche. Wer wohl dieser Jemand war, der sie sehen wollte? Hoffentlich ein Mann von einer Zeitung oder einem Magazin, der sich für ihre Fotos interessierte. Simon hatte versprochen, so jemanden für sie aufzutreiben. Sie kontrollierte in ihrem Schminkspiegel ihre Frisur und frischte den Lippenstift auf.
Als sie zurück in den Gastraum kam, lehnte Simon am Tresen und plauderte mit Jimmy über irgendein Sportereignis. Auch wenn Jimmy jetzt so tat, als seien sie beide nur zwei Kerle, die sich über Männerkram unterhielten, und als sei Simons bestimmendes Auftreten vorhin vergessen, würde er sie bei ihrer nächsten Schicht die Demütigung büßen lassen.
Simon hielt Magda die Glastür auf, und sie trat mit einem großen Schritt in diesen grauen, aber milden Tag, der zufällig ihr dreißigster Geburtstag war, tauchte ein ins Rauschen der Stadtautobahn über ihren Köpfen, das einem nur auffiel, wenn es, so wie jetzt, durch einen Moment der Stille unterbrochen wurde. Erst hier draußen nahm Simon sie in den Arm, küsste sie auf die Wange und sagte noch einmal: »Happy birthday, honey. Ich wünsche dir alles Glück der Welt. Niemand hat es so sehr verdient wie du.«
Magda lächelte und löste sich rasch aus der Umarmung. Egal, wie sehr Simon sich verändert hatte, eines hatte sich nicht geändert: seine mehr oder weniger heimliche Liebe zu ihr. Doch nicht nur deshalb vermied sie alles, was ihm falsche Hoffnungen machen könnte. Auch wenn er wohl kaum eine andere Wahl hatte, konnte sie nicht darüber hinwegsehen, dass er Blohms Mann war und damit der Wärter des Gefängnisses, zu dem Blohm ihr Leben gemacht hatte. Dass ausgerechnet er ihr nun alles Glück der Welt wünschte, klang wie Hohn in ihren Ohren, selbst wenn es ehrlich gemeint war.
Simon ging voraus, auf eine dunkle Limousine zu, die ein paar Meter entfernt parkte, und öffnete ihr den Schlag. Von der Person im Innern konnte sie nur die Hand sehen, die die aufgeschlagene Wochenendausgabe der New York Times hielt. Magda zögerte, denn sie ahnte, wer sich dahinter verbarg.
»Steig schon ein«, sagte Simon ungeduldig.
Magda folgte der Forderung, und ihre Ahnung bestätigte sich, als der Mann die Zeitung zusammenfaltete.
Blohm. Es war Blohm. Ihr Ehemann. Ihr Verhängnis. Eines Tages vielleicht ihr Untergang.
»Guten Tag, Magda«, sagte er, »und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Hier, für dich.« Er fasste neben sich und hielt ihr einen Strauß weißer Rosen hin.
Inzwischen war Simon eingestiegen. Er ließ den Motor an und fuhr los, ohne dass Blohm ihn anweisen musste, wohin.
Magda sah die Blumen nicht, die Blohm ihr in den Arm legte, sie starrte nur ihn an, während sie innerlich versteinerte. Fast zweieinhalb Jahre hatte sie ihn nicht gesehen, und nun saß er einfach so neben ihr. Doch das Déjà-vu-Erlebnis, das sie gerade hatte, reichte noch viel weiter zurück: bis zu ihrer ersten Begegnung, bei der sie ebenso ahnungslos gewesen war und die schon damals Simon eingefädelt hatte. Geschichte wiederholt sich, dachte sie, aber niemals auf dieselbe Weise.
»Du siehst gut aus«, sagte Blohm, »ein wenig mager vielleicht, aber es steht dir.«
»Was willst du?«, konnte sie endlich fragen.
»Nur meine geliebte Gattin besuchen. Auch wenn sie mich schwer gekränkt hat. Benutzt.«
Er sagte es ohne Groll in der Stimme. Sofort keimte Hoffnung in ihr auf. Vielleicht war er milde gestimmt, weil er endlich jemanden kennengelernt hatte. Wieder heiraten wollte. Und er brauchte dafür die Scheidung. Jede Nacht betete sie für eine solche Lösung zu einem Gott, an den sie nicht glaubte.
»Wie ist es dir denn ergangen, in all der Zeit?«, fragte er im Plauderton.
»Das hat dir Simon doch sicher alles längst berichtet.«
Blohm lachte auf. »Glaubst du wirklich, ich habe ständig Rapport erhalten über dein kleines Leben hier? Glaubst du, es hat mich interessiert, was du jeden Tag so treibst? Ich bitte dich! Da gab es für mich wirklich Wichtigeres in den letzten beiden Jahren.«
Der gallige Ton, der unterdrückte Zorn, der sich in seiner Antwort zeigte, ließen ihre Hoffnung, dass sich etwas zum Besseren gewendet haben könnte, zerplatzen. Er würde die Sache niemals auf sich beruhen lassen. Selbst nach einer Scheidung nicht. Sie war für immer seine Gefangene. Und solange er offiziell der Vater ihres Kindes war, hatte er ein Druckmittel, das sie gefügig machte. Ganz abgesehen von der Drohung, Karl etwas anzutun, sollte sie nicht stillhalten.
»Und warum bist du dann hier, wenn du dich überhaupt nicht für mich interessierst?«, fragte sie schroff.
»Weil ich ein wenig Zeit bis zu meinem Rückflug überbrücken muss. Denkst du etwa, ich fliege deinetwegen um die halbe Welt?« Er lachte höhnisch. »Da ich dich jeden Monat mit einem gewissen Geldbetrag unterstütze, werde ich doch einmal nachsehen dürfen, wie sich meine Investition entwickelt. Ich habe nicht den Eindruck, dass sie sich lohnt.«
Magda war kurz davor, ihm seinen verdammten Strauß Rosen um die Ohren zu hauen. Doch sie beherrschte sich.
»Es geht mir gut«, sagte sie. »Ich arbeite, wie du gesehen hast. Daneben fotografiere ich.«
»Und Peterle? Wie geht es ihm?«
»Es war nicht leicht für ihn, sich hier einzugewöhnen. Inzwischen geht es. Seit Herbst besucht er die öffentliche Schule in unserem Viertel.«
Sie wünschte, es wäre wirklich so einfach gewesen, wie sie es darstellte. Anfangs hatte Peterle mit Staunen und Schrecken auf die neue Umgebung reagiert. Spätestens als er begriff, dass sie nicht wieder nach München zurückkehren würden, blieb nur noch der Schrecken übrig. Die schiere Größe der Stadt, ihre Unerbittlichkeit, die Andersartigkeit der Menschen und die fremde Sprache schüchterten ihn so sehr ein, dass er für fast ein ganzes Jahr verstummte und sich auch sonst wieder zu einem Kleinkind zurückentwickelte. Für das, was der Bub durch ihn leiden musste, hasste sie Blohm, während Peterle anfing, sie zu hassen, weil sie ihn nicht aus seinem Leid erlöste. Wie sollte sie ihm erklären, dass der Vater, der immer gut zu ihm gewesen war und der dadurch in seiner Phantasie zu einer Art Gott eines verlorenen Paradieses wurde, in Wahrheit der Teufel war, der ihn aus diesem Paradies vertrieben hatte?
Magda schaute aus dem Seitenfenster. Erst jetzt fiel ihr auf, dass Simon nicht, wie erwartet, den Weg zum Ocean Parkway nahm, die schnellste Verbindung nach Flatbush, sondern in die 5th Avenue eingebogen war. »Wo fahren wir hin?«, fragte sie Blohm.
»Wir machen nur einen kleinen Spaziergang«, sagte der. »Wir sind auch gleich da, Simon, oder?«
»In ein paar Minuten, Herr Blohm.«
Wie klein Simon plötzlich ist, dachte Magda. Eben noch hat er sich vor Jimmy als großer Herr aufgespielt, aber in Wirklichkeit ist er doch nur ein Chauffeur und Handlanger.
Ob es etwas zu bedeuten hatte, dass Blohm mit ihr durch einen Friedhof spazieren wollte? Wobei der Green-Wood Cemetery kein Friedhof war, wie man sie aus Europa kannte. Magda kam nach manch einer anstrengenden Arbeitsschicht gern hierher, um sich von dem Trubel zu erholen. Weitläufig auf der höchsten Erhebung Brooklyns angelegt, war er mit seinen grünen Hügeln und kleinen künstlichen Seen, den Bäumen und Sträuchern und den breiten asphaltierten Wegen mehr ein Park. Nichts Schauriges oder gar Bedrohliches ging von den alten verwitternden Grabsteinen, den kleinen und großen Mausoleen und Kreuzen, den Engeln, Kindern und sonstigen Gestalten aus Marmor oder Sandstein aus. Sie beide waren auch keineswegs die einzigen Besucher. Green-Wood galt als Sehenswürdigkeit. Eltern mit Kleinkindern und Kinderwagen, Sonntagsausflügler allein oder in Gruppen und sogar Liebespaare verloren sich auf dem weitläufigen Gelände. Von manchen höher gelegenen Stellen bot sich ein einmaliger Blick hinüber zu den Wolkenkratzern an der Südspitze Manhattans.
Nachdem sie eine Weile schweigend nebeneinanderher spaziert waren, sagte Blohm: »Es gibt etwas über Karl, das ich dir erzählen muss.«
Ein Zucken ging durch sie hindurch. »So? Was denn?« Sie versuchte, nicht allzu interessiert zu klingen.
»Er hatte einen Herzanfall. Einen Infarkt.«
Erschreckt blieb sie stehen, packte Blohm am Arm.
»Ist er …?«
»Tot? Nein. Er hat den Kopf noch einmal aus der Schlinge gezogen. Aber er bleibt auf der Liste. Dem ersten Infarkt folgt oft ein zweiter.«
Magda stieß Blohms Arm, den sie immer noch festhielt, mit Nachdruck weg und wandte sich ab. Für einen Moment spürte sie ihren Körper nicht mehr, war nur noch ein Gedanke: Karl … beinahe tot … aber er lebt … noch …
»Geht es dir gut?«, hörte sie Blohm hinter sich fragen.
Sie begriff sofort, dass er ihr das nur erzählt hatte, um sie zu quälen. Er wollte sie weinen sehen. Zusammenbrechen. Oder hilflos toben. Doch sie würde ihm den Gefallen nicht tun. Sie straffte die Schultern, drängte die aufkommenden Tränen zurück und drehte sich um.
Blohm trat dicht an sie heran, nahm ihr Kinn zwischen seine Finger, so dass sie ihm ins Gesicht sehen musste, als er sagte: »Ich weiß ja nicht, wie du inzwischen zu Karl stehst. Gefühle ändern sich bekanntlich. Jedenfalls hast du keinen Grund, dich darüber zu freuen, dass der gute alte Karl das Zeitliche noch nicht gesegnet hat. Solange er lebt, wirst du unter meiner Aufsicht bleiben. Nicht einmal zu seiner Beerdigung wirst du gehen. Und danach … Nun, wir werden sehen.«
Wie böse er war! Wie perfide! Er wollte sie dazu bringen, sich Karls Tod zu wünschen. Doch das würde nicht geschehen. Sie hatte sich nur gefügt, um Karl vor Blohms Rache zu schützen, und sie bereute es nicht, auch wenn sie Karl und ihre Beziehung zu ihm heute durchaus etwas nüchterner sah. Sie trat einen Schritt zurück und sagte so beherrscht, wie sie es angesichts ihrer inneren Erregung zustande brachte: »Es freut mich, dass es Karl gut geht. Aber selbst wenn er nicht überlebt hätte, würde das für mich nichts ändern. Ich lebe gern hier, es macht mir auch nichts aus, mit wenig Geld auszukommen. Ich brauche weder dich noch Karl noch sonst irgendjemanden.«
Blohm lächelte sein Schlangenlächeln. »Freut mich zu hören. Dann kann ich meine Zuwendungen endlich einstellen.«
Magda zuckte mit den Schultern. Sie hatte keine Ahnung, wie viel von dem Geld, das Simon für sie ausgab, aus Blohms Tasche kam, denn Simon mochte es abstreiten, sie war dennoch überzeugt, dass er mit eigenem Geld einsprang, wenn es am Monatsende nicht reichte.
Blohm schaute auf die Uhr an seinem Handgelenk. »Wir sollten zurück zum Wagen gehen, sonst verpasse ich noch meinen Flieger.«
»Apropos Flieger«, sagte Magda. »Dann hast du keine Angst mehr vorm Fliegen?«
»Wo denkst du hin. Ich schwitze Blut und Wasser da oben. Aber es hilft nichts. Das ist die neue Zeit, das neue Tempo. Man muss sich überwinden und anpassen.«
Sie kehrten um. Nach einer Weile fragte Blohm: »Stimmt es übrigens, was Simon mir erzählt hat? Bist du wirklich zum Judentum konvertiert?«
Simon ließ Magda an der Ecke Ocean Avenue aussteigen. »Vergiss deine Blumen nicht«, sagte Blohm, als sie schon auf dem Bürgersteig stand, und reichte den Strauß aus dem Wagen. Wortlos nahm Magda ihn entgegen, schlug dann die Autotür zu. Die Limousine fuhr weiter Richtung Flughafen Idlewild. Hinter ihr, einen Steinwurf entfernt, ratterte ein Zug der Brighton-Line durch den offenen U-Bahn-Schacht und sandte dabei feine Erschütterungen durch den Untergrund und alle Gebäude, die darauf standen. Anfangs hatte Magda gedacht, sie werde sich daran gewöhnen. Doch das tat sie nicht. Jeder einzelne Zug, jedes Glas und jedes Messer, das im Teller vibrierte, zerrte an ihren Nerven, seit nunmehr über zwei Jahren. Am nächsten Abfallkorb blieb sie stehen, betrachtete den Strauß und sog den intensiven Geruch der Rosen ein. Eigentlich waren sie viel zu schön, um sie wegzuwerfen. Doch sie konnte nichts, was von diesem Mann kam, in ihrer Nähe ertragen.
Während sie zu ihrem Apartmenthaus ging, musste sie wieder an Karl denken. Er bedeutete ihr immer noch viel. Daran würde sich auch nichts ändern. Und doch konnte sie sich nicht mehr vorstellen, wie ein Leben mit ihm hätte aussehen können. Es gab zu vieles, das sie Karl nicht verzeihen konnte. Sie zog die Glastür auf, trat in die Lobby. Am Fahrstuhl hing das altbekannte Schild: Out of service. Die Tür zum Treppenhaus stand offen. Schon auf der ersten Etage brach Magda der Schweiß aus, drei Stockwerke lagen noch vor ihr. Es war nicht die Anstrengung, denn sie war es gewöhnt, viel zu laufen. Doch von Karl zu hören, selbst wenn es Blohm war, der seinen Namen aussprach, hatte Gefühle in ihr geweckt, Sehnsüchte und Begierden, die sie aufwühlten. Sie wünschte, es wäre anders. Vielleicht würde es das eines Tages sein. Bis dahin aber musste sie damit leben wie mit einer unheilbaren Krankheit.
Das Apartment lag am Ende eines langen, schlauchartigen Korridors, in dem nur jede zweite Deckenlampe brannte. Sie kramte den Schlüssel aus der Handtasche. Unter ihr vibrierte der Boden. Wieder ein Zug. Ein Königreich für ein schönes heißes Schaumbad, dachte sie. Doch in ihrem winzigen Badezimmer gab es nur eine Dusche.
Magda wunderte sich, dass sämtliche Schlösser an der Tür abgeschlossen waren. Wahrscheinlich war Agota mit Peterle drüben im Park, und die beiden hatten einen schönen Tag gehabt. Peterle liebte Agota über alles. Magda öffnete die Schlösser und trat ein. Sie hängte den Mantel an die Garderobe in der kleinen Diele und ging ins Wohnzimmer.
»Überraschung!«, schallte es ihr ihr mehrstimmig entgegen. Ein paar Nachbarn und Freunde standen lachend vor ihr. Freudestrahlend löste Agota sich mit zwei gefüllten Sektgläsern aus der Gruppe und kam auf Magda zu. »Hast du wirklich geglaubt, du kannst dich um eine Party drücken? Nicht mit uns, Darling! Nicht an deinem dreißigsten Geburtstag!« Sie gab Magda eines der beiden Gläser. »Happy birthday to you!«
So sehr sich Magda über die kleine Party gefreut hatte, so froh war sie, als sie die letzten Gäste an der Tür verabschieden konnte. Nur Agota und Simon, der nach seiner Fahrt zum Flughafen noch dazugestoßen war, waren noch da. Agota spülte in der Küche Gläser und Besteck, Simon sammelte die Pappteller, Luftschlangen und Geschenkpapiere ein und stopfte sie in einen Müllsack. Magda hatte striktes Verbot, sich an den Aufräumarbeiten zu beteiligen. Sie saß mit einem Drink auf dem Sofa und sah zu, wie Peterle in der Ecke mit seinen Flugzeugen, Jeeps und Panzern Krieg spielte und sie dabei geflissentlich ignorierte. Er wird einmal gut darin sein, Frauen für etwas zu bestrafen, das sie nicht getan haben, dachte sie. Erst als Agota ins Zimmer kam, sprang er auf und lief zu ihr.
»Langsam musst du mal ins Bett, kleiner Kamerad«, sagte Agota. »Soll die Mama …?«
»Nein, du!«, rief Peterle.
Agota schaute Magda fragend an, die nickte nur.
»Aber erst Zähneputzen.«
Die beiden verschwanden ins Bad.
Simon setzte sich zu Magda und zündete zwei Zigaretten an. »Alles okay?«, fragte er, als er ihr eine davon reichte.
»Ein bisschen müde.« Sie stellte ihr Glas ab und zog an der Zigarette. »Wie kommt Blohm eigentlich auf die Idee, ich sei zum Judentum konvertiert?«, fragte sie dann. »Stammt das von dir?«
»Hat er das gesagt?« Simon schaute sie überrascht an. »Da hat er mich wohl falsch verstanden. Aber du hast dich hier überall als Jüdin ausgegeben, also …«
»Also was? Und was heißt überhaupt ausgegeben …«
Hier im Haus lebten viele Juden, und nach ihrem Einzug hatten die Nachbarn sie natürlich gefragt, wer sie sei und woher sie komme. Dass sie eine Deutsche sei, wollte sie auf keinen Fall an die große Glocke hängen. Natürlich hätte sie sagen können, sie stamme aus Österreich oder der Schweiz, doch was, wenn hier wirklich jemand von dort lebte und sich nach Einzelheiten erkundigte? Sie hatte keine große Ahnung von diesen Ländern. Oder wenn jemand ihren Reisepass sah. Daher hatte sie, ohne weiter zu überlegen, gesagt, sie sei eine katholisch getaufte Jüdin aus München. Sie hatte in dem Moment nicht bedacht, dass alle Welt nun wissen wollte, wie sie die Verfolgung überlebt hatte. Ob sie auch in einem der Lager gewesen sei. Nein, log sie, sie sei bei Bekannten auf dem Land untergeschlüpft. Simon nahm es ihr insgeheim übel, dass sie als Deutsche hier das Nazi-Opfer spielte. Er bezweifelte auch, dass ihr das einfach so rausgerutscht war. Und vielleicht hatte er sogar recht.
Schweigend rauchten sie, bis Simon schließlich sagte: »Er ist ganz überraschend gekommen. Noch heute Morgen wusste ich nichts davon.«
»Blohm?« Sie zuckte mit den Schultern. »Ist schon okay.«
Wieder wartete er ein paar Sekunden, ehe er fortfuhr: »Wenn es Blohm nicht mehr gäbe und diese gesamte Situation … was würdest du tun? Wieder nach München zurückgehen?«
Magda überlegte. München – das war Karl. Wollte sie wirklich zu ihm zurück? »Wenn es nur um mich ginge, würde ich bleiben und hier mein Glück versuchen. Aber Peterle … es bricht mir das Herz, ihn leiden zu sehen … und nichts dagegen tun zu können …«
Sie wünschte, sie hätte jetzt Tränen gehabt. Doch sie hatte keine. Und das verschlimmerte alles. Etwas in der Verbindung zwischen Peterle und ihr war gebrochen, vielleicht weil er unglücklich war und sie ihm nicht helfen konnte. Doch statt seine Distanziertheit mit Zuwendung zu beantworten und so sein Vertrauen zurückzugewinnen, verhärtete auch sie sich. Vielleicht hatte sie sich etwas vorgemacht. Peter war nun mal das Ergebnis einer Gewalttat, und diese Tatsache ließ sich nicht auf Dauer verleugnen. Wut und die Verachtung für denjenigen, der sie missbraucht hatte, waren noch in ihr. Sie hatte gedacht, sie könne diese Gefühle in Liebe zu dem Kind verwandeln, das ja nicht für die schrecklichen Umstände seiner Zeugung verantwortlich war. Sie hatte dieses Kind gewollt, ja, aber nicht so, wie andere werdende Mütter ihr Kind wollten, sondern aus Trotz gegenüber ihrem Vergewaltiger und der ganzen Welt. Und nun? Was war daraus geworden?
»Blohm wird nicht zulassen, dass du auch nur den kleinsten deiner Träume verwirklichst«, sagte Simon. »Er wird immer da sein, um das zu zerstören, was du dir aufbaust.«
»Weil du es ihm erzählst.«
»Was denkst du?«, fuhr Simon auf. »Dass ich das gern tue? Ich bin sein Gefangener, genau wie du. Wir kommen aus der Sache nur gemeinsam heraus.«
Magda horchte auf. Sah ihn an. Was meinte er damit? Glaubte er, dass es einen Ausweg gab?
Ehe sie fragen konnte, kam Agota herein. »Er ist sofort eingeschlafen«, sagte sie und setzte sich zwischen Magda und Simon. »Und was heckt ihr beiden Hübschen aus?«
»Wir schmieden einen finsteren Plan, wie wir den alten Blohm um die Ecke bringen«, sagte Simon in scherzhaftem Ton.
»Fein!«, rief Agota begeistert. »Darf ich mitmachen?«
Dienstag, 25. März 1958
München
Der Schuss hallte weithin durch den Perlacher Forst, gefolgt von Knacken im Unterholz, wo aufgeschrecktes Wild das Weite suchte. Pulverdampf stach Karl in die Nase. Das Kreidekreuz am Baumstamm hatte er zwar verfehlt, aber nur ganz knapp. Für diese Distanz kein schlechtes Ergebnis. Seit ihn die Amerikaner nach dem Krieg entwaffnet hatten, hatte er keinen Schuss mehr abgefeuert. Und damals hatte er sich, wie so viele Deutsche, geschworen, es auch nie mehr zu tun. Doch nicht jeder Schwur ließ sich halten. Deutschland hatte wieder eine Armee und war sogar Mitglied eines Verteidigungsbündnisses, und er lernte das Zielen und Feuern nun auch wieder ganz schnell. Die alte Luger und er passten anscheinend gut zusammen. Aber sie weckte auch lange verdrängte Gefühle in ihm. Gefühle, die mit seinem Vater zu tun hatten. Und mit dem Töten. Einen letzten Schuss wollte er noch versuchen. Er legte auf das Kreuz an, zielte und drückte ab. Ein Schlag ging durch sein Handgelenk. Er musste gar nicht hinsehen, er wusste auch so, dass der Schuss nicht einmal den Baum getroffen hatte. Er war nicht zu hundert Prozent bei der Sache gewesen, seine abschweifenden Gedanken hatten die Konzentration gestört. Außerdem war er müde. Zeit, die Schießübungen zu beenden. Er sicherte die Luger, wickelte sie in das Öltuch und steckte sie in seinen Rucksack. Dann zog er die Handschuhe aus und legte sie zu der Waffe.
Als er auf den Waldweg zurückkehrte, begegneten ihm zwei Spaziergänger, ein älteres Pärchen, der Mann mit einem Schmiss auf der Wange. »Haben Sie das auch gehört?«, fragte er ohne Begrüßung, so wie man einen Untergebenen fragte. »Die Schüsse, meine ich.«
»War nicht zu überhören«, antwortete Karl. »Es kam von da drüben.« Er deutete in eine beliebige Richtung.
»Es ist doch noch gar nicht Jagdsaison, oder?«
»Nicht, dass ich wüsste. Vielleicht ein paar Burschen, die einen alten Revolver gefunden haben und die letzten Patronen verballern. Liegen ja sicher noch einige in Gärten oder sonst wo vergraben.«
»Dass bloß nix passiert«, sagte die Frau so bestürzt, als sei schon etwas passiert.
»Wollen wir’s hoffen.«
Karl nickte einen Gruß und ging weiter. Es war klug gewesen, die Schießübungen an mehreren, weit voneinander entfernten Orten zu machen. Vor Augen- und Ohrenzeugen konnte man nie sicher sein, und Aufmerksamkeit war das Letzte, was er jetzt brauchte.
Nach einer knappen halben Stunde erreichte Karl den Waldrand, wo sein Wagen auf ihn wartete. Er blieb stehen, um ihn sich aus der Ferne anzusehen: sein neues Borgward Isabella TS Cabriolet, das er sich vor einer Woche gekauft hatte. Nur ein Jahr alt, also so gut wie neu. Umständehalber abzugeben, hatte in der Anzeige gestanden. Ein guter Preis, trotzdem eigentlich zu teuer für seine Verhältnisse. Doch wozu geizen. Den Taunus hatte er Gisela überlassen, was allerdings ihren heiligen Zorn auf ihn nur geringfügig schmälerte. Mit etwas Zeit und Überlegung würde auch sie erkennen, dass die Trennung für sie beide das Beste war. Denn er war für sie eine Enttäuschung, wenn auch aus anderen Gründen und in anderer Weise, als sie annahm. Er ging auf den Wagen zu, dessen Weiß strahlender war als der Schnee, der am Wegesrand und in Mulden noch vereinzelt anzutreffen war. Magda würde so gut in den rot-weißen Ledersitzen aussehen, vor allem im Sommer, bei offenem Verdeck. Er konnte es kaum erwarten, sie darin zu bewundern. Ihr schwarzes Haar, vom Fahrtwind gestreichelt; das Lächeln ihrer vollen Lippen; die vor Lebenslust sprühenden Augen. Entweder das, dachte er, oder man kann mich darin begraben.
Er legte den Rucksack auf den Beifahrersitz, stieg ein, ließ den Motor an und fuhr los. Der Waldweg endete unmittelbar an der Tegernseer Landstraße, die bis nach Haidhausen führte. In der Steinstraße parkte er den Wagen vor dem Kammererwirt. Es befremdete ihn selbst noch immer, dass er nach so vielen Jahren wieder in diesem Haus eingezogen war. Und manchmal fragte er sich, ob es wirklich eine gute Idee gewesen war, denn der Ort rührte einiges in ihm auf. Genauso wie das Schießen. Aber er sagte sich, dass es wichtig und nötig sei. Eine Art Fegefeuer. Er war zu lange vor zu vielem weggelaufen. Hatte die Schatten seiner Vergangenheit gemieden, aus Angst vor dem, was ihm von dort womöglich entgegensprang. Angst hatte er immer noch. Aber die Angst durfte sein Leben nicht länger bestimmen.
Obwohl der Zimmerschlüssel in seiner Tasche steckte, ging Karl durch die Gaststube, um seine Post mitzunehmen. Lindemeier empfing ihn mit einem säuerlichen Lächeln. Es hatte ihm nicht gefallen, dass einer seiner Pachtherren einzog, er hatte anfangs sogar so getan, als seien alle Zimmer ausgebucht, bis wie durch ein Wunder doch noch ein freies aufgetaucht war. Vielleicht fürchtete er, dass er beaufsichtigt werden sollte oder, schlimmer noch, dass dies der erste Schritt zur Übernahme durch die Eigentümer war. Der Pachtvertrag war schließlich jährlich kündbar. Karl ließ ihn im Ungewissen, damit er sich daran erinnerte, wer der Herr im Haus war. Denn Lindemeier schien noch immer zu glauben, er sei Blohm verpflichtet, nur weil der damals die Verpachtung des Gasthauses eingefädelt hatte.
»Post für mich da?«
Lindemeier holte ein paar Umschläge heraus, die Karl an sich nahm, ohne sie näher zu betrachten. Durch die Tür zum Flur und zur Treppe verließ er den Gastraum. Er hatte dasselbe Zimmer wie vor acht Jahren, als er aus Berlin zurückgekommen war. Doch nur der Raum war derselbe, die Einrichtung war neu und viel moderner. Geblümte Vorhänge, ein neuer Schrank mit Spiegel, ein richtiger Schreibtisch, auf dem die Schreibmaschine thronte, und sogar ein kleines Regal für Bücher.
Karl legte den Rucksack ab und warf die Post auf den Schreibtisch, um sie später zu öffnen. Die Waffe zu reinigen, das war immer das Erste. Doch dann fiel ihm eine Nachsendung ins Auge. Die von einem Postbeamten durchgestrichene, in einer geschwungenen Handschrift geschriebene Adresse weckte seine Aufmerksamkeit. Es befand sich keine Absenderangabe auf dem Umschlag, nur der Poststempel verriet, dass der Brief aus Berlin kam. Er riss den Umschlag auf, zog eine Postkarte heraus. Grüße aus Berlin stand zwischen kleinen Fotografien von Berliner Sehenswürdigkeiten. Auf der Rückseite der Karte war in derselben Handschrift wie auf dem Umschlag geschrieben: Berlin vermisst dich. Berlin braucht dich. Berlin freut sich, dich an Ostern zu sehen. Und vergiss deine Glückszahl nicht: 33456. Karl betrachtete die Absenderangabe auf dem Umschlag: G. W., Berlin (W 30), Rankestraße 27 (Ecke Augsburger Straße). Mit keiner dieser Angaben konnte Karl etwas verbinden. Allerdings stand die Augsburger Straße in dem Ruf, von Bohemiens, Kleinganoven, Prostituierten und Homosexuellen bevölkert zu sein. Und was war mit dieser Glückszahl gemeint? Er glaubte nicht an Horoskope, Wahrsagerei und Glückszahlen, und wer ihn auch nur ein wenig kannte, wusste das. Was hatte das also zu bedeuten? Erlaubte sich da jemand einen Scherz mit ihm? Oder lag eine Verwechslung vor, und die Sendung war gar nicht für ihn bestimmt? Er steckte die Karte zurück in den Umschlag. Am besten fragte er Ludwig, was er von der Sache hielt.
New York City
Ausgerechnet heute, dachte Magda, als sie die Decke von Peterles Bett zurückschlug und den Urinfleck bemerkte. Obwohl es ja nichts Neues war. Der Laundromat verdiente an ihnen ein Vermögen, so viel Bettwäsche und Schlafanzüge, wie sie zu waschen hatten. Die Badezimmertür öffnete sich, Peterle hatte seine ausgiebigen Wasserspiele, die er für Waschen hielt, beendet. Als er Magda an seinem Bett erblickte, blieb er so abrupt stehen, als sei er gegen eine unsichtbare Mauer gerannt. Dann fuhr er herum und rannte zurück ins Bad. Sie hörte nur noch das Schloss einrasten.
Shit, dachte sie und biss sich auf die Unterlippe. Sie wusste genau, wie sie ihn eben angesehen hatte, und auch, wie schwer solche Blicke die Seele eines Kindes verletzten. Zu oft war sie als Kind selbst so angesehen worden, um das jemals vergessen zu können. Doch trotz aller guten Vorsätze konnte sie sie nicht vermeiden. Die Blicke waren stets schneller und immer schon da, bevor sie sich ihrer bewusst wurde.
Sie schaute zum Wecker. Gleich halb acht.
»Peter!«, rief sie. »Jetzt beeil dich schon!«
Mit hektischen Bewegungen riss sie das Laken von der Matratze, die durch eine Gummimatte geschützt wurde, ballte es zusammen und warf es in die Ecke. Dann trat sie vor die Badezimmertür. Drinnen hörte sie ein Plätschern. Wasserspiele Runde zwei. Sie hämmerte gegen die Tür. »Aufmachen, und zwar ein bisschen plötzlich! Hörst du? Ich versohl dir den Hintern, wenn du nicht folgst!«
Ein leises Klicken im Schloss. Magda stieß die Tür auf. Immer noch im Schlafanzug stand Peterle vor ihr und schaute sie mit finsterer Miene an. Wenn er jetzt auch noch anfing zu bocken, wusste sie nicht, was sie tat.
»Ist nicht schlimm, was da passiert ist«, sagte sie. »Aber wir müssen uns jetzt beeilen, verstehst du? Es ist schon spät. Zieh den Schlafanzug aus, du musst unter die Brause.«
Sie wollte ihm beim Ausziehen helfen, doch er stieß ihre Hände weg und schrie sie an: »Das kann ich selber!«
»Dann tu’s auch«, gab sie zurück. »Tick-tack macht die Uhr.«
»Du musst rausgehen.«
»Okay. Aber schnell jetzt. Kein Rumplanschen mehr, verstanden? Ich leg dir deine Sachen zum Anziehen vor die Tür.«
Nachdem sie das erledigt hatte, überprüfte sie noch einmal ihre Fotoausrüstung, die sie gleich mitnehmen wollte: zwei Kameras, verschiedene Objektive, Ersatzfilme in Farbe und Schwarz-Weiß, Blitzlichter. Ein prickelndes Gefühl lief durch sie hindurch. Sie war eingeladen worden, einen Tag lang einen Fotoreporter der Daily News durch die Stadt zu