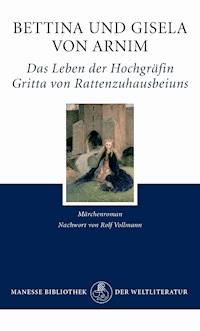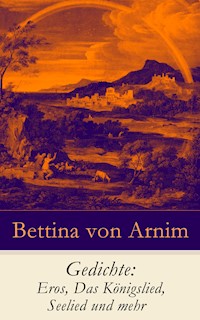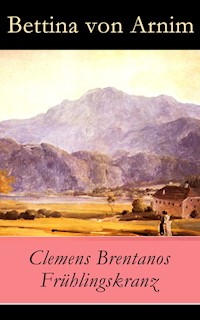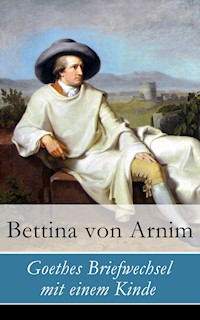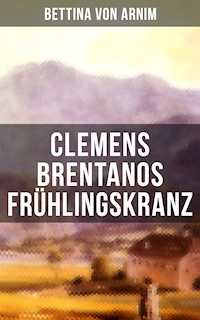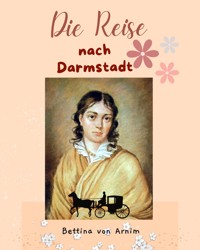Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Bettina beschreibt in dem Briefroman "Dies Buch gehört dem König" mögliche Gespräche zwischen der Mutter Goethes, "Frau Rat" und der Mutter des Königs von Preußen, Konigin Louise, die die Mißstände in Preußen anprangern und Wahrheiten aussprechen, die man als Untertan nicht ohne weiteres sagen darf, etwa, daß der "... Staat für den größten, ja für den einzigen Verbrecher am Verbrechen" gelte. Dieses Buch ist adressiert an König Friedrich Wilhelm IV., den Bettina noch als liberalen Kronprinz kennengelernt hatte. Da die Königin Louise in Bayern eine Art Heilige ist und Bettina damit eine Majestätsbeleidigung begangen hat, wird das Werk in Bayern verboten. (Zitat aus martinschlu.de)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 567
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dies Buch gehört dem König
Bettina von Arnim
Inhalt:
Bettina von Arnim – Biografie und Bibliografie
Dies Buch gehört dem König
Erster Teil
Der Erinnerung Abgelauschte
Gespräche und Erzählungen von 1807
Die Frau Rat erzählt:
Ein vertraut Gespräch. 1807
Zweites Gespräch
Zweiter Teil
Sokratie der Frau Rat
Das Gespräch der Frau Rat mit einer französischen Atzel
Erfahrungen eines jungen Schweizers im Vogtlande
Dies Buch gehört dem König, B. von Arnim
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849604912
www.jazzybee-verlag.de
Bettina von Arnim – Biografie und Bibliografie
Eigentlich Elisabeth von Arnim, Gattin von Achim von Arnim, Schwester von Klemens Brentano, Enkelin der Sophie Laroche, geb. 4. April 1788 in Frankfurt a. M., gest. 20. Jan. 1859 in Berlin, verlebte ihre Jugend teils in einem Kloster, teils bei Verwandten in Offenbach und Marburg, teils in Frankfurt selbst. In ihrer Kindheit schon zu Sonderbarkeiten geneigt, gab sie sich seit ihrer Bekanntschaft mit dem Stiftsfräulein v. Günderode krankhafter Naturschwärmerei hin. Später trat sie mit Goethes Mutter in ein enges Freundschaftsverhältnis und fasste zu Goethe selbst, den sie 1807 persönlich kennen lernte, nachdem sie schon vorher in Briefwechsel mit ihm gestanden hatte, eine Neigung, die der Dichter zwar freundlich duldete, jedoch nicht erwiderte. Nach ihrer Verheiratung (1811) lebte sie, nachdem sie mit Goethe vollständig gebrochen, teils in Berlin, teils in Wiepersdorf, dem Gut ihres Gatten. Erst nach dessen Tode trat sie als Schriftstellerin auf; dabei hegte sie lebhaftes Interesse für die sozial-politischen Zeiterscheinungen, gab sich in Berlin mit großem Eifer der Sorge für Arme und Kranke hin und nahm an den Hoffnungen und Erregungen des Jahres 1848 einen Anteil, der ihr in den höheren Kreisen sehr schadete. Ihre Werke sind geniale Improvisationen, in einem schwunghaften und blütenreichen, oft auch verworren stammelnden und pythisch-dunkeln Stil abgefasst. So das bekannte Buch »Goethes Briefwechsel mit einem Kinde« (Berl. 1835, 3 Bde.), das neben viel Echtem manche freie Ausschmückung enthält; auch das Buch »Die Günderode« (Grünb. 1840, 2 Bde.) bietet eine Mischung[800] von Erinnerungen und Phantasien. Später erschienen: »Dies Buch gehört dem König« (Berl. 1843, 2 Bde.), worin die Frage des sozialen Elends zu lösen versucht wird; »Klemens Brentanos Frühlingskranz« (Charlottenb. 1844), dem Andenken ihres Bruders gewidmet; ferner: »Ilius Pamphilius und die Ambrosia« (Berl. 1848, 2 Bde.), wieder ein »Briefwechsel«, der eine Art Herzensverhältnis (zum jungen Dichter Phil. Nathusius) zum Inhalt hat; endlich die dunkeln »Gespräche mit Dämonen. Des Königsbuchs zweiter Teil« (das. 1852). Ein Plan, der sie bis in die letzten Tage ihres Lebens beschäftigte, war die Errichtung eines großen Goethe-Denkmals, zu dem sie selber die Zeichnungen entworfen hatte, doch wurde nur ein Teil (Goethe und Psyche) von Steinhäuser (s. d.) ausgeführt. Ihre »Sämtlichen Werke« erschienen in 11 Bänden (Berl. 1853). Vgl. »Goethes Briefe an Sophie Laroche und Bettina Brentano« (hrsg. von Loeper, Berl. 1879); »Bettina von A. und Friedrich Wilhelm IV. Ungedruckte Briefe u. Aktenstücke« (hrsg. von Geiger, Frankf. 1902); K. Alberti, Bettina v. A. (Leipz. 1885); Carriere, Bettina v. A. (Bresl. 1887); L. Geiger, Dichter und Frauen (Berl. 1896); Berdrow, Frauenbilder aus der neueren deutschen Literaturgeschichte (2. Aufl., Stuttg. 1900). – Ihre jüngste Tochter, Gisela, Gattin des Kunsthistorikers und Dichters Herman Grimm, geb. 30. Aug. 1827, gest. 4. April 1889 in Florenz, hat sich als dramatische Schriftstellerin versucht; ihre »Dramatischen Werke« erschienen in 4 Bänden (Bonn u. Berl. 1857–75).
Dies Buch gehört dem König
Erster Teil
Da waren Leute – Köhler, die wohnten tief im Wald, wo keine Blütenbäume gedeihen, vielleicht nur Föhren und Tannen. – Dieser armen Leute Kind hatte noch nie eine Kirsche gesehen und keinen rotbackigen Apfel. Auch die Rose war da nicht aufgeblüht. Die Naturgeheimnisse, in denen ihr Zauber sich offenbart und ihr Genuß, waren nicht in die einsame Wildnis eingedrungen. Doch einmal brachte das meilenweit gereiste Familienhaupt vom Markt ein solch Naturgeheimnis mit von der Borsdorfer Art. Mit hochgeröteter Wange, mit schwarzem Butzen schalkhaft lächelnd und edlem Rund sanft geschmeidig nach beiden Polen sich dehnend, wie der große Euler, Neuton und Kopernikus das Weltenall beschreibt. – Warum soll nicht der Apfel nachahmen in seinem Rund, was jedem Geschöpf die Aufgabe ist des Werdens? – So zahlte das weltabgeschlossene Kindesherz mit der Sehnsucht verzehrendem Feuer in der Beschauung des Apfels den Tribut dem Geistesideal der Natur. – Dies brachte den kleinen Erdenwaller bald zu seiner Reise Ziel. Das innere Ideal steigerte seiner Begeisterung Flut; nirgend in der Wüste fand er, wo sie könne an sanftem Ufer sich ebnen: sie brauste hin in die Ewigkeit mit doppeltem Pulsschlag.
Der Unbefangene trat zum Himmelssaal ein, den Apfel in der Hand, er hatte im Tod ihn nicht losgelassen, was man liebt, nimmt man mit, – sein Blick fiel nicht auf des Paradieses Gold- und Rubinfrüchte im smaragdenen Blätterschmuck, in denen die Sonne durch die gewölbten Himmelsfenster sich malt! – Nein! – Wenn man liebt, – wahrhaft – so zieht nicht fremder Reiz ab von langgehegtem Liebesreiz. – Des Allvaters Wunderschöpfungen waren dem liebenden Aug nicht sichtbar, und der Lobgesänge ewiges Echo, das die Himmel durchdröhnt, widerhallte nicht an seinem Ohr. – Nur seines Apfels Schöpfer gewahrte er im Erzeuger aller Majestäten und auch der einsamen Kinder der Wüste. Der weiße Bart umfloß wie Morgenwolken der Menschheit göttlich Ebenbild und sonderte mild den Gott ab von der zerstreuungsvollen Allheit des Himmelsreichtums. Kein Reflex der tausendfarbigen Phantasie wagte in dieser einsamkeitstrahlenden Weißheit des Bartes sich zu spiegeln.
Hier fühlte der Fremdling sich zu Haus! – »Strömt's nicht dort, wie vom Kohlenmeiler der Rauch bei scharfer Morgenluft durchs Gebüsch sich drängt? Und wie an Tanne und Kiefer die aufsteigenden Nebel in Flocken sich hängen?« – Nein, es ist des Bartes Fülle, aus der ein göttlich Menschenantlitz vertraulich ihn anstrahlt. Da reicht er sein Liebstes dem Gott zum Geschenk, wie fromme Kinder tun.
Gottvater nimmt die Gabe, ohne sie zu betrachten. Er kennt seiner Schöpfung Erzeugnisse auswendig. Obschon er vielleicht manchmal in ihrer Beschauung sich auf sich selber besinnt. Er stellte den Apfel hinter sich auf den Kaminsims, sein Blick aber hat den unbefangenen Geber erfaßt, der fortan nicht mehr dem Apfel, sondern dem Erzeuger aller Schönheit in liebender Betrachtung huldigt.
Hätte ein wohlgebildet Rund ebenso dieser Gabe Reiz verliehen, wie der begünstigte Apfel von der Natur ihn empfängt, so wär auch hier wie bei Gottvater auf Nachsicht zu hoffen; und würde auch kein Aufhebens von diesem Apfel gemacht, so wär doch nicht zu fürchten, daß er verachtet die Stufen wieder hinabrolle, die er in begeisterter Geberlust hinangetragen war; am Baum der Erkenntnis gewachsen, der nur lockende Früchte trägt, ist er dennoch schief und krumm geraten, Adam und Eva würden eine Ewigkeit sündenfrei im Schatten des Baumes stehen, ehe sie vor Langeweile in den schlechten Apfel bissen.
Ach, die Langeweile kann schwerlich sich durchschleichen zwischen den Horen, die mit Blumengewinden den ewig geschäftigen Tanz der Musen durchschlingen auf den Stufen des Thrones, eines Königs, der sie liebt. Eifersüchtige Musen! – Ihr machet nicht Platz, – Ihr senket das Haupt nicht und schlummert ein Weilchen, daß die Langeweile könnte kommen mit dem Apfel, der mit Komma und Frag- und Ausrufungszeichen wie mit mancherlei Sommersprossen übersät ist. Und der gütige Humboldt, der Große, der Weise, der auch Geringem sich neigt, möchte der ordnend, mit mildem Wohllaut und mit des Geistes Betonung, den Apfel genießbar machen. Vielleicht! – Ja, vielleicht dann lief er euch Musen den Rang ab.
Der Erinnerung Abgelauschte
Gespräche und Erzählungen von 1807
Wundre Dich über nichts, es ist kein höheres Geheimnis, daß Gott dem Menschen seinen Odem einblase, als daß dies Leben nicht immer die Freiheit atme.
Der Geist der Schönheit in der Form wird im Menschengeist zum Propheten.
Der Geist, in dem die reine Form der Individualität liegt, der ist gesund.
Freiheit allein bringt Geist, Geist allein bringt Freiheit.
Rücksicht ist das Unkraut auf dem Feld der Freundschaft und der Liebe, oft überwuchert es den ganzen Boden, so daß kein gesundes Pflänzchen drauf gedeiht.
Aussprüche der Fr. Rat
Die Frau Rat erzählt:
Es war an einem recht sommerlichen Tag, ich denk nach, was aus dem lieben Sonnenschein all werden soll, den ich da so mutterselig allein in mich fressen muß: – es wird Mittag, die Türmer blasen derweil den Ablaß meiner Sünden vom Katharinenturm herunter. – In dieser Welt, wo Böses und Gutes oft in so herzlicher Umarmung einander am Busen liegen, da haben irdische und himmlische Angelegenheiten gar einen künstlichen Verkehr; an so einem melancholischen Feiertag, da verschmäht der Teufel auch eine falsche Trompet nicht, um den Menschen aus seinem geduldigen Seelenheil herauszublasen, opfre den Verdruß, den du davon spürst, Gott auf, und die Kreide von der Rechnungstafel deiner Sünden ist heruntergewischt, denn lieber als das Sündengestöhn, was falscher klingt als die Sünd selber, will Gott den Teufel falsch blasen hören. Die Langeweil ist nun ganz apart an einem Sonntag in der Stadt Frankfurt, aber gar an so einem lange staubige Sommertag, wo man sich in die Sonn stellt und denkt wie ein angezündt Licht am hellen Tag, vor was bist du da? – alles kann bestehn ohne dich! oder: alles geht ja doch konfus, und mit dem Zweifel, ob der blaue Dunst da oben wohl doch der Himmel sein könnt, streckt man sich am End seiner Erdentage aus den Erdensorgen heraus mit den Himmelssorgen auf dem Herzen und bedenkt nicht, daß alle Sorge Irrtum ist.
An so einem langweiligen Tag also, wie der Türmer wirklich in einer der Musik sehr mißgünstigen Stimmung in die Stadt herunter blies, – ich meint als, wenn mir der jung Wein nur nicht auf dem Faß säuerlich wird: – eine rauhe Halsarie wie heut, und die Sonn schien mir auf die Nas, daß ich nießen mußt, und die Lieschen bekomplimentiert mich da drüber, da schellt's – ich ruf: »Guck einmal, wer's ist.« »Ei, es ist der Frau Bethmann ihr Bedienter, ob Sie wollte heunt nachmittag mit ins Kirschenwäldchen fahren?« – Ei was? – Ei freilich! Was werd ich nicht wollen fahren an diesen einzigen Pläsierort vor allen schönen Orten in ganz Deutschland, wo die Kirschen wie die schönste Rubinen im smaragdnen Blätterschmuck an den Bäumen hängen, wo die Frankfurter Sonnenstrahlen ein Goldnetz durchwirken und der Himmel sein blaues Zelt mit silbernen Wolken drüber spannt. – Jetzt sag ich, wir wollen präzis zwölf Uhr essen, dann wird alles zurecht gemacht zum Abend, wann ich heim komm, da wird meine Wasserflasche hingestellt, das Bett zurecht gemacht, damit mir die Zeit vergeht, bis die Füchserchen angetrabt komme, dann setz ich meine Haub auf, bloß die mit den Spitzen. »Ei, wollen Sie net die mit den Sternblume aufsetzen, die steht schöner!« –
Nein, die will ich nicht aufsetzen, man muß bescheiden sein in der schönen Natur und sie nicht überstrahlen wollen, es gelingt einem doch nicht. Was meint Sie denn, daß so ein Kranz von papierne Blume zu sagen hätt da draußen auf der grünen Wies? Ei, ich setz den Fall, ich könnt der Stadtherd begegnen, so könnt mich ja der Brummelochs mit einem einzige Maul voll Dotterblume, die er vom Weidanger mit seiner lange Zung in einem Hui zusammenrafft und wegschnappt, in die größt Beschämung versetze, daß er frißt und verdaut, was die Frau Rat in Papier nachgemacht zum Putz auf dem Kopf trägt. – Jetzt ohne weiter Federlesen die Spitzehaub eweil auf der grünen Bouteille aufgepflanzt, dann die Filethandschuh ohne Daumen, daß ich sie nicht brauch auszuziehen beim Kirschenessen, das Körbchen nehm ich mit, daß ich kann Kirschen mitbringen – die kleine schwarze Salopp und den Sonneparaplü, denn um die jetzig Sommerzeit kommt häufig so ein klein erquicklich Regenschauerchen mitten durch den Sonnenschein. Da lacht's und flennt's zu gleicher Zeit am Himmel. – Nun ist alles in Ordnung – so wird der Tisch gedeckt und aufgetragen – denn zwölf Uhr ist schon vorbei – was gibt's heut? – »Brühsupp.« Fort mit, ich mag keine. – »Aber Frau Rat, Ihne Ihr Magen!« – Aber ich will keine Supp, sag ich; komm Sie mir nicht an so einem schöne Sommertag mit Ihren Magensorgen an, was gibt's noch? »Stockfisch aufgewärmt von gestern und Kartoffel.« Den Stockfisch laß mir vor der Nas eweg, der paßt nit zu meiner Stimmung, ich mag mir keinen Stockfischgeruch in den Vorgeschmack aufdampfen lassen, den ich von dem Blumenduft draus auf der Wies schon in Gedanken genieß, aber die Kartoffel bring Sie, an denen verunreinigt man die erhabenen Gedanken nicht, die könnt so ein indischer Priester in seiner Verzückung ungestört genieße. – Ich glaub gewiß, die sind aus dem Manna gewachse, das vom Himmel fiel, wie die Juden in der Wüst in der Hungersnot waren, das war so ein verzettelter Mannasame, aus dem sind dann die Kartoffeln gewachsen, die vor aller Hungersnot bewahren. Ja, damals hatten die Juden noch eine Wüst, wo sie sich niederlassen konnten, jetzt ist keine Wüst mehr da, und wann die närrische Häns nicht fliegen lerne wie die Raubvögel, daß sie als manchmal auf eine vorüberfahrende Segelstang sich könne setzen wie die Zugvögel, so weiß ich nicht, wo sie werden bleiben, in der Wüste waren sie nit so gierig, hätten sie damals alles verschlungen, so wär kein himmlischer Mannasamen übrig geblieben, und ich wüßt nicht, was ich heut essen sollt, und jetzt geb nur künftig ohne Widerred allemal dem Betteljud zwei Kreuzer, sooft er kommt, denn wir könne den Juden das nicht genug Dank wissen, daß wir Kartoffeln essen. – Nun war das Essen noch nicht all, es kam noch eine gebratne Taub. – Ich hatte Appetit, fliegt mir grad eine lebendige Taub vors Fenster und rucksert mir lauter Vorwürf ins Herz. Ich fahr ins Kirschenwäldchen, und das arme Tier mit verschränkte Flügel, mit denen es sich hätt können in alle Weltfreude schwingen, liegt in der Bratpfann. Der Christ jagt die halb Natur durch den Schlund, damit er auf der Erd kann bleibe, um sein Seelenheil zu befördern, und dann macht er's grad verkehrt. – Nun kurz, der Vorwurf von der Taub am Fenster lastet mir auf dem Herzen, ich kann keinen Bissen essen. – Die Taub wird unberührt wieder in die Speiskammer gestellt, ich zieh mich derweil an, um der Ungeduld etwas weiszumachen, die Spitzehaub wird von der Bouteille heruntergenommen, aufgesetzt, und die Nachtmütz wird draufgestülpt, damit ich sie heut abend, wenn ich nach Haus komm, gleich auswechsle kann, noch eh Licht kommt; das ist so meine alte Gewohnheit. Nun sitz ich da mit meinem Sonnenschirm in der Hand im besten Humor und lach die Lieschen aus, mit ihrer Angst wegen meinem leeren Magen. – Ich guck auf die Uhr – der Wagen kommt gerappelt, den alten Johann, ein ganz gescheuter Kerl, hör ich schon an seinem gewohnten Gang der Trepp herauf kommen. – Lieschen, geschwind lauf Sie hinaus auf den Vorplatz an die Tür, eh's schellt. Da schellt's schon, die Lieschen macht die Tür auf, da steht ein goldbordierter Herr mit einem dreieckigen Hut und guckt mir ins Gesicht, und mein alter Johann kommt hinten nach. – Ich sag zu dem fremde Wundertier: Sie sind wohl einen unrechten Weg gangen! – und will mich an ihm vorbei machen, aber weil er sagt: »Ich bin geschickt von Ihro Majestät der Frau Königin von Preußen an die Frau Rätin Goethe!« – so guck ich ihn an, ob er wohl nicht recht gescheut wär. – »Und« – fährt er fort – »die königlich Equipage werden um zwei Uhr kommen, um die Frau Rätin nach Darmstadt abzuholen, mit Ihrer Majestät sollen Sie den Tee trinken im Schloßgarten!« – Ich sag: Johann! jetzt hör Er einmal, was das vor Sachen sind! wenn einem eine Bomeranz aus dem blauen Himmel grad auf die Nas fällt, da soll man gleich sein Verstand bei der Hand haben und sie auffangen, das will viel heißen! – Ei, wem hatt ich denn die Kontenance zu verdanken als bloß dem Johann? Der stellt sich an die Seit aus lauter Respekt vor dem unvorhergesehenen Ereignis und guckt mich so feierlich an, daß ich mich gleich besinn, was ich mir und der Einladung schuldig bin; ich guck ihn mit einem Feuerblick an, daß der Kerl in sich geht, denn er war nah dran zu lachen. Ich sag: Mein Herr Kammerherr, oder was Sie vor ein höflicher Beamter sein mögen, rennen Sie nur wieder spornstreichs zur Frau Königin und melden, die Frau Rat werden ihrerseits die Ehre haben, die von der Frau Königin ihr zugedachte Auszeichnung anzunehmen. Und machen Sie nur, daß die Kutsch hübsch akkurat kommt, damit ich auch nicht zu spät komm, da das Warten und Wartenlassen meine Sach nicht ist. – Dabei macht ich so große Augen, daß der preußisch Hoflakei gewiß seine Verwundrung wird gehabt haben über den besondern Schlag Madamen aus der freien Reichsstadt Frankfurt. Man muß seine Zuflucht nehmen zu allerlei Künsten, um seine Würde zu behaupten. Wer kann sonst Religion in die Menschen bringen? Daß so ein Hofschranz Respekt hätte vor einem Bürger, dazu ist er einmal verdorben; da muß man auf Mittel denke, wie er den Kopf ganz verliert und nicht weiß, was er dazu sagen soll. Da fiel mir der Türklopper ein von unserm Aderlaßmännchen, dem Herrn Unser, das ist so ein Löwenfratz, wie sie am Salomon seinem Thronsessel zur Verzierung angebracht sind. Den mach ich nach; – damit jag ich meinen Herold in die Flucht, er nimmt die Bein an den Hals und rennt der Trepp herunter. Ich bleib stockstill stehn, die Lieschen bleibt stehn, der Johann rührt sich nicht vom Fleck, bis wir die Haustür zumachen hören. »Frau Rat,« sagt der Johann, »Sie werden also jetzt unmöglich ins Kirschenwäldchen fahren, und da werd ich dann bestelle, warum Sie nicht mit könne fahren?« Ja, lieber Johann, und bestell Er's doch gleich im Vorbeigehn beim Perückenmacher Heidenblut, der soll gleich kommen, und erzähl Er's unterwegs alle Leut, so was muß stadtbekannt werden. – »Ja, das ist gewiß,« sagt der Johann, »und wenn mir nur das Herz nit bersten wird, bis ich herausgeplatzt bin dermit« – fort ist der Johann. – Nun guck ich mein Lieschen an, die steht vor mir wie nicht recht gescheut und zittert an alle Glieder. Ei, Lieschen, sprech ich voll Verwunderung, wie kommt's, daß Ihr die Haub hinderst der vörderst sitzt, das war doch vorher nicht? – Und ich weiß nicht, wie das möglich war! es ist doch wunderlich, wie bei überraschende Gelegenheiten die Spukgeister sich allerlei Schabernack erlauben mit solchen Leut, die der Sach nicht gewachsen sind. Das war nun mein Lieschen wirklich nicht. Sie konnt nichts finden, weder Zwickelstrümpf noch Schuh, noch sonst ein Kleidungsstück, kein Rock konnt sie mir ordentlich über den Kopf werfen. Wenn ich nun auch den Kopf verloren hätt, ich wär nicht fertig geworden. Jetzt sag ich: Bring Sie mir einmal die gebratne Taub wieder herein, denn ich verspür über die königlich Geschicht ein schreiende Hunger. Und nun schmeiß Sie die Nachthaub von der Bouteille herunter – ich werd aber auch noch meiner Seel den ganzen Stockfisch herunter fressen. Nun schenk Sie mir ein Glas Wein ein, ich muß Feuer in den Adern haben. Der Perückenmacher war gleich herbei, über die unbegreifliche Nachricht hat er in seinem stumme Erstaune mich aufgedonnert, und nun mußt er mir die Haub aufsetze mit den Sternblumen. Es war ein Heidenpläsier, fingerdick Schmink hat er mir aufgelegt, »die Frau Rat sehn superb aus,« sagt der Herr Heidenblut. Und die Liesche stand wie eine Gans vor mir, als ob sie mich nicht mehr kennte. – Nu wir verbringe noch so ein Zeitchen vor dem Spiegel, links die Lieschen mit der verkehrte Haub, denn die hat sie noch nicht Zeit gehabt herum zu kriegen, rechts der Herr Heidenblut mit dem Kamm hinterm Ohr, ganz verzückt in mein Lockenbau, ich in der Front mit einem feuerfarbne Schlepprock mit doppelte Florspitzen, Diamantbracelett, echte Perlen um den Hals, ein Schlupp von Diamante vorgesteckt. Nun es war zum Malen, die drei Personagen da aus dem Spiegel herauslachen zu sehen. Wir wurden ganz lustig und dachten nicht, wie die Zukunft mir auf den Hals gerückt kommt. Wenn ich doch an all die charmante Witze von Heideblut mich noch erinnern könnt, er mußt sich hinstellen, und ich macht mein Probkompliment vor ihm, er versteht's. Er frisiert ja die allerhöchste Theaterprinzesse. – Da kommt's aber wie ein Sturm angerennt und hält still vor der Haustür. Rutsch – vier Pferd und zwei Lakaie hinten drauf, noch ohne den Kutscher. – Jetzt kommen sie herbeigestolpert, faßt mich ein jeder unterm Arm und tragen mich schwebend in die Kutsch. Schad, daß die Fahrt nicht mit meine vier Pferd durch die Bockheimergaß geht am Haus vom Herr Bürgermeister vorbei – aber das Glück bescherte mir unser Herrgott noch, denn kaum biege wir im volle Trab um die Eck, stoßen wir auf die Bürgermeisterskutsch, mitsamt dem Herrn Bürgermeister von Holzhausen drin mit seine zwei Lakaien hinten drauf mit ihre alte abgelebte Haarbeutel, – ich auch – aber meine Haarbeutel waren ganz neu. In vollem Rand fahren wir vorbei am Herrn Bürgermeister, ich grüß feierlich mit dem Fächer und hab das Pläsier zu sehn, daß mein Herr von Holzhausen im Wagen sitzen, versteinert, und sehn mich nicht mit ihre Glotzaugen; er streckt den Kopf heraus, aber umsonst, wir flogen wie der Wind vorbei.
Sollt ich nun alle Gedanken erzählen, die mir auf meiner Reis bis Darmstadt eingefallen sind, so müßt ich lügen, denn ich war sozusagen auf einer Schaukel, die schlecht in Schwung gebracht war, bald flog ich dort hinaus, bald wieder nach der andren Seit, bald dreht sich alles mit mir im Durmel herum, dann dacht ich wieder, wie ich's alles meinem Sohn wollte schreiben, und da fing mir das Herz an zu klopfen. Ich konnt's vor Ungeduld nicht behaglich finden in der Kutsch – ich fing an, die Kastanienbäum zu zählen in der Allee, ich wollt probieren, ob ich's könnt bis hundert bringe, aber ich bracht keine zehn Bäum zusammen, da waren meine Gedanken wieder wo anders. Einmal kam mir ein gescheuter Gedanken, ich dacht, was hab ich dervon? ist mir die Geschicht angenehm? – sollt sie mir nur noch ein einzigmal wieder begegnen, da würd ich mich schon besinne, daß sie mir langweilig wär. Was war das heunt morgen vor eine Komödie, was ist mir vor eine Hitz in den Kopf gestiegen, und nun steck ich in einer zweifelhaftigen Unbequemlichkeit – wo ich da hingeh zu fremde Leut, die gar nicht dran denke, wer da angerumpelt kommt. – Ohne Courage kein Genie, hat mein Sohn immer gesagt, und will ich oder nicht, so muß ich doch einmal die höfliche Schmach auf mich nehmen, mit gesundem Mutterwitz dort in dem Fürstensaal vor einer eingebildten Welt zu paradieren und bloß für eine Fabelerscheinung mich betrachten zu lassen, ja die Welt steht auf einem Fuß, wo keiner an die Wirklichkeit vom andern glaubt und sich doch selber vergnügt fühlt, wenn er nur von so einem Scheinheiligen bescheinigt ist. Nun alleweil kamen wir wie ein Sturmwind angerasselt, ganz erschrocken, daß ich schon da bin, wie ich eben vor Ungeduld mein, es wird nie dazu kommen. Ich steig aus, die Bediente renne wie ein Lauffeuer vor mir weg. Ei, ich kann da nicht wie eine Lerch mich ihnen nachschwingen, ich seh den Augenblick kommen, wo ich weder Bediente noch Weg mehr finden kann. Ich hatt mich ein bißchen versäumt gehabt, die Krumplen aus meinem Staatskleid herauszuschüttlen, da waren sie unterdessen in einer Allee verschwunden wie ein paar Irrlichter, wir waren auseinander kommen, ich geh so dem Gehör nach, immer im Kreis ums Hofgezwitscher herum, immer näher, bis ich endlich aus meinem Schattenreich heraus unter den aufgepolsterte Hoftroß trete. Ich hielt mich im Hintergrund mit meinen Beobachtungsgaben, grad wie ein General bei einer Position, die er dem Feind abluchsen will. Denn überraschen laß ich mich nicht, Mut hab ich, womit ich den Leuten, wenn sie den Kopf verlieren, ihn oft wieder zurecht gesetzt hab. Ja bei Gelegenheiten, von denen eine Frau keinen Verstand zu haben behauptet wird, da steht als dem Mann derselbig ihm allein zugemeßne Verstand still, daß er wehklagt: Ach was fangen wir an? – Da antwortet die Frau und schlägt dem Nagel auf den Kopf. – Die Welt wird immer hinkend bleiben, wenn der Verstand auf dem Mann seiner Seit hinüber hinkt, mit dem er die verrückte Weltangelegenheiten so schwermütig hinter sich drein schleppt. Was batt's den große Weltgeist, daß er das Eheprinzip in sich trägt, wenn der männliche Verstand ein Hagestolz bleibt. – Also die erst Bemerkung, die ich mach in dem mich umgebenden Hofzirkel, ist die, daß meine amarantfarbne Schleppe nicht grad ein guter Passepartout ist, denn nicht ich mit meinem Vierundzwanzigpfünderblick, nicht meine Person wird mit neugierigen Augen betracht, nein, die wird übergesehn, aber meine Falbelas, meine Taille, meine Frangen, von unter herauf, immer höher und höher werd ich scharf examiniert, bis sie endlich zur Florfontage kommen, wo die Sternblumen drauf gepflanzt waren, da halten sie an und entdecken, daß auch ein Gesicht mit kommen war, da prallen sie wie der Blitz auseinander und melden meine Erscheinung der Frau Königin, die kommt mit einem ehrfurchtsvoll gehaltnen Schritt auf mich los, ich – gleich salutiere mit einem Feuerblick vom erste Kaliber, und nun mache alle Leut Platz, und die Frau Königin wie eine schöne Götternymph führt mich an ihre Hand, und der Wind spielt in dem schneehagelweiße Faltengewand, und ein Lockenpaar, das spielt an auf jeden Tritt, den sie tut, und die blendende Stirn und die wunderschön blaßrote Farb von ihrem Gesicht und der freundlich Mund, der ganz voll allerlei Geflüster mich anspricht, verstanden hab ich's nicht, ich war durmlich von Vergnügen und konnt auch nichts weiter vorbringen als: hochgeschätzter Augenblick und liebwerteste Gegenwart und wundernswert vor Götter und Menschen – und wie sie erst die Kett vom Hals sich losmacht und hängt sie mir um, und der ganze Hofkreis trippelt und guckt. Ich hab innerlich den Apoll und den Jupiter angerufen, diese menschenbegreifende Götter sollen mir beistehn, daß ich vernünftig bleib und nicht alles um mich her für wunderliche Tiere halt, denn alle diese vornehmen Hofchargen kamen mir vor wie ein heraldischer Tierkreis. Löwen, Büffel, Pfauen, Paviane, Greife, aber auf ein Gesicht, das menschlich schön zu nennen wär, besinn ich mich nicht. Das mag davon herkommen, weil diese Menschengattung mehr eine Art politischer Schrauben oder Radwerk an der Staatsmaschine und keine rechte Menschen sind. Harthörig, hartherzig, kurzsichtig, stolz und eigensinnig Volk, und es gehört immer der Zufall und ein Verdienst um sie, absonderlich aber ihre eigne Laune dazu und noch gar viel andre Künste, um von ihnen bemerkt und gehört zu werden. Schreien und Poltern oder gar recht haben hilft gar nichts bei ihnen, ja besonders das Rechthaben, das kommt der politische Staatsmaschine ihrer hochtragenden Nas immer in die Quer. »Was soll das heißen, daß man mit seim Recht an die widerrennen tut?« – Sollte das Schicksal diese Nas ausersehen haben, daß sie drauf falle, das wär kein Schaden; darum muß man ihr Platz machen. Ja von solchen ist kein christlich Gesinnung zu erwarten, das ist übrig. Man soll seines Bestallungsbriefes an die Natur sich erinnern, wenn man was mit ihne zu verhandeln hat, damit man an der doppelschneidig-weltbürgerliche Politur nicht auch mit seinen edleren Gesinnungen als ausglitscht. Das fehlte noch, daß man wie ein Lauskerl vor sich selber dasteht und darf nicht in den Spiegel gucken vom eignen Gewissen. – Solche Gedanke hatte ich in dem Tierkreis, wo die Ordensbänder und Stern und goldblitzende Staatsröck rund um mich herum blinkerte wie im Traum, und wie im Traum dacht ich, wenn ich König wär, ich hielt mir eine aparte Insel vor das heraldische Tiervolk, da könnten sie so fortleben, bis sie sterben wollten, aber mir jederzeit unter den Füßen herum zu grabeln, daß man alle Augenblicke über sie stolpern müßt, das litt ich nicht.
Wenn man aber nun bedenkt, daß diese absonderliche Abart von Menschengattung eigens da ist, um mit ihrem närrischen Egoismus die Regenten zu unterstützen bei den Weltangelegenheiten, soll's einem da wundern, wenn da alles, was geschieht, einem wider den gesunde Menschenverstand lauft? Aber das kann einen wundern, daß die Menschen sich's gefallen lassen, von denen sich regieren zu lassen, statt von ihrem angestammte Herrn, dem diese heraldische Untiere den Kopf toll machen. So ein Staatsbeamter ist wie ein Schafbock, vor Begeisterung über sich hat er den Dreher, hoffärtig ist er, vor was hat er Hörner, damit er um sich stoßen kann auf die demütigen Leute, die was von ihm zu fordern haben, ohne daß er acht zu geben braucht, wen's trifft. Ei, was kommst du mir zu nahe, siehst du nicht, daß ich Hörner hab? Das ist die Rechtfertigung. Nichts lieber tut so einer als geschwind Antwort geben, weil er da die Geistesgegenwart mit vorstellen will, und da gibt er denn auch gleich eine abschlägige Antwort, weil er meint, daß er sich damit selber nichts vergibt, und wenn man denn mit seinem guten Recht will eine Einwendung machen, da hilft's eim nichts, denn es ist Staatsprinzip, das Unrecht nicht wieder gut zu machen, an dem halten die närrische heraldische Tiere wie die Klette. Ei warum dann nur? – Nun? – Von leere Köpf, in denen der Hoffart sich eingenistet hat, von große Bäuch, wo viel mühselige Verdauungsgeschäfte drin vorgehn, kann man nicht fordern, daß sie auf Kosten dieser beiden Punkte eine feurige Partei ergreifen für die Menschheit. – Die Exzellenz sein ganz abgeäschert, sagt so ein neuer Kammerdiener in der neuen Livree von einem neuen Beamten. Ei von was? – Ei vom Beraten fürs Menschenwohl, das können sie gar nicht gewohne werden. – Ei, fort mit euch, ihr heraldischen Tiere, auf die grüne Insel, wo eure Vettern, die Paviane, und noch allerlei antediluvianische Naturexkremente vom vorige Jahrtausend als Naturseltenheite bewahrt werden. – – Nun während ich über den Darmstädter Tierkreis meine Glossen mach, wovon ein nicht unbedeutender Teil mit besterntem Bauch mit übereinander schielenden Blicken und überlegenden Mienen des Menschenwohls da unter der Herd herumstolpern, spür ich deutlich, daß ich in dem Verwunderungsstrudel dagesessen hatte wie ein Schaf. Ich schäme mich, daß ich sollte mit einem so unscheinbare Antlitz die freie Reichsstadt vertreten, ich such mir eine andere Physiognomie aus, den Frankfurter Adler. No! – wie der Adler, wenn er Donner und Blitz bewacht, so sitz ich da, und die lieb Sonn, ohne Urlaub zu nemme, setzt sich auf den Reisefuß und ging hinter denen schöne Linde bergab spazieren, und der Mond kam herauf, auf den mit allerlei poetische Spekulatione angespielt wurde, ich mußt lachen über die empfindungsvolle Tonarte, in welche die Gesellschaft da überging. Nun, ich kann nicht alles aus dem Gedächtnis hervorkrame. Ich schwieg in meiner stolze Position still, denn kein Mensch hatte mir ein Wort zu sagen, seit die Paradeßen vorbei war, ich machte daher meine olympische Adlersmiene ohne Unterbrechung fort, und da war auch nicht ein Augenblick, wo ich mir nachgegeben hätt und hätt meinem Alltagsgesicht auch nur erlaubt, durchzublinzeln. – Auf emal! – schlägt mir ein Trompetegeschmetter durchs Ohr, ich fahr aus einem tiefen Schlaf, in dem ich aller Herrlichkeiten, die um mich her vorgingen, vergessen, träume, dem Herrn Heideblut und der Jungfer Lieschen meine erlebte Abenteuer zu erzähle, und ganz vergnügt bin, daß alles überstande ist. – Ja, der vermeint Adler hat den Kopf in sein Spitzekragen gesteckt und war unbewußt seiner entschlummert über dem viele Geschwärm von alle bedeutungsvolle Momente, die mir da in eim Hui ins Alltagsleben hereingestoben kamen, und ich, als in der Meinung, meinen olympischen Götterglanz fortzubehaupten, fall aus der Roll heraus und in Schlaf. Mit natürliche Dinge war's zugegangen; denk sich einer die verschiedene Motionen, dene ich vom frühen Morgen an ausgesetzt gewesen war, es war ja alles wie ein Traum, war's da ein Wunder, daß ich's am End für ein Traum hielt und ruhig weiter schlief? – Und die Nachtdämmerung – und ich saß ja da für gar keine weitere Geschäfte, als bloß Betrachtung anzustelle, was doch die Parze vor eigensinnige Begebenheiten einem in den Lebensfaden einspinne. – No! Als ich mit einem Schrecke durch alle Eingeweide aufwach, hat sich die Szen verändert, das Gebüsch wirft keinen Schatten mehr auf dem leeren Platz, weil alles Tageslicht gewichen war, der Trompetenstoß, der mich von meinem tiefe Schlaf auferweckt hatte, war aus dem Tanzsaal erschallt, wo helle Fackeln brenne, wo die ganze Hofnympheschar in einem schwebende Tanz mit dene heraldische Kavaliere herumhüppen; aus den unterirdische Kellerhäls dampft ein köstlicher Speisegeruch, in denen sieht man die Herrn Köche mit weißen Zipfelmützen munter und alert Fett in das Feuer werfe, daß es hell aufflackert, die Champagnerflasche hört man im Plotonfeuer losknalle, und die Frau Rat, die zu diesem Göttermahl feierlichst eingeholt waren mit vier weiße Schimmel, die sitzen unter einem Vogelkirschbäumche, welche Frucht man bekanntlich nicht esse kann, und spüren Hunger.
Ja! so auf die Probe gesetzt zu werde, wo man sich selber rate soll, ohne daß einem irgendeiner widerspricht, das ist unangenehm; denn im Widerspruch, wenn er einem auch in die Quer kommt, liegt doch eine Entscheidung, man besinnt sich und weiß am End, was man tun soll, aber der Nachttau, von dem mein stolzer Lockenbau einsank, und alle Steifigkeit aus der Florgarnierung war zum Teufel gangen, und nun gar noch haus zu stehn vor dem Tanzsaal mit ringende Hände, nit wisse, wie mer enein solle komme! Dazu geigen die Violinen ein fürchterliche Krätzer ins Ohr. Nun der gute Rat war einmal nit geharnischt und beritten heunt; sogar kein Lust, Tabak zu schnuppe, hatt ich mehr, was mir immer nur in dene verwirrteste Gelegenheite widerfahren ist.
Aber jetzt paßt einmal auf und gebt mir recht, denn obschon meine Erzählung nur die auswendige Welt berührt, so hat sie doch Saiten, die klingen mit großen Weltgedanken zusammen, und fast jedes Lebensereignis gibt uns einen Anlaß, daß wir uns auf eine innere Macht besinne solle und mit der den Lebensweg getrost vorwärts schreiten. Was hilft mich's, den Nachbar zu fragen, wie er an meiner Stelle denken oder handlen würde. Ei wann der sich drauf besinne soll, so konnt auch das Schicksal es ihm passieren lassen; also mit meinen eigentümliche Anlagen muß ich die meinige Begebnisse durchfechte, denn sonst verzettel ich mein Lebenslauf, denn warum? es ist kein Halt drin. Und ein Landesherr stirbt, und es kommt ein anderer, und der fragt, wie hat's mein Papa gemacht, und der hat's wie der Großpapa gemacht, und der wie der Urgroßpapa, und wann stößt man da endlich auf einen, der's aus eignem Gutdünken gemacht hat, und ein solcher war allemal ein großer Mann! ganz neue Anlage mußten dabei in ihm aufwachen. Denn Halt zu machen, dazu ist der Mensch nicht da im Leben, fertig werde kann keiner, jeden Augenblick, und wann es der letzte wär, kann noch was Wichtiges vorgehn in ihm. Was heißt das, ich bin schon zu alt, ich mag nichts mehr lerne! – Ei bist du nicht zu alt zum Atemhole, zum Essen, Trinken und Schlafen, so sei's auch nicht zum Denken. – Wer hat dir dann das weisgemacht, du wärst zu alt? – Was ist alt? – Das ist eine Fabel, oder einer müßt dann Verzicht auf die Ewigkeit tun, wozu ich aber nicht Lust hab, Widerspruch gibt's nicht in der Natur, sie ist konsequent in alle Dinge, so wird sie's auch im Geist sein. Nun, wenn ein Baum blüht, so möge vielleicht noch andere Gründe vorhande sein, die wir jetzt nicht erörtern wollen, aber gewiß ist, daß ein ganz in die Augen fallender Grund der ist, daß aus der Blüt schönes erfrischendes Obst wird; der Natur ihr Ziel ist also das Leben, sie strebt immer nach dem Lebendigen, – so schön und luftig die Blütezeit ist, so muß man doch die Zeit, wo das Obst reift, am meisten respektieren! Denke doch einmal, sie steigt herauf, die Natur, in alle Baumzweigelcher, und so schön ihr die Blütezeit läßt, und so verliebt sie auch in ihre eigne Jugendschönheit ist, sie schüttelt sie sich ab, und nun arbeit sie eifrig in der heißen Sommerzeit, alles sammelt sie, den Regen, den Sonnenbrand, bis sie ihre Kirsche zustand gebracht hat, nun gibt sie's dem Menschen hin; ist das nicht eine große Lehr, die sie gibt? – Heunt noch übersät mit den schönsten roten Korallen, schüttelt sie alle herab dem durstigen Mund; ist das nicht eine zweite gute Lehr, die sie gibt, daß wir alles andern schuldig sind und sollen gar nichts veruntreue den allgemeine Bedürfnisse, und wär aber das dem Wille der Natur nach gehandelt, wenn der Baum mit seim Ältervater seim Backobst sich behängen wollt, statt erst zu blühe zum Ergötzen der Menschheit und dann gesunde Früchte zu tragen zu ihrem Gedeihen? – Ei frag doch so ein närrische Kerl, warum er doch er selber ist? – Denn originaliter zu sein, das ist erst wirklich sein, und das macht erst die Zeit zum Gepräg!
Was hilft's, daß so ein Gesicht von einem Landesherrn auf die Batzen geprägt ist, wenn er der Zeit seinen lebendigen Geist nicht einschmelzen kann, wann er ihrer harmonischen Stimmung fürs große Ganze immer mit der alt Leier den Garaus macht und jeden musikalischen Gedanken durchkreuzt und ein Scharivari draus macht? So geht's aber, wenn einer von dene alte Hutzel und Schnitzel nicht lasse will und durchaus kein frische Äpfel will zulasse zu speise, aus Furcht, es möcht vom Baum der Erkenntnis sein! – Ach welche dumme Weisheit hat doch der Mensch! welche Streiche spielt ihm der Teufel! – Du sollst nicht vom Baum der Erkenntnis essen. Das spielt ihm der Teufel in einer kleine Komödie als ersten Akt der Weltgeschichte vor. Der Mensch muß selbst eine Rolle drin übernehme und sich dabei mit Schimpf und Schand aus dem Paradies hinausjage lasse, und noch heunt hunzen einem die Prediger auf öffentlicher Kanzel aus davor, und doch war's nur ein Schabernack vom Teufel und nicht Schuld vom Menschen!
Ei, Gott wird einem ein Baum vor die Nas stelle mit wohlschmeckende Früchte und die größt Lust einem dazu erwecken und dabei auf Tod und Leben verbiete, sie anzurühren! Ei, wär das nicht Ja und Nein von dem Herrgott gesagt?
Wenn Gott den Baum wachse läßt, und du hast Appetit auf sein Obst, so speise vom Baum der Erkenntnis, so würde zum Beispiel die Sachsenhäuser urteilen und zwar mit Recht, denn alles, was du genießt, muß zur Erkenntnis werden in dir, sonst hast du nicht moralisch verdaut, und alle Früchte, die du aus dir selber reifst im Verstand und im Herzen, die sollen aus dieser Erkenntnis hervorgehen und sollen wieder Früchte der Erkenntnis reifen in den andern, und die ganze Menschennatur soll ein blütevoller und schwer mit Früchte beladener Erkenntnisbaum sein, und so ein Landesvater soll wie ein guter Wirt vom Apfelwein, wenn er die Apfelbaumallee nach Oberrath und Offebach zu gepacht hat, alle schleifende Baumzweig unterstütze und acht gebe, wann der Sturmwind in der Geschichtswelt daher gesaust kommt, daß diese mit Erkenntnisfrüchte beladne Baumzweig nicht knacke und breche von ihrer Wucht oder ihre schöne Früchte müsse fallen lassen, eh sie reif sind, wo sie dann Futter werde vor die Schwein, aber kein seelenerquickende Genuß geben: ja wer weiß, ob wir nicht selbst eine Gattung Gedankenbäum sind, die ihre Früchte tragen für andre Wesen, die in einem Element wohne, was wir nicht gewahr werde, so wie das Kirschenwäldche seine Herzkirsche für die Frankfurter Bürgerschaft trägt und auch nicht den Menschen gewahr wird, der da kommt und seine Frucht abbricht und genießt. Doch kann man das nicht genau wissen, es kann leicht sein, daß der Baum sein Gärtner kennt, der ihn großgezogen hat. Daß ein Baum dem eine Gärtner lieber folgt wie dem andern, davon hat man die deutlichste Beweise, einem Gärtner vor dem andern gedeiht alles, da mag sich einer spät oder früh plagen, hat er die gesegnet Hand nicht, die dem Sträuchelchen die Blume herauslockt, so ist seine Bemühung umsonst.
Nun machen wir den Schluß so weit, nämlich daß, wann die Natur immer einen Zweck hat, auf den sie lossteuert, der Mensch auch einen hat, und wenn ich das Klaglied hör, – ich bin schon zu alt, so muß ich mich betrüben über den Unverstand, bis zum letzte Augenblick, als Gott einem die Geistessonn auf den Gedankenbaum scheine läßt, solle die Gedanke auch sich dran sonne und reifen, und daß es nicht umsonst ist, das beweist uns schon, daß es dem Menschen keine Ruh läßt, alles wissen und fühlen zu wollen, alle Arte von Erfahrung machen zu wollen. Ei, unser Herzog Karl von Weimar hat als so ein junger Fürst, als er war, immer die größt Begierd gehabt, alles zu verstehn. Wie oft hat er zu meinem Sohn gesagt, nur eine vierundzwanzig Stund möcht er in der Höll sein, um alle Erfindungen zu sehen, die von dem Teufel gemacht werden, um sich zu frischieren in ihrem Backofen, und wie sonst ihre Zeit sie zubringen, denn von den Himmelsbewohner wissen wir, daß sie mit Musik sich die Zeit vertreibe, mit Hosiannasinge und Halleluja, was nicht besonders lauten müßt, wenn sie nicht so perfekt wären in ihrem Gesang, wie das vorauszusetze ist, weil sie ewig dasselbige aufspiele, daß sie's vielleicht durch Verfeinerung dahin gebracht haben, daß man sich daran gewöhne kann. Gottlob, die Gewohnheit macht manches erträglich, hab ich mich doch an die verflucht Plump gewöhnt, die in eim fort da vor der Tür greint, wo alle Nachbarsleut Wasser dran hole, so daß, wenn sie an so einem Tag, wo ein Volksfest ist, wo alle Leut aus der Stadt laufe nach der Pfingstweid am Kringelbrunne oder auf den Schneidwall oder ans Stallburgsbrünnche, still steht, so denk ich, was fehlt mir dann heut? – und dann wird mir's als so trocken in der Kehl, als ob ich für alle Leut Durst haben müßt, ich schick herunter und laß eine Bouteille Wasser nach der andern hole, damit ich die Plump gehen hör, so wird Gott sich auch daran gewöhnt haben, daß es ihm ordentlich ungewohnt sein mag, wenn die Lobsänger eine Pause zu machen manchmal genötigt sind. Ob sie sich selber dabei amüsieren, das ist gar keine Frag, denn wir wissen, daß ihnen die Zeit gar schnell vergeht, denn die Heilige und Prophete, die in den Himmel verzückt waren, die haben oft hundert Jahr und länger damit zugebracht, und als sie wieder aus ihrem Himmelsversatz herauskamen, da waren die hundert Jahr herumgelaufen wie ein Augenblick; solche Streich spielen einem die himmlische Freude, aber auf die war der Herzog nicht lüstern zu machen, denn so kurz das war, so war es ihm doch viel zu langweilig, nur nach denen höllische Unterhaltungen hat er gelungert, und da konnt ich ihm hundertmal mein Beispiel mit der Plump vorhalte und mahne, die Gottseligkeit nicht ganz zu beseitigen, damit hat er mich ablaufen lassen. Warum erfinde sich die Engel nichts Gescheuteres, hat er gesagt, damit könne sie kein Hund aus dem Ofen locken, aber wohl hineinjagen, und nun gar der Weihrauch, da will ich lieber dem schlechteste Bauer sein schlechte Kneller riechen.
Der Herzog konnte nun überhaupt kein Weihrauch leide, er liebt die Schmeichelei nicht, er meint, man könne nie mehr wie seine Schuldigkeit tun, er hing an dem merkwürdige biblische Satz: »Und wenn du alles getan hast, so bist du doch nur ein unnützer Knecht.« Und er sagt, er wär bloß neugierig, um der Menschheit durch das, was er lernt, nützlich zu werden, und so möcht er nichts lieber, als nur einmal ins Kindbett komme, damit er wüßt, wie das tät, ich sagt, das Pläsier würde wohl mit dene Hölleunterhaltungen akkordieren.
Sehn Sie, so ein neugieriger Landesherr ist unser Herzog von Sachseweimar in seine junge Jahre gewesen, und er ist es noch, und ich stehe dafür, daß er gar manches erfahren und sich zu eigen gemacht wird haben, was kein anderer ahnt. Dafür könnt ihm aber auch kein anderer was weismachen, meint er. Ja, Gefahr und Not und Angst wär einem am End noch der best Lebensgenuß, wenn man's überstande hätt; ein Soldat freut sich über die Feldzüge, die er gemacht hat, ein Seemann freut sich über den Sturm, den er erlebt hat, und genug, es ist kein Ereignis und Schicksal, was sich nicht auch in eine Nahrung der Seele reifte.
Ja, das sind so Anschauungen und Prinzipien, die könne nur allein aus einem edlen vollkommen feurigen Gemüt hervorgehen, aus einem, der's verdient, ein Fürst zu sein, weil er's nicht scheut, sich und sein Volk dem Welleschlag des Zeitenstroms preiszugeben, wovor die andern all wie die Hasen ausreißen, aber das ist allemal verspielt, und der Herr wie der Untertan sind da beide die elende Sklaven des Zufalls und werden gewöhnlich zermalmt, wenn der reißende Strom einmal plötzlich den Damm durchbricht und mit einer viel gewaltigere Wut auf solche unbewaffnete, im Vorurteil versunkne geistlose Naturen eindringt, als daß sie sich besinnen könnten, wenn sie auch Erfahrung hätten. Die haben sie aber ohnedem nicht, so geht denn Zeit und Ereignis und alles an ihne verloren und zum Henker, bloß weil sie sich fürchte, was Absonderliches zu erleben.
»Aber!« sagte der Herzog, »nur das Absonderliche ist Erlebnis für die feurige lebendige Gemüter. Todigen Menschen aber macht's Leibschneiden, und da sitzt so ein toter Furchthas und hält sich als den Bauch und krümmt sich, bis die Zeit wieder ruhig ist, und schwitzt seinen Kamilletee darzu, während ein Erlebter und Durchlebter wie ein Fisch im Wasser drin herumschnalzt.«
Man könnt das Schicksal mit einem Baum vergleichen, der lauter Früchte reift, um die Seel mit zu nähren. Denn einer, der diese Kost der Drangsale nicht scheut, der wird auch seinem Schicksal gewachsen sein, es zu verdauen.
Aber einer, der kleinlich genug ist, sich vor allem zu fürchte, was hilft es dem, wenn das Meer erbraust in Geburtswehen, und wenn da plötzlich die Inslen der Freiheit neu geboren, und die also gewiß auch keinen Herrn haben, vor seine Augen aus dem Meeresschoß hervorkommen, er wird sich ja fürchte, sich frei zu fühle, und wenn ihm das Herz auch zittert vor heißem Verlangen. Und er wird über den Erdboden auch nicht sich erheben, denn er fürchtet sich vor dem Aufrauschen seiner Flügel, und wird endlich erstarren im Gefühl des Unvermögens, und die Inslen und Meere und blühende Gärten, ja die Welten alle der Geisteskraft, die gehen wieder unter, und das prächtige, aufgeklärte, mit volkreichen Städten prangende Europa, was soll das ihm, und was soll einem solche die Unsterblichkeit, denn er fürcht sich ja vor ihr, er fürchtet sich vor ihrem schimmernden Licht, und seine Gedanken, sie werden nicht am Wolkenfußschemel des Allgeistes anklingen. Was kann er da für sein Volk tun, das so laut, so kräftig und so aufrichtig zu ihm gerufen hat; ja es gehört Mut zur Unsterblichkeit. Alert muß einer sein, denn sie ist kein Schlafmütz, sie ist Allebendigkeit. Aber die Eier, die der Osterhas am Auferstehungstag ins Gras legt, davon kann sie sich nicht erhalten. Bequemlichkeit, Selbstzufriedenheit, Genügsamkeit und wie die überflüssige Bausteine des Glücks all heißen, von denen der Mensch meint, daß sie ein Beweis wären für seine moralische Gesinnungen und ein Lohn dafür, daß er auf dem Weg des Herrn wandle. Ja dergleichen ist für den nicht mehr brauchbar, der der Unsterblichkeit sich hingibt und dem großen Genius vertraut, der ihn mit sich erheben soll, ein solcher sieht wohl ein, daß Glück, was den Menschen seßhaft und preßhaft macht und an der Scholle fesselt, ihn durchaus nicht weiter fördern kann. Und drum kommt mir's auch immer lächerlich vor, wenn man einem Fürsten seine Regententugenden danach abwägt, wie er seinem Volk hat irdische Glücksgüter und Vorteile zugewendt. Laß erst einmal ein Fürsten sein, der diese Schneiderkünsten, sich Lappen und Flicken anderer Länder anzunähen, verachtet, der bloß durch seinen Geist die Oberhand behält, durchgreift durch alle politische Künste dieser fürstlichen Allmeine, indem er die verlornen Rechte der Menschheit wieder einsetzt; und für ihre Würde kämpft. Nun was ist denn Menschenwürde? Daß er allem irdischen Glückswechsel gewachsen sei, also darauf kommt's nicht an, daß man vollauf besitze, was die Not einem entbehren lehrt, sondern auf die freudige Ausdauer im Wechsel der Geschicke, und wenn ich erst den Fürsten sehe, der sein Volk mit sich zusamt erzogen hat auf die freudige Ausdauer im Mißgeschick, dann will ich ihn loben; denn warum, er hat den Geist verstanden, daß dem das irdische Glück überlästig ist, und daß der erstickt im Daunebett des Wohllebens, das ihm über dem Haupt zusammenschlägt, daß er vor lauter Glücksunrat nichts mehr hören und sehen kann.
Wer nicht an die Unsterblichkeit glaubt – wie ich denn weiß, daß die superkluge Menschen als so was denken, dem sag ich, sie will errungen sein, und das ist die Faulheit im Menschen, die das leugnet. Die Unsterblichkeit erringen bei den vielen andren Versäumnissen, die man schon machen muß, wo kommt die Zeit her? fragt ihr – und doch ist's nur Unsterblichkeitsdrang, der den Menschen ins Leben fördert. Eine Seele würde sich dem neunmonatlichen Gefängnis im Mutterleib nicht unterwerfen, wenn sie nicht sich gedrungen fühlte, in diesem menschengebornen Leib ihre Unsterblichkeitsbefähigung zu entfalten. Aber die wahre Unsterblichkeit, das ist der reine große furchtlose Menschensinn, der nicht am Irdischen hängt. – Und ich geb's zu bedenken, daß es kein Rätsel, sondern eine große Dummheit wär, zu glauben, all die Einrichtungen der Natur, die dem guten und gerechten Menschen seine Seel reifen, so daß, der als kleines unverständiges Kind auf die Welt kommt, jetzt als großer Held an den Pforten der Ewigkeit steht! Daß diese Laufbahn umsonst wär? – Hat Gott so ein jung Leben genährt und geschützt, und zwar, damit der Geist soll in ihm Wurzel fassen und blühen und Früchte tragen, so ist das nicht, daß er am End die Menschheit wie eine Mücke totschlägt, die ihn inkommodiert. – Man sagt zwar, Gott hätt die Welt in sechs Tag gemacht und am siebenten Tag geruht, da wär also die Versäumnis nicht zu rechne, zumal die Ewigkeit ohne End sieben Tag liefert, wenn er aus Schöpfungsdrang die ganz Menschheit als wieder einmal in Lehmepatzen zusammendrückt, um nach einem so langweiligen siebenten Ruhetag in den Lehme hineinfahren zu könne und drin herum zu kneten bis über die Ellenbogen, was ich aber für Narrheit halte, und aus mehreren Gründen, denn einmal ist keiner dabei gewesen, der's gesehen hat, daß der Gott sich eine Woch lang mit der Schöpfung abgeäschert hätt, – zweitens hat sich's also einer unterstande, das zu behaupten, was er doch nicht von unserm Herrgott hat vertraut kriegt. – Ein solcher hat es also der Menschheit weisgemacht, und die hat's fest geglaubt und wird's noch glauben. Aber auch das hat sein Nutzen, nämlich daß die Menschheit endlich gewahr werde muß, wie sie sich alles weismachen läßt und fest und steif dran hält, als ob der Gott ihr nicht selbst den Verstand ins Herz gelegt hätt, zu denken? – als ob der Geist nicht dadurch allein, daß er die kühnste Dinge voraussetzt, endlich auf die einzig wahrheitdurchdrungne Position komme sollt, nämlich auf den Begriff, der bloß durch dem Geist seine Freiheit kann geboren werden.
Ich will gern glauben, daß, was Menschen sich einbilden oder erfinden, eine Basis der Wahrheit muß haben, denn warum? – sie sind dazu geführt worden dadurch, daß ihre Unbewußtheit nach Bedürfnis sich in ihrer Anschauung hat ausgestreckt. Da sind denn endlich die Fabeln ihnen auch Wahrheiten geworden. Und was den Aberglauben betrifft, der eigentlich der Garderobemeister ist von diesem Mummeschanz des menschlichen Geistes, so wird den die allgewaltig Zeit schon unter seinem Plunder ganz sanft zu Grab bestatten. Aber zu lang muß es auch nicht dauern, daß man den gute alte Hans über der Erd läßt, um seine Furcht zu respektieren vor dem Lebendigbegrabenwerden. Wann's anfängt in die Luft zu steigen wie Verwesung, was soll man da noch lang Bedenken tragen? Wissen wir nicht, daß dies der Gesundheit unerträglich ist? Also fort mit dir, wie vergnügt sind wir! – Nein, der Glaube soll kein stehender Sumpf werden für die Denkfähigkeiten, daß die am End drin verwesen und verdumpfen.
Also nennt das nicht Aberwitz, daß ich an die sieben Schöpfungstag nicht glauben will. – Denn wer über eine Sach nachdenkt, der hat allemal ein größeres Recht an die Wahrheit, als wer sich von einem Glaubensartikel aufs Maul schlagen läßt. – Ich möcht wissen, ob die Wahrheit nicht eher dem sich hingibt, der mit Eifer um sie wirbt, als dem, der ihr den Rücken dreht und sagt: »Nun ja! es ist schon gut, alles ist abgemacht im Glaubensartikel; belästige mich nicht mit deine Wahrnehmungen, die du mir aufdrängen willst; – ich hab schon Müh genug, an den ewigen Wahrheiten festzuhalten, käme mir nun gar noch Zweifel, so hätt ich kein Brett, ja kein Strohhalm, um mich in dem schwankenden Meer festzuhalten!« – Ei Narr, warum willst du dich festhalten? laß los, du kannst allein schwimmen, aber lern deine Glieder bewegen, und helf dir, und seh, was das für eine Selbstheit erwirbt, wenn man alles lernt berühren und um-und umdrehen von allen Seiten. Ei, die Natur gibt auch nicht alles von selbst hin, nur das Notdürftige – das andre muß man alles erwerben. – Die große Chemiker haben ihr gar sehr müssen unter die Augen sehen, ehe sie ihren Blick verstanden haben. »Schelm!« haben sie als gesagt, »du hast uns wolle was weismachen, aber wart, wir wollen dich schon fassen.« Nun, und da haben sie immer mit neuem Eifer und mit ewige Zweifel über das schon Festgestellte wieder von vorne angefangen, und grad diese Zweifel sind ihr Ruhm geworden. – Also sollt man beinah glauben – alles, was als Glaube festgestellt ist, das wär da, um seine Zweifel dran auszubilden und zum Selbstdenker sich umzuschaffen. Ich bin in meiner Jugend in einem Verein gewesen von einer christlichen, die biblische Wahrheiten in ihrem Lebensumgang verwirklichende Sekte. Es war der Erfahrung wert, zu sehen, von welchem beschränkten Gesichtspunkt wir unserm Schöpfer Himmels und der Erden da haben zugesetzt, was wir da all um des ewigen Heils wille uns zugemut haben, zu tun und zu lassen. Man mußt ein Pinsel oder ein Narr sein dazu. Und ich will's mit Stillschweigen übergehen. Aber wahrhaftig, hörte einer einen Hund bellen in der Nacht, ohne daß sich ein Lärm sonst spüren ließ, so kame einem die wunderlichste Gedanken, als ob es nicht allenfalls der heilig Geist könnt gewesen sein, der in der Mitternacht über den Hof wär kommen und hätt einen Besuch wolle abstatten und die Hund (unserer war noch derzu ein schwarzer Spitz) hätten in der Luft ihn gewittert und verscheucht. Solche Träumereien kamen vor in unsern Konventikeln, alle Augenblick hatte eins ein solch Fabelchen halb erfahren, halb erdacht und eingebildt, das bracht er vor, um die andern mit zu erbauen. Und glaubt man's oder nicht, es geht von Mund zu Mund, und man kreuzt und segnet sich dabei und denkt an die gottlose Zeiten, wo der heilig Geist nicht einmal unberufen ein Viertelstündchen bei einem brüten kann. So geht's aber mit all dergleichen; man behaupt's, aber man glaubt's nicht.
Nur Wahrheiten kann man glauben; aber die kann man auch nicht leugnen, man sitzt mitten drin, als wär man hineingeboren, da wirft der Geist den alten durchlöcherten schmutzigen Madensack des Aberglaubens ab und bewegt sich frei im Geniusgewand der Wahrheit, dieses aber besteht nicht aus einem wollnen Unterrock und Holzpantoffeln der Demut, nicht aus einem Kapereinchen ohne Garnierung, und auch nicht aus West und Hosen und Überrock ohne Knöpf und einer rundlockigten Perück. Nehmt's nicht übel, Hose trägt der Genius nicht und kein grobwollne Unterrock. Seine Montur besteht lediglich in ein Paar ungeheuere mächtige Flügel, mit vollen warmen Daunen der Menschenlieb, mit denen er zu den Bergen sich aufschwingt, wo er die allbelebende Sonn kann heraufkommen sehn, und kann sich satt trinken in ihrem Licht zum Morgengruß, und dann sich erheben und nicht scheuen, hinauf über die gewittertürmenden Wolken sich empor zu tragen. Ha! was kann den starken Fittich brechen dem Luftschiffer, der's verachtet, etwas ins Aug zu fassen, was unter ihm ist, der einer himmlischen Küste zusteuert. »Aufwärts, aufwärts, zu dir, alliebender Vater!« – – Da müßte man doch berechnen, daß es Himmelskräfte gäb, die ihn wieder niederdonnern. Aber was hat er denn verbrochen, daß Gott sollt Alarm blasen lassen gegen ihn? – Denkt ihr euch den Gott nicht besser wie euch selber, die ihr alle Augenblick einen Prozeß habt um einen Grenzstein? – Ach nein! Alles Mein und Dein ist eigentlich nur Täuschung, in der die irdische Menschheit und vorab die Fürsten befangen sind. Die, sag ich, vorab, weil ihre geistige Anschauungen über das Wohl der Menschheit immer eine so allgemeine sein muß, daß Grenzen von Mein und Dein dabei gar nichts bedeuten. Ihr versteht mich nicht? – He! – Laßt euch sagen: – Der Mensch hat einen Leib! – Der Fürst im geistigen Sinn genommen hat auch einen Leib. Das ist sein Volk. Wie käm's euch vor, wenn der Nachbar von euch wollt das Terrain seines Leibes ausdehne und wollt euch ausmerglen, um sich selber fett zu machen? – Nicht besonders schön und edel, und zu riskieren wär, daß er durch diesen unverschämten Unverstand seine Gesundheit, all seine leibliche und geistige Fähigkeiten, verliert. Seht ihr nun, im höhern geistigen Sinn gilt nichts von Mein und Dein. Wie sollte also Gott den Menschengeist zurückdrängen wollen, der im Geniusgewand, also im bräutlichen Gewand an sein Gastmahl tritt? –
Aber wo versteig ich mich hin? Von meiner Enttäuschung über meine Sekte, die gar nicht durch ein himmlisch Donnerwetter, sondern durch eine Nachtmütze ist bewirkt worden, und woraus man schließen kann, daß selbst das Geschick ökonomisch mit denen Werkzeuge seiner Macht umgeht, und daß, wann es einen Floh will knicken, es nicht den Berg Ossa auf ihn fallen läßt. Die Sekte, die hier in meiner liebe Stadt Frankfurt wie die Gretel im Busch aufgeblüht war, mitten im Luxus von den Reifröcken, Paniers, Andrieng, cu de Paris, Fontangen, Merluchen und wie die bizarre Modenamen all zu nennen beliebt werden. Die war nach Art der Quäker; man durfte keine Schminke tragen und nichts von titulierten Kleidungsstücken.
Zusammenkünfte wurden gehalten, darin wurd gesungen und gebetet in einer schläfrig näselnde Weis, worüber ich meine Ungeduld kaum bezwingen konnt, auch Inspirationen, vorab gingen die immer darauf aus, wie das Verhältnis vom Himmelsregiment wär. – Mir wollt darüber nichts einleuchten, ich mußt schweigen, wenn die andern ihr ungereimt Zeug vorbrachten, das war mir unangenehm.
Einmal waren wir über Land gefahren, um in einem Landwirtshaus eine Zusammenkunft zu haben, es war im Frühjahr; bis wir all uns versammelt hatten und in einer Reih dem Tor hinaus gefahren, hatte sich die Zeit verlaufen. Wir rechneten auf den Mondschein, der kam sehr bald und beleuchtet uns das Ziel unserer Reise. Das war eine lange eiserne Stang, die sich ausstreckte vom erste Stock am Wirtshaus, woran das Schild hing. Wenn der Wind ging, so bambelt das Schild hin und her. Wir fahren über einen großen Anger im Abendwind, wir sehen in dem im Mondschein verscheidenden Tagslicht etwas Weißes schweben, was sich von dem schwankenden Schild durchaus nicht entfernen will. Die Wagen halten still, um ihre Bemerkungen zu machen, wer rät nicht auf den heiligen Geist. Voller Verwundrung, daß wir endlich einmal mit leiblichen Augen etwas sehen könne, was der Einbildungskraft zu Hilf kommt, fahren wir auf besagten heiligen Geist los, den wir da um das Wirtshausschild herum schwindlen sehn. Wir fahren in einem Bogen um das große Wiesegeländ herum auf eine Brück zu, so daß wir den heilige Geist am Schild immer im Aug behalte. Alleweil kommt eine Wolk, die den Mond verbirgt, sowie er durchpassiert ist, sehn wir auch den heilige Geist wieder und hören einen gewaltigen Tusch von Pauken und Trompeten blasen, er schwingt sich hinauf aufs Bierschild, als wollt er von dem volle schäumende Becher, der drauf gemalt war, nippen. Wer denkt da nicht an dem Apelles seine gemalte reife Trauben, nach denen die Vögel auch so lüstern waren, daß sie mit ihre krumme Schnäbel ihm habe die gemalte Leinwand durchgepickt? – Doch im Näherrücken will uns die Phantasie nicht mehr so herzlich dienen. Wir wollen gar zweiflen, wir leiden Anfechtung an unserm Glauben, der Teufel spiegelt uns vor als wär's eine Nachtmütz, keiner mag's dem andern bekenne.