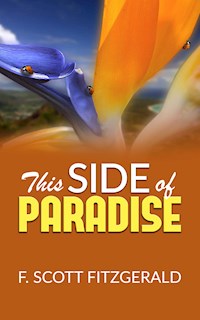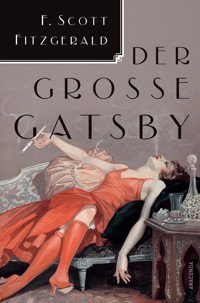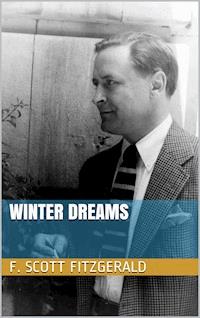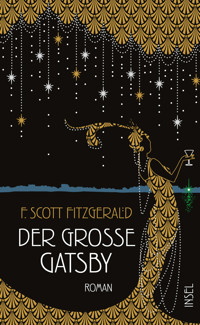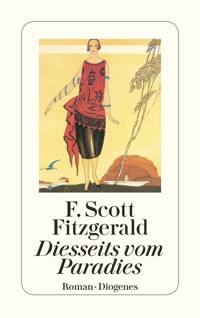
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Amory Blaine ist begabt und privilegiert. Von der Mutter hat er die Überzeugung, zu Höherem geboren zu sein. Er studiert in Princeton, und nach etlichen Flirts begegnet er Rosalind, seiner ersten großen Liebe. Als sie ihn für einen anderen verlässt, zerschellen Amorys jugendliche Ideale. Was bleibt, ist der Alkohol – aber trotz aller Trauer und Enttäuschung auch die Erkenntnis, dass das Leben, so pathetisch und lächerlich es oft scheint, doch lebenswert ist: nicht jenseits, sondern diesseits vom Paradies.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 462
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
F. Scott Fitzgerald
Diesseitsvom Paradies
Roman
Aus dem Amerikanischen von
Martina Tichy und
Bettina Blumenberg
Mit einem Nachwort von
Manfred Papst
Titel der 1920 bei
Charles Scribner’s Sons, New York,
erschienenen Originalausgabe:
›This Side of Paradise‹
Die deutsche Erstausgabe erschien 1988
im Arche Verlag, Zürich
Die Übersetzung wurde für diese Ausgabe von
Hans Christian Oeser überarbeitet
Umschlagillustration: ›An evening dress from
the haute couture house of Jenny,
painted by Brunelleschi for a 1920 edition
of Guirlande des Mois‹, 1920
Librairie Emile Jean-Fontaine & Jules Meynial,
Paris 1917-21
Alle Rechte an dieser Ausgabe vorbehalten
Copyright © 2013
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 23691 0 (2.Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60268 5
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5] …Diesseits vom Paradies sei wie ein Quell!…
Es liegt wenig Trost in der Weisheit.
Rupert Brooke
Erfahrung ist der Name, den so viele Leute ihren Fehlern geben.
Oscar Wilde
[7] Inhalt
Erstes Buch
Der romantische Egoist
I Amory, Beatrice’ Sohn [11]
II Turmspitzen und Wasserspeier [60]
III Der Egoist überlegt [136]
IV Narziss außer Dienst [179]
Zwischenspiel
Mai 1917 – Februar 1919[229]
Zweites Buch
Die Ausbildung des Charakters
I Die Debütantin [245]
II Experimente zur Gesundung [286]
III Jugendliche Ironie [320]
IV Die hochmütige Aufopferung [351]
V Der Egoist wird zum Charakter [366]
Diesseits vom Paradies –
F.Scott Fitzgeralds gefeierter Erstling von Manfred Papst [409]
[9] Erstes Buch
Der romantische Egoist
[11] I
Amory, Beatrice’ Sohn
Amory Blaine glich in jeder Hinsicht seiner Mutter, außer in den wenigen unaussprechlichen Eigenschaften, die ihn interessant machten. Sein Vater, ein erfolgloser und sprachlich unbeholfener Mann mit einer Vorliebe für Byron und der Gewohnheit, über der Encyclopaedia Britannica einzunicken, kam mit dreißig Jahren durch den Tod zweier älterer Brüder, erfolgreicher Chicagoer Börsenmakler, zu Reichtum; im ersten Freudenrausch darüber, dass die Welt nun ihm gehörte, ging er nach Bar Harbor, wo er Beatrice O’Hara traf. Die Folge davon war, dass Stephen Blaine der Nachwelt seine Größe von knapp einem Meter achtzig und eine Neigung zur Unentschlossenheit im entscheidenden Augenblick hinterließ: Beide Anlagen machten sich auch bei seinem Sohn Amory bemerkbar. Viele Jahre hielt er sich in seiner Familie im Hintergrund, eine seltsam farblose Figur, das Gesicht halb verdeckt von schlaffem, seidenweichem Haar; ständig war er damit beschäftigt, für das Wohlergehen seiner Frau zu sorgen, ständig von der Vorstellung gequält, sie nicht zu verstehen und nicht verstehen zu können.
Beatrice Blaine dagegen – das war eine Frau! Frühe Fotografien, auf den Besitzungen ihres Vaters in Lake Geneva, Wisconsin, aufgenommen oder in der Klosterschule Sacro Cuore in Rom, einer erzieherischen Extravaganz, die in [12] ihrer Jugend nur den Töchtern außerordentlich reicher Eltern vorbehalten war, zeigten die erlesene Zartheit ihrer Gesichtszüge, ihre ausgesuchte, bei aller Raffinesse schlichte Garderobe. Eine glänzende Erziehung hatte sie genossen – ihre Jugend verbrachte sie im Glanz der Renaissance und war mit den neuesten Klatschgeschichten über die alteingesessenen römischen Familien bestens vertraut; ihr Ruf als märchenhaft reiches amerikanisches Mädchen verschaffte ihr die Ehre der Bekanntschaft mit Kardinal Vitori, Königin Margherita und anderen hochgestellten Persönlichkeiten, von denen auch nur gehört zu haben bereits eine gewisse Kultiviertheit voraussetzte. In England lernte sie, lieber Whisky-Soda statt Wein zu trinken, und eine Wintersaison in Wien erweiterte ihren Konversationsstoff in zweifacher Hinsicht. Alles in allem erhielt Beatrice O’Hara eine Art von Erziehung, wie es sie nie mehr geben wird: eine Bildung, die Menschen und Dinge ausschließlich danach beurteilte, ob man sie verachten oder sich für sie begeistern konnte; eine Kultur, reich an Künsten und Traditionen, aber arm an Ideen, am Ende jener Epoche, da der große Gärtner die minderwertigen Rosen abschnitt, um eine vollkommene Knospe hervorzubringen.
In einem weniger bedeutsamen Augenblick ihres Lebens kehrte sie nach Amerika zurück, begegnete Stephen Blaine und heiratete ihn; das tat sie nur deshalb, weil sie ein wenig müde war und ein wenig traurig. Ihr einziges Kind wurde in einer lästigen Schwangerschaft ausgetragen und kam an einem Frühlingstag des Jahres 1896 zur Welt.
Schon als Fünfjähriger war Amory ihr ein wunderbarer Begleiter. Er hatte kastanienbraunes Haar und bekam mit [13] zunehmendem Alter schöne große Augen, er steckte voller oberflächlicher, phantastischer Einfälle und hatte eine Vorliebe für hübsche Kleidung. Zwischen seinem vierten und zehnten Lebensjahr reiste er mit seiner Mutter im privaten Eisenbahnwaggon ihres Vaters kreuz und quer durch die Lande: von Coronado, wo sie sich derart langweilte, dass sie in einem vornehmen Hotel einen Nervenzusammenbruch erlitt, bis hinunter nach Mexico City, wo sie sich eine milde, anfallartig auftretende Tuberkulose zuzog. Sie genoss die Wirkungen, die sie damit erzielte, und bediente sich ihrer, bis die Anfälle schließlich untrennbar zu ihrem Leben gehörten – vor allem nach mehreren anregenden Schnäpsen.
So entging Amory dem mehr oder weniger glücklichen Schicksal reicher Sprösslinge, die am Strand von Newport ihre Gouvernanten tyrannisierten, verprügelt wurden, Privatunterricht erhielten oder Vorlesungen aus Do and Dare oder Frank on the Mississippi über sich ergehen lassen mussten; stattdessen biss er im Waldorf geduldige Hotelpagen, überwand allmählich seinen natürlichen Widerwillen gegen Kammermusik und Symphonien und genoss eine sehr spezielle Erziehung durch seine Mutter.
»Amory.«
»Ja, Beatrice.« (Was für ein eigenwilliger Name für seine Mutter; doch sie wollte das so.)
»Liebling, komm um Himmels willen nicht auf den Gedanken, schon aufzustehen. Ich bin sicher, dass diese Frühaufsteherei junge Menschen wie dich nur nervös macht. Clothilde wird dir dein Frühstück heraufbringen lassen.«
»Ist gut.«
»Ich fühle mich sehr alt heute, Amory«, seufzte sie dann [14] mit vornehm gedämpfter Stimme und dem Gesichtsausdruck einer kostbaren Kamee; ihre Hände waren feingliedrig wie die von Sarah Bernhardt. »Meine Nerven sind am Ende – einfach am Ende. Morgen reisen wir ab aus diesem trostlosen Nest, irgendwohin, wo die Sonne scheint.«
Amorys durchdringende grüne Augen schauten durch wirres Haar hindurch auf seine Mutter. Schon in diesem Alter machte er sich keinerlei Illusionen über sie.
»Amory.«
»Was ist denn?«
»Ich möchte, dass du ein kochendheißes Bad nimmst, so heiß, wie du es aushalten kannst, und dich entspannst. Du darfst auch in der Wanne lesen, wenn du möchtest.«
Sie fütterte ihn mit Abschnitten aus den Fêtes Galantes, noch bevor er zehn Jahre alt war; mit elf konnte er sich gewandt, wenn auch nur anekdotenhaft, über Brahms, Mozart und Beethoven unterhalten. Eines Nachmittags, als er allein im Hotel in Hot Springs geblieben war, kostete er von dem Aprikosenlikör seiner Mutter, und da der Geschmack ihm zusagte, bekam er einen gehörigen Schwips. Das machte ihm eine Weile Spaß, als er aber in seiner Begeisterung auch noch eine Zigarette probierte, fiel er einer höchst vulgären und gemeinen Reaktion seines Körpers zum Opfer. Obwohl der Vorfall Beatrice schockierte, amüsierte er sie doch insgeheim und wurde eine ihrer bevorzugten »Storys«, um den Ausdruck einer späteren Generation zu gebrauchen.
»Mein lieber Sohn ist wirklich schon sehr reif für sein Alter«, hörte er sie einmal zu einem ganzen Salon voller ehrfürchtig bewundernder Damen sagen, »und recht charmant – aber doch zart – wir alle sind so zart; hier, wissen [15] Sie.« Ihre Hand lag fächerartig auf ihrem schönen Busen; dann senkte sie die Stimme zu einem Flüstern und erzählte die Geschichte vom Aprikosenlikör. Die Damen amüsierten sich köstlich, denn sie war eine glänzende Erzählerin; doch viele Anrichten wurden in dieser Nacht sorgfältig verschlossen, gegen mögliche Übergriffe eines kleinen Bobby oder einer kleinen Barbara…
Diese Pilgertouren durchs Land hatten die immer gleiche Besetzung: zwei Dienstmädchen, der Privatwaggon, Mr.Blaine, wenn er gerade verfügbar war, und nicht selten ein Arzt. Als Amory an Keuchhusten erkrankte, drängten sich vier Spezialisten um sein Bett und warfen einander giftige Blicke zu; als er Scharlach bekam, waren alles in allem, Ärzte und Krankenschwestern eingerechnet, vierzehn Personen mit seiner Pflege befasst. Doch da Blut dicker ist als Wasser, überstand er auch dies.
Die Blaines waren nicht mit einer Stadt verbunden. Es genügte, dass sie die Blaines aus Lake Geneva waren, mit einer riesigen Verwandtschaft anstelle von Freunden und einem beneidenswerten Ansehen von Pasadena bis Cape Cod. Doch war Beatrice zunehmend auf immer neue Bekanntschaften erpicht, weil sie bestimmte Geschichten aus ihrem Repertoire, wie die ihrer gesundheitlichen Verfassung und deren ständiger Veränderung oder ihre Erinnerungen an die Jahre im Ausland, in regelmäßigen Abständen erzählen musste, um sie wie freudsche Träume abzuschütteln, bevor sie übermächtig wurden und ihre Nerven zerrütteten. Doch an amerikanischen Frauen hatte Beatrice einiges auszusetzen; besonders an denen aus dem Westen, die ständig von einem Ort zum andern zogen.
[16] »Sie sprechen mit einem Akzent, Liebling«, sagte sie zu Amory, »der nirgendwo gesprochen wird, nicht im Süden und nicht in Boston, sie sprechen einfach mit Akzent« – sie verfiel in Träumereien. »Alte, mottenzerfressene Londoner Akzente, die ihre besten Tage hinter sich haben und von jemandem aufgegriffen werden müssen. Sie sprechen wie ein englischer Butler, der ein paar Jahre an der Chicagoer Oper zugebracht hat.« Sie verlor ein wenig den Zusammenhang. »Stell dir vor – so ein Augenblick im Leben einer Frau aus dem Westen – sie hat das Gefühl, ihr Mann sei jetzt wohlhabend genug, dass sie mit – Akzent – sprechen darf – und damit versucht sie, mich zu beeindrucken, Liebling…«
Obwohl sie ihren Körper für eine Ansammlung von Gebrechen hielt, sah sie ihre Seele als ebenso krank an und maß ihr daher große Bedeutung in ihrem Leben zu. Ursprünglich war sie Katholikin; nachdem sie jedoch entdeckt hatte, dass Priester ihr unendlich viel mehr Aufmerksamkeit widmeten, wenn sie gerade dabei war, den Glauben an die allein seligmachende Kirche zu verlieren oder zurückzugewinnen, blieb sie ein für alle Mal bei ihrer zauberhaft schwankenden Haltung. Oft beklagte sie das bourgeoise Verhalten der amerikanischen katholischen Geistlichen und war überzeugt, dass ihre Seele als schwaches Flämmchen auf Roms mächtigem Altar weiterbrennen würde, wenn sie ihr Leben im Schatten der großen Kathedralen des Kontinents zugebracht hätte. Trotz allem waren Priester, neben Ärzten, ihr liebster Zeitvertreib.
»Ach, Bischof Wiston«, pflegte sie zu sagen, »ich will gar nicht von mir sprechen. Ich kann mir vorstellen, wie viele hysterische Frauen aufgeregt an Ihre Tür klopfen und Sie [17] anflehen, simpatico zu sein«, und nach einem kleinen Intermezzo seitens des Geistlichen fuhr sie fort, »aber mein Zustand – lässt sich damit – überhaupt nicht vergleichen.«
Nur Bischöfen und Höherrangigen enthüllte sie ihre klerikale Romanze. Kurz nach ihrer Rückkehr in ihre Heimat hatte sie in Asheville einen gottlosen jungen Swinburne-Verehrer getroffen, dessen leidenschaftliche Küsse und unsentimentale Unterhaltungen ihr entschieden zusagten; sie hatten das Für und Wider dieser Angelegenheit diskutiert und dabei trotz aller Verliebtheit durchaus einen kühlen Kopf bewahrt. Schließlich hatte sie beschlossen, der Sache durch eine Heirat den entsprechenden Hintergrund zu geben, was den jungen Heiden aus Asheville in eine seelische Krise stürzte und ihn in die Arme der katholischen Kirche trieb, und nun war er – Monsignore Darcy.
»Ja, Mrs.Blaine, es ist immer noch nett, mit ihm zusammen zu sein – ganz die rechte Hand des Kardinals.«
»Eines Tages wird Amory zu ihm gehen, das weiß ich«, hauchte die schöne Dame, »und Monsignore Darcy wird so viel Verständnis für ihn haben wie damals für mich.«
Amory war nun dreizehn Jahre alt, recht groß und schlank und hing mehr denn je an seiner keltischen Mutter. Gelegentlich hatte er Privatunterricht erhalten – damit er »den Anschluss behielt« und an jedem Ort »die Arbeit an dem Punkt wiederaufnehmen konnte, wo er zuletzt aufgehört hatte«; doch da keiner seiner Lehrer je den Punkt fand, an dem er aufgehört hatte, war sein Verstand noch in ausgezeichneter Verfassung. Was einige weitere Jahre dieser Lebensart aus ihm gemacht hätten, ist allerdings fraglich. Jedoch kam ihm auf einer Schiffsreise in Richtung Italien mit [18] Beatrice nach vier Stunden auf See ein Blinddarmdurchbruch dazwischen, möglicherweise von zu vielen Mahlzeiten im Bett, und eine Reihe aufgeregter Telegramme nach Europa und Amerika bewirkte, dass das große Schiff, sehr zum Erstaunen der Passagiere, langsam wendete und nach New York zurückkehrte, um Amory am Pier abzusetzen. Man muss zugeben, dass die Geschichte, wäre sie nicht tatsächlich so passiert, kaum besser hätte erfunden werden können.
Nach der Operation erlitt Beatrice einen Nervenzusammenbruch, der eine verdächtige Ähnlichkeit mit Delirium tremens hatte, und Amory musste in Minneapolis bleiben, wo er die folgenden zwei Jahre bei seiner Tante und seinem Onkel verbringen sollte. Und dort packte ihn zum ersten Mal die rauhe, vulgäre Wirklichkeit der westlichen Zivilisation – sozusagen am Schlafittchen.
Ein Kuss für Amory
Seine Lippen kräuselten sich, als er Folgendes las:
Am Donnerstag, dem siebzehnten Dezember, um fünf Uhr, veranstalte ich eine Schlittenpartie, und ich würde mich sehr freuen, wenn Du kommen könntest.
Herzlich
U.A.w.g.
Myra St.
Claire
Er war nun seit zwei Monaten in Minneapolis und hatte sich nach Kräften bemüht, »den anderen Jungs in der Schule« [19] nicht zu zeigen, wie himmelhoch überlegen er sich fühlte, doch war diese Überzeugung auf Sand gebaut. Einmal hatte er sich im Französischunterricht (in diesem Fach besuchte er die höhere Klasse) als Angeber aufgeführt, zur völligen Verwirrung von Mr.Reardon, dessen Akzent Amory mit Verachtung strafte, und zum Vergnügen der ganzen Klasse. Mr.Reardon, der vor zehn Jahren einmal ein paar Wochen in Paris verbracht hatte, rächte sich mit unregelmäßigen Verben, wann immer er sein Buch aufschlug. Ein anderes Mal hatte Amory sich in der Geschichtsstunde aufgespielt, mit ziemlich katastrophalem Erfolg, denn die anderen Jungen waren in seinem Alter, und in der ganzen folgenden Woche warfen sie mit Sticheleien um sich:
»Äh, wissen Sie, ich glaub, dass die amärikaanische Rävolutioon weitgeehend eine Sache der Müttelklasse war«, oder: »Washington stammte aus sehr guter Familie – äh, ziemlich guter –, glaub ich.«
Amory versuchte sehr geschickt, sich dadurch zu retten, dass er von nun an absichtlich die dümmsten Fehler machte. Zwei Jahre zuvor hatte er begonnen, eine Geschichte der Vereinigten Staaten zu schreiben, die zwar nur bis zu den Unabhängigkeitskriegen reichte, von seiner Mutter aber als absolut hinreißend bezeichnet wurde.
Seine größte Schwäche lag im Sport, doch als er begriffen hatte, dass dies der Prüfstein für Macht und Ansehen in der Schule war, bemühte er sich heftig und hartnäckig um überragende Leistungen in den Wintersportarten; tapfer lief er – trotz aller Bemühungen mit schmerzenden und verkrampften Knöcheln – jeden Nachmittag Schlittschuh auf der Lorelei-Eisbahn und fragte sich, wann er wohl einen [20] Hockeyschläger so halten könnte, dass dieser nicht auf unerklärliche Weise zwischen seine Schlittschuhe geriet.
Die Einladung zu Miss Myra St.Claires Schlittenpartie verbrachte den Vormittag in seiner Manteltasche, wo sie einen heftigen Flirt mit einem angestaubten Stück Erdnusskrokant anzettelte. Am Nachmittag beförderte er sie mit einem Seufzer ans Tageslicht und verfasste nach reiflicher Überlegung und einem ersten Entwurf auf dem Einband von Collar und Daniels Latein für Anfänger eine Antwort:
Meine liebe Miss St.Claire,
Ihre wirklich reizende Abendeinladung für nächsten Donnerstagabend hat mich heute Morgen aufs höchste erfreut.
Es wird mich entzücken und mir ein großes Vergnügen sein, Ihnen am nächsten Donnerstagabend meine Aufwartung zu machen.
Ihr sehr ergebener
Amory Blaine
Also schlenderte er am Donnerstag gedankenverloren über die glatten, vom Schnee geräumten Gehwege zu Myras Haus, wo er eine halbe Stunde nach fünf Uhr eintraf, eine Verspätung, von der er annahm, dass seine Mutter sie gutgeheißen hätte. Mit lässig halbgeschlossenen Augen wartete er auf der Treppe vor dem Eingang und plante sorgfältig seinen Auftritt. Er würde gemessenen Schrittes durch die Halle auf Mrs.St.Claire zugehen und genau im richtigen Tonfall sagen:
»Meine liebe Mrs.St.Claire, es tut mir schrecklich leid, [21] dass ich mich verspätet habe, aber mein Dienstmädchen« – hier hielt er inne, weil er merkte, dass es sich um ein Zitat handelte –, »aber mein Onkel und ich hatten noch einen Besuch bei einem Freund zu machen – ja, ganz recht, ich habe Ihre entzückende Tochter in der Tanzstunde kennengelernt.«
Darauf würde er all den steifen kleinen Mädchen mit einer leichten, etwas befremdlichen Verbeugung die Hand geben und den Jungen zunicken, die in kleinen starren Gruppen wie angewurzelt beieinanderstehen würden, um sich wechselseitig zu beschützen.
Ein Butler (einer von dreien in ganz Minneapolis) öffnete schwungvoll die Tür. Amory trat ein und legte Mütze und Mantel ab. Leicht überrascht stellte er fest, dass aus dem anliegenden Raum kein schrilles Stimmengewirr zu hören war, und schloss daraus, dass es wohl sehr formell zuginge. Das fand seine Zustimmung – wie auch der Butler seine Zustimmung fand.
»Miss Myra«, sagte er.
Zu seiner Überraschung setzte der Butler ein entsetzliches Grinsen auf.
»Na klar«, verkündete er, »sie is’ da.« Er war sich nicht bewusst, dass sein missglückter Versuch, Cockney zu sprechen, den ersten guten Eindruck zunichte machte. Amory musterte ihn kalt.
»Aber«, fuhr der Butler fort und hob unnötigerweise die Stimme, »sie is’ die Einzige, wo hier is’. Die Gäste sind schon weg.«
Amory schnappte vor Schreck nach Luft.
»Was?«
[22] »Sie wartet nur noch auf Amory Blaine. Das sin’ Sie doch, oder? Ihre Mutter hat gesagt, wenn Sie bis halb sechs noch auftauchen, soll’n Sie beide mit dem Packard nachkomm’n.«
Amorys Verzweiflung erstarrte mit Myras Erscheinen: Sie war bis zu den Ohren in einen Kamelhaarmantel verpackt und schmollte ganz offensichtlich; nur mit Mühe brachte sie einen freundlichen Ton heraus.
»’n Abend, Amory.«
»’n Abend, Myra.« Seine Lebensgeister schienen ihn völlig verlassen zu haben.
»Na – immerhin hast du hergefunden.«
»Hör zu, ich will’s dir erklären. Du hast wohl nichts von dem Autounfall gehört«, flunkerte er.
Myras Augen öffneten sich weit.
»Was für ein Autounfall?«
»Na der«, fuhr er in seiner Verzweiflung fort, »von mei’m Onkel un’ meiner Tante und mir.«
»Ist jemand umgekommen?«
Amory wartete einen Moment und nickte dann.
»Dein Onkel?« – Entsetzen.
»Nein, nein – nur ein Pferd – so ein graues Pferd.«
In diesem Moment kicherte der irische Butler.
»Vielleicht is’ der Motor kaputt«, mischte er sich ein.
Amory wäre ihm am liebsten ins Genick gesprungen.
»Wir müssen jetzt gehen«, sagte Myra kühl. »Verstehst du, Amory, die Schlitten waren für fünf Uhr bestellt, und alle waren pünktlich, wir konnten wirklich nicht warten…«
»Ich konnte doch nichts dafür, oder?«
»Mama hat gesagt, ich soll noch bis halb sechs warten. [23] Wir holen den Schlitten ein, bevor sie am Minnehaha-Club ankommen.«
Amorys angekratztes Selbstbewusstsein fiel völlig in sich zusammen. Er malte sich die fröhliche Gesellschaft aus, wie sie bimmelnd durch die schneebedeckten Straßen fuhr, dann die Ankunft der Limousine, der Myra und er in einem schrecklichen öffentlichen Auftritt entsteigen mussten, von dreißig vorwurfsvollen Augenpaaren beobachtet, dann seine Entschuldigung – diesmal eine glaubwürdige. Er seufzte laut.
»Was ist?«, fragte Myra.
»Nichts. Ich hab nur gegähnt. Holen wir sie auch wirklich ein, bevor sie ankommen?« Er nährte eine schwache Hoffnung, dass sie zum Minnehaha-Club vorausfahren und dort, traulich vereint vor dem Kamin sitzend, die anderen empfangen könnten; so würde er seine verlorene Fassung wiedergewinnen.
»Aber natürlich, wir holen sie sicher ein – komm, lass uns schnell aufbrechen.«
Er fühlte einen Druck im Magen. Als sie ins Auto stiegen, hatte er bereits einen ziemlich schlagenden Plan gefasst, dem er schnell den Anstrich des Diplomatischen verlieh. Der Plan beruhte auf einigen »Komplimenten«, die er in der Tanzstunde aufgeschnappt hatte und die besagten, dass er »wahnsinnig gut aussah und irgendwie englisch«.
»Myra«, sagte er mit gesenkter Stimme und sorgfältig gewählten Worten, »ich bitte tausendmal um Vergebung. Kannst du mir jemals verzeihen?«
Sie betrachtete ihn ernsthaft, seine tiefen grünen Augen und seinen Mund, die für ihren braven [24] Jungmädchengeschmack den Inbegriff des Romantischen darstellten. Ja, Myra konnte ihm sehr leicht verzeihen.
»Warum – ja – sicher.«
Er sah sie wieder an und schlug dann die Augen nieder. Er hatte lange Wimpern.
»Es ist schlimm mit mir«, sagte er traurig. »Ich bin einfach anders. Ich weiß nicht, warum ich immer solche Fauxpas begehe.« Dann, in verwegenem Ton: »Ich hab einfach zu viel geraucht. Ich hab’s schon am Herzen.«
Myra malte sich eine wilde nächtliche Tabakorgie aus, mit einem bleichen, von nikotinvergifteten Lungen taumelnden Amory. Sie rang ein wenig nach Luft.
»O Amory, lass das Rauchen. Das hemmt dein Wachstum!«
»Es ist mir egal«, beharrte er mit finsterem Blick. »Ich kann nicht anders. Ich hab’s mir nun mal angewöhnt. Ich hab eine Menge Sachen gemacht, wenn meine Familie davon wüsste« – er hielt inne, um ihr Zeit zu geben, sich im Geiste düstere Schreckensbilder auszumalen –, »letzte Woche bin ich im Varieté gewesen.«
Myra war sichtlich überwältigt. Er richtete wieder seine grünen Augen auf sie.
»Du bist das einzige Mädchen in der Stadt, das ich wirklich mag«, rief er in einer plötzlichen Gefühlswallung aus. »Du bist simpatico.«
Myra war nicht sicher, ob sie das wirklich war, aber es klang sehr schick, wenn auch irgendwie ungehörig.
Draußen herrschte tiefe Dunkelheit, und als die Limousine eine plötzliche Wendung machte, wurde sie gegen ihn geworfen; ihre Hände berührten sich.
[25] »Du solltest nicht rauchen, Amory«, flüsterte sie. »Das weißt du doch?«
Er schüttelte den Kopf. »Wen kümmert das schon?«
Myra zögerte. »Mich.«
Irgendetwas regte sich in Amory.
»Von wegen! Du bist doch in Froggy Parker verknallt. Das weiß doch jeder.«
»Nein, bin ich nicht«, kam es sehr langsam.
Schweigen, während Amory vor Spannung zitterte. Myra hatte etwas Faszinierendes an sich in dieser behaglichen Umgebung, die sie vor der Kälte und Dunkelheit draußen schützte. Myra, dieses winzige Kleiderbündel, unter deren Wollmütze blonde Locken hervorquollen.
»Weil ich auch verknallt bin« – er hielt inne, denn aus der Entfernung hörte er das Lachen von jungen Stimmen, und als er durch die gefrorenen Scheiben spähte, erkannte er im Laternenlicht der Straße die dunklen Umrisse der Schlittenpartie. Er musste schnell handeln. Mit krampfhafter Anstrengung fasste er nach Myra und umklammerte ihre Hand – ihren Daumen, um genau zu sein.
»Sag ihm, er soll direkt zum Minnehaha fahren«, flüsterte er. »Ich will mit dir reden – ich muss mit dir reden.«
Myra entdeckte die Schlittengesellschaft, stellte sich einen Augenblick lang ihre Mutter vor und – zum Teufel mit den Konventionen – schaute dann in das Augenpaar neben sich.
»Biegen Sie in diese Seitenstraße, Richard, und fahren Sie direkt zum Minnehaha-Club!«, rief sie durch das Sprechrohr. Amory sank mit einem Seufzer der Erleichterung in die Polster zurück.
[26] Jetzt kann ich sie küssen, dachte er. Wetten, dass ich’s kann. Wetten, dass ich’s kann!
Teils war der Himmel über ihnen kristallklar, teils nebelverhangen, und die Nacht war kalt und vibrierte vor Spannung. Vor der Treppe des Country-Clubs strebten die Straßen auseinander, dunkle Kerben in der weißen Decke; große Schneehaufen säumten die Ränder wie Spuren von riesigen Maulwürfen. Sie blieben einen Moment auf den Stufen stehen und betrachteten den weißen Wintermond.
»So bleiches Mondlicht« – Amory machte eine unbestimmte Geste – »gibt den Menschen etwas Mysteriöses. Du siehst aus wie eine junge Hexe, ohne Hut, mit wirrem Haar« – ihre Hände griffen sofort nach ihren Haaren –, »nein, lass es so, es sieht gut aus.«
Sie stiegen die Stufen hinauf, und Myra führte ihn in das gemütliche kleine Zimmer, das er sich erträumt hatte, wo vor einer riesigen, tiefen Couch ein behagliches Feuer brannte. Einige Jahre später sollte dies ein wichtiger Schauplatz in Amorys Leben werden, die Wiege so mancher Gefühlskrise. Im Augenblick jedoch sprachen sie über Schlittenpartien.
»Es gibt immer ein paar verschüchterte Jungs«, bemerkte er, »die ganz hinten auf dem Schlitten sitzen und auf der Lauer sind und heimlichtun und sich gegenseitig runterschubsen. Und dann ist immer irgendein verrücktes schielendes Mädchen dabei« – er spielte es erschreckend gut vor –, »und die kriegt sich immer mit der Anstandsdame in die Haare.«
»Du bist wirklich ein komischer Junge«, sagte Myra erstaunt.
[27] »Wie meinst du das?« Amory wandte ihr sofort seine Aufmerksamkeit zu; endlich war er auf vertrautem Grund.
»Ach – weil du immer über so verrückte Sachen redest. Willst du nicht morgen mit Marylyn und mir Skilaufen gehen?«
»Bei Tageslicht mag ich Mädchen nicht«, sagte er kurz und fügte hinzu, weil es ihm doch etwas abrupt vorkam: »Aber ich mag dich.« Er räusperte sich. »Ich mag dich am erst- und zweit- und drittliebsten.«
Myras Augen schauten verträumt. Was würde sie Marylyn nicht alles zu erzählen haben! Sie hier auf der Couch mit diesem phantastisch aussehenden Jungen – das kleine Feuer – sie beide allein in dem großen Haus…
Myra kapitulierte. Die Atmosphäre war zu überwältigend.
»Ich mag dich am erst- bis fünfundzwanzigliebsten«, gestand sie mit zitternder Stimme, »und Froggy erst am sechsundzwanzigliebsten.«
Froggy war innerhalb einer Stunde um fünfundzwanzig Plätze zurückgefallen. Bisher hatte er es noch nicht einmal bemerkt.
Aber jetzt war Amory am Zug; schnell beugte er sich zu Myra hinüber und küsste sie auf die Wange. Er hatte noch nie ein Mädchen geküsst und schmeckte neugierig seine Lippen, als hätte er von einer neuen Frucht gekostet. Dann streiften sich flüchtig ihre Lippen wie junge wilde Blumen im Wind.
»Wir sind schlimm«, frohlockte Myra leise. Sie schob ihre Hand in seine, ihr Kopf sank auf seine Schulter. Plötzlich überkamen Amory Ekel, Abscheu und Widerwille [28] gegen den ganzen Vorgang. Er wünschte sehnlichst, weit fort zu sein, Myra nie wiederzusehen, nie wieder jemanden zu küssen; sein Gesicht und ihres, ihre ineinanderverschlungenen Hände standen ihm plötzlich deutlich vor Augen, und er wäre am liebsten aus seinem Körper gekrochen und hätte sich irgendwo versteckt, wo niemand ihn finden konnte – in einem fernen Winkel seiner Seele.
»Küss mich noch einmal.« Ihre Stimme kam aus einer großen Leere.
»Ich will nicht«, hörte er sich sagen. Dann herrschte wieder Schweigen.
»Ich will nicht!«, wiederholte er leidenschaftlich.
Myra sprang auf, die Wangen rosig glühend vor verletzter Eitelkeit; die große Schleife auf ihrem Hinterkopf zitterte vor Mitgefühl.
»Ich hasse dich!«, schrie sie. »Wage es ja nicht, je wieder mit mir zu sprechen!«
»Was?«, stammelte Amory.
»Ich sag’s Mama, dass du mich geküsst hast! Ja, das tu ich! Ja, das tu ich! Ich sag’s ihr, und dann lässt sie mich nie wieder mit dir spielen!«
Amory stand auf und starrte sie hilflos an, als sei sie ein neues Tier, von dessen Vorhandensein auf der Erde er bislang keine Ahnung gehabt hatte.
Plötzlich öffnete sich die Tür, und auf der Schwelle erschien Myras Mutter, die an ihrem Lorgnon nestelte.
»Ah«, sagte sie freundlich und rückte das Lorgnon zurecht, »der Mann am Empfang hat mir gesagt, dass ihr beiden Kinder hier oben seid – wie geht es dir, Amory?« Amory beobachtete Myra und wartete auf den Knall – doch [29] er kam nicht. Der Schmollmund verschwand, die hochrote Färbung verblasste, und Myras Stimme war so friedlich wie ein sommerlicher See, als sie ihrer Mutter antwortete:
»Ach, wir sind erst so spät losgefahren, Mama, dass ich dachte, wir könnten genausogut…«
Von unten hörte er kreischendes Gelächter, und als er Mutter und Tochter schweigend nach unten folgte, drang ihm der fade Geruch von heißem Kakao und Teekuchen in die Nase. Viele Mädchenstimmen summten die Melodie mit, die vom Grammophon ertönte, und allmählich breitete sich eine leichte Röte auf seinem Gesicht aus:
Casey Jones – bestieg die Kabine
Casey Jones – mit seinen Orden in der Hand.
Casey Jones – bestieg die Kabine
Zur letzten Reise ins verheiß’ne Land.
Schnappschüsse vom jungen Egoisten
Amory verbrachte fast zwei Jahre in Minneapolis. Im ersten Winter trug er zu seinem graukarierten Wollmantel und der roten Rodelmütze Mokassins, die ursprünglich gelb gewesen waren, nach reichlicher Anwendung von Schmierfett und Schmutz jedoch als endgültige Färbung ein schmutzig-grünliches Braun annahmen. Sein Hund Count del Monte fraß die rote Mütze, und sein Onkel schenkte ihm stattdessen eine graue, die man übers Gesicht ziehen konnte. Das Problem an dieser Mütze war, dass man hineinatmen musste und der Atem darin zu Eis wurde; eines Tages fror das [30] verdammte Ding an seiner Wange fest. Er rieb sie mit Schnee ab, aber sie färbte sich trotzdem bläulichschwarz.
Count del Monte fraß einmal eine Dose blauer Schuhcreme, ohne Schaden zu nehmen. Später jedoch verlor er den Verstand und fegte wie ein Verrückter die Straße entlang, stieß an Zäune, wälzte sich im Graben und machte sich auf diese exzentrische Weise aus Amorys Leben davon. Amory weinte auf seinem Bett.
»Armer kleiner Count«, schluchzte er, »mein armer kleiner Count!«
Einige Monate später hatte er den Verdacht, dass Counts Amoklauf ein feiner Bluff gewesen war.
Amory und Frog Parker waren überzeugt, dass der großartigste Satz der Weltliteratur im dritten Akt von Arsène Lupin vorkam.
Jeden Mittwoch und Samstag saßen sie zur Matinee in der ersten Reihe. Der Satz lautete:
»Wenn man nicht ein großer Künstler oder ein großer Krieger sein kann, ist es das Beste, ein großer Verbrecher zu sein.«
Amory verliebte sich erneut und schrieb ein Gedicht. Hier ist es:
Marylyn und Sallie,
wie lieb ich beide sie,
doch Marylyn noch mehr
als Sallie, ja, die lieb ich sehr.
[31] Ihn bewegte die Frage, ob McGovern aus Minnesota Erster oder Zweiter bei den amerikanischen Meisterschaften werden würde, wie man Karten und Münzen verschwinden ließ und andere Taschenspielertricks, wie Babys auf die Welt kamen und ob Dreifinger-Brown wirklich ein besserer Pitcher war als Christie Mathewson.
Er las unter anderem: Der Schule zu Ehren, Kleine Frauen (zweimal), Das Bürgerliche Gesetzbuch, Sappho, Der gefährliche Dan McGrew, Die breite Straße (dreimal), Der Untergang des Hauses Usher, Drei Wochen, Mary Ware, The Little Colonel’s Chum, Gunga Dhin, die Polizei-Gazette und Jim-Jam Jems.
Alle seine Lieblingshelden in der Geschichte bezog er aus Hentys Romanen, und besonders begeistert war er von den liebenswerten Mordgeschichten von Mary Roberts Rineheart.
Die Schule ruinierte sein Französisch und lehrte ihn, die klassischen Autoren zu verabscheuen. Seine Lehrer hielten ihn für faul, unzuverlässig und nur oberflächlich begabt.
Er sammelte Haarlocken von vielen Mädchen. Von einigen trug er einen Ring, doch irgendwann bekam er keine Ringe mehr, weil er die nervöse Angewohnheit hatte, auf ihnen herumzubeißen und sie dadurch zu deformieren. Das erweckte offenbar eifersüchtige Verdächtigungen beim nächsten Träger.
Während der Sommermonate gingen Amory und Frog Parker jede Woche ins Theater. Danach schlenderten sie in der [32] milden Abendluft des Augusts nach Hause; gedankenverloren gingen sie über die Hennepin- und die Nicollet-Avenue, mitten durch das fröhliche Menschengewühl. Amory war überzeugt, dass es niemandem entgehen konnte, welch glänzende Zukunft ihm bevorstand, und wenn sich aus der Menschenmenge ein Gesicht nach ihm umwandte und ihn mit vieldeutigem Blick musterte, gab er sich so romantisch wie nur möglich und schwebte auf Wolken vorbei, die für einen Vierzehnjährigen noch auf dem Asphalt liegen.
Wenn er im Bett lag, waren Stimmen vor seinem Fenster zu hören – verschwommene, verklingende, verzaubernde Stimmen –, und bevor er einschlief, träumte er einen seiner liebsten Wachträume: dass er ein großer Stürmer werden würde oder dass er als Auszeichnung für den Kampf bei der japanischen Invasion zum jüngsten General der Welt ernannt werden würde. Immer träumte er, etwas zu werden, nie, etwas zu sein. Auch dies war typisch für Amory.
Der Kodex des jungen Egoisten
Bevor er nach Lake Geneva zurückgerufen wurde, war er zum ersten Mal – verlegen, doch innerlich glühend vor Stolz – in langen Hosen erschienen, ausstaffiert mit einer purpurroten Krawatte und einem Belmont-Kragen mit tadellos gestärkten Ecken sowie purpurroten Socken und einem purpurrot gesäumten Taschentuch, das aus seiner Brusttasche lugte. Darüber hinaus aber hatte er seine erste Philosophie formuliert, einen Kodex von Lebensregeln, den man als eine Art aristokratischen Egoismus bezeichnen könnte.
[33] Ihm war klargeworden, dass sein Hauptinteresse einer gewissen schillernden vielfältigen Persönlichkeit galt, deren Signatur – um keinen Zweifel an ihrer gemeinsamen Vergangenheit aufkommen zu lassen – Amory Blair lautete. Amory bezeichnete sich selbst als einen vom Glück begünstigten jungen Mann mit schier unbegrenzten Entwicklungsmöglichkeiten zum Guten wie zum Bösen. Er hielt sich nicht für einen »starken Charakter«, sondern vertraute auf seine leichte Auffassungsgabe (lernt alles ziemlich schnell) und seine überlegenen geistigen Fähigkeiten (liest eine Menge tiefsinniger Bücher). Er war stolz darauf, dass aus ihm niemals ein handwerkliches oder wissenschaftliches Genie werden würde. Keine anderen Gipfel waren ihm versperrt.
Körperlich: Amory hielt sich für außerordentlich gutaussehend. Zu Recht. Er bildete sich ein, ein vielversprechender Sportler und ein eleganter Tänzer zu sein.
Gesellschaftlich: In diesem Punkt war seine Stellung wohl am stärksten gefährdet. Er sprach sich Persönlichkeit, Charme, magische Anziehungskraft und Selbstsicherheit zu, die Macht, alle gleichaltrigen jungen Männer zu übertrumpfen, und die Gabe, alle Frauen faszinieren zu können.
Geistig: Absolute, über jeden Zweifel erhabene Überlegenheit.
Nun ist es Zeit für ein Geständnis. Amory hatte ein durchaus puritanisch geprägtes Gewissen. Was nicht heißen soll, dass er sich danach richtete – in späteren Jahren tötete er es fast völlig ab –, doch mit fünfzehn bewirkte es, dass er sich für sehr viel verderbter hielt als andere Jungen… Skrupellosigkeit… der Wunsch, andere Menschen in jeder Hinsicht zu beeinflussen, auch zum Bösen… eine gewisse [34] Kälte und ein Mangel an Gefühl, die zuweilen in Grausamkeit ausarteten… ein schwankendes Ehrgefühl… eine unselige Selbstsucht… ein lebhaftes, verstohlenes Interesse an allem, was mit Sex zu tun hatte.
Doch gab es auch einen seltsamen Zug von Schwäche, der seine Pose durchkreuzte… ein hartes Wort von den Lippen eines älteren Jungen (die älteren verabscheuten ihn meistens) genügte, ihm seine Selbstsicherheit zu rauben und ihn empfindlich zu kränken oder ihn vor Angst völlig zu betäuben… er war der Sklave seiner Launen, und obwohl er zu kühnen und verwegenen Taten fähig war, spürte er, dass er weder Mut noch Ausdauer oder Selbstachtung besaß.
Eitelkeit, gedämpft durch Selbstzweifel, wenn nicht gar durch Selbsterkenntnis, dazu die Vorstellung, dass Menschen seinem Willen wie Automaten zu folgen hätten, und das Verlangen, so viele Gleichaltrige wie möglich zu »übertrumpfen« und zu einem unbestimmten Gipfel der Welt vorzudringen… mit diesem Hintergrund trat Amory ins Jünglingsalter ein.
Vorbereitung auf das große Abenteuer
Der Zug fuhr mit hochsommerlicher Trägheit in Lake Geneva ein, und schon sah Amory seine Mutter, die auf dem kiesbestreuten Bahnhofsvorplatz in ihrem Elektromobil wartete. Es war ein uraltes, graulackiertes Elektromobil, eins der ersten Modelle. Der Anblick ihrer Gestalt, wie sie schlank und aufrecht dasaß, und ihres Gesichts, auf dem Schönheit und Würde zu einem Lächeln verschmolzen, an [35] das er sich aus seinen Träumen erinnerte, erfüllten ihn plötzlich mit großem Stolz. Während sie sich flüchtig küssten und er in das Elektromobil stieg, überkam ihn für einen Augenblick die Furcht, er könnte den nötigen Charme eingebüßt haben, um sich mit ihr zu messen.
»Mein lieber Junge – wie groß du geworden bist – schau dich um, ob irgendetwas hinter uns ist…«
Sie blickte nach rechts und links, beschleunigte dann vorsichtig auf eine Geschwindigkeit von etwa drei Stundenkilometern und flehte Amory an, mit auf den Verkehr aufzupassen; an einer belebten Kreuzung ließ sie ihn aussteigen und vorauslaufen, um ihr wie ein Polizist Zeichen zu geben. Man konnte Beatrice wirklich als achtsame Fahrerin bezeichnen.
»Du bist wirklich groß geworden – aber du bist immer noch sehr hübsch – du hast dieses schreckliche Alter wohl übersprungen, oder kommt das erst mit sechzehn; vielleicht auch mit vierzehn oder fünfzehn, ich weiß es nie genau; aber du hast es übersprungen.«
»Mach mich nicht verlegen«, murmelte Amory.
»Aber mein lieber Junge, was trägst du für seltsame Kleidung! Das sieht ja nach einer kompletten Kombination aus, nicht wahr? Ist deine Unterwäsche auch purpurrot?«
Amory grunzte unhöflich.
»Du musst dir bei Brooks ein paar wirklich hübsche Anzüge besorgen. Ach ja, wir müssen heute Abend miteinander reden oder vielleicht morgen Abend. Es geht mir um dein Herz – vermutlich hast du es vernachlässigt – und weißt es gar nicht.«
Amory stellte fest, wie oberflächlich der Einfluss seiner [36] eigenen Generation auf ihn geblieben war. Abgesehen von einem Anflug von Schüchternheit spürte er, dass die alte zynische Verbundenheit mit seiner Mutter nach wie vor ungebrochen war. Dennoch streifte er in den ersten Tagen durch die Gärten und am Seeufer entlang, als sei er von aller Welt verlassen, und fand eine einschläfernde Befriedigung darin, mit einem der Chauffeure in der Garage »Bull«-Zigaretten zu rauchen.
Das ganze Anwesen war etwa sechzig Morgen groß und übersät mit alten und neuen Sommerhäuschen, zahlreichen Springbrunnen und weißen Parkbänken, die einem plötzlich von halb überwachsenen Verstecken aus ins Auge fielen; es gab eine große, sich ständig vermehrende Sippe weißer Katzen, welche die unzähligen Blumenbeete nach Beute durchstreiften und nachts plötzlich schemenhaft vor den düsteren Umrissen der Bäume auftauchten. Auf einem dieser schattigen Pfade passte Beatrice schließlich Amory ab, nachdem Mr.Blaine sich wie gewöhnlich für den Abend in seine Privatbibliothek zurückgezogen hatte. Sie warf Amory vor, dass er ihr aus dem Weg gegangen sei, und nahm ihn dann mit auf ein langes Tête-à-tête im Mondschein. Er staunte über ihre Schönheit, die er von ihr geerbt hatte, über ihren vollendeten Hals und ihre Schultern, über die Anmut einer vom Glück verwöhnten Frau von dreißig Jahren.
»Amory, Liebling«, sagte sie leise und klagend, »ich habe so viel Schweres und Seltsames durchgemacht seit unserer Trennung.«
»Wirklich, Beatrice?«
»Als ich meinen letzten Zusammenbruch hatte« – sie sprach davon wie von einer großartigen Heldentat. [37] »Damals sagten mir die Ärzte« – ihre Stimme nahm einen vertraulichen Ton an –, »dass jeder Mann, der unentwegt so viel getrunken hätte wie ich, ein körperliches Wrack wäre, Liebling – und schon unter der Erde läge – längst unter der Erde läge.«
Amory zuckte zusammen und fragte sich, was wohl Froggy Parker dazu gesagt hätte.
»Ja«, fuhr Beatrice in dramatischem Ton fort, »ich hatte Träume – wundervolle Visionen.« Sie presste ihre Handflächen auf die Augen. »Ich sah bronzefarbene Flüsse, die gegen marmorne Ufer schwappten, und große Vögel, die durch die Lüfte segelten, bunte Vögel, deren Gefieder in allen Regenbogenfarben schillerte. Ich hörte seltsame Musik und gewaltige Trompetenstöße – was ist?«
Amory hatte gekichert.
»Was ist, Amory?«
»Sprich weiter, habe ich gesagt, Beatrice.«
»Das war schon alles – es kam nur immer und immer wieder – Gärten von solcher Farbenpracht, dass unsere dagegen trist erscheinen, und wirbelnde, taumelnde Monde, blasser als Wintermonde, goldener als Spätsommermonde –«
»Geht es dir jetzt wieder gut, Beatrice?«
»So gut es mir eben gehen kann. Niemand versteht mich, Amory. Ich weiß, das wird dir nichts sagen, aber es ist so – niemand versteht mich.«
Amory war sehr gerührt. Er umarmte seine Mutter und rieb den Kopf liebevoll an ihrer Schulter.
»Arme Beatrice – meine arme Beatrice.«
»Erzähl mir etwas von dir, Amory. Hast du zwei schreckliche Jahre hinter dir?«
[38] Amory überlegte, ob er lügen sollte, und entschied sich dagegen.
»Nein, Beatrice, es war eigentlich ganz schön. Ich hab mich der Bourgeoisie angepasst. Bin ziemlich konventionell geworden.« Er war selbst überrascht, dass er so etwas sagte, und stellte sich vor, wie erstaunt Froggy geglotzt hätte.
»Beatrice«, sagte er unvermittelt, »ich möchte woanders zur Schule gehen. Alle gehen jetzt weg von Minneapolis und woanders zur Schule.«
Beatrice sah ihn erschrocken an. »Aber du bist erst fünfzehn.«
»Ja, aber alle gehen mit fünfzehn woanders zur Schule, und ich will das auch, Beatrice.«
Auf Beatrice’ Vorschlag hin wurde das Thema für den Rest des Spaziergangs fallengelassen, doch eine Woche später machte sie ihm eine erfreuliche Mitteilung:
»Amory, ich habe darüber nachgedacht, und du sollst deinen Willen haben. Wenn du noch immer möchtest, kannst du auf eine andere Schule gehen.«
»Ja?«
»Und zwar nach St.Regis in Connecticut.«
Amory wurde ganz aufgeregt.
»Es ist alles in die Wege geleitet«, fuhr Beatrice fort. »Es ist besser, wenn du in eine andere Stadt gehst. Ich hätte dich zwar lieber nach Eton und später aufs Christ Church College nach Oxford geschickt, aber im Augenblick scheint mir das undurchführbar – und die Universitätsfrage lassen wir erst einmal auf sich beruhen.«
»Und was wirst du tun, Beatrice?«
»Weiß der Himmel. Es scheint mein Schicksal zu sein, [39] mein Leben in diesem Land zu fristen. Dabei bedaure ich keine Sekunde, Amerikanerin zu sein – das tun nur sehr gewöhnliche Menschen –, und ich bin sicher, dass unsere Nation groß im Kommen ist – aber« – sie seufzte – »mein Leben hätte in einer älteren, reiferen Zivilisation dahindämmern sollen, in einem Land voller Grün und herbstlicher Brauntöne…«
Amory antwortete nicht, und seine Mutter fuhr fort:
»Was ich bedaure, ist, dass du noch nie im Ausland warst, aber da du ein Mann bist, ist es sicher besser, dass du hier unter dem grimmigen Adler aufwächst – so sagt man doch?«
Amory stimmte ihr zu. Die japanische Invasion hätte nicht ihre Billigung gefunden.
»Und wann beginnt die Schule?«
»Nächsten Monat. Du musst etwas früher Richtung Osten aufbrechen, um deine Aufnahmeprüfung zu machen. Danach hast du eine Woche frei, und ich möchte, dass du dann den Hudson hinauffährst und einen Besuch machst.«
»Bei wem?«
»Bei Monsignore Darcy, Amory. Er möchte dich kennenlernen. Er ist in Harrow gewesen und dann in Yale – bevor er Katholik wurde. Ich möchte, dass er mit dir spricht– er könnte dir eine große Hilfe sein…« Sie strich sanft über sein kastanienbraunes Haar. »Lieber Amory, mein lieber Amory…«
»Liebe Beatrice…«
Also fuhr Amory Anfang September, ausgerüstet mit »sechs Garnituren Sommerunterwäsche, sechs Garnituren [40] Winterunterwäsche, einem Pullover oder T-Shirt, einer Weste, einem Sommermantel, einem Wintermantel etc.« nach Neuengland, in das Land der Schulen.
Dort gab es Andover und Exeter, die an ein längst vergangenes Neuengland erinnerten – heute waren sie große demokratische Einrichtungen, fast wie Colleges; St.Mark, Groton, St.Regis, die sich aus Boston und den Knickerbockerfamilien New Yorks rekrutierten; St.Paul mit seinen phantastischen Eisbahnen; Pomfret und St.George, wohlhabend und gut gekleidet; Taft und Hotchkiss, welche die Reichen aus dem Mittelwesten auf die nächste Stufe der sozialen Erfolgsleiter vorbereiteten, nämlich auf Yale; Pawling, Westminster, Choate, Kent und hundert andere; sie alle ließen Jahr für Jahr denselben gutgebauten, konventionellen, eindrucksvollen Typ durch ihre Mühlen laufen; ihr geistiger Stimulus war die Aufnahmeprüfung ins College; ihre vagen Ziele wurden in Hunderten von Pamphleten verbreitet, mit Titeln wie Leitfaden einer gründlichen geistigen, sittlichen und körperlichen Erziehung zu einem christlich denkenden Gentleman, die den jungen Menschen befähigt, die Probleme seiner Zeit und seiner Generation zu meistern, und ihm eine solide Grundlage in den Künsten und Wissenschaften verschafft.
Amory blieb drei Tage in St.Regis, legte die Prüfung mit spöttischer Selbstsicherheit ab und fuhr dann sofort nach New York, um den versprochenen Besuch abzustatten. Der flüchtige Blick, den er dabei auf die Metropole werfen konnte, machte ihm wenig Eindruck; er hatte nur ein Gefühl von Reinheit beim Anblick der hohen weißen Gebäude, die er im frühen Morgenlicht von einem [41] Dampfer auf dem Hudson aus sehen konnte. Seine Gedanken waren schon so sehr mit Träumen über seine zukünftigen sportlichen Heldentaten in der Schule überlastet, dass er diesen Besuch als ein ziemlich lästiges Vorspiel zu dem großen Abenteuer sah. Das aber erwies sich als falsch.
Monsignore Darcys Haus, ein altes verschachteltes Gebäude, lag auf einem Hügel oberhalb des Flusses, und sein Besitzer lebte dort, wenn er nicht gerade irgendeinen Teil der katholischen Welt bereiste, wie ein exilierter Stuartkönig, der auf seine Wiedereinsetzung wartet. Monsignore war damals vierundvierzig Jahre alt und sprühte nur so vor Energie; er war etwas zu stämmig für die richtigen Proportionen, seine Haare hatten die Farbe gesponnenen Goldes; er war ein glänzender und einnehmender Kopf. Wenn er in vollem Ornat, ganz und gar in Purpur gekleidet, einen Raum betrat, ähnelte er einem Sonnenuntergang von Turner und erregte Bewunderung und Aufmerksamkeit. Er hatte zwei Romane geschrieben: einen äußerst antikatholischen kurz vor seiner Konversion; den anderen fünf Jahre später, in dem er den Versuch unternahm, all seine geschickten Seitenhiebe gegen die Katholiken in noch geschickter versteckte Anspielungen gegen die Episkopalkirche zu verdrehen. Er hatte eine Leidenschaft für Rituale und war aufsehenerregend theatralisch, er liebte die Idee Gottes genug, um im Zölibat zu leben, und seinen Nachbarn auch.
Kinder liebten ihn heiß, weil er selbst wie ein Kind war; junge Leute waren in seiner Nähe ausgelassen, weil er selbst noch ein junger Mann war und ihn nichts schockieren konnte. Am rechten Ort und zur rechten Zeit hätte er ein Richelieu sein können – doch wie die Dinge standen, war er [42] ein sehr moralischer, sehr religiöser (wenn auch nicht übermäßig frommer) Geistlicher, der ein großes Geheimnis um längst eingerostete »gute Drähte« machte und für alle Freuden des Lebens empfänglich war, wenn er sie auch nicht vollständig auskostete.
Amory und er verstanden sich auf Anhieb – der joviale Prälat, der mit seiner eindrucksvollen Erscheinung auf jedem Diplomatenball hätte glänzen können, und der grünäugige junge Mann in seinen ersten langen Hosen waren schon nach halbstündiger Unterhaltung innerlich übereingekommen, wie Vater und Sohn miteinander zu reden.
»Mein lieber Junge, seit Jahren warte ich darauf, dich endlich kennenzulernen. Nimm dir einen Sessel, und lass uns ein bisschen plaudern.«
»Ich komme gerade aus der Schule – St.Regis, wissen Sie.«
»Ja, deine Mutter hat mir davon erzählt – eine bemerkenswerte Frau; willst du eine Zigarette, du rauchst doch sicher. Ja, wenn du so bist wie ich, dann sind dir Naturwissenschaften und Mathematik sicher ein Greuel…«
Amory nickte heftig.
»Kann ich alles nicht ausstehen. Englisch und Geschichte auch nicht.«
»Natürlich nicht. Eine Zeitlang wirst du die ganze Schule abscheulich finden, aber ich bin trotzdem froh, dass du nach St.Regis gehst.«
»Wieso?«
»Weil es eine Schule für Gentlemen ist und dich die Demokratie noch nicht zu fassen kriegt. Das kommt noch früh genug auf dem College.«
[43] »Ich möchte nach Princeton gehen«, sagte Amory. »Ich weiß nicht, wieso, aber ich stell mir die Harvard-Leute alle als Weichlinge vor, so wie ich früher war, und die aus Yale tragen alle weite blaue Pullover und rauchen Pfeife.«
Monsignore schmunzelte.
»Ich war auch dort, musst du wissen.«
»Ach, aber Sie sind anders – Princeton stell ich mir lässig vor, gutaussehend und aristokratisch – wie einen Frühlingstag, wissen Sie? Harvard klingt so nach Eingesperrtsein…«
»Und Yale ist wie November, kühl und tatendurstig«, vollendete Monsignore.
»Genau.«
Sie hatten sich blitzschnell in eine Vertrautheit begeben, aus der sie nicht wieder auftauchten.
»Ich war immer für ›Bonnie Prince Charlie‹«, verkündete Amory.
»Ja, natürlich – und für Hannibal…«
»Ja, und für die Südstaatenkonföderation.« Er hatte Zweifel daran, ob er ein irischer Patriot sein sollte – Ire zu sein hatte für ihn einen Beigeschmack des Gewöhnlichen –, doch Monsignore versicherte ihm, dass die Iren ganz reizende Leute seien und das romantische Irland eine verlorene Sache, das ihm stets ein besonderes Anliegen sein solle.
Nach einer Stunde höchst angeregter Unterhaltung bei etlichen Zigaretten hatte Monsignore unter anderem erfahren, dass Amory nicht im katholischen Glauben erzogen worden war, was ihn überraschte, ohne ihn sonderlich zu schockieren; er kündigte Amory einen weiteren Gast an – den Ehrenwerten Thornton Hancock aus Boston, ehemals Vertreter bei den Haager Friedenskonferenzen und [44] Verfasser eines gelehrten Geschichtswerkes über das Mittelalter – der letzte Nachkomme einer distinguierten, hochgebildeten und patriotischen Familie.
»Er kommt her, um sich ein bisschen auszuruhen«, sagte Monsignore vertraulich, als spräche er zu einem Gleichaltrigen. »Ich bin seine Zuflucht, wenn er vom Agnostikerdasein erschöpft ist, und ich bin wohl der Einzige, der weiß, wie seine gelassene alte Seele hilflos in der Brandung treibt und sich nach einem verlässlichen Balken wie der Kirche sehnt, an den er sich klammern kann.«
Ihr erstes gemeinsames Mittagessen war eins der denkwürdigsten Ereignisse in Amorys jungem Leben. Er glänzte mit funkelnden Einfällen und bezauberte durch seinen Charme. Monsignore beschwor seine besten Ideen in bestechenden Thesen und Fragestellungen, und Amory fand aus der Fülle seiner Eingebungen und Sehnsüchte und Abneigungen und Überzeugungen und Befürchtungen eine geistreiche Erwiderung nach der anderen. Monsignore und er bestritten die Unterhaltung allein, und der Ältere, weniger empfänglich und duldsam in seinem Denken, doch gewiss nicht kälter in seinen Empfindungen, schien zufrieden damit, ihnen zuzuhören und sich an den milden Sonnenstrahlen zu wärmen, die zwischen den beiden hin und her tanzten. Viele Menschen spürten dieses warme Licht, das Monsignore ausstrahlte; Amory verströmte es in seiner Jugend und in gewissem Grade auch später, als er sehr viel älter war, doch nie wieder strahlte es so spontan auf beiden Seiten.
Ein vielversprechender Junge, dachte Thornton Hancock, der mit der Elite zweier Kontinente vertraut war und Parnell, Gladstone und Bismarck kennengelernt hatte – und [45] später fügte er Monsignore gegenüber hinzu: »Man sollte seine Erziehung jedoch nicht einer Schule oder einem College überlassen.«
Doch in den nun folgenden vier Jahren waren Amorys Geisteskräfte ganz darauf konzentriert, Ansehen zu erringen und die verzwickten gesellschaftlichen Verhältnisse an der Universität und in der amerikanischen Gesellschaft beim Tee im Biltmore und auf dem Golfplatz in Hot Springs zu durchschauen.
Alles in allem eine wundervolle Woche, die Amory völlig durcheinanderbrachte, hundert seiner Theorien bestätigte und aus seiner Lebensfreude tausend ehrgeizige Pläne herauskristallisierte. Dabei war die Unterhaltung keineswegs schulmeisterlich – Gott bewahre! Amory hatte nur eine vage Vorstellung, wer wohl Bernard Shaw war – doch Monsignore widmete The Beloved Vagabond und Sir Nigel ebenso viel Aufmerksamkeit und sorgte dafür, dass Amory niemals den Boden unter den Füßen verlor.
Doch schon waren die Signale hörbar, die Amory zum ersten Gefecht mit seiner eigenen Generation riefen.
»Nein, es fällt dir nicht schwer zu gehen. Für unsereins ist die Heimat immer da, wo wir nicht sind«, sagte Monsignore.
»Doch, es fällt mir schwer…«
»Nein. Du und ich, wir brauchen niemanden auf der Welt.«
»Aber…«
»Leb wohl.«
[46] Der niedergeschlagene Egoist
Obwohl die zwei Jahre in St.Regis für Amory abwechselnd schmerzliche und glanzvolle Erfahrungen bereithielten, blieben sie für sein Leben ähnlich bedeutungslos wie die amerikanische prep school für das Leben der Amerikaner im Allgemeinen, werden sie doch von den Universitäten mit dem Absatz zerdrückt. Wir haben kein Eton, um das Selbstbewusstsein einer herrschenden Klasse zu bilden; stattdessen haben wir saubere, farblose und langweilige prep schools..
Amory machte von Anfang an alles falsch, galt bei allen als dünkelhaft und arrogant und wurde allgemein verachtet. Er spielte mit Hingabe Football, schwankte jedoch zwischen verwegenen Bravourstücken und der Neigung, so wenig zu riskieren, wie es nur irgend mit Anstand möglich war. In heller Panik drückte er sich vor einer Rauferei mit einem gleichstarken Jungen, was ihm wildes Hohngebrüll eintrug, und eine Woche später brach er tollkühn einen Streit mit einem wesentlich größeren Jungen vom Zaun, aus dem er schwer geschlagen, aber zufrieden mit sich selbst hervorging.
Autoritäten reizten ihn grundsätzlich zum Widerspruch, und dies, gepaart mit einer lässigen Gleichgültigkeit gegen alles, was Arbeit hieß, brachte jeden Lehrer zur Weißglut. Er verlor den Mut und betrachtete sich als Ausgestoßenen, begann, sich gekränkt in einsamen Winkeln herumzudrücken und nachts verbotenerweise zu lesen. Da er das Alleinsein nicht ertragen konnte, schloss er Freundschaft mit solchen Schülern, die nicht zur Elite der Schule gehörten, doch dienten sie ihm nur als Spiegel seiner selbst, als Publikum [47] für seine Posen, ohne die er nicht leben konnte. Er war unerträglich einsam, verzweifelt unglücklich.
Doch gab es auch tröstende Lichtblicke. Wenn Amory in Selbstmitleid zu versinken drohte, war seine Eitelkeit die letzte Rettung, und von »Wookey-Wookey«, der tauben alten Wirtschafterin, zu hören, er sei der bestaussehende Junge, den sie je gesehen hätte, bereitete ihm nach wie vor prickelnde Genugtuung. Es freute ihn, dass er als Jüngster und Leichtester in die erste Footballmannschaft aufgenommen worden war; und es freute ihn auch, von Dr.Dougall am Ende einer hitzigen Unterredung zu vernehmen, wenn er nur wollte, könnte er einer der besten Schüler sein. Doch Dr.Dougall irrte sich. Amorys Naturell machte es ihm unmöglich, jemals bester Schüler zu werden.
Unglücklich, sich seiner Grenzen bewusst, unbeliebt bei Schülern und Lehrern – das war Amorys erstes Semester. Aber zu Weihnachten kehrte er mit zusammengebissenen Zähnen und seltsam euphorisch nach Minneapolis zurück. »Ach, am Anfang hab ich vielleicht ein bisschen dick aufgetragen«, sagte er gönnerhaft zu Frog Parker, »aber dann hab ich’s geschafft – als Leichtester in der ersten Mannschaft. Gar nicht übel, so ’ne Schule, Froggy – du solltest auch woandershin gehen.«
Die Sache mit dem wohlmeinenden Lehrer
Am letzten Abend des ersten Semesters ließ Mr.Margotson, der rangälteste Lehrer, Amory die Nachricht in den Studiensaal bringen, dass er ihn um neun Uhr in seinem [48] Zimmer zu sprechen wünsche. Amory vermutete, dass ihm ein ernstes Wort drohte, beschloss aber, höflich zu sein, denn dieser Mr.Margotson war ihm bisher immer wohlwollend entgegengekommen.
Der Lehrer empfing ihn mit feierlichem Ernst. Er räusperte sich und sah so absichtsvoll freundlich drein wie jemand, der weiß, dass er sich auf ein heikles Gebiet gewagt hat.
»Amory«, setzte er an, »ich wollte in einer persönlichen Angelegenheit mit dir sprechen.«
»Ja, Sir.«
»Du bist mir in diesem Jahr aufgefallen, und – nun, du gefällst mir. Ich glaube, du hast das Zeug dazu – ein großer Mann zu werden.«
»Ja, Sir«, brachte Amory mit Mühe heraus. Er hasste es, wenn man über ihn sprach, als sei er ein kompletter Versager.
»Aber mir ist aufgefallen«, fuhr der Ältere unbeirrt fort, »dass du bei den anderen nicht sehr beliebt bist.«
»Nein, Sir.« Amory fuhr sich mit der Zunge über die Lippen.
»Äh – ich dachte, vielleicht weißt du nicht genau, was – äh – die anderen an dir stört, und ich wollte es dir sagen, weil ich glaube – äh –, wenn jemand seine Schwächen kennt, kann er sie besser meistern – sich so verhalten, wie es die anderen von ihm erwarten.« Er räusperte sich wieder taktvoll und fuhr dann fort: »Sie sind offenbar der Ansicht, dass du – nun, dass du dir ein bisschen zu viel einbildest…«
Das war zu viel für Amory. Er erhob sich von seinem Stuhl und hatte seine Stimme nur mühsam in der Gewalt, als er zu sprechen begann.
[49] »Das weiß ich – glauben Sie vielleicht, ich wüsste das nicht selbst?« Seine Stimme wurde lauter. »Ich weiß ganz genau, was sie alle denken; glauben Sie etwa, Sie müssten mir das noch sagen!« Er hielt inne. »Ich bin – ich muss jetzt zurück – wollte nicht unhöflich sein…«
Eilig verließ er das Zimmer. Draußen in der kühlen Nachtluft, auf dem Weg zu seinem Haus, genoss er den Triumph, die Hilfe zurückgewiesen zu haben.
»Dieser verdammte alte Narr!«, schrie er wütend. »Als ob ich das nicht selber wüsste!«
Das Ganze diente ihm nun als guter Grund, an diesem Abend nicht mehr in den Studiensaal zurückzugehen, und so beschloss er, stattdessen gemütlich auf seinem Bett Kekse zu knabbern und The White Company zu Ende zu lesen.
Die Sache mit dem wunderbaren Mädchen
Der Februar stand unter einem Glücksstern. New York überraschte ihn an Washingtons Geburtstag mit dem Glanz eines langerwarteten Ereignisses. Sein damaliger flüchtiger Eindruck von strahlendweißen Gebäuden vor tiefblauem Himmel hatte sich ihm als prächtiges Bild tief eingeprägt, das den Traumstädten aus 1001Nacht gleichkam; doch diesmal sah er die Stadt bei künstlichem Licht, und am Broadway ging ein gewisser Zauber von den Leuchtreklamen für Autorennen aus, und es funkelte aus den Augen der Frauen im Astor, wo er mit dem jungen Paskert, einem Mitschüler von St.Regis, zu Mittag aß. Als sie im Theater an den Sitzreihen entlanggingen, begrüßt vom hektischen [50] Durcheinander, den Missklängen ungestimmter Geigen und dem schweren, betörenden Duft von Schminke und Puder, bewegte sich Amory in einer Sphäre epikureischer Lebensfreude. Das alles entzückte ihn. Man spielte The Little Millionaire mit George M. Cohan; außerdem wirkte eine junge, hinreißend schöne Brünette mit, deren Tanz ihn in Ekstase versetzte und bei deren Anblick ihm die Augen aus dem Kopf quollen.
Oh – du – wunderbares Mädchen
Ein wunderbares Mädchen bist du –
sang der Tenor, und Amory stimmte ihm schweigend, doch leidenschaftlich zu.
All – deine – wunderbaren Worte
Lassen mich erbeben –
Bei den letzten Tönen steigerten sich die Geigen zu einem gefühlvollen Tremolo, das Mädchen sank als sterbender Schmetterling auf der Bühne zusammen, und gewaltiger Applaus erfüllte das Haus. Ach – sich so zu verlieben, zu den sehnsüchtigen, zauberhaften Klängen einer solchen Melodie!
Die letzte Szene spielte auf einem Dachgarten, und die Cellos seufzten zum Theatermond hinauf, während sich auf der weißgekalkten Bühne ein Feuerwerk aus frivolen Abenteuern und harmlos-seichter Komödie versprühte.
Amory hätte den Rest seines Lebens auf Dachgärten zugebracht, wenn es dort Mädchen gab wie dieses – oder [51] besser: genau dieses Mädchen… Er malte sich aus, wie ihr Haar im Mondlicht golden schimmerte, während ein aus dem Nichts hervorgezauberter Kellner ihnen perlenden Wein einschenkte. Als der Vorhang sich zum endgültig letzten Mal senkte, gab er einen so tiefen Seufzer von sich, dass die vor ihm Sitzenden sich umdrehten, ihn anstarrten und laut genug, dass er es hören konnte, sagten:
»Was für ein gutaussehender Junge!«
Dies ließ ihn das Theater vergessen, und er fragte sich, ob die New Yorker Gesellschaft ihn wohl tatsächlich für gutaussehend hielt.
Ohne ein Wort gingen sie zum Hotel zurück. Paskert brach als Erster das Schweigen. Seine rauhe Stimme eines Fünfzehnjährigen hatte eine melancholische Färbung, als sie Amorys Träumereien unterbrach:
»Ich würd das Mädchen auf der Stelle heiraten.«
Es war keine Frage, welches Mädchen er meinte.
»Ich würd sie gern mit nach Hause nehmen und meiner Familie vorstellen«, fuhr Paskert fort.
Das imponierte Amory gewaltig. Er wünschte, er und nicht Paskert hätte das gesagt. Es klang so erwachsen.
»Wie ist es denn mit Schauspielerinnen – die sind wohl alle ziemlich verdorben?«