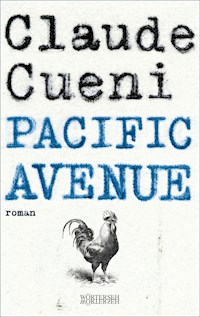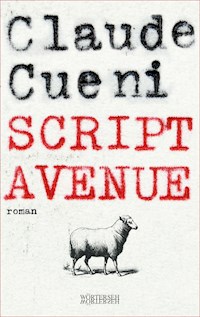Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Königstuhl
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eigentlich ist der Stand-up-Comedian Bobby Wilson kein schlechter Kerl. Er hatte Gutes tun wollen und nicht damit gerechnet, dass die Geschichte so schnell ausser Kontrolle geraten würde. "What the fuck!", hatte Wilson dem Mexikaner Pote Valdez ins Gesicht geschrien, "ihr könnt mich doch nicht einfach entführen!". "La boca", hatte Pote gebrummt und ihm eine Kopfnuss verpasst. Aber es kam noch schlimner. Der Thriller spielt in Basel, Monfalcone und auf den Golanhöhen. Cueni schreibt wie wir rocken: Dreckig, ehrlich und auf den Punkt. Love it! Chris von Rohr, Rocklegende (Krokus)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 320
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mit Ausnahme der Beltracchis sind alle handelnden Figuren frei erfunden.
Impressum
© 2022 Edition Königstuhl
Alle Rechte vorbehalten.
Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert werden, insbesondere nicht als Nachdruck in Zeitschriften oder Zeitungen, im öffentlichen Vortrag, für Verfilmungen oder Dramatisierungen, als Übertragung durch Rundfunk oder Fernsehen oder in anderen elektronischen Formaten. Dies gilt auch für einzelne Bilder oder Textteile.
Umschlagsgestaltung:
jarzina kommunikationsdesign, Holzkirchen
Bildnachweis:
bomg, www.shutterstock.com
Gestaltung Inhalt:
Stephan Cuber, diaphan gestaltung, Bern
Lektorat:
Manu Gehriger
Druck und Einband:
CPI books GmbH, Ulm
Verwendete Schriften:
Adobe Garamond Pro, Museo Sans
ISBN 978-3-907339-23-7
eISBN 978-3-907339-87-9
Printed in Germany
www.editionkoenigstuhl.com
© 2022 Dina Cueni
Claude Cueni, geboren 1956 in Basel, ist Schriftsteller, Drehbuchautor und Kolumnist. Er schrieb Romane, Theaterstücke, Hörspiele und über 50 Drehbücher für Film und Fernsehen (»Tatort«, »Peter Strohm«, »Eurocops«). Sein historischer Roman über den Papiergelderfinder John Law (Das Grosse Spiel) war auf Platz 1 der Schweizer Bestsellerliste und wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt. Mit seinen historischen Romanen über Charles Henri Sanson (Der Henker von Paris), Gustave Eiffel (Giganten), die Entdeckung der Philippinen (Pacific Avenue), Hergé (Warten auf Hergé) und die Dramatisierung des Gallischen Krieges (Cäsars Druide / Das Gold der Kelten), hat er eine treue Leserschaft gefunden.
Für seinen autobiographischen Roman Script Avenue verliehen ihm die Zuschauer des Schweizer Fernsehens 2004 den »Golden Glory« für die berührendste Geschichte des Jahres. Zuletzt erschienen Genesis – Pandemie aus dem Eis (2020) und Hotel California (2021).
www.cueni.ch
Dedicated to my extraordinary wife Dina Ariba Cueni
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
1
Wie dumm, dass Sie dieses Buch gekauft haben. Es ist bestimmt nicht das, was Sie suchten. Eigentlich ist Dirty Talking eine Dienstleistung von Prostituierten. Einige Kunden mögen das, weil sie sich zu Hause nicht getrauen zu sagen: »Komm her, du geile Schlampe. Ich will dich bumsen.« Unter dem Druck der Political Correctness wächst auch in der gehobenen Gesellschaft der Wunsch nach Dirty Talking abseits des Rotlichtmilieus. Gebildete Menschen, die sich eloquent und höflich ausdrücken, kriegen vor lauter Political Correctness einen dicken Hals, dann platzt ihnen der Kragen und ihr Wortschatz fällt vorübergehend in jene prähistorischen Zeiten zurück, als man sich noch mit Grunzen und Drohgebärden verständigte. Wie Tourette-Kranke posaunen sie nach Einbruch der Nacht das Repertoire von Dirty Talking heraus. Sie tun dies in den privaten Salons, wo man die guten Manieren an der Garderobe abgibt. Sie versammeln sich in Debattierclubs mit Gleichgesinnten wie damals die Republikaner vor Ausbruch der Französischen Revolution. Sie flüstern sich Dinge ins Ohr und sagen, das dürfe man nicht mehr laut sagen. Sie unterhalten sich über Bücher wie dieses hier: Dirty Talking. Und falls Sie es nicht mögen: I give a shit!
PS: Beinahe hätte ich etwas vergessen. In diesem Buch werden oft Kraftausdrücke benutzt, die Sie irritieren oder gar verletzen könnten. Don’t worry. Fluchen setzt physische Kräfte frei, man wird schmerzresistenter. Steckt man Sie kopfvoran in eine Kloschüssel, halten Sie es etwas länger aus, wenn Sie dabei fluchen. Neurologen haben das mit Eiswasser getestet. Im Vergleich mit der Kontrollgruppe hielten es Fluchende fünf Minuten länger aus. Fünf Minuten können eine Ewigkeit sein. Seien Sie also nachsichtig, wenn einige Leute in diesem Buch fluchen, was das Zeug hält. Der Mensch ist nicht perfekt, ich bin es auch nicht. Manchmal erleben wir einen richtig beschissenen Tag und man wünscht sich, man wäre nie geboren. Wir alle kennen diese Anspannung, die wie ein Tsunami unseren Körper flutet. Es wäre in diesem Augenblick unmenschlich, keine vulgären Flüche auszustossen. Lassen Sie ihre Wut raus, bevor Sie implodieren. Das ist ein spontaner Reflex, ein uralter evolutionärer Reflex, der im ruchlosen Teil unseres Gehirns entsteht. Wir teilen ihn mit allen anderen Primaten, Säugetieren und Echsen, er löst Freude, Wut, Angst, trompetenhafte Fürze, Kampfbereitschaft oder Fluchtbewegungen aus. Die Herzfrequenz schiesst in den roten Bereich. Würden wir keine Socken tragen, könnten wir sehen, wie der Angstschweiss zwischen unseren Zehen trieft. Fluchen jagt Blut und Adrenalin durch unsere Venen, es schiesst in alle Extremitäten und so ertragen wir ihn besser, diesen ganzen Scheiss, den uns das Leben dauernd in die Fresse haut.
Fluchen Sie ungeniert! In diesem Buch wird gleich auf Deutsch, Englisch und Spanisch geflucht. Spanisch? Ja, denn die beiden Mexikaner sprechen spanisch. Was zum Teufel suchen Mexikaner in der Schweiz? Und ausgerechnet in Basel. Hatte sich Bobby Wilson auch gefragt. Dirty Talking ist seine Geschichte und ich werde sie erzählen, so, wie sie mir Bobby Wilson erzählt hat. An der jordanisch-israelischen Grenze. Es ist keine alltägliche Geschichte. Als Wilson mittendrin steckte, hatte er keine Ahnung, was die beiden Mexikaner im Schilde führten. Ich weiss es mittlerweile und werde es Ihnen nicht vorenthalten. »What the fuck!«, hatte Bobby Wilson Pote Valdez ins Gesicht geschrien, »ihr könnt mich doch nicht einfach entführen!«
»La boca« hatte Pote gebrummt und ihm eine Kopfnuss verpasst. »La boca« bedeutet so viel wie »Klappe halten«. Was mit Bobby Wilson geschah, ist auch deshalb eine ungewöhnliche Geschichte, weil er ursprünglich Gutes tun wollte. Doch bald darauf steckte er bis zum Hals in der Scheisse. Und das ist seine Geschichte:
2
Bobby Wilson wurde am neunten Dezember 1972 im Zürcher Hallenstadion gezeugt. Der Saal war stockdunkel und proppenvoll. Aus den monströsen Lautsprecherboxen dröhnten dumpfe Schläge, Herzschläge, aber es waren nicht die von Bobby Wilson. Die Leute wurden unruhig, einige begannen zu schreien, sie hielten es kaum noch aus. Immer diese monotonen Herzschläge. Die meisten waren bereits so zugedröhnt, dass sie regelrecht ausflippten. Plötzlich wurde der Saal mit grellen Scheinwerferlichtern geflutet und auf der Bühne standen die vier späteren Legenden David, Nick, Roger und Rick an der Orgel. Die britische Rockband tourte durch Europa und die damals 30-jährigen Hippies Jamie und Jolene hatten eine Menge Joints eingepackt und waren ihnen gefolgt. Sie wollten dieses endlos lange Musikstück hören, das mit einem Herzschlag beginnt. Damals, im Winter 72 in Zürich, spielten Pink Floyd eine frühe Version ihres späteren Welthits »Dark Side of the Moon«. Sie sangen, dass der Mond keine dunkle Seite habe, dass er in Wirklichkeit ganz dunkel sei (»There is no dark side of the moon, really; as a matter of fact it’s all dark«) und Jamie und Jolene hatten Sex, mitten in der Menge, wie einst in Woodstock und niemand störte sich daran. Als das Konzert zu Ende war, lagen Jamie und Jolene ermattet von der Liebe inmitten von leeren Bierdosen, Zigarettenstummeln, Unterwäsche und ausgelatschten Espadrilles. Ihnen war etwas widerfahren, dass Normalsterbliche nur aus Komödien kennen. Während die Bühne abgeräumt wurde, stand Jamies’ Penis immer noch wie ein Laternenpfahl und schmerzte grauenhaft. Nach einer halben Stunde bat Jolene die Garderobiere, ihnen ein Taxi zu bestellen. Sie fuhren auf die Notfallstation des Zürcher Universitätsspitals. Die Ärzte diagnostizierten einen Fall von Priapismus, eine schmerzhafte Dauererektion. Mit einer Phenylephrin-Spritze brachten die Notärzte das Ding zum Erschlaffen. Jamie wurde einem Bluttest unterzogen und musste unzählige Fragen beantworten. Nachdem alle möglichen Ursachen ausgeschlossen worden waren, blieb nur noch eine Hypothese übrig: Priapismus in Verbindung mit einer Überdosis Cannabis. Der Fall war damals so aussergewöhnlich, dass er sogar im amerikanischen »Journal of Cannabis Research« ausführlich dokumentiert wurde. Angeblich reisten einige Ärzte vom »Coliseum Medical Centers« aus dem US-Bundesstaat Georgia nach Zürich, um mehr zu erfahren. Die forschenden Spesenritter vermuteten damals, dass durch übermässigen Marihuanakonsum die Blutgefässe derart erweitert werden, dass die Mutter aller Erektionen entstehen könne. Ein Inhaltsstoff der Pflanze bewirke aber, dass jene Signale des Gehirns ausgeschaltet werden, die normalerweise Erektionen wieder beenden. Die US-Delegation reiste vergebens an. Jamie und Jolene waren bereits weitergezogen und hatten sich zum ersten schweizerischen Love-in (nach kalifornischem Vorbild) in Birmenstorf, einem kleinen Dorf im Kanton Aargau, niedergelassen. Dort, an der Badenerstrasse, lebten ein Dutzend Hippies. Sie lasen Hermann Hesse, Jack Kerouac, Gandhi und das Magazin Konkret, die »Polit-Porno-Postille« und Onanievorlage der 68er, der Playboy für Linke, verdeckt subventioniert von der DDR. Chefredakteurin war zeitweise eine Ulrike Meinhof, die spätere RAF-Terroristin, die mit Bombenanschlägen einen Volksaufstand auslösen wollte, aber lediglich schärfere Gesetze bewirkte. Im Keller der Liegenschaft übte eine Band, im ersten Stock war ein Matratzenlager, das nach verwesten Fischen stank. Bobby Wilson kam während einer Jam-Session im verwilderten Vorgarten zur Welt. Fast alle halfen bei der Geburt mit, einige waren allerdings zu bekifft. Shorty übernahm den Lead, denn er hatte Medizin studiert, doch Bobby Wilson weigerte sich, diese beschissene Welt zu betreten. Er versuchte, sich mit der Nabelschnur zu erdrosseln. Shorty schrie verzweifelt, er hätte damals das Studium abgebrochen, das sei alles ganz neu für ihn. Die alte Nachbarin, die hinter ihren Gardinen alles beobachtet hatte, humpelte aus dem Haus, schubste Shorty beiseite und kniete vor Jolene nieder. Sie hiess Agathe Bruhin und es war ausschliesslich ihr zu verdanken, dass Bobby Wilson die Welt einigermassen unbeschadet erblickte und es ist ihr besonders hoch anzurechnen, weil ihr Ehemann, ein Stammgast im »Gasthof zum Bären«, die »Langhaardackel« an der Badenerstrasse als »faule Säcke«, und »Schmarotzer« beschimpfte. Das hatte Jamie und Jolene nicht weiter gestört, denn sie waren stolz, Teil einer jener Grossfamilien zu sein, die sich jenseits der bürgerlichen Kleinfamilie als politisches und künstlerisches Kollektiv verstanden, das ihrer Zeit weit voraus war. Die damalige Elterngeneration war genauso prüde und spiessig wie heutige Wokenesprediger. Im Laufe der Zeit realisierte Jolene, dass die Clique musizierender Kumpels sie nur für Spaghetti Bolognese, Sex und 90-Grad-Wäschen benutzte. Ihr Alltag unterschied sich kaum vom Leben der Agathe Bruhin, die in der Wohnstube eine eingerahmte Fotografie von General Guisan unter dem gekreuzigten Jesus aufgehängt hatte. Ab und zu schaute der nonkonformistische Volkskundler Sergius Golowin vorbei, eine helvetische Taschenbuchausgabe von Timothy Leary und pries die neuen Wohnformen als Oasen der Bewusstseinserweiterung. Mit Golowin kamen jeweils Gäste, die nur vorübergehend im Matratzenlager schliefen, ein bisschen Sex hatten und dann weiterzogen. Mittlerweile war die Zahl der »neuen Nomaden« im Westen auf über eine Million angewachsen. Sie liebten das Zigeunerleben (damals noch ein positiver Begriff) und verachteten einen festen Wohnsitz als verstocktes Spiessertum. Während in den umliegenden Dorfkinos immer noch »Easy Rider« lief, zogen Jolene und Jamie auf eine abgelegene Tessiner Alp, wo Gleichgesinnte sich im Gras paarten, während nackte Kinder von Geissen abgeleckt wurden. Weder den Geissen noch den Kleinkindern setzte man Grenzen. Erziehung galt als Folter, Sex mit einer festen Partnerin war reaktionär. Zur Abwechslung gab es auch Geissen und Kinder auf dem Berg. Das wurde erst 20 Jahre später publik, aber da einigen der pädophilen Grünalternativen der Marsch durch die Institutionen gelungen war, wehte in den Redaktionsstuben mittlerweile der Duft von Che Guevaras exklusiven Montecristo Zigarren.
Was den Tessiner Behörden nicht gelang, schaffte 1983 eine neuartige Krankheit: Aids. Der Tod raffte viele dahin. Bobby Wilson war damals zehn Jahre alt. Jolene und Jamie zogen nach Basel, weil sie dachten, dort würde man die beste medizinische Behandlung kriegen. Beide hatten sich mit HIV infiziert. Bobby Wilson besuchte die Schulen in Basel. Da er bisher mit seinen Eltern nur englisch gesprochen hatte, war die Integration schwierig. Er hatte später die eine oder andere Liebschaft, eine feste Partnerschaft hatte sich nie ergeben, sowas kannte er nur aus dem Kino. Er war durchaus auf der Suche nach etwas, aber er hatte keinen blassen Schimmer, was dieses Etwas hätte sein können. Dreissig Jahre später hatte er einen Plan. Jeder Mensch hat einen Plan, bis er eins in die Fresse kriegt. Zum Beispiel die Faust von Pote Valdez. Und das ist die Geschichte eines Mannes, der Gutes tun wollte.
3
Alles begann an einem Aprilmorgen um Viertel nach neun. Es war kurz vor Bobby Wilsons fünfzigstem Geburtstag. Das ist kein einfaches Alter, man entdeckt unter der Dusche das erste weisse Schamhaar, beim Pinkeln kommt stets noch ein Abschiedstropfen, man legt an Gewicht zu, obwohl man seine Essgewohnheiten nicht geändert hat und der Zahnarzt empfiehlt eine Gesamtsanierung. Fuck! – war sein tägliches Vaterunser geworden. Nach ein paar Flüchen fühlte er sich jeweils besser.
Bobby Wilson betrat an jenem Morgen wie üblich die kleine Online-Redaktion im Untergeschoss des Basler Postillon am unteren Rheinufer. Die Elsässerin Solange Crevoisier, die in die Jahre gekommene Einkäuferin von People-Content, war mit ihrem iPad beschäftigt und spielte »Candy Crash«. Seit Wochen biss sie sich an Level 179 die letzten Zähne aus. Vor zwanzig Jahren war sie Bobby Wilson beim Firmenessen noch liebevoll über das lange Haar gestrichen und hatte geflüstert, er sehe aus wie ein Barockengel. Aber seit der Engel Haare und Flügel verloren hatte, waren die beiden nur noch gute Kollegen. John, der bärtige Lokalredakteur, eine Chimäre aus Reinhold Messner und Karl Marx, sass mit grimmigem Blick beim Fenster und überprüfte die Online-Kommentare der Leserschaft. Eigentlich hiess er Johannes, nannte sich aber trotz seines heroisch zelebrierten Antiamerikanismus John, weil er das cooler fand und ein bisschen wie John Lennon klang. Er war etwas jünger als Bobby Wilson. Seine zusammengekniffenen Augen liessen keinen Zweifel daran, dass das Gewicht der kapitalistischen Welt auf seinen Schultern lastet. Eigentlich hatte er nur zwei Gesichtsausdrücke, einen mit Brille und einen ohne Brille. Die war riesengross und hatte schwarze Ränder. Das verstrubbelte Haar bedeckte er auch im Sommer mit einem speckig filzigen Barett, das an Che Guevara erinnerte. Wahrscheinlich zierte der Marlboro Mann der Linken ein vergilbtes Poster auf seinem Klo. Die Stimmung im Hause hatte an jenem Morgen durchaus Steigerungspotential. Melancholie lag in der Luft, denn die Tage des lokalen Online-Mediums waren gezählt. Das einstige Paradepferd des linken Establishments war als Printzeitung gestartet und nach und nach zu einem Ackergaul verkommen. Da kaum einer ein Zeitungsabo gelöst hatte, weil Geiz so geil war, hatte man einen Teil der gedruckten Auflage jeweils kostenlos am Flughafen abgegeben, was japanische Touristen nur beschränkt begeistert hatte. Die WEMF AG für Werbemedienforschung hatte ihre Auflagenbeglaubigung revidiert, die Zahlen nach unten geschraubt und der Printausgabe den Garaus gemacht. Es waren ausgerechnet die milliardenschweren Nachkommen der Basler Pharmaindustrie, die nun die Online-Ausgabe jener kosmopolitischen Salonrevolutionäre finanzierten, die ihre Gönner eigentlich enteignen wollten. Doch wenn journalistische Beiträge so voraussehbar waren wie Publikationen der Zeugen Jehovas, stösst auch die palliative Hilfe an ihre Grenzen. Vor einigen Wochen schloss sich deshalb das Redaktionskomitee mit ähnlichen Bonsai-Medien in Zürich und Bern zusammen. Der Input sollte ab nächstem Jahr aus Zürich geliefert werden, in Basel blieb nur noch eine Rubrik für die Regionalberichterstattung. Die wiederum wollte man Freelancern übertragen, die das 16. Lebensjahr überschritten hatten. Für die Auflösung des Basler Postillon hatte man eine Tatortreinigerin aus Berlin verpflichtet: Dr. Malika Meinhof, noch keine 24, aber jung, weiblich und mit Migrationshintergrund. Sie betrat an jenem Morgen selbstbewusst und voller Tatendrang das Untergeschoss und setzte sich demonstrativ auf Bobby Wilsons Schreibtisch, um ein bisschen Dominanz zu demonstrieren. Wir kennen das aus dem Tierreich. Letzte Woche hatte sie sich kurz der Redaktion vorgestellt. Sie hatte an der Universität Bayreuth Anglophone Literaturen studiert und in London mit einer Arbeit über Feminismus in der nigerianischen Literatur promoviert. Ihre aktuelle Forschung, die sie in Zürich weiterbetreiben wollte, betrafen Postkolonialität, Intersektionalität mit Schwerpunkt auf Narrationen von Migration, Diversität, Weisssein und Widerstand. Aber ihre Kernkompetenz waren ihre tagesaktuellen sexuellen Präferenzen, die eigentlich niemanden interessierten, aber die sie stolz vortrug, als hätte sie die Olympischen Spiele im Alleingang gewonnen und würde jetzt Immunität auf Lebenszeit geniessen. Malika war keine Liebhaberin langer Einführungen: »Schnitzel ohne festen Wohnsitz«, begann sie und fixierte Wilson streng, »was zum Teufel hast du dir dabei gedacht?«
»Dass ich genau noch acht Minuten habe, um eine lustige Formulierung zu finden. Oder hätte dir Zigeunerschnitzel besser gefallen?«
»Niemand findet das lustig, Bobby.« Malika schüttelte unwirsch den Kopf. Wilson warf Solange einen irritierten Blick zu und hoffte auf Unterstützung, doch die Elsässerin tat so, als lese sie auf ihrem Monitor gerade einen besonders interessanten Bericht über einen Yak-Hirten der im tibetischen Hochland von einem Yeti verfolgt worden war. Auch John gab sich beschäftigt und versuchte ein hämisches Grinsen zu unterdrücken. Er kratzte sich wie üblich am Hinterkopf. Wilson schien, Johns Beweglichkeit im rechten Schultergelenk hatte erneut nachgelassen.
»Das ist einfach primitiv, Bobby, der klassische Rassismus alter, weisser Männer«, belehrte ihn Malika, »so was gibt’s bei uns nicht.«
»Ich muss ihr leider recht geben«, schleimte John, »es gab wieder einen Shitstorm, ich musste sogar die Kommentarfunktion ausschalten.« Wie ein braver Junge schaute er zu Malika hoch.
»John sollte die Kommentare gleich selber verfassen, Malika.«
»Bobby, du sitzt da und klopfst deine blöden Sprüche, ich hingegen bin der Zentrale in Zürich verantwortlich.«
»Ist ja schon gut Malika, slow down, als meine Mutter in deinem Alter war, galt der Zigeunerlook als Synonym der Freiheit. Nur Spiesser hatten einen festen Wohnsitz. On the road again and fuck around the world and Sex & Drugs and Rock’n’Roll.«
»Bobby«, unterbrach Malika unwirsch, »Woodstock, das ist schon eine Weile her, heute sind die Menschen sensibler, die meisten jedenfalls.«
»Okay, Malika, wie kann ich das wieder gutmachen?«
»Lass dir was einfallen.«
»Ich könnte mir ein Büssergewand ausleihen und in den Roma-Camps im Elsass den Müll wegräumen, den unsere Mitmenschen ohne festen Wohnsitz hinterlassen haben.«
Malika atmete tief durch und sagte, sie erwarte noch vor Mittag einen konstruktiven Vorschlag. »Bobby, wir wollen nicht noch mehr Abonnenten verlieren.«
»Ihr habt noch welche?«
»Wir müssen Geld verdienen, damit wir Leute wie dich noch bis Ende Jahr bezahlen können.«
»Sorry, Malika, sorry, I am not sorry.«
»Du machst es mir einfach, Bobby, eigentlich wollten wir dich auf Ende Jahr entlassen, aber du bist jetzt ab sofort freigestellt.«
Darauf war Wilson nicht vorbereitet: »Und meine Humorseite, meine Kreuzworträtsel?«
»Wird nächstes Jahr eh alles zentral in Zürich erstellt«, sagte Malika, »wir kaufen das im Paket ein für alle Satellitenblätter.«
Es war Malika offenbar ernst. Wilson begriff, dass er soeben den Job verloren hatte, das einzige Standbein, das ihm seit zwanzig Jahren monatlich ein fixes Einkommen sicherte. Malika verstand, dass Wilson nun ein Problem hatte, aber sie schaute ihm regungslos in die Augen, weil sie dachte, das sei professionell.
»Bobby, ich gehöre nicht zu den Menschen, die den Gang zum Zahnarzt aufschieben. Wir verschwenden unsere Zeit. Du bist ab sofort freigestellt und kriegst noch drei Monatslöhne plus Ferientage.«
»Ab sofort freigestellt?«, wiederholte Bobby Wilson ungläubig.
»Ja, Bobby, du nützt dem Verlag mehr, wenn du zu Hause bleibst.«
»Darf ich wenigstens noch das Klo benützen, bevor ich gehe?«
»Für das Administrative wendest du dich an Solange.«
»Scheissen ist kein administrativer Vorgang, Malika …«
Sie lief einfach davon. Wilson rief ihr nach: »Und ich dachte, du willst mir zum Geburtstag gratulieren!«
»Happy Birthday, Bobby.« Sie öffnete die Tür zum Flur.
»Dann werden die Leute in Zukunft ein ironiefreies Wochenende erleben! Wie sollen sie bloss all die Sonntage überleben? Mit Saufen, Bumsen und Kiffen?«
Malika blieb stehen und drehte sich nochmals um: »Bobby, nimm es so wie es ist, ich habe in fünf Minuten Sitzung. Es ist vorbei. Sorry, I am not sorry.«
»Wozu haben wir diese ganze Scheissdiskussion geführt, wenn eh klar war, dass in Zukunft Zürich alle Satellitenblätter …«
Malika hatte das Büro bereits verlassen. John kraulte verlegen seinen Bart, Solange zog theatralisch ihr Gesicht in die Länge: »Ich fand die Kolumne lustig, Schnitzel ohne festen Wohnsitz, aber …« Sie unterdrückte ein Lachen.
»Er hat schon bessere Kolumnen geschrieben«, mischte sich John ein, ohne von seinem Bildschirm aufzuschauen.
»Immerhin« scherzte Wilson, »gibst du endlich zu, dass ich auch gute Kolumnen geschrieben habe.«
»Ich sagte bessere, nicht gute.«
»Vertragt euch wieder, wir wollen doch nicht so auseinandergehen.«
»Ich kanns kaum erwarten, dann muss ich mir seine blöden Sprüche nicht mehr anhören«, brach es aus John heraus, »ich habe mich oft gefragt, was ihm in Australien über die Leber gekrochen ist, dass er als Stinkstiefel zurückgekommen ist.«
»Mein Sabbatical war vor zehn Jahren, da bist du an der Uni gerade durch die Prüfung gefallen.« John war nicht besonders schlagfertig, zum Prügeln fehlten Mut und Kraft, so beschränkte er sich darauf, Wilson den Stinkefinger zu zeigen.
»Das kommt in etwa hin, seit zehn Jahren spielst du hier in der Redaktion den Kotzbrocken.«
»Hört endlich auf«, rief Solange dazwischen, »es ist bald vorbei. Aber John hat schon recht, Bobby, Australien hat dich verändert, ich weiss auch nicht, was da passiert ist.«
»Die Midlife-Crisis, Solange«, vermutete John, »vielleicht ist ihm die Freundin davongelaufen.«
»Oh«, machte Wilson, »du liest jetzt Sachbücher, Psychologie für Dummies?«
»Lasst uns in Frieden das Jahr beenden«, versuchte es Solange erneut. Nach einer Weile fragte John: »Was wirst du jetzt tun, Solange?«
Jetzt schien er plötzlich verunsichert, »was wird aus uns?«
»Jetzt spricht er plötzlich von uns«, zwinkerte Wilson Solange zu.
»John«, antwortete Solange mit leuchtenden Augen, »ich werde frühpensioniert. Ich werde mit dem Glacier Express von Zermatt nach St. Moritz fahren, mir ein leckeres 5-Gang-Menue servieren lassen, dazu ein Glas Prosecco, imposante Gebirgslandschaften geniessen, wandern, die Schweiz hat grossartige Berge und Seen, und den Winter verbringe ich in Thailand. Ich werde alles auf Facebook posten.«
John verwarf die Hände: »Und ich? In diesem Alter findet man keinen Job mehr? Wir sollten einen Protestbrief nach Zürich schicken!« Er schaut hilflos zu Wilson hoch.
»John, steck dir deinen Protestbrief irgendwohin, wo die Sonne nicht hin scheint.«
John wandte sich an Solange: »Aber wir zwei schreiben einen Brief!«
»John, ich kann es kaum erwarten, dieses Büro für immer zu verlassen, sorry.«
»Ich brauche den Job«, stiess John leise hervor. So hilflos hatte ihn Wilson noch nie erlebt. Offenbar kannte John Krisen nur vom Hörensagen. »Was soll ich jetzt tun?«
»Du könntest schwanger werden«, schlug Wilson vor.
Bobby Wilson machte es etwas aus, dass er so plötzlich seinen Job verlor. Er hatte ihn stets gerne gemacht und keine Mühe gescheut. Ihm war durchaus bewusst, dass es im Leben für nichts eine Garantie gab. Ausser für Staubsauger und Kühlschränke. Wovon sollte er in Zukunft leben? Er verdiente ein Zubrot als freiberuflicher Gaglieferant der mitternächtlichen TV-Comedyshow »Nachteule«. Das reichte nicht zum Leben, da man nur für die Gags bezahlt wurde, die es in die Sendung schafften. Die meisten Texter hatten deshalb noch andere Jobs, schrieben Drehbücher oder Beipackzettel für Kaffeemaschinen. Und wenn das immer noch nicht reichte, gesellte man sich zu den ganz grossen Losern, die in Seminaren lehrten, wie man als Gaglieferant Millionär wird. Bobby Wilson hatte wenigstens noch den Notar und Lokalpolitiker Dr. Alexander Hollenstein. In seinem Namen schrieb er als Ghostwriter die wöchentliche Kolumne über die Bedeutung von Basler Strassennamen. Nicht sehr lukrativ. Bobby Wilsons Haupteinnahmequelle war bisher der Basler Postillon! Womit sollte er das Loch stopfen? Wilson hatte früher gerne Witze über die Altersguillotine gemacht, aber jetzt, wo er selber oben auf dem Schafott stand, blieb ihm der Humor im Halse stecken. Aber nicht sehr lange. Wilson hatte Prinzipien. Eine seiner Devisen lautete, dass man Unangenehmes sofort als neue Normalität akzeptieren und dann nach vorne schauen sollte. Aber da vorne war gar nichts. Wilson verliess das Redaktionsgebäude am Unteren Rheinweg und schlenderte die Uferpromenade entlang. Es war Ende April, die Kirschbäume blühten und als die Sonne hinter den Wolken hindurchbrach, wertete er dies als gutes Zeichen, obwohl er für Spirituelles nichts übrighatte, aber die Japaner behaupten, man könne auch zu einer Sardine beten, wenn man fest daran glaube. Wilson mochte die Gegend, aber nach Einbruch der Nacht war es empfehlenswert, eine gute Zahnversicherung abzuschliessen, bevor man die breite Steintreppe zum Rheinufer hinunterstieg. Basel war nun mal die kriminellste Stadt der Schweiz.
4
Wilson wohnte an der Allschwilerstrasse 97, wenige Minuten von der Kantonsgrenze entfernt, die jedoch niemand wahrnahm, da die Strassenbahn noch einige Haltestellen weiterfuhr bis dicht an die französische Grenze. Nachdem aus dem Häuschen im Grünen nichts geworden war, hatte er in diesem Aussenquartier eine Zweizimmerwohnung gemietet, die genauso heruntergekommen war wie seine aktuelle Gemütsverfassung. Wilson vermisste die Natur, aber ohne Freundin waren auch die natürlichsten Dinge im Grünen nicht möglich und onanieren konnte er auch in einer Badewanne mit Klauenfüssen. Im Haus wohnten alleinstehende Senioren, Witwen und ein alternatives Paar, das die Stoffwindeln ihres Babys in der gemeinschaftlichen Waschmaschine wusch, um die Welt zu retten. Wilson wohnte auf der gleichen Etage wie sein 95-jähriger Nachbar Aaron Friedmann. Er war das, was seine Glaubensbrüder jiddisch »a mensch« nannten, ein gütiger und nobler Rentner, der, obwohl von der Altersarmut stark betroffen, nicht den Glauben an einen allmächtigen und gerechten Gott verloren hatte. Erstaunlich, hatte Friedmann doch als Teenager das Konzentrationslager Birkenau überlebt. Einmal die Woche schob er Wilson einen Einkaufszettel unter die Wohnungstür. An jenem Tag war es wieder so weit. Er bestellte immer das Gleiche, und aus unerfindlichen Gründen schrieb er den Zettel immer wieder neu.
Seit Wilson wieder alleine lebte, schätzte er die einfache Küche. Er raspelte jeweils eine Kartoffel, schnitt drei Tomaten, eine Peperoni, hakte Zwiebeln und Knoblauch und mischte das Ganze mit geriebenem Käse, Chili, Pfeffer und Salz. Nach zwanzig Minuten im Backofen schlang er sein Essen im Akkord hinunter, rülpste wie ein Tier, tigerte im Wohnzimmer herum, setzte sich an den Schreibtisch und starrte auf seine beiden iPhones 13 und 14. Keine Anrufe. Die neusten Apple-Versionen würde er sich nicht mehr leisten können. Das 13er-iPhone hatte auf dem roten Case einen mittelalterlichen Hofnarren abgebildet, das 14er-Modell war schwarz und ohne Bild. Wilson rief Georgette Decastel vom Kleintheater Satyricon an. Ob sie Interesse habe, dass er bei ihr auftrete? Vielleicht ein andermal. Das bedeutet in der Branche so viel wie fuck you. Wilson spürte den zunehmenden Druck im Oberbauch. Insgeheim hatte er damit gerechnet, oder wenigstens gehofft, Georgette Decastel würde ihn mit offenen Armen willkommen heissen, schliesslich hatte er einst eine gute Beziehung zu ihrem Vater gehabt und ihr, als sie noch klein war, stets Luxemburgerli von Sprüngli mitgebracht, aber die Süssigkeiten waren längst gegessen und ausgeschieden. Wilson überlegte, wie er nach der letzten Lohnzahlung in drei Monaten über die Runde kommen sollte. Gerne hätte er mit Mady darüber gesprochen, aber Mady war nicht mehr da. Wilson brauchte dringend neue Einnahmequellen. Nicht nur für sich. Er hatte Verpflichtungen. Jeden Monat brachte er seinen verkoksten Eltern eine Tüte Medikamente und vierhundert Franken in bar. Und das, obwohl sie ihn für einen Loser hielten. Ausgerechnet sie! Würde er seine familiäre Sozialhilfe einstellen, wären sie in ihrem Urteil bestätigt. Aus unerfindlichen Gründen wünschte er sich dennoch ihre Anerkennung. Er träumte manchmal davon, dass er ein erfolgreicher Stand-up-Comedian war und seine Eltern bekifft im Zuschauerraum sassen und applaudierten. Und manchmal, wenn er seine Gags in die Tastatur haute, wünschte er sich, seine Mutter wäre dabei und würde ihn für sein flinkes Tippen bewundern. Ratlos blieb Wilson vor seinem Bücherregal stehen. Brauchte er diese Bücher noch? Er hatte sie alle gelesen, einige mehrmals. Mit staubigen Bücherwänden konnte man heute eh keine Frau mehr beeindrucken. Heute zählten Followers. Wilson rief einige Buchantiquariate an. Sie wollten die Bücher nicht. Nicht einmal geschenkt: Sie klagten, Verlage würden sie mit unverkauften Restexemplaren zumüllen und die Kundschaft sterbe aus, gedruckte Bücher seien immer weniger gefragt. Ja, sagte Wilson, »Print ist out«. Er schaute sich weiter nach Verwertbarem um. Auf einem Bücherregal stand eine Bronzefigur von Frédéric Auguste Bartholdi, dem Schöpfer der Freiheitsstatue. Sie zeigte den gallisch-keltischen Arverner Fürst Vercingetorix, der mit seinem Pferd einen am Boden liegenden römischen Legionär niedertrampelt. Wilson hatte die Bronzestatue vor vielen Jahren auf einem Pariser Flohmarkt gekauft. Sie bedeutete ihm viel. Sie erinnerte ihn an unbeschwerte Zeiten, als die Zukunft schier grenzenlos schien und alte Menschen zu einer unbekannte Rasse gehörten. Wilson beobachtete ihn eine Weile, als würde er erwarten, dass Vercingetorix seinen Sockel verlässt und ihm beisteht. Jetzt, wo er mit dem Gedanken spielte, die Bronze zu verkaufen, fiel ihm auf, wie schön die braune Patina geworden war. Wahrscheinlich schätzt man Dinge erst, wenn man sie verloren hat. Wilson glaubte, das sei auch in Beziehungen so. Er vermass die Bronze: 37,5 Zentimeter hoch, 37 Zentimeter breit. Er googelte auf seinem iPad Antiquitätengeschäfte und rief einen nach dem andern an. Die meisten hatten kein Interesse, sagten, solche Dinge gebe es wie Sand am Meer. »Diesen Strand möchte ich sehen!«, entfuhr es Wilson nach der fünften Absage. Er wollte schon aufgeben, als ein François Bertrand lauwarmes Interesse zeigte, endlich. Wilson solle die Figur vorbeibringen, er sei noch bis vier Uhr im Laden. Wilson nahm eine Dusche, genoss das kalte Nass und zog frische Kleider an, schwarzes T-Shirt, schwarze Trainerhosen mit gelbem Puma-Logo und darüber seine in die Jahre gekommene braune US-Army-Jacke.
Das Antiquariat lag am unteren Petersgraben gegenüber dem Basler Universitätsspital. Wilson betrat das Geschäft. Ein kahlköpfiger Mann um die 50 kniete vor einer Kiste und packte kleine Blechautos aus. Er trug eine schwarze Hose, weisses Hemd, ein schwarzes Gilet darüber und einen übertriebenen Moustache unter seiner Knollennase. Den Wänden entlang waren Kisten, Schachteln und Truhen aufeinandergestapelt, einige enthielten Kitsch und Kleinkram, den man aus Trödelmärkten kannte. Wilson stellte seinen Vercingetorix auf einen beigen Küchentisch aus den 1960er-Jahren und sagte, sie hätten vor einer Stunde telefoniert. François Bertrand erhob sich und klagte, die jungen Leute hätten heute keinen Sinn mehr für Antiquitäten, die rennen alle zu Ikea. »Nicht alle«, wandte Wilson ein, »sonst wären Sie längst pleite. Wir haben ein junges Paar im Haus, die kaufen dem Klima zuliebe nur altes Zeug. Why not?«
Bertrand zwinkerte Wilson zu und reichte ihm freundlich die Hand. Sein Blick fiel auf den berittenen Vercingetorix. Er schielte zu Wilson, als wolle er einschätzen, ob Wilson ein Kenner war und welchen Preis er ihm dafür anbieten könne. Seine Augen waren permanent in Bewegung, als leide er an einer kindlichen Aufmerksamkeitsstörung. Ein bisschen Danny DeVito als Trödler mit Moustache. Bertrand wog die Bronze in den Händen und sagte mit einem Anflug von Bedauern, er habe schon manche Bartholdi-Statue im Laden gehabt, die würden sich gut verkaufen, aber den Vercingetorix, hm, den gebe es …«
»… wie Sand am Meer?«
Bertrand hob überrascht den Kopf und schmunzelte, er wolle auf keinen Fall den Preis drücken, aber dieses Exemplar sei von der Giesserei Barbedienne in Rouen, 1898, »ihre Kopien sind nicht gerade selten, die waren damals sehr beliebt und entsprechend verbreitet. Man findet sie in Frankreich in fast jedem gehobenen Nachlass. Aber die Zeiten haben sich geändert. Die Alten verarmen. Sie verkaufen ihre Bronzen bereits zu Lebzeiten. Essen wie Gott in Frankreich, das war mal. Was wollen Sie dafür?«
»Viertausend.«
»Puhh …« Bertrand schüttelte theatralisch den Kopf, als sei er plötzlich von einem Kälteschauer befallen und gab Wilson die Bronzefigur zurück: »Ich mache vor allem Nachlässe, Räumungen und ab und zu ist was Interessantes dabei, den Rest verramsche ich hier im Laden. Haben Sie noch was anderes?«
Bobby Wilson zuckte die Schulter.
»Was sich gut verkauft, sind hochpreisige Gemälde und Bronzen. Die Reichen fliehen in teure Sachwerte. Objekte unter fünfzigtausend sind keine Kapitalanlage.«
»Dreitausend?«, fragte Wilson verunsichert.
Bertrand begutachtete die Bronze erneut: »Im 19. Jahrhundert haben in Frankreich viele Giessereien Kopien hergestellt, das Original befand sich zur Zeit Napoleons in Paris, bis es 1815 wieder nach Rom zurückgebracht wurde.«
»Zweitausend?«
Bertrand reichte Wilson die Bronzefigur erneut zurück: »Ich würde die Bronze auf eBay stellen, da kriegen Sie vielleicht zweihundert, zweihundertfünfzig.«
»Wie viel würden Sie denn bezahlen?«
Bertrand zupfte an seinem Schnurrbart: »Dreihundert, aber auch das ist zu viel, also höchstens dreihundert.«
»Vierhundert cash.« Wahrscheinlich sah Bertrand Wilson die Verzweiflung an.
»Haben Sie einen finanziellen Engpass?«
»Ja, ich habe heute meinen Job verloren. Jetzt bieten Sie mir wohl nur noch die Hälfte.«
Bertrand nickte verständnisvoll und breitete seine Arme aus, als wolle er Wilson gleich umarmen: »Mein lieber Freund, ich mag ehrliche Menschen. Einige meinen, man würde als ehrlicher Menschen geboren und als Betrüger sterben, aber das ist nicht wahr. Es gibt noch ehrliche Menschen. So wie Sie und ich. Vierhundert.«
Bobby Wilson verliess das Antiquariat ohne seinen Gallier und warf einen Blick über die Strasse. Links vor dem Haupteingang der Universitätsklinik war eine Raucherzone. Dort standen und sassen einige Leute in weissen Kitteln herum. Offenbar beeindruckten sie jene Krebskranke, die im Lungenlabor wie Walrosse röhrten, nicht sonderlich. Wilson ertappte sich dabei, dass er erneut an einem Comedy Programm herumstudierte, aber über Kranke wollte er keine Witze reissen. Ja, Bobby Wilson wollte sich als Stand-up-Comedian versuchen, aber ein Programm von sechzig Minuten konnte verdammt lang sein. Er lief die Strasse runter und blieb ein paar Häuser weiter vor der Notfallapotheke stehen. Sie öffnete jeweils um 5 Uhr abends und war die ganze Nacht über offen. Es war noch einige Minuten zu früh. Wilson bereute bereits, seinen geliebten Vercingetorix verkauft zu haben. Er war sich durchaus bewusst, dass es nicht wirklich hilfreich war, das ganze Mobiliar zu veräussern, denn irgendwann waren auch Klobürste und Seifenhalter auf eBay versteigert. Wilson brauchte neue Einnahmequellen! Und weniger Ausgaben. Pünktlich um fünf öffnete die Apotheke. Agnis Bolund, die blonde Apothekerin, war im Hintergrund beschäftigt. Als sie Wilson sah, gab sie ihm ein Zeichen und verschwand im Lager. Sie kam mit einem Stapel Medikamente zurück und legte sie auf den Tresen. Agnis war Schwedin, Mitte 20, sie gehörte zu den Frauen, die Hosen anziehen, um wie Jungs auszusehen, und durchsichtige Blusen, um zu beweisen, dass sie keine sind. Sie hatten nach all den Jahren ein freundliches Verhältnis, mehr nicht. Da sie selten lachte, überlegte Wilson, ob er sein erstes Programm zuerst an ihr testen könnte, denn wenn er Agnis Bolund zum Lachen brächte, hätte er bestimmt volle Säle. Wilson liess die Idee fallen und überlegte, ob man Blondinenwitze vielleicht durch Celebrities ersetzen könnte, deren Aussagen jeweils zum Fremdschämen waren. Auch ihm war nicht entgangen, dass Blondinenwitze aus der Zeit gefallen waren, aber auch sein Publikum würde vielleicht von vorgestern sein. Andererseits mögen die Leute, wenn sich jemand getraut, etwas auszusprechen, was politisch verdammt unkorrekt ist: Um eine Frau zu verstehen, braucht es ein Handbuch, das in etwa so umfangreich ist wie die Betriebsanleitung der Air Force One. Die kostete 84 Millionen, wer kann sich das schon leisten?
»84 Millionen Dollar?«, fragte Agnis.
»Wie kommen Sie denn darauf?«, fragte Wilson verdutzt.
»Sie murmelten gerade 84 Millionen Dollar.«
»Ich war gerade auf Sendung«, grinste Wilson und nahm den verstörten Blick der alten Dame links von ihm mit Nonchalance zur Kenntnis.
»Ihr Vater kann stolz sein, einen derart fürsorglichen Sohn zu haben«, sagte Agnis, während sie die Medikamentenschachteln eintütete.
»Ich würde ihm lieber 20 mg Phenobarbital bringen«, antwortete Wilson trocken.
Agnis hob die Brauen.
»Oder irgendein Rattengift, falls das ohne Rezept geht.«
Agnis war sichtlich irritiert. Sie überprüfte nochmals das Dauerrezept: »Es ist abgelaufen, wir brauchen ein Neues.«
»Ich hoffe, es muss nicht mehr oft verlängert werden.«
5
»Wir haben dich zum Mittagessen erwartet«, stänkerte Jolene Wilson nachdem sie umständlich die Tür entriegelt und geöffnet hatte. Sie wohnte in einer Genossenschaftssiedlung an der Kaysersbergerstrasse, unweit der französischen Grenze. Die 80-Jährige trug eine bunte Tunika mit Blumenmustern, das weisse Haar lang und mit einem Tribe-Stirnband zusammengebunden.
»Ich bin berufstätig, Mom«, scherzte Wilson, »kennt ihr wohl nur vom Hörensagen.«
Der Duft von Cannabis lag in der Luft. Wilson vermutete, dass seine Mutter schon ziemlich high war und seine Worte nur noch als Geräusch wahrnahm. Er reichte ihr den Plastiksack mit den Medikamenten: »Ich brauche ein neues Dauerrezept für die Apotheke.«
»Ich kann dir kein Dauerrezept ausstellen, Bobby«, murmelte Jolene Wilson und schüttelte verwirrt den Kopf.
»Ich weiss, Mom, das muss der Arzt tun, ihr solltet deshalb bei der nächsten Arztvisite …«
»Hast du etwa nicht alle Medikamente?«, fragte sie aufgebracht.
»Temesta hatten sie nicht mehr an Lager, es gibt ja immer mehr Psychos in dieser verfickten Stadt, aber am Montag kriegen sie Nachschub und ich bringe die Medis vorbei.«
»Wärst du früher vorbeigegangen, hätten sie bestimmt noch welche gehabt«, ärgerte sich Jolene.
»Ach, wirklich? Hast du mit der Apothekerin telefoniert?«
Jolene schüttelte erneut den Kopf und ging mit leicht federndem Schritt ins abgedunkelte Wohnzimmer. Es schien, als schwebe sie auf Wolke Neun. Der Raum hatte noch den Charme der 1970er-Jahre, als bunte, runde Formen die trostlosen eckig-kantigen Designs der Nachkriegsgeneration verdrängten. Der Flokati-Teppich war mit psychedelischen XL-Mustern verziert, die Tapeten im farbigen Flower-Power-Stil. An der Wand eine eingerahmte Fotografie, die Wilsons Eltern 1968 mit den Beatles und dem Guru Maharishi Mahesh Yogi im nordindischen Bundesstaat Uttarakhand zeigte. An der Decke hing eine Orion-Kugellampe. Organisch weiche Kurven dominierten die Gute-Laune-Einrichtung und markierten mit ihren kitschigen Pril-Blumen den Beginn der wehleidigen Pussy-Gesellschaft, die permanent überfordert war und psychische Rundumbetreuung brauchte. Und ein Dauerrezept für Temesta. Wilsons Vater Jamie war in einem knautschigen Modulsofa mit unterpolsterter Polyesterwatte versunken und schaute sich eine Leichtathletik Übertragung an. Das ergraute Haar hatte der 80-Jährige zu einem Rossschwanz gebunden und die weissen Koteletten wuchern lassen. Der Arm hing schlaff über der Lehne, in der Hand hielt er eine zerdrückte Bierdose. Das war sein stiller Protest gegen den Kapitalismus, der es ihm damals ermöglicht hatte, wegen einer Sozialphobie bereits als 24-jähriger eine ¾ Invalidenrente zu beziehen. Wilson konnte sich jedoch nicht erinnern, ob sein Vater Jamie, eine Mischung aus Big Lebowski und einer Figur von Robert Crumb, jemals ein Rockkonzert verpasst hatte. An den Wänden hingen pilzförmige Leuchten, die den Raum in orangerotes Licht tauchten. In einer Ecke stand ein antiker Altar-Schrein aus der tibetanischen Gelugpa Schule. Jolene hatte einen Apfel als Opfergabe niedergelegt. Wilson nahm ihn aus der Schale und biss ein Stück ab. Jolene verwarf die Hände, aber Wilson sagte, dass nicht die Götter, sondern er die Medikamente geholt habe und reichte ihr Bertrands vier Hundertfrankenscheine. Sie zählte nach und steckte sie kommentarlos ein. Wilson zeigte auf Jamie, der gerade das nächste Dosenbier köpfte: »Aber keinen Alk für die US Special Forces. Ich habe keine Lust, ihm auf eBay eine neue Leber zu ersteigern. Der Kerl …«
»Hör auf damit!«, unterbrach ihn Jolene. Sie musterte ihren Sohn, als hätte er Schimmel angesetzt: »Wie siehst du denn aus?«
»Eine Mutter sollte ihren Sohn nach einer Woche noch erkennen, Jolene. Geistige Veränderung im Alter? Oder einfach zu viel gekifft?«
Sie macht eine abfällige Handbewegung: »Kannst du dir keine anständigen Jeans leisten?«
»Vielleicht leihst du mir eines eurer Hare-Krishna-Nachthemden. Orange soll nächstes Jahr ziemlich cool sein.«
»Er hat keinen Respekt, der Motherfucker«, schimpfte Jamie mit schleppender Stimme.
»Respekt muss man sich verdienen«, rief Wilson laut, weil sein Vater auf einem Ohr taub war, »ich habe keinen Respekt vor Leuten, die ihr Kind nackt wie ein Schwein auf einer Hanfplantage herumkriechen liessen.«
Jolene schimpfte: »Lass deinen Frust nicht an uns aus, Bobby. Wenn du ein grosser Künstler wärst, würdest du nicht in Trainerhosen herumlaufen.«