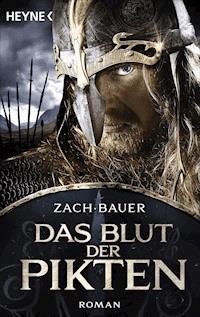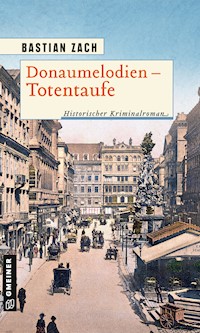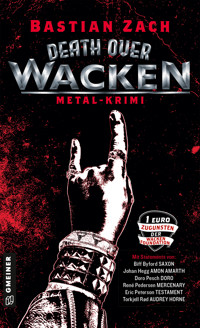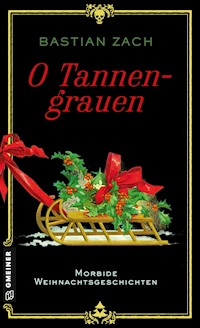Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Geisterfotograf Hieronymus Holstein
- Sprache: Deutsch
Wien, 1877. Ein junger, vornehm gekleideter Mann wird ermordet aufgefunden. Die Polizei legt den Fall schnell als Lustmord zu den Akten. Zu ihrer Überraschung werden Geisterfotograf Hieronymus Holstein und sein Freund, der „bucklige Franz“, von Pathologe Salomon Stricker mit der Aufklärung des Falls beauftragt. Doch nichts ist, wie es scheint. Waren etwa die Fiaker involviert? Und was hatte die berühmte Hellseherin Madame Asima mit dem Opfer zu schaffen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bastian Zach
Donaumelodien – Fiakertod
Historischer Kriminalroman
Zum Buch
Der Tod ist ein Wiener Wien, 1877. Die Polizei handelt einen Leichenfund schnell als Lustmord ab. Zu seiner Überraschung wird Geisterfotograf Hieronymus Holstein von Pathologe Salomon Stricker mit der Aufklärung des Falls beauftragt, doch er und sein Freund, der „bucklige Franz“, tappen im Dunkeln. Eine Spur führt sie zu Wiens Fiakern, eine andere zu der berühmten Hellseherin Madame Asima. Überhaupt scheint das Opfer sehr empfänglich für Spiritismus gewesen zu sein. Aber was in Wien unauffindbar ist, könnte Paris offenbaren. Trotz ihrer Rivalität machen sich Hieronymus und Salomon gemeinsam in die „Stadt der Liebe“ auf und müssen zwischen affektierten Künstlern, Cancan und Absinth erkennen, dass nichts und niemand ist, wie es scheint. Doch die beiden geben nicht auf. Während sich Franz’ Freundin Anezka zu seinem Leidwesen immer mehr in das Legen von Tarotkarten und die Deutung ihrer Zukunft hineinsteigert, wird die Zeit knapp, den Mörder zu finden …
Bastian Zach wurde 1973 in Leoben geboren und verbrachte seine Jugend in Salzburg. Das Studium an der Graphischen zog ihn nach Wien, als selbstständiger Schriftsteller und Drehbuchautor lebt und arbeitet er seither in der Hauptstadt. 2020 wurde sein Krimi-Debüt „Donaumelodien – Praterblut“ für den Leo-Perutz-Preis nominiert. Wiens morbider Flair ist es auch, der ihn zu seinen Kriminalromanen inspiriert, und seine Liebe, Historie mit Fiktion zu verweben, lässt das Wien um die Jahrhundertwende wieder lebendig werden.
Impressum
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2023 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Bildes von: © https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raimund_von_Stillfried-Rathenitz_Der_Hohe_Markt_in_Wien_1898.jpg
ISBN 978-3-8392-7518-4
Widmung
Für meine Lieben.
Karte
Wien, 1877
I
Drei Mal hintereinander hatte Josefine Lewinsky den schweren ehernen Türklopfer betätigt, den ein Löwenkopf aus gleichem Material im Maul hielt. Drei Mal hatte sie auf Antwort gewartet, drei Mal vergeblich.
Aus ihrer abgetragenen Ledertasche, die beinahe so viele Falten und Furchen aufwies wie ihr Gesicht, holte die Frau einen reichlich bestückten Schlüsselbund hervor. Geschickt ließ sie mit dem Daumen einen Schlüssel nach dem anderen den Haltering hinunterrutschen, bis sie fand, wonach sie gesucht hatte.
Als Josefine den Schlüssel ins Schloss der Eingangstür zu der kleinen Villa am Rande der Donaumetropole steckte, umfing sie jäh ein eigenartiger Schauer, einer schrecklichen Vorahnung gleich.
Das Schloss klickte, die Eingangstür schwang knarzend auf.
»Herr Kaderka?« Josefine lauschte, doch erneut ertönte keine Antwort.
Der Schauer, den die Frau eben noch empfunden hatte, war so schnell verflogen, wie er gekommen war, und wich Gleichgültigkeit. Sie zuckte mit den Schultern. Dann war der Herr wohl, entgegen seiner Beteuerung, am heutigen Tage nicht zugegen. Ein Umstand, den die Haushälterin eigentlich guthieß.
So würde sie ihr Auftraggeber nicht in unnötige Gespräche verwickeln oder zu jeder geschlagenen Stunde fragen, ob sie denn einen Tee mit ihm trinken wolle. Josefine Lewinsky konnte ungehindert das verrichten, weshalb sie gekommen war – putzen, waschen und auch sonst den Haushalt des immer noch alleinstehenden Lebemannes in Ordnung bringen. Dass sie bei einem Junggesellen putzte, der dem Vierziger näher war denn dem Dreißiger, hatte ihr zwar den einen oder anderen zweideutigen Zuruf eingebracht, aber Josefine gab nichts auf Gerüchte und Mauscheleien. Gustav Kaderka war eben ein Mann, der sein Leben so genoss, wie er es für richtig hielt, und das bewunderte Josefine an ihm. Dass er nebenbei ein fescher Stenz war, der immer gepflegt auftrat und dabei auch noch die richtige Dosis Parfüm zu verwenden wusste, betrachtete die Haushälterin zusätzlich zu ihrem Lohn als angenehme Vergütung.
Josefine betrat den Eingangsbereich, schloss die Tür hinter sich. Irritiert reckte sie ihre spitze Nase in die Höhe und schnüffelte. Die Luft im Haus roch abgestanden, nach Tabakwaren und schimmligen Lebensmitteln. Seltsam, dachte Josefine, denn dies sah Gustav Kaderka ganz und gar nicht ähnlich. Aber vielleicht hatte er sein Haus schon vor Tagen verlassen, um auf eine kleine Reise zu gehen, und irgendein Lebensmittel unachtsam liegen gelassen.
Josefine schmunzelte unwillkürlich. Oder ihr Dienstherr hatte sich in ein Frauenzimmer verscharmiert und konnte nun nicht von ihr lassen.
Ihr Schmunzeln wurde immer breiter, bis sich ihre Lippen aufs Äußerste spannten. Eigentlich fände sie es schön, wenn dieses Haus in Zukunft belebter wäre, gar durch das Trappeln von Kinderfüßen.
Josefine atmete durch. Dann schritt sie in die kleine Kammer neben der Küche und holte einen Kübel, ein Stück Kernseife sowie einige Putzfetzen.
Gerade setzte sie an, zur Wasserpumpe hinter dem Haus zu gehen, da hörte sie ein leises, erbarmungswürdiges Winseln aus dem ersten Stock.
»Rembrandt?« Die Haushälterin stutzte. Lauschte. Wieder ein Winseln, diesmal noch erbarmungswürdiger.
Josefine ließ Kübel und Putzzeug fallen und stürmte über die hölzerne Treppe ins obere Stockwerk.
»Rembrandt? Wo bist denn?«
Die Schritte der Frau wurden schneller, ihre Stimme hektisch. Sie eilte von einer Tür des Flurs zur nächsten, warf in jedes der Zimmer einen Blick –
Und erstarrte mit einem Mal in der Bewegung.
Vor ihr auf dem Dielenboden, nur wenige Schritte entfernt, kauerte der Kleinspitz, sichtlich geschwächt. Der Hund machte keinerlei Anstalten, Josefine so freudig zu begrüßen, wie er es sonst immer tat, vermochte kaum noch, den Kopf zu heben.
Neben dem Hündchen lag Gustav Kaderka. Seine Haut wirkte fahl wie Käse, der zu lange der Sonne ausgesetzt gewesen war. Seine Augen standen offen, waren starr aufgerissen, die Pupillen milchig. Unter ihm hatte sich eine dunkelrote Lache in den Holzboden gesogen.
Erst jetzt stach Josefine der beißende Gestank der Verwesung in die Nase, ließ sie würgen und um ihr Bewusstsein kämpfen. Sie stürzte zum Fenster, riss die Läden auf, streckte den Kopf, so weit sie konnte, ins Freie.
Dann erbrach sie sich.
Als sie das Gefühl hatte, wieder Herrin ihres Körpers zu sein, wischte sie sich die Tränen aus den Augen, die das Würgen begleitet hatten, und wandte sich um.
Gustav Kaderka lag noch immer am Boden. Rembrandt wich keine Haaresbreite vom kalten Körper seines Herrchens.
Josefine schlug die Hände vor ihrem Mund zusammen, konnte immer noch nicht glauben, was sie sah. Wer um Himmels willen hatte dies nur verbrochen? Kaderka war ein so freundlicher Mann gewesen, jemand, für den Güte und Mitgefühl keine Fremdwörter darstellten. Ein Mensch, der das Leben liebte, kein Geizhals, Grapscher oder Hallodri.
Und nun lag er da, bleich und starr, als wäre er eine Wachsfigur, die aus ihrem Schaukasten gestürzt war.
Josefine straffte sich den Rock und wusste, was sie zu tun hatte: Sie musste umgehend die Polizei alarmieren, musste alles in ihrer Macht Stehende tun, damit der Halsabschneider gefasst wurde, der dieses unmenschliche Verbrechen zu verantworten hatte.
Aber zuallererst wollte sie eine Schale mit Wasser für Rembrandt holen.
II
Die Tabakschwaden in der Kellerschenke »Zum roten Säbel« wogen schwer. Gleich einem seidenen Vorhang schienen sie sich zu öffnen, wenn ein Gast durch sie hindurchwankte, und schlossen sich in kräuselnden Formationen, wenn er sie passiert hatte. Über Jahrzehnte hatten sie das einst ausgeweißelte Gewölbe dunkel gefärbt, hatten die Wandmalereien gebräunt, waren in jede Ritze gekrochen und hatten sich in einer immer dicker werdenden Staubschicht auf dem Gebälk zur Ruhe gesetzt. Jene Gerüche, die der Rauch nicht zu übertünchen vermochte, waren die nach abgestandenem Bier, verschüttetem Wein und kaltem Schweiß.
Die Lokalität war wie immer gut besucht. Doch kaum einer kam hierher, um der Gesellschaft anderer zu frönen. Vielmehr zogen es die meisten vor, neben den anderen allein zu bleiben. Allein mit sich, ihren Gedanken, ihren Sorgen. Überhaupt stellten Letztere den eigentlichen Grund dar, weshalb man sich hierherbegab, von der Außenwelt die schmale Wendeltreppe hinab in die Schank, wo es weder Tag noch Nacht zu geben schien. Ein Raum, losgelöst von der Zeit, entrissen dem Alltag.
Hieronymus stierte auf seinen Bierkrug. Der wenige Schaum, der nach dem Einschenken die Krone gebildet hatte, war nun an den Wänden des Krugs getrocknet, eine verkrustete Erinnerung an jeden Schluck. Am Boden hatte sich ein hauchdünner Satz Bier gesammelt, warm und bar jeder Kohlensäure. Hieronymus griff das Trinkbehältnis, setzte es an die Unterlippe und wartete geduldig, bis auch der letzte Tropfen hinabgelaufen und in seinen Schlund getropft war.
Lauter, als er es vorgehabt hatte, stellte Hieronymus das Gefäß auf den Tisch und winkte dem Wirt, ihm ein neues Bier zu bringen.
Anschließend fingerte er mit ungeschickten Bewegungen das silberne Zigarettenetui aus seiner Rocktasche, ließ es aufklappen und entnahm mit gespitzten Lippen einen Glimmstängel der Marke Eckstein. Mit der Flamme der Kerze am Tisch entzündete er sie.
Hieronymus’ Lungen brannten, ihm wurde schwindelig. Seine Augen suchten hektisch nach etwas, woran sie sich festhalten konnten.
Mit einem Tusch stellte der Wirt, der ob seines aufgedunsenen Gesichts und seiner geröteten Wangen sein eigener bester Kunde zu sein schien, das frisch gezapfte Bier auf den Tisch vor Hieronymus, daneben ein kleines Glas mit klarer Flüssigkeit.
»Den Obstler hab ich nicht bestellt«, sagte Hieronymus mit hörbar schwerem Zungenschlag und ergriff sofort das Stamperl. »Trink ihn trotzdem.«
Der Wirt knurrte etwas Unverständliches und verschwand wieder hinter der Wand aus Rauch.
Mit dem Blick trunkener Erkenntnis betrachtete Hieronymus das kleine Glas in seiner Hand – des Teufels flüssige Manifestation – und leerte es in einem Zug. Nun brannten ihm auch die Kehle, die Speiseröhre, der Magen. Doch all dies war nichts im Vergleich zu dem Schmerz in seiner Seele.
»Karolína«, formten seine Lippen lautlos, mit grausamer Gewissheit. Anscheinend, so kam Hieronymus in den Sinn, war er noch nicht betäubt genug. Er zuckte unwillkürlich mit den Schultern. Und wenn schon. Der nächste Krug voll abgestandenem, kellerkühlem Bier würde es wohl richten. Und wenn nicht, dann der Krug danach.
»Da steckst du also, du Taugenichts!«
Hieronymus kannte die Stimme. Benommen blickte er auf. Vor ihm stand ein kleiner, korpulenter Mann. Das Haupt kaum von den spärlichen grauen Haaren bedeckt, dafür mit buschigen Augenbrauen. Sein Wanst war so beachtlich wie sein Buckel. Franziskus Maria Rudolphi, Weggefährte und engster Verbündeter von Hieronymus.
»Franz.« Hieronymus grinste schmierig und verwies auf die beiden leeren Stühle an seinem Tisch. »Ich würde dir ja gern ein Platzerl anbieten, aber wie’st sehen kannst, sitzt da schon wer.«
Der Bucklige setzte ein mindestens ebenso schmieriges Grinsen auf. »Ah, die Herren Schuld und Reue. Habe d’Ehre!«
Der andere machte eine lapidare Handbewegung. »Nein, die sind erst morgen bei mir zu Gast. Im Augenblick sitzen hier die Gebrüder Istmiralleswurscht.«
»Nüchtern betrachtet bist du besoffen noch weniger zu ertragen, mein Freund und Kupferstecher.«
Hieronymus hob herausfordernd sein Glas. »Da ich dich sowieso nicht davon abhalten kann, so gesell dich halt zu uns.« Er stutzte, verengte die Augen. Sein Blick fixierte die hagere Gestalt, die hinter Franz stand und wirkte, als lauerte sie auf etwas. »Momenterl! Wen hast du da im Schlepptau?«
Franz trat zur Seite, die hagere Gestalt einen Schritt nach vorn. Ein Mann Mitte dreißig, in einen edlen Frack gekleidet, eine Nickelbrille im scharfkantigen Gesicht, den Oberlippenbart zu einer präzisen Linie rasiert.
Hieronymus stieß ein unüberhörbares Seufzen aus. »Ist nicht dein Ernst!«
»Ich freue mich auch, Sie wiederzusehen, Herr Holstein«, sprach der Mann mit näselnder Stimme und norddeutschem Akzent. »Ich hab mich schon immer gefragt, wie einer wie Sie seine Zeit vertrödelt. Und nun, da ich es weiß, wünschte ich, ich wüsste es nicht.«
Hieronymus griff das Schnapsglas, versuchte verzweifelt, noch einen letzten Tropfen mit der Zunge zu ergattern. Vergebens. Resigniert ließ er es über den Tisch kullern.
»Warum genau schleppst du den Leichenschänder zu mir?«
Der Pathologe Salomon Stricker goutierte die Insultation mit einem lakonischen Zucken der rechten Augenbraue. Seitdem er vor einem Dreivierteljahr die Bekanntschaft des Geisterfotografen Hieronymus Holstein und seines Begleiters, dem buckligen Franz, gemacht hatte, waren sich die Herren so sympathisch wie Hund und Katze.
Franz rückte den einen Stuhl für seinen Gast zurecht. Auf den anderen ließ er sich ächzend fallen, was dieser ebenso ächzend quittierte.
»Ich weiß«, begann Franz, während Salomon ebenfalls Platz nahm, »du bist hier, um von mir und allen anderen, denen du am Herzen liegst, möglichst weit weg zu sein. Hab ich in den letzten Wochen auch respektiert, oder?«
Hieronymus machte eine zwiespältige Handbewegung.
»Also, von mir aus kannst du dir den Seelenschmerz wegsaufen. Oder –«
»Dann hätten wir das auch besprochen«, unterbrach ihn der Geisterfotograf. »Danke für die Visite.«
»Jetzt reißen Sie sich mal am Riemen, Mensch!« Salomons Stimme hallte durch das Gewölbe des Sabelkellers. Gespräche verstummten.
Hieronymus antwortete auf den energischen Einwand mit einem demonstrativ großen Schluck Bier, gefolgt von demonstrativem Schweigen.
»Also gut«, versuchte sich Franz erneut zu erklären. »Hör dir an, was der Herr Stricker zu berichten weiß. Wenn du dich danach immer noch vernichten willst, stehen wir auf und gehen.«
Hieronymus überlegte, was angesichts seines nicht unbeträchtlich alkoholisierten Zustands länger dauerte, als er selbst wahrnahm. Schließlich winkte er dem Wirt, Nachschub zu liefern.
»Na dann packen Sie mal aus, Sie Fleischhackerbub. Aber zuerst –«
Der Wirt stellte drei Krüge mit Bier am Tisch ab und ging erneut wortlos.
»Zuerst trinken wir. Wird Zeit, dass der Herr aus dem Norden den original Wiener Fensterschwitz1 kennenlernt.«
Franz verdrehte genervt die Augen. Dann stießen die drei Männer an und tranken.
Mit diebischer Freude beobachtete Hieronymus, wie es den Pathologen bei jedem Schluck würgte. Und dass dieser sich sein Unwohlsein tunlichst nicht anmerken lassen wollte.
»Wohlan«, gab Hieronymus sich höfisch. »Was ist Euer Begehr?«
Salomon atmete tief durch, was aufgrund der schlechten Luft einen hässlichen Hustenanfall mit sich zog. Nachdem er sich ausgiebig geräuspert hatte, wurde er todernst.
»Zunächst einmal können Sie mir glauben, dass ich im Augenblick überall sonst lieber wäre als hier bei Ihnen. Und dennoch bin ich gekommen, da ich vermeine, nur Sie können mir helfen. Sie und Ihr freundlicher Freund.«
»Geh, ich bin einfach der bucklige Franz«, warf der ein, ohne dass dies in irgendeiner Weise vonnöten gewesen wäre.
Hieronymus fixierte sein Gegenüber. »Eine Angelegenheit, bei der nur wir Ihnen helfen können? Was ist denn geschehen? Sind Sie aufgrund Ihrer hochtrabenden Art bei Polizeipräsident Marx in Ungnade gefallen?« Er hielt inne. »Nein! Sagen Sie nichts! Sie haben eine Mamsell aufgeschnitten und dabei erkannt, dass sie noch gar nicht tot war, doch nun ist sie es?«
Salomon rang nach Worten.
Franz rieb sich peinlich berührt die Stirn.
»Oder haben Sie –«
»Ein Bekannter von mir wurde ermordet.« Salomons Worte klangen kalt und unnahbar, offensichtlich um zu verhehlen, wie nahe sie ihm gingen.
»Ein … Mord?« Nun wurde auch Hieronymus ernst. »Sollten Sie damit nicht zur Polizei gehen?«
»Dort war ich schon«, antwortete der Pathologe. »Doch dort gedenkt man, einen feuchten Kehricht zu tun.«
Hieronymus zog an seiner Zigarette und sah zu Franz. »Warum in Gottes Namen sollte es der Heh2 wurscht sein?«
Der andere zuckte mit den Schultern.
»Erklär ich Ihnen später«, fuhr Salomon unbeirrt fort. »Aber –«
»Was ist mit Polizeipräsident Marx?«, schlug Hieronymus vor. »Belästigen Sie doch ihn damit. Der freut sich immer über –«
»Der Herr Polizeipräsident weilt mit seiner Frau Gemahlin zur Kurfrische in Baden. Und sein Stellvertreter hat so viel Rückgrat wie ein französischer Soldat.«
»Also sollen der Franz und ich in der Sache für Sie ermitteln. Hab ich Sie da richtig verstanden?«
Salomon nickte entschlossen.
Hieronymus ließ nicht locker. »Nach all unseren Zwistigkeiten, Verbalinjurien und Keppeleien3 kommen Sie also zu uns und erbitten unsere Hilfe?«
Erneut nickte der Pathologe.
»Dann sagen Sie’s doch auch.«
Der andere runzelte irritiert die Stirn.
»Erbitten Sie unsere Hilfe«, wiederholte Hieronymus und lehnte sich provokant leger in seinem Stuhl zurück.
Franz rollte erneut mit den Augen. »Heast, muss das Spielchen sein?«
Als Antwort setzte Hieronymus ein genüssliches Grinsen auf und verschränkte seine Arme vor seinem Bauch.
Salomon stieß ein angewidertes Schnauben aus, atmete behutsam durch. »Wenn es Ihnen so wichtig ist: Ich erbitte untertänigst Ihre Hilfe bei der Aufklärung des Mordes an meinem Bekannten.«
Hieronymus nickte. »Nein.«
Ein wütender Schlag mit der Faust auf den Tisch ließ erneut die Gespräche im Raum verstummen.
»Jetzt reiß dich zusammen!«, knurrte Franz seinen Freund an. »Oder ich werde echt ungemütlich.«
Der seufzte übertrieben angestrengt. »Ja, verdammt. Wir können uns zumindest einmal ansehen, worum es bei der Sache geht. Wann ist der Mord denn geschehen?«
»Vor sieben Tagen.« Salomons Stimme klang mit einem Mal rissig.
»Können wir den Tatort betreten?«
Der Pathologe holte einen Notizzettel aus seinem Frackrock und gab ihn Franz. »Die Adresse. Morgen um zehn?« Dann wandte er sich wieder Hieronymus zu: »Schaffen Sie das?«
»Ich werde mein Unmöglichstes tun.«
Salomon Stricker stand auf, schüttelte Franz die Hand und nickte Hieronymus zu. Er hielt inne, schien mit sich zu ringen. Dann presste er ein knappes »Danke« hervor.
»Gehaben Sie sich wohl.« Hieronymus winkte dem Mann in einer Art hinterher, wie es Eltern mit Kleinkindern taten.
»Du kannst schon ein gehöriger Arsch sein«, knurrte der Bucklige und trank von seinem Bier.
»Danke, ich bemühe mich redlich«, meinte Hieronymus süffisant und erhob sein Glas. »Ich bemühe mich redlich.«
1 Volkstümlich: billigstes, abgestandenes Dünnbier.
2 Wienerisch: Polizei.
3 Wienerisch: Gezanke.
III
Eine Burg, die über einer Stadt thront.
Eine Tür, die eingetreten wird.
Schemenhafte Gestalten, auf ihn zustürmend.
Ein Schlag.
Die rechte Hand, die auf eine Tischplatte gedrückt wird.
Ein Beil, das hinabsaust.
Ein kleiner Finger, eben noch Teil von ihm selbst,
nun abgehoben neben der Hand liegend.
Dann ein stechender Schmerz, rot und alles beherrschend –
Die Nacht hatte aus verzerrten Bildern bestanden, aus zerfetzten Erinnerungen und kakophonischen Klängen. Hieronymus war, als hätte er kein Auge zugetan, und zugleich, als hätte er nicht aus seinem Albtraum erwachen können.
Doch bald würde es so weit sein. Bald würde die Wirklichkeit seine Albträume zerschmettern. Dann, wenn er Karolína wiedersehen konnte. Seine Karolína, die Liebe seines Lebens. Jene Frau, die er so lange tot geglaubt hatte. Die nur mehr in Hieronymus’ Erinnerung lebte, die seine Träume beherrschte, seine Albträume. Schemenhafte Fratzen eines früheren Lebens, das so gänzlich anders verlaufen war, als er sich erhofft hatte. Gleißende Erinnerungen voll Schmerz und Pein. Und doch –
Das schier Unmögliche war Wirklichkeit geworden, als Karolína am einundzwanzigsten Dezember aus dem Zug gestiegen war, gänzlich vertraut und doch so fremd.
Hieronymus’ Herz war für Minuten stillgestanden, das mochte er beschwören, bis zu dem Augenblick, als er seine Liebste endlich wieder in die Arme geschlossen hatte. Alles schien wieder gut zu sein, all die Qualen wie weggeblasen. Dann hatte Karolína jene Worte gesprochen, um die sich Hieronymus’ Gedanken seither drehten: »Ich kann mich nicht an dich erinnern.«
Den Schock, den diese Worte ausgelöst hatten, musste er erst einmal verdauen. Der Geisterfotograf verstand nicht, was sie bedeuteten. Erst hatte er gehofft, nur vorgeführt zu werden, ein – wenn auch grausamer – Spaß auf seine Kosten. Doch schnell war ihm bewusst geworden, dass es dies nicht war. Karolína konnte sich tatsächlich nicht daran erinnern, dass sie mit Hieronymus einst das Band der Liebe verbunden hatte, dass sie ihm als Zeichen ihrer Liebe einen Ring geschenkt hatte, den ihr Vater dem Geisterfotografen mit dem Beil vom Leib hatte trennen lassen – mitsamt dem Finger daran. Und sie konnte sich auch nicht daran erinnern, dass sie sich das Leben hatte nehmen wollen, woraufhin sie ihr Vater in ein Kloster verbannt hatte.
Erst von da an, im Kloster von Zarnowitz, wo sie alle »Schwester Krystyna« nannten, begannen Karolínas Erinnerungen für sie wieder greifbar zu werden.
Und obwohl Hieronymus alles in seiner Macht Stehende versucht hatte, dass sich seine Liebste an die gemeinsame Zeit erinnerte, blieb er doch erfolglos. Ebenso wie Karolínas Bruder František, bei dem sie seit ihrer Ankunft in der Donaumetropole wohnte.
Von der Schuld seiner Verfehlungen seiner Schwester gegenüber geplagt hatte František Koffer packen lassen und Hieronymus versprochen, er wolle quer durch Europa reisen, in der Hoffnung auf Heilung für Karolína. Denn auch sie wollte sich erinnern. Durch die Lücken in ihrem Gedächtnis fühlte sie sich leer und wie ausgehöhlt.
Hieronymus rappelte sich auf, streifte die speckige Filzdecke ab, die ihn auf seinem Strohsack stets warm hielt. Er raufte sich die Haare, versuchte, die Träume abzuschütteln.
Der Morgen war noch nicht angebrochen, die kleinen Fenster in der Stube wirkten, als wären sie mit Glas verschlossene Öffnungen ins Nichts. Auf der anderen Seite des Raums schimmerte ein wenig Glut im ehernen Ofen, auch wenn diese nicht mehr imstande war, der Kälte im Raum Paroli zu bieten.
Als Hieronymus Geräusche aus der Kammer neben sich vernahm, in der Anezka und Franz schliefen, wusste er, dass es Zeit war aufzustehen.
Obwohl die kommenden Stunden nur ein Aufschub bis zu neuerlichen Albträumen darstellen würden.
IV
»Hast du nicht was vergessen?«
Die Frage von Anezka Svoboda, ihres Zeichens Fratschlerin4 und Quartiergeberin von Hieronymus und Franz und seit nicht allzu langer Zeit auch Partnerin von Letzterem, klang mehr wie ein Befehl. Unterstrichen wurde dies von ihrem harten böhmischen Akzent.
Franz wandte sich um. Er stand am Ende des Hofs neben Hieronymus und war gerade im Begriff gewesen, in den Fiaker zu steigen, den sie für die Fahrt zu Salomons Adresse hatten kommen lassen.
Anezka hielt ein kleines, in Leinen geschlagenes Bündel in die Höhe.
Der Bucklige stapfte in Richtung des schiefwinkeligen Hauses, das seit einem Dreivierteljahr ihr Zuhause darstellte und in dem er neben einem warmen Schlafplatz die Liebe gefunden hatte. Auch wenn diese zuweilen ruppig sein konnte.
Anezka, die das entbehrungsreiche Leben mit ihren knapp dreiunddreißig Jahren wesentlich älter aussehen ließ, als sie war, zog das Bündel just in dem Augenblick zurück, als Franz es greifen wollte.
»Was hast du außerdem vergessen, můj drahý?« Sie blickte ihren Liierten herausfordernd an.
Der verstand. Franz gab ihr einen Kuss auf den Mund. »Verzeih, Liebes.«
Nun erst durfte er das Päckchen nehmen.
»Anezka hat dir ein paar Butterbrote geschmiert.« Sie lächelte schief. »Kannst ja dem Herrn Holstein auch was davon abgeben.«
Franz nickte. »Wird nicht spät werden.«
»Das ist aber keine dieser Sachen, wo dir einer nach dem Leben trachtet, oder?«
»Diesmal nicht«, versuchte sich Franz im Scherz, merkte aber an Anezkas verengten Augen, dass sie bei dem Thema wohl keinen Spaß mehr verstand.
»Gut, ich versprech es dir.«
Die Fratschlerin seufzte laut genug, um zu verdeutlichen, dass sie ihm offenkundig nicht glaubte. »Passt auf euch auf. Anezka will nicht um jemanden trauern, den sie im Herzen trägt.«
Ohne jede Hast zogen die Rappen den Fiaker, durch Alleen, vorbei an kleinen, idyllischen Häusern und aus Backstein gemauerten, weniger idyllischen Industriegebäuden. Mit einem Mal roch es stechend und brandig. Das Fuhrwerk passierte die rauchenden Schlote der Wienerberger Ziegelfabrik, die einst Heinrich Drasche zu Europas größter Ziegelei ausgebaut hatte, was ihn zum »reichsten Mann Wiens« machte. Und das, obwohl er Pensionsfonds, eine Kinderbewahranstalt sowie Arbeiter-Cassen für die Krankenfürsorge hatte einrichten lassen. Seitdem das Werk jedoch 1869 zur »Wiener Ziegelfabriks- und Baugesellschaft« umgewandelt worden war, war von den sozialen Ambitionen ihres einstigen Eigentümers nicht mehr viel geblieben.
Allmählich wurde die Luft wieder besser, es roch nach Aufbruch und Neubeginn. Das Gezwitscher von Vögeln und die vereinzelten Knospen und grünen Blätter auf Büschen und Bäumen bekräftigten das Bild – der Frühling war angebrochen.
Im offenen Wagen sitzend genoss Franz sichtlich das herrliche Wetter.
»Erst die frische Brise macht einem den Schädel so richtig frei. Ganz anders als diese versiffte Luft in irgendwelchen Tschocherln, hab ich recht?«
Hieronymus zuckte mit den Schultern. »Also ich bin heute Morgen ohne Kater aufgewacht, wenn du auf gestern anspielst.«
Franz rieb sich über den beinahe kahlen Schädel. »Ein Umstand, der dir eigentlich Anlass zur Sorge geben sollte, wie ich finde. So, wie du gestern beieinander warst.«
»Was ich immer sage: Ein halber Rausch ist verplempertes Geld.«
Der Bucklige lachte glucksend. »Nachdem man sich nun mit dir wieder einigermaßen sinnstiftend unterhalten kann: Was hältst du von Strickers Ansinnen?«
Der Geisterfotograf strich sich über seinen dreieckigen Kinnbart. »Schwer einzuschätzen. Aber wenn er sich dazu hinablässt, uns um Hilfe zu bitten, dann steht ihm der Ermordete näher, als er im Augenblick bereit ist zuzugeben.«
»Mich hat vielmehr überrascht, dass dem Pathologen überhaupt irgendwer am Herzen liegt. Hatte ihn bisher für einen unnahbaren Einzelgänger gehalten.«
»Na ja, selbst Napoleon soll Freunde gehabt haben. Mich wundert, dass die Polizei die Sache so schnell auf sich beruhen lässt. So was kenne ich eigentlich nur, wenn es sich um einen Griasler5, Mordbuben oder ähnliche Klientel handelt.«
Hieronymus’ Blick schweifte in die Ferne, blieb dabei jedoch fokussiert und klar.
Franz entging das nicht. »Na schau, kann sich da vielleicht einer doch zu mehr durchringen, als im Fusel das Vergessen zu suchen?«
Mit einer lapidaren Handbewegung versuchte der Geisterfotograf, das Offensichtliche abzutun. »Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.«
»Nein«, bekräftigte Franz. »Aber sie ist womöglich das erste Anzeichen einer Veränderung.«
Die kleine Villa am Fuß der Weinberge des Wiener Vororts Döbling besaß eine herrschaftliche Ausstrahlung. Das riesige Geweih, das unter einem der Giebel thronte, verwies darauf, dass der Besitzer das Recht zur Jagd besaß und daher wohl adliger Abstammung war. Das Erdgeschoss war gemauert und in hellem Gelb gestrichen. Der obere Stock war mit dunklem Holz vertäfelt, das, wie auch das Mauerwerk darunter, bereits deutlich von Verwitterung gezeichnet war, was allerdings zu seinem Charme beitrug.
Vor dem schmiedeeisernen Eingangstor wartete ein Mann, gekleidet in einen Frack.
Hieronymus entlohnte den Fiaker für seine Fuhre. Dann stiegen er und Franz aus der Kutsche.
»Herr Holstein, Herr Rudolphi«, begrüßte Salomon die beiden Herren.
»Herr Stricker. Immer noch im selben Zwirn wie gestern?«, stichelte Hieronymus.
Der andere gab sich überrascht. »Sie können sich daran erinnern, was ich gestern anhatte? Respekt.«
»Im Gegensatz zu der rauen Profession, Menschen irgendwie aufzuschneiden, will das Trinken eben gelernt sein.«
Franz hob die Hände, die Schaufelblättern glichen. »Nachdem wir uns jetzt alle gegenseitig einen guten Morgen gewünscht haben, wollen wir nicht zur Tat schreiten? Oder besser gesagt, zur Besichtigung des Ortes einer solchen?«
Salomon rückte sich die Nickelbrille zurecht. »Sie haben recht. Ich freue mich, dass Sie es beide einrichten konnten.«
Er schwieg für einen Augenblick, in scheinbarer Erwartung einer zynischen Reaktion, doch es kam keine. »Hinter mir liegt das Haus von Gustav Kaderka. Der Mann ist – war siebenunddreißig Jahre alt, alleinstehend, keine Kinder bekannt. Das Anwesen hat er vor ein paar Jahren gekauft. Seinen Lebensunterhalt verdiente er als Uhrmachermeister.«
»Da möchte man beinahe sagen: wem die Stunde schlägt«, meinte Franz mehr zu sich selbst. »Aber na ja.«
»Gibt es ein Testament, irgendwelche Begünstigten, die von Kaderkas Tod profitieren würden?«, fragte Hieronymus, ohne den Blick vom Haus abzuwenden.
Der Pathologe schüttelte den Kopf. »Notarielles ist nichts bekannt. Es scheint keine Verwandten zu geben, mit Ausnahme seiner Schwester.«
Er zückte einen Notizblock, blätterte, bis er gefunden hatte, wonach er suchte. »Seine Schwester ist ein Jahr jünger. Eine Minna Ohlden, verwitwet.«
»Verschuldet?«
Erneut ein Kopfschütteln. »Ihr Gemahl war mit Aktien an verschiedenen Unternehmen beteiligt. Die Gewinnausschüttungen sind auch letztes Jahr beträchtlich gewesen. Mehr geben die Polizeiakten nicht her.«
»Polizeiakten?« Hieronymus wurde hellhörig. »Da scheint sich ja einer überraschend wenig an den Dienstweg zu halten, was? Oder an Zuständigkeitsbereiche«, raunte er Franz zu. »Wenn Sie so weitermachen, werden Sie noch zu einem ähnlich guten Ruf kommen wie der Franz und ich. Dann ist Schluss mit der moralischen Erhabenheit.«
»Da hätte ich wohl noch arg viel aufzuholen«, entgegnete Salomon und fuhr fort: »Spuren eines Einbruchs wurden am Haus keine gefunden. Nur drei Personen besaßen einen Hausschlüssel. Kaderka selbst. Seine Schwester. Und seine Haushälterin, eine gewisse Josefine Lewinsky. Sie hat mir ihren Schlüssel überlassen und sie war es, die den Toten gefunden hat. Ihn und seinen Hund.«
»Man hat auch seinen Hund getötet?« Franz’ Stimme klang überraschend empört.
Salomon wiegelte ab. »Nein, das Tier hat überlebt. Kaderkas Schwester hat sich seiner angenommen. Im Inneren des Hauses scheint auch nichts –«
»Ich weiß, es klingt abwegig«, unterbrach ihn Hieronymus dreist grinsend. »Aber sollten wir uns nicht einmal selbst einen Eindruck vom Tatort verschaffen?«
Der Pathologe hielt kurz inne. Dann zückte er den Hausschlüssel und wies den Weg.
Im Inneren des Hauses roch es muffig, immer noch nach Verwesung. Salomon ging voraus, nahm die Treppe ins Obergeschoss. Dann wies er in das Studierzimmer, dessen Dielenboden ein großer dunkler Fleck zierte.
»Hier hat die Haushälterin Kaderka gefunden«, sagte Salomon und zeigte in die Raummitte.
Hieronymus und Franz betraten ebenfalls den Raum, sahen sich um.
»Todesursache?« Hieronymus blickte zu Salomon. »Ich nehme an, Sie haben die Leichenschau gemacht?«
Der Angesprochene nickte knapp, deutete dann mit dem Zeigefinger seiner rechten Hand auf seine linke Brust, knapp oberhalb des Herzens. »Kaderka wurde erschossen. Aus nächster Nähe, wie die Schmauchspuren an Kleidung und Haut nahelegen.«
»Hat man ihm die Waffe auf die Brust gedrückt?«
»Nein, ich denke nicht. Dann wären die obersten Haut- und Gewebeschichten stärker zerfetzt und verbrannt gewesen. Warum –«
»Vielleicht nicht von Bedeutung«, meinte Hieronymus. »Aber wenn man jemandem die Waffe von vorne auf den Körper drückt, handelt es sich oft um Notwehr aufgrund einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Ein Schuss aus der Distanz spricht eher für kaltblütigen Mord. Haben Sie die Kugel gefunden?«
»Nur Bruchstücke davon. Das Projektil hat sich kurz nach dem Eintreten in den Körper zerteilt, die Einzelteile haben sich durch seine Innereien gefräst wie gierige Maden.«
Franz schluckte. »Danke für die anschauliche Beschreibung.«
»Woher kannten Sie den Mann eigentlich?«, wollte Hieronymus wissen.
Salomon zuckte unwillkürlich zusammen, gleich einem Kind, das man bei etwas Verbotenem auf frischer Tat ertappt hatte.
»Ich … kannte Herrn Kaderka von der Oper. Er und ich schienen einen ähnlichen Kunstgeschmack zu teilen. Er war nur eben –« Der Pathologe brach ab.
Franz warf Hieronymus einen fragenden Blick zu. Der antwortete mit einem unwissenden Gesichtsausdruck.
Salomon straffte seinen Frack. »Es mag wenig professionell klingen«, begann er zögerlich. »Aber es ist etwas anderes, ob man bei der Leichenschau eine unbekannte Person vor sich liegen hat oder jemanden, von dem man annimmt, ihn am nächsten oder übernächsten Sonntag wiederzusehen, verstehen Sie?«
»Ich denke, das tun wir«, sagte Hieronymus ohne jeden Hohn. »Es … tut mir sehr leid. Ehrlich.«
Er machte eine kurze Pause, damit sich der Pathologe fangen konnte. »Wollen wir uns das Haus besehen? Vielleicht wurde ja doch etwas gestohlen oder beschädigt?«
Die anderen beiden im Raum nickten stumm.
4 Obstverkäuferin ohne festen Stand.
5 Wienerisch: Obdachloser.
V
Ohne jede Wolke stand die Frühlingssonne am Himmel, während Stadt und Land unter ihr aus dem Winterschlaf zu erwachen schienen. Vögel zwitscherten wild durcheinander, als wollten sie ihren Artgenossen über all das berichten, was sie während der Wintermonate erlebt hatten. Zarte Knospen an Bäumen und Büschen reckten sich, um möglichst viel Wärme und Licht zu ergattern. Und die Kinder liefen johlend und kreischend umher, weil sie instinktiv wussten, dass von nun an die Tage wieder länger und wärmer sein würden.
Anezka Svoboda riss ein Fenster nach dem anderen in ihrem schiefwinkeligen Haus in der Vorstadt auf und genoss es, dass der heutige Tag ihr allein gehören würde. Ohne Kinder, die tollten irgendwo draußen herum. Ohne Hieronymus, dessen Aufenthaltsort sie kein bisschen interessierte. Und ohne Franz, mit dem sie zwar seit Ende letzten Jahres lose liiert war, doch auch gut ohne ihn zurechtkam – vorausgesetzt, sie wusste, wo er sich herumtrieb.
Nachdem Anezka alle Fenster geöffnet hatte, spürte sie, wie ein lauer Wind durchs Haus zog, ihr Gesicht umschmeichelte und ihr eine feine Gänsehaut auf die Arme zauberte. Mit geschlossenen Augen sog sie die frische Luft ein und atmete aus. Vielleicht, so kam ihr in den Sinn, würde dies ja ein schönes Jahr werden. Verdient hätte sie es sich, davon war sie überzeugt.
Um ihre Stimmung noch weiter zu heben, schenkte sie sich ein Gläschen Schnaps ein – einen »Putzsli«, wie sie ihn spontan taufte, einen Putz-Sliwowitz.
Sie genoss das scharfe Gebrannte auf einen Zug. Dann begann sie beschwingt, den Boden mit einem Reisigbesen zu fegen.
Die Strohsäcke aller, die im Hause schliefen, neun an der Zahl, schleifte sie auf den Hof und postierte sie in der Sonne. Sie füllte einen Kübel mit Wasser aus dem Brunnen und wischte Dielen und Möbel feucht ab.
Bei der Truhe neben dem Ofen machte sie eine Pause, öffnete diese und kramte in den Habseligkeiten, die sich über die Jahrzehnte angesammelt hatten – Erinnerungsstücke, die ihr ganzes Leben umspannten:
Das kleine Püppchen aus Stoff, das ihre Mutter ihr noch genäht hatte, bevor sie die Schwindsucht dahingerafft hatte. Den Orden der Eisernen Krone, den ihr Großvater für herausragende militärische Dienste verliehen bekommen hatte. Eine getrocknete Rose – oder was davon übrig war –, die ihr Leoš an jenem Tag in Prag geschenkt hatte, an dem sie gemeinsam nach Wien aufgebrochen waren, »in ein besseres Leben«. Doch von diesem Versprechen war genauso viel übrig geblieben wie von der Blume.
Anezka kramte weiter. Säckchen aus Leinen, in denen sie die Milchzähne ihrer Kinder aufhob. Und schließlich die Tarotkarten ihrer Großmutter. Wann immer Anezka eine Frage gehabt oder nicht weitergewusst hatte, war sie zu ihrer Babička gelaufen, die sogleich in den Karten gelesen hatte, was ihr Schicksal für eine Wendung nehmen würde.
Dass Leoš nicht ihr Ritter auf hohem Ross gewesen war, hatte Anezka damals ignoriert – die Karten wussten schließlich nicht alles. Und doch hatten sie recht behalten.
Anezka blätterte die Karten durch, deren Papier aufgequollen war, während sich die Oberfläche speckig anfühlte. Dabei sah sie die von der Gicht knorrig gewordenen Hände ihrer Babička, ihr wohlwollendes Lächeln.
Die Fratschlerin wischte sich eine Träne von der Wange. Bittersüß war sie ihr plötzlich hinabgelaufen, in Dankbarkeit, dass sie eine solch gütige und liebevolle Großmutter hatte haben dürfen. Und in Trauer, da sie diese nun nicht mehr um Rat fragen konnte, auch wenn ihr so vieles unklar erschien in ihrem Dasein.
War es ein Fehler gewesen, Franz in ihr Leben zu lassen, in ihr Herz? Nicht, dass sie nicht glücklich mit ihm war, doch Zweifel blieben. Zweifel, die ihre Großmutter schnell ausgeräumt hätte, denn diesmal würde Anezka sich an das halten, was ihr die Karten wiesen.
Entschlossen legte sie das Kartenbündel zurück in die Kiste, schloss diese wieder. Was sollte die Gefühlsduselei? Sie war eine gestandene Frau Anfang dreißig, und wenn ihr das Glück wohlgesonnen war, hatte sie noch zehn, vielleicht fünfzehn gute Jahre vor sich. Sie musste ihre Kinder großziehen, musste ihnen all das fürs Leben mitgeben, wozu ihre Mutter bei ihr einst nicht mehr imstande gewesen war.
Da blieb schlicht kein Platz für Zweifel.
VI
Die Räume im Haus des Ermordeten wirkten, als wäre in ihnen die Zeit stehen geblieben. Nichts, was den Anschein erweckte, es sei aufgerissen oder durchsucht worden. Nichts, was gemessen an der Staubschicht, die es umgab, an einen anderen Platz gerückt worden wäre. Unterstrichen wurde dieser Eindruck von den schier unzähligen Wanduhren, die beinahe jeden freien Platz für sich beanspruchten und von denen keine mehr tickte.
Selbst die Flaschen im Weinkeller schienen unangetastet, ebenso die vielen Lebensmittel in der Vorratskammer.
Mit penibler Genauigkeit überprüften Hieronymus und Franz alle Fenster und Türen auf Spuren eines Einbruchs. Ohne Erfolg. Keinerlei Anzeichen auf die Verwendung eines Brecheisens oder sonstiger Gewalteinwirkung.
Die drei Männer teilten sich auf, jeder nahm sich einen anderen Raum im Haus vor, den er akribisch nach dem kleinsten Hinweis absuchte – Küche, Salon, Ankleidezimmer, Abstellraum, Schlafgemach, Bibliothek. Alle Räume waren zusammengeräumt, alles schien sich an seinem angestammten Platz zu befinden. Keine leere Stelle an der Wand, an der ein wertvolles Gemälde gehangen haben könnte, kein Häkeldeckerl, das nur zum Selbstzweck dalag.
Franz und Salomon trafen im Eingangsbereich wieder aufeinander, beide mit dem gleichen resignierten Gesichtsausdruck.
»Öha!« Hieronymus’ Ausruf erschallte von oben.
Die beiden Männer eilten die Treppe hinauf, fanden den Geisterfotografen im Studierzimmer vor, eine kleine Mappe in Händen. Und mit argwöhnischem Blick.
»Was –« Der Pathologe brach ab, spürte, dass etwas auf ihn zukommen würde.
»Sagen Sie, Herr Stricker«, begann der Geisterfotograf ohne Hast. »Gestern wollten Sie uns nicht sagen, weshalb die Polizei den Fall nicht weiterverfolgt hat. Nun würde es mich aber brennend interessieren.«
Salomon schluckte. »Jemand brachte das Gerücht auf, Kaderka könnte, also, Sie wissen schon … ein Sodomit gewesen sein.«
Franz runzelte die Stirn. »Und? Warum halten Sie damit so lange hinter dem Berg?«
»Nun ja«, sagte Salomon kleinlaut. »Was wirft das auf mich für ein Licht, wenn ich mit einem Sodomiten Bekanntschaft pflegte?«
»Beim Herrn, es gibt wahrlich schlimmeren Umgang!«, entgegnete der Bucklige erbost.
»Mit einem Totschläger, beispielsweise, oder einem Kinderschänder. Die Liste ist lang.« Hieronymus deutete mit beiden Daumen auf sich. »Sogar besser, als mit einem wie mir bekannt zu sein, oder?«
Salomon nickte kleinlaut. »Sie haben natürlich recht. Aber die Leute –«
»Die Leute sind Idioten.« Franz’ Stimme klang zornig. »Versaufen, verhuren und verspielen ihren ganzen Lohn, schlagen ihre Weiber, aber: ›Er war ja so ein guter Christ, weil er jeden Sonntag in die Kirche gegangen ist.‹« Er spuckte verächtlich aus. Als ehemaliger Mönch, der sich vom Klerus abgewandt hatte, wusste Franz ob der Wohltaten der Religionsverfechter – und ihrer schändlichen Verfehlungen.
»Selbst wenn also Gustav Kaderka die Gesellschaft von Männern bevorzugt hat«, ließ Hieronymus nicht locker, »ist das doch noch lange kein Grund, den Fall polizeilich nicht weiterzuverfolgen, oder?«
»›Lustmord im Milieu‹ hat der leitende Polizeiagent in seinen Bericht geschrieben. Fall erledigt.« Salomon seufzte. »Ich meine jedoch, dass jedes Opfer ein Recht darauf hat, dass man seinen Täter findet.«
Hieronymus nickte. »Deshalb sind wir hier. Und was die angeblichen sexuellen Vorlieben des Opfers betrifft –« Nun hielt er die Mappe in seiner Hand in die Höhe. »Womöglich waren die hervorgebrachten Gerüchte eben keine.«
Er faltete die Mappe auf. In ihr lagen Fotografien, die einen Mann zeigten, der mehr oder weniger nackt posierte.
»Ist das Kaderka?«
Salomon nahm eines der Lichtbilder. »Das war er. Ein wenig jünger, aber ja.«
»Gut«, warf Franz ein, »ein paar erotische Bilder. Das sagt noch gar nichts.«
Hieronymus zückte eines der unteren, auf dem Kaderka einen ebenfalls unbekleideten Mann küsste, und hielt es Franz vor die Nase.
»Überzeugt. Kaderka war also Sodomit. Meint ihr, sein Freund oder Liebhaber hat ihn ermordet?«
»Eine Beziehungstat ist nie auszuschließen, im Gegenteil«, meinte Hieronymus nachdenklich. »Aber dafür muss man zuerst in einer Beziehung gewesen sein.«
Er sah zu Salomon, der unwissend mit den Schultern zuckte.
Dann ging der Geisterfotograf zu mehreren Schatullen, die auf einer Kommode standen, und öffnete sie. »Hierin befinden sich immer noch Schmuck und andere Gegenstände von Wert.«
»Also auch kein Raubmord?« Salomon schien die Erkenntnis mitzunehmen.
»Keine Spuren eines Einbruchs«, fasste der Geisterfotograf zusammen, »Kaderka hat den Täter vermutlich gekannt. Offenbar kein fehlendes Inventar, kein erkennbarer Vandalismus. Das Tafelsilber ist noch hier, der Schmuck, ebenso vieles mehr, was man zu Geld machen kann. Und dann haben wir noch eine Schusswunde aus nächster Nähe und einen zurückgelassenen Wauwau.«
Salomon strich sich mit Daumen und Zeigefinger den Oberlippenbart glatt. »Ein eigenartiges Konglomerat, da muss ich Ihnen recht geben. Was wollen Sie nun tun?«
»Ich vermeine, wir sollten jemanden befragen, der Gustav Kaderka gut kannte. Der ihn wirklich gut kannte.«
Franz spitzte die Lippen. »Aber geh, den Hund kannst du doch nicht befragen.«
»Den –?« Hieronymus ballte gespielt die Faust. »Idiot! Ich rede von Kaderkas Schwester.«
VII
Minna Ohlden war eine Frau Mitte dreißig, der man ansah, dass sie in den letzten Tagen viel Kummer ertragen hatte. Die Tränensäcke unter den glasigen Augen wogen schwer, ihre Nase war von der zu häufigen Benutzung eines Taschentuchs gerötet. Ihre Mundwinkel wiesen stets nach unten. Ihre Lippen säumten mehrere Fieberblasen, was wohl ebenfalls auf die Taschentücher zurückzuführen war.
Die Vorhänge in ihrer Stube hatte sie beinahe ganz zugezogen, sodass die Schatten das wenige Tageslicht fraßen, das durch die beiden Fenster hereinfiel.
»Unser aufrichtiges Beileid«, bekundete Hieronymus mit gedämpfter Stimme. »Und danke, dass Sie uns in solch schweren Stunden empfangen.«
Die Frau nickte stumm. Neben ihr und dem Geisterfotografen hatten auch Franz und Salomon am Tisch Platz genommen. Das ihnen kredenzte Glas Wasser hatte keiner von ihnen angerührt.
»Ich weiß nicht, was ich Ihnen sagen soll«, meinte Minna schließlich mit leichtem steirischem Akzent. »Ich habe doch schon alles der Polizei gesagt.«
»Ich habe den Bericht gelesen, Frau Ohlden«, sagte der Pathologe, ebenfalls gedämpft. »Aber eine Mitschrift ist doch immer nur eine Momentaufnahme, ohne jegliches Gefühl, ohne Feingespür für die Person, die aussagt. Außerdem –« Salomon überlegte einen Augenblick lang, dann fuhr er entschlossen fort. »Außerdem sind wir nicht in einer offiziellen Funktion hier. Da wollen wir Sie gar nicht täuschen. Wir sind hier, weil ich Ihren Bruder flüchtig kannte und nicht akzeptieren will, dass sein Tod ungesühnt bleibt.«
Minna wirkte irritiert. »Aber man hat mir versprochen, alles Menschenmögliche zu unternehmen, um den Mörder zu finden.«
»Und mehr ist es auch nicht als ein Versprechen«, warf Hieronymus ein. »Ein Versprechen, dass man vorhat, etwas zu tun, von dem man nicht weiß, ob es von Erfolg gekrönt sein wird. Wir hingegen wollen etwas hartnäckiger sein.«
Die Frau schniefte, trank einen Schluck Wasser gegen den trockenen Geschmack in ihrem Mund. »Sie vermeinen, mehr erreichen zu können?«
»Kann es denn schaden, es zu versuchen?«
Ein Knurren unter dem Tisch ließ Franz erschrocken von seinem Stuhl aufspringen.
»Ach, das ist nur der Rembrandt«, sagte Minna tonlos. »Der Hund vom Gustav, der tut keinem was zuleide.«
Hieronymus lugte unter den Tisch. Ein Kleinspitz mit schwarz-braun-weiß geschecktem Fell und dunklen Knopfaugen blickte ihm entgegen, die Schnauze am Boden, die Brauen nach oben gezogen, als täte ihm irgendwas unendlich leid.
»Zumindest hat er bei Ihnen ein neues Zuhause gefunden.«
Auch Salomon riskierte einen Blick unter den Tisch und lächelte, obwohl er Hunde eigentlich nicht leiden mochte.
»Leider nicht.« Wieder schniefte Minna. »Mein Gemahl mag keine Hunde, die kleiner als kniehoch sind, weshalb er einen Schäferhund hat. Brutus. Der kommt übermorgen mit meinem Gatten wieder und ich kann mir nicht vorstellen, dass der sich mit dem Rembrandt gut verträgt.« Sie seufzte schwer. »Ich werde ihn morgen fortgeben müssen.«
Tränen liefen ihr über die Wangen.
Franz setzte sich wieder an den Tisch, tätschelte der Frau die Hand. »Na, na, ich bin mir sicher, das Viecherl wird einen Platz finden, wo es sich wohlfühlt.«
»Irre ich mich oder löchern dich Anezkas Kinder nicht seit Weihnachten wegen eines Hundes?« Hieronymus sah seinen Freund herausfordernd an.
Der wurde ernst. »Du meinst also, sechs Gschrappen und ein Pferd sind noch nicht genug am Hof?«
Der Geisterfotograf hielt abwehrend die Hände hoch. »Mir tät das ja völlig genügen. Je weniger, desto besser. Aber die Kinder …«
»Mei, Herr Franz, da würden S’ mir eine schwere Last von den Schultern nehmen.« Minna sah den Buckligen hoffnungsvoll an. »Wenn ich nur wüsste, dass der Rembrandt gut versorgt wäre.«