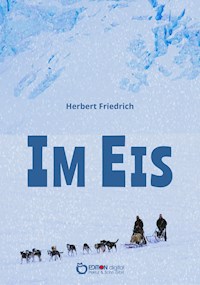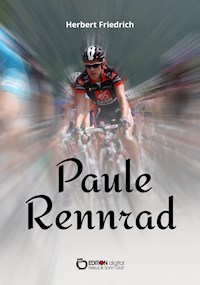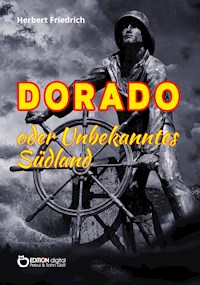
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der junge Holländer Daniel Hillebrant arbeitet bei der Handelscompagnie seines Landes in der kambodschanischen Königsstadt Lauweck. Gefesselt von der Schönheit Südostasiens, der Exotik seiner Natur, der Anmut seiner Menschen, erkennt er aber bald die Intrigen, die unsauberen Geschäfte am Königshof und innerhalb der niederländischen Faktorei. Auf dem Meer und an Land wütet eine erbarmungslose Konkurrenz, der auch der mutige, lebensbejahende Abel Janszoon Tasman, ein erfahrener Schiffsmann, durch dessen Fähigkeiten und dessen Ehrgeiz sich die holländischen Kaufleute reiche Landstriche und neue Seewege erhoffen, zum Opfer fällt. Seine Expeditionen, die unter schweren Bedingungen verlaufen, haben nicht den erwarteten Erfolg. Daniel Hillebrant weiß, dass Tasman, dessen Tochter er geheiratet hat, ein unglücklicher Mensch ist, der rastlos und schließlich auch rücksichtslos nach Glück und persönlichem Erfolg sucht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 663
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Impressum
Herbert Friedrich
Dorado oder Unbekanntes Südland
ISBN 978-3-96521-543-6 (E-Book)
Umschlaggestaltung: Ernst Franta
Das Buch erschien 1974 im Verlag Neues Leben Berlin.
2021 EDITION digital
Pekrul & Sohn GbR
Godern
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Tel.: 03860 505788
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.edition-digital.de
Erstes Kapitel
I.
Der, der herrscht, hatte zur Audienz befohlen. Er trug viele Titel: der König von Kambodscha, der von der Gottheit Erleuchtete, der Souveräne Meister, der alle Staatsmacht in sich vereinte, der oberste Anführer der Streitkräfte, der höchste Beamte. Herbefohlen hatte er die Holländer aus ihrer Niederlassung in seiner Hauptstadt. Da war Daniel Hillebrant gegangen, in der Maischwüle, in der unbarmherzigen Sonne. Man hatte ihm Harmen Broeckman mitgegeben, damit die Verhandlung gedeihe. Und da saß er im dürftigen Schatten einer Arecapalme neben dem alternden Broeckman und starrte auf die zinnenbewehrte Mauer mit dem verschlossenen Tor.
In der ersten Stunde des Wartens hatte Daniel kein Gedanke bewegt, der nicht mit seiner Mission zusammengehangen hätte. Er war jung, Mitte Zwanzig. Er wollte vorwärtskommen wie jeder in der holländischen Niederlassung. Er lebte ein knappes Jahr jetzt in diesem weltfernen Land, beauftragt mit Reiskauf, mit Fellkauf, befasst, holländische Schiffe mit Gütern für Japan zu beladen, und instruiert, den Portugiesen gute Waren wegzuschnappen.
Der, der herrscht, ließ ihm viel Zeit zum Denken, darüber, wer hier herrscht in dieser Stadt Lauweck und in diesem Land, das von der Mutter der Gewässer Mekong durchströmt wurde. Die Luft schmeckte nach fauligen Wurzeln und nach Fischen, nach dem Teer der Dschunken und nach Segeln und Dschungel. Und war noch eine Weile Beglückung in Daniel gewesen, dass er zum König gehen durfte, um die Sache einer ganzen Niederlassung zu vertreten, ja die eines Generalgouverneurs, der weit entfernt in Batavia residierte, so merkte er doch bald, dass er ein Opfer war.
In diesen Stunden des Wartens auf den König, unter den Augen der Mandarine, unter dem Gelächter vorbeistreunender Portugiesen, die Wetten abschlossen, wann er vorgelassen werde, spürte der junge Mann, dass, was Erhöhung schien, in Wirklichkeit Erniedrigung war. Er spürte, dass da etwas auf seinem Rücken ausgetragen werde.
So hatte der Leiter der Niederlassung, Wuysthoff, auf diesen Gang zum Hof verzichtet, beileibe aber nicht, weil er unbedingt dem angekündigten holländischen Schiff auf dem Fluss entgegenfahren müsse. Lange genug hatte es allerdings auf sich warten lassen. Vielmehr, dachte Daniel Hillebrant, hatte man ihn als den rangniedrigsten Kaufmann geschickt, um dem König zu zeigen, dass die holländische Faktorei nicht nach Befehl springt.
Der korpulente Wuysthoff hatte ihn in dieser Sache selbst noch über Broeckman gesetzt, der doppelt so alt war wie er, zugleich aber Broeckman mitgeschickt wie einen Aufpasser oder Hund. Und das musste alle demütigen, Daniel, Broeckman. Und den König.
In den ersten Stunden hatten Daniel und Broeckman noch miteinander gesprochen, hatten sich beraten über ihr Vorgehen, einig über die Winkelzüge des Herrn Wuysthoff. Sie hatten versucht herauszufinden, in welcher Angelegenheit sie der König zu sprechen wünsche. Sie waren die anstehenden Sachen durchgegangen. Vor fünf Jahren hatte sich der König von einem gestrandeten holländischen Schiff die dreizehn Geschütze angeeignet. Davon würde er kaum sprechen, und es war auch besser, nicht mehr daran zu rühren. Vor drei Jahren hatte der, der da herrscht, neuntausend Gulden gegeben, damit der Handel eingerichtet werden könne. Doch bereits im letzten Jahr hatte er das Geld bis zum letzten Stuiver zurückerhalten. Wie viel Jahre lag es zurück, dass die Holländer eine portugiesische Fregatte im Fluss erobert hatten, wie lange hatten sie prozessiert? Wurde da erneut Genugtuung verlangt? Wollte der König bei den Holländern herumhorchen, weil plötzlich ein portugiesisches Schiff aus Manila angelangt war? So viele Fragen.
Wenn sie sofort Einlass gefunden hätten in diesen ummauerten Königssitz, wäre Daniel Hillebrant unbeschwerter hineingegangen.
Es war gut, nicht allein mit Broeckman vor dieser Mauer auszuharren. Es war gut, die beiden Sklaven bei sich zu haben. Denn diese trugen das Geschenk für den König, zwei Ellen feine weiße Leinwand. Auch einige chinesische Buchspiegel hatten sie einstecken, damit die Frauen des Königs ihre Schönheit bewundern konnten. Karge Gaben alles in allem. Man schenkte lieber, wenn man eingeladen und nicht herbefohlen wurde. Aber es waren doch Dinge, die dem König zeigten, dass man kein Bettler war. Dass man etwas hatte. Vor Jahren hatte der erste Leiter der Niederlassung Gewehre mit zerbrochenen Schnapphähnen gegeben, die man lieber ins Wasser geschmissen hätte. Mit solchem Kram konnte man heute dem König nicht mehr kommen.
Vor einer Stunde, kurz nach Mittag, hatte sich das Tor geöffnet.
Aber nicht der König war erschienen oder ein Mandarin, der sie hineingeleitet hätte, sondern des Königs Elefant. Den Königssessel trug das Tier, und aufgeputzt war es wie zu einem Ausritt. Da bereits hatte Broeckman gesagt, dass es nun besser wäre zu gehen, als hier zu stehen und zu gaffen. Herbefohlen und stehengelassen, vorbeigeritten wie vor einem Dreck!
Nicht die Musikanten des Königs hatten gepfiffen, sondern in den Schirmpalmen am Fluss die bunten Vögel mit ihrem seltsam hallenden Ton. Als die Musikanten dann endlich doch pfiffen und trommelten, war es vor dem zweiten Tor gewesen, hinter der Biegung der Mauer. Daniel Hillebrant, herankeuchend, hatte nur noch gesehen, wie zwölf Männer den König in einer Sänfte davonschleppten. Und Broeckman hatte gesagt, dass man nun doch schon ein Hund sei, wenn man so hinter einem König herkeucht. Von da an hatte Broeckman nicht mehr gesprochen. Stumm saßen auch die Sklaven vor dem kleinen Tuchpacken.
Längst hatte der Treiber den Elefanten weggeführt, vielleicht der Sänfte nach. Vielleicht ging es zur Jagd. Vielleicht hatte der König in der Sänfte durch eine dritte, vierte, fünfte Pforte den Hof wieder betreten. Die grell in der Sonne liegenden Mauern verrieten nichts. Die gedrungenen Türme entließen keinen Menschen, der sie endlich zur Audienz geführt hätte.
Man wird gleichgültig. Warten stumpft ab, Hitze lähmt. Daniel sehnte sich nach dem Fluss, auf dem das Schiff heraufkam, vom offenen Meer her. „Vielleicht bringt das Schiff ’nen Brief mit“, sagte er mit trockenem Mund.
Broeckman kniff die Augen zusammen. „Ich habe nichts zu erwarten.“
Sie verstummten wieder. Ungeschickt hatte Daniel das falsche Thema angeschnitten. Broeckmans Frau war tot.
„Da will einer was von uns“, sagte Broeckman.
Daniel drückte sich den Hut in die Stirn, so dass der Schatten in sein hageres Gesicht fiel. Da war die Sonne weg und das Tor da. Und das Tor, wie durch Zauberspruch, stand offen! Aufgeregt packte Daniel Broeckman am Arm.
Beide schauten sie auf das Tor, auf die wie vom Himmel gefallenen speertragenden Soldaten unter dem Bogen, auf den Mann, der da herausschritt und sich vor ihnen über die Weite des Platzes hinweg verneigte.
„Gehen wir!“ Daniel Hillebrant riss Broeckman vorwärts, der längst nicht mehr der Behändeste war. Die Sklaven nahmen die Geschenke.
Dann schritten sie auf den Hof zu.
Unterm Torbogen, in das unergründliche Gesicht des Kambodschaners hinein, sagte Broeckman: „Du müsstest am Kreuz in der Sonne schmoren, so lange, wie wir gewartet haben.“
Schweigend folgten sie dem Mann über leere Höfe, durch Tore, die sich lautlos vor ihnen öffneten, an steinernen Löwen vorbei und an Götzen, die die Ruhe des Königs bewachten.
Ein einziges Mal war Daniel hierherein gelangt; diese Figuren rührten ihn auch diesmal tief. Er hatte sie an der Pagode wiedergefunden und Sita danach gefragt. Mächtig waren die Götter und duldsam Buddha.
Er hatte sie gezeichnet, Köpfe mit aufgerissenen Augen beiderseits einer breiten, plumpen Nase, dicke durchgehende Brauen darüber, mit Mündern, aus denen Hauer standen. Er hätte auch Sita gezeichnet; sie hatte es verboten. Weil das, was dem Bild zustoßen könne, auch den Dargestellten selbst träfe … Wer gibt schon sein Leben aus der Hand? Broeckman allerdings hatte er gezeichnet, ältlich und grau, mit vorgefallenen Schultern. Gelacht hatte Broeckman, sich aber doch des Bildes versichert, damit es nicht die Ameisen fräßen.
Die Dämonen beim König dagegen überdauerten. Sie lauerten hinter Ecken, mit Schlangen bewehrt und mit Dolchen. Blitze schleuderten sie. Affen tanzten in wildem Getümmel. Elefanten zertrampelten Menschen. Pferdegesichtige Götter glotzten ihn an und Musikanten mit Vogelfüßen. Ein gespenstisches Spalier, an dem die Holländer vorbeidefilierten. Es war, als wolle der König seine Besucher durch Hitze und Schreckbilder schocken und durch Wartenlassen zermürben.
Auf Matten saßen sie in einem dämmrigen, kühlen Raum. Es war schon nicht mehr von Bedeutung, dass kein Thronsessel hier stand, kein Ruhebett für den Herrscher, kein Baldachin und königlicher Schirm. In einer schläfrigen Ruhe saß Daniel jetzt, da er hätte hellwach sein müssen. Lange hockte er da. Dass Broeckman neben ihm saß, schien er vergessen zu haben. Auch dass irgendwo die Sklaven mit ihren Geschenken waren.
Als endlich jemand hereinschritt, war es der Sekretär des Königs, Intje Idop, gefolgt vom Dolmetscher Patanees. Unwichtig nun, dass doch nicht der König erschien. Patanees sagte es gleich zum Anfang, und Broeckman rief gallig: „Plattnase, säufst du immer noch soviel Arrak?“
Patanees hütete sich, das zu übersetzen. Glücklicherweise auch forderte Intje Idop keine Übersetzung, und vielleicht brauchte er auch keine. Daniel fühlte sich wieder frisch. Er sagte: „Wir hören, weshalb uns der König hergebeten hat.“
Das Wetter.
Das Wasser im Fluss ist gut.
Der Tanz kambodschanischer Frauen ist das schönste, was es auf der Welt gibt.
Die Schwüle ist zum Erbarmen. Und der Fluss hat fast zu viel Wasser für unser Schiff vom Meer her, seitdem täglich Monsunregen fällt. Und die Anmut kambodschanischer Frauen kann nicht schöner sein als die Zärtlichkeit Sitas, der kleinen Malaiin, die bei Chichermodt dient.
Daniel beugte sich vor. „Wir hören, weshalb uns der König hergebeten hat.“
Der Sekretär Intje Idop ließ sich Zeit. Drei Beulen bedeckten seinen Schädel, der die Haare verlor. Auch sein Kinnbart war dünn und fasrig. Er saß mit untergeschlagenen Beinen und öffnete beim Sprechen kaum den strichförmigen Mund.
Der junge König. Die Königinmutter. Wie werden junge Elefanten gezähmt. Patanees konnte sich das Übersetzen sparen.
Später erst horchte Daniel auf, als der Sekretär fragte: „Ein holländisches Schiff kommt den Fluss herauf?“
„Es kommt.“ Das war seit Wochen bekannt.
„Wie groß ist es?“
„Nicht kleiner als die Schiffe im Vorjahr.“
„Ein portugiesisches Schiff kam gestern.“
„Ich sah es im Fluss.“ Keine Neuigkeit.
„Zwei Dschunken des Herrn Chichermodt liegen bereit zum Auslaufen nach Japan.“
Daniel nickte. Auch das wusste er. Von Sita. Und er wusste, dass die Dschunken gar nicht so bereit waren zum Auslaufen, da sie noch auf Handelsgüter warteten.
„Der König hat euch herbefohlen, weil er von euch die Seide fordert.“ Intje Idop, mit den drei schrecklichen Beulen, lächelte zum ersten Mal. Er konnte gewiss sein, dass Patanees alle groben Worte auch getreu in der fremden Sprache wiedergäbe.
„Welche Seide?“ Daniel spannte die Muskeln an. Jetzt fragte er eigentlich nur noch, um Zeit zu gewinnen. An die Seide hatten weder er noch Broeckman gedacht.
Es kam die Antwort, die er nun allerdings erwartete. „Die Seide, die die Chinesen ins Land gebracht haben.“
Er sah, wie sich Broeckman verächtlich abwandte, und zwang sich selber zu Geduld. „Diese Seide, das weiß der König, ist doppelt holländische Seide.“ Langsam, wie einem, der es zum ersten Mal hört, setzte er dem Sekretär Intje Idop den Fall auseinander. „Unsere Niederlassung in Tonking hat einen großen Posten Seide nach Japan geschickt. Auf einer Dschunke, die mit 19 Holländern besetzt war und mit 36 Chinesen. Diese Chinesen haben unsere Leute überfallen, getötet und in die See geworfen.“ 19 Mann, und vielleicht lebte noch einer, als er ins Wasser klatschte. Die Haie holten jeden.
Patanees übersetzte, und der Sekretär saß, als wäre er ein aus Bronze gegossener Gott der Schlangen oder der Krokodile.
Daniel war es sich auf einmal gewiss, dass sie nicht den eifrigen Patanees brauchten zu dieser mühseligen Übersetzung, dass auch der Sekretär das Holländische verstand und es zu verbergen wusste. Es schien Daniel, dass in jeder Beule auf Intje Idops nacktem Schädel eine andere Sprache stecke.
„Diese Chinesen wollten das Diebesgut losschlagen.“ Einen Teil machten sie zu Geld auf der Insel Formosa im Fort Kelangh bei den Spaniern. Doch das sind arme Teufel, ihre Beutel sind leer, und die Dschunke steckt noch voller Seide. Also ab damit nach Manila. Aber weit ist das Meer, und erforsche einer den Sturm.
„Hier, hierher wurden sie verschlagen“, sagte Daniel bissig, „in deines Königs Land! Und uns haben sie die Seide angedreht!“ Den Holländern geraubte Seide an die Holländer verschachert – doppelt holländische Seide also. Ein Meisterstück von Dieben.
„Drecksseide“, murmelte Broeckman; er hatte damals beim Öffnen der Packen einen Zettel gefunden, auf dem das Gewicht notiert war. In holländischer Sprache!
Intje Idop ließ die Hand fallen, als wolle er alles abtun als Geschwätz und Gewäsch. „Der König hat in der Seidensache geurteilt“, sagte er entschieden durch Patanees’ Mund.
„Der König hat die Seidenräuber gegen Geld freigelassen und nicht an uns ausgeliefert!“
„Der König hat geurteilt: Ein Drittel der Seide erhält er für seine Mühe, ein Drittel erhalten die Holländer. Ein Drittel die Chinesen.“
„Wofür die Chinesen?“
„Wann werdet ihr liefern?“
Daniel bohrte hartnäckig: „Wofür die räuberischen Chinesen? Für das Ermorden unserer Leute?“
„Es ist besser, Herr Daniel“, warnte Patanees, „ich übersetz das nicht.“
Daniel spürte den Schweiß auf der Stirn, und er blickte Broeckman an. Der zischte: „Nur weiter!“ Und er nannte den Patanees einen Aasknochen, den kein Hund mehr benagt.
Dabei hatte die Niederlassung die umstrittene Seide bereits im Vorjahr mit dem letztmöglichen Schiff nach Japan gesandt! Und Daniel hatte gedacht, dieser Streit sei beigelegt! Ein Drittel der Seide nun für den König. Oder 40 000 Gulden dafür, entsprechend ihrem Wert, da diese nicht mehr vorhanden war. Ganz zu schweigen davon, dass man den Räubern einen Teil des Diebesgutes belassen sollte …
„Die Sache ist verjährt“, bemerkte Daniel Hillebrant. „Sie liegt so lange zurück, da war ich noch nicht einmal hier. Und jetzt kommt ihr damit.“
„Der, der herrscht“, erklärte Intje Idop durch Patanees, „will die beiden Dschunken des Chichermodt mit dieser Seide beladen.“
Daniel hob die Braue. Dass dieser Plan bestand, hatte nicht einmal Sita gewusst.
„Nun liegen die Dschunken hier und haben keine Ware.“ Selbst in Patanees’ Übertragung klang es noch bedrohlich, was Intje Idop gesagt hatte. Das Festliegen der Dschunken. Die Verluste des Königs! Die Japanreise unwiederbringlich dahin, weil bald der Wind Monsun aus jener Ecke bliese, gegen den sich die Schiffe vergeblich stemmten!!
„Oder“, fragte Intje Idop, und dies verstand Daniel sogar ohne Patanees: „Oder … habt ihr die Seide bereits verkauft?“
Daniel hörte es deutlich: Das war keine Frage, sondern bereits die Feststellung.
Er antwortete rasch: „Ich bin nicht befugt, über den Handel der Faktorei Auskunft zu geben.“ Eine miserable Antwort; er griff sich an den Hals. Natürlich hatte sich Intje Idop vor diesem Gespräch bei dem Hafenmeister erkundigt, der für sie zuständig war.
Intje Idop schwieg und berührte mit der Hand den Boden wie ein Buddha, der die Erdgöttin anruft. Dann war lange Stille.
Als Intje Idop endlich wieder sprach, war es, als sänge er. „Der König kann vergessen. Er weiß von keiner Seide. Er weiß von keinem Streit. Er vergisst den Anteil, den er den Chinesen versprochen hat. Der König hat andere Waren für Chichermodts Dschunken. Aber - er traut euch nicht.“ Das letzte kam scharf. Daniels Fuß verkrampfte sich in der ihm unbequemen Sitzhaltung; er bewegte sich dennoch nicht.
„Was haben wir mit des Königs Waren zu schaffen?“, fragte er schroff.
„Seit gestern liegt das portugiesische Schiff im Fluss.“
„Da ist es Zeit, alle Frauen in der Stadt einzuschließen und den Palmwein zu verstecken!“, sagte Broeckman.
„Der, der herrscht, hat euch Holländer zu Hofe befohlen, um euch zu verkünden, dass er den portugiesischen Kaufleuten genehmigt hat, ihre Waren auf den Dschunken des Chichermodt nach Japan zu senden. Und er lässt sagen, dass diese Waren unter seinem Schutz stehen und unter seiner Flagge segeln. Kein holländisches Schiff wage es, diese Dschunken anzutasten! Es herrsche kein Krieg hier in seinem Land zwischen Portugiesen und Holländern! Dies will der König, und euch erlässt er die Seide!“
Ehe Daniel etwas entgegnen konnte, ja noch bevor Patanees zu Ende gesprochen hatte, erhob sich der Sekretär und verschwand hinter den Mattenwänden. Patanees schritt hinterher, die Hände im Gewand verborgen.
„Jetzt bring das Wuysthoff bei“, sagte Broeckman.
II.
Sie gingen zurück zur Niederlassung. Mühselig stapften sie durch das Gewirr der leichten, aus Bambus errichteten Häuser; eilten, solange noch Licht war. Sie suchten auch, den Weg abzukürzen, und balancierten über Stege, die Gräben überbrückten. Mücken tanzten in Schwärmen über dem kaum bewegten Wasser.
Sie mussten warten, wenn Frauen mit Früchtekörben auf den Köpfen die Stege versperrten. Einmal glaubte Daniel, auch Sita zu sehen. Doch was hätte sie hier in diesem Viertel zu suchen gehabt. Dem Japanerviertel. Seide nach Japan bringen, die schon in Japan war; dein verfluchter Herr Chichermodt mit seinen Dschunken!
Daniels gedrückte Stimmung löste sich dennoch, während er neben dem müde wirkenden Broeckman herschritt. Sita – das war etwas, das einen das Jahr in dieser merkwürdigen Stadt leichter tragen ließ.
Kambodschaner lebten hier, natürlich. Aber auch Chinesen, kaum weniger, mit Chichermodt an der Spitze. Und Malaien. Und Japaner, die nicht mehr in ihr Mutterland zurückkehren durften bei Strafe des Todes, weil ihr Kaiser die japanischen Grenzen geschlossen hatte. Damit nicht die fremden Sitten hereingeschleppt werden. Der fremde Ungehorsam. Die fremden Götter. Alle Christen hatte er den Tod ihres Gottessohns sterben lassen: am Kreuz. Nur den Holländern und den Chinesen stand ein japanischer Hafen zum Handel offen. Und nun wollte Chichermodt seine Dschunken aussenden. Mit portugiesischen Waren …
Soll er’s probieren. Die Seide war bereits in Japan, das Geld im Säckel der Faktorei. Die neunzehn Holländer wurden davon nicht wieder lebendig.
Er hörte Broeckman sagen: „Es wird dunkel sein, bevor wir am Boot sind.“
Daniel spähte nach dem gelben Himmel, in dem sich wie ein Dolch die Pagode abzeichnete. Die Luft schmeckte nach Fäulnis, Mücken stachen Krankheiten unter die Haut. Die Nacht würde ihre Fallen stellen mit dem Getier, das sie entließ, mit der Binde, die sie einem vor die Augen legte. Affen keckerten noch einmal in den Palmen. Oder waren es Vögel? Trommeln schlugen.
Daniel blieb stehen. „Sie singen.“
„Männer.“ Sie lauschten. Eigenartig klangen diese Instrumente, die hinter den Hütten spielten, viel zu wenig fremd, viel zu bekannt einem europäischen Ohr. Das waren nicht kambodschanische Melodien oder japanische. Nicht Malaien tanzten da. Das waren Geigen und Flöten!
„Nimm das Messer in die Hand!“, zischte Broeckman, auf einmal seltsam verjüngt. Er fluchte, weil es nun mit Macht finster wurde. Und Daniel schaute sich um, ob nicht ein anderer Weg zur Faktorei führte, ein Umweg freilich, über neue Stege. Jetzt hätte er gern die Sklaven hier gehabt, die sofort nach dem Abliefern der Geschenke in die holländische Niederlassung zurückgekehrt waren.
Während sie noch standen und Daniel nach dem Messer griff, wurde der Gesang hinter den Hütten lauter. Ein portugiesisches Lied! Lange genug hatte Daniel diese Sprache erlernt. Sie sangen von Indien.
„Segelt nach Indien davon der arme Pedro, steht das Mädchen Maria weinend am Fluss …“
Ihr armen Pedros wollt Waren nach Japan schmuggeln …!
Er sah Broeckman an. „Zurück?“
„Wir kommen vom König.“
Daniel lachte auf. Ein dürftiger Schutz, sich jetzt auf den König zu berufen. Wenn hier ein Messer flog – tief waren Busch und Wasser. Nie würde herauskommen, wer da gemordet hatte: Tiger oder Portugies! „Ich weiß einen Weg, den hat Sita mir gezeigt“, flüsterte Daniel hastig. Broeckman rührte sich nicht.
Und da sangen die Portugiesen immer noch:
„… trinkt der Pedro Tee bei einer schönen Chinesin, hat das Mädchen Maria den Juan zum Mann …“
So geht es im Leben.
Daniel zog Broeckman am Arm, um nur endlich fortzukommen. In dem Augenblick tanzten die Portugiesen hinter den Hütten hervor. Der erste, ein Fiedler, stockte, als da plötzlich auf dem Pfad zwischen Bambus und Bananen zwei Männer standen. Die Flöte blies noch allein, dann brach auch sie ab. „… trinkt der Pedro … he, he, was ist!“ Sieben Portugiesen.
„Holländer!“ „Bauernköpfe!“ „Schaut doch ihre Hüte!“
„Die Specks!“, zischte Broeckman, „na, traut ihr euch nicht weiter?“ „Aus dem Weg, ihr Hammel!“, schrie ein Portugiese, ein kleiner, zum Fettansatz neigender Mann. Gasper Borses, Daniel kannte ihn nur zu gut. Es war ihr Anführer, der eifrigste Verfechter der portugiesischen Sache. Und Pedro de Vero war bei ihm, sein Schatten, schon mit gezücktem Degen.
„Nur heran!“, rief Broeckman. „Ihr holt euch mehr Beulen, als Intje Idop sie hat!“
„Haut sie in den Bambus!“
„Wir kommen vom König“, warnte Daniel. Also doch der König als Schutz … Schulter an Schulter mit Broeckman stand er, beide mit dem Messer in der Faust. Sie deckten gerade die Breite des Pfades. Das schlimme war, dass die Portugiesen getrunken hatten.
Was stieß ihnen da alles auf mit dem Alkohol: Jeder Fall, wo ein Holländer einmal schneller am Messer gewesen war. Jede verzweifelte Flucht übers Meer, ein holländisches Schiff im Kielwasser! Wie oft hatten dann Verfolgte und Verfolger einträchtig nebeneinander im Hafen dessen liegen müssen, der da herrscht!
„Gebt den Weg frei!“, forderte Daniel.
Die Portugiesen drängten vor, Gasper Borses, dahinter Pedro de Vero, düster wie ein Inquisitor. Mit euern Missionaren, Priestern, Kreuzen habt ihr hier auch nicht viel ausgerichtet! Sumatra, Java, Celebes, Borneo, Molukken – es gab doch keine Insel in ganz Indien jenseits des Ganges, die nicht die Portugiesen entdeckt und mit Niederlassungen besetzt hatten und die ihnen nicht von den Holländern wieder abgenommen worden war!
Für Sitas Weg durch das Labyrinth der Hütten, für Flucht war es zu spät. Gasper Borses kam bereits mit gezogenem Degen auf sie zu. Seine Augen lachten listig. „Angst haben sie nicht.“
„Genug gespaßt!“ Ein Mann, der alle anderen überragte, drängte Borses zurück. Als Broeckman zustieß, wich er aus. „Aber, aber.“ Broeckman stach ins Leere. „Spiel, Juan“, verlangte der Riese. Diesen Mann hatte Daniel noch nie bei den Portugiesen gesehen. Zögernd setzte die Flöte ein, schließlich die Geige.
Der Riese nahm dem Zunächststehenden die Flasche aus der Hand und trank, ohne Broeckman zu beachten. „Portugiesischer Wein.“ Mit dem Handrücken wischte er sich den Mund ab. „Trinkt, dann könnt ihr weiter.“ Er ging mit der Flasche auf die beiden Holländer zu.
Broeckman schüttelte Daniels besänftigende Hand ab. „Keinen Schritt näher.“ Der Portugiese kam, die Musik spielte, fünf, sechs drüben sangen mit, bei Fackelschein, da die Sonne versunken war.
Drei Schritte vor Broeckman blieb der Portugiese stehen, „Lass endlich das Messer. Trink mit mir, komm!“ Er setzte selbst noch einmal die Flasche an und hielt sie dann Broeckman hin.
Die Portugiesen standen abwartend. Still nunmehr, schauten sie auf das, was Broeckman anfangen werde. Nur die Musik ging weiter. „Angst?“, fragte der Riese.
„Mein Messer ist mir lieber als deine Flasche.“
Der hochgewachsene Portugiese lachte. „Unser Wein ist zu gut, als dass er noch wärmer werden sollte. Also trink. Ich bin Manuel Dias, der letzte Nacht mit seinem Schiff von Manila herübergekommen ist. Und ich weiß etwas, was du nicht weißt, Kamerad. Und du sollst mit uns feiern. Trink auf den König von Portugal, den wir nun wieder haben! Denn wir sind frei von den Spaniern. Wir haben sie endlich abgeschüttelt. Nach sechzig Jahren! Genauso, wie ihr sie abgeschüttelt habt. Wenn alles Spanische euer Feind ist, nun gut, Kameraden. Aber Portugal ist nicht mehr spanisch. Es ist Frieden zwischen uns.“ Der Schiffer von Manila streckte die unbewaffnete Hand vor. „Na, greif zu, Companero.“ Misstrauisch blickte Broeckman ihn an.
Daniel aber steckte langsam das Messer weg. „Gib die Flasche“, sagte er.
„Na also.“
Er trank lange. Wenn dieser Mann Manuel Dias die Wahrheit sprach, war tatsächlich Frieden mit Portugal. Und warum sollte er nicht die Wahrheit sprechen. Daniel lachte leise. Die Portugiesen plötzlich keine Feinde mehr? Ein völlig neues Gefühl wäre das, an das man sich würde gewöhnen müssen.
Er schmatzte. „Euer Wein ist gut.“ Wenn ihm hier einer ein Haar krümmte – nie liefen dann die Dschunken des Chichermodt unbehelligt mit portugiesischen Waren nach Japan! Also konnte er trinken, nichts würde ihm geschehen. Die wartenden Dschunken des Chichermodt retteten ihn. Selbst wenn der Mann aus Manila gelogen hätte und kein Frieden war zwischen Portugal und Holland.
Und wenn doch Frieden war – um so besser.
„Ich trinke auf den Frieden“, sagte Daniel. Der Wein rann ihm warm die Kehle hinab und klebte am Kinn.
Der Schiffer aus Manila streckte die Arme vor. „Ihr seid meine Gäste. Trinken wir was in meinem Quartier. Helft uns, ein Schwein aufzuessen, damit der Wein besser fließen kann.“
Da riss Broeckman Daniel die Flasche vom Mund. „Sauf nicht alles allein aus!“ Er gluckste und sprudelte. „Gehen wir mit, Daniel? Gehen wir. Es muss doch mal Frieden sein.“
III.
Tief in der Nacht, fröhlich vom portugiesischen Wein, erreichten Daniel Hillebrant und Harmen Broeckman die Niederlassung. Sie banden das Boot im Flussarm fest und riefen zum nächsten Wachthäuschen hinauf, wer sie seien. „Damit wir nicht noch eins auf den Pelz gebrannt kriegen!“, schrie Broeckman. Arm in Arm tappten sie durch das Tor in den Palisaden an den Packhäusern vorbei auf das große Doppelhaus zu. Auf der Treppe schon stand Regemortes. „Betrunken?“
„Besoffen“, sagte Broeckman.
Angewidert verzog Regemortes den Mund. „Wir suchen nach euch den Fluss ab, und ihr trinkt.“
„Des Königs Wein. Der König ist ein Schw-ein.“ Broeckman lachte.
Es war Daniel peinlich. Wenigstens hatte Broeckman noch so viel Verstand, nicht zu sagen, dass sie mit den Portugiesen getrunken hatten. „Habt ihr das Schiff gefunden?“, fragte er.
„Es liegt zu Phnom Penh. Und nun herein. Wuysthoff wartet.“
„Jetzt noch …?“
„Jetzt“, sagte Regemortes bestimmt.
Daniel hob die Schultern. Müde stolperte er hinter Regemortes her. Auch Broeckman fluchte. Jemand leuchtete ihnen mit einer Laterne. Sie zwängten sich durch den Gang, der einer Herberge glich, so viele Fremde waren angekommen. Überall lagen Schlafende.
In dem spärlich erleuchteten Kontor saß eine Handvoll Männer, Wuysthoff in der Mitte wie ein Buddha. „Hast du sie, Regemortes?“
Taumlig stützte sich Daniel an der Tür, erstaunt, dass hier ein Mann lag, der stöhnte und von dem die Nässe herabtroff, als liefe ein Wassersack leer. Er trat durch die Pfütze und blickte Wuysthoff fragend an. „Schlägerei?“
„Ein Bootsmann vom Schiff. Er will das Boot an der Faktorei festmachen und springt zu kurz.“ Es war mehr Vorwurf in Wuysthoffs Stimme als Bedauern.
„Gebt ihm ’nen Schnaps“, brabbelte Broeckman.
Einer schiente dem Verunglückten das Bein.
„Drüben liegen Briefe für dich“, sagte Wuysthoff. Daniel trat an den Wandtisch. Nun erst schien er zu glauben, dass sie das Schiff gefunden hatten. Wie im Nebel griff er zu.
„Erst erzählst du vom König“, befahl Wuysthoff.
Der eine Brief war von seinem Vater, das erkannte Daniel noch, bevor er alles unters Wams schob. Er sagte: „Der König will die Seide.“
Wuysthoff knallte die Faust auf den Tisch. Es amüsierte Daniel, der Wein saß ihm auf der Zunge.
„Du hast uns verkauft“, brüllte Wuysthoff.
„Nichts habe ich. Der König denkt nicht mehr an die Seide, wenn wir eine Bedingung erfüllen.“ Eine Bedingung, die nichts kostete als ein Lächeln. Eine gute Bedingung, die Daniel mit dem Sekretär Intje Idop ausgehandelt hatte. Oder besser: der er zugestimmt hatte. Zugestimmt freilich auch nur nachträglich, weil da der Sekretär schon lange gegangen war.
Daniel merkte, dass er viel zu viel redete. Und Broeckman schnarchte bereits. Regemortes gab sich gelassen.
„Welche gottverdammte Bedingung?“
„Die Portugiesen schicken Waren auf den Dschunken des Chichermodt nach Japan. Und – wir – tasten – sie – nicht – an!“
Wuysthoff starrte Daniel überrascht an. „Das soll gut sein?“, brüllte er. Der Verunglückte an der Tür jammerte.
„Was soll gut sein?“, fragte der erwachende Broeckman und suchte nach etwas Trinkbarem.
Regemortes tadelte Wuysthoff. „Warum haben Sie nicht mich zum Hof geschickt?“
„Warum nur uns Dummköpfe“, lispelte Broeckman, der noch immer keine Flasche hatte.
Daniel zog sich einen Stuhl heran. Seine Knie zitterten plötzlich. „Der König hätte auch andere Bedingungen stellen können. Gebt mir 40 000 Gulden! Oder Waren dafür aus euern Packhäusern! Oder er hätte auch verlangen können, dass ein Herr Gerrit Wuysthoff als Leiter der Faktorei geht, so wie damals schon einer hatte gehen müssen.“
„He, du bist doch gefährlich“, keuchte Wuysthoff.
„Besoffen“, sagte Broeckman.
„So aber hat der König etwas gefordert, was wir sowieso hätten tun müssen. Nämlich die Portugiesen in Ruhe lassen. Weil Frieden mit ihnen ist.“
„Frieden?“ Alles stutzte. „Wie kommst du darauf?“ Selbst Regemortes verzog den Mund.
„Es ist wirklich Frieden. Das Schiff von Manila …“ Er erzählte es.
Wuysthoff höhnte: „Warst du bei diesem Friedensschluss dabei?“ Daniel war froh, dass er saß. Besser, dass keiner wusste, wie viel portugiesischen Wein er gekippt hatte. Auf deine Gesundheit, Manuel Dias. Dir zum Wohl, Gasper Borses. Leben sollst du, Bruder Pedro …
„Es gibt keinen Frieden“, sagte jemand barsch hinter ihm. Es war der, der den Kranken verarztet hatte und der nun an den Tisch ins Lampenlicht trat. Ein untersetzter Mann war das, mit einem Gesicht, in dem alles kraftvoll gezeichnet war, Spitzbart und Schnurrbart, ein lächelnder Mund.
„Tasman“, sagte Daniel. Tasman war wieder im Land. Der also hatte das Schiff den Mekong heraufgebracht!
„Ja, ich, Hillebrant. Und vor ein paar Wochen, wo war ich da? In Batavia. Und nichts von Frieden dort.“
„Du hast dich übertölpeln lassen!“, rief Wuysthoff ergrimmt.
Tasman erklärte: „Ich habe hier einen Befehl des Generalgouverneurs, der ausschließt, dass Frieden ist.“ Dabei rückte er die Tasche vor, die er um die Schulter hängen hatte. Das Schriftstück, das er ihr entnahm, reichte er Wuysthoff.
Gespannt beobachtete Daniel, wie jener es aufriss und dann las. Regemortes hätte das Blatt mit einsehen können, doch zeigte er keine Neugier. Broeckman trank aus dem erstbesten Becher.
Endlich hatte Wuysthoff alles verdaut. „Der Generalgouverneur untersagt der Faktorei, Geleitbriefe an Schiffe auszustellen, die portugiesische Waren transportieren.“
„Wenn also die Dschunken des Chichermodt ohne Geleitbrief abreisen?“, fragte Daniel rasch.
„Werden die Waren beschlagnahmt.“
„Kambodschanische Dschunken“, erinnerte Daniel, „denn Chichermodt, obwohl er Chinese ist, lebt in diesem Land!“
„Portugiesische Waren“, gab Wuysthoff zurück. „Den Portugiesen ist der Handel mit Japan verboten. Und nun trachten sie danach, ihn fortzusetzen, indem sie ihre Güter auf fremde Fahrzeuge laden.“
Daniel lief rot an. „Ich weiß nicht, ob uns die paar Ballen Stoff der Portugiesen in Japan schaden. Ich weiß aber, dass es nicht gut ist, hier den König gegen uns aufzubringen. Er ist der Herrscher hier! Er macht hier die Gesetze! Und er kann sie sehr unangenehm für uns machen.“
Regemortes nahm Broeckman den Becher fort. „Wir lassen uns nicht den Handel mit Japan kaputtschlagen!“
„Reden wir bei Tag weiter“, entschied Wuysthoff und heftete seinen Blick so lange auf Daniel, bis dieser aufstand. Das letzte, das Daniel Hillebrant beim Hinausgehen hörte, war das Stöhnen des Kranken an der Tür. Noch einmal wandte er sich um. „Gebt dem Mann wenigstens trockene Sachen.“
IV.
In seiner schmalen Kammer setzte er sich auf das Bett und stützte das Kinn in die Hand. Später drehte er die Öllampe größer. Ja, Feinde waren die Portugiesen. Hatten ihm den Kopf dumm gemacht mit ihrem Wein. Hatten sich selbst geschadet damit, weil er sonst hätte anders dreinfahren können gegen den fetten Wuysthoff. Die Portugiesen – Feinde, solange er denken konnte.
Er konnte die Hitze nicht mehr ertragen, riss sich Wams und Hemd vom Leibe. Da fiel etwas auf den Boden. Er nahm die Lampe vom Tisch und bückte sich. Es waren die Briefe.
Ameisen huschten ins Dunkel. Daniel blickte nach den Bettbeinen, die in Wassernäpfen standen, damit das Ungeziefer nicht heraufkriechen konnte. Alle essbaren Dinge musste man in Kisten verschlossen halten. Motten und Würmer bedrohten Kleider, Papier, Bücher. Mit Kakerlaken, groß wie Bienen, musste man leben. Mit Portugiesen, Intje Idop, Plattnase, Chichermodt, mit Wuysthoff, Regemortes und dem gutmütigen Broeckman, der seinen Kummer in Schnaps ersoff.
Daniel ließ sich auf den Schemel fallen. Der feuchte Körper juckte ihn. Er konnte sich nicht entschließen, die Briefe zu öffnen. Das war zu viel gewesen, auf einen König zu warten, der dann nicht kam, sich um Seide zu balgen, die schon verramscht worden war, Frieden mit den Portugiesen zu schließen, und das nur privat, weil es den anderen nicht in den Streifen passte.
Mit Sechzehn hatte er die Eltern verlassen, war zur Schwester gezogen, die den Kaufmann Dircksen geheiratet hatte, war alles bei Dircksen gewesen, was zwischen Schreiber und Schwager liegt, hatte von ihm Portugiesisch gelernt, weil es gut sei, die Sprache seiner Feinde zu beherrschen, und ob sie noch Feind waren, wusste keiner.
Endlich hielt er doch den ersten Brief vor die Lampe. „Unser lieber Junge Daniel Hillebrant. Wir hoffen, dass du mit Gottes Hilfe gesund bist, wir sind es auch.“ Während er von den bescheidenen Ereignissen in dem Amsterdamer Elternhaus las, wurde er ruhiger. Die Schwester hatte das dritte Kind bekommen, das sie wiederum zu ihrer Mutter gab. Der Kaufmann Dircksen liebte noch immer kein Kindergeschrei. Vater war noch einmal in der Ostsee gewesen, eine bescheidene Reise fürwahr, nachdem er als Schiffer Indien gesehen hatte, was ihm als Schiffsjunge entgangen war. „Zum Abgewöhnen“, schrieb Vater. „Das Meer lässt mich nicht los.“ Auf Nowaja Semlja bei Barents hatte es ihn fast behalten. Zwanzig Jahre später auf Ostindienfahrt ebenfalls, als es ihn an die Küste des Unbekannten Südlandes verschlagen hatte. So schnell ging ein Hillebrant nicht unter.
Daniel lehnte sich zurück. Auch er war gesund, nicht aufgefressen von dem Ungeziefer. Wenn ihn auch van der Lijn, mit dem der Vater so manches Mal gefahren war, von Batavia aus in dieses weltfremde Land geschickt hatte. Damit er sich Sporen verdiene. „Wind um die Ohren pfeifen lassen“, nannte man so etwas.
Er öffnete den zweiten Brief. „Cornelis van der Lijn, Mitglied des Rates von Indien, an Daniel Hillebrant …“ Ein glatter Mann war dieser van der Lijn, allgegenwärtig, lautlos. Einer, der es verstand, eine entwürdigende Arbeit noch als Belohnung auszugeben. Nach Kambodscha zu gehen zum Beispiel. Und doch: Sein Name machte Eindruck. Natürlich wussten Wuysthoff und Tasman, wer ihm da schrieb.
Die Öllampe flackerte, und draußen schlugen Türen. Schritte tappten auf dem Gang. Hastig überflog Daniel das Schreiben. Möglich, dass Broeckman jetzt kam. Er verspürte keine Lust mehr, mit ihm noch einmal alles durchzukauen.
„Batavia braucht dringend Reis“, schrieb van der Lijn, „seht zu, dass ihr ihn auftreibt. Und kauft Kardamom nicht teurer als zu elf, zwölf Tail und Zimtrinde höchstens zu zwanzig …“ Handelssachen wie üblich. In Japan verkaufte man dann für das Vierfache.
Die Schritte draußen waren zum Glück wieder verhallt. Was noch, van der Lijn …? „… Der Portugiese Johann von Braganza hat die spanische Regentin in ihrem Palast in Lissabon gefangen genommen und ist im Dezember als Johann IV. zum König von Portugal gekrönt worden …“
Eine heiße Welle durchströmte den Kaufmann, als er so plötzlich den Beweis gefunden hatte, dass kein Spanier mehr auf dem portugiesischen Thron saß. Der Schiffer von Manila hatte nicht gelogen!
Nun hatte auch Daniel Hillebrant seine Instruktion erhalten: Portugal war seit einem halben Jahr ein selbstständiges Land! Er streckte sich auf das Bett. Als Broeckman die Tür öffnete, lag er mit geschlossenen Augen.
V.
Am nächsten Tag kam das Schiff „Oostcappel“ die vier Meilen von Phnom Penh herauf und lag nun breit und behäbig unweit der Faktorei. Hinter den geöffneten Stückpforten glänzten wie Zähne die Kanonen. Eine Viertelmeile flussauf schwammen Chichermodts Dschunken neben der portugiesischen Fregatte und übernahmen Seide. Wuysthoff schickte einen Jungen aus, der einen halben Tag vom Busch aus Fregatte und Dschunken beobachtete und dann den Lastträgern in den Weg stolperte. Er konnte am Abend berichten, dass die eine von Chichermodts Dschunken lecke und die Portugiesen alles aufböten, um den Schaden zu beheben.
Wuysthoff lächelte, als er das vernahm, und lief schwitzend davon, um persönlich die gemieteten Prauwen zu kontrollieren. Diese brachten Hirschfelle zum Schiff. Achttausend davon lagen in den Packhäusern, geascht und gebündelt, in Japan begehrt. Nun rennt, ihr Ochsen! Regemortes stand am Tor und trieb die Lastträger an.
Wie um die Wette luden sie an beiden Schiffsplätzen, die Holländer und die Portugiesen. Jeder, der Beine hatte von der holländischen Niederlassung, Kaufmann und Junge, Dolmetscher und Packhausarbeiter, hetzte herum.
Im kleinen Packhaus beaufsichtigte Daniel Hillebrant das Verladen der Felle. Dabei dachte er an van der Lijns Brief. Viel zu viel dachte er daran. War es nicht gleich, wer als König auf den portugiesischen Thron gelangt war? Hatte das Einfluss auf sein Leben in Kambodscha?
Er sprang hinzu, als ein schlecht verschnürter Ballen aufplatzte. Er hustete in Staub und Hitze. Er freute sich auf Sita am Abend. Und doch dachte er an den gekrönten Portugiesen.
Mit der ersten Prauw fuhr er zum Schiff, um dem Unterkaufmann die Listen zu übergeben. Er hoffte auch mit dem Schiffer Tasman in Ruhe reden zu können. Er konnte ihn vorsichtig ausholen, über Batavia und den neuen König in Lissabon. Wie das nun werden soll. Was stand wirklich in der Anweisung für die Faktorei, die Geleitbriefe betreffend? Wusste der Generalgouverneur Anthonio van Diemen weniger über die Vorgänge in Portugal als das Mitglied seines Rates van der Lijn? Würde der Generalgouverneur seinen Schiffen befehlen, portugiesische Waren zu kapern, obwohl ihm bekannt war, dass Portugal keine Provinz des Erbfeindes Spanien mehr war? Hatte etwa auch van der Lijn seine Unterschrift unter die Anweisung an die Niederlassung gesetzt, was ihm freilich zuzutrauen war?
Zu viele offene Fragen für Daniel. Und da war der König von Kambodscha mit seiner Forderung: freie Fahrt für die Dschunken – oder ein Drittel der von den Chinesen geraubten Seide! So wie es jetzt aussah, wollte die Faktorei beides nicht zugestehen. Da konnte man wahrhaftig den Brand riechen in der Hauptstadt Lauweck. Und er würde die Faktorei auslöschen …
Daniel fuhr zurück, ohne Tasman gefunden zu haben. Ihm wurde gesagt, der Schiffer stecke in der Faktorei. Er hatte keine Zeit, länger zu suchen. Am kleinen Packhaus riefen sie nach ihm. Dennoch ging er zunächst zum Kontor. Schon auf der Treppe hörte er jemand schreien. Er rannte los, die erste Tür riss er auf.
„Wasser, Kamerad“, stammelte ein Mann. Daniel beugte sich erschreckt über ihn, den er in dem Dämmerlicht fast übersehen hätte.
Es war der Bootsmann, der letzte Nacht verunglückt war. „Gleich bring ich dir Wasser“, murmelte er und legte dem Kranken die Hand auf die feuchte Stirn. Er ging hinaus an das Fass, schöpfte Wasser in einen Krug, fischte Kakerlaken heraus. Der Kranke dann trank gierig. Tropfen hingen in seinem Bart. Er sagte seinen Namen. Conrad Rooder hieß er. Wenn einer vom Schiff nach ihm frage … Jung war er, ein kräftiger Bursche mit einem Buckel auf der Nase und mit Augen, die leicht hervortraten.
Daniel jagte ihm die Mücken weg. „Sie haben mich vergessen“, klagte Rooder zwischen zwei Schlucken.
„Sie beladen das Schiff.“
„Das verfluchte Bein! Das hackt da drin … Ob ich das Bein behalten werd, Kamerad?“
„Du wirst wieder springen.“ Daniel stellte den leeren Becher weg.
„Das war ich, Gotts Teufel. Ich will heiraten, wenn ich zurückkomm nach Amsterdam, und vielleicht ohne Bein …“
„Das Bein ist gebrochen, das heilt. Bist du schon lange in Indien?“ „Meine erste Fahrt …“
Frisch von Amsterdam also … „Verpflichtet für drei Jahre?“
„Hol der Teufel den Tag, an dem ich das unterschrieben hab. Und wer bist du, Kamerad?“
„Daniel Hillebrant. Unterkaufmann hier.“
„Oh, so … Verzeihen Sie …“
Daniel deckte dem Bootsmann ein leichtes Tuch über das Gesicht.
„Gegen die Mücken.“
„Wie schon verreckt …“
„So schnell stirbt sich’s aber nicht. Ich schick dir gleich was zu essen.“ Er ergriff Rooders Hand. „Ich bin auch aus Amsterdam.“ Dann ging er hinaus.
VI.
Das war die Faktorei. 819 Fuß streckte sich ihr Gelände am Palmenwald entlang. 324 Fuß am Fluss, von Palisaden umgeben, von Türmen geschützt. Der König hatte ihnen das günstige Gelände vor drei Jahren angewiesen, als die alte, kleine Niederlassung über Nacht abgebrannt war. Nur im Hemd hatten sich die Holländer retten können. Vor Daniels Zeit war das gewesen. Broeckman schilderte manchmal, wie sie gelaufen wären, Flammen im Rücken. Bauholz hatte der König genehmigt, mit 1200 Gulden war das neue Doppelhaus bezahlt. Breit lagerte es mit seinen beiden runden Giebeln zum Weg hin, auf Pfählen zum Schutz gegen Tiere und Wasser. –
Am Abend beriet sich Wuysthoff im größten Raum der Faktorei mit den anderen vier Kaufleuten. Anwesend war auch der gesamte Schiffsrat der „Oostcappel“, an seiner Spitze Tasman. Ein Dutzend Männer alles in allem, das da um den wuchtigen Tisch saß und mit Wein die Trockenheit hinunterspülte. Regemortes als einziger rauchte das Kraut Tabak. Gegen die Mücken, wie er sagte. Tasman kaute Betel, was Wuysthoff sichtlich verdross, weil es den Mund rot machte, als schäume aus ihm Blut.
„Wie Ihnen bekannt ist“, begann Wuysthoff, „hat das Schiff >Oostcappel“ die laotischen Kaufleute zurückgebracht, die es im Januar nach Batavia mitgenommen hatte. Nun verlangt der Generalgouverneur, dass einer von uns diese Kaufleute in ihr Heimatland begleitet und dem Fürsten dort Geschenke überbringt.“ Er starrte auf Tasmans betelrote Lippen. „Beraten wir, wer fährt.“
Daniel hatte andere Dinge erwartet, die besprochen werden müssten. Unterm Wams knisterte seine Instruktion. Er sagte: „Ich bitt um Verzeihung. Aber ich bin von Ihnen gestern zum König geschickt worden und will da Klarheit. Was wird mit den Dschunken?“
Wuysthoff sagte schroff: „Zum König geschickt, ja. Aber nicht zu den Portugiesen!“
„Deren Wein Ihnen immerhin geschmeckt hat“, setzte Regemortes hinzu.
Daniel hob die Schultern. Was blieb schon verborgen in diesem Dorf. „Ich hab einen Brief, der bestätigt, dass Portugal sich befreit hat.“
Wuysthoff blickte ihn verdrossen an. „Ich hab einen Befehl, und der besagt: keine Geleitbriefe! Portugiesische Schiffe sind Feindschiffe, portugiesische Waren Konterbande. Und Sie haben der Faktorei wahrhaftig einen schlechten Dienst erwiesen, sich so einseifen zu lassen von Gasper Borses!“ Wuysthoff redete sich allmählich in Hitze. „Seien Sie froh, wenn wir Sie nicht belangen. Aber das sag ich: Darüber wird noch zu reden sein!“ Er las auch dem Broeckman die Leviten. Als älterer hätte er ein Beispiel geben sollen. „Warum habe ich Sie denn mitgeschickt? Da hätten Sie auch zu Hause bleiben können!“
„Wahr, wahr“, entgegnete Broeckman gelassen. „Nämlich in Amsterdam.“
In dumpfem Zorn saß Daniel. Zuerst wollte er van der Lijns Brief herausreißen. Er ließ es, griff nach seinem Becher, trank. Und als er in die Runde blickte, wusste er, dass jeder da dachte: Genauso hat er mit den Portugiesen gesoffen!
Da begriff er, sie hatten schon alles abgesprochen, Wuysthoff, Regemortes, Tasman. Sie wollten auf Biegen und Brechen an die Dschunken, mit ihrem Befehl in der Tasche, auf den sie sich jederzeit berufen konnten.
„Also zu Laos“, sagte Wuysthoff. „Einer von uns hat zu fahren, da beißt die Maus keinen Faden ab.“
Daniels Blick suchte Broeckman, der zuckte mit den Schultern. Die Dschunkensache war endgültig erledigt. Laos also, das Elefantenland.
Alle starrten auf den Tisch. Wer da nach Laos fuhr, dem stand allerhand bevor; eine mühsame Bootsreise auf dem Mekong. Wie lange? Unter Fremden. Von wem erwartet? Wie empfangen?
Allein Tasmans Leute kümmerte es nicht, was da ausgehandelt werden sollte. Nur einer der Kaufleute kam für Laos in Frage. Keiner redete, und all das wurmte Daniel, die Zurechtweisung vorhin und dass die Dschunkensache abgetan war. Und dass da einer in ein Land sollte, für einen fragwürdigen Erfolg, zu einer Zeit, da in der Faktorei jeder Mann gebraucht wurde.
Er raffte sich auf. Es war ja nun schon egal, so tief, wie er hier in der Kreide stand. „Sie haben mich getadelt. Gestatten Sie, dass ich dennoch spreche. Aus ernster Besorgnis. Ich bin dagegen, dass wir in dieser Zeit der Spannungen unsere Faktorei von Volk entblößen. Denn es bleibt doch nicht bei dem Kaufmann, der fahren soll. Will er zum Fürsten von Laos, muss er würdig auftreten, mit Gefolge, mit Dolmetscher.“
Wuysthoff schnitt ihm das Wort ab. „Sie sind dagegen, und Sie vergessen, dass hier ein Befehl des Generalgouverneurs vorliegt.“
„Der Generalgouverneur ist über unsere Lage schlecht unterrichtet.“
„Besser als einer, der kaum ein Jahr in dieser Niederlassung Dienst tut.“
Sie schienen sich einen Spaß daraus zu machen, ihn vor den Leuten vom Schiff herunterzuputzen, was nun auch Broeckman hochfahren ließ. Er schrie: „Es ist doch wahrhaftig bequemer, wenn die laotischen Kaufleute ihre Waren selber nach Batavia bringen! Oder zumindest hier in die Faktorei.“
Ungeduldig schnaufte Wuysthoff. „Bequem, unbequem. Hier geht es um mehr, lieber Broeckman. Hier geht es darum, das Wohlwollen des laotischen Fürsten zu gewinnen und sein Interesse für einen Handel mit Holland. Und deshalb wird ein Holländer ihn aufsuchen.“
„Dann hätte der Generalgouverneur entsprechende Leute aus Batavia mitschicken sollen“, warf Daniel ein.
„Herrgott, hier wird nicht an Befehlen herumgedeutelt!“
Broeckman sagte: „Dann schickt Leute vom Schiff ‚Oostcappel‘.“ „Oho!“ Tasman spuckte den roten Betelsaft aus. „Ihr Krämer. Und wen schick ich in die Wanten?“
„Kommen wir zum Schluss.“ Wuysthoff hob die Stimme. „Ich schlage vor, der Unterkaufmann Daniel Hillebrant reist nach Laos. Er hat doch jetzt erst sehr gut die Sache der Faktorei vor dem kambodschanischen König vertreten.“
Offener Hohn. Daniel senkte den Kopf. Wie von fern hörte er Wuysthoff reden.
„Stimmen wir ab. Regemortes? Dafür. Hillebrant und Broeckman – Sie sind dagegen? Ich bin dafür. Herr Daniel Hillebrant fährt.“
„Laos liegt nicht aus der Welt“, tröstete Tasman.
Daniel presste die Lippen zusammen.
VII.
Der, der herrscht, schickte zwei Elefanten für den Schiffer Tasman. Da ritt er zu Hofe mit Wuysthoff, mit Regemortes und mit Daniel Hillebrant. Morastig waren die Pfade durch einen heftigen Regenguss, der kurz zuvor niedergegangen war. Hoch über den Köpfen des Volkes schaukelten sie dem König zu. Das große Tor in der Mauer stand offen, Mandarine verneigten sich, und Trommeln schlugen. Es gab kein Warten in greller Sonne, als der Schiffer Tasman mit seinem Gefolge einritt. Daniel war dabei, damit er noch etwas sähe von Manieren und Zeremonien bei Hofe, bevor er selbst zu dem laotischen König fuhr. So nach Wuysthoffs Worten.
Der König saß auf dem Boden, auf Matten, umgeben von den Großen des Landes, dem Mandarin von der Kostbaren See und dem der Barken, dem Bewahrer des Palastes und dem des Zimmerholzes, dem Rechtssprecher und dem Schatzhalter, dem Mandarin über die königlichen Elefanten und dem „Göttlichen Wagen“, das war der Kommandeur über die Fahrzeuge des Königs.
Intje Idop mit seinem Beulenkopf saß zur Linken des Herrschers. Patanees, der Übersetzer, stand.
Tief verbeugten sich die Holländer und ließen sich dann auf die Knie nieder. „Bringt ihnen Matten“, befahl der König.
„Du bist der Schiffer?“, fragte er durch Patanees’ Mund. Tasman neigte den Kopf. Er hielt sich sehr gerade.
„Wie lange hast du gebraucht, den Fluss herauf?“
„Drei Wochen.“
Der König, mit Gold und Silber geschmückt, eine Krone wie eine Pagode auf dem Haupt, lächelte zufrieden. „Wir schaffen es in zwei.“
Noch nicht alt war der König, kräftig von Statur und sehr männlich. Erst vor zwei Jahren war ihm ein Sohn geboren worden. Bis vor einem Jahr hatte er mit seinem Neffen und mit seiner Schwester zusammen regiert. Drei Könige herrschten über dem Land. Der weibliche König allerdings war im Vorjahr an einem bösen Fieber gestorben. Den jungen König, den Neffen, hatte wenig später ein Elefant zertreten. Buddha war einst als weißer Elefant vom Himmel gekommen und als siebenfarbiger Lichtstrahl in den Leib seiner Mutter eingegangen und dann geboren worden. Heilig war der Elefant. Was war das für ein Zeichen der Gottheit gewesen, die den Neffen vernichtete? Also gewarnt, hatte der Herrscher nicht wieder einen Neffen zum zweiten König erwählt, sondern den ältesten Sohn.
Der König war wissbegierig. „Du kommst mit sehr viel Kanonen auf deinem Schiff in meine Hauptstadt gefahren.“
Tasman sagte: „Wir haben sie zu unserer Verteidigung.“
„Du hast so viel nicht nötig. Aber der, der herrscht, braucht sie. Siams Heer steht an unserer Grenze, du weißt es.“
„Ich kann dir keine Kanonen geben.“
„Zwei, zwei Stücke nur, und du fährst davon, königlich belohnt.“
„Nicht eins.“ Tasman bewahrte eine heitere Gelassenheit auf seinem Gesicht. „Ich habe 22 Kanonen auf dem Schiff, und jede brauch ich. Lass sie zählen. Was darüber hinaus ist, das will ich dir schenken.“
„Der König bezahlt.“
„Will der König Kanonen kaufen, kann nicht ich das entscheiden. Darüber befindet der Generalgouverneur in Batavia.“
Der König dachte schweigend nach, schließlich winkte er. Diener brachten Früchte und Getränke. „Stärkt euch.“
„Ich habe Briefe deines Generalgouverneurs mitgebracht“, sagte er dann. „Ich habe sie gelesen. Seine Meinung ist nicht immer meine Meinung. Er untersagt praktisch meinen Schiffen, portugiesische Waren zu befördern.“
Wuysthoff warf ein: „Die Portugiesen sind seit 30 Jahren unsere Feinde.“
Ruhig blickte ihn der König an. „Nicht aber die Kambodschaner. Es gefällt mir nicht, wie ihr die Meere, die Gewässer unsicher macht, wie ihr mit Kanonen herumfahrt, beladen mit diesen Teufelszähnen, die Kugeln spucken und Handelsschiffe zerbeißen!“
Patanees ahmte in seiner Übersetzung den Tonfall des Königs nach.
Daniel dachte, nun muss Wuysthoff doch Farbe bekennen! In dem, was der König sagte, lag ein viel deutlicherer Tadel als in dem, was Intje Idop ihm gegenüber vorgebracht hatte.
Wuysthoff erklärte: „Wir gehen nur gegen Schiffe vor, die keinen Geleitbrief des Generalgouverneurs haben.“
Es war, als zaudere der König. „Dann gebt mir den Geleitbrief für die Dschunken des Chichermodt.“
„Nein!“,m sagte Wuysthoff. (Daniel fühlte das Blut im Halse pochen. „Nein!“, sagte Wuysthoff dem König ins Gesicht!) „Nehmt keine portugiesischen Waren mit, dann fahrt ihr sicher. Das ist euer Geleitbrief.“
Daniel wunderte sich, dass der König noch immer ruhig blieb. Er saß allerdings lange schweigend. Und dann sprach er, aber nicht mehr mit Wuysthoff. Er wandte sich an den Schiffer. „Dann bitt ich, dass dein stolzes Schiff mit seinen 22 Kanonen später als die Dschunken des Chichermodt aus meiner Hauptstadt abreist.“ Der König bat!
„Wie viel später?“
„Zwei Wochen.“
„Ich muss eher fahren“, sagte Tasman. „Ich muss nach Japan fahren. Die Zeit ist kurz, und lange kann man nicht mehr nach Japan fahren. Wie lange haben oftmals in deiner Stadt unsere Schiffe gelegen und auf Reis gewartet, auf Zimmetrinde, Sandelholz, Lack, weil ihr schleppend verkauft habt! Haben ihre Zeit verlegen, die ihnen dann im Meer für Japan gefehlt hat. Und jetzt soll ich vierzehn Tage warten! Wofür?“
Da erhob sich der König und ging, umgeben von seinem Gefolge. Als sich die Holländer das Kreuz gerade gereckt hatten, stand nur noch Patanees, Plattnase, vor ihnen und sagte leise: „Es wäre besser, wenn du recht, recht lange Gast in unserem Lande bliebest, Schiffer Tasman. Und wenn der Leiter der Niederlassung, Herr Wuysthoff, sich nicht so bald wieder bei Hofe sehen ließe. Dies ist der ausdrückliche Wunsch des Königs.“
VIII.
Es war der Abschied.
Das Boot lag am Ufer unweit Chichermodts Haus. Und Sita war still, als wüsste sie, dass es der Abschied sei. Dabei hatte Daniel noch gar nicht davon gesprochen. Er sah hinauf zu den Sternen am schwarzen Himmel.
Es ist der Abschied, Sita. Sie schicken mich nach Laos, mit den laotischen Kaufleuten, die heimkehren. Auf vier Prauwen werden wir fahren, zwei Assistenten dabei, ein Dolmetscher und ein Junge. Und immer flussauf. Stromschnellen wird es geben und Felsen, die zu umgehen sind, Inseln und überschwemmter Wald, Wasserfälle, höher als die Westertore in Amsterdam. Und am Ende des Weges diesen Fluss hinauf sitzt ein Fürst, von dem wir wollen, dass er uns gut gesonnen ist, dass er uns Gold lässt und Damast nimmt, Spezereien gegen Teppiche, Gummilack gegen Leinwand tauscht. Mich schreckt nicht diese Monate währende Flussfahrt; der Fluss ist mir vertraut von unseren Nächten her. Nicht die Echsen im Wasser und die Tiger im Busch beunruhigen mich, Sita. Es ist der Abschied.
Er musste kommen, gewiss. Nur der Tod ist ewig. Oder das Leben nach dem Tod. Aber dass er so kommt, plötzlich und kommandiert … Es beunruhigt mich, dass sie mich ausschicken, wiederum nicht, weil sie mich für den Geeignetsten halten, sondern für den Unbequemsten. Der da hat sich gegen die Reise nach Laos ausgesprochen, also fährt er. Der da will die Dschunken des Chichermodt nicht antasten, will Frieden halten mit den Portugiesen, mit denen er gesoffen hat. Man muss ihn ertragen, diesen Herrn Daniel Hillebrant. Denn jeder Mann zählt auf dieser holländischen Insel in des Königs Stadt. Man kann freilich Batavia einen Wink geben über diesen Querkopf. Aber er erhält Privatpost von einem van der Lijn, Mitglied des Indischen Rates. Da ist es gefährlicher, ihn anzutasten als die Dschunken des Chichermodt. Also erhöht man ihn, macht ihn zum Gesandten, schickt ihn zu einem König und hat ihn aus dem Haus. So reisen müssen, Sita, ist nicht leicht.
Abel Janszoon Tasman ist gestern gereist, den Tonle Chrap Chheam hinab in den Mekong zum Meer, nach Formosa und Japan. Eine weite Reise, zu der er aufgebrochen ist mit dem stolzen Schiff „Oostcappel“. Die 22 Kanonen sind hinausgeschwommen aus des Königs Stadt. Hirschfelle sind davongeschwommen nach Japan. Und Seidenballen. Rhinozeroshörner. Lack. Viel früher, als der König es gewünscht hat. Und die Dschunken deines Herrn Chichermodt liegen noch hier.
Dort auf dem Schiff „Oostcappel“ schwimmt noch allerlei den Fluss hinab, den ich hinauf muss. Der Bootsmann Conrad Rooder zum Beispiel, mit dem gebrochenen Bein; er hätte sich an Land auskurieren können, wenn Tasman nicht aus Angst vor dem Nordwind so schnell Anker gehievt hätte, um wirklich nach seinem verdammten Japan zu gelangen. Und der Bootsmann Rooder, der nun krank in einem Verschlag des Schiffes liegt und also kein Mann für die Wanten sein kann, hätte doch hier einen guten Wächter für das Lager abgegeben, da so viele nach Laos reisen und die Faktorei von Volk entblößt ist.
Und da schwimmt noch auf dem stolzen Schiff „Oostcappel“, vorn im Kabelgatt, im zugigen Bug, ein Geschenk des Königs. Ein Geschenk an den Generalgouverneur in Batavia. Ein angeschmiedetes Geschenk, in Eisen geschlagen. Die Leute haben Spalier gestanden, als es an Bord gebracht wurde. Kein Elefant, Sita, für den Herrscher der Holländer in Indien, kein gefangener Tiger. Viel mehr. Der König von Kambodscha liefert dem Generalgouverneur einen chinesischen Seidenräuber aus!
Ich bewundere die Schlauheit des Königs. Wenn er den Räuber ausliefert, heißt das doch: Er pocht nicht mehr auf ein Drittel der Seide. Der Seidenstreit ist begraben; der König hat dafür einen sichtbaren Beweis geliefert. Da ist die Gegenleistung fällig. Der König erwartet dafür etwas von den Holländern. Das kann nur sein: dass die Dschunken des Chichermodt mit den portugiesischen Waren nicht angetastet werden.
Ich hasse Chichermodt, bei Gott. Ich habe Grund, ihm alles Böse auf der Welt zu wünschen. Deinethalben, Sita. Aber dennoch: Seine Dschunken müssen ungeschoren bleiben.
Frei werden sie schwimmen nach Japan, weil da einer gefangen schwimmt auf dem Schiff „Oostcappel“. Der in Ketten geschlagene chinesische Seidenräuber im Bugraum von Tasmans Schiff ist der Geleitbrief, der den Schiffen sichere Fahrt verheißt!
Wenigstens diese Gewissheit kann ich nach Laos mitnehmen.
Es ist der Abschied, Sita. Vielleicht werde ich in Laos etwas tun, was du hier nie geduldet hast: nämlich dich zeichnen. Deine Augen. Den sanften Schwung deiner Brauen, eine Blüte im schwarzen Haar an der Schläfe, die Ohren mit den kleinen Ringen geschmückt. Ich wird‘ dich bei mir haben.
Und was wird sein, wenn ich wiederkomm? Und wann? Dein Vater war ein armer Mann; und er hat die Dschunke nicht halten können im Sturm, die er mit dem Geld des Herrn Chichermodt ausgerüstet hatte. Möge er ruhig liegen, dort auf dem Grund vor der Küste von Chiampa. Schrecklicher wäre es für ihn zu wissen, dass du, Sita, seine Tochter, seine Schuld an Chichermodt bezahlst, indem Chichermodt dich zur Sklavin machte.
Das ist es, was mir den Abschied am schwersten macht: dass ich das Geld nicht zusammenbekommen habe, um dich freizukaufen. Und Chichermodt lacht, wenn ich mit ihm spreche.
„So still, Freund?“, fragte Sita leise und strich ihm übers Haar.
Da sagte er es: „Ich reise morgen.“
„… morgen …?“
„Nun lach, was trauern wir. Die Zeit gehört uns, und wir sind jung! Laos hat Gold, und macht es mich auch nicht reich, so wird es mir doch so viel lassen, dass ich einem Herrn Chichermodt einen Beutel voll vor die Füße werfen kann.“
Sitas stumme Augen. Ihre Angst. „Dan, Dan …“ Er nahm sie in die Arme. „Weine nicht, Sita, es ist doch nicht Abschied für immer.“
IX.
Daniel Hillebrant kam zurück in die Faktorei, um die Mitternachtszeit. Die Prauwen für Laos lagen beladen in dem Wasserarm vor dem Tor. Sie trugen Laternen. Schwer war die Nacht mit ihrer Finsternis und Schwüle. Als Daniel die Treppe ersteigen wollte, stockte er. Ein unförmiger Haufen hockte da wie ein großes Tier.
„Kommst du endlich?“, klang es aus dem Dunkel.
„Broeckman. Harmen! Du schläfst nicht?“
„Du hast gefehlt beim Rat.“
„Beratung, heute Abend noch?“
„Du kannst dir gratulieren. Du fährst nicht nach Laos. Wuysthoff selber geht. Regemortes übernimmt die Niederlassung.“
Daniel musste sich plötzlich setzen. „Wie das?“, brachte er hervor.
„Wuysthoff hat Angst. Die Stadt ist ihm zu heiß. Als er heute über den Platz am Königshof gehen wollte, haben ihn Soldaten gezwungen, einen anderen Weg zu nehmen. Der König kann Wuysthoffs Fresse nicht mehr sehen.“
„Wuysthoff geht.“ Daniel lachte. Wuysthoff auf der Prauw; sein Fett wird schmelzen. Und alles rings um ihn kaut Betel!
So einfach also … Der König zwang Wuysthoff zu gehen … Fünf Jahre war die Niederlassung alt, und vor drei Jahren hatte Gaelen, ihr erster Leiter, gehen müssen. Vor einem Jahr war sein Nachfolger van der Hagen gestorben. Jetzt marschierte Wuysthoff ab. Wie kurz sie amtierten! Daniel lachte aus vollem Halse.
„Du weckst noch die Leute“, warnte Broeckman.
Vier Ströme trafen sich bei Lauweck, des Königs Stadt. Der eine speiste den See Tonlesap in der Regenzeit und entnahm ihm wieder das Wasser, wenn es ihm mangelte. Der andere war Tasmans Straße zum Meer. Auf dem dritten reisten an diesem Sommertag vier Prauwen mit den laotischen Kaufleuten ins Laoland, Wuysthoff an Bord, mit einer Gesandtschaft für den laotischen König. Auf dem vierten Fluss aber, ebenfalls dem Meer zu, schwammen die beiden Dschunken des Chichermodt mit den portugiesischen Waren.
Am Abend, sobald er sich frei machen konnte, eilte Daniel Hillebrant zu Chichermodts Haus. Sita, es war doch nicht der Abschied! Er passierte einen Steg, trat ins Dickicht, kam an den Bambuszaun, stieß einen Pfiff aus, so wie ein Star pfeift in Hollands Kirschbäumen. Verschlossen blieb die Pforte im Zaun, und die Hütten versanken in der hereinbrechenden Nacht. Trauere nicht, Sita, in der Hütte, glaub nicht, dass ein Geist den Pfiff deines Liebsten nachahmt. So viel kann passieren in knapp einem Tag.
Lange wartete Daniel Hillebrant, pfiff wieder. Einmal hörte er die Portugiesen singen. Sie feierten wohl die Abreise ihrer Waren. Er dachte an die Schiffe, die da nach allen Himmelsrichtungen fuhren. Er lehnte sich an den Zaun, roch den Bambus. Dann erinnerte er sich des Boots.
Daniel Hillebrant eilte über den Steg zurück, gelangte an den leeren Ladeplatz des Chichermodt, ging auf dem schmalen Saum zwischen Palmen und Wasser.
„Sita!“ Da war sie! Sie saß dort, wo die Dschunken gelegen hatten. Sita … Sie saß nicht dort. Es war die alte Dienerin des Chichermodt. Sita? Weiß er’s denn nicht, der Herr Daniel, Sitas Geliebter? Die Sklavin Sita schwimmt doch auf den Dschunken des Chichermodt mit den portugiesischen Waren nach Japan.
„Sita!“ Daniel schrie ihren Namen hinaus. Er warf sich in den Sand. Es war doch der Abschied.
Zweites Kapitel
I.
Der Wind wehte stetig über das Meer, Südwind, Segelwind. Regen brachte er und Gewitter, schob den Himmel wieder von Wolken frei und ließ Wellen tänzeln. Aber er schob nicht das Schiff.
Das Schiff „Oostcappel“ lag vor der Küste, vor dem Delta des Stromes. Die Segel hatte es gerefft, der Anker ruhte im tonigen Grund. Behäbig drehte es sich in der Strömung, im Wasser, das noch vom Lehm verfärbt war, den der Fluss ins Meer schleppte.
Manchmal entfaltete es auch urplötzlich die riesigen Segel, Fock und Großsegel, Blinde und Besan, so dass es den Anschein hatte, als vergrößere es sich, als plustere es sich auf wie ein Kampfhahn. Dann hing die Mannschaft in den Wanten, turnte über die Stags, angetrieben von den Kommandos des Hochbootsmanns. Und das Schiff bekam Leben, Fahrt. Und es hetzte die Küste entlang, an den unzähligen Inseln, Flussarmen, Buchten vorbei.
Und wieder lag es irgendwo vor Anker, geschützt nicht nur vor Sturm, sondern auch vor Blicken vom Land aus, während es selbst zehn Augen hatte. In jedem Mars steckte ein Mann, und am Bug lag einer und am Heck.
Ein faules Leben für die Mannschaft war das. Pützen voll Wasser hievten sie aus der See und gossen sie sich über die erhitzten Körper. Mit Mangofrüchten zielten sie auf die Rückenflossen der Haie, die das Schiff umschwammen. Die Glocke schlug die Glasen, die Wachen wechselten. Sieben volle Tage lag das Schiff so im Meer.
Der Hochbootsmann Gerrit Jorisse stiefelte über die Kuhl, an den Beibooten vorbei, blickte hinauf zu dem Mann im Großmars und öffnete die Tür zur Kampanje. Es roch nach warmem Holz und nach Teer, und die Hitze hier schien unerträglich, obwohl alle Luken offenstanden. Zwei Männer saßen bei den Geschützen, bei Lunten und Pulver. Ihre nackten Oberkörper glänzten vor Schweiß. „Wann segeln wir, Hochbootsmann.“ Schweigend ging Gerrit Jorisse weiter, matt in den Beinen. Er hatte am Morgen im Spiegel das gerötete Weiß seiner Augen gesehen. Wie ausgetrocknet von der Sonne war sein Gesicht, gelblich die Haut, und die Hitze in seinem Schädel kam nicht nur von diesem verfluchten Sommer.
Und wieder eine Tür. Der Rudergänger hob den Kopf von dem Bettsack, auf dem er lag. Der Kolderstock, mit dem er so fein, so behutsam das mächtige Schiff dirigieren konnte, war festgebunden.
Er war schon auf den Beinen, noch bevor Gerrit Jorisse die Tür geschlossen hatte. „Geht es los, verdammich?“
Der Hochbootsmann winkte ab, der Rudergänger de Ratte kroch mit einem Fluch erneut auf den Sack.
Die nächste Tür. Dahinter, in der Staatskajüte, Tasman. Gerrit klopfte und trat, ohne Antwort abzuwarten, ein. Tasman, am Tisch, setzte die Kanne ab. „Sieben Tage“, sagte Gerrit. „Sieben Tage warten wir vor der lausigen Küste, und wann segeln wir, Schiffer? Wann kommt frischer Wind durch die Luken?“
Tasman sah auf den Mann, auf diese Jammergestalt, die das Fieber auszehrte. „Fieber hast du, ich seh’s“, sagte er und griff nach der Kanne. „Trink ’nen Schluck Arrak.“ Er füllte den Becher und schob ihn Gerrit zu, der nahm, trank, ließ sich auf die Bank am schräggeschnittenen Fenster fallen. Durch die offene Tür zur Galerie erblickte er wie einen feinen Strich die Küste.
Der Arrak machte Gerrits Kehle noch heißer. „Ich muss dir nicht sagen, Schiffer Abel, wie weit Japan von hier ist. Du hast uns im Vorjahr hingeführt, vier Schiffe, ‚Oostcappel‘, ‚Meerman‘, ‚Otter‘, ‚Broeckoort‘. 205 Mann haben dir gehorcht. Sicher war die Fahrt. Ich muss dir nicht sagen, wie bald der Wind umschlägt, gegen den wir uns nicht stemmen können. Aber auch ich weiß: Nie erreichen wir Japan, wenn wir noch lange hier herumlungern.“
Tasman nahm aus einer hölzernen Schale ein Stück Arecanuss und steckte es in den Mund. Während er kaute, schlitzte er mit dem Daumennagel die Rispen aus einem Blatt vom Betelpfefferstrauch, wobei er Gerrit ruhig maß. Er wischte sich den Daumen ab. Den Nagel hatte er sich extra lang wachsen lassen und geschärft, um die Betelblätter sachgemäß entrispen zu können. „Nimm dir!“ Vor Gerrits Augen drehte sich alles. Kreischte da der Papagei draußen auf der Heckgalerie in seinem Käfig, oder lachte Tasman, der das Blatt zusammenrollte und in Kalk stippte. Das Dröhnen freilich kam nicht aus seinem Schädel, das war ein Klopfen an der Tür. Er blickte hin. Da stand der Kaufmann Coomans auf einmal in der „Hütte“. Gebückt, um nicht an die Lampe zu stoßen, musterte er misstrauisch den zusammengesunkenen Hochbootsmann. „Ihm fehlt frische Luft“, erklärte Tasman. „Fahrtwind“, präzisierte Gerrit und drückte sich am Tisch hoch. „Ich nehm nie ein Blatt vor den Mund. Ich red, wie ich denk. Und ich denk, wenn du nicht bald fährst, Abel Tasman, fährst du in den Grund.“ Damit ging der Hochbootsmann hinaus.
„Er ist fertig“, sagte Coomans geringschätzig. „Du solltest ihn in Formosa auswechseln.“
„Er ist mein bester. Er wird Chinarinde fressen und gesund werden.“ Unvermittelt stellte sich Tasman vor Coomans und verkrallte sich in dessen schweißfeuchtem Hemd. „Ich riskier was für dich, Kaufmann“, zischte er. „Längst müsst ich fahren. Ich brauche Japan, und ich brauch zugleich die Dschunken. Und das ist doch auch dir am liebsten!“
Nervös befreite sich Coomans von Tasmans Griff. „Was der Ostindischen Compagnie dient, ist richtig.“
„Einen Tag wart ich noch, keinen länger.“
„Und wenn du dann fährst, ohne dass die Dschunken gekommen sind, und sie kämen nur acht Glasen später, und du hättest sie haben können, wenn du auch diese paar Glasen noch gewartet hättest, nachdem wir hier eine volle Woche vertan haben?“
„Wenn, wenn!“ Tasman fegte in jähem Zorn den Becher vom Tisch, so dass der Papagei aufschrie. „Geh, geh, Coomans! Hock dich über deine Rechnungen, blas mir nichts ins Ohr! Die Compagnie wird dir keinen Stuiver Prämie zahlen, wenn du Japan nicht zu sehen bekommst.“ Er schob den erschrockenen Kaufmann aus der Tür.