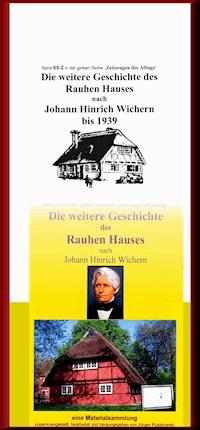Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dr. Karl Semper, geboren am 6. Juli 1832 in Altona, bereiste ab 1859 zu zoologischen und ethnologischen Forschungen zunächst die Philippinen und 1863-64 die Palau-Inseln im Stillen Ozean. Dort begegnete er Anfang November 1863 dem 1835 in Wilster geborenem Kapitän Alfred Tetens – damals noch Steuermann im Dienste des Schotten Anrew Cheyne – der später im Auftrage des Hamburger Reeders Godeffroy auf dessen Bark "VESTA" nach Palau und Yap zurückkehrte. Dr. Semper habilitierte nach seiner Rückkehr nach Deutschland 1866 in der Universität Würzburg in Zoologie und wurde dort 1868 Professor für Zoologie und vergleichende Anatomie. - Aus Rezensionen: Ich bin immer wieder begeistert von der maritimen gelben Buchreihe. Die Bände reißen einen einfach mit. Inzwischen habe ich ca. 20 Bände erworben und freue mich immer wieder, wenn ein neues Buch erscheint. Oder: Sämtliche von Jürgen Ruszkowski aus Hamburg herausgegebene Bücher sind absolute Highlights. Dieser Band macht da keine Ausnahme. Sehr interessante und abwechslungsreiche Themen, die mich von der ersten bis zur letzten Seite gefesselt haben! Man kann nur staunen, was der Mann in seinem Ruhestand schon veröffentlicht hat. Alle Achtung!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 394
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jürgen Ruszkowski
Dr. Karl Semper und seine Studien auf den Palau-Inseln im Sillen Ozean
Band 105-1 in der maritimen gelben Reihe bei Jürgen Ruszkowski
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort des Herausgebers
Alfred Tetens
Dr. Karl Gottfried Semper
I. Die Palau-Inseln im Stillen Ozean
Von Manila nach den Palau-Inseln
Abfahrt der „LADY LEIGH“
II. Erster Aufenthalt am Lande
Die sozialen Strukturen der Palau-Insulaner
Bau eines eigenen Hauses für mich
Beginn meiner Forschungsarbeiten
Der Angriff auf Aibukit
Friedensschluss
Das „Geld“ der Insulaner
Badebräuche der Insulaner
III. Ich zahle Lehrgeld
IV. Ich werde selbständig
V. Wanderleben
VI. Kreiangel
VII. Getäuschte Hoffnungen
VIII. Era Tabatteldil
IX. Reise nach Coröre
N achtrag: Über das Aussterben der Palau-Insulaner und dessen mutmaßliche Ursachen
D ie maritime gelbe Buchreihe
W eitere Informationen
Impressum neobooks
Vorwort des Herausgebers
Von 1970 bis 1997 leitete ich das größte Seemannsheim in Deutschland am Krayenkamp am Fuße der Hamburger Michaeliskirche. Dabei lernte ich Tausende Seeleute aus aller Welt kennen.
Im Februar 1992 entschloss ich mich, meine Erlebnisse mit den Seeleuten und deren Berichte aus ihrem Leben in einem Buch zusammenzutragen. Es stieß auf großes Interesse. Mehrfach wurde in Leserreaktionen der Wunsch laut, es mögen noch mehr solcher Bände erscheinen. Deshalb folgten dem ersten Band der „Seemannsschicksale“ weitere Bände.
Zufällig kamen mir die Texte über Alfred Tetens auf einem Flohmarkt in die Hände, welche die große Zeit der Handelsschifffahrt unter Segeln des 19. Jahrhunderts sehr plastisch beschreiben.
Der 1835 im damals noch dänischen Wilster geborene Alfred Tetens reiste im Auftrage des in Blankenese wohnenden Hamburger Reeders Joh. Ces. Godeffroy & Sohn erstmals 1865 mit der Brig „VESTA“ in die Südsee, um dort mit den Bewohnern der Palau-Inseln Handel zu treiben. Er belieferte Godefroy auftragsgemäß auch mit diversen Exponaten für dessen naturkundliches Museum.
Alfred Tetens begegnete auf den Palau-Inseln auch Dr. Karl Semper. Diesem deutschen Naturforscher und seiner unvergesslichen Leistung sei dieser Band 105e gewidmet.
Der vom Herausgeber vor Jahren neu geschaffene Beitrag bei Wikipedia ist inzwischen zu einer umfangreichen wissenschaftlichen Würdigung angewachsen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_Tetens
Hamburg, 2019 Jürgen Ruszkowski
Ruhestands-Arbeitsplatz des Herausgebers
Alfred Tetens
Alfred Tetens, am 1.07.1835 in Wilster als Sprössling Nummer Sieben eines in dänischen Diensten stehenden Justizrates und Senators geboren, fuhr als Schiffsjunge, Matrose, Steuermann und Kapitän in britischen, dänischen, peruanischen, bremischen und hamburgischen Diensten jahrelang weltweit auf Segelschiffen zur See, ‚entdeckte’ und erschloss in den 1860er Jahren etliche pazifische Inselgruppen im Auftrage des „Königs der Südsee“, des Hamburger Handelshauses J. C. Godeffroy & Sohn für den Handel mit Deutschland und bekleidete später das Amt des Wasserschouts ‚eines hohen Senats’ der Freien und Hansestadt Hamburg. Er war 1891 auch Mitbegründer der noch heute für Seeleute aus aller Welt gemeinnützig arbeitenden Deutschen Seemannsmission in Hamburg R.V.
Der bei uns in Vergessenheit geratene Name des Kapitäns Alfred Tetens taucht heute noch in mehreren englischsprachigen Internetseiten und auch in einer spanischen im Zusammenhang mit der Geschichte der mikronesischen Inselwelt auf:
www.micsem.org/pubs/articles/historical/bcomber/sources.htm
In seinen 1889 in Hamburg beim Verlag G. W. Niemeyer Nachfolger (G. Wolfhagen) erschienenen und von S. Steinberg bearbeiteten „Erinnerungen aus dem Leben eines Capitäns – Vom Schiffsjungen zum Wasserschout“, die ich zufällig in einem antiquarischen Flohmarkt-Bücherkarton fand und die es im Handel nicht mehr gibt, habe ich als der Herausgeber dieser maritimen gelben Buchreihe den Band 4e
(unter ISBN 978-3-7467-8730-5 – unter dem Titel Weltweit unter Segeln um 1850-70 – bei Amazon unter ISBN 978-1515096061 – auch als eBook im ePub- und Kindle-Format
unter ISBN 978-3-7380-3510-0) gestaltet.
Hier die entscheidende Passage aus Band 4:
„Mit wem habe ich die Ehre?“, fragte der Fremde höflich. – „Mein Name ist Tetens, ich bin Führer der „ACIS“ und Teilhaber des Kapitäns Cheyne.“ – „Sehr erfreut, Herr Tetens, ich bin Dr. Semper. – „Darf ich mir eine Frage gestatten, Herr Doktor?“ – „Bitte sehr.“ – „Sind Sie Engländer?“ – „Nein, nein, ich bin Deutscher.“
Bis jetzt war die Unterhaltung in englischer Sprache geführt, als ich nun aber deutsch antwortete und meine holsteinische Heimat nannte, da sprang Dr. Semper freudig erregt empor. „Das ist ja famos, dann sind Sie ja nicht nur mein Landsmann im Allgemeinen, sondern auch im engeren Sinne, ich bin aus Altona.
Es waren angenehme Stunden, die ich in Gesellschaft des Gelehrten verlebte. Nicht nur die Erinnerung an die ferne Heimat war geweckt, es füllte mich auch mit Bewunderung, wie der deutsche Forscher im Dienste der Wissenschaft alle Strapazen, jedes Ungemach ertrug und mit welcher unermüdlichen Ausdauer er seine wissenschaftliche Aufgabe zu erfüllen suchte.
Im Allgemeinen ist unter dem Volke die Ansicht vorherrschend, dass der deutsche Professor nur Auge und Sinn für das streng Wissenschaftliche habe, dass er alles, was seinem eigentlichen Gebiete ferner liegt, nicht beachte und mit den einfachsten Dingen weit unpraktischer verfahre wie der Mann aus dem Volke. Hat diese Meinung eine gewisse Berechtigung, so machte Dr. Semper eine glänzende Ausnahme. Ihm war auch nichts entgangen, selbst die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse der Inselgruppe hatte er mit einer seltenen Klarheit erfasst und er wusste die geringfügigsten Vorkommnisse wissenschaftlich zu erläutern.
Von allen Einwohnern geachtet, hatte der deutsche Gelehrte in einer verhältnismäßig kurzen Zeit nicht nur alles Wissenswerte erfahren, sondern auch, vom Zufall begünstigt, Cheynes selbstsüchtige Pläne entdeckt und höchst geschickt vereitelt.
König Abba Thule war im Besitze eines Buches: „An Account of the Pelew-Islands“, dessen Verfasser Wilson im Jahre 1780 auf den Palau-Inseln gescheitert und der somit wohl die erste eingehende Schilderung von diesem Volke geliefert hat. Der König betrachtete dieses Buch als ein Heiligtum, erzählte es doch von einem jungen Königssohn, der einst die Insel verlassen, um in England europäische Sitten zu erlernen, dort im fernen Lande von einem frühzeitigen Tod ereilt worden, und der nie wieder in seine Heimat zurückgekehrt war. Dr. Semper empfing dieses Buch zur Durchsicht aus den Händen des Königs, fand auch manche wissenschaftlichen Aufschlüsse, aber weit mehr als der Inhalt, fesselten den aufmerksamen Forscher zwei zufällig zwischen die Blätter des Buches geratene Abschriften eines geheimen Vertrags zwischen dem Könige und dem Kapitän Cheyne, sowie einer Konstitution von Palau.
Die Originale dieser interessanten Schriftstücke befanden sich im englischen Konsulate in Manila. Wurden die Bestimmungen ausgeführt, so war Kapitän Cheyne tatsächlich König von ganz Palau. Dr. Semper hatte Abschrift von den Dokumenten genommen und sowohl diese, wie auch die mutwillige Zerstörung von Korror-Dörfern durch das englische Kriegsschiff „SPHINX“ in der in Manila erscheinenden Zeitung Diario de Manila veröffentlichen lassen.
Spanien, das angeblich vor 150 Jahren die Palau-Inseln als Eigentum erworben haben will, schenkte diesem Vorkommnis zwar nicht die erwünschte Beachtung, aber der deutsche Gelehrte erreichte wenigstens den moralischen Erfolg, dass Cheynes Handlungsweise in weiten Kreisen zur Kenntnis kam und seine Pläne wie von unsichtbarer Macht durchkreuzt wurden.
Für mich waren die freimütigen Eröffnungen meines gelehrten Landsmannes von höchster Wichtigkeit; wenn ich mich auch nicht um Politik kümmerte, so hatte ich doch den wahren Charakter meines Reeders kennen gelernt und konnte demnach meine Maßregeln treffen.
Der Herausgeber dieses Bandes 105e war beim Lesen der Texte des Dr. Semper und dessen Darstellung der Begegnung zwischen beiden Anfang November 1862 auf der Insel Corror sehr erstaunt über die doch recht unterschiedliche Darstellung dieser Begegnung. Laut Dr. Semper hatte Tetens bereits vor dieser Begegnung in Manila von seinem hier forschenden Landsmann gehört. Es ist durchaus möglich, dass diese unterschiedliche Darstellung auf den GhostwriterSammy Steinberg zurückzuführen ist, der den ursprünglichen Bericht Alfred Tetens' für eine Buch-Veröffentlichung umgeschrieben und nachweislich verfälscht hat.
Dr. Karl Gottfried Semper
https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Semper
geboren am 6. Juli 1832 in Altona
verstorben am 29. Mai 1893 in Würzburg
Semper war Naturforscher, Zoologe, Ethnologe und Forschungsreisender. Er studierte an der Technischen Hochschule in Hannover, wo er 1852 Mitglied des Corps Visurgia wurde. Als Ethnograph bereiste er 1859 bis 1864 die Philippinen und die Palauinseln und kehrte im November 1865 über Hongkong, Saigon und Ceylon nach Europa zurück.
In Manila hatte er die aus Hamburg stammende Anna Hermann (* 28. Oktober 1826) kennen gelernt. Sie wird in den nachfolgenden Texten von ihm als Verlobte mehrfach erwähnt.
1866 habilitierte er an der Universität Würzburg in Zoologie und wurde dort 1868 Professor für Zoologie und vergleichende Anatomie.
So sieht der Originaltext in Dr. Sempers bei Brockhaus erschienenem Buch aus dem Jahre 1873 aus.
I. Die Palau-Inseln im Stillen Ozean
Original 1873 bei F A Brockhaus in Leipzig erschienen
Von Manila nach den Palau-Inseln
Es war im Mai des Jahres 1859. Von Luban, einem hoch am nordöstlichen Abhange des erloschenen Vulkans Banajao auf Luzon liegenden Bergdorfes aus ritt ich auf schlechtem, aber wunderbar schönem Wege nach Mauban zu. Ehe ich diesen an der östlichen Küste liegenden Ort erreichte, bot mir noch in ziemlicher Höhe eine Windung des Weges den ersten Blick auf den Stillen Ozean, dessen langgestreckte Wogen sich an den Riffen des Ufers brachen, während er im Horizont mit dem Himmel zu verschmelzen schien.
Die Bewegung des Seeganges war nur an dem Schaum der Küste zu erkennen; und das Meer selbst schien gänzlich ruhig dazulegen, in der Tat ein stiller Ozean, auf dessen weiter Fläche kein Boot, kein Schiff zu erblicken war. Aber der unbegrenzte Horizont setzte meiner Phantasie kein Hindernis entgegen; weiter und weiter nach Osten zu schweifte mein Blick in die Ferne, und je weiter er drang, umso bewegter schien mir auch das Leben des Meeres zu werden. Zunächst traf mein Auge die Marianen, unter denen mir Tinian in der Erinnerung an Anson’s warme Schilderung tiefe Sehnsucht erweckte, während von südwärts her die kraushaarigen dunkelbraunen Bewohner der Carolinen gastlich zu winken schienen.
Abba Thules (siehe das Buch von Keate Wilson, „an Accoutt of the Pelew Islanda“ London 1783, das seinerzeit großes Aufsehen erregte und auch in Deutschland viel gelesen wurde) und Leeboos freundliche Gestalten zogen, bedeutungsvoll lächeln, an mir vorüber; aber auch grausame Mordszenen zwischen Farbigen und Weißen traten mir vor das Auge. Bald sah ich die Fidschi-Insulaner den getöteten Feind als Sühnopfer verzehren, während von ihrer heimatlichen Insel vertriebene Bewohner der Samao-Inseln nach Tonga und Neuseeland absegelten, bis plötzlich ein großartiger Ausbruch des Mauna-Roa das Bild zerstörte, das sich mir so in der Fülle des tropischen Lebens und mir geschichtlichen Erinnerungen verwebt entrollt hatte. Verlangen nach den wunderbaren Koralleninseln des Stillen Ozeans erfasste mich mächtig, und ich gelobte mir, keine Gelegenheit unbenutzt vorübergehen zu lassen, wenigstens einen kleinen Zug aus dem übervollen Freudenbecher zu tun, den ich dort zu meinen Füßen so unermesslich weit ausgebreitet zu sehen wähnte.
Mit diesem Entschluss, einige Inseln des Stillen Ozeans kennen zu lernen, kehrte ich nach Manila zurück. Bald schien sich mir eine treffliche Gelegenheit zu bieten. Ich erfuhr durch einen Freund, dass ein englischer Kapitän namens Cheyne soeben mit einer Ladung Trepang (so heißen die für den Handel nach China zubereiteten Holothurien, eigentümliche fast wurmartige Tiere aus der Klasse der Echinodermen) von einer den Spaniern längst bekannten Inselgruppe, den Palaos (Pelew-Islands der Engländer, besser Palau-Inseln), angekommen sei und nach Verkauf derselben möglichst rasch wieder dahin zurückzukehren gedenke.
Zwar lagen diese Inseln noch ziemlich nahe an den Philippinen und schienen so von keinem besonderen Interesse, aber da ihre Bewohner sicherlich einer ganz andern der tagalischen, ganz fern stehenden Rasse angehörten und ihre Barrièrenriffe mit den durch sie eingeschlossenen Kanälen und Lagunen reiche zoologische Ernte versprachen, so verschaffte ich mir eine Empfehlung an diesen Kapitän. Ich besuchte ihn an Bord seines Dreimasters. Er empfing mich freundlich, fast zu sehr, war gleich bereit mich mitzunehmen und deutete mir sogar an, dass ich mit ihm reisend wohl auch im Handel mit den Eingeborenen, den er mir gestatten wolle einigen Ersatz für meine Reisekosten würde finden können. Dennoch wies er mich nachher mit einigen Entschuldigungen ab.
Ich vergaß bald diese Enttäuschung während einer gleich danach unternommenen Reise nach dem südlichsten Punkte der Philippinen, nach Zamboanga und Basilan; und ich vergaß Cheyne um so leichter, als ich bei meinen Erkundigungen nach dem Trepang-Handel mit den Palaos in Erfahrung gebracht dass noch andere Kapitäne von Zeit zu Zeit in Manila einzulaufen pflegten, welche vom Stillen Ozean herkämen, dass ich also leicht zu einer andern Zeit den ungern aufgegebenen Plan würde ausführen können.
Jahre vergingen nun. Rastlos wandernd, bald zu Fuß, bald zu Pferde oder im Boot durchzog ich das nördliche Luzon nach allen Richtungen bis mich endlich im Oktober des Jahres 1861 eine lang genährte aber nicht erkannte und unbeachtet gelassene Dysenterie (Die Dysenterie ist eine Entzündung des Darms, die oft zu starker Diarrhö, Magenschmerzen und Erbrechen führt.) so danieder warf, dass ich die Reise unterbrechend rasch nach Manila zurückkehren musste. Meinen Diener Antonio Angara schickte ich weiter auf der begonnenen Reise, da ich hoffte, ihn in kürzester Frist wieder irgendwo im Norden treffen zu können. Das Schicksal hatte es anders beschlossen. Dort in Manila obgleich von treuen liebenden Händen gepflegt und von einem geschickten deutschen Arzt behandelt, wurde ich des Nebels nicht Herr – und mitten in meinem Gram über die Unmöglichkeit meiner Weiterreise überraschte mich eines Tages meine Braut mit dem Worte, dass der Arzt eine Seereise dringend anrate und dass sie bereits ein Schiff gefunden habe, welches in wenig Wochen nach den Carolinen absegeln solle! Alles war bereits mit dem Kapitän Woodin verabredet, ich brauchte nur noch mein Wort zu geben, dass ich mich der auf höchstens vier bis fünf Monate berechneten Expedition anschließen wolle. Die sicher scheinende Aussicht auf Erfüllung eines meiner sehnsüchtigsten Wünsche gab meiner Spannkraft neue Nahrung – und ich entschloss mich leicht und gern zu einer Reise, die ich krank, nur unvollständig ausgerüstet und ohne meinen treuen erprobten Antonio antreten musste, die aber zu einer der genussreichsten und zugleich mühseligsten meines ganzen Wanderlebens werden sollte!
Kapitän Woodin der Befehlshaber der „LADY LEIGH“ ein alter englischer Seemann von echtem Schrot und Korn empfing mich aufs freundlichste. Zwar bot er mir nicht an wie Cheyne es früher getan, dort neben ihm Handel treiben zu dürfen, ja er verweigerte sogar seine Einwilligung Äxte Beile und eiserne Kochschalen, die dort auf den Inseln beliebtesten Artikel zum Zweck des Eintauschens von Tieren mitnehmen zu dürfen. Aber gerade diese Offenheit und die humane Gesinnung, die aus seinem nicht sehr geistreichen Auge sprach, nahmen mich für den Mann ein. Unter seiner Leitung besorgte ich denn auch meine Ausrüstung, obgleich ich mir namentlich in Bezug auf Lebensmittel wie Schokolade Biscuit, Tee Plumpudding und konserviertes Fleisch einige Ausschreitungen erlaubte, und es kostete mir einen kleinen Kampf, seine Einwilligung zu meinem Plane zu erhalten außer einem nur für meine leiblichen Bedürfnisse sorgenden Diener Alejandro, noch einen jungen Mestizen D Enrique Gonzalez, seines Zeichens ein angehender Maler, mitzunehmen. Mit diesem letzteren wollte ich einmal den Versuch wagen, ob nicht ein in der zu Manila 1859 gegründeten und unter der Leitung des trefflichen spanischen Malers D Matias de Sainz stehenden Malerschule (Real Academia de pinturas) gebildeter Mestize der Leitung seines Lehrers entzogen und selbständig arbeitend Tüchtiges würde leisten können.
Durch seine Hilfe hoffte ich eine Fülle ethnologischer Studien und Porträts, ohne selbst viel Zeit an die Verfertigung von Skizzen verwenden zu müssen, sammeln, statt dessen aber meine Zeit zu Beobachtungen aller Art und zum Fangen von Tieren verwenden zu können. Während ich teilweise die Anschaffung der Lebensmittel und der benötigten Tauschartikel (Reis, Pulver und Flintenkugeln, weißer und roter Calico (Kattun - Baumwolle), Taschenmesser usw. dem Kapitän überließ, wendete ich die geringe mir noch zu Gebote stehende Zeit und körperliche Kraft dazu an, meine Gläser für die Reise einzupacken und alle nötigen Vorbereitungen zu zoologischen Arbeiten zu machen.
Abfahrt der „LADY LEIGH“
Endlich war alles bereit. Meiner Braut, die nun so nah vor der Trennung sich einer sorgenden Ängstlichkeit nicht ganz erwehren konnte, rief ich Trost noch die Scheideworte zu, „dass es ja nur eine Spazierfahrt zu nennen und etwa einer Reise von Deutschland nach Italien zu vergleichen sei“; und am letzten Tage des Jahres 1861 fuhr ich, eher heiter als trübe gestimmt um 5 Uhr abends an Bord der „LADY LEIGH“. Der kleine Schoner von 110 Tonnen Gehalt lichtete um 6 Uhr die Anker.
Karte aus dem Originalbuch
Aber schon die Neujahrsnacht brachte uns Unglück. Noch in der Bai von Manila in der Nähe des Leuchtturms der Insel Corregider mussten wir ankern – das Schiff machte Wasser – und erst am 2. Januar konnte das Leck gestopft werden, denn Kapitän Woodin war ein energischer Seemann, aber auch ein frommer Engländer, der am Neujahrstag nur das eindringende Wasser auspumpen ließ, sonst aber nicht arbeiten lassen wollte. Mittags den 2. Januar fuhren wir fort, und nun ging es lustig bei frischem Winde zum Hafen hinaus an Ambil vorbei in die Straße zwischen Mindoro und der Provinz Natangas hinein. Hier wechselten stürmische Winde und Windstillen. Mochte nun bei dem heftigen Herumwerfen des kleinen und alten Fahrzeuges das frühere Leck wieder aufgesprungen oder ein neues entstanden sein, genug, wir mussten während dieser Tage wieder ziemlich stark pumpen und schließlich im Hafen von Burias am 7. Januar einlaufen, um das Schiff womöglich gründlichen Reparatur zu unterwerfen.
Die Einfahrt in den kleinen, aber sehr geschützten Hafen von Bunas ist schmal und eng, durch die zahlreichen von Korallen bedeckten Untiefen in der Nähe der Ufer gefährlich und nur bei gutem Winde und am Tage zu passieren. Dadurch dass diese kanalartige Lücke zwischen der eigentlichen Insel Burias und der nach Westen liegenden Insel Busin sich in der Nähe der Hauptstadt des kleinen Distrikts bassinartig ausweitet, entsteht ein jeglichem Seegange fast gänzlich entzogener und auch gegen die Südweststürme wie gegen den heftigen Nordostmonsun geschützter Hafen. Doch wird er nur im Binnenverkehr von einiger Bedeutung sein können; denn er ist einesteils zu klein und der Eingang zu schwierig für große Schiffe, andererseits aber ist die Insel selbst von zu geringer Bedeutung und den Nachbarprovinzen gegenüber zu ungünstig gelegen, um jemals zu einem Ausfuhrhafen nach fremden Ländern werden zu können. Die Insel selbst, lang und schmal, hügelig aber sicher nicht im Mittel die Höhe von 800 bis 1000 Fuß übersteigend (nach Schätzung) ist zum größten Teil bedeckt von Wiesen, die hier und da von mächtigen Waldungen unterbrochen sind und zahlreichen Rinderherden Weide geben. Es ist die Zucht und die Ausfuhr der lebenden Kühe, hauptsächlich nach den nächstliegenden Provinzen, die einzige Beschäftigung der nur einige hundert Tribute (als Tribut bezeichnet man auf den Philippinen die Summe der Abgaben, welche zwei erwachsene Menschen zusammen zahlen; Kinder bis zu 10 Jahren und Greise über 60 Jahren sind gänzlich frei. Die Zahl der Tribute gibt daher weniger als die Hälfte der Einwohner an. Kurzweg bezeichnet man auch je zwei Menschen immer als einen Tribut; man fragt viele „tributantes“ im Dorfe seien, sondern nur wie viele „tributos“) zahlenden Einwohner. Ursprünglich waren es ausschließlich militärische Sträflinge, die hierher geschickt wurden: sie siedelten sich hier an, und so entstand allmählich das kleine Gemeinwesen, das von einem Kapitän der Armee als sogenanntem Kommandanten des Militärdistrikts geleitet wird.
Obgleich nun trotz des längeren Lebens auf der See mein Unwohlsein nicht ganz gehoben, meine Kräfte noch nicht völlig wiederhergestellt waren, so konnte ich doch der Versuchung nicht widerstehen, der in den Annalen der Conchologie (die Conchologie ist ein Teilgebiet Zoologie und befasst sich mit Schalenweichtieren – Muscheln) berühmt gewordenen Isla Temple einen Besuch abzustatten. Der Kommandant selbst ein Schalenliebhaber, wusste mir viel von dem Reichtum der kleinen Insel an Landschnecken zu erzählen; er besorgte mir ein Boot und Leute, und so fuhr ich denn von einem ebenfalls als Passagier auf der „LADY LEIGH“ befindlichen Schweden, Namens Johnson, begleitet, am 9. Januar morgens dahin ab. Dieser Schwede war ein alter Bekannter des Kapitäns. Als Mr. Woodin in früheren Jahren noch reich und Besitzer mehrerer großen Schiffe gewesen war, welche alle zwischen Hobarttown, China und den Inseln des Stillen Ozeans fuhren, war Johnson auf einem derselben als Kajütenjunge angestellt gewesen. Unglückliche Spekulationen zwangen Woodin eins oder zwei seiner Schiffe zu verkaufen, ein anderes wurde irgendwo in China kondemniert ( im Seewesen soviel wie ein seeuntüchtig gewordenes Schiff von der Seefahrt ausschließen), und das, worauf Johnson fuhr, scheiterte beim Einlaufen in einen Hafen der Palau-Inseln. Es ging ihm wie so manchem europäischen Matrosen. Die Freundlichkeit der Eingeborenen gegen den kräftigen und jungen hübschen Menschen und die Achtung, in welcher unter jenen Wilden jeder noch so ungebildete Europäer steht, erleichterten ihm die Angewöhnung an ihr häusliches Leben, sodass er gern das gezwungene Exil zu einem freiwilligen machte, als vorbeifahrende Schiffe seinen Gefährten und auch ihm die Rückkehr ins europäische Leben ermöglichen wollten. Hier fand ihn dann – ich weiß nicht nach wie viel Jahren – sein alter Kapitän der nun verarmt wieder am Ende seiner Tage zum abenteuernden Leben des handeltreibenden Seefahrers seine Zuflucht nehmen musste; aber er fand ihn schon halb als Eingeborenen, kaum noch fähig, seine Muttersprache korrekt zu schreiben, schwach und krank, sodass er ihm aus Mitleid freie Passage nach Manila gewährte, um ihm durch bessere Nahrung und weniger ausschweifendes Leben wieder zu Kräften zu verhelfen. Sein Plan freilich, ihn seinem Vaterlande wieder zu gewinnen schlug fehl.
Mochte Johnson wirklich sein den Eingeborenen gegebenes Wort, wieder zurückzukehren heilig halten, wie er vorschützte; oder glaubte er, verleitet durch die Ehrfurcht, die er als Weißer genoss, „der Erste in dem kleinen Ländchen werden zu können“ genug er kehrte mit uns wieder nach den Palaus zurück. Mir war natürlich ein Europäer, der irre ich nicht, schon vier oder fünf Jahre mit den Bewohnern gelebt ihre Sprache erlernt und manche ihrer Gebräuche und Sitten mit offenem Auge, wie mir damals schien, beobachtet hatte, ein angenehmer und nützlicher Reisegefährte, ein angenehmer, denn die Hoffnung, wirklich gebildete Begleiter zu finden, hatte ich längst aufgegeben, und ein nützlicher, denn wäre er mehr das gewesen, was er zu sein schien, so hätte ich sicherlich nicht so sehr mit meinen eigenen Augen sehen gelernt, als ich es nachher tat.
Wir kamen auf der Insel Temple nach ruhiger und bequemer Fahrt an. Schon in ziemlicher Entfernung sahen wir am Meeresgrunde zahlreiche Korallen, in wunderbaren Gestalten und prangend im prächtigsten Farbenschmuck, regellos durcheinander wachsend dem langsam ansteigenden Meeresboden folgen, ohne ein eigentliches durch schäumende Wogen – die sogenannten Brecher – bezeichnetes Korallenriff zu bilden. Nur an einigen vorspringenden Punkten am Südende der Insel brachen sich die unbedeutenden Wellen, die der leichte und wechselnde Wind erhob. Aus dem so ganz allmählich vom Meeresgrunde emporwachsenden Korallenboden, der aber bis einige Fuß unter die tiefste Ebbelinie von größtenteils abgestorbenen Korallen gebildet ward, stieg die niedrige, ganz aus Korallenkalk und einem Konglomerat von Korallenfragmenten, Muscheln und Sand gebildete Insel in steilen Klippen empor. Nur an geschützten Stellen, Buchten und Einschnitten war das Gestein unter Korallensand begraben, während an den vorspringenden Punkten die Klippen einen durch die Brandung ziemlich tief ausgewaschenen Fuß zeigten. Nirgends war eine Spur eruptiven Gesteins zu bemerken. Überall mit ziemlich dichtem Wald bedeckt, unter dessen Bäumen vor allem die herrlichen Barringtonien (Palo Maria) und die unschönen aber charakteristischen Pandanusarten auffielen, stieg die Insel zu höchstens (schätzungsweise) 30 bis 40 Fuß über dem Meeresspiegel an. Das Wetter war köstlich während der zwei Tage, die ich dort zubrachte – im Sinne des Touristen; denn mir, der ich mit Schmetterlingsnetz und Schachteln ausgerüstet war, schien die Trockenheit, welche schon seit langer Zeit hier geherrscht haben musste, nach dem verstaubten und vertrockneten Aussehen der Blätter zu urteilen, ein ungünstiges Zeichen für die gehoffte Ernte. In der Tat fing ich denn auch fast gar keine Insekten, während ich doch im Jahre vorher zur selben Zeit in den ewig feuchten tiefen Schluchten der Gebirge in Zentral- Luzon viele der schönsten Schmetterlinge erbeutete. Dennoch aber füllten sich die Bambusrohre, welche mir auf meinen Reisen seit langem die Schachteln und Körbe ersetzten, rasch mit zahlreichen von den Baumblättern abgelesenen Landschnecken, welche in allen Altersstufen vertreten waren. Hier fand ich Eierhaufen in wie Düten zusammengedrehten Blättern; dort krochen die kleinen durchscheinenden Tierchen munter herum, während für die grün gebänderten oder roh und gelblich gesprenkelten halb oder ganz erwachsenen Tiere der Wonnemonat gekommen zu sein schien. Wie aber erstaunte ich erst, als ich am 11. Januar schon auf der Rückfahrt begriffen, auf einer kleinen zwischen Temple und Busin liegenden Insel landete. Hier waren fast buchstäblich die Bäume mit Schnecken bedeckt. In weniger als drei Stunden sammelten wir mehr als 1.200 Stück durch Schütteln der Bäume, wobei natürlich immer nur ein Teil der Tiere herab fiel aber die einzelnen Bäume zu ersteigen oder ihre Äste auch nur herabzubiegen, war eine zu große Mühe, da wir durch einige rasche Stöße an den Baumstamm mehr Exemplare auf den Boden brachten, als wir nachher wieder auflesen konnten. Auch unter diesen, die alle einer einzigen Art angehörten, fanden sich sämtliche Altersstadien vom Ei bis zum ausgewachsenen Tiere vor.
Ganz anders zeigte sich das Verhältnis in Bunas selbst, wo ich am 11. Januar abends wieder eintraf. Obgleich die nächste hügelige Umgebung des Hafens von Burias (Die genannten und noch einige andere in der Nähe liegende Inseln sind durchweg niedrig, die Hügel selbst aber dicht am Meere oft sehr schroff aufsteigend. Diese Felsen bestehen aus einem Konglomerat einer Unzahl von solchen Muschel und Korallenfragmenten, wie man sie jetzt noch am Ufer aller dortigen Koralleninseln findet. Die einzelnen Teile des Conglomerats werden durch einen stark kalkhaltigen Kitt zusammengehalten, und das Gestein häufig weiß, nimmt durch den Kitt oft, so namentlich bei der Stadt Burias und an der Nordseite der Insel – die deshalb auch Punta Colorada d. h. rote Spitze genannt wird – eine rotbraune oder selbst schwärzliche Färbung an. Bei Burias an der Südostseite des Hafens steht ein brauner grobkörniger harter Sandstein an mit sehr zahlreichen Schalen von Ostreen und Pecten, sowie zahlreichen Fragmenten von Echinidenstacheln, aber fast ganz ohne alle Cephalophoren. Alle Inseln, namentlich die kleineren, tragen den deutlichsten Charakter allmählicher Auflösung; einzelne abgerissene Felsblöcke, die auf schmaler Basis stehen – Resultat der Ausfressung durch die Brandung – zeigen deutlich die Fortsetzung korrespondierender Schichten an den ihnen benachbarten Inseln. Die Schichten lagern fast ganz horizontal.) aus gehobenem Korallenkalk und Schichten desselben Kalkkonglomerats bestand, welches ich auch auf Temple beobachtet hatte, so fanden sich hier doch weder genau dieselben Arten, als dort noch auch die vorhandenen in so großer Individuenzahl. Dagegen flogen hier, wenn auch spärlich, doch mehrere Arten von Schmetterlingen, und auf den Büschen erhaschte ich manche Insekten, während ich von Temple deren fast gar keine mitbrachte. Da sich nun aber mein altes Übel durch einen leichten Anfall bei mir wieder in Erinnerung gebracht hatte, so folgte ich dem Rate des Kapitäns, unterließ die Landexcursionen und brachte die Tage, welche wir noch zur Reparatur des lecken Schiffs dort verweilen mussten mit gelegentlichen Untersuchungen von Meertieren und einem unter dem Tropenhimmel so glücklich machenden dolce far niente (süßes Nichtstun) zu.
Das Leck war, wie die fortgesetzte Arbeit des Kapitäns zeigte, gefährlicher gewesen als er gesagt und wir geglaubt hatten. So konnten wir erst am 21. Januar, nachdem wir also volle 14 Tage in Bunas zugebracht hatten, nachmittags 3 Uhr den Anker lichten. Ein frischer Nordostwind brachte uns rasch zur südlichen Öffnung des Kanals heraus, um die Südspitze der Insel herum, und in der Nacht des 24. Januar kamen wir bei leichten Winden in der Straße von S.-Bernardino bei der Insel gleichen Namens an. Die bis dahin vergleichsweise rasche Reise mit dem altersschwachen Schiff hatte mir hinreichende Beschäftigung und Abwechselung in der Betrachtung der zahllosen Inseln gebracht, sodass ich leicht den unbehaglichen Eindruck überwand, den mir das, wie mir schien, nach jener langen Reparatur in Burias allzu häufige Auspumpen des Grundwassers verursachte. Wer jemals in einem stark Wasser machenden alten Schiffe gereist ist, weiß was für verpestende Gerüche das Auspumpen eines solchen in den Kajüten verbreitet; und obgleich meine empfindliche Nase ein väterliches Erbteil, um welches mich meine Frau später noch oft unglücklich schalt, sehr darunter zu leiden hatte, so vergaß ich doch leicht alles unangenehmes Geräusch und Gerüche und den Gedanken, dass das Meer keine Balken hat, in der Hoffnung einer raschen Fahrt nach den Inseln des Stillen Ozeans. Abermals getäuschte Hoffnung! Kalmen, konträre Winde und heftige von Osten her zur Straße S.-Bernardino einsetzende und täglich etwa 18 Stunden lang anhaltende Strömungen bannten unser Schiff fast wie auf einen Fleck und gaben mir nun Gelegenheit, mich etwas mehr der Unterhaltung mit meinen Schiffsgenossen zu widmen, als ich es bisher getan.
Wie ich auf meiner Reise um das Kap aus Langeweile fast die ganze Reise verschlief, so fing ich nun an, aus dem gleichen Grunde mit dem alten Woodin, Johnson, seinem Steuermann Mr. Barber und einem kleinen Palau Insulaner, Namens Cordo, zu plaudern. Gern hätte ich neben der geistigen Nahrung auch noch etwas mehr leibliche erhalten, als ich wirklich bekam. Im Anfang der Reise zwar waren wir ziemlich reichlich bei Tische versehen, aber das dauerte nicht gar lange. Während wir früher mittags und abends jedes Mal wenigstens ein Huhn nebst eingemachtem Fleisch, Gemüse usw. erhalten, wurde bald nur noch ein warmes Mittagsmahl gemacht, zu welchem ein Huhn gewöhnlich die Suppe, Braten und den in indischen Gegenden so allgemein verbreiteten „curry“ für sieben Personen abgeben musste. Je länger aber die Reise dauerte, um so stärker wurde mein Rekonvaleszentenhunger, den ich nun in Ermangelung eines guten Mittagsmahls mit Schokolade, vielem Zwieback und einsam verzehrten in Blechdosen mitgenommenen geräucherten Zungen und Würsten zu stillen versuchte. Woodin war dabei immer sehr um meinen Appetit besorgt. Wie oft sagte er mir nicht, wenn nur noch ein Unterschenkel des Huhns im Reis versteckt lag: „Hier, Dr. Semper nehmt dies gute Stück vom Huhn – upon my soul (auf meine Seele), Ihr esst nicht wie Ihr tun solltet.“ Nun dachte ich bei mir, der Mann hat wohl eigentümliche Ansichten, wie man einen heißhungrigen, kaum vom Tode erstandenen Genesenden behandeln soll, vielleicht spart er mir alle die Leckerbissen, die er damals in Manila mitzunehmen versprach, für spätere Zeiten auf, wenn ich besser im Stande sein werde, als Gastronom mich an die Arbeit ihrer Vertilgung zu machen. Dennoch, ich leugne es nicht, sehnte ich mich mitunter nach diesen sicherlich im Raume versteckten Fleischtöpfen, von denen ich hin und wieder einen reizenden Vorgeschmack durch die Gunst des Steuermanns erhielt, den ich mir zum Freunde gemacht und der bisweilen einen derselben in das gewöhnliche Mittagsessen von Reis, Huhn, Erbsen und Speck einschmuggelte. Ich erinnerte eines Tages, gerade als mich mein Heißhunger plagte, Mr. Barber an Woodin’s Versprechungen. „Ja“, meinte dieser lachend, „die Liste hatte Woodin allerdings entworfen, es waren zwei Folioseiten voll trefflicher Gerichte, die von Ihrem teurem Passagegeld gekauft werden sollten. Der Kapitän hatte die beste Absicht mit Ihnen. Aber dann tat ihm wieder das viele Geld leid; und nun wurde Tag für Tag etwas von der Liste als überflüssig gestrichen, bis endlich fast keine Nummer auf dem Papier mehr stehen blieb. Ihr habt gut getan, Euch selbst zu verproviantieren.“
„Aha, nun verstehe ich, darum fordert er mich immer des Mittags auf, so ängstlich um meinen Appetit besorgt, auch noch die Knochenreste des Hühnchens zu verzehren; er fürchtet, ich könnte Sie veranlassen, zum Abend doch wieder eins dieser seltenen Gerichte zum Vorschein zu bringen! Nun, da werde ich mich wohl auf die Palau-Insulaner verlassen müssen, nicht wahr mein Cordo?“
Damit wandte ich mich, wie ich oft und gern zu tun pflegte, diesem kleinen muntern Burschen zu, der, um sich Manila anzusehen, als Passagier mitgegangen war und, voll von Bewunderung des europäischen Lebens und der Männer des Westens, der „lakad-ar-angabard“, der großen Städte und der zahllosen Schiffe, der Uniformen der Soldaten und der hoch auf getreppten Häuser, nun nach seiner Heimat zurückkehrte, brennend vor Sehnsucht. all das Gesehene seinen Freunden schildern zu können. Aufmerksam, sinnenden Auges hörte er zu, wenn ich ihm diese oder jene Frage beantwortete, oder ihm irgendeine gerade seinen Blick fesselnde Erscheinung zu erklären versuchte; aber lebhaft in seinen Worten und feurigen Blickes wurde er erst, wenn er mir nun von seiner Heimat erzählte, und wie sich seine Mutter, die Frau des Krei, und seine gleichaltrigen Freunde alle freuen würden, ihn wiederzusehen und von ihm zu hören, wie das Land des Westens, „angabard“, doch so gar wunderbar sei. In seinem gebrochenen Englisch teilte er mir manche Notiz über die Verhältnisse seines Heimatdorfes Aibukit mit, die mir erlaubten, nach meiner Ankunft mich rasch zu orientieren. Auch Johnson, der als Passagier an Bord nichts zu tun hatte, erzählte mir während unserer langweiligen Irrfahrten in der Straße S.-Bernardino und an der Nordküste von Samar gar manches über die Sitten der Eingeborenen, ihre Kriege, ihr staatliches Leben, ihre Sagen und religiösen Gebräuche. (Zur vorläufigen Orientierung mag hier kurz Folgendes bemerkt werden: Trotz der Kleinheit des Areals sind doch die Bewohner der Inseln in eine große Menge einzelner mehr oder minder selbständiger Staaten geschieden, und oft bestehen diese, wie z. B. der Staat Coröre, nur aus einer einzigen kleinen Insel, mit zwei oder drei Dörfern, denen dann häufig eine ganze Menge anderer oft größerer Staaten verbündet sind. Doch stehen auch diese immer in einem gewissen Vasallenverhältnis, das sich freilich nicht kurz in einer für uns recht verständlichen Weise bezeichnen lässt. Ohne dass solche Vasallenstaaten gerade einen Tribut zu zahlen brauchen, sind sie doch in gewisser, später zu erörternder Weise an das leitende Reich gebunden, d. h. sie müssen sich manche Eingriffe in ihr soziales Leben gefallen lassen, die sie unter andern Umständen zurückweisen würden. Es hängt dies damit zusammen, dass bei der Kleinheit der Reiche alle persönlichen Beziehungen höheren Wert erhalten als in größeren; und es wird dadurch noch gesteigert, dass auch die geselligen Bande so mit der halb monarchischen, halb oligokratisch-republikanischen Staatsform verquickt sind, dass die Lösung der ersteren auch die politischen Beziehungen der Staaten zueinander lockern muss.
Auf der dem Originalbuch beigefügten Karte sind die hauptsächlichsten Staaten verzeichnet. Die politische Gruppierung war, als ich dort ankam, folgende. Infolge der Unterstützung von feiten Wilson’s und seiner Engländer am Ende des vorigen Jahrhunderts hatte Coröre, im Zentrum der Inselgruppe gelegen, unerwartetes Ansehen und Macht gewonnen, sodass sich Eirei, Armlimui und einige andere Staaten im südlichen Teil von Babelthaub wegen ihrer großen Nähe zu jener Insel, ferner Aracalong an der Nordspitze von Babelthaub aus persönlichen Rücksichten der dort herrschenden Familie, dem Ebadul, (d. h. dem König) von Coröre, als Verbündete angeschlossen hatten. Früher waren auch noch die Mittelstaaten von Babelthaub in diesem Bunde gewesen, mit einziger Ausnahme von Athernal an der Ostküste, welches sich zu Wilson's Zeit nach drei verlorenen Schlachten zur Tributzahlung genötigt sah, doch nie in die Stellung eines Vasallen von Coröre gebracht werden konnte. Die Eroberung und vollständige Zerstörung des Ortes Kaslan an der Westküste von Babelthaub, dicht bei Aibukit, im Anfang dieses Jahrhunderts, scheint der Grund gewesen zu sein, weshalb sich nun Aibukit auf die Seite Athernals stellte, und mit ihm wurden zu Verbündeten des letzteren eine Reihe kleiner Staaten dicht bei Aibukit (Roll, Rallap, Aural usw.), welche von jeher wirklich in einem Vasallenverhältnis zu diesem standen. Es war also die nördlichste Spitze und die südliche Hälfte von Babelthaub, der größten Insel der Gruppe, verbündet mit Coröre; ihnen gegenüber standen, geographisch abgeschlossen aber isoliert, die Mittelstaaten von Babelthaub. Kreiangel im höchsten Norden, ein durch einen breiten Kanal getrennter Atoll, und Peleliu wie Ngaur ganz im Süden spielten die Neutralen; sie standen in einer gewissen Abhängigkeit durch die Furcht vor Coröre, ohne dass sie jedoch an ihren Kriegen teilnahmen oder selbst den dort üblichen Tribut an lebenden Tauben entrichteten. Dass trotzdem das Wort Ebadul's von Coröre ein großes Gewicht hatte, sollte ich bald zu eigenem Nachtheil erfahren.)
Abermals zwang uns hier ein neues, wie es schien sich immer vergrößerndes Leck, am 29. Januar in den Hafen von Palapa einzulaufen. An der Nordostspitze von Samar, die ziemlich weit ins Meer vorspringt, zieht sich Batag, eine niedrige und von einem weit abstehenden Riffe umsäumte Insel, hoch nach Norden hinauf und begrenzt gegen Süden einen nach Westen wie Osten geöffneten ziemlich breiten aber, wegen zahlreicher Korallenbänke gefährlichen und stark gewundenen Kanal. Wir ankerten südlich von Batag, einem kleinen Dorfe auf der Insel gleiches Namens, aber da bis hier herein der Seegang seinen Einfluss geltend machte, und der Kapitän infolge davon nicht bis zu den ziemlich tief liegenden Lecken gelangen konnte, so beschloss er, in den inneren eigentlichen Hafen von Pampan zu gehen, wo günstige Verhältnisse zur Reparatur des Schiffs obzuwalten schienen. Bei einem ersten Versuch am 1. Februar, durch den engen gewundenen Kanal zu gelangen, stieß das Schiff auf einen Korallenblock, kam jedoch bald wieder los; aber erst am 3. Februar gelang es uns, den ganz gegen allen Seegang geschützten Hafen zu erreichen. Hier wurde das Schiff teilweise gelöscht und dann auf die Seite gelegt, sodass bei niedrigem Wasser der Kiel hervortrat; denn die Lecke schienen alle in der Nähe desselben zu sein, sodass eine solche für die Passagiere natürlich sehr unbequeme Prozedur absolut nötig war zur Ausbesserung des Schiffs. Ich packte deshalb mein Handwerkszeug zusammen und bezog ein kleines Häuschen im Dorfe Pampan, das ich mir für die Dauer unseres Aufenthalts gemietet hatte. Mein Diener Alejandro führte hier nach gewohnter Reisesitte unsern Haushalt, während ich selbst mich teils mit Exkursionen, teils mit zoologischen Untersuchungen vergnügte und Gonzalez dazu anhielt, möglichst viel Aquarellskizzen zu machen.
Überall zeigten die nur zu niedrigen Hügeln ansteigenden Inseln die deutlichsten Spuren ganz junger Hebung. Schon am 29. Januar besuchte ich eine im nördlichen Kanal liegende kleine kaum 4 Fuß über Flutlinie hohe Koralleninsel, auf deren Mitte große Korallenblöcke lagen, die nur durch Hebung, sicherlich nicht durch die hier sehr schwache Brandung hingelangt sein konnten. Auch die im Mittel etwa 50 bis 70 Fuß hohen Vorhügel der Insel Batag bestanden gänzlich aus teilweise verändertem Korallenkalk, welcher nur von einer sehr wechselnden Humusschicht oder direkt von Korallendetritus bedeckt war. Dagegen war die Batag gegenüberliegende den Südrand des Kanals bildende Insel Laguan die ich zu verschiedenen malen besuchte, aus einem horizontale Schichten aufweisenden kalkigen feinkörnigen Sandstein gebildet, in welchem Pteropodenschalen fast die einzigen Petrefacten zu sein schienen. Die mikroskopische Untersuchung ließ aber außerdem zahlreiche Foraminiferen erkennen. Von dem ziemlich steil abfallenden Ufer stürzte ein dünner Bach herab, welcher uns das zur Weiterreise benötigte gute Wasser lieferte, und in seiner Nähe hing hart am Meere ein großer abgestorbener Baum über, der mit seinen Wurzeln noch in der Erde befestigt, mit den herabhängenden Zweigen nur eben noch die höchste Flutlinie berührte. Dennoch war der Baum in etwa 2 Fuß Länge ganz von leeren Gängen eines Schiffsbohrers (Teredo) durchlöchert, sodass eine Erhebung von mindestens 4 Fuß stattgefunden haben musste während der Zeit, welche seit seiner Senkung ins Meer verflossen sein mochte. Die kleine, im inneren Hafen liegende Insel Busin, südlich von Laguan, von ihr nur durch einen schmalen Kanal getrennt, war hügelig, und die etwa 150 bis 200 Fuß hohen dicht bewaldeten Hügel bestanden aus stark tonhaltigem, bald gelblichem, bald blaugrauem Sandstein, den ich wegen seines großen Reichtums an Foraminiferen als „Foraminiferensandstein von Pampan“ bezeichnen will. Es war derselbe Ton, der auch Laguan bildete; und ebenso bestanden die niedrigen Hügel der Insel, auf welcher Pampan liegt, aus dem gleichen Tonsandstein. Endlich fand ich dann am nordwestlichen Ufer der Insel Pampan ein weitgehendes abgestorbenes Korallenriff, auf dessen Fläche große Blöcke fast gänzlich metamorphosierten Korallenkalks lagen, die sich bei niedrigster Ebbe etwa 4½ bis 5 Fuß über Wasser erhoben. So fanden sich überall die mannigfaltigsten und sichersten Anzeichen, dass noch in der allerjüngsten Zeit eine Hebung erfolgt sein musste. Sie war vielleicht der Grund eines Unfalls, der uns nachher beim Auslaufen betraf, und ihr dankten wir es auch wohl, dass wir beim Einlaufen am 1. Februar auf einer Stelle einen Korallenblock berührt hatten, der nach den neuesten spanischen Karten 3 bis 4 Faden unter höchster Flutlinie liegen sollte, nach dem Tiefgange unseres Schiffs jetzt aber nur 2 Faden Wasser über sich haben konnte. Bei dem fortgesetzt stürmischen Wetter der letzten Wochen konnten die Arbeiten am Schiff nicht so rasch beendigt werden, als unsere Ungeduld, endlich in den Stillen Ozean zu gelangen, uns alle wünschen ließ. Bei dem Umlegen des Schiffs hatten wir eine hohe Springflut gehabt, sodass nun als die niedrigen Fluten kamen, nie genug Wasser war zum Flottmachen des aufliegenden Schiffs, und erst am 13. Februar kam es mit vieler Mühe und nach mehreren vergeblichen Versuchen wirklich vom Boden ab. Nun waren aber unter der Wasserlinie noch einige Löcher zu stopfen, dann noch die teilweise gelöschte Ladung wieder einzunehmen, sodass abermals drei Tage verflossen, ehe wir versuchen konnten, wieder unter Segel zu gehen. Der stürmische, von häufigen Regenschauern begleitete Nordost- Monsun hatte nun schon mit seiner ganzen Wucht eingesetzt und vereitelte mit den heftigen und sehr unregelmäßigen, gerade in der Richtung des Kanals herein stehenden Winden erst am 21. Februar, dann wieder am nächsten Tage unsern Versuch, bei Eintritt der Ebbe aus dem Hafen herauszukreuzen. Auch am 23. schlug ein Versuch fehl. Endlich am 24 gelangten wir in den äußeren Kanal. Aus Verdruss über die viele verlorene Zeit und im Vertrauen auf die Richtigkeit eines der Karte von Morata Coello beigegebenen Spezialplanes des Hafens von Palapa, versuchte der Kapitän durch die östliche Mündung desselben direkt in den Stillen Ozean zu gelangen, um so den beim Auslaufen aus der westlichen Mündung durch die weit nach Norden hin vorspringende Insel Batag verursachten Umweg abzuschneiden. Dieser Versuch, an und für sich nicht tollkühner als der früher gewagte, überhaupt in den Hafen einzulaufen, sollte uns teuer zu stehen kommen. Der Wind war günstig zum Auslaufen, der Weg den wir beständig sondierend verfolgten, schien klar, aber plötzlich schrabten wir an einem Korallenfelsen, den wir des trüben Wassers wegen nicht hatten sehen können, an, und im Moment nachher saßen wir auf einem andern fest. Der arme Woodin tat mir in der Seele leid, wie er nun, um seine letzte aufs Spiel gesetzte Karte, die „LADY LEIGH“ zu retten, die Befehle zum Backen der Segel und zu andern Manövern gab, die geeignet waren, das Schiff flott zu machen. In seine den Matrosen zugerufenen Befehle mischten sich Wehklagen um sein Weib und seine Kinder, die er in Hobarttown in Armut zurückgelassen und die aus solcher zu erretten ihm die früher so gewogene Glücksgöttin versagen zu wollen schien. Aber keins half.
Das Wasser war noch im Fallen, und das Schiff bewegte sich nicht von der Stelle. Zum Glück war es nahe an tiefster Ebbe gewesen, als wir auf den Felsen aufliefen, sodass keine Gefahr des Umschlagens zu besorgen war. Nach einigen ängstlichen Stunden endlich hob uns die rückkehrende Flut wieder von unserm Ankergrunde ab.
Inzwischen war die Nacht hereingebrochen, sodass wir in der Nähe dieses unglückseligen Korallenblocks ankern mussten. Nun hatte Woodin alle Lust verloren, nochmals eine Ausfahrt zum östlichen Kanal zu versuchen, und da auch am 25. morgens ein schöner Ostwind wehte, so fuhren wir diesmal ohne weiteren Unfall zum westlichen Kanal hinaus. Freilich brauchten wir jetzt drei volle Tage, um die Nordspitze der Insel Batag, ankämpfend gegen Wind und Wogen, zu gewinnen, und auch am 1. März verloren wir gegen östliche und südöstliche Winde kreuzend, nur sehr langsam die Ostküste Samars aus dem Auge. Eine heftige etwa 1½ bis 2 Knoten stündlich laufende südöstliche Strömung setzte uns immer wieder zurück, sodass der Kapitän, um recht rasch aus dieser widrigen Gegend herauszukommen, möglichst nach Süden zu gelangen trachtete.
Mochte nun der Landaufenthalt und die schon so lange anhaltende kärgliche Nahrung, verbunden mit dem ewigen schlechten Wetter und dem heftigen Schreck am 25. Februar, mir geschadet haben; genug, bis zum 1. März fühlte ich mich so elend, dass ich selbst die wenigen günstigen Stunden, die mir hin und wieder der etwas leichtere Wind gönnte, nicht zum Fischen mit dem feinen Netz zu benutzen vermochte. Als wir aber am 1. und 2. März in jenen südöstlichen Strom hinein gerieten und einige Thermometermessungen mir die hohe Meereswärme von 22° R. am ersten Tage, später sogar von 23° R. ergaben, nahm ich voller Erwartung mein Netz zur Hand. Denn ich dachte mich wieder in eine ähnliche warme Strömung versetzt, wie sie am Kap der guten Hoffnung als letztes Ende des Mozambiquestromes bis auf 42° und 44° südlicher Breite heruntergeht, und welche mir auf meiner Reise nach Singapore eine Überfülle der schönsten pelagischen Seetiere ins Netz lieferte. Drei Tage lang fuhren wir damals in einem so dichten Schwarme der kolossalen Feuerzapfen (Pyrosoma giganteum) dass selbst beim Wasserschöpfen mit Eimern häufig die fast einen Fuß langen Tiere gefangen wurden, und des Nachts leuchteten alle diese Myriaden von Wesen die den Ozean bis zum Horizont zu bedecken schienen, in so zauberhaftem Lichte, dass ich mit einziger Ausnahme einer wunderbaren Oktobersturmnacht nördlich von Helgoland nie etwas Ähnliches gesehen zu haben glaubte. Leider wurde meine Erwartung gänzlich getäuscht. Trotz der tiefblauen reinen Farbe des Meeres fing ich auf der Oberfläche nichts als eine geringe Zahl gallertiger Haufen von einzelligen Algen, wie sie mir so oft schon in den Tropen das Fischen mit dem feinen Netz verleidet hatten; und auch das bei Windstillen bis zu 60 bis 80 Fuß Tiefe niedergelassene und durch die starken, auch hier wirkenden Strömungen in senkrechter Stellung erhaltene Netz brachte mir keine Ausbeute. Allmählich waren wir aus den südöstlichen Strömen in nordöstliche geraten, die uns nun rasch weiter nach Süden brachten, bis wir endlich am 9. März in 7° 39’ nördlicher Breite und 129° östlicher Länge auf starke und sehr warme westliche Strömungen trafen, die uns nach den Berechnungen des Schiffsjournals um durchschnittlich 50 bis 55 Seemeilen per Tag weiter nach Osten brachten. So waren wir allmählich aus dem nach Norden an der Ostküste Luzons umbiegenden oberen Arme des nordpazifischen Äquatorialstromes in die gerade Fortsetzung desselben, dann in den südlichen nach Süden zu an Samar und Mindanao hinstreichenden Arm desselben Stromes geraten, der sich zwischen 6° und 7° nördlicher Breite mit jenem von Westen her aus der heißen Celebes-See entspringenden äquatorialen Gegenstrom verbindet, welcher, wenn anders die von Quatrefages aufgestellten Theorien über die verschiedenen Wanderungen der polynesischen Völker richtig sind, in der östlichen Hemisphäre eine ebenso bedeutungsvolle Rolle gespielt hat wie der Golfstrom, freilich in anderer Beziehung, auf der westlichen Erdhälfte. Es ist bekannt, dass die Bewohner der Carolinen nicht selten nach den Philippinen verschlagen werden; sie erreichen dann jedes Mal die Insel Samar oder den südlichsten Teil von Luzon, zum Beweise, dass gerade hier sich der nordäquatoriale Strom an der philippinischen Inselmauer bricht. Dagegen scheinen niemals Bewohner der Philippinen nach den Palau Inseln gekommen zu sein, wohl aber solche von Celebes und den in der Celebesstraße liegenden Inseln. So war nach Johnson's Aussage im Jahre 1859 oder 1860 ein Boot ohne Segel an der Nordwestseite der Inselgruppe bei dem Dorfe Aibukit angetrieben, dessen Passagiere sechs an der Zahl in drei Tagen von der Insel Salibago dahin gelangt zu sein behaupteten. Den einen überlebenden Mann sah ich später noch, sodass ich mich von der Wahrscheinlichkeit seiner Behauptung von der genannten Insel gekommen zu sein, überzeugen konnte. Auch als der bekannte Kapitän Wilson – dessen Erzählung vom Schiffbruch der „ANTILOPE“ und dem liebenswürdigen Völkchen der Palau-Inseln überall sympathisches Interesse erweckte – mit den Bewohnern dieser Inseln in Verkehr trat, fand er einen ebenfalls von einer Celebes benachbarten Insel stammenden Malaien, der wie jene Leute aus Salibago durch die westliche Strömung dorthin getrieben worden war.
Unsere Freude, endlich in einem gut ausgebesserten, wasserdichten Schiffe zu fahren, sollte leider nur die beiden ersten Tage anhalten. Solange wir nur leichtere Winde hatten und der Meergang nicht stark war, musste die Pumpe nicht öfter in Bewegung gesetzt werden, als es überhaupt an Bord eines Schiffs geschieht. Aber als nun im Streit der starken Meeresströmungen und der häufig diesen entgegenwehenden, bis zum Sturm sich steigernden Winde die See sich in hohen und unregelmäßigen Wellen erhob, da fing unser in allen Fugen ächzendes und grausam herumgeworfenes Schiffchen wieder an, sehr viel Wasser zu machen, und da, je tiefer wir nach Süden kamen, der Sturm wuchs und das Meer aufgeregter wurde, so nahm das Pumpen in ganz unliebsamer Weise zu.