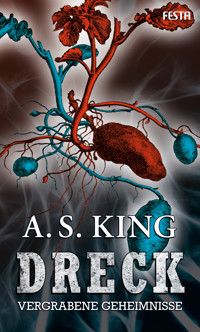
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Festa Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dreck verbirgt alles – vor allem die verdorbene Wahrheit, die droht, ausgegraben zu werden … An der Spitze der Familie Hemmings steht ein reiches Ehepaar – alte knauserige Bauern aus einer amerikanischen, weißen Vorstadt. Sie verwehren ihren eigenen Nachkommen das Vermögen, das sie zu Lebzeiten anhäuften. Aber nicht nur Kartoffeln schlugen auf ihrer Farm Wurzeln, sondern auch Hass, Neid und Rassismus. Amy Sarig King gehört laut der New York Times im Bereich der Jugendliteratur zu den besten zeitgenössischen Autoren. Dreck wurde ausgezeichnet mit dem Michael L. Printz Award. Der Roman ist ein Leseerlebnis, nicht einfach, aber herausfordernd. A. S. King: »Das Buch soll unangenehm sein. Ich würde mich ja dafür entschuldigen, aber es tut mir nicht leid.« Kirkus: »Ungewöhnliche, herzzerreißende Geschichte, meditativ und unglaublich originell.« Los Angeles Times: »King zwingt die Leser effektiv dazu, sich mit der unbequemen Realität der amerikanischen Gesellschaft auseinanderzusetzen.« Bookandfilmglobe.com: »Auch wenn in diesem Buch schreckliche Dinge passieren, erzählt King dennoch eine Geschichte der Hoffnung.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 464
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Aus dem Amerikanischen von Petra Huber und Karin Will
Impressum
Die amerikanische Originalausgabe Dig
erschien 2019 im Verlag Dutton Books For Young Readers.
Copyright © 2019 by A. S. King
Copyright © dieser Ausgabe 2021 by Festa Verlag, Leipzig
Lektorat: Joern Rauser
Bildmotive unter Verwendung von
Adobe Stock/Frank und Adobe Stock/Hein Nouwens
Alle Rechte vorbehalten
eISBN 978-3-86552-962-6
www.Festa-Verlag.de
Für Pam, die sagte: »Das sind deine Leute.«
Ein Mann, der sich mit seiner Herkunft brüstet, ist wie die Kartoffelpflanze, deren bester Teil sich unter der Erde befindet.
Spanisches Sprichwort
Ohne die Kartoffel hätte sich der Machtschwerpunkt in Europa womöglich nicht nach Norden verschoben.
Michael Pollan
Ich flehe meine Lieben an,
TEIL EINS: EINFÜHRUNGEN
HANDELNDE PERSONEN IN DER REIHENFOLGE IHRES AUFTRETENS:
Marla & Gottfried
Zwei tote Rotkehlchen
Jake & Bill: die Marks-Brüder
Die Schlange
Marlas & Gottfrieds Osteressen
1. April 2018
Marla Hemmings versteckt neonfarbene Plastikostereier im Blumenbeet vor dem Haus. Ein paar Schritte hinter ihr hackt Gottfried auf ein Büschel Perlgras ein. Dann hält er inne, um zwei Frühlingsrotkehlchen zu beobachten, die auf einem Ast zwitschern.
»Meinst du, dass ich die Eier zu gut verstecke?«, fragt Marla.
Gottfried widmet sich wieder seinem Perlgras. »Sie werden sie schon finden.«
»Das habe ich nicht gefragt.«
»Sie finden sie doch immer.«
Gottfried schaut wieder zu den Rotkehlchen hinüber. Er denkt an einen Tag zurück, an dem er den Führerschein gerade frisch in der Tasche hatte. Höchstens 17 Jahre alt. Hat er das jetzt laut gesagt? Marla beäugt ihn, als hätte er es getan. Er kehrt zu seinem Gedanken zurück. 17 Jahre alt. Am Steuer des 1960er Dodge Matador mit den Heckflossen, in den sich damals seine ganze Familie gequetscht hatte, um zum Strand oder zu seinen Leichtathletikwettkämpfen zu fahren. Ein warmer Tag, genau wie heute. Kurz vor Ostern. Zwei Rotkehlchen tanzten mitten auf der Straße. Zumindest dachte er, sie tanzten. Dann dachte er, sie stritten sich. Schließlich begriff er, was sie wirklich taten. 17 ist alt genug, um zu verstehen, was Rotkehlchen im Frühling tun.
»Ich gehe jetzt nach drüben«, sagt Marla. Sie streicht ihre Gartenschürze glatt, greift nach dem Korb mit den glänzenden Plastikeiern und mustert Gottfried, der die Rotkehlchen beobachtet. »Du musst den Schinken bald in den Ofen schieben.«
»Schinken«, sagt Gottfried. »Alles klar …«
Marla schüttelt den Kopf. Manchmal fragt sie sich, ob bei ihrem Mann noch alles ganz richtig im Kopf ist. Dabei hat er doch nie mehr tun müssen als zur Arbeit zu gehen und den Rasen zu mähen. Sie selbst hat fünf Kinder großgezogen und die ganze Arbeit geschultert, die das mit sich brachte, und sie hat geistig noch nicht nachgelassen.
Der Wagen fuhr zu schnell, um stehen bleiben zu können. Die Rotkehlchen stoben hoch, landeten dann noch einmal, danach flatterten sie wieder auf. Als Gottfried nahe genug bei ihnen war, um zu wissen, dass er sie erwischen würde, konnte er nicht noch weiter abbremsen. 50 Stundenkilometer ist zu schnell für ein Rotkehlchen. Bevor er das Auto nach Hause zurückbrachte, fuhr er quer durch die ganze Stadt zu einer Autowaschanlage. Während der Vorwäsche weinte er.
Gottfried hatte nie an die Wiederauferstehung geglaubt. Marlas Beharren auf der perfekten Ostereiersuche – damals, als ihre Kinder klein waren – war ihm auf die Nerven gegangen. Dass sie davon jetzt, da sie Enkel hatten, geradezu besessen war, brachte ihn zur Weißglut, insbesondere weil die meisten ihrer Enkel schon Teenager waren, also bereits zu alt dafür. Und wenn Marla solche Fragen stellt – ob er finde, dass sie die Eier zu gut verstecke –, überlegt er tatsächlich, ob Marla noch ganz richtig im Kopf ist.
Sie sagt: »Und vergiss nicht, die Kartoffeln zu schälen!«
Er wirft die Perlgrasbüschel in den Wald, der das Haus umgibt.
Er geht hinein und wäscht sich die Hände.
Er schiebt den Schinken in den Backofen.
Er schüttet einen Zweikilosack Kartoffeln in das Spülbecken und kramt den Schäler aus der Schublade. Während er die Schale Zentimeter für Zentimeter abzieht, denkt er wieder an die Rotkehlchen und weint.
Jake & Bill können die Schlange jetzt rausbringen
1. April 2018
Jake Marks und sein älterer Bruder Bill gehen über den High-School-Parkplatz. Bill hat seine Schlange dabei – um den Hals gewickelt und unter dem Mantel versteckt. Jake macht ein Gesicht wie ein Schulschwänzer, obwohl es Sonntag und ein Feiertag ist. Seinetwegen könnte es genauso gut ein Schultag sein. Jake scheißt darauf. Jake scheißt auf alles. Jemand hat mal vorgeschlagen, den Schularrestraum in Jake-Marks-scheißt-auf-alles-Zimmer umzubenennen.
Jake folgt Bill auf Schritt und Tritt. Sechs Jahre Altersunterschied, und die beiden benehmen sich wie Zwillinge, was, genauer betrachtet, traurig ist. Entweder ist Bill extrem unreif oder Jake wird zu schnell erwachsen. Mit zehn die erste Zigarette geraucht. Mit zwölf das erste Auto geschrottet.
TEIL 1.1: EINFÜHRUNG DES SCHAUFLERS UND VON FREAK
HANDELNDE PERSONEN IN DER REIHENFOLGE IHRES AUFTRETENS:
Der Schaufler
Mr. –son
Die Mutter des Schauflers
Mike von nebenan
Mrs. Zweitklässlerlehrerin
Penny und Doug oder Dirk oder Don
Freak, flimmernd
Die bescheuerten High-School-Bitches Kelly und Mika
Freaks Mom und Dad
Die Schaufel des Schauflers
Bill mit dem Halstattoo
Der sprechende Dreck
Der Schaufler: der Schneesturm und Mr. –son
84 Tage vor Marlas & Gottfrieds Osteressen
5:33 Uhr
Mein Handy klingelt, doch es ergibt keinen Sinn, dass mein Handy klingelt, weil ich im Meer bin. Es ist dunkel – ein Sturm zieht auf, der Himmel wirkt bedrohlich, und ich versuche das Ufer zu erreichen, bevor der Sturm da ist. Ich habe keine Angst, obwohl die Wellen gut fünf Meter hoch sind und immer noch höher werden. Aber ich bin eins mit dem Meer. Jedes Mal wenn hinter mir eine Welle heranrollt, drehe ich den Kopf nach ihr, dann tauche ich gelassen unter, bis sie vorüber ist. Dann gehe ich auf das Ufer zu, bis die nächste Welle kommt, und tauche wieder unter.
Da sind Menschen am Ufer, aber ich weiß nicht, wer sie sein mögen. Sie scheinen sich Sorgen um mich zu machen, aber mir geht’s gut.
Ich ging ans Handy. Ein Mann war dran, und es war nicht mein Vater.
Es ist nie mein Vater.
»Hallo?«, fragte er.
»Mjaaa.«
»Ist … da?« Ich erinnere mich nicht, welchen Namen er nannte – selbst als der Mann ihn aussprach, hatte ich ihn nicht gehört. Es war Sonntagmorgen, 5:33 Uhr – ich war noch unterwegs zum Ufer, bis zur Brust im Wasser. Er hatte meine Antwort gehört, heiser, verschlafen und noch im Traum gefangen. Er wusste, dass er sich verwählt hatte.
»Sie müssen sich verwählt haben.«
»Das ist Mr. –son.«
»Sie müssen sich verwählt haben«, wiederholte ich.
»Entschuldigen Sie die Störung«, sagte er. Es klang, als wäre er auf dem Weg zur Kirche. Seine Stimme klang wie der Chor. Sanft, verständnisvoll, entschuldigend. Er legte auf.
Bevor ich wieder einschlief, wusste ich noch, wie er hieß. Ich wiederholte den Namen hundertmal, um ihn mir einzuprägen. Aber als ich aufwachte, hatte ich ihn vergessen. Ich ging alle Namen durch. Stephenson, Richardson, Davidson, Hutchinson, Robinson, Johnson, Morrison, Nicholson, Jefferson. Keiner davon war seiner.
Aber es war irgendjemandes Sohn.
Ich überprüfe, ob ich mir den Anruf nur eingebildet habe. Aber er steht auf der Liste eingegangener Anrufe. 5:33 Uhr. Ein Anruf von 407-555-1790. Vielleicht war es die Küstenwache, die sichergehen wollte, dass ich es ans Ufer geschafft habe. Vielleicht ist es auch nur irgendein Typ gewesen, der seinen Kumpel, mit dem er immer in die Kirche geht, aufwecken wollte. Vielleicht wollten sie ja nach der Predigt fischen gehen. Vielleicht einen Lebensmittelladen ausrauben. Vielleicht einen Freund im Krankenhaus besuchen. Vielleicht nach New York fahren und sich dort eine Show ansehen.
Ich weiß nicht, wie ich die Variablen eingrenzen soll.
Ich weiß, dass Mr. –son nicht mit meiner Mutter sprechen wollte. Niemand ruft an, um mit meiner Mutter zu sprechen. Nicht weil sie so unsympathisch ist; sie ist einfach nur schwer ausfindig zu machen. Heute, am Sonntag, versucht sie gerade, Ordnung in die Küche zu bringen. Wir sind erst vor drei Tagen eingezogen, und sie kann ihren großen Topf für die Kartoffeln nicht finden. Was ein Problem ist.
»Bist du wirklich sicher, dass du ihn nicht für irgendwas genommen hast?«, fragt sie mich.
»Ganz sicher.«
»Ich versteh nicht, wo er hingekommen ist«, sagt sie.
»Draußen im Schuppen liegen drei Kartons, die wir noch nicht ausgepackt haben.«
Sie seufzt und runzelt die Stirn. »Da ist nur Kleidung drin. Keine Töpfe. Das ganze Küchenzeug habe ich in Küchenkartons getan. Ich weiß, wie man packt.«
Meiner Erinnerung nach sind wir 17-mal umgezogen, und ich bin 16 Jahre alt. Sie weiß, wie man packt.
»Schließlich hab ich nicht viele Sachen«, sagt sie.
»Ich sehe trotzdem mal in den Kartons nach. Vielleicht ist ja was durcheinandergeraten. Kann nicht schaden.«
Sie lächelt, und der Teekessel auf dem Herd pfeift, also dreht sie die blaue Gasflamme ab und gießt das dampfende Wasser in eine Schüssel mit Instanthaferflocken. Die Art, wie sie den Haferbrei umrührt. Die Art, wie sie den Teebeutel mit dem Faden ausdrückt, wirkt selbstbewusst. Meine Mutter ist selbstbewusst, was Haferbrei und Tee angeht, und sie weiß, wie man packt.
Doch es fällt ihr schwer, die Miete zu bezahlen. Und erfolgreich mit Vorgesetzten, Vermietern und dem Stromversorger zu kommunizieren. Es fällt ihr schwer, die Wahrheit zu sagen.
Sie will mir nicht verraten, wer mein Vater ist, aber ich weiß, dass sie es weiß.
Ich gehe nach draußen zum Schuppen – es schneit leicht – und stelle fest, dass jemand die Kartons geöffnet hat. Der Schuppen wird von allen Mietern des Hauses genutzt. Ich weiß nicht, ob Mom selbst die Kartons geöffnet hat oder irgendjemand anders. Gestern, als ich hier draußen heimlich eine Zigarette geraucht habe, waren sie noch zu.
Jetzt sind die Kartons geöffnet, und die Dinge darin wirken verletzlich und verängstigt. Meine Sommerkleidung, die mir im Sommer vermutlich nicht mehr passen wird. Meine Badehose. Meine Flipflops. Alles zittert.
Ich schiebe die Hand an den Seiten in die Kartons hinein und betaste alle Schichten. Im zweiten Karton finde ich den Kartoffelkochtopf, ziehe ihn heraus und stelle ihn auf den Boden des Schuppens. Dann finde ich eine Einkaufstasche voller Küchenutensilien. Ich stelle sie in den Topf. Dann verschließe ich die Kartons ordentlich – eine Klappe oben, die andere darunter – und staple sie hinten in der Ecke, so weit wie möglich vom Rasenmäher entfernt, damit unsere Sachen nicht den Geruch von gemähtem Gras und Benzin annehmen.
Ich zünde mir eine Zigarette an. Ich denke an meine Sommerkleidung. Ich denke an Texas und Arizona und Nebraska, meine letzten drei Sommer. Manchmal versuche ich, mich an die Namen meiner Freunde an den Orten zu erinnern, an denen ich, soweit ich mich erinnern kann, gelebt habe, aber ihre Namen sind mir genauso unzugänglich wie der von Mr. –son. Dafür erinnere ich mich an Kleinigkeiten. Wie den Namen einer Eidechse in einem Schulzimmer in der dritten Klasse. Pollo – ausgesprochen wie im Spanischen mit den beiden »l« als »j«. Dämlicher Name für eine Eidechse. »Pollo« ist Spanisch für »Huhn« – für das Gericht, nicht für das lebendige Tier. Vielleicht war das witzig gemeint. Vielleicht schmeckt Eidechse ja wie Hühnchen. Den Namen des Lehrers habe ich vergessen, sonst würde ich ihm schreiben und ihn fragen, warum er seine Eidechse »Huhn« getauft hat. Er besaß für jeden Wochentag eine Reptilienkrawatte.
Bei jedem Wohnort erinnere ich mich an meinen besten Freund, wenn ich denn einen hatte. Meine anderen Freunde verschwimmen alle miteinander. JoshSethJaiquanRayRayBillSumo. Vor der jetzigen Wohnung lebten wir in einer kleineren mit Ziegelwänden; und nebenan wohnte Barry, der texanische Junge, der mir das Rauchen beibrachte. Barry werde ich nie vergessen. Niemand vergisst, wer einem das Rauchen beigebracht hat.
Barry fand es merkwürdig, dass Mom und ich uns ein Bett teilen, aber wir hatten nur ein Bett und ein Zimmer, und ich hatte es irgendwann satt, auf dem Boden zu schlafen, und sie hatte nichts dagegen, und schließlich haben wir nichts Unanständiges getan, denn so etwas tun wir nicht. Wir versuchen nur zu überleben. Kartoffeln und Maisbrot. Kartoffeln und Schweinekoteletts. Kartoffeln und Süßmais. Kartoffeln und Brathühnchen. Wen kümmert es, wo wir träumen?
Der Wetterbericht sagt einen richtigen Blizzard voraus – bis zu einen Meter Schnee. Ich steige die Treppe zu unserer Wohnung wieder hinauf – zwei Zimmer mit zugigen Fenstern auf zwei Stockwerken – und gebe Mom den Kartoffelkochtopf. Sie strahlt, als hätte ich ihr gerade einen Cadillac mit einer Million Dollar drin geschenkt. Dann verzieht sie das Gesicht.
»Du glaubst wohl, ich rieche das nicht«, sagt sie. »Wie kannst du dir das Zeug überhaupt leisten?«
»Ich hatte noch eine Packung ›von vor dem Umzug‹«, antworte ich.
Sie dreht das heiße Wasser auf, um den Kartoffelkochtopf zu waschen. »Wir brauchen beide einen Job«, sagt sie und deutet auf die Zeitung, die auf der Frühstückstheke ausgebreitet liegt.
»Stimmt.«
»Morgen früh fahr ich zur Zeitarbeitsvermittlung, vielleicht haben sie ja was für mich.«
»Vor Dienstag oder vielleicht sogar Mittwoch kommst du da nicht hin. Schneesturm.«
Sie schweigt, denn wir wissen beide, dass ein Job das Letzte ist, was sie will.
In der Zeitung blättere ich die Rubrik »Hilfe gesucht« auf. Lastwagenfahrer, ein Batteriewerk und Nachtschicht in der Fabrik eine Straße weiter. Der Typ von nebenan, Mike, hat mir gestern seine Schneeschaufel geliehen und mir erzählt, dass dort Mausefallen hergestellt werden. Daraufhin habe ich gewitzelt, dass es in der 3rd Street dann ja wohl keine Mäuse geben könne – was ein Glück sei, denn in unseren letzten beiden Wohnungen hätten Mäuse meine geheimen Junkfood-Vorräte aufgefressen. Als Mike dann gelacht hat, bekam ich das Gefühl, das Leben hier könnte okay sein.
In meinem Alter sollte man eigentlich hinter den Mädchen her sein, die Hausaufgaben machen, sich an den Freitag- und Samstagabenden bei McDonald’s herumtreiben und mit anderen Zehntklässlern Blödsinn anstellen. Aber Mike ist mir lieber, obwohl er schon über 30 ist. Er hat einen guten Job und eine Harley, und im Winter fährt er mit einem kleinen Pick-up herum. Ich glaube, er ist glücklich, obwohl er mit seiner Mutter zusammenlebt. Ich bin glücklich, und ich lebe auch mit meiner Mutter zusammen.
»Wenn dir irgendein Teilzeitjob unterkommt, gib Bescheid«, sage ich. »Hier sind nur Vollzeitstellen drin.«
»Mach ich«, sagt Mom. Sie ist mit dem Kartoffelschälen fertig. »Ich muss gleich rüber in den Lebensmittelladen. Hast du da ein Auge drauf? Sie dürfen nicht überkochen.«
»Alles klar.«
Sie glaubt, ich wüsste nicht, dass sie über eine Stunde weg sein wird. Sie glaubt, ich wüsste nicht, dass sie absichtlich kurz vor einem Schneesturm in den Laden geht, weil dann jede Menge Leute Milch und Klopapier kaufen und ihre vollgestopften Taschen keinem auffallen werden. Sie glaubt, ich wüsste nicht, dass sie mit Mike von nebenan flirtet, obwohl wir erst vor drei Tagen hierhergezogen sind. Sie glaubt, ich wüsste nichts von den Anrufen unseres letzten Vermieters, der sie verklagt hat. Sie glaubt, ich wüsste nicht, dass ihr niemand einen Kredit geben will. Sie glaubt, ich wüsste nicht, dass sie die Daten fremder Leute benutzt, damit wir einen Stromanschluss bekommen – dass sie deren Müllsäcke stiehlt und durchwühlt, auf der Suche nach irgendetwas Nützlichem. Sie glaubt, ich wüsste nicht, dass sie mir jeden Samstagabend eine Zigarette klaut und auf der Veranda raucht.
Ich kann die Variablen nicht eingrenzen.
Sie kann die Variablen nicht eingrenzen.
Jeden Abend essen wir Kartoffeln.
Der Schaufler: Eine alte Sache
Wenn es schneit, schneit es schnell. Unter der Straßenlaterne bewegt sich der Schnee seitwärts, und manchmal trotzt er der Schwerkraft und bewegt sich nach oben. Ich schaue vom Wohnzimmerfenster aus zu. So viel Platz hatten wir seit Arizona nicht mehr. Mom meinte, das liegt daran, dass sie mehr Geld für die Kaution hatte, aber Mike von nebenan nahm an, dass es an dem undichten Dach liegt.
Mom sieht auf ihr Smartphone. »Du musst morgen nicht in die Schule.«
Ich nicke. »Wie viel Schnee sollen wir kriegen?«
»Einen halben Meter oder so.«
»Vielleicht hätten wir nach Kalifornien ziehen sollen.«
»Ich hab hier etwas Geschäftliches zu erledigen«, sagt Mom. Sie sieht aus dem Fenster und macht nicht ihre übliche geschäftliche Miene.
»Was genau?«
»Nur eine alte Sache.«
Variable, wie immer. Und wie immer ist mein Vater die erste Variable. Wie immer kann ich nichts dazu sagen.
Wie immer zieht Mom keine Schlussfolgerung. Also sitze ich einfach da und schau dem Schnee zu. Nach einer Stunde ist mir langweilig.
»Ich geh nach draußen und fang mit dem Auto an«, sage ich. »Dann hab ich morgen weniger zu tun.«
»Bleib hier«, meint Mom. »Mike hilft dir morgen früh.«
Mike. Okay. Klar.
Ich gehe trotzdem raus. Auf der Veranda bleibe ich stehen, um mich herum ist kein einziger Fußabdruck zu sehen. Als wäre ich auf dem Mond gelandet. Still. Gedämpft. Kalt. Mit Mikes Schaufel fange ich an dem logischsten Ort an – da, wo ich stehe. Ich bahne einen Durchgang unseren Eingangsweg hinunter bis zum Gehsteig. Es schneit so heftig, dass ich mir alle fünf Minuten die Schultern abwischen muss.
Sobald ich mit dem Fußweg angefangen habe, kann ich nicht mehr aufhören. Ich mache das Stück vor unserem Haus sauber, und dann das vor dem von Mike, und dann das vor dem Haus der alten Frau neben dem von Mike. Er hat mir erzählt, dass er ihr das Schaufeln normalerweise abnimmt, also habe ich das Gefühl, etwas Gutes zu tun.
Ein Schneepflug biegt in die Straße ein. Er schiebt den Schnee aus der Straßenmitte zu den am Rand geparkten Autos. Die Schneewehen sind bereits so hoch, dass die Autos wie Raumkapseln auf dem Mond aussehen. Ich blicke zu den Straßenlaternen hinauf, und der Schnee wirbelt immer noch schnell herunter.
»He!«
Es ist Mike. Ich winke ihm zu. Als er mich erreicht hat, ist sein Kinnbart schon schneeverklebt.
»Deine Mom hat mir gesagt, dass du hier draußen bist. Mann, du hättest auf mich warten sollen. Wir können das morgen früh erledigen. In meiner Garage steht die Schneefräse von meinem Bruder.«
»Du hast doch gesagt, das Ding ist schrottreif.«
»Stimmt. Aber immer noch besser als mit Muskelkraft«, gibt er zurück. »Komm doch rein auf ein Bier oder so.«
»Ich bin 16.«
»Dann komm einfach so rein. Ich hab den Ofen angeheizt.«
Mike hat einen Holzpelletofen. Und die alte Schneefräse seines Bruders sowie eine beeindruckende Sammlung von Schneeschaufeln und außerdem den größten Flachbildschirmfernseher, den ich jemals gesehen habe. Mike nimmt sämtliche Baseballspiele der Saison auf und sieht sie sich dann im Winter an. Er sagt, davon wird ihm wärmer.
Ich glaube, deshalb mag ich Mike.
Er scheint nicht der Typ Mensch zu sein, der in Läden klaut oder den Müll anderer Leute nach ihren Sozialversicherungsnummern durchwühlt. Nur Baseball und Bier. Und im oberen Stockwerk seine Mutter, die ich noch nie gesehen habe.
Vor seiner Hintertür bleibe ich stehen – wo ein paar schneebedeckte Stufen nach oben führen – und ziehe meine Schachtel Camel Lights heraus. Ich biete ihm eine an, und er nimmt sie.
»Komm mit hier rüber«, sagt er. »Hier kann uns deine Mom nicht sehen.«
Wir rauchen und stoßen riesige Wolken aus. In einem Schneesturm zu rauchen ist etwas Besonderes. Ganz anders als in Texas zu rauchen. Schwer zu erklären.
»Hast du dich schon eingewöhnt?«, fragt er.
»Ja.« Ich zucke mit den Achseln. Ich frage mich, ob ich mich überhaupt schon mal an irgendetwas, an irgendeinen Ort gewöhnt habe.
»Deine Mom sagt, dass du ein guter Junge bist.«
»Klar«, sage ich.
»Entschuldige. Du bist doch kein Junge mehr.«
»Keine Ahnung. Schwer zu sagen.« Ich denke kurz nach und füge hinzu: »Ist wohl eine Grauzone, glaub ich.«
»Stimmt«, antwortet Mike.
Nachdem wir reingegangen sind, drückt er auf einen Knopf seiner Fernbedienung, und der erstarrte Schlagmann beginnt sich wieder zu bewegen. Mike sagt: »Schau dir das mal an!«, und der Spieler erzielt einen Homerun. Eigentlich sehe ich kein Baseball, aber der Schlag zum Homerun ist beeindruckend. Über das Spielfeld hinweg. Aus dem Stadion hinaus.
Ich setze mich an den Holzofen und wärme mir die Hände.
Mike geht zum Kühlschrank und holt eine Dose Bier für jeden von uns. Aber ich sage: »Nein danke, Mann.«
Er nickt und setzt sich, und ich stehe auf und stelle das Bier in den Kühlschrank zurück. In der Küche mache ich eine Bestandsaufnahme der Küchengeräte. Mike besitzt einen Mixer, einen Toaster, eine Kaffeemaschine, ein Brotbackgerät, einen Dörrautomaten, eine Küchenmaschine, einen Entsafter und etwas, das sich Anzuchtschale nennt und wie der Käfig von Pollo der Eidechse aussieht.
Für einen Typen, der mit seiner Mutter zusammenlebt, die nie nach unten kommt, besitzt Mike eine Menge Küchengeräte.
Und trotzdem hat er nur Bier und Senf und anderes Soßenzeug im Kühlschrank.
Am liebsten würde ich ihn fragen, wovon er sich ernährt, aber das kommt mir dumm vor. Ich gehe wieder rein und setze mich auf sein Sofa und schaue am Holzofen Baseball. Ich sage: »Du hast recht. Vom Baseball wird mir wärmer.«
Mit dem Zeigefinger deutet er sich auf die Stirn. »Mann, das spielt sich alles im Kopf ab. Kontrolliere dein Gehirn, und der Rest ist einfach.«
Der Schaufler: Tunnel auf der Mondoberfläche
Kontrolliere dein Gehirn, und der Rest ist einfach. Ich denke darüber nach, während ich nach Hause gehe.
Wahrscheinlich hat Mike nicht mich gemeint. Wahrscheinlich weiß er nichts von meinem Gehirn. Selbst Mom weiß nichts über mein Gehirn. Wie könnte ich ihr davon erzählen? Wann könnte ich ihr davon erzählen? Gibt es irgendeine Tageszeit, zu der sie aufhört, an sich zu denken?
Mein Gehirn geht sie nichts an.
Auch wenn es mich in den Wahnsinn treibt.
Seit dem Anruf um 5:33 Uhr jagt mein Gehirn jede Stunde etwas anderem hinterher. Stephenson, Richardson, Davidson, Hutchinson, Robinson, Johnson, Jefferson. Seit ich mir Fragen stellen kann, fragt es sich tagtäglich, wo meine andere Hälfte ist. Seit ich mir ein Bild von mir machen kann, bin ich nur halb vorhanden.
Aufgabe, einen Stammbaum zu erstellen. Zweite Klasse. Lieber hätte ich mir den eigenen Fuß seziert. Während er noch am Knöchel dran war. Florida. Die Lehrerin malte einen Baum an das Whiteboard. Zeichnete Linien daneben. Schrieb etwas auf die Linien. Ihre Mutter. Ihr Vater. Ihre Schwester. Ihre zwei Brüder. Ihr Mann. Ihre Kinder. Ihre Nichten und Neffen. Ihre Haustiere. Nur so zum Spaß, sagte sie. Ich zeichnete meinen Baum. Ich zeichnete meinen großen Baum auf das Papier, und dann sagte sie: Mein Lieber, du hast keinen Platz für deine Familie gelassen! Ich hatte eine dieser dicken Wachsmalkreiden in der Hand. Ich schrieb MOM über den Baum. Ich schrieb ICH mitten auf den Baumstamm. Mrs. Zweitklässlerlehrerin stand eine Minute lang still da, und ich konnte es hören. Konnte hören, wie es bei ihr klick machte und wie ihr das Herz wegen mir Ärmstem brach. Nie eine Chance gehabt. Keine Äste. Keine Blätter. Keine Zweige. Keine Haustiere nur so zum Spaß.
Sie gab mir eine Eins. Ein Junge in meiner Klasse hatte seinen Stammbaum auf ein Blatt Papier gezeichnet, das so groß war, dass er es ausrollen musste. Der Stammbaum reichte vier Generationen zurück. Vier Generationen. Es war nicht einmal seine Handschrift. Er beschwerte sich, dass ich eine Eins bekommen hatte. Er sagte, er habe als Einziger eine Eins verdient. Mrs. Zweitklässlerlehrerin antwortete: Die Noten hängen nicht von der Größe deiner Familie ab.
Große Pause. Selber Tag. Der Junge nennt mich einen Bastard und meine Mom eine Schlampe. Ich sage zu ihm, dass er mich am Arsch lecken kann. Er versucht, mich zu schlagen, aber die Jungs in Florida sind langsamer als ich. Stattdessen schlage ich ihn. Er blutet.
Finde mich im Büro des Rektors wieder. Sage ihm, dass der Junge meine Mom eine Schlampe genannt hat. Werde trotzdem nach Hause geschickt. Dort sind Mom und ihr Freund gerade dabei, Dinge zu tun, die ich lieber nicht hören will.
Meinen Stammbaum habe ich nicht mit nach Hause genommen. Hab ihn in den Mülleimer des Klassenzimmers geworfen. Und zur Sicherheit noch mal draufgespuckt.
Mein Hirn gräbt Tunnel. Sie werden immer kleiner. Irgendwann schließen sie sich. Normalerweise. Der Stammbaumtunnel schließt sich nie ganz.
Stephenson, Richardson, Davidson, Hutchinson, Robinson, Johnson, Jefferson. Ich bin der Sohn von jemandem.
Von Mikes Baseballspiel ist mir immer noch warm, und ich beschließe, mir einen Weg zum Auto zu bahnen, damit ich es freischaufeln kann. Wenn ich schaufle, habe ich das Gefühl, zum Schaufeln geboren zu sein. Ich spiele mit dem Gedanken, den Rest meines Lebens damit zu verbringen. Mit dem Schaufeln von Schnee, von Dreck, von Mom, von mir selbst. Irgendwann stoße ich vielleicht auf die Antwort. Hört sich dämlich an, stimmt’s? Ein 16-Jähriger, der nach einer Antwort sucht, obwohl er nicht mal die Frage kennt.
Dabei kennen wir alle die Frage.
Sie lautet: Was tue ich hier überhaupt?
Ich beobachte, wie Schneepflüge und Streufahrzeuge die Hauptstraße entlangfahren und die Ampelkreuzung überqueren. Dann fährt ein Schneepflug an mir vorbei und schiebt den Schnee von der Straße auf die Stellen, die ich gerade freigeschaufelt habe, und ich überlege, ob die Antwort lautet, dass man dauernd Sachen tut und nie etwas erreicht.
In einem Schneesturm draußen zu sein, das hat jedenfalls was. Die Antwort ist eine Schneeflocke. Ist ein Blizzard. Ist die Art, wie mir im Inneren heiß und meine Nase gleichzeitig taub ist. Schweiß läuft mir den Rücken hinunter. Meine Finger sind wie steif gefroren, weil meine Handschuhe nass sind. Vielleicht sind das die Antworten.
Es hat noch 30 Zentimeter geschneit. Ich weiß nicht, wie lange ich schon hier draußen bin. Bei Mike brennt nach wie vor Licht, also ist es wohl nicht zu spät, um Baseball zu schauen und das Gehirn zu kontrollieren, damit man glaubt, dass Sommer ist. Die Straßen sind vereist. Morgen kann bestimmt niemand irgendwohin fahren. Ich blicke zur Kirche auf der anderen Straßenseite, und der Schnee liegt so schwer auf den Ästen der Tannen um sie herum, dass es aussieht, als würden sie gleich brechen.
Ich drehe mich um und schaue unser Haus an. Im Schnee sieht es hübsch aus. Unten wohnt eine Frau, die Penny heißt und Musiklehrerin ist. Wir wohnen vorn in den beiden Stockwerken über ihr. Ein Typ, der Doug oder Dirk oder Don oder so heißt, wohnt in der hinteren Wohnung. Mike sagt, dass er Nachtschicht hat, weshalb wir ihn nie sehen. Penny kümmert sich um die Veranda, und es sieht so aus, als würde sie Blumen und so was anpflanzen. Vor dem Schnee, meine ich. Jetzt sieht es so aus, als würde sie Mondgestein züchten.
Vor einer Woche erst hab ich in Jeans in der Sonne von Südtexas wie ein Schwein geschwitzt. Und jetzt wohne ich in einem Schneesturm. Ich bin 16 Jahre alt, und unser Kartoffelkochtopf ist abgesehen von meiner Mutter die einzige Konstante in meinem Leben.
Die Antwort hat etwas mit Kartoffeln zu tun. Es kann nicht anders sein.
FREAK SOLL VERSCHWINDEN!
An einem Samstagabend vor ungefähr zwei Jahren beschloss Freak, zum Kino in der Mall zu fahren und einen Film anzuschauen. Irgendeinen Zeichentrickfilm. Was für Kinder.
Während Freak am Kiosk Popcorn kaufte, steuerten Kelly Pointer und ihre beste Freundin Mika auf sie zu. Ein paar Schritte von ihr entfernt blieben sie stehen und sprachen leise miteinander, dann ging Mika weg, in Richtung Spielhalle. Kelly kam auf Freak zu, einen Ausdruck von Panik im Gesicht. Freak kam das gleich komisch vor. Freak war erst vor ein paar Wochen hergezogen, und Kelly Pointer hatte sie bisher immer links liegen lassen.
Kelly sagte: »Ich muss dir etwas erzählen.«
Freak sagte: »Okay.«
»Du darfst es aber keinem sagen, ja?«
Freak sagte: »Okay.«
»Ich bin schwanger.«
Freak stellte ein paar Fragen. Das übliche Bist du okay? und Wirst du’s behalten? Kelly Pointer ging wieder weg, und Freak begriff, dass sie gerade verarscht worden war. Und wenn das irgendwas mit Kellys bester Freundin Mika zu tun hatte, na dann gute Nacht, denn die war so dumm, die konnte nicht mal bis drei zählen.
Eine Stunde später, mitten im Film.
Mika beugt sich zu Freak hinüber und sagt: »…«
Um Freak herum erstarrte alles.
Freak hatte keine Ahnung, was hier gespielt wurde, aber sie wusste, dass etwas gespielt wurde. Freak dachte, Mika würde sagen: Was ist heute Abend nur mit Kelly los? Sie rückt nicht mit der Sprache raus! Freak kennt die Bitches ganz genau. Kennt sie alle. Freak kennt das Bitch-Drehbuch in- und auswendig.
Mika beugt sich also zu Freak rüber und sagt: »Hast du schon gehört, dass Kelly schwanger ist?«
Freak hatte keine Ahnung, was sie sagen sollte. Das stand nicht im Drehbuch. Also sagte sie: »Ist sie okay?«
Mika nickte und wandte sich wieder dem Film zu.
Eine Stunde später, der Film war vorbei, kam Kelly auf Freak, während diese am Getränkeautomaten stand, zumarschiert und sagte: »Du hast Mika erzählt, dass ich schwanger bin!« Und weil Kelly unfähig war, ihre Lautstärke herunterzudrehen, wussten jetzt alle in der Lobby, dass Kelly Pointer schwanger war, was bedeuten musste, dass das kein Problem war.
Freak sagte: »Mika hat mir erzählt, dass du schwanger bist.«
Kelly sagte: »Nein, hat sie nicht.«
Freak sagte: »Hat sie doch.«
Kelly sagte: »Du hast es ihr erzählt, stell dich nicht blöd.«
Freak schaute zu Mika hinüber, die keinen Schimmer hatte, was gerade passierte, und einen Jungen auf der anderen Seite des Foyers anstarrte.
Freak sagte: »Sie hat es mir während des Films erzählt. Ich hab nur gefragt, ob du okay bist.«
Kelly wuchtete ihren angeblich schwangeren Körper auf Freak zu, die rechte Hand schlagbereit. Freak rannte davon.
Seitdem hat Freak nicht mehr aufgehört zu rennen. Fast zwei Jahre ist das her.
Sie rennt über alle Kontinente, durch alle Klimazonen. Sie macht einfach die Augen zu und flimmert von einem Ort zum anderen. So gerät sie nie in Gefahr. Egal ob sie in einem kriegsgeplagten Land mit einer Waffe bedroht wird oder ob in einer x-beliebigen Stadt ein Mädchen wie Kelly Pointer sie verprügeln will, sie braucht nur die Augen zuzumachen, und schon flimmert sie woandershin.
Gestern war sie fast den ganzen Tag in Berlin und hat Bauchtanzen gelernt.
Heute war sie fast den ganzen Tag in der Wüste und hat eine Giftschlange gereizt.
Sie trainiert ihre Reflexe. Die Schlange bäumt sich auf, zum Stoß bereit, und Freak flimmert davon, bevor ihr etwas passieren kann. Sie landet auf dem Planeten Schneemond, mitten auf einer frisch geräumten Straße.
FREAK HASST DIE BESCHEUERTEN HIGH-SCHOOL-BITCHES!
Freak ist wütend. Wie hatte sie nur so dumm sein können, sich von zwei bescheuerten High-School-Bitches verarschen zu lassen? Fast zwei Jahre ist das schon her, und sie ist immer noch wütend darüber.
Der Schnee beruhigt sie. Er fällt so schnell, dass sie keine zehn Meter weit sehen kann. Sie versucht nicht, Flocken mit der Zunge aufzufangen. Freak fängt nie Schneeflocken mit der Zunge auf. Stattdessen greift sie in die Tasche, zieht ein Feuerzeug heraus und versucht, die Schneeflocken anzuzünden, bevor sie den Boden erreichen. Bevor sie alles zudecken. Was natürlich völlig sinnlos ist.
Am letzten Freitag ist Freaks Vater ausgezogen. Wieder einmal. Zum Glück. Er bestand aus lauter Reglern und Schaltern, die alles kontrollierten – wann sie ein Bad nahm und wann sie sich die Haare bürstete. Als sie einen Busen bekam, sagte er, ihre BHs seien zu teuer, weshalb sie mehrere Schichten tragen musste, damit man ihre Nippel nicht sah. Als sie ihre Periode bekam, sagte er, Tampons und Binden seien zu teuer, deshalb benutzt sie seit dem ersten Tag alles, von der Menstruationstasse bis zu irgendwelchen Waschlappen. Vielleicht ist das sogar der Grund, warum alle Freak zu ihr sagen, aber es ist bestimmt nicht der einzige.
Freak ist wütend auf Kelly Pointer und deren dämliche Freundin Mika. Sie ist jetzt schon wütend auf ihre Mutter, weil sie ihren Vater irgendwann wieder einziehen lassen wird. Das ist jedes Mal so, wie bei einem Jo-Jo. Länger als drei Monate haben ihre Eltern es nie geschafft, getrennt zu bleiben. Das war vor zwei Jahren, als ihre Mom mit ihr nach Pennsylvania zog. Freak versucht, den Schnee auf einem Autodach zu verbrennen. Er schmilzt, und das fühlt sich gut an. Sie weiß nicht, wo sie sich gerade befindet, aber das weiß sie nie, wenn sie flimmert. Flimmern kann gefährlich werden. Sie hätte wer weiß wo landen können. Schön, wieder mal Schnee zu sehen.
»He! Was treibst du da an meinem Auto?«
Freak vergisst immer, dass man sie sehen kann.
Der Typ, der sie angeschrien hat, steht in seiner Eingangstür in einem dicken Flanellhemd und nicht zugebundenen Schneestiefeln. Sie geht weiter. Flüstert: »Entschuldigung.« Der Schnee schluckt alle Geräusche, vermutlich hat der Typ sie gar nicht gehört, aber dann sagt er: »Ist dir kalt? Willst du nicht reinkommen?«
Freak hat die Nase voll von perversen älteren Typen. Schon seit sie zwölf war, hat sie von ihnen die Nase voll. Ihr ist nicht kalt. Sie hat gerade acht Stunden in einer Wüste verbracht. Sie geht einfach weiter und wedelt mit der Hand. Er schließt die Haustür, und sie ist wieder allein. Kein Verkehr. Keine Menschen. Kein Lärm. Schnee lässt alles verschwinden, was mit dieser Welt nicht stimmt.
Das Problem beim Flimmern ist, dass sie, selbst wenn sie es will, nicht an einem Ort bleiben kann. Freak ist an einem Strand. Freak ist in dem Sitzungssaal. Freak ist beim Wandern in den Alpen. Freak ist auf einem Schiff. Freak erntet russischen Weizen. Freak ist auf dem Schneemond.
Als Freak 16 war, schnitt ihr Freund ihr mit einem Steakmesser in den Arm. Freak sagte zu ihm, er solle sich zur Hölle scheren. Aber am nächsten Tag tat es ihm leid. Eine Woche später spülte sie sich die Scheide mit Terpentin. Es tat ein bisschen weh, aber nicht so sehr wie andere Sachen.
Flimmern tut nicht weh. Flimmern ist einfach.
Jetzt muss sich Freak nie wieder die Scheide mit Terpentin spülen.
Sie kann einfach zum Strand gehen.
Freaks Füße sind im Sand.
Freaks Füße sind in der Brandung.
Freaks Füße stecken in Wollstiefeln, und sie lässt mit ihrem Feuerzeug Schnee schmelzen.
Freak schnorrt in New York eine Zigarette von einem Fremden.
Freak ist beim Snowboarden am Lake Tahoe.
Freak ist nüchtern. Freak ist betrunken. Freak ist wütend.
Die Erwachsenen ermahnen sie zu lächeln. Die Erwachsenen ermahnen sie, nicht so ängstlich zu sein. Sie sagt: »Spült ihr euch erst mal die Scheide mit Terpentin, dann können wir weiterreden.«
Freak hat Gefühle. Und sie hat nicht vor, sie durch bescheuerte Gespräche bei Wein oder politische Diskussionen zu unterdrücken. Rot, Weiß, Rot, Blau. Freaks Mutter steht auf Rot. Große runde Gläser – sie schwenkt den Wein darin und riecht daran. Wen kümmert es am Ende des Abends schon, wie der Wein gerochen hat? Am Ende des Abends stolpert Freaks Mutter durchs Haus, spricht mit der Katze, als könnte die sie wirklich verstehen. Die Katze und Freak würden beide vor dem Fluch des Rotweins zurückweichen: schwarzes Zahnfleisch und der unverkennbare Geruch nach Schwefel.
Jake & Bill schaufeln
Im Dunkeln schaufeln Jake und sein Bruder Bill ihre Einfahrt frei. Sie haben ein schönes Zuhause – es steht in einem Neubaugebiet. Dem Äußeren des Hauses nach würdet ihr nie auf den Gedanken kommen, Typen wie sie könnten dort wohnen. Alles dort ist normiert – als hätte eine Hausbaumaschine soeben 200 Häuser perfekt an der Straße aufgereiht, nur die Farbe variiert von Hellbeige zu Dunkelbeige zu Grau und immer so weiter. Drinnen sieht es genauso normal aus. Kitschige Deko von den Ausflügen der Mutter der beiden ins Amish Country. Gerahmte Kinderbilder. Ein wandteppichgroßer Quilt, auf dem »Familie« zu lesen ist. Überall riecht es nach Zimt und Vanille. Die Küche ist sauber, und das Zimmer daneben ist mit ganz gewöhnlichen Möbeln und Lampen und einem hübschen, fleckenlosen Teppich ausgestattet.
Das einzig Merkwürdige an dem Haus ist das beheizte Terrarium in Bills Zimmer – für die Schlange. Aber Jungs sind nun mal so, und sie mögen so merkwürdiges Zeug wie Schlangen. Dem Äußeren nach sind die beiden so normal wie jeder andere hier in der Straße.
Jake schaufelt schneller als Bill, so als wäre es ein Wettkampf. Der Asphalt der Einfahrt sieht genauso aus wie der auf allen anderen Einfahrten. Sobald Jake den Asphalt unter dem Schnee sehen kann, will er auch den Rest der Einfahrt freilegen. Er schaufelt schneller. So tief er kann. Träumt davon, in den Süden zu ziehen.
»Scheiß drauf«, sagt Bill, geht ins Haus und überlässt Jake die ganze Arbeit.
Der Schaufler: Hirntyp
Da kommt ein Mädchen die Straße entlang, mitten auf der Fahrbahn. Ich weiß nicht, woher sie kommt, und sie scheint nicht zu wissen, wohin sie geht. Sie schlendert einfach vor sich hin. Sie sieht mich nicht, und ich stehe still da, weil ich aus irgendeinem Grund nicht will, dass sie mich sieht.
Aber ich muss sie einfach anstarren.
Aus irgendeinem Grund denke ich: Sie ist die Antwort.
Aus irgendeinem Grund denke ich: Sie ist der Sinn des Lebens.
Wir blicken uns eine Sekunde lang an, dann kommt sie langsam auf mich zu. Schlendert noch immer. Bleibt stehen, um ihr Feuerzeug anzuschnippen, aber ich bin mir nicht sicher, warum sie das tut. Ich glaube, sie versucht, den Schnee anzuzünden.
Irgendwann sagt sie: »Hi.«
Ich sage: »Hi.«
»War das dein Dad, der mich gefragt hat, ob ich reinkommen will?«, fragt sie und deutet auf Mikes Haus.
Ich schüttle den Kopf. »Das ist unser Nachbar. Ich habe keinen Vater.«
»Unbefleckte Empfängnis?«
»Genau.«
»Abgefahren.« Sie greift tief in die Tasche ihres Parkas und scheint enttäuscht, als sie nichts darin findet. »Väter werden sowieso überschätzt.«
»Das sagst du bestimmt nur, weil du einen hast.«
Sie sagt: »Als ich fünf war, hat mir meine Mom erzählt, dass mein Vater ein Hinterntyp ist. Ich hab nicht kapiert, was sie meint. Später hat sie mir erklärt, dass manche Männer Hinterntypen sind, manche Busentypen und manche Beinetypen. Ich suche nach einem Hirntypen. Habe aber noch keinen gefunden.«
Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. So habe ich das nie gesehen. Außerdem: Was für ein krasser Gesprächseinstieg.
»Als hätten sie uns in Stücke aufgeteilt, bevor wir in die Middle School kommen. Scheiß auf die Männer. Nimm’s mir nicht übel, aber ihr seid alle Arschlöcher … Väter eingeschlossen.«
Auch dazu weiß ich nicht, was ich sagen soll. Ich würde ihr gern erklären, dass ich ein Hirntyp bin, aber das stimmt nicht. Ich habe auf Busen gestarrt. Ich habe auf Beine gestarrt. Ich habe auf Hintern gestarrt. »Vielleicht liegt’s daran, dass man das Hirn nicht sehen kann«, sage ich. »Man muss jemanden erst kennenlernen, bevor man sein Hirn kennt.«
»Sag bloß.«
Ich schweige ein paar Sekunden zu lang. »Wir sind alle Arschlöcher«, sage ich dann. Sie sieht mich an und verdreht die Augen. »Sorry. Ich überlege gerade, ob ich einen Hirntypen kenne, aber mir fällt keiner ein.«
»Deshalb seid ihr noch lange nicht alle Arschlöcher. Bist du vielleicht eins? Schaufelst hier draußen im Dunkeln Schnee. Arschlöcher sind normalerweise faul.«
Faul bin ich noch nie gewesen. Das gibt mir ein gutes Gefühl.
»Und außerdem bist du zumindest keine Waise«, sagt sie.
»Stimmt.« Ich denke an Mom. Manchmal komme ich mir wie eine Waise vor, aber ich bin keine.
»Und bald hast du einen guten Job. Sieh mal morgen in deinen Briefkasten. Da wirst du was finden.«
Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
»Hast du eine Kippe?«, fragt sie.
Ich gebe ihr eine Zigarette, und sie zündet sie mit ihrem Feuerzeug an. Mir ist nicht nach einer zweiten, also sehe ich ihr nur beim Rauchen zu. Mir fallen ihre Lippen auf. Voll und rot. Kein Lippenstift. Natürlich perfekte Lippen. Ich wollte noch nie jemanden küssen. Noch nie in meinem Leben. Aber jetzt? Jetzt will ich ihre Lippen auf meinen spüren und ihren Geschmack schmecken.
Ich sehe ihr zu, wie sie wieder an der Zigarette zieht, und kann nicht aufhören, an meinen Vater zu denken. Das ist mein Haupttunnel. Er führt zu den anderen Tunneln. Ich komme nicht los von meinem Vater, und dabei weiß ich nicht einmal, wer er ist. Ich bin 16 Jahre alt und wollte noch nie ein Mädchen küssen. Wie beschissen ist das denn? Ernsthaft. Ein Mann, den ich nicht kenne – ein Mann, von dem ich nicht einmal den Namen kenne –, hat alles an mir verkrüppelt.
FREAK GEHÖRT JETZT ZU EINEM TEAM!
Freak liebt es, diese Mischung aus Rauch und Dampf auszuatmen. Das ist der Beweis, dass sie dort ist, auf dem Schneemond. Sie spricht mit einem Jungen. Normalerweise tut sie das nicht gern, aber dieser Junge ist anders. Er schaufelt Schnee, während sie raucht. Er scheint überhaupt nicht an ihr interessiert zu sein, abgesehen von ihrer zufälligen Unterhaltung. Kein Geflirte, keine Anmache, keine Tipps, wie sie hübscher oder stylisher aussehen könnte, keine Ermahnung, wie sie sich ausdrücken soll, weil Schimpfwörter Jungs abschrecken. Die meiste Zeit bewegt er Schnee und atmet schwer. Es ist was Besonderes an ihm. Er gefällt ihr zu gut. Noch nicht einmal halb geraucht. Das ist nicht gut. Also legt sie die Zigarette auf den Bordstein, als wäre die Straße ein riesiger Aschenbecher, und flimmert in ihr Zimmer.
Dort findet sie eine Nachricht von ihrer Mutter.
Du kannst nicht einfach verschwinden, ohne mir Bescheid zu sagen, wo du bist. Ich weiß, dass es schwer für dich ist, seit dein Vater uns verlassen hat, aber wir müssen jetzt ein Team sein. Ich will deine Autoschlüssel vor dem Abendessen auf dem Küchentisch sehen.
Seit sie den Führerschein in der Tasche hatte, tat Freak nichts lieber als zu verschwinden. Zuerst war sie Nacht für Nacht mit ihrem Terpentinfreund unterwegs. Danach ließ sie die Finger von Jungs und fuhr allein herum, damit sie sich die Streitereien nicht anhören musste. Schon merkwürdig, diese Nachricht. Liegt immer noch hier in ihrem alten Zimmer in Kalifornien. Als wäre das in Pennsylvania nie passiert. Als hätten Autoschlüssel jetzt noch irgendeine Bedeutung.
Der Schaufler: Durchsichtiger Rucksack
Sie ist einfach verschwunden. Hat eine Zigarette geschnorrt, halb geraucht, und dann habe ich aufgesehen, und sie war weg. Auf dem Bordstein, wo sie sie hingelegt hat, glimmt ihre Zigarette noch, aber sie ist nass, was eigentlich unmöglich ist – eine schneenasse Zigarette, die brennt. Das Mädchen geht nicht die Straße hinunter oder hinauf. Sie sitzt nicht auf der Veranda. Sie verschwindet nicht in einer Nebenstraße. Ihre Fußspuren hören da auf, wo sie stehen geblieben ist. Das ergibt keinen Sinn. Die Variablen stürmen auf mich ein. Ich schaue zur Kirche auf der anderen Straßenseite. Daneben liegt einer dieser winzigen alten Friedhöfe. Vielleicht gibt es dort ja Gespenster. Ich habe keine Angst vor Gespenstern, aber sie ist mir nicht wie eins vorgekommen.
Als ich damit fertig bin, die Dächer der Autos freizuräumen – unseres und das von Penny –, schneit es langsamer. Zehn, zwölf Zentimeter noch, maximal. Ich trage die Schaufel und den Besen auf die Veranda, klopfe mir, so gut es geht, den Schnee von Stiefeln und Jacke und ziehe sie dann in der Eingangshalle aus.
Als ich unser Apartment betrete, sehe ich, dass es halb zwei Uhr morgens ist. Mom schläft zusammengerollt auf dem Sofa, das Gesicht zur Wand gedreht. Ich bin hellwach, setze den Teekessel auf und mache mir heiße Schokolade.
Ich ziehe meine feuchte Kleidung aus und schlüpfe in eine Flanellschlafanzughose und ein Langarmshirt. Mein Zimmer ist klein und leer, abgesehen von meinem Bett, dem Schulhandbuch, zwei Müllsäcken mit Kleidung und einem neuen Rucksack, den Mom mir von ihrem Erster-Tag-in-einer-neuen-Stadt-Kaufrausch mitgebracht hat. Der Rucksack ist aus durchsichtigem Plastik. Was nie ein gutes Omen ist.
Ich schlage das Handbuch auf und klappe es wieder zu. Was könnte schon drinstehen, außer dem Offensichtlichen – dass alle Rucksäcke durchsichtig sein müssen? Komm nicht zu spät; geh nicht zu früh. Schwänze nicht die Schule. Schlag niemanden. Verletz niemanden mit einem Messer. Trag keine Kleidung, die deine Geschlechtsteile unzureichend verdeckt. Fall bei den Prüfungen nicht durch. Benimm dich in der Mensa nicht wie ein Arsch. Benimm dich im Bus nicht wie ein Arsch. Benimm dich in der Bibliothek nicht wie ein Arsch. Benimm dich beim Wechseln des Klassenzimmers nicht wie ein Arsch. Benimm dich auf dem Schulgelände nach Unterrichtsende nicht wie ein Arsch.
Erster Tag an einer neuen Schule. Der läuft nie gut. Bin immer zu nervös. Bin immer komplett durchgeschwitzt. Verstecke mich immer vor den Schülern, die mich verprügeln wollen. Es gibt immer irgendwen, der den Neuen verprügeln will. Es ergibt keinen Sinn. In Texas war es ein Junge, der Kyle hieß. In Arizona war es einer, der Paco Taco hieß, was ein rassistischer Spitzname ist. Aber alle wussten, dass er gern Tacos aß, und er nannte sich selbst so, also war das vermutlich okay. In Nebraska war es ein Mädchen. Sie hieß Juli. Sie verprügelte jeden, bei jeder Gelegenheit. Und damals in Kentucky, in der vierten Klasse, war es der Rektor der Schule. Er wollte mich schon am ersten Tag verprügeln. Sagte, dass die Schüler, die mittags kostenlos mitessen dürfen, sich zumindest die Haare waschen sollten.
Obwohl ich mir in der vierten Klasse die Haare jeden Tag wusch, behauptete der Rektor immer, sie wären fettig. Er sagte, die Schüler, die mittags kostenlos essen dürften, sollten gefälligst Jeans mit sauberen Knien tragen, und er habe die Nase gestrichen voll von Kindern wie mir, die würden den Notendurchschnitt drücken.
Eines Tages zog er das Käsebrett heraus. Löcher mit Holz drum herum. Beim Zuschlagen pfiff es. Ich kotzte mein kostenloses Mittagessen auf seinen Teppich.
Wurde von der Schule geschmissen. Zog um. Der Tunnel schließt sich.
In meinem Zimmer hängen keine Vorhänge, also blendet mich die Schneesonne, als ich früh am Montag aufwache. Der Schneesturm ist vorbei. Ich gehe nach draußen, um mir ein Bild von der Arbeit zu machen, die mich erwartet. Ich bin froh, dass ich gestern schon so viel geschafft habe, weil nur circa 15 Zentimeter auf dem Eingangsweg und dem Bürgersteig liegen. Unsere Autos sind zu erkennen, während alle anderen Autos an unserer Straße immer noch wie geschwungene Eisberge in einem Schneeozean aussehen.
Ich gehe wieder hinein und sehe, dass in unserem Briefkasten eine kleine Zeitung steckt, der Merchandiser. Keine Fußabdrücke. In Pennys Briefkasten liegt keine Zeitung. Nur in unserem.
In der Zeitung steht ein Job für mich. Das hat das Mädchen gesagt. Ich weiß immer noch nicht, ob sie real war. Sie hat aber real gewirkt. Beim Ausatmen hatte sie Wolken vor Mund und Nase. Sie hat den Schnee angezündet. Sie hat über den Schneepflug geschimpft. Sie sprach von Hintern. Wenn sie ein Geist war, dann ein hübscher und ziemlich merkwürdiger.
Ich blättere die Rubrik »Hilfe gesucht« auf, und da ist eine Anzeige, mit lilafarbenem Leuchtstift umrahmt.
Arbeiter gesucht. Bin ich ein Arbeiter?
Für das Streichen von Innenräumen. Ich habe ein paar unserer Wohnungen gestrichen. Normalerweise muss ich die Wände dann wieder weiß streichen, weil Mom sich ein lila Schlafzimmer oder eine zitronengrüne Küche in den Kopf gesetzt hat und Vermieter neutrale Farben mögen.
Zehn Minuten von der Stadt entfernt. Perfekter Job für Schüler oder Studenten. Nur Abende und Wochenenden.
Mom kommt in die Küche. »Du bist früh auf«, sagt sie.
»Das hat gestern jemand in den Briefkasten gesteckt.« Ich zeige ihr den Merchandiser.
Sie brummt nur und macht Kaffee, dann lässt sie sich neben mir auf das Sofa fallen.
»Hast du die Nacht durchgeschaufelt?«
»Nur bis ich fertig war.«
»Ich hab dich mit diesem Mädchen sprechen sehen.«
»Ja«, sage ich und lächle, weil das bedeutet, dass sie tatsächlich da war.
»Mike hat mir erzählt, dass sie versucht hat, Schnee mit Feuer zu schmelzen oder so was in der Art. Merkwürdiges Mädchen. Vielleicht solltest du dich von ihr fernhalten.«
Als Mom unter der Dusche ist, beschließe ich, dass jetzt eine gute Gelegenheit ist, die Leute mit dem Maler-Job anzurufen. Sie gehen nicht ans Telefon, weshalb ich eine Nachricht auf dem offenbar ältesten Anrufbeantworter der Welt hinterlasse – die Ansage klingt wie unter Wasser aufgenommen, und der Signalton kommt ganz unerwartet. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, aber mein letzter Satz hallt noch immer in mir wider. Ich freue mich, von Ihnen zu hören!
Ich ärgere mich, weil ich so forsch klinge. Aber da der Job wohl bar bezahlt wird, kann das wahrscheinlich nicht schaden. Barzahlung heißt, dass Mom mir den Scheck nicht abnehmen kann, ihn auf ihr Konto umleiten und mir 40 Dollar für eine Woche Arbeit geben wird, wie bei meinen letzten beiden Jobs.
NICHT EINMAL NACKT KANN FREAK WEINEN!
Freak will zu dem Schaufeljungen zurück. Sie muss ihm sagen, was ihn in der Schule erwartet. Sie muss ihn warnen, mit keinem zu sprechen, der eine Schlange herumträgt. Sie muss ihm sagen, dass man nicht immer gleich sieht, wer eine Schlange mit sich herumträgt.
Aber sie steckt hier fest. In ihrem verstaubten alten Zimmer, wo sie zuhört, wie ihre Eltern sich unten streiten.
Sie kann nicht glauben, dass ihre Mutter ihn wieder ins Haus gelassen hat. Sie kann es nicht glauben, aber sie versteht es. Die Zeiten sind hart. So eine Scheiße lässt Leute zerbrechen, und irgendwie passen die Scherben ihrer Eltern zusammen, obwohl ihnen das noch nie gutgetan hat.
Freak hat jedoch keine Angst vor einem bisschen Streit. Sie sitzt auf ihrem Bett und hört ihnen zu.
»Ich hätte nicht zulassen dürfen, dass du dorthin ziehst«, sagt er.
»Ich wollte es aber«, gibt sie zurück. »Und wir brauchten das Geld.«
»Ich hätte mir einfach einen anderen Job suchen sollen. Oder meinen Vater anbetteln. Oder …«
Freaks Vater weint. Das hat es noch nie gegeben. Dann fängt ihre Mutter auch an. Das ganze Haus ist vom Schluchzen der beiden erfüllt. Freak versucht zu weinen, aber sie kann keine einzige Träne herauspressen – nicht mal eine der Wut. Sie betrachtet sich im Spiegel. Zieht sich nackt aus. Damit klappt es normalerweise, aber noch immer kommt nichts. Das lässt Freak noch wütender werden. Sie tritt ihren Mülleimer um. Sie schlägt mit der Faust gegen den Spiegel, und er zerbricht.
»Hast du das gehört?«, fragt ihr Vater.
»Ich höre ständig was«, antwortet ihre Mutter. »Ständig.«
Freak versucht ihre Zimmertür zu öffnen, aber sie ist von außen versperrt.
Sie setzt sich auf ihr Bett. Kann noch immer nicht weinen, obwohl sie nie in ihrem Leben so traurig gewesen ist.
Sie flimmert.
Freak ist nach wie vor nackt, als sie im Hörsaal einer Universität auftaucht, wo ein Professor gerade über Solanum tuberosum spricht – die Kartoffelpflanze.
»Wer hätte gedacht, dass die Nordeuropäer auf eine derart giftige Pflanze angewiesen sein würden? Alles daran ist giftig, außer den Knollen. Blätter, Stiele, Wurzeln, Samen, alles giftig. Das Geheimnis« – er schlägt mit der Hand auf einen Bücherstapel – »ist, die Knollen im Erdreich zu belassen. Weil jeder Teil der Pflanze, der mit Licht in Berührung kommt, beim Verzehr schädlich sein kann. Sogar tödlich – aber erst, nachdem man sich die Seele aus dem Leib gekotzt und den Verstand verloren hat.«
Der Professor erzählt vom Europa im 16. Jahrhundert – davon, wie vor der Einführung der Kartoffel die Menschen an Seuchen und Hunger starben –, und dann sagt er zum Abschluss etwas, das im Hörsaal für erregtes Gemurmel sorgt. Er sagt: »Das Wesen der Welt, in der wir leben – diese Vorherrschaft der Nordeuropäer –, ist auf Solanum tuberosum zurückzuführen. Meiner Meinung nach ist es eine Ironie der Geschichte, dass unsere Vorfahren es geschafft haben, sich nicht mit der Kartoffelpflanze zu vergiften, mit ihrem Aufstieg aber andererseits die ganze Welt vergiftet haben.«
Während die Studierenden diese Behauptung murmelnd diskutieren, schreibt Freak ein Gedicht auf ihren Tisch.
Regenwürmer verraten Freak Geheimnisse!
(Regenwürmer kennen die
Geschichte der ganzen Welt,
weil sie die Geschichte
der ganzen Welt fressen.)
Wenn ihr etwas über die Geschichte des Drecks erfahren möchtet, müsst ihr den Würmern zuhören.
Der Professor schlägt wieder mit der Hand auf den Bücherstapel und lädt ein, Fragen zu stellen.
Freak hatte schon immer aufs College gewollt, aber jetzt ist sie nackt und die Studenten starren sie an.
In vielerlei Hinsicht fühlt sich Freak immer nackt.
In vielerlei Hinsicht ist Freak immer nackt.
Wahrscheinlich macht das den Leuten am meisten Angst vor ihr.
Marla & Gottfried im Autokino
»Du bist zu alt, um dich so abzuplagen«, sagt Marla. »Wir müssen doch nirgendwohin. Wir können einfach den Mann mit dem Schneepflug anrufen, der bei Helen räumt.«
Gottfried ist gerade dabei, eine letzte Schicht Kleidung anzuziehen. Bisher trägt er eine dünne Schicht lange Unterwäsche und darüber eine dickere Schicht lange Unterwäsche, zudem zwei Paar Socken, Jeans und seinen Gürtel sowie zwei Sweatshirts über einem Rollkragenpullover. Während Marla mit ihm spricht, geht er zum Dielenschrank und holt seinen Gesichtsschutz aus Vlies sowie Schal und Ohrenwärmer heraus.
»Du solltest das wirklich nicht mehr tun. Du könntest wieder hinfallen.«
Im Winter vor zwei Jahren ist Gottfried gestürzt und mit dem Kopf aufs Eis geschlagen. Bis heute weiß er nicht, wie lange er bewusstlos war, aber er erinnert sich an einen schönen Traum, in dem keine Rotkehlchen vorkamen.
Er setzt seinen Hut auf, schlüpft in seinen Mantel, stopft die Handschuhe in die Taschen und geht in die Garage, wo seine Stiefel auf ihn warten, die Sohlen mit besonderen Metallspikes bespannt.
»Gottfried! Warum hörst du mir nicht zu?!«, schreit Marla.
Er drückt auf den Schalter für das automatische Garagentor, und während es sich öffnet und 40 Zentimeter Schnee zum Vorschein kommen, sagt er: »Ich höre ja zu.«
»Ruf den Mann mit dem Schneepflug an. Irgendwann kommt er immer auch hier vorbei!«
»Ich bin nicht zu alt, um meine Einfahrt zu räumen. Genauso wenig, wie du für das zu alt bist, was du tust.«
Gottfried geht zur Schneefräse und lässt sie an. Marla versucht, das Motorengeräusch zu überschreien, aber da es ihr nicht gelingt, geht sie wieder ins Haus und macht sich daran, den Kühlschrank zu reinigen.
Ich bin nicht zu alt für das, was ich tue? Warum hast du das gesagt? Was tue ich denn überhaupt noch? Du führst mich nicht mehr zum Essen aus. Und auch nicht ins Theater oder in ein Konzert. Ich koche für dich. Zu den Feiertagen kaufe ich Geschenke und denke an alle Geburtstage. Ich schneide immer noch Coupons aus. Ich ertrage deine Baseballspiele und recycle deine Bierflaschen.
Rutsch nur ruhig aus und fall hin, das ist mir egal. Schlag dir den Kopf auf. 50 gemeinsame Jahre, und das Einzige, was sich im Bett noch tut, ist dein Geschnarche.
Gottfried kommt zum Mittagessen herein. Er hat erst ein Drittel der Einfahrt geschafft.
»Der Schnee ist gut. Leicht«, sagt er.
»Iss dein Sandwich nicht nur halb«, sagt Marla. »Du wirst Kraft brauchen.«
»Die Suppe ist wirklich gut, Marla.«
»Deine Lieblingssuppe.«
Sie lächeln sich an. Gottfried kann sie, nach einem Vormittag im blendend weißen Schnee, nur ganz schlecht erkennen. Marla kann ihn, da sie ihren grauen Star seit Jahren ignoriert, nur ganz schlecht erkennen. Manchmal, wenn sie ihn anschaut, sieht sie den jungen Mann in dem schlecht sitzenden Anzug vor sich, der gerade zu seinem ersten Vorstellungsgespräch aufbricht, den Mann, der von der Farm seiner Familie wegwollte, um Geschäftsmann zu werden – den Mann, in den sie sich damals verliebt hat. Manchmal, wenn er sie anschaut, sieht er die junge Frau vor sich, die zu ihrem ersten Rendezvous weiße Handschuhe trug und ein Anstecksträußchen von ihm erwartete, obwohl sie nur ins Autokino fuhren.
Gottfried hat Marla nie von den Rotkehlchen erzählt – es gehörte sich nicht für einen Mann, vor einer Frau wegen so etwas zu weinen. Zumindest nicht, als sie beide jung waren. Damals war alles anders.
Marla hat Gottfried nie von dem erzählt, was nach der Geburt ihres letzten Kindes passierte. Damals hielt man als Frau solche Probleme vom Ehemann fern. Und sorgte ihm zuliebe dafür, dass die Kinder keine Schwierigkeiten machten.
»Ich gehe wieder raus«, sagt er nach einem Abstecher auf die Toilette.
»Sei vorsichtig!«
Die Kinder vor Schwierigkeiten zu bewahren war nicht so einfach, wie es sich anhörte.
Marla hatte ihre eigenen Rotkehlchen, und manchmal weinte auch sie ihretwegen.
Jake & Bill fahren ein paar Bier trinken
Jake Marks will einen Schnee-Engel hinbekommen. Er weiß nicht, warum; aber er weiß, dass ihn das zur größten Schwuchtel aller Zeiten machen wird. Er ist Jake-fucking-Marks. König des Schularrests. König der Aufforderung an die Lehrer, sich ins Knie zu ficken. Aber eine Minute lang wünscht er sich, er wäre einfach Jake, der kleine Junge, der einen Schnee-Engel machen kann, ohne von seinem Bruder eine Pussy genannt zu werden.





























