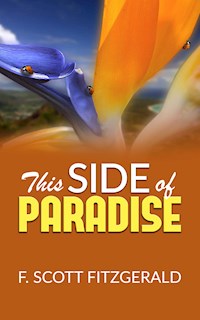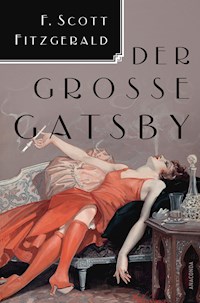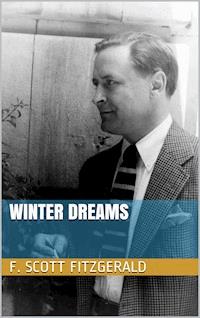9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Geschichten aus den Roaring Twenties, als das Trinken und Tanzen kein Ende hatte, skandalöse junge Frauen ihr Haar kurz trugen (wie in der Erzählung Bernices Bubikopf) und nur eines im Sinn hatten: den Männern den Kopf zu verdrehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 292
Ähnliche
F. Scott Fitzgerald
Drei Stunden
zwischen zwei Flügen
und andere Meistererzählungen
Ausgewählt und mit einem Nachwort
von Daniel Kampa
Nachweis der einzelnen Texte
am Schluss des Bandes.
Umschlagillustration:
Georges Lepape, ›Bal de la Couture‹,
1924 (Ausschnitt)
Copyright © Georges Lepape/
2012 ProLitteris, Zürich
Alle deutschen Rechte vorbehalten
Copyright © 2012
Diogenes Verlag AG Zürich
ISBN Buchausgabe 978 3 257 24185 3 (1. Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60144 2
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5] Inhalt
Anstelle eines Vorworts: Hundert Fehlstarts [7]
›One Hundred False Starts‹, deutsch von Renate Orth-Guttmann
Bernice’ Bubikopf [26]
›Bernice Bobs Her Hair‹, deutsch von Bettina Abarbanell
Winterträume [77]
›Winter Dreams‹, deutsch von Bettina Abarbanell
Die letzte Schöne des Südens [122]
›The Last of the Belles‹, deutsch von Bettina Abarbanell
Stürmische Überfahrt [157]
›The Rough Crossing‹, deutsch von Dirk van Gunsteren
Die Hochzeitsparty [197]
›The Bridal Party‹, deutsch von Walter Schürenberg
[6] Wiedersehen mit Babylon [235]
›Babylon Revisited‹, deutsch von Walter Schürenberg
Verrückter Sonntag [277]
›Crazy Sunday‹, deutsch von Walter Schürenberg
Drei Stunden zwischen zwei Flügen [314]
›Three Hours Between Planes‹, deutsch von Renate Orth-Guttmann
Leben und Werk [326]
Nachweis [328]
»To the happy few« [330]
Die Erzählungen von F. Scott Fitzgerald
[7] Hundert Fehlstarts
Peng!, macht die Pistole, und der Läufer startet. Hin und wieder kriegt er das richtig gut hin, häufiger allerdings war es ein Fehlstart. Dann läuft er, wenn er Glück hat, zehn, zwölf Meter, schaut sich um und trottet verlegen zurück zum Start. Nur zu oft aber umrundet er einmal die ganze Bahn in der Meinung, dass er die Spitze hält, nur um beim Endspurt festzustellen, dass keiner hinterherkommt. Der Lauf muss wiederholt werden.
Trainieren Sie fleißiger, machen Sie einen langen Spaziergang, streichen Sie Ihren Schlaftrunk, verzichten Sie aufs Fleisch beim Dinner und belasten Sie sich nicht mehr mit politischen Fragen…
So weit ein Interview mit einem Fehlstart-Champion der schreibenden Zunft – mit mir. Ich greife zu einem ledergebundenen Müllbehälter, von mir albernerweise »Notizbuch« genannt, und hole aufs Geratewohl ein dreieckiges Fetzchen Packpapier heraus. Auf einer Seite klebt eine abgestempelte Briefmarke, auf der anderen steht:
[8] Boopsie Dee war pfiffig
Mehr nicht. Kein Hinweis darauf, was auf diese absurde Feststellung hätte folgen sollen. Boopsie Dee – dass ich nicht lache! – konfrontiert mich mit dieser einen dogmatischen Aussage über ihre Person. Nie werde ich erfahren, was aus ihr geworden ist, wo und wann ihr dieser grässliche Name angehängt wurde und ob die Tatsache, dass sie pfiffig war, ihr viel Ärger gebracht hat.
Ich nehme einen anderen Zettel zur Hand:
Artikel – »Unerfreuliche Sachen, die Frauen anstellen« plus Artikel einer Frau als Gegenstück: »Unerfreuliche Sachen, die Männer anstellen.«
Nr. 1: Bei Tisch Glasauge herausnehmen.
Mehr steht da nicht. Offenbar eine Idee, die sich in Gelächter aufgelöst hat, noch ehe sie richtig Gestalt angenommen hatte. Was sind das für unerfreuliche Sachen, die junge Frauen anstellen? Generell und heutzutage – meine ich. Oder was stellt eine große Mehrheit von ihnen an oder eine starke Minderheit? Ich hätte da schon ein paar vage Vorstellungen – aber nein, die Idee ist gestorben. Ich erinnere mich nur an einen Artikel, in dem es um eine Frau ging, die sich von ihrem Mann hatte scheiden lassen, weil [9] es sie störte, wie er sein Kotelett anging, und dass ich damals überlegte, warum sie ihn nicht schon vor der Heirat ein Kotelett zur Probe hatte essen lassen. Nein, all das gehört in ein Goldenes Zeitalter, in dem sich die Leute einen Nervenzusammenbruch leisten konnten, weil Daddys Schuhe quietschten.
Es gibt Hunderte solcher Ideen – nicht alle haben mit Literatur zu tun. Mal ging es darum, eine Ouled-Naïl-Tanztruppe aus Afrika zu importieren, dann wieder, den Grand Guignol aus Paris nach New York zu bringen oder den Football in Princeton wiederzubeleben (ich hätte da zwei torreiche Spiele zu bieten, mit denen der Trainer sich innerhalb einer Saison einen Namen machen könnte); schließlich finde ich noch einen vergilbten Vermerk »D. W. Griffith klarmachen, dass Kostümstücke wiederkommen« sowie meinen Plan für eine Verfilmung von H. G. Wells’ Geschichte unserer Welt.
Diese kurzen Geistesblitze belasteten mich nicht weiter – es waren die Träume eines Opiumessers, die gleichsam mit dem Rauch aus der Pfeife verflogen. Mich gedanklich mit ihnen zu beschäftigen kam dem Vergnügen gleich, sie in eine vollendete Form gebracht zu haben. Es sind vielmehr die sechsseitigen, zehnseitigen, dreißigseitigen Konvolute, die mir beruflich Kummer machen, als wären es erfolglose Ölbohrungen – sie sind meine eigentlichen Fehlstarts.
[10] Da gibt es beispielsweise einen, den ich mindestens zehn-, zwölfmal hingelegt habe – eine Short Story oder vielmehr ein Text, der versucht, die Form einer Short Story anzunehmen. Im Lauf der Zeit habe ich so viele Worte davon zu Papier gebracht, dass man durchaus einen vorzeigbaren Roman daraus hätte machen können, die derzeitige Version aber umfasst nur an die zweitausendfünfhundert Worte und liegt seit zwei Jahren unberührt da. Der jetzige Titel – die Story lief schon unter mehreren Decknamen – lautet Die Familie Barnaby.
Von klein auf beschäftigt mich ein Tagtraum – was für ein Wort für einen Mann, der sein ganzes Leben damit verbringt, Tagträume aufzuschreiben! –, auf einer einsamen Insel bei null anzufangen und aus dem vorhandenen Material eine relativ hochstehende Zivilisation zu schaffen. Ich fand schon immer, dass Robinson Crusoe geschummelt hat, als er die Werkzeuge aus dem Schiffswrack rettete, und das Gleiche gilt für die Schweizer Familie Robinson, die Zwei kleinen Wilden und die mit dem Ballon Gestrandeten der Geheimnisvollen Insel. In meiner Geschichte würde es nicht nur keine praktischerweise an Land geschwemmten Weizenkörner, keine Winchesterbüchse, keinen 4000-PS-Dieselmotor oder technokratischen Butler geben, sondern meine Figuren würden hilflose Städter sein, die von der [11] Holzbearbeitung nicht mehr Ahnung hätten als der Kuckuck in der Uhr.
Solche Figuren zu erfinden war ein Klacks, sie an Land zu schwemmen das Einfachste von der Welt.
Drei lange Stunden lagen sie erschöpft am Strand. Dann stand Donald auf.
»Da wären wir nun«, sagte er benommen.
»Wo?«, fragte seine Frau gespannt.
»Amerika kann es nicht sein, und die Philippinen sind es auch nicht, denn von dem einen Land sind wir aufgebrochen und in dem anderen noch nicht angekommen.«
»Ich habe Durst«, sagte das Kind.
Donalds Blick ging rasch zum Ufer.
»Wo ist das Floß?« Er sah Vivian einigermaßen vorwurfsvoll an. »Wo ist das Floß?«
»Als ich aufwachte, war es weg.«
»Typisch!«, sagte er erbittert. »Jemand hätte daran denken müssen, den Wasserkrug an Land zu bringen. Wenn ich mich nicht um alles kümmere, passiert in diesem Haus überhaupt nichts. In dieser Familie, meine ich.«
Und wie weiter? Freiwillige vor! Du da in der zehnten Reihe, aufstehen! Erzähl einfach die Geschichte [12] weiter. Wenn du dich festfährst, kannst du immer noch die tropische Flora und Fauna im Lexikon nachschlagen – oder einen Nachbarn anrufen, der einen Schiffbruch hinter sich hat.
Genau an dieser Stelle beginnt meine Geschichte (und den Plot finde ich nach wie vor großartig), vor Unglaubwürdigkeit zu ächzen und zu knirschen. Nach einer Weile mache ich mit einem unbehaglichen Gefühl kehrt – wer soll einem den Unsinn von den Affen abnehmen, die mit Kokosnüssen schmeißen? –, trotte zurück zum Start und gehe wieder in die Hocke. Tagelang.
An solchen Tagen brüte ich manchmal über einem Packen von Blättern mit der Überschrift »Ideen für Storys«. Da finde ich dann unter anderem:
Badewasser in Princeton oder Florida.
Plot – Selbstmord, Luxus, Hass, Leber und besondere Umstände.
Brüskieren oder Brüskiertwerden.
Tänzerin merkt, dass sie fliegen kann.
Eigenartigerweise sind das für mich verständliche, wenn auch vielleicht nicht unbedingt erhellende Vorschläge. Aber sie sind alle uralt und ungefähr so aufregend wie meine Unterschrift oder der Klang meiner Schritte auf dem Fußboden. Einer gab mir [13] jahrelang Rätsel auf, er ist nicht weniger mysteriös als Boopsie Dee.
Geschichte: DER WINTER WAR KALT
Figuren
Victoria Cuomo
Mark de Vinci
Alice Hall
Jason Tenweather
Notarzt
Stark, Wachmann
Worum ging es da? Wer waren diese Menschen mit den finsteren Namen? Bestimmt sollte jemand ermordet werden beziehungsweise selbst einen Mord begehen, ansonsten habe ich den Plot längst vergessen.
Ich blättere weiter und stoße auf einen Text, bei dem ich ein wenig länger verweile: Ein vielversprechender Ansatz, der mich womöglich sogar über die volle Distanz hätte bringen können.
WORTE
Wenn man einen teureren Artikel in Betracht zieht, um dann doch den billigeren zu nehmen, ist der Verkäufer meist so nett, einen in der Wahl zu bestätigen. »Der ist bestimmt besonders haltbar«, sagt [14] er tröstend. Oder gar: »Den hätte ich auch genommen.«
So machten es die Trimbles – Experten in der Kunst, das Zweitbeste zum Besten hochzureden.
»Das kann man gut im Haus tragen«, pflegten sie zu sagen, oder: »Wir warten lieber, bis wir uns was wirklich Schönes kaufen können.«
Als ich so weit gekommen war, wurde mir klar, dass ich über die Trimbles nicht würde schreiben können. Es waren sympathische Leute, und eine Geschichte über ihr weiteres Schicksal hätte ich mit Vergnügen gelesen, aber ich selbst schaffte es nicht, unter die äußere Hülle ihres Lebens zu sehen, ich kam nicht dahinter, warum sie sich damit zufriedengaben, aus den Umständen das Beste zu machen, statt die Umstände zu ändern. Deshalb habe ich sie aufgegeben.
Ein anderes Thema sind Hundegeschichten. Ich mag Hunde und würde gern wenigstens eine Hundegeschichte im Stil von Mr. Terhune schreiben, aber sehen Sie mal, was passiert, wenn ich zur Feder greife:
[15] DOGDie Geschichte eines Hündchens
An der Ecke nur ein Zeitungsverkäufer mit verwittertem Gesicht, der seine Blätter feilbot. Ein großer Hundefreund am Straßenrand lachte verächtlich und schlug den Kragen seines Airedale-Mantels hoch. Ein anderer reicher Hundemensch ließ aus einem vorüberfahrenden Taxi ein kurzes abschätziges Bellen hören.
Doch den Zeitungsverkäufer interessierte der Vierbeiner, der sich ganz nah an ihn herangeschlichen hatte. Es war nur ein Straßenköter – das krause Fell hatte er von der Mutter, einer modischen Pudeldame, während er von der Figur her seinem Vater, einer Dänischen Dogge, nachschlug. Dass irgendwo auch ein Kanarienvogel mitgemischt hatte, verriet ein gelbes Federbüschel, das aus seinem Rücken spross…
So konnte das natürlich nicht weitergehen. Man denke nur an die Hundebesitzer aus allen Ecken des Landes, die Leserbriefe an die Redaktion schreiben und erklären würden, ich sei der falsche Mann für den Job.
Ich bin sechsunddreißig Jahre alt. Seit achtzehn Jahren ist – mit einer kurzen Unterbrechung [16] während des Krieges – das Schreiben meine Hauptbeschäftigung, und ich bin in jedem Sinne ein Profi. Trotzdem überkommt mich auch jetzt noch, wenn wieder einmal der Ausruf »Das Baby braucht Schuhe!« ertönt und ich mich vor meine gespitzten Bleistifte und meinen Schreibblock setze, ein Gefühl grenzenloser Hilflosigkeit. Es kommt vor, dass ich meine Erzählung in drei Tagen herunterschreibe, häufiger aber dauert es sechs Wochen, bis ich etwas zustande bringe, das ich guten Gewissens abliefern kann. Manchmal schlage ich einen Band aus einer Sammlung von Strafrechtsfällen auf und finde tausend Plots. Manchmal streife ich über Straßen und Wege, durch Stube und Küche und höre mir private Enthüllungen an, die Schriftstellerkollegen für ein ganzes Leben reichen würden. Bei mir geht das alles ins Leere und langt nicht einmal für einen Fehlstart.
Meist wiederholen wir Schriftsteller uns – das ist nun einmal so. Wir machen zwei oder drei große, bewegende Erfahrungen im Leben, Erfahrungen, die so groß und bewegend sind, dass uns in diesem Augenblick scheint, kein Mensch habe je zuvor so in der Tinte gesessen, sei so geprügelt und geblendet und überrascht und besiegt und gebrochen und errettet und erleuchtet und belohnt und gedemütigt worden. Dann lernen wir unser Handwerk – ordentlich oder weniger ordentlich – und erzählen unsere [17] zwei oder drei Geschichten – jedes Mal in neuem Gewand – zehnmal, hundertmal, so lange, wie man bereit ist, uns zuzuhören.
Verhielte es sich anders, müsste man sich dazu bekennen, dass es einem an Individualität fehlt. Ich bin jedes Mal ehrlich davon überzeugt, dass ich mich, weil ich eine neue Kulisse, eine neue, originelle Wendung gefunden habe, von meinen zwei oder drei Basisgeschichten gelöst habe, das Ergebnis aber ähnelt Ed Wynns berühmter Anekdote von dem Bootsmaler, der von einem Auftraggeber gebeten wurde, dessen Vorfahren zu malen. Die beiden wurden handelseinig, allerdings wies der Maler vorsorglich darauf hin, dass die Ahnen ihm vermutlich wie Boote geraten würden.
Wenn ich akzeptiere, dass meine Storys alle eine gewisse Familienähnlichkeit aufweisen, ist das ein Schritt zur Vermeidung von Fehlstarts. Behauptet ein Freund, er habe eine Geschichte für mich, und erzählt mir des Langen und Breiten, wie er von brasilianischen Piraten in einer schwankenden Strohhütte am Rand eines rauchenden Vulkans in den Anden überfallen wurde, während seine Braut gefesselt und geknebelt auf dem Dach lag, nehme ich ihm durchaus ab, dass dabei die verschiedensten menschlichen Emotionen im Spiel waren, aber da ich bisher Piraten, Vulkane und auf Dächern [18] gefesselte und geknebelte Bräute tunlichst gemieden habe, kann ich sie nicht nachempfinden. Unabhängig davon, ob etwas vor zwanzig Jahren oder erst gestern passiert ist – ich muss immer von einer Empfindung ausgehen, die mir nahegeht und die ich nachvollziehen kann.
Im Sommer brachte man mich mit hohem Fieber und Verdacht auf Typhus ins Krankenhaus. Meine Angelegenheiten waren nicht besser geordnet als die Ihren, geschätzter Leser – ich hätte dringend eine Story schreiben müssen, um meine Schulden zu bezahlen, und dass ich kein Testament gemacht hatte, lag mir schwer auf der Seele. Hätte ich wirklich Typhus gehabt, hätte ich mir über derlei Dinge nicht den Kopf zerbrochen und auch nicht so ein Theater gemacht, als die Krankenschwestern versuchten, mich in ein Eisbad zu stecken. Sowohl der Typhus als auch das Eisbad sind mir erspart geblieben, trotzdem haderte ich mit dem Schicksal, dass ich gerade in dieser entscheidenden Phase meines Lebens zwei Wochen im Bett vertrödeln, mich auf die Babysprache der Schwestern einlassen musste und nichts erledigen konnte. Drei Tage nach meiner Entlassung aber hatte ich eine Krankenhausstory zu Ende geschrieben.
Langsam, ohne es zu merken, hatte ich den Stoff aufgesogen – ich war zutiefst bewegt von Angst, [19] Befürchtungen, Sorge, Ungeduld, alle Sinne waren hellwach, und das sind ideale Voraussetzungen, um Stoff für eine Story zu sammeln. Leider geht das nicht immer so mühelos. Ich sage mir (mit Blick auf den schaurig leeren Block): »Da gibt es doch diesen Swankins, den ich seit zehn Jahren kenne und schätze. Ich bin in alle seine Eskapaden eingeweiht, und manche sind echte Knaller. Ich habe ihm angedroht, über ihn zu schreiben, und er hat gesagt, ich soll tun, was ich nicht lassen kann.«
Leichter gesagt als getan. Ich habe mindestens so oft in der Klemme gesteckt wie Swankins, aber ich bin an die Sache anders herangegangen als er; nie wäre es mir in den Sinn gekommen, mich mit der von Swankins gewählten Methode der chinesischen Polizei oder den Klauen eines gewissen weiblichen Wesens zu entziehen. Ich könnte ein paar durchaus brauchbare Absätze über Swankins schreiben, aber eine Geschichte um ihn herumzubauen, in der auch nur ein Hauch von Gefühl steckt, wäre für mich ein Ding der Unmöglichkeit.
Oder nehmen wir eine junge Frau namens Elsa, deretwegen ich 1916 an Selbstmord dachte und die jetzt in meinen ratlosen Überlegungen auftaucht.
»Wie wär’s mit mir?«, fragt Elsie. »Damals hast du doch hoch und heilig deine Gefühle für mich beschworen. Hast du das vergessen?«
[20] »Nein, Elsie, ich habe es nicht vergessen.«
»Dann schreib eine Story über mich. Du hast mich vor zwölf Jahren zum letzten Mal gesehen und weißt deshalb nicht, wie dick ich geworden bin und wie sehr ich meinen Mann anöde.«
»Nein, Elsie, ich…«
»Komm schon – für eine Story gebe ich doch bestimmt was her. Damals hast du beim Abschiednehmen nie ein Ende gefunden und dabei ein so unglückliches und drolliges Gesicht gemacht, dass ich fast verrückt geworden bin, bis ich dich endlich los war. Und jetzt traust du dich nicht mal, eine Story über mich auch nur anzufangen? Deine Gefühle müssen ziemlich halbherzig gewesen sein, wenn du sie nicht mal für ein paar Stunden wiederbeleben kannst.«
»Nein, Elsie, versteh doch. Ich habe bestimmt zehn-, zwölfmal über dich geschrieben. Dass du immer so lustig die Lippen hochgezogen hast wie ein Kaninchen – das habe ich vor sechs Jahren in einer Story verwendet; wie sich unmittelbar vor dem Lachen dein ganzes Gesicht veränderte, was so typisch für dich war – das habe ich auf die erste junge Frau übertragen, über die ich je geschrieben habe; wie ich beim Verabschieden nie die Kurve gekriegt habe und dabei genau wusste, dass du zum Telefon rennen würdest, sobald die Haustür hinter mir [21] zugefallen war – all das steht in einem Buch, das ich vor langer, langer Zeit geschrieben habe.«
»Verstehe… Nur weil ich nicht auf dich geflogen bin, hast du mich auseinandergenommen und stückweise verarbeitet.«
»Tut mir leid, Elsie, aber so ist es. Du hast mir ja nie auch nur einen Kuss gegeben – bis auf das eine Mal, als du mich gleichzeitig weggeschubst hast, und das taugt nun mal nicht zu einer Story.«
Plots ohne Gefühle, Gefühle ohne Plots – so geht es manchmal. Aber nehmen wir an, ich sei losgelaufen – zweitausend Worte, die Arbeit von zwei Tagen, sind fertig und werden als erster Entwurf zum Tippen gegeben. Und plötzlich kommen die Zweifel.
Wenn das alles nun nichts als sinnloses Gelaber ist? Was spielt sich bei dieser Regatta überhaupt ab? Wen interessiert es, was einer jungen Frau widerfährt, aus der so sichtbar das Sägemehl rinnt? Wie habe ich es bloß fertiggebracht, die Handlungsstränge so hoffnungslos zu verheddern? Ich bin allein in meinem blassblauen Zimmer mit meiner kranken Katze, den kahlen Februarzweigen, die sich vor dem Fenster hin- und herbewegen, einem ironischen Briefbeschwerer mit der Aufschrift »Das Geschäft geht gut«, einem (in Minnesota herangereiften) Neuengland-Gewissen und meinem größten Problem: »Weiterlaufen? Oder umkehren?«
[22] Soll ich sagen: »Ich weiß, dass ich etwas beweisen wollte, und im Lauf der Story könnte sich da noch etwas entwickeln!«
Oder:
»Sei kein Sturkopf – am besten wirfst du alles weg und fängst noch mal von vorn an.«
Letzteres ist eine der schwersten Entscheidungen, die ein Schriftsteller zu treffen hat; sie gelassen zu treffen, ehe er sich in einem hundertstündigen Versuch aufgerieben hat, eine Leiche wieder zum Leben zu erwecken oder zahllose nasse Knoten zu entwirren – daran zeigt sich, ob er ein echter Profi ist oder nicht. Oft ist so eine Entscheidung doppelt schwierig – in den letzten Phasen eines Romans etwa, wenn es nicht mehr darum gehen kann, das ganze Werk in den Papierkorb zu befördern, wohl aber, eine Lieblingsfigur bei den Füßen zu packen und unter Protestgeschrei herauszuzerren, auch wenn sie dabei fünf, sechs gute Szenen mitnimmt.
An dieser Stelle verbinden sich diese Geständnisse mit einem Problem, das nicht nur Schriftsteller beschäftigt, sondern das allgemeiner Natur ist. Wann es besser ist loszulassen, als sich abzuzappeln und seinen Mitmenschen auf die Nerven zu fallen – vor dieser Entscheidung steht jeder im Lauf seines Lebens oft genug. Wenn wir jung sind, bringt man uns als relativ simple Spielregel bei, nie aufzugeben, [23] weil die Programme, die wir abspulen, von Menschen ersonnen wurden, die vermutlich klüger sind als wir. Ich persönlich bin zu dem Schluss gekommen, dass man, wenn der eingeschlagene Weg immer zweifelhafter wird und einen das Gefühl beschleicht, dass die Lebenskräfte zu versiegen drohen, am besten jemanden um Rat fragt, sofern ein vernünftiger Ratgeber greifbar ist. Columbus tat es nicht, Lindbergh konnte es nicht – weshalb meine Haltung auf den ersten Blick in ketzerischem Widerspruch zu jener Idee steht, mit der es sich am angenehmsten lebt – mit der Idee des Heroismus. Aber ich trenne hier scharf zwischen dem Berufsleben, in dem nach der Lehrzeit allenfalls zehn Prozent der Ratschläge, die man bekommt, noch etwas wert sind, und dem privaten und weltlichen Leben, in dem oftmals ein Außenstehender die Lage besser beurteilen kann als man selbst.
Vor nicht allzu langer Zeit, als meine Arbeit von so vielen Fehlstarts behindert wurde, dass ich dachte, nun sei endgültig alles aus, und es in meinem Privatleben noch trüber aussah, fragte ich einen alten Neger aus Alabama:
»Onkel Bob, wenn du so schlimm dran bist, dass du keinen Ausweg mehr siehst, was machst du dann?«
Die Hitze vom Küchenherd, an dem er sich [24] wärmte, kräuselte seinen weißen Backenbart. Wenn ich als alter Zyniker eine Platitude erwartet hatte, einen vielleicht aus Uncle Remus in Erinnerung gebliebenen Sinnspruch, wurde ich enttäuscht.
»Dann, Mr. Fitzgerald«, sagte er, »gibt’s für mich nur eins – ich tu arbeiten.«
Es war ein guter Rat: Arbeit ist fast das Wichtigste von allem. Schön wäre es freilich, wenn es einem gelänge, nützliche Arbeit von bloßer aufgewandter Mühe zu unterscheiden. Vielleicht ist das Teil der Arbeit: den Unterschied zu erkennen. Womöglich sind meine häufigen einsamen Umrundungen der Aschenbahn etwas Konstruktives. Ich könnte Ihnen da noch eine Geschichte erzählen, von einer Idee, die ich hatte – aber wenn ich die Seiten zähle, stelle ich fest, dass meine Zeit abgelaufen ist und ich mein Buch der Irrwege weglegen muss. Ins Feuer damit? Nein, ich packe es brav zurück in die Schublade. Diese alten Fehler sind jetzt einfach Spielsachen, kostspielige Spielsachen. Gönne ihnen ein Spielzeugregal, und begib dich schleunigst wieder an das seriöse Geschäft deines Berufs, das kein anderer Zeitgenosse so klar und anschaulich formuliert hat wie Joseph Conrad:
»Meine Aufgabe ist es, euch durch die Macht des geschriebenen Wortes zum Hören zu bringen, zum Fühlen und vor allem zum Sehen.«
[25] Es ist nicht sehr schwer, kehrtzumachen und noch einmal von vorn anzufangen, besonders wenn niemand zusieht. Das große Ziel aber ist es, ein, zwei gute Läufe hinzulegen, wenn Zuschauer auf der Tribüne sitzen.
[26] Bernice’ Bubikopf
I
Wer am Samstagabend nach Einbruch der Dunkelheit am ersten Abschlag des Golfplatzes stand, konnte die Fenster des Countryclubs als gelben Streifen über einem sehr schwarzen welligen Ozean leuchten sehen. Die Wellen dieses Ozeans bestanden sozusagen aus den Köpfen etlicher neugieriger Caddies, einiger besonders vorwitziger Chauffeure sowie der tauben Schwester des Golftrainers. Dazu kamen meist ein paar verirrte, zaudernde Wellen, die hätten hineinschwappen können, wenn ihnen danach gewesen wäre; das war der Balkon.
Der erste Rang war drinnen. Er bestand aus einem Kreis von Korbstühlen, die ringsherum die Wände des kombinierten Club- und Ballsaals säumten. Auf den Samstagabendbällen pflegte er überwiegend weiblich besetzt zu sein: ein großes Babel reiferer Damen mit scharfem Auge und eisigem Herzen hinter Lorgnon und stattlichem Busen. Der erste Rang hatte vorwiegend kritische Funktion. [27] Bisweilen bekundete er widerstrebend Bewunderung, niemals aber Beifall, denn unter Damen jenseits der fünfunddreißig gilt es als ausgemacht, dass das junge Volk, das sich im Sommer zum Tanzen versammelt, dies nur mit den schlechtesten Absichten der Welt tut, und wenn man es nicht mit steinernen Blicken bombardiert, wird so manches verirrte Paar in einer Ecke des Ballsaals seltsame, barbarische Intermezzi tanzen, und die attraktiveren, gefährlicheren Mädchen werden sich womöglich in den draußen geparkten Limousinen ahnungsloser ehrbarer Damen küssen lassen.
Und doch ist dieser Kreis von Kritikerinnen der Bühne nicht nah genug, um die Gesichter der Darsteller zu erkennen und die feiner gesponnene Nebenhandlung zu verfolgen. Er kann nur die Nase rümpfen und raunen, Fragen stellen und aus seinen Axiomen befriedigende Schlüsse ziehen, wie etwa jenen, dass jeder junge Mann mit hohem Einkommen das Leben eines gejagten Rebhuhns führt. Für die Dramatik der wechselvollen und oft grausamen Welt der Heranwachsenden hat er letzten Endes kein Verständnis. Nein; Logen, Orchestergraben, Hauptdarsteller und Chor werden von jenem Potpourri aus Gesichtern und Stimmen gebildet, die sich im wehmutsvollen afrikanischen Rhythmus von Dyers Tanzkapelle wiegen.
[28] Von dem sechzehnjährigen Otis Ormonde, der noch zwei Jahre an der Hill School vor sich hat, bis zu G. Reece Stoddard, über dessen heimischem Schreibtisch ein Diplom der Harvard Law School hängt; von der kleinen Madeleine Hogue, der das hochgesteckte Haar oben auf ihrem Kopf immer noch komisch und nicht geheuer vorkommt, bis zu Bessie MacRae, die schon ein wenig zu lange – seit über zehn Jahren – der Herzschlag jeder Party ist, beherrscht dieses Potpourri nicht nur das Geschehen auf der Bühne, sondern schließt auch diejenigen ein, die allein eines unverstellten Blicks darauf fähig sind.
Mit Tusch und Paukenschlag endet die Musik. Die Paare tauschen ein gekünsteltes, leichtfertiges Lächeln, summen noch einmal spielerisch »la-di-da-da-dum-dum«, und schon übertönt das Geschnatter junger Frauenstimmen den Applaus.
Ein paar enttäuschte Herren, die noch mitten auf der Tanzfläche standen, wo sie eben ein Mädchen hatten abklatschen wollen, zogen lustlos von dannen, denn hier ging es nicht zu wie auf den wilden Weihnachtsbällen – diese sommerlichen Tanzereien, auf denen selbst die jüngeren Ehepaare sich zum nachsichtigen Amüsement ihrer jüngeren Geschwister erhoben und altmodische Walzer oder furchtbare Foxtrotts tanzten, galten bloß als angenehm lau und vergnüglich.
[29] Warren McIntyre, der zwanglos in Yale studierte, war einer der glücklosen Herren, und so tastete er in seiner Jackentasche nach einer Zigarette und schlenderte hinaus auf die große schummrige Veranda, wo überall Pärchen an den Tischen saßen und die laternenbehängte Nacht mit vagen Wörtern und diesigem Gelächter füllten. Hier und da nickte er einem weniger versunkenen Pärchen zu, und alle naselang erstand ein halbvergessenes Fragment irgendeiner Geschichte in seinem Kopf, denn die Stadt war nicht groß, und jeder gehörte ins Who’s who der Vergangenheit aller anderen. Dort zum Beispiel saßen Jim Strain und Ethel Demorest, die seit drei Jahren heimlich verlobt waren. Alle wussten, dass sie ihn heiraten würde, sobald es ihm gelänge, mehr als zwei Monate dieselbe Arbeitsstelle zu behalten. Aber wie gelangweilt sie beide aussahen und wie müde Ethel Jim manchmal anschaute, als fragte sie sich, warum sie die Ranken ihrer Zuneigung an einer so windzerzausten Pappel hochgezogen hatte.
Warren war neunzehn und bedauerte all seine Freunde, die nicht im Osten aufs College gingen. Doch wie die meisten jungen Männer gab er gewaltig mit den Mädchen seiner Heimatstadt an, solange er selber nicht dort war. Da war zum Beispiel Genevieve Ormonde, die regelmäßig bei den Bällen, Privatpartys und Footballspielen in Princeton, [30] Yale, Williams und Cornell auftauchte; oder die schwarzäugige Roberta Dillon, in ihrer Generation ähnlich berühmt wie Hiram Johnson oder Ty Cobb; und natürlich war da Marjorie Harvey, die nicht nur ein feengleiches Gesicht und ein sagenhaftes, verblüffendes Mundwerk hatte, sondern auch, ganz zu Recht, bewundert wurde, weil sie beim letzten Pumps- und Slipperball in New Haven fünf Räder hintereinander geschlagen hatte.
Warren, der als Junge Marjorie gegenüber gewohnt hatte, war lange Zeit »verrückt nach ihr« gewesen. Manchmal schien sie seine Gefühle mit einer gewissen Dankbarkeit zu erwidern, doch sie hatte ihn ihrem unfehlbaren Test unterzogen und ihm dann feierlich mitgeteilt, sie liebe ihn nicht. Der Test war, dass sie ihn vergaß und sich anderen Jungen zuwandte, sobald sie nicht in seiner Nähe war. Warren fand das entmutigend, zumal Marjorie den ganzen Sommer lang kleine Reisen unternommen hatte und er an den ersten zwei oder drei Tagen nach jeder Rückkehr auf dem Tisch in der Harvey’schen Eingangshalle stapelweise in diversen männlichen Handschriften an sie adressierte Briefe liegen sah. Zu allem Überfluss hatte sie den ganzen August über Besuch von ihrer Cousine Bernice aus Eau Claire, und es schien unmöglich, sich allein mit ihr zu treffen. Immer musste er erst jemanden auftreiben, der [31] bereit war, sich mit Bernice abzugeben. Je weiter der August voranschritt, umso schwieriger wurde das.
Sosehr Warren Marjorie auch verehrte, Cousine Bernice fehlte, wenn er ehrlich war, der Pep. Mit ihrem dunklen Haar und der frischen Gesichtsfarbe war sie zwar ganz hübsch, doch auf Partys war nichts mit ihr anzufangen. Jeden Samstagabend tanzte er Marjorie zuliebe einen langen, anstrengenden Tanz mit ihr, aber er hatte sich in ihrer Gesellschaft immer nur gelangweilt.
»Warren« – eine leise Stimme dicht hinter ihm unterbrach ihn in seinen Gedanken. Er drehte sich um und blickte in Marjories Gesicht, lebhaft und strahlend wie immer. Sie legte ihm eine Hand auf die Schulter, und er begann fast unmerklich zu leuchten.
»Warren«, flüsterte sie, »tu mir einen Gefallen – tanz mit Bernice. Sie kommt schon seit einer Stunde nicht von dem kleinen Otis Ormonde los.«
Warrens Leuchten erlosch.
»Ja – natürlich«, sagte er halbherzig.
»Es macht dir doch nichts aus, oder? Ich passe auch auf, dass du nicht bei ihr hängenbleibst.«
»Schon in Ordnung.«
Marjorie lächelte – jenes Lächeln, das Dank genug war.
»Du bist ein Engel, tausend Dank.«
Seufzend schaute der Engel sich auf der Veranda [32] um, doch Bernice und Otis waren nicht in Sicht. Er schlenderte wieder hinein, und dort, vor der Damengarderobe, entdeckte er Otis inmitten einer Gruppe junger Männer, die sich vor Lachen bogen. Otis schwang ein Holzscheit, das er in der Hand hatte, und hielt flammende Reden.
»Sie ist da drinnen und richtet sich das Haar«, verkündete er aufgeregt. »Ich warte hier, um noch eine Stunde mit ihr zu tanzen.«
Erneutes Gelächter.
»Warum tanzt ihr nicht auch mal mit ihr?«, rief Otis empört. »Über etwas mehr Abwechslung würde sie sich freuen.«
»Wieso denn, Otis«, sagte einer seiner Freunde, »du bist doch gerade erst mit ihr warm geworden.«
»Wozu das Holzscheit, Otis?«, fragte Warren lächelnd.
»Das Holzscheit? Ach, das hier? Das ist ein Knüppel. Wenn sie rauskommt, zieh ich ihr eins über und prügel sie wieder rein.«
Warren ließ sich auf ein Kanapee fallen und johlte vor Vergnügen.
»Keine Sorge, Otis«, brachte er schließlich heraus. »Ich erlöse dich dieses Mal.«
Otis simulierte einen plötzlichen Ohnmachtsanfall und reichte Warren das Holzscheit.
»Falls du’s brauchst, Alter«, sagte er heiser.
[33] Wie schön oder blitzgescheit ein Mädchen auch sein mag, der Ruf, nicht oft abgeklatscht zu werden, bringt sie auf jedem Ball in eine schlechte Position. Vielleicht ist den jungen Männern ihre Gesellschaft sogar lieber als die der Schmetterlinge, mit denen sie im Laufe eines Abends ein halbes Dutzend Mal tanzen, doch die Jugend dieser vom Jazz genährten Generation hat ein rastloses Temperament, und der Gedanke, mehr als einen vollständigen Foxtrott mit demselben Mädchen aufs Parkett zu legen, ist ihnen unangenehm, um nicht zu sagen zuwider. Kommt es zu mehreren Tänzen, einschließlich der Pausen, kann das Mädchen ziemlich sicher sein, dass ihr der junge Mann, einmal erlöst, nie wieder auf den störrischen Zehen herumtrampeln wird.
Warren tanzte den ganzen nächsten Tanz mit Bernice und begleitete sie schließlich, dankbar für die Pause, an einen Tisch auf der Veranda. Ein kurzes Schweigen trat ein, während sie wenig überzeugend mit ihrem Fächer wedelte.
»Es ist heißer hier als in Eau Claire«, sagte sie.
Warren unterdrückte einen Seufzer und nickte. Selbst wenn das stimmte, was kümmerte es ihn. Er fragte sich gelangweilt, ob sie schlecht Konversation machte, weil sie wenig Aufmerksamkeit bekam, oder ob sie wenig Aufmerksamkeit bekam, weil sie schlecht Konversation machte.
[34] »Bleiben Sie noch lange hier?«, fragte er und wurde ziemlich rot. Womöglich ahnte sie, warum er das wissen wollte.
»Eine Woche noch«, antwortete sie und starrte ihn an, als wollte sie sich auf seine nächste Bemerkung stürzen, sobald sie seine Lippen verließ.
Warren wurde unruhig. Dann beschloss er aus einer plötzlichen barmherzigen Laune heraus, es mit einem Teil seiner Masche bei ihr zu probieren. Er wandte sich ihr zu und schaute ihr in die Augen.
»Sie haben wirklich einen Mund zum Küssen«, begann er leise.
Das sagte er manchmal auf Collegebällen zu den Mädchen, mit denen er sich in genau solchem Halbdunkel wie hier unterhielt. Bernice zuckte sichtlich zusammen. Sie wurde ganz ohne Charme rot und hantierte linkisch mit ihrem Fächer. So etwas hatte noch nie jemand zu ihr gesagt.
»Frechheit!« – das Wort rutschte ihr so heraus, und sie biss sich auf die Lippen. Zu spät versuchte sie, amüsiert zu tun und ihm ein verwirrtes Lächeln zu schenken.
Warren ärgerte sich. Er war es gewohnt, dass seine Bemerkung nicht ernst genommen wurde, doch meistens erntete er ein Lachen oder ein paar Sätze gefühlsseliger Plänkelei. Und er mochte es überhaupt nicht, wenn man ihn frech nannte, außer, [35] es war scherzhaft gemeint. Seine barmherzige Laune verflog, und er wechselte das Thema.
»Jim Strain und Ethel Demorest hocken wieder mal zusammen«, sagte er.
Das lag schon mehr auf Bernice’ Linie, doch in ihre Erleichterung mischte sich ein leises Bedauern, als die Unterhaltung eine neue Wendung nahm. Männer sprachen mit ihr gemeinhin nicht über Münder, die zum Küssen waren, aber dass sie mit anderen Mädchen so oder ähnlich sprachen, das wusste sie durchaus.
»O ja«, sagte sie und lachte. »Angeblich krebsen sie seit Jahren ohne einen roten Heller herum. Ist das nicht albern?«
Warrens Ärger wuchs. Jim Strain war ein enger Freund seines Bruders, und er hielt es ohnedies für schlechten Stil, sich über Leute lustig zu machen, weil sie wenig Geld hatten. Aber Bernice hatte gar nicht die Absicht gehabt, sich lustig zu machen. Sie war nur nervös.
II
Als Marjorie und Bernice gegen halb eins nach Hause kamen, wünschten sie sich oben an der Treppe gute Nacht. Sie waren zwar Cousinen, aber keine [36] Freundinnen. Genau genommen hatte Marjorie keine einzige Freundin – sie fand Mädchen dumm. Bernice dagegen hatte sich während ihres ganzen von den Eltern arrangierten Besuchs durchaus danach gesehnt, jene mit Gekicher und Tränen gewürzten Vertraulichkeiten auszutauschen, die sie für einen unverzichtbaren Bestandteil allen weiblichen Miteinanders hielt. In dieser Hinsicht erschien ihr Marjorie jedoch eher kalt; irgendwie fiel es Bernice genauso schwer, mit ihr zu reden wie mit Männern. Marjorie kicherte nie, hatte nie Angst, war selten verlegen und besaß überhaupt wenige jener Eigenschaften, die Bernice bei einer Frau als geziemend und segensreich erachtete.
Während sie mit Zahnbürste und Zahnpasta hantierte, fragte sie sich zum hundertsten Mal, warum man ihr nie Beachtung schenkte, wenn sie von zu Hause fort war. Darauf, dass ihre Familie die reichste in Eau Claire war; dass ihre Mutter als großartige Gastgeberin galt, vor jedem Ball ein kleines Abendessen für ihre Tochter gab und ihr ein eigenes Auto gekauft hatte, hätte sie ihren gesellschaftlichen Erfolg daheim nie zurückgeführt. Wie die meisten Mädchen war sie mit der warmen Milch Annie Fellows Johnstons großgezogen worden und mit Romanen, in denen die weibliche Hauptperson geliebt wurde, weil sie gewisse geheimnisvolle frauliche [37] Eigenschaften besaß, die stets erwähnt, aber nie zur Schau getragen wurden.
Bernice verspürte einen leisen Schmerz, weil sie gegenwärtig alles andere als umschwärmt war. Sie wusste nicht, dass sie ohne Marjories Fürsprache den ganzen Abend mit ein und demselben Mann getanzt hätte; wohl aber, dass sich selbst in Eau Claire Mädchen von geringerer Stellung und Schönheit eines stürmischeren Andrangs erfreuten als sie. Ihrer Meinung nach lag das an einer subtilen Gewissenlosigkeit, die diesen Mädchen eigen war. Es hatte ihr nie Sorgen bereitet, und wäre es anders gewesen, hätte ihre Mutter ihr versichert, solche Mädchen würdigten sich selbst herab, und die Männer würden eigentlich Mädchen wie Bernice viel mehr Achtung entgegenbringen.
Sie löschte das Licht im Bad und beschloss aus einer Laune heraus, zu ihrer Tante Josephine hineinzugehen, bei der noch Licht brannte. Ihre weichen Pantoffeln trugen sie lautlos über den mit Teppich ausgelegten Flur, doch als sie hinter der halb geöffneten Tür Stimmen hörte, blieb sie stehen. Dann schnappte sie ihren eigenen Namen auf, und ohne es vorgehabt zu haben, lauschte sie an der Tür – und der Gesprächsfaden wirkte sich in ihr Bewusstsein, als zöge ihn jemand mit der Nadel hindurch.
[38] »Sie ist ein vollkommen hoffnungsloser Fall!« Das war Marjories Stimme. »Ja, ja, ich weiß schon, was du sagen willst! Etliche Leute haben dir erzählt, wie hübsch sie sei und wie lieb und wie gut sie kochen könne! Na und? Sie amüsiert sich kein bisschen. Die Männer mögen sie nicht.«
»Was zählt schon ein bisschen billige Beliebtheit?«
Mrs. Harvey klang verärgert.
»Alles, wenn man achtzehn ist«, sagte Marjorie entschieden. »Ich habe mein Bestes gegeben. Ich war nett zu ihr, ich habe die Männer gebeten, mit ihr zu tanzen, aber sie haben einfach keine Lust, sich zu langweilen. Wenn ich bloß an diesen schönen Teint denke, der an so eine graue Maus verschwendet ist, und daran, was Martha Carey daraus machen könnte – ach!«
»Es gibt heutzutage keinen Anstand mehr.«
Mrs. Harveys Stimme ließ erkennen, dass ihr die heutigen Zustände nicht in den Kopf wollten. Als sie jung war, hatten sich alle jungen Damen, die aus guten Familien stammten, prächtig amüsiert.
»Also«, sagte Marjorie, »kein Mädchen kann einer lahmen Ente von einem Gast ständig auf die Sprünge helfen. Heutzutage muss jedes Mädchen allein zurechtkommen. Ich habe ja sogar versucht, ihr kleine Tipps zu geben, für ihre Kleidung und so, aber da ist sie wütend geworden und hat mich ganz [39] komisch angeguckt. Sie ist feinfühlig genug, um zu merken, dass sie hier nicht gut abschneidet, aber ich wette, sie tröstet sich damit, dass sie ja ach so tugendhaft ist, während ich viel zu leichtlebig und oberflächlich bin und es böse mit mir enden wird. Alle unbeliebten Mädchen denken so. Saure Trauben! Sarah Hopkins nennt Genevieve und Roberta und mich die Gardenienmädchen! Ich wette, sie würde zehn Jahre ihres Lebens und ihre europäische Ausbildung dafür geben, ein Gardenienmädchen zu sein, in das drei oder vier Männer gleichzeitig verliebt sind und das alle paar Schritte von einem anderen aufgefordert wird!«
»Mir scheint«, unterbrach Mrs. Harvey sie ziemlich müde, »du müsstest imstande sein, etwas für Bernice zu tun. Ich weiß wohl, dass sie nicht sehr lebhaft ist.«
Marjorie stöhnte auf.
»Lebhaft! Du liebe Zeit! Ich habe sie noch nie etwas anderes zu einem Jungen sagen hören, als dass es ja so heiß sei oder die Tanzfläche so voll oder dass sie nächstes Jahr in New York aufs College gehen werde. Manchmal fragt sie sie auch, was für einen Wagen sie fahren, und erzählt ihnen, was sie für einen hat. Wie aufregend!«
Ein kurzes Schweigen trat ein, ehe Mrs. Harvey ihren Refrain wieder anstimmte:
[40] »Ich weiß nur, dass nicht halb so liebenswerte und reizvolle Mädchen wie sie auch Erfolg haben. Martha Carey zum Beispiel ist stämmig und laut, und ihre Mutter ist entschieden gewöhnlich. Und Roberta Dillon sieht dieses Jahr so mager aus, als müsste sie mal zur Kur nach Arizona. Sie tanzt sich noch zu Tode.«
»Aber Mutter«, entgegnete Marjorie gereizt, »Martha ist fröhlich und wahnsinnig schlagfertig und sieht wahnsinnig schick aus, und Roberta ist eine phantastische Tänzerin. Sie wird schon seit Ewigkeiten von allen umschwärmt!«
Mrs. Harvey gähnte.
»Ich glaube, es ist dieses komische indianische Blut in Bernice’ Adern«, fuhr Marjorie fort. »Vielleicht kommen bei ihr die Gattungsmerkmale wieder durch. Indianerfrauen haben auch immer nur dagesessen und nichts gesagt.«
»Jetzt aber ab ins Bett mit dir, du dummes Kind«, lachte Mrs. Harvey. »Wenn ich geahnt hätte, dass du dir so etwas merkst, hätte ich’s dir nicht erzählt. Und das meiste von dem, was du sagst, halte ich für baren Unsinn«, fügte sie schläfrig hinzu.