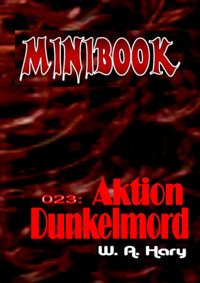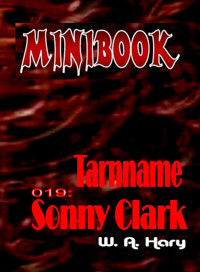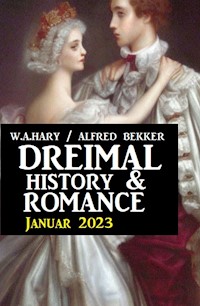
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CassiopeiaPress
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieser Band enthält folgende Romane (399XE) von W.A.Hary & Alfred Bekker: Die geheimnisvolle Marie Catrina und Ricardo Miranda und Jaffar Venedig, um das Jahr 1400… Ein zufälliges Treffen von Catrina und Ricardo, dem Straßenjungen, in Venedig ist schnell vergessen. Sie treffen nach Jahren wieder aufeinander, und die Verhältnisse haben sich grundlegend geändert. Nun muss Ricardo im Auftrag des Dogen einen Serienmörder suchen. Catrina will ihm trotz ihrer Blindheit helfen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 277
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alfred Bekker, W.A.Hary
Inhaltsverzeichnis
Dreimal History & Romance Januar 2023
Copyright
Die geheimnisvolle Marie
Catrina und Ricardo: Die venezianische Seherin 1
Miranda und Jaffar: Die Sarazenenbraut 1
Dreimal History & Romance Januar 2023
von Alfred Bekker und W.A.Hary
Dieser Band enthält folgende Romane
von W.A.Hary & Alfred Bekker:
Die geheimnisvolle Marie
Catrina und Ricardo
Miranda und Jaffar
Venedig, um das Jahr 1400…
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author
COVER: A. PANADERO
© dieser Ausgabe 2023 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Die geheimnisvolle Marie
Die Seherin von Paris 1
von W. A. Hary & Alfred Bekker
nach einem Exposé von Alfred Bekker
Frankreich 1680
Robert de Malboné wird geheimer Sonderermittler in den Diensten Ludwigs XIV., um einer okkulten Verschwörung um den so genannten „Circle Rufucale“ auf die Spur zu kommen, die das Ziel hat, den König zu einer willenlosen Marionette der Verschwörer zu machen.
Bei seinen Ermittlungen trifft er unter anderem auf Marie de Gruyére, eine geheimnisvolle und zunächst auch zwielichtige Schönheit, die in eingeweihten Kreisen „Die Seherin von Paris“ genannt wird, was er allerdings erst noch herausfinden muss.
Wieso ist er ausgerechnet von dieser Frau dermaßen fasziniert, dass sie ihm einfach nicht mehr aus dem Sinn gehen will, als habe sie ihn verhext?
Eine Faszination, die sie übrigens zu teilen scheint …
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author
nach einem Exposé von Alfred Bekker
Titelbild: Steve Mayer nach Motiven
© dieser Ausgabe 2021 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
1
Er sollte später oft an diesen Augenblick zurückdenken.
Den Moment, als er zum ersten Mal in ihre Augen sah.
Ihrem Blick begegnete.
Niemand hatte ihn je so angesehen.
Niemand.
Nicht auf diese ganz besondere Weise.
*
Die Vernunft sollte die Welt beherrschen, so dachte er. Nicht der Glaube. Und schon gar nicht der Aberglaube, wobei beides kaum zu unterscheiden ist...
Robert de Malboné war dreißig Jahre alt. Ein Mann, der von den Ideen Blaise Pascals fasziniert war. Er glaubte mithin lediglich an die reine Logik und die Erklärbarkeit aller Dinge. Die Mathematik, die in jenen Jahren, unter dem Regime von König Ludwig XIV., einen starken Aufschwung nahm, übte von daher gesehen einen besonders großen Reiz auf ihn aus, weil sie ganz offenbar dem Kundigen auf faszinierende Weise die Beziehung zwischen den Dingen logisch zu erklären vermochte.
Dem Glauben an das Übernatürliche hingegen – obzwar in seiner Zeit weit verbreitet und eher die Regel als die Ausnahme – stand er äußerst skeptisch gegenüber. Er war eben vielmehr der absoluten Überzeugung, dass es für jedes Phänomen eine streng logische Erklärung geben musste, und falls diese nicht allzu offensichtlich wurde, hatte man die Zusammenhänge eben noch nicht zur Gänze begriffen.
Allerdings glaubte er auch nicht an so etwas wie Zufälle. Nicht, dass er bei seiner Skepsis eher dem Schicksal und dem, was die Menschen darunter verstanden, den Vorzug gab. Nein, auch solches versuchte er rein logisch und nüchtern zu betrachten. Wenn also Seine Majestät, König Ludwig XIV., ihm mittels eines persönlich Beauftragten eine bindende Vorladung zukommen ließ, versuchte er sogleich, die wahre Absicht dahinter zu erkennen.
“In dem Schreiben, dass Ihr mir überbracht hab, steht nicht, worum es geht”, stellte Roberte de Malboné fest.
Der persönliche Beauftragte des Königs verzog das gepuderte Gesicht.
“Wenn der König es euch hätte mitteilen wollen, dann hätte er es zweifellos getan.”
“Nun…”
“Er braucht Eure Dienste, Monsieur de Malboné. Das muss Euch vorerst genügen, wie ich finde.”
“Natürlich.”
“Möglicherweise seid Ihr einer Krankheit anheim gefallen, die schon einige dahingerafft haben soll, Monsieur de Malboné.”
“Von welch einer Krankheit sprecht Ihr?”
“Von der Neugierde!”
“Oh!”
“Vor allem in ihrer übersteigerten Form.”
“Nun, vielleicht habt Ihr da sogar Recht.”
“Lasst Euch gesagt sein, dass diese Erkrankung tödlicher sein kann, als die Pest.”
Robert erwiderte den Blick des persönlichen Gesandten.
Ein Blick, der sehr ernst wirkte.
*
Es half allerdings nichts. Er musste der Vorladung auf jeden Fall Folge leisten. Ohnedies. Ob er nun wollte oder nicht. Niemand blieb fern, wenn der König, der sich selbst als eine Art antiker Gott dünkte – nach dem Vorbild römischer Imperatoren, falls er nicht einfach nur behauptete, er selbst sei der Staat und sonst nichts und niemand – nach einem verlangte. Robert würde zeitig dem königlichen Befehl Folge leisten. Koste es, was es wolle. Ob mit vernünftiger Erklärung dafür, wieso die Vorladung überhaupt erfolgte, oder auch ohne.
Obwohl sich im Stillen natürlich sogleich der bedrückende Verdacht breit machen wollte, es könnte unmöglich etwas Positives der Anlass sein. Wer war er denn schon? Der Sohn von Henri de Malboné. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Bislang hatte er den katholischsten aller Könige, wie sich Ludwig selber auch nannte, am liebsten nur von Weitem gesehen. Wobei er etwaige fehlende Nähe zu Seiner Majestät eben tatsächlich niemals bedauert hatte. Zum direkten Dunstkreis Seiner Majestät zu gehören durfte seiner Meinung nach nicht zwangsläufig als Vorteil gewertet werden. Vor allem nicht bei einem Skeptiker, wie Robert einer war. Schließlich hatte „der katholischste aller Könige“ maßgeblich dafür gesorgt, dass gerade auf Versailles, das mehr war als nur ein Königspalast, sondern vielmehr eine eigene Welt, weitgehend abgeschottet gegen die schnöde Wirklichkeit außerhalb, nicht nur der Glaube an Gott, sondern vor allem an Hexerei und die garantierte Wirksamkeit magischer Praktiken gang und gäbe wurden.
Zwar stand er auch im Ruf, während seiner Regentschaft Wissenschaft und Fortschritt einen regelrechten Schub gegeben zu haben, aber für Robert war das eher die Auswirkung des dominanten Aberglaubens, was letztlich die Kräfte der Vernunft beinahe zwangsläufig mobilisierte.
Ansonsten: Es war zwar angeblich streng geheim, und doch war einiges davon längst durchgesickert und hatte auch Robert de Malboné erreicht: Dass nämlich immer wieder Mätressen, Günstlinge, selbst Minister, dafür sorgten, dass der König beispielsweise eine sogenannte magische Substanz ins Essen gemischt bekam oder irgendwelche Zauberzeichen in seiner Nähe angebracht wurden.
Robert hatte Versailles bislang zu meiden versucht. Sofern es ihm möglich gewesen war. Dieses Eintauchen in eine Art Schattenwelt, losgelöst von allem, was sich außerhalb befand, sollte niemals auch noch seine Welt werden. Obwohl er als Sohn Henri de Malbonés durchaus zu diesem selbsternannt erlauchten Kreis hätte gehören müssen. Nicht nur, weil er adeligen Geblüts war. Denn Henri hatte immerhin zu jenen gehört, die sich während der sogenannten Fronde, einem Adelsaufstand in den Anfangsjahren von Ludwigs Herrschaft, ganz klar auf die Seite des Königs gestellt hatten.
Nicht nur von daher gesehen wäre es vielleicht sogar sicherer für ihn gewesen, ebenfalls hier sein Leben zu verbringen, obwohl er es persönlich als völlige Vergeudung angesehen hätte. Denn ob dieses Vorgangs damals, der ihn ja nur mittelbar über seinen Vater betraf, war er bei vielen Adeligen ziemlich verhasst. Man würde ihm wohl sogar nach dem Leben trachten, würde man nicht entsprechende Repressalien von Seiten des Königs befürchten müssen.
Der Gedanke daran faszinierte ihn auf einmal: War darin vielleicht sogar der Grund dafür zu sehen, dass er diese Vorladung bekommen hatte? Hatte es mit der Feindschaft so vieler Adeligen gegen seine Person zu tun, nur weil er ein unmittelbarer Abkömmling jenes Henri de Malboné war?
Er würde es erfahren, ja, erfahren müssen. Eben weil er sich der Vorladung nicht entziehen konnte. Unter anderem auch noch zusätzlich aus dem Grund, weil er als Adeliger eigentlich sogar gezwungen gewesen wäre, ständig im Schloss zu leben. Weil jeder französische Adelige hier wohnen und leben musste. In der Regel ohne Ausnahme. Vom König selbst so angeordnet.
Dass Robert de Malboné sich, obwohl als Adeliger eigentlich eher unbedeutend in diesem illustren Kreis der Erlauchten, das unerhörte Privileg herausnahm, hier nur hin und wieder Gast zu spielen in den hier seiner Person zugewiesenen Gemächern, hatte vielleicht sogar den späten Unmut des Königs erregt? Sollte er jetzt deshalb bei ihm vorsprechen, um seine diesbezügliche Strafe zu erfahren?
Jedenfalls rüstete er sich eilig für die nicht sehr weite Reise von Paris nach Versailles und bestieg rechtzeitig die Kutsche, die ihn, vom König selbst geschickt, dorthin bringen würde.
Unterwegs wuchs allerdings noch die Unruhe in seinem ohnedies schon aufgewühlten Inneren. Er spielte immer wieder alles in Gedanken durch, was ihm noch so in den Sinn kommen wollte, die gegenwärtigen Zustände auf Versailles berücksichtigend, die er ja durchaus gut genug kannte, wenngleich eher als nicht sehr häufiger Gast denn als ständiger Bewohner.
Eigentlich erschien ihm das Ganze höchst inoffiziell. Der Bote, der ihm mündlich den Befehl des Königs übermittelt hatte, jener gedrungen wirkende Bursche im Kapuzenumhang, war gleichzeitig der Kutscher?
Vielleicht hätte er sich so etwas wie Misstrauen leisten sollen? War er denn nun tatsächlich auf dem Weg zum König? Oder war das auf einmal nur eine Falle für ihn, vielleicht gestellt von jenen Adeligen, denen er verhasst war?
Er sah aus dem Fenster und konnte das Gegenteil feststellen: Die Kutsche war tatsächlich auf dem direkten Weg nach Versailles.
Und dann der Umstand, dass er auf jeden Fall ganz allein kommen musste. Niemand sonst durfte ihn begleiten. Außer eben dem Kutscher, der hoch oben auf dem Kutschbock saß, jetzt außerhalb seines Sichtbereiches.
Nun, die Heimlichkeit konnte gewährleistet werden. Schließlich war er als ein echter Malboné bisher hier ein- und ausgegangen, wie er es für richtig gehalten hatte. Es würde also keinerlei Aufsehen erregen, wenn er mit der Kutsche vorfuhr und es wider Erwarten jemand bemerken sollte. Wer sich an ihn zu erinnern vermochte, würde an einen der eher kurzen Besuche denken, weil er anscheinend mal wieder von schierer Neugierde geplagt wurde. Nichts weiter würde er sich dabei denken. Vor allem nicht, dass Robert de Malboné doch tatsächlich der persönlichen Vorladung Seiner Majestät folgen musste.
Man würde ihn nach der Ankunft sowieso auf möglichst direktem Weg in das Allerheiligste des Königs führen, zu dem nur solche überhaupt Zutritt erlangten, die der König höchst persönlich dazu ermächtigte. Wenn nicht, würde Robert wohl annehmen müssen, sein Misstrauen betreffend der Echtheit der königlichen Vorladung sei durchaus berechtigt.
Ja, Versailles. Das Leben hier glich einem einzigen Fest. Bis zu zehntausend Menschen lebten hier ständig. Das Ganze wurde wie eine niemals enden wollende Theaterinszenierung zelebriert.
Die Inszenierung des Königtums!, dachte Robert und gab sich dabei Mühe, dies nicht allzu abfällig zu meinen, obwohl er sicher sein konnte, dass niemand gerade seine Gedanken las. Weil das seiner Auffassung nach sowieso niemals jemand vermochte.
Mit dem einfachen Leben in den grauen Gassen von Paris hatte man hier auf jeden Fall nichts zu tun. Man ahnte hier noch nicht einmal etwas von den Lebensumständen der einfachen Leute, sondern hatte sich in einer gar mythisch überhöhten Traumwelt abgekapselt, deren Zentrum einzig und allein der König war. Unter den Mätressen und Günstlingen tobten ständig Auseinandersetzungen, während man nach außen hin sich gespielt fröhlich und in ununterbrochener Feierlaune präsentierte.
Es ging in Wahrheit für alle Beteiligten am Hofe vor allem nur darum: Den König zu beeinflussen, der von sich selbst sagte, er sei der Staat. Natürlich zu beeinflussen zum ureigenen Vorteil. In stetiger Konkurrenz zu allen und jedem, der die gleichen Motive hatte.
Und dann kehrte Robert in Gedanken wieder zu jenem Umstand zurück, den er von allen am meisten verabscheute, als Hauptgrund dafür, sein ständiges Wohnrecht – um nicht zu sagen seine Wohnpflicht – am Hofe für seine eigene Person lieber auch noch weiterhin auszusetzen, wider die ausdrückliche Anordnung Seiner Majestät, die ja wirklich für alle gelten sollte:
Eben der ausufernde Glaube an Hexerei und die Wirksamkeit magischer Praktiken.
Und als er schließlich wieder an dem Punkt angelangt war, dass dem König immer wieder Substanzen mit angeblich magischer Wirkung heimlich eingeflößt wurden und man irgendwelche Zauberzeichen in seiner Nähe anbrachte, glaubte er endlich, der Vorladung auf den wahren Grund gekommen zu sein: Schließlich hatte er niemals einen Hehl daraus gemacht, ein überzeugter Skeptiker von all diesem Humbug zu sein, wie er es nannte. War es da denn abwegig, anzunehmen, dass der König in einer diesbezüglichen Angelegenheit vielleicht seinen persönlichen Rat einholen wollte?
Näher betrachtet, kam ihm das sogleich wieder absurd vor. Weil er sich selbst eben als viel zu unwichtig einstufte, als dass der König sich persönlich ausgerechnet für ihn interessieren würde. Er war bislang eher der Meinung gewesen, der König würde es ihm deshalb durchgehen lassen, dass er nicht ständig am Hofe verweilte, weil er ihn glatt übersah.
Dann wäre er nach wie vor immerhin so unwichtig, dass er auch nicht wirklich Schlimmes befürchten musste, was ihn beim König erwartete. Oder?
Die Ungewissheit nagte erneut an seiner Seele und drohte, die Oberhand zu gewinnen. Nur die eine Tatsache, wie er sie sich immer wieder einhämmerte, verhinderte, dass er augenblicklich die Reise unterbrach und fluchtartig die Kutsche verließ, obzwar er noch niemals ein Feigling gewesen war: Er hatte nun einmal keine andere Wahl, als dem König vorzusprechen, wenn der König persönlich nach ihm verlangte!
Flucht wäre also ausgeschlossen. Nicht nur, weil sich die Neugierde irgendwo mit der bangen Erwartung die Waage hielt. Mit einem Ausschlag mal in die eine und mal in die andere Richtung. Was ja nun wirklich verständlich war, wenn man als bislang unwichtige Person auf einmal zwingend zur Audienz beim womöglich mächtigsten Mann seiner Zeit geladen war.
So tat er nichts dergleichen, blieb einfach sitzen, lauschte dem Klappern der Hufe, dem Scheppern der Räder und – wenn er sich ganz besonders darauf konzentrierte – dem Schnauben der trabenden Rösser.
Ab und zu auch noch dem Schnalzen des Kutschers, zuweilen begleitet vom Knallen seiner Peitsche, mit denen er seine Rösser zusätzlich dirigierte, zusätzlich zu den Zügeln. Ohne sie natürlich auch tatsächlich mit der Peitsche zu treffen. Robert hatte ja vor dem Einsteigen gesehen, dass die beiden Rösser sehr gepflegt waren. Gepflegter eigentlich als all diese dekadenten Adeligen im Dunstkreis von König Ludwig XIV.
Robert kannte ja die hygienischen Verhältnisse in Versailles. Er selbst hielt sie für katastrophal, obzwar gemäß seiner Zeit einiges gewöhnt. Kein Wunder seiner Meinung nach, dass auf Versailles Krankheiten bis zum viel zu frühen Tod sogar noch schlimmer kursierten als auf irgendeinem Bauernhof in der Provinz. Immer noch im Grunde genommen schlimmer gar als im ewigen Dreck der Gassen und Gässchen, aus dem Paris zum größten Teil bestand?
Wer die Zustände am Hofe sah, mochte wohl Probleme haben, wirklich zu glauben, dass Frankreich immerhin die mächtigste Nation der Welt sein sollte. Zumindest jedoch Europas. Mit ganzen zwanzig Millionen Einwohnern. Damit zwar weniger als Spanien und England mit jeweils nur fünf Millionen, aber kaum weniger als Deutschland, das dafür allerdings in hunderte von Kleinstaaten zerfallen war.
Nein, Robert bevorzugte eindeutig Paris als Lebensraum. Trotz des Schmutzes vor Ort. Vielleicht auch, weil dieser Schmutz und die grassierende Armut eine gar schaurige Parallelwelt zum wahrhaft gigantischen Hof von Versailles bot? Hier war die Lebenserwartung eben nicht nur für Seinesgleichen dennoch geringfügig besser noch als am Hofe, obzwar hier Seuchen und Armut grassierten.
Flüchtig dachte Robert in diesem Zusammenhang auch an die Formen organisierten Verbrechens, wie sie immer deutlicher zutage traten. Noch vermochten wohlhabendere Bürgerliche sich hier in Paris ausreichend zu schützen. Ja, noch. Auf das, was man in Paris zu jener Zeit Polizei nannte, konnte und wollte man sich nicht unbedingt verlassen. Da richtete man sich in seiner Stadtbehausung doch lieber gleich so ein wie in einer kleinen, irgendwie noch überschaubaren Festung. Mit entsprechendem Personal natürlich.
Zumal sich hier jeder städtische Angestellter Polizist nennen durfte, der die Gewalt der sogenannten Obrigkeit exekutierte. So etwas wie eine spezielle Ausbildung war für niemanden dabei vorgesehen. Es zählten dazu sogar Straßenkehrer, Nachtwächter und Abortreiniger.
Und wenn man es sich leisten konnte, warb man einfach die augenscheinlich besten von denen ab, um sie zu eigenen Hauswachen zu befördern. Wie nicht nur Robert es hatte tun müssen, sondern eben alle in Paris, die von der Armut und dem daraus erblühenden Verbrechen nicht unmittelbar betroffen waren. Um dies auch unbedingt beizubehalten.
Und dann war das Ziel erreicht und all jene Gedanken, ohnedies eher unerfreulicher Art, verblassten. Sie konnten ihn nicht mehr länger von dem ablenken, was nun unmittelbar bevor stand:
Die persönliche Audienz beim König!
Einem König mithin, der sich selbst eben nicht nur als Verkörperung des Staates, sondern in Anlehnung an römische Kaiser als antiken Gott stilisieren ließ. Sogar welcher Minister ihm beim Aufstehen den linken oder den rechten Ärmel seiner Jacke anziehen durfte, verdeutlichte, welche Position der Betreffende oder die Gruppe, die er vertrat, gegenwärtig innehatte.
Tatsächlich!
Der Adel hatte hier durchgängig Präsenzpflicht, hier auf und in Versailles. Was für den König einfach dem Zweck diente, mögliche Putschisten unter seiner direkten Kontrolle zu haben.
Abgesehen von mindestens einer Person: Robert de Malboné, der das Kunststück geschafft hatte, seine eingebildete Unwichtigkeit als Unauffälligkeit zu zelebrieren und dabei dennoch den Vorteil zu genießen, als Sohn jenes Henri de Malbonés insofern ein Günstling sein zu dürfen, dass er eben Versailles betreten und verlassen durfte, wie es ihm beliebte.
Außer hier und jetzt natürlich.
Der Kutscher war gleichzeitig sein Lotse und seine Eintrittskarte unmittelbar bei König Ludwig XIV. Das erwies sich jetzt also als eindeutig wahr. Keine wie auch immer geartete Falle, sondern tatsächlich eine überaus geheime Audienz bei Seiner Majestät.
Es galt, keinerlei Zeit mehr zu verlieren, um nicht die Geduld Seiner Majestät noch unnötig zu strapazieren.
2
Überwiegend war Paris dem Elend anheimgefallen. Nichts wies darauf hin, dass sich diese Stadt je zu einer echten, schillernden Metropole entwickeln würde. Doch das unsägliche Elend war nur die eine, die traurig-dominante Seite dieser Stadt, die im Dreck versank und teilweise in den eigenen Exkrementen. Es gab auch wenige schönere Seiten. Häuser außerhalb des größten Elends. Nicht nur diejenigen der etwas betuchteren Bürgerlichen mit ihren eigenen kleinen Hausarmeen, mit denen sie sich nicht nur selbst vor Übergriffen durch die allzu Armen schützten, sondern auch ihre Geschäfte, die nicht unbedingt der menschenfreundlichen Art waren.
Und dann gab es auch noch jene Gaukler und sogenannten Künstler, die nicht zum erlauchten Kreis derer gehören durften, die am Hofe für die Unterhaltung der Adelsgemeinde sorgten und von daher gesehen im wahrsten Sinne des Wortes kleinere Brötchen backen mussten. Neben weiteren Leuten, die einerseits zwar nicht zu den Betuchteren gehörten, andererseits jedoch auch nicht ganz dem Elend verfallen waren. Eine Art Grauzone dieser Minderheit, mochte man sagen. Man kannte sich untereinander, hielt aus verständlichen Gründen zusammen und genoss von daher gesehen einen gewissen gemeinschaftlichen Schutz, den man zum Überleben in dieser Stadt durchaus benötigte.
Eine davon nannte sich Madame de Marsini. Eine dunkelhaarige Schönheit von unbestimmbarem Alter, mit geheimnisvollen Augen und einem Lebenswandel, der durchaus ebenfalls mit der Umschreibung geheimnisvoll bezeichnet werden durfte.
Diejenigen, die zu jener mehr oder weniger verschworenen Minderheit gehörten und sie von daher gesehen hier in Paris zu kennen glaubten, nannten sie „die Seherin von Paris“, sie sich selbst jedoch vergleichsweise schlichter eine Wahrsagerin. In einer Zeit, in der Aberglauben das Volk bestimmte, neben dem Gottesglauben als einzige Hoffnung auf eine bessere Existenz, durchaus eine Tätigkeit, die einem beim Überleben helfen konnte. Wenn man sich dann auch noch mit Gleichgesinnten zusammengetan hatte, umso mehr.
Aber wussten die Gleichgesinnten auch, dass Madame de Marsini nicht nur eine Wahrsagerin in Paris war, sondern sich selbst an anderer Stelle beispielsweise Marie de Gruyére nannte?
Nicht nur das: Sie hatte sogar ihren zusätzlichen Wohnsitz ausgerechnet auf Schloss Versailles, wo man sie nur unter diesem Namen kannte.
Welcher war denn nun richtig und welcher war falsch? War sie die Adelige Marie de Gruyére, die unter anderem Namen hier in Paris ein verbotenes Doppelleben wie eine Bürgerliche führte, oder war sie umgekehrt eine, die in Paris als vorgeblich Bürgerliche lebte und außerdem auch noch am Hofe allen überzeugend weis zu machen verstand, eine von ihnen zu sein? Natürlich wiederum unter einem völlig anderen Namen?
Sicherlich gab es nur eine Person, die darüber hätte erschöpfend Auskunft geben können, und diese Person war eindeutig sie selbst. Niemand sonst. Weder hier in Paris, wo bei der von ihr angemieteten Wohnung einige Leute ein und aus gingen, in erster Linie anscheinend, um sich und ihren Liebsten die Zukunft wahrsagen zu lassen, noch einer der Adeligen am Hofe.
Madame de Marsini würde schweigen, selbst wenn man es wagen sollte, sie direkt darauf anzusprechen. Obwohl man dafür ja erst einmal über dieses Doppelleben hätte stolpern müssen. Wie denn, wenn man entweder aus Paris nicht heraus kam oder andererseits eben nicht aus Schloss Versailles?
So gab es in Paris eben nicht nur einen einzelnen Menschen, der zwischen beiden Welten hin und her wechseln konnte, sondern mindestens zwei. Die eine Person war dabei Robert de Malboné und die andere eindeutig Madame de Marsini, alias Marie de Gruyére. Obwohl sich beide Personen noch niemals in ihrem Leben je begegnet waren.
Bislang jedenfalls noch nicht!
Doch das sollte sich ändern, denn ihre Schicksalslonien waren anscheinend untrennbar miteinander verknüpft.
Nun, der Name Madame de Marsini passte durchaus zu einer Tätigkeit wie die einer Wahrsagerin. Das fand eigentlich jeder von denen, die sie hier kannten und schätzten. Um nicht zu sagen, liebten.
Immerhin eine Dame wie sie. An ihr war wirklich nichts Gewöhnliches. Sie konnte in jegliche Rolle schlüpfen. Niemand würde je Verdacht schöpfen. Ein Blick in ihre unergründlichen Augen, die mehr Geheimnisse versprachen als jeder andere je hätte haben können, würde sozusagen genügen. Eine Frau, die jeden für sich einnahm, der ihr begegnete. Für viele sogar so etwas wie eine überirdische Schönheit. Was auch immer man darunter verstehen mochte: Auf sie traf es auf jeden Fall zu.
Hier, in der Stadt, als Wahrsagerin, war sie natürlich bei Weitem nicht so festlich gekleidet wie während ihrer Aufenthalte als Marie de Gruyére im Schloss, mitten unter den Höflingen. Mit solcher Kleidung wäre sie dort nur unnötig aufgefallen, um nicht zu sagen: unangenehm sogar.
Für jene, die hingegen eine Wahrsagerin erwarteten, wenn sie zu ihr in diese Stadtwohnung kamen, wäre es umgekehrt befremdlich erschienen, hätte sie sich nicht eben wie eine solche gekleidet. Was für Madame de Marsini ja kein Problem bedeutete. Und wer würde eine Wahrsagerin schon fragen wollen, wieso sie zeitweise nicht erreichbar war in ihrer Wohnung und auch nirgendwo sonst in Paris? Genauso wenig wie man sie umgekehrt am Hofe fragte, wie sie die Zeit verbrachte, wenn sie nicht gerade mal wieder an den Dauerfestlichkeiten teilnahm.
Zumal sie niemanden so wirklich an sich heran ließ.
Man hatte sich zudem auch am Hofe daran gewöhnt, dass sie eine solch geheimnisvolle Frau war. Sowieso. Die einen, weil sie es für eine besondere Masche von ihr hielten, die anderen, weil sie gewissermaßen allein schon von ihrem Anblick dermaßen fasziniert waren, dass eine solche Frage ihnen überhaupt nicht in den Sinn kommen wollte.
Dabei war Marie de Gruyére nicht gerade das, was man als eine Person in dauernder Feierlaune bezeichnen konnte. Sie nahm zwar hin und wieder teil, aber ansonsten erschien sie eher unstet, war irgendwie fast überall im Schloss zuhause, tauchte mal hier und mal da auf. Nicht etwa, dass sie beschäftigt tat. Das wäre allerdings unangenehm aufgefallen, weil niemand am Hofe geschäftig tat, sofern er nicht zu den vielen fleißigen Helfern gehörte, die sich um das Wohl aller Erlauchten am Hofe kümmerten.
Madame de Marsini befand sich an jenem Tag, während ein gewisser Robert de Malboné noch unterwegs war mit der königlichen Kutsche in Richtung Versailles, in ihrer Wohnung inmitten einer kleinen Versammlung. Alles Getreue, denen sie ganz besonders vertrauen konnte, wie es schien. Obzwar sie keine Ahnung von ihrem Doppelleben hatten. Sie hätten es noch nicht einmal gewagt, sie nach so etwas zu fragen.
Sie löste schließlich die Versammlung auf und wartete erst noch ab, bis alle verschwunden waren und keiner von ihnen wieder zurückkehrte, etwa weil er noch etwas vergessen hatte. Dann hatte sie es plötzlich jedoch eilig. Denn sie beabsichtigte, wieder zurückzukehren ins Schloss. Auf dem üblichen Weg. Einem Weg, der immerhin so sicher war, dass sie bislang nicht ein einziges Mal aufgefallen war. Dafür war sie viel zu vorsichtig.
Und nicht nur das: Sie schloss trotz der gebotenen Eile jetzt erst noch fest die Augen und konzentrierte sich. So hoch konzentriert lauschte sie in sich hinein.
Sie konnte es nicht wirklich kontrollieren, aber wenn ihr tatsächlich die Gefahr der Entdeckung drohen würde, müsste sie es eigentlich vorher schon spüren können.
Falls ihre Gabe sie nicht schon wieder mal im Stich ließ, wohlgemerkt.
Denn Madame de Marsini nannte sich deshalb eine Wahrsagerin, weil sie fest davon überzeugt war, tatsächlich eine solche Begabung zu haben, eine besondere seherische Fähigkeit. Weshalb viele sie ja auch anstelle von Wahrsagerin sogar „Seherin von Paris“ nannten.
In Wahrheit war das allerdings bei ihr nicht besonders stark ausgeprägt. Weshalb sie ihre Hellsichtigkeit, Vorahnungen, Visionen oder wie auch immer man es nennen wollte, eben nicht so zuverlässig sich gab, wie sie es gern gehabt hätte.
In ihrem tiefsten Innern blieb alles ruhig. Sie wertete dies als gutes Zeichen, kleidete sich jetzt wirklich in aller Eile um, warf noch zur zusätzlichen Tarnung einen grauen, unscheinbaren und somit unauffälligen Umhang über, vergaß nicht, die Kapuze über ihr dunkel gelocktes Haar zu ziehen, damit sie halb ihr Gesicht verdeckte, und verließ die Wohnung durch den geheimen Hintereingang. xxx
“Madame de Marsini!”, rief ihr ein bettelnder Zwerg hinterher, nachdem sie das Gebäude verlassen hatte.
“Was willst du?”
“Du könntest mir die Zukunft vorhersagen!”
“Kannst du das bezahlen?”
Der Zwerg lachte. “Nein!”
“Na, also!”
“Ich könnte darauf achten, dass bei dir niemand einbricht”, schlug der Zerg vor.
Sie sah ihn an. Ihr Lächeln wirkte freundlich. Freundlich, aber geheimnisvoll und sehr hintergründig. xxx
3
Undenkbar, dass sich Ludwig XIV. anlässlich einer für ihn selbst offensichtlich wichtigen Angelegenheit nicht im größten Prunk präsentierte. Das war zwar genau das, was Robert sowieso schon erwartete, als er zum Eintreten aufgefordert wurde, doch dann konnte er sich von eigenem Augenschein her davon überzeugen.
Und er musste zwangsläufig Seine Majestät ansehen, um nur ja keinen Fingerzeig zu übersehen, egal wie geringfügig er auch erscheinen mochte.
Ansonsten allerdings war der Raum ganz und gar nicht so sehr auf Prunk und Repräsentation ausgelegt, handelte es sich doch eher um einen kleinen Audienzsaal, geeignet nur für entsprechend kleine Runden.
So lange blieb er an der Tür stehen, die sich hinter ihm schloss, bis er die Erlaubnis bekommen würde, näher zu treten.
Dabei fiel ihm noch etwas auf. Er war doch tatsächlich allein hier mit Seiner Majestät!
Erschien ihm schon die erzwungene Audienz als höchst ungewöhnlich, so erschien ihm noch weit ungewöhnlicher die Tatsache, dass Seine Majestät ihn völlig schutzlos empfing. Hieß es denn nicht, er sei sprichwörtlich das Musterbeispiel an Misstrauen und Vorsicht?
Jetzt machte Ludwig ein herrisches Handzeichen, das seinen Gast näher treten ließ.
Robert tat, wie ihm befohlen, in eindeutiger Demutshaltung, den Rücken gebeugt, den Blick nach unten gerichtet. Das rundliche, beinahe jugendlich wirkende Gesicht Seiner Majestät sah er nicht mehr, aber die Hände und die ungewöhnlich schlank erscheinenden Beine in eng geschneiderten Beinlingen.
All die üppig verwendeten Stoffe der kostbarsten Art, die ansonsten seinen königlichen Leib verhüllten, ließen nur vermuten, in welch körperlicher Verfassung der König war, der sich zusätzlich zu all seinen großherrlichen Beinamen auch noch Sonnenkönig nannte. Aus einfachem Grund, denn zu jener Zeit setzte sich in der Wissenschaft mehr und mehr die Erkenntnis durch, dass nicht die Erde, sondern die Sonne Mittelpunkt von allem war. Was also lag näher, als die Sonne zu seinem eigenen Symbol zu machen, ihm, als dem absoluten Mittelpunkt der Menschenwelt?
In immer noch gebührendem Abstand zum – hier im Audienzraum kleineren Ausführung – stilisierten Thron fiel Robert erwartungsgemäß auf die Knie, beugte sich weiter vor und stützte sich mit beiden Händen am Boden auf.
„Robert de Malboné!“, sagte Ludwig XIV. laut und deutlich.
Nein, das klang nicht danach, als würde sein Gast Schlimmes befürchten müssen. Ganz im Gegenteil. Zumal diese besondere Atmosphäre, sozusagen intimerer Art, da es keinerlei Zeugen gab, bereits entsprechende Vermutungen zugelassen hatte.
Robert wagte es dennoch nicht, sich zu rühren. Er wartete lieber erst einmal ab.
„Ihr seid der Sohn des Eurem König treu gedienten teuren Henri de Malboné, der Eurem König zu einem wahren Freund wurde. Seit Langem hält Euer König Euch daher unter Beobachtung. Seine Majestät kennt Euch besser als Ihr Euch selbst, wie zu vermuten ist. Und es ist obendrein anzunehmen, dass Ihr nichts von alledem bislang bemerken konntet?“
Robert sah sich bemüßigt, darauf zu antworten, ohne es zu wagen, dabei den Blick zu heben.
„Nein, Eure Majestät, mit Verlaub gesagt. Nichts dergleichen wurde von mir wahrgenommen.“
„Oh, das ist gut. Sehr gut sogar. Gut für jene, die in den königlichen Diensten stehen und für diese Beobachtung zuständig waren. Um nicht zu sagen: Überwachung. Euer großherrlicher König und Gönner von Gottes Gnaden musste sicher sein, und das gelang schon länger. Sicher sein, dass es wirklich niemanden sonst gibt, dem Euer König in solchem Maße vertrauen könnte, weil ansonsten wirklich niemand mehr vertrauenswürdig erscheint. Aus gutem Grund, wie Ihr noch erfahren werdet, sofern Ihr nicht ohnedies schon Euch denken könnt, worauf Euer König hinaus will. Denn genau aus diesem Grund seid Ihr schließlich hier, direkt vor Eurem König.
Aber Schluss jetzt mit dem höfischen Gebaren. Steht auf, Robert de Malboné! Erhebt euch zu Eurer vollen Größe. Lasst mich, Euren König, Euch betrachten, von Kopf bis Fuß. Ich will wissen, wie der Mann aussieht, dem ich so sehr vertraue – ja, vertrauen muss.“
Robert seinerseits traute dem selber nicht so ganz. Er hatte größte Mühe, sich aus der Demutshaltung zu erheben und aufzustehen. Immerhin vor Seiner Majestät, dem König von Frankreich, mithin für so viele tatsächlich wie die Inkarnation eines wahren Gottes. Sogar für seine Feinde. Obwohl sie tatsächlich alles zu tun schienen, was ihnen in den Sinn kam, um seiner Erhabenheit Herr zu werden.
Niemandem schien es bislang gelungen zu sein. Soviel stand für Robert fest. Obwohl ihn durchaus beispielsweise sogar seine Mätresse Madame de Montespan angeblich mit allerlei Mixturen der mystischen Art zur Willfährigkeit hatte bringen wollen. Zwölf Jahre lang war Untersuchungsrichter La Reynie damit beauftragt gewesen, Beweise für diese Schändlichkeit zu sammeln. Was ihm niemals wirklich überzeugend gelungen war. Es blieb ein Gerücht, sicherlich nicht ausreichend genug, drastische Maßnahmen zu ergreifen. Zumal Ludwig XIV. gerade sie betreffend durchaus Skrupel hatte. Immerhin hatte er sechs der Kinder, die Madame de Montespan ihm als Maîtresse en titre geschenkt hatte, offiziell anerkannt. So hieß es am Hofe sogar, er habe die wenigen Beweise, obzwar bei Weitem noch unzureichend, ausdrücklich verbrennen lassen, um Madame im Nachhinein zu entlasten.
Nur die Gerüchte blieben eben bestehen und gaben sich unausrottbar. So zum Beispiel auch das Gerücht, sie habe schon im Jahre des Herrn 1666 an verbotenen sogenannten Schwarzen Messen teilgenommen. Es gab sogar einen Namen. Genannt wurde in diesem Zusammenhang der Priester Etienne Guibourg, der zu diesem Zeitpunkt noch die Gunst des Königs besaß und eigentlich die Seelen der Adeligen auf ganz andere Weise hatte betreuen sollen als ausgerechnet dem Satan zu huldigen.
Eigentlich ein unerhörter Skandal, der lediglich dazu geführt hatte, dass jener Priester inzwischen auch nicht mehr am Hofe weilen durfte.
Diejenigen, die solche Gerüchte verbreiteten, wurden derweil nicht müde, auch darauf hinzuweisen, dass es nach wie vor nur sehr mangelhafte Beweise für alles dies gab, falls man überhaupt so etwas wie Beweise finden konnte, hieß das. Was wiederum zu dem Gerücht führte, es handele sich im Grunde genommen um Verschwörungen, die weit über das Geschehen am Hofe hinausgingen, vielleicht sogar Fäden zogen bis hinein in den Vatikan. Eingefädelt von Mächten, die es bravourös verstanden, ihr Treiben zu verschleiern.
Dinge, die Robert blitzschnell durch den Kopf schossen, und die darin gipfelten, insgeheim festzustellen: Zumindest hatte es Seine Majestät dazu bewogen, Madame vom Hofe zu verbannen. Gleiches hätte auch dem ermittelnden Untersuchungsrichter La Reynie widerfahren können, denn es wurde gemunkelt, dass Seine Majestät nicht ausschloss, dass ausgerechnet der Untersuchungsrichter selbst absichtlich so erfolglos geblieben war. Vielleicht weil er selbst Opfer war jener Hintermänner bei diesen möglichen und öffentlich doch noch sehr diffusen Verschwörungen?
Es gab andererseits, und das musste Robert vor allem bedenken, nicht wenige, die das Ganze einfach nur als Hirngespinste ansahen und Madame de Montespan gar als in Wahrheit unschuldig. Vielleicht sogar als Opfer irgendwelcher Hofintrigen, weil man ihr diese besondere Rolle in der Gunst des Königs nicht gegönnt hatte.
Robert wusste es nicht definitiv. Er wusste nur, dass soeben sein König doch tatsächlich erklärt hatte, nur noch ihm vertrauen zu wollen. Ihm? Und das, nachdem er angeordnet hatte, ausgerechnet einen Adeligen unter besonderer Beobachtung zu halten, der doch eigentlich völlig unwichtig sein musste? Weil der noch nicht einmal ständig am Hofe weilte?
Kaum stand er aufrecht vor Seiner Majestät, dem König, gewahrte er den bewundernden Blick desselben. Wie er mehrmals an ihm auf- und abwärts wanderte.
„Welch stattliche Erscheinung!“, murmelte er sogar. „Dies übertrifft, was ich über Euch vernahm, werter Robert de Malboné. Ihr seid wahrhaft würdig, so groß und aufrecht vor Seiner Majestät zu stehen. Doch sagt nun selbst, werter Robert de Malboné: Seid ihr tatsächlich so loyal, wie es Euer Herr Vater einst war?“
„Es gibt nichts, was meine Loyalität Euch gegenüber je hätte erschüttern können. Ich, Robert de Malboné, gehöre Euch mit Haut und Haaren. Wie dereinst mein Vater, so auch ich. Mein Leben ist das Eure! Ihr könnt voll und ganz über mich verfügen.“
„Es ist genau das, was Euer König von Euch hören wollte. Und ist es auch das, was Ihr tatsächlich insgeheim denkt?“
Ludwig musterte ihn sorgsam. Robert wagte es nicht, auch nur mit einem Finger zu zucken. Er stand stocksteif da vor Seiner Majestät und verdammte es, atmen zu müssen, denn atmen war halt nicht möglich, ohne jegliche Regung zu zeigen.
Da lachte der Sonnenkönig wie befreit.
„Euer König glaubt Euch jedes Wort!“, bekannte er. „In der Tat, Monsieur, ihr seid es wert, hier vor mir zu stehen. Wert, mein stattlicher Krieger zu werden, gegen meine unsichtbaren Feinde, die nur deshalb unsichtbar bleiben, weil es Kräfte gibt, die sie decken. Damit sie sich erfolgreich dem Zugriff des Königs entziehen können.“
Robert hörte sich daraufhin selber etwas sagen. Es war, als hätte sich seine Stimme selbständig gemacht, würde nicht mehr seinem Willen gehorchen. Er lauschte seinen eigenen Worten nach und wunderte sich noch mehr über deren Bedeutung.
„Eure Majestät, bei allem Respekt, aber seht Ihr denn einen konkreten Anlass für Euren zugegebenermaßen recht weitgehenden Verdacht?“
War das nicht zu ungehörig? Zu respektlos? Wie konnte er es überhaupt wagen, das Wort zu erheben, ohne dazu ausdrücklich aufgefordert zu sein?
König Ludwig XIV. jedoch reagierte überraschend: Er lachte. Ja, er hieb sich dabei sogar voller Vergnügen auf beide Schenkel.
„Ihr seid köstlich, Monsieur! Das sind genau die Worte, wie ich sie erwarte von einem feinsinnigen Verstand. Ihr, der Ihr Euch den Ruf verdient habt, nüchtern und logisch alles anzugehen, seid wie kein anderer dazu geeignet, jenen Kräften auf die Spur zu kommen, die alles tun wollen, damit man sie fürchten lernt.“
Er wurde schlagartig sehr ernst. Eine Stimmungsschwankung, die Robert ziemlich ernüchternd fand. Jedenfalls hatte er nicht das Falsche gesagt. Soviel stand fest. Und er log ja nicht, wenn er behauptete, ein loyaler Diener seines Königs zu sein. Er war genau in diesem Sinne erzogen worden, und es gab nichts, was an dieser Loyalität hätte zweifeln lassen. Selbst die Zustände in Paris nicht, während der König hier in seinem wahrhaft gigantischen Schloss mit bis zu zehntausend Speichelleckern in der Art einer Masseninszenierung das Oberhaupt spielte.
Immerhin ein Machtpotenzial, das bis in die letzten Winkel Frankreichs und sogar darüber hinaus wirksam blieb. Nicht etwa nur im Guten, sofern es die altbekannten Mechanismen wie Unterdrückung und Ausbeutung betraf.
Nichts dergleichen konnte jedoch einen Robert de Malboné erschüttern in seiner Ergebenheit gegenüber seinem König. Nicht etwa deshalb, weil er blind gegenüber den Umständen war, sondern ganz im Gegenteil: Als rational denkender Verstand wusste er sehr wohl, dass ein starker König, obzwar hier weitgehend abgeschottet von der eigentlichen Welt, ein Garant war für die Größe Frankreichs, wie sie auch noch weiterhin bestehen blieb.