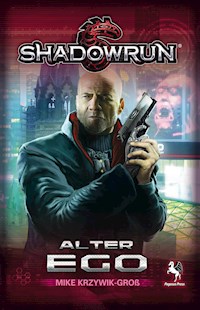Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ulisses Medien und Spiel Distribution GmbH
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Das Schwarze Auge
- Sprache: Deutsch
Riva, die freie Stadt an den Ufern des Kvill. Die horasische Altertumsforscherin Ancalita Balliguri ist nicht sehr angetan davon, die Nachfolge des geistig verwirrten Magisters Scribani anzutreten. Doch was hat den armen Magister in den Wahnsinn getrieben? Waren es die Geheimnisse des düsteren Riedemoors, in dem sich seit Phexens Sternenregen allerlei merkwürdige und sinistre Gestalten herumtreiben? Gemeinsam mit dem maraskanischen Zauberer Madajin folgt sie einer unheilvollen Spur, die ihr mehr abverlangt, als sie geben kann. Und auf einmal muss sie sich sogar den Dämonen der eigenen Vergangenheit stellen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Biografie
Mike Großwurde 1976 im verregneten Harz zwischen finsteren Tannen und majestätischen Bergen geboren. 1999 zog er in die Hansestadt Lüneburg, um dort Sozialpädagogik zu studieren. Er verliebte sich nicht nur in die historische Salzstadt mit ihren zauberhaften Giebeln und düsteren Gassen. Denn im letzten Jahr wurde geheiratet, und der NachnameGroßerhielt den unaussprechlichen ZusatzKrzywik.
Weitere Informationen unter www.krzywikgross.de
Titel
Mike Krzywik-Groß
Riva Mortis
Ein Roman in der Welt von Das Schwarze Auge©
Originalausgabe
Impressum
Ulisses Spiele Band 11067PDFTitelbild:Arndt Drechsler Aventurienkarte: Ralph HlawatschLektorat: Florian Don-Schauen Buchgestaltung: Ralf Berszuck E-Book-Gestaltung: Michael MingersCopyright ©2012 by Ulisses Spiele GmbH, Waldems. DAS SCHWARZE AUGE, AVENTURIEN und DEREsind eingetragene Marken. Alle Rechte von Ulisses Spiele GmbH vorbehalten.
Titel und Inhalte dieses Werkes sind urheberrechtlich geschützt.
Danksagung
Ich danke Karsten, Torsten, Ralf und Alex für all die Inspiration, Kreativität, Begeisterung und ihren DSA-Sachverstand. Ohne eure selbstlose Hilfe wäre dieses Buch nicht das Gleiche.
Ein besonderer Dank gilt meinem Lektor Florian Don-Schauen, dem ich mit diesem Erstlingswerk einen Haufen Arbeit beschert habe, die er mit freundlicher Gelassenheit konterte.
Nicht unerwähnt möchte ich die Autoren des QuellenbandesPatrizier & Diebesbandenlassen. Aufgrund ihrer Ausarbeitung der wundervollen Stadt Riva mit all ihren herrlich skurrilen Bewohnern konnte die Geschichte zu dem Buch werden, das die geneigte Leserschaft nun in ihren Händen hält.
Widmen möchte ich dieses Buch meiner Gattin Weronika, die immer an mich geglaubt hat, mir viel Geduld entgegenbrachte und mich während des Schreibens vonRiva Mortissogar heiratete – az do konca swiata.
»Die Menschenseele ist wie ein verpesteter Sumpf; wenn man nicht rasch darüber hinweggleitet, versinkt man darin.«
—Stendhal
Prolog
Nördliches Aventurien, nahe des Flusses Kvill, ca. 5000 Jahre vor Bosparans Fall
Sie zitterte am ganzen Leib.
Immer wieder wurden ihre Muskeln von übermächtigen, aus Furcht geborenen Wellen erfasst. Die Poren ihrer hellen, zarten Haut waren weit geöffnet und förderten Unmengen Schweiß zutage. Mit einer Hand wischte sie die salzige Körperflüssigkeit aus ihrem Gesicht, während ihre andere den zwei Schritt langen Speer so fest umklammert hielt, dass ihre Finger bereits schmerzten. Ihr Atem ging stoßweise, und die Last der eleganten Plattenrüstung aus verzaubertem Mammuton drückte schwer auf ihren schmalen Schultern. Jedoch nicht annähernd so gewichtig wie das Schicksal ihrer Gefährten, die an diesem Tag den Tod gefunden hatten.
In den letzten Stunden hatte die junge Frau mit ansehen müssen, wie jeder Einzelne ihrer fast einhundert Brüder und Schwestern einen grausamen Tod gefunden hatte. Auch jetzt noch sah sie die Verzweiflung in den Augen Allandirels, als er erkannt hatte, dass sein Lied für immer verklingen würde. Kurz bevor die namenlose Bestie seinen Körper in zwei Teile riss. Sie hörte noch die Schreie Enjallas, als sie von Dutzenden Scheusalen niedergetrampelt wurde. Sie war schlichtweg überrannt worden, ohne eine Chance auf den ehrenhaften Kampf, dem sie so entgegengefiebert hatte. Doch vor allem sah die junge Elfe vor ihrem geistigen Auge das alles verzehrende Feuer des leibhaftigen Drachen, der das Leben so vieler tapferer Elfen in einem Augenblick, nicht länger als ein kurzes Zwinkern, ausgelöscht hatte. Ihre anmutigen Körper waren in wenigen Momenten zu Asche vergangen und vom kühlen Nordwind fortgetragen worden. Noch immer hatte sie den beißenden Geruch von verbranntem Fleisch in der Nase und sah die schweren Rauchwolken über den Bäumen des Waldes aufsteigen. Tränen rannen ihr über die Wangen.
Sie war in den letzten Stunden gerannt wie nie zuvor in ihrem Leben. Nicht einen Moment hatte sie zurückgeschaut oder gar mit dem Gedanken gespielt, kehrtzumachen. Urtümliche, blanke und reine Angst hatte sie angetrieben auf ihrer kopflosen Flucht durch den dichten Wald. Leandra Sternenfänger wollte nur weg von all dem Tod und Leid.
Als die Dämmerung langsam einsetzte, kauerte sie einsam und verlassen hinter einem Wacholderstrauch im Dickicht. Noch vor wenigen Tagen war sie voller Tatendrang und erfüllt von leidenschaftlicher Opferbereitschaft gewesen. Mit ihren Schwestern und Brüdern wollte sie ruhmreich in die Schlacht ziehen und Teil der Lieder ihres Volkes werden. Denn diese berichteten von einem Schrecken, der nicht sein durfte. Von dem essenziellen Bösen, das sich anscheinend unaufhaltsam über die bekannte Welt ausbreitete wie eine Seuche ungeahnten Ausmaßes. Die Gesänge hatten die Kunde von der größten Gefahr, die die Lebenswelt der aus dem Licht Geborenen bedrohte, weiter und weiter getragen, bis immer mehr Sippen sich ihrer Sache angeschlossen hatten. Sie hatten nicht länger tatenlos zusehen können, wie dasdhazadie Eintracht der Welt ins Wanken brachte und in die tiefsten Abgründe zog, verdorben von der Disharmonie. Die Legendensänger hatten die größten Helden ihrer Zeit zusammengerufen, gewappnet mit Rüstungen, die übersät mit arkanen Zeichen waren, und mit magischen Klingen in den Händen, mit denen man selbst einen Drachen das Fürchten lehren konnte, so hatte Leandra einst gedacht. Sie hatten sich unbesiegbar gefühlt, als sie ausgezogen waren, um die Konfrontation mit demdhazazu suchen. Zu Hunderten hatten sie auf der Suche nach der verborgenen Zitadelle den Urwald durchstreift, um diese im Sturm zu nehmen. Es sollte eine Entscheidung herbeigeführt werden. Die Hochelfen hatten ein letztes Gewicht auf die Waagschale der Geschichte geworfen, um sie zugunsten des Friedens in der Welt zu neigen. Habgier, Bosheit und Niedertracht hatten auf ewig aus der Welt verbannt werden sollen. Doch alles, was Leandra Sternenfänger an diesem Tage gefunden hatte, waren namenloses Grauen, Verzweiflung und Tod.
Sie fischte zum hundertsten Mal eine verschwitzte Haarsträhne aus ihrem Gesicht, während ihre Augen hektisch nach einer neuen Bedrohung suchten. Unaufmerksamkeit und Stillstand waren gleichbedeutend mit ihrem Untergang, daran hatte sie keinen Zweifel. Doch ihre Angst hielt sie an diesem Ort hinter den Büschen in trügerischer Sicherheit fest, als sei sie leibhaftig geworden. Die Furcht schien starke Arme zu haben, die Leandra an diesen Ort banden und ihr nur erlaubten, flach zu atmen. Ihr Verstand sandte allerdings gegensätzliche Signale. Eine innere Stimme schrie sie panisch an, sich erneut in Bewegung zu setzen, bevor eine dieser Bestien sie aufspürte oder gar der Drache zurückkehrte.
Der innere Zwist hielt die junge Elfe mehrere Minuten an diesem Ort, und erst, als er sie zu zerreißen schien, sprang sie auf. Ihr Kopf ruckte von links nach rechts. Wohin konnte sie fliehen? Sie war umgeben von dem immer dunkler werdenden Grün der Blätter und Nadeln.
Als sie in die Ferne lauschte, hörte sie von scheinbar überall her Kampfeslärm. Die Schreie der Sterbenden und dem Wahnsinn Anheimfallenden drang durch das Buschwerk, genau wie das Klirren von Stahl auf Stahl, das vom Wind zu ihr getragen wurde. Noch ehe sie sich für eine Richtung entscheiden konnte, bebte der Boden. Als wäre eine ganze Herde Mammutons im schnellen Galopp unterwegs, erzitterte der lockere Waldboden rhythmisch. Die Erschütterung erfasste ihren Körper und schüttelte ihn kräftig durch, sodass ihre Zähne aufeinanderschlugen. Die Blätter der Bäume lösten sich von den Ästen und fielen, gemächliche Kreise drehend, zu Boden.
Leandra verfolgte den Flug eines einzelnen Blattes, bis es sanft auf den Waldboden glitt. Fast verlor sie sich in der ruhigen Harmonie des Augenblicks, der ihr für einen Moment erlaubte, die Gräuel des vergangenen Tages zu verdrängen. Doch das Bersten junger Bäume riss sie zurück in die Wirklichkeit. Was auch immer dort durch den Wald brach – es kam direkt auf sie zu. Sie wollte erneut fliehen, es war der einzige Gedanke, der ihren strapazierten Geist erfüllte, doch dieser Wunsch erreichte einfach nicht ihre Beine. Wie angewurzelt verharrte sie auf der kleinen Lichtung zwischen den hohen Bäumen. Sie betete still zuzerza, der luchsköpfigen Kriegsgöttin, dass ihr Mut geschenkt würde, der Gefahr zu trotzen.
Nun sah sie einen Schemen zwischen den Bäumen vor ihr. Eine riesige Gestalt bahnte sich unaufhaltsam einen Weg in ihre Richtung. Leandra konnte sehen, wie alte und starke Bäume zur Seite gebogen wurden, als wären es Blumen auf einer Frühlingswiese. Was auch immer dort kam, es war unglaublich massig und erschreckend schnell.
Ihre Beine zitterten im Takt des vibrierenden Bodens, als sie den Jagdspieß fest mit beiden Händen umklammerte und abwehrend vor sich hielt. Ein gewaltiger Schatten fiel über sie, als die letzten Bäume von einer mehrere Schritt langen Keule zur Seite gefegt wurden. Leandra Sternenfängers Blick wanderte höher und höher, doch das Ungeheuer vor ihr wollte einfach kein Ende nehmen. Sicherlich vier Mannslängen ragte ein muskulöses, trollartiges Wesen vor ihr auf, dessen verfilzte Haare allein doppelt so lang waren, wie die Elfe an Körpergröße maß. Dann sah sie das hassverzerrte Gesicht des Riesen, in dessen Augen sich grenzenloser Wahnsinn widerspiegelte. Für einen kurzen Moment nahm er Notiz von der Existenz der angsterfüllten Leandra. Ihre Blicke begegneten sich, und die junge Elfe sah ihrem Tod ins Angesicht.
Mit einem gewaltigen Schritt überbrückte der Riese die Lichtung und stand direkt vor der wie Espenlaub zitternden Frau. Noch immer hielt sie ihren Speer schützend vor sich, doch wirkte die Waffe eher wie ein kurzes Birkenreisig und erschien Leandra völlig nutzlos gegen ihren gigantischen Feind. Der meterdicke rechte Arm des Ungetüms reckte sich über die Baumwipfel der Umgebung in ungeahnte Höhe und schwang dabei die acht Schritt lange Keule in einem tödlichen Kreis. Leandra riss angsterfüllt die mandelförmigen Augen auf, als sie sich der zerschmetternden Gewalt bewusst wurde, die jeden Moment göttergleich auf sie niederfahren sollte.
Noch immer konnte sie sich keinen Deut rühren. Erst als die mächtige Waffe auf sie niederschoss, erhob Leandra schützend den Speer über sich, um den gewaltigen Hieb damit abzuwehren. Sie erkannte in einem Moment voll endgültiger Traurigkeit, wie lächerlich ihr Versuch der Verteidigung gegenüber der alles zerquetschenden Keule war. Wäre sie doch nur zur Seite gehechtet, hätte sich mit einem gewagten Sprung in Sicherheit vor dem drohenden Tod gebracht! Doch noch immer stand die zitternde Elfe vor Furcht wie angewurzelt dort, gefangen in einer Lethargie, wie sie sie zuvor noch nicht gekannt hatte.
Plötzlich schallte der Ruf einer unbekannten Stimme und riss ihren gefangenen Geist zurück in das Hier und Jetzt.
Die Keule schlug mit einem dumpfen Dröhnen auf, das den Boden erneut zum Beben brachte.
Kapitel 1
Enqui, Frühsommer 1031 BF
Zum wahrscheinlich hundertsten Mal versuchte Ancalita die Bruchstücke zu einem Ganzen zusammenzusetzen, doch es wollte ihr nicht gelingen. Irgendein garstiger und widerspenstiger, der Forscherin völlig unbekannter Fehler hatte sich eingeschlichen und verhinderte konsequent, dass die junge Frau ihre Arbeit beenden konnte. Die gesamte Nacht hatte die Horasierin bereits damit verbracht, die zerbrechlichen Tonstücke, von denen jedes ungefähr so groß war wie ihre Handfläche, zu einem Mosaik zusammenzufügen. Mehr als ein Dutzend der antiken, scharfkantigen Relikte lagen vor ihr auf dem Tisch verteilt. Unschlüssig kratzte sich Ancalita am Kopf.Was konnte diesesDingnur gewesen sein?
Schon seit mehreren Tagen versuchte sie verbissen herauszufinden, welchem Zweck die uralte Tonplatte wohl gedient hatte, doch noch wollte sich kein tieferer Sinn herausstellen. Die verzierten Bruchstücke waren eindeutig elfischer Machart, was dem speziellen Forschungsgebiet der dunkelhaarigen Frau mit den nicht zu bändigenden Locken entsprach und somit ihr Interesse weckte. Vor wenigen Wochen hatte sie das erste Teil in den Brinasker Marschen westlich von Enqui gefunden. Das als »die Seenlandschaft der Drei Klageweiber« bekannte Gebiet war nur spärlich besiedelt und durchsetzt von sumpfigen Seen, die von Zeit zu Zeit verlorene Dinge der Vergangenheit preisgaben, welche Jahrhunderte, manchmal gar Jahrtausende im tiefen Matsch auf ihre Entdeckung gewartet hatten. Nach kurzer Suche hatte sie immer mehr von den Bruchstücken gefunden, die aufgrund ihres gleichverlaufenden Rankenmusters eindeutig zueinandergehörten.
Verzweifelt rieb sie sich die Schläfen. Sie hatte die letzte Nacht damit verbracht, die Relikte anzustarren und mit Unterstützung von unterschiedlichen Lupen übersehene Details herauszufinden. Stechender Kopfschmerz war das Einzige, was sie gefunden hatte. Zumindest war es ihr vergönnt gewesen, ungestört zu arbeiten, da sie für ihre langwierigen, analytischen Untersuchungen meist die Nächte wählte. Sie genoss die Einsamkeit ihrer Forschungen.
Auf ihren wochenlangen Expeditionen in diesen finsteren Landstrichen rund um die Hafenstadt Enqui begegneten ihr nur selten andere Menschen. Und dies war ihr auch sehr recht so, denn Ancalita Lutecia Balliguri war sicherlich sehr gebildet, hatte eine Ausbildung an einer der bedeutendsten Akademien im Horasreich genossen, doch was definitiv nicht zu ihren Stärken gehörte, war Weltgewandtheit.
Im Umgang mit anderen Menschen fühlte sie sich meist unsicher und tollpatschig. Ganz unbegründet war ihr Selbstbild wahrlich nicht, passierten ihr doch in unschöner Regelmäßigkeit überaus peinliche Missgeschicke. Ihr Vater hatte ihr schon früh beigebracht, dass sie ein zwischenmenschlicher Tölpel war und lieber ihre Nase in Bücher vergraben sollte, anstatt Gesellschaft zu suchen. Ancalita beherzigte diesen Rat seit vielen Jahren und fand darin eine angenehme Zufriedenheit, die sie aus ihrer Jugend nicht kannte.
Damals, es mochte ein halbes Leben her sein, hatte sie sich noch um die Anerkennung ihrer sogenannten Freundinnen aus den besseren Kreisen Kusliks bemüht, und um die Aufmerksamkeit der jungen Signori, denen sie schöne Augen zu machen versucht hatte.
Eben diese Aufmerksamkeit hatte sie zu ihrem Leidwesen recht häufig errungen, nur nicht in der Art und Weise, wie sie sich immer erhofft hatte. Vielmehr war sie berühmt gewesen für vergossenen Traubensaft auf dem Schoß ihres momentan Angebeteten, waghalsige Stürze die meisten Treppen Kusliks hinab oder, und dies war selbst für sie etwas Besonderes, einen ausgewachsenen Großbrand bei ihrem ersten Rendezvous, als es ihr gelungen war, einen ganzen Olivenhain niederzubrennen.
Nein, bei Rahja und ihren elf göttlichen Geschwistern, der gesellschaftliche Umgang gehörte nicht zu ihren Stärken, und so genoss sie die ausgedehnten Forschungsarbeiten mit äußerst wenigen menschlichen Kontakten. Wenn sie jemanden in den Brinasker Marschen traf, waren es meist Glücksritter auf der Suche nach dem geheimnisumwobenen Orakel der drei Klageweiber.
Die Sage erzählte, dass die drei alten Hexen in einem Baumstamm lebten, versteckt in den Wäldern nahe Enqui. Einst sollte dort die stolze Stadt Svellt gestanden haben, die durch eine mächtige Flutwelle ausgelöscht worden war, sodass nicht ein Stein mehr auf dem anderen geblieben war. Die Legende berichtete weiter, dass die drei Hexen in einer Vision bereits zuvor von dem drohenden Unglück erfahren hatten, jedoch in ihrem Gram niemanden rechtzeitig vor der Katastrophe warnten, sodass die Stadt mitsamt allen dort lebenden Menschen untergegangen war. Verflucht zum ewigen Leben, so erzählte man sich, harrten die drei Frauen seit diesem Tage aus und beantworteten jedem Fragenden ein Anliegen. Die Kunst bestand nur darin, den mystischen Baumstamm ausfindig zu machen, was nicht vielen Suchenden gelang.
Was hätte Ancalita dafür gegeben, diesen sagenumwobenen Baum zu finden! Es hätte ihre Forschungen um Jahre nach vorne gebracht. Mehr als einmal hatte sie sich ertappt, wie sie einen alten Baumstumpf untersuchte, in der Hoffnung auf nandusgefälliges Wissen. Doch viel mehr als dieses Dutzend Relikte, die vor ihr auf dem Tisch lagen, hatte sie während ihrer Arbeit in den Marschen nicht aufspüren können. Mehr als einen Götterlauf hatte sie bereits damit verbracht, das morastige Gelände zu durchkämmen, um Anzeichen für die Existenz einer untergegangenen hochelfischen Siedlung zu belegen, dem eigentlichen Kern ihrer Forschung. Während ihres Aufenthaltes vor drei Jahren in Donnerbach, dem Studium alter Schriften und der Konversation mit den dort ansässigen Auelfen, war sie zu dem Schluss gekommen, dass es eine Ansiedlung der vergangenen Elfenkultur nördlich von Simyala geben müsse. Die spärlichen Hinweise wiesen auf die Region rund um die Hafenstadt Enqui hin. Umgehend hatte sie entsprechende Fördergelder beantragt und sich bald darauf auf den Weg zu dem svelltschen Flussdelta am Golf von Riva gemacht.
Anfangs hatte ihre Suche, so hatte sie geglaubt, unter dem Segen Phexens gestanden, denn rasch konnte sie einzelnen Hinweisen folgen, die sie zu uralten Monolithen geführt hatten. Die alsTürme des Schweigensbezeichneten und über drei Schritt großen Quader östlich von Enqui trugen Inschriften in Asdharia, der untergegangenen Sprache der Hochelfen. So hatte Ancalita eine erste Spur verloren geglaubter Kultur der Hochelfen in dieser Region gefunden. Immer mehr von diesen steinernen Relikten hatte sie entdeckt, verstreut auf einem Gebiet von mehreren Meilen. Allen waren die Größe und die verwaschenen Inschriften gemein, die sich ringartig in zwei Schritt Höhe um die Steine schlangen. Moos und anderer Bewuchs schien vor den Monolithen haltzumachen, wuchsen sie doch nicht weiter als über den ebenerdigen Sockel.
Akribisch hatte die Forscherin begonnen, die Inschriften zu kopieren und zu katalogisieren, doch dann war ihren Bemühungen ein jähes Ende bereitet worden. Ein ganzer Trupp muskelbepackter Männer und Frauen mit langen Zöpfen und finsterem Blick hatte ihr unmissverständlich klargemacht, dass der Hetmann es alles andere als schätzte, wenn man die hochelfischen Relikte untersuchte. Natürlich hatte sich Ancalita davon nicht abhalten lassen und forschte weiter, was ihr einen ganzen Mond im Kerker Enquis eingebracht hatte. Die thorwalschen Besatzer schienen keinen Spaß zu verstehen, und so hatte sie ihre Expeditionen in den westlichen Teil der Brinasker Marschen verlegen müssen.
Nach monatelanger vergeblicher Suche hatte ihr Herz höher geschlagen, als sie die Bruchstücke im Schlamm entdeckt hatte. Der Fund der Tonscherben könnte ihr Durchbruch werden, hatte sie anfangs gedacht. Sie hatte sich selbst bereits in den renommiertesten Akademien über die Lebensweise der Hochelfen referieren gesehen und schon das anerkennende Schulterklopfen der studierten Fachwelt verspürt. Doch in der weiteren erfolglosen Suche hatte sich mehr und mehr der Gedanke aufgedrängt, dass sie im Begriff war, nicht mehr als einen wertlosen elfischen Teller zusammenzusetzen, den ein Reisender auf seinem Ritt durch die Brinasker Marschen verloren hatte.
Vielleicht war es wirklich nichts weiter als billiger Tinnef. Ganz gewiss war es nicht der archäologische Durchbruch, auf den sie seit Jahren hoffte. Es ließen sich keinerlei weitere Spuren auf die Existenz einer untergegangenen hochelfischen Kultur in diesem Gebiet finden. Zweifel machten sich zunehmend breit. Sie gingen einher mit dem zutiefst frustrierenden Gefühl, ihre Zeit an diesem Ort zu vergeuden, während ihre akademischen Kollegen signifikante Durchbrüche auf ihren jeweiligen Forschungsgebieten feierten.
Ungeduldig und wütend über die scheinbare Sinnlosigkeit ihrer Arbeit schob sie die Bruchstücke grob von sich fort und seufzte schwer, während sie die müden Muskeln ihrer Arme streckte.
Wenn sie doch nur den Fehler in der Zusammensetzung der Splitter finden würde! So könnte sie ihren Geldgebern zumindest einen ersten Erfolg vermelden, ehe die Geduld der Horaskaiserlich Privilegierten Nordmeer-Compagnie überstrapaziert war. Denn dies war gleichbedeutend mit dem Ende des Dukatenflusses und somit auch ihrer Forschungsarbeit auf dem Gebiet der hochelfischen Kulturen. Die Nordmeer-Compagnie, ein Zusammenschluss von bedeutenden horasischen Handelsfamilien, hatte das exklusive Privileg, nördlich der nostrischen Stadt Salza Handel zu treiben, aber auch Expeditionen in diesen Gegenden zu fördern, wie etwa die ihre.
Natürlich hatte sich Ancalita bereits vor einer Handvoll Götterläufen dazu verpflichtet, ihre Forschungsergebnisse und Relikte ausschließlich der HPNC zukommen zu lassen, damit diese sie zu barer Münze machen konnte. Bis zum heutigen Tage lag der Vorteil dieser Vereinbarung jedoch auf Seiten Ancalitas, da sich der durch ihre Arbeit erwirtschaftete Profit in sehr überschaubaren Grenzen hielt. Berechnete man ihre gesonderten Ausgaben für die ausgedehnten Studienreisen, Kost und Logis sowie entsprechende Fachliteratur und einen bescheidenen Lohn für sie selbst mit, waren die Zahlen in den Rechnungsbüchern der Nordmeer-Compagnie mit roter Tinte geschrieben anstatt in einem freundlichen Schwarz. Lange würden sich die Auftraggeber nicht mehr mit ihrer erfolglosen Arbeit zufriedengeben.
Schon seit Wochen befürchtete Ancalita bei jedem Einlaufen eines Schiffes in den Hafen von Enqui, dass ein Gesandter der HPNC an Bord sein würde, der ihr eine Strafexpedition in die Nebelzinnen, die Gorische Wüste oder nach Maraskan aufbürden würde.
Die Brinasker Marschen im Allgemeinen und Enqui im Besonderen standen sicherlich nicht sehr weit oben auf ihrer ganz persönlichen Liste von angenehmen Orten auf dieser Welt, doch könnte es immer noch schlimmer kommen. Natürlich sehnte sie sich nach den gelehrten Hallen Kusliks und Vinsalts zurück oder nach einer Anstellung im klimatisch traumhaften Belhanka, doch konnte sie aufgrund ihrer erfolglosen Forschungsarbeit kaum mit einer Beförderung rechnen.
Ausgiebig rieb sie sich die müden Augen und gähnte genüsslich, bis ihr Kiefer schmerzte. Ein Blick aus der schmalen Luke ihres gemieteten Hausbootes verriet, dass der Morgen bereits dämmerte.
Mit einem letzten Blick auf die vor ihr liegenden Bruchstücke beschloss sie, die Arbeit vorerst ruhen zu lassen, da sie in ihrem übermüdeten Zustand nicht mehr in der Lage war, hesindegefällig zu denken. Darüber hinaus meldete sich ihr Magen mit einem mächtigen Grollen, das sie über den Zeitpunkt ihrer letzten Mahlzeit nachdenken ließ. Da sie sich beim besten Willen nicht mehr erinnern konnte, wann das gewesen war, beschloss sie, sich etwas zu essen zu besorgen, ehe sie sich für ein paar Stunden in ihrer Kajüte schlafen legen würde.
Es war für sie ein recht gewöhnlicher Rhythmus, in der Nacht zu arbeiten, am Morgen warm zu speisen und sich dann zur Ruhe zu begeben. Bevor sie aufbrach, spritzte sie sich ein paar Handvoll kühles Wasser ins Gesicht, was zumindest die ärgste Müdigkeit vertrieb.
Wie immer, wenn sie zu Tisch ging, klemmte sie sich einen Stapel Bücher unter den Arm, denn sie wusste nie, wann ihr ein verfolgenswerter Gedanke kam und sie das eine oder andere nachschlagen musste. Um kein größeres Risiko einzugehen, nahm sie lieber mehr Bücher mit als zu wenige – man konnte ja nie wissen.
Die Rufe der tiefkreisenden Möwen begrüßten sie, als sie über das Deck der kleinen Nussschale schwankte, die ihr im vergangenen Götterlauf als Heim gedient hatte. Der salzige Geruch der sanften Meeresbrise lag gemeinsam mit dem Duft nach geräuchertem Fisch in der Luft und weckte vertraute Gefühle. Sie hatte ihr ganzes Leben am Meer verbracht und fühlte sich an den Küsten Aventuriens heimisch. Sie mochte die ungezügelte Naturgewalt der sich brechenden Wellen. Die Brandung hatte für sie schon immer eine romantische Wildheit inne, die Ancalita sich nicht bis ins Letzte erklären konnte und wollte. Auch für sie gab es Bereiche auf Dere, die existieren durften, ganz ohne wissenschaftliche Herleitungen und Analysen. Das sich an den Küsten des Alten Reiches aufbäumende Meer der Sieben Winde gehörte zu solchen natürlichen Phänomenen.
Mit vorsichtigen Schritten überquerte sie die schmale Planke, die ihr Hausboot mit dem Hauptsteg verband. Der Wind wehte ihr durchs lockige Haar und vertrieb die Schmerzen aus ihrem Kopf.
Ihr momentanes Zuhause lag inmitten eines unübersichtlichen Labyrinths aus weiteren Booten unterschiedlichster Machart und Größe vertäut. In diesem heillosen Chaos aus Planken, Stegen, Booten und Segeltuchplanen war es ihr auch nach dieser langen Zeit, die sie bereits in Enqui verweilte, unmöglich, alle Wege zu kennen. Immer wieder verlief sie sich in dem Gewirr aus kleinen Schiffen, Beibooten und Flößen. Manchmal vermutete sie, dass die Segler und Ruderboote absichtlich ihre Position tauschten, nur um sie zu verwirren. Vergangene Woche hatte sie eine geschlagene Stunde gebraucht, um ihr Hausboot wiederzufinden. Seitdem versuchte sie, sich an den breiteren Hauptstegen zu orientieren und tunlichst die kleineren Planken zu meiden. Diese Bereiche waren darüber hinaus nicht ganz ungefährlich, und man sollte sie gerade zur nächtlichen Stunde umgehen, wie sie schmerzhaft hatte feststellen müssen. Im vergangenen Jahr war sie ganze fünf Mal ausgeraubt worden, als sie zu später Stunde heimkehren wollte.
Sie konnte es sich nicht leisten, in den Stadtteil Svellttor zu ziehen, sondern musste weiterhin im Viertel Fischerstadt verweilen, da ihre knappe Geldkatze nicht mehr zuließ. Aber sie war vorsichtiger geworden und machte inzwischen einen großen Bogen um die dunklen Ecken der Pfahlbauten und Seilbrücken, die sich über den Svellt spannten. Sie hatte mehrmals bei den thorwalschen Herrschern vorgesprochen und sich über die mangelnde Sicherheit in der Stadt beschwert, geändert jedoch hatte sich nichts.
In den frühen Morgenstunden des Wassertages oder auch Hjaldisdags, wie die thorwalschen Besatzer Enquis sagten, waren nur wenige Einwohner auf den Straßen der Hafenstadt zu sehen. Ancalita wandte ihre Schritte Richtung Efferd den Irrlichterhügel hinauf, denn dort im ehemaligen Fürstenpalast gab es in der TaverneRettungsankerden besten Prembutt ganz Enquis. Häufig suchte sie das raue Etablissement auf, um dort zu speisen. Doch auch nach dem wahrscheinlich hundertsten Besuch fand sie das Gefühl befremdlich, in eine Schänke einzukehren, die einst Teil des herrschaftlichen Palastes gewesen war.
DerRettungsankerwar in einem Flügel der ehemaligen Festung der vergangenen Herrscher der Stadt untergebracht. Vor zwanzig Jahren hatten die Thorwaler unter Führung der Hetfrau Ingibjara Hjaldasdottir diese Hochburg des Walfangs überfallen, um die in ihren Augen gotteslästerlichen Taten zu stoppen. Walfang war in ganz Thorwal unter schwerster Strafe verboten, beteten doch die Nordmänner den göttlichen Wal Swafnir an. Als dann die wilden Krieger der Hetfrau in Enqui eingefallen waren, hatten sie einen Großteil der ortsansässigen Walfänger erschlagen, den amtierenden Fürsten aufgehängt und die Stadt besetzt. Für eine Burg mittelreichischer Prägung hatten die Eroberer wenig Verwendung gehabt und sich im östlichen Teil der Stadt eine eigene Feste nach thorwalscher Art erbaut. Die neuen Herren der Stadt hatten den Palast sich selbst überlassen, auf dass allerlei zwielichtige Gestalten dort ihre Tavernen, Spielhäuser und Bordelle eröffnet hatten.
Ancalita durchquerte die von hölzernen Gebäuden gesäumten Straßen, was sich zu einem wahren Spießrutenlauf entwickelte. Zwar schliefen noch die meisten Bewohner Enquis friedlich in ihren Betten, doch umso mehr Aufsehen erregte sie bei den Bettlern, die das Stadtbild in den heutigen Zeiten prägten. Die Bevölkerungszahl Enquis hatte in den vergangenen Jahren um ein Vielfaches zugenommen, denn auch weit im Norden Aventuriens suchten die unzähligen Flüchtlinge aus dem ehemaligen Tobrien und dem Svelltschen Städtebund Zuflucht vor dem Schrecken ihrer einstmaligen Heimat.
Nach dem Verbot des traditionellen Walfanges war es mit Enqui bereits wirtschaftlich steil bergab gegangen, und der Zustrom Hunderter mittelloser Flüchtlinge hatte die Unterschicht gewaltig vergrößert. Die thorwalschen Besatzer nahmen sich dieser Problematik nicht an, was zu einer Stimmung in der Stadt geführte hatte, die bald in einen Aufstand münden könnte. Es war nicht der erste Morgen, an dem Ancalita eine mit schnellen Pinselstrichen geschriebene Parole gegen die Besatzer aus Thorwal an einer Häuserwand lesen konnte.
Doch sie interessierte sich nicht für solche Dinge, denn für ihre Forschung nach jahrtausendealten Relikten war unwichtig, wer sich zurzeit Herrscher nannte. Sie war in Gedanken eher mit einem frischen Prembutt beschäftigt als mit ihrer näheren Umgebung oder gar weltpolitischen Zusammenhängen.
Doch sie kam nicht um die Feststellung herum, dass der bevorstehende Sommer mit aller Macht in den Golf von Riva drängte. Die noch zaghafte Praiosscheibe sandte bereits am frühen Morgen wärmende Strahlen aus, die Ancalita über die Haut tanzten und sie lächeln ließen.
Endlich ein wenig Wärme an diesem firunsnahen Ort, dachte sie erfreut, und ihr Schritt wurde leichter. Sie ließ den Efferd-Tempel rechter Hand liegen und erklomm nach der Überquerung einer weiteren der unzähligen Brücken Enquis, die sich über die Arme des Svellt erhoben, den sanft ansteigenden Irrlichterhügel. Schon von Weitem konnte sie die zusehends verfallenden Mauern des Palastes sehen, der auf der höchsten Kuppe thronte. Niemand investierte seine Dukaten in die Instandhaltung der Feste, konnten sich die heutigen Bewohner doch nicht sicher sein, auch am morgigen Tag noch Inhaber ihrer Schänken und Kaschemmen zu sein. Wer wusste schon, wann es erneut zu einem Machtwechsel kam oder die von den meisten alteingesessenen Enquinern verhassten Thorwaler doch beschlossen, den Palast für sich selbst zu beanspruchen.
Noch war wenig Betrieb zwischen den alten Mauern auszumachen, und Ancalita befürchtete, dass sie zu früh versuchte, ihr Stammlokal aufzusuchen. Doch zu ihrer Erleichterung bemerkte sie, dass im südlichen Teil des stattlichen Baus schon wieder Rauch aus dem Küchenabzug aufstieg. Oder war die Taverne noch immer vom Vorabend geöffnet? Dies würde sie nicht wundern und erhöhte sogar noch ihre Hoffnung auf gebratenen Prembutt, ein in Thorwal beliebter brauner Fisch mit schiefem Kopf und zartem, weißem Fleisch.
Ancalita durchquerte das ehemalige Haupttor zum Innenhof der Burg und ging schnurstracks auf die schwere Eichentür zu, über der ein mächtiger, gusseiserner Anker hing. Sie war stets darauf bedacht, nicht die Blicke der Dirnen und Lustknaben zu kreuzen, die sich im Hof zwischen allerlei Kisten und Fässern verstohlen herumtrieben oder in den Ecken lungerten. Selbst um diese Zeit sah sie verwahrloste Frauen und Männer mit leeren Blicken, die hier ihrer Arbeit nachgingen, frei von jeglicher Scham. Sie war nie besonders fromm oder streng in der Auslegung ihrer moralischen Werte gewesen, doch der zunehmende Verfall der örtlichen Sitten machte selbst ihr zu schaffen. Ihr sonst so undurchdringlicher Panzer aus mehreren Schichten Verdrängung und Desinteresse bekam mehr und mehr Risse, wenn sie dem Elend der Huren und Lustknaben begegnete. Vielleicht wurde es langsam Zeit, sich nicht mehr auf den Irrlichthügel zu begeben und lieber in einer der unzähligen Garküchen zu speisen.
Schnell schlüpfte sie durch die Eingangstür desRettungsankers. Als sie den Schankraum betrat, schwappte eine Welle übelster Gerüche über sie hinweg, bestehend aus abgestandenem Schweiß, altem Tabakgeruch und schalem Bier. Ein paar speziellere Noten hatten sich unter den Gestank gemischt, über deren Herkunft Ancalita gar nicht spekulieren wollte und die den nicht gerade angenehm duftenden Hof in ihrem Rücken spielend in den Schatten stellte.
Im Zwielicht der spärlich beleuchteten Kaschemme erkannte sie einige wenige Stammgäste am Tresen, darüber hinaus war die Taverne leer. Der dickbäuchige Wirt mit der stets dreck- und fettverschmierten Schürze um die Hüften und dem schiefen, zahnlosen Lächeln versuchte gerade, seinen Tresen zu säubern. Dass er dabei einen Lappen benutzte, der das Mobiliar an schmierigen Schlieren noch übertraf, schien dem Mittfünfziger nicht aufzufallen oder ihn nicht zu stören.
»Mutter Travia zum Gruße, mein lieber Herr Wirt«, rief Ancalita ihm zu, während sie über die Türschwelle stolperte, im letzten Moment noch ihr Gleichgewicht fand und sich vor einem Sturz bewahren konnte. Jedoch konnte sie ihre mitgebrachten Bücher nicht mehr halten, und sie flogen in einem hohen Bogen durch den Schankraum, wobei sie einen schlafenden Gast an einem der wackeligen Tische nur um eine Fingerbreite verfehlten.
»Immer langsam, meine ungeschickte Studiosa. Ich möchte doch meinen besten Gast nicht durch einen tragischen Unfall verlieren«, antwortete der Wirt mit einem phexischen Grinsen.
Ancalita blickte verlegen drein und strich ihr derangiertes, grünes Kleid glatt. »Äh, jemand sollte etwas gegen diese hervorstehende Türschwelle unternehmen, Herr Wirt. Ich schlage vor, dass Ihr Zimmerleute beauftragt, dies auszubessern, sonst verletzt sich noch jemand ernsthaft.«
»Aber natürlich, Frau Balliguri! Ich werde gleich heute Nachmittag jemanden damit beauftragen.«
Mit hämischem Gelächter quittierten die übrigen Gäste die Aussage des Besitzers des Hauses, und sein immer breiter werdendes Grinsen ließ Ancalita an seinen Worten zweifeln.
»Das wäre auch nur recht so. Und darüber hinaus muss ich Euch mitteilen, dass ich schon lange keine Studiosa mehr bin, sondern die Herzog-Eolan-Universität zu Methumis gleich innerhalb mehrerer Fakultäten absolviert habe, werter Herr.«
Der Wirt verstand kein Wort von dem, was sie ihm mitteilen wollte, zuckte nur mit den Schultern und reagierte, wie er immer reagierte, wenn er nicht wusste, was er sagen sollte.
»Darf‘s was zu trinken sein?«
»Sehr gerne«, bemerkte Ancalita, während sie bemüht war, ihre verstreuten Bücher einzusammeln. »Ich würde mich über einen kräftigen Kräutertee sehr freuen, und falls Ihr noch frischen Prembutt habt, wäre ich glücklich.«
»Setzt Euch nur, ich bringe Euch gleich, was Ihr wünscht. Aber bitte werft keine Bücher mehr durch meine Schänke. Ist nicht gut für meinen Ruf.«
Erneut erklang heiseres Gekicher von den umstehenden Frauen und Männern. Missmutig wählte Ancalita einen abgelegenen Tisch, der einen halbwegs sauberen Eindruck vermittelte, und breitete ihre Bücher aus. Schnell verschwand ihr Gesicht hinter großen Folianten und tauchte erst wieder auf, als der Wirt ihr die Speisen und den Kräutertee brachte.
»Und was machen die Forschungen, Frau Gelehrte?«
»Magistra, Herr Wirt, Magistra. Ich erklärte Euch doch bereits mehrfach die korrekte Anrede einer Absolventin der Herzog-Eolan-Universität. Aber trotzdem danke der Nachfrage. Es geht voran mit meinen Studien«, log sie.
Sie sortierte ihre Bücher beiseite, damit der Wirt auftischen konnte, unterbrach die Lektüre jedoch nur für einen kleinen Moment und versteckte sich sofort wieder hinter ihren Büchern. Verstohlen machte sie sich über den Fisch her.
Sie hatte kaum aufgegessen, da wurde die Eingangstür mit großem Schwung aufgerissen, sodass sie mit einem lauten Knall gegen die Wand schlug. Der Lärm erregte sogar Ancalitas Interesse, sie blickte auf und sah das bekannte Gesicht des kleinen Alrik durch den Türrahmen lugen. Der ungefähr zehnjährige Junge schaute sich hektisch um, bis sein Blick auf Ancalita fiel und er umgehend auf sie zurannte. Die magere Gestalt mit den straßenköterblonden, wuscheligen Haaren war ganz außer Atem. Schweiß rann ihr in kleinen Sturzbächen durchs Gesicht.
»Bei Horas, mein Junge, was ist denn dir wiederfahren? Es schickt sich nicht, an solch einem öffentlichen Ort einfach so hereinzuplatzen, ganz außer Atem und den Tisch mit seinem Schweiß volltropfend.«
Schleunigst brachte sie ihre wertvollen Bücher in Sicherheit, damit der Junge keine salzigen Flecken auf ihnen hinterlassen konnte.
»Ver… Ver… Verzeihung, Ma… Magistra«, brachte er keuchend hervor.
Alrik war ein tobrisches Flüchtlingskind, das ungefähr zur gleichen Zeit nach Enqui gekommen war wie auch Ancalita. Seine Eltern hatten den Schrecken der Schwarzen Lande nicht überlebt, und so war er ganz auf sich allein gestellt aus Transysilien geflohen, so weit ihn seine Füße trugen. Ancalita war es vollkommen schleierhaft, wie der Zehnjährige es halbwegs unbeschadet über den halben Kontinent bis nach Enqui hatte schaffen können.
Sie hatte ihn vor einem halben Götterlauf kennengelernt, als er ungeschickt versucht hatte, ihren Geldbeutel zu stehlen. Sie hatte ihn bei seiner Tat erwischt und ihn daraufhin unter ihre Fittiche genommen. Denn auch wenn es um ihre Menschenkenntnis nicht weit bestellt war, so erkannte sie doch, dass der kleine Alrik aus großer Not heraus gehandelt hatte und von Grund auf ein anständiger Junge war. Sie hatte ihn noch genau vor Augen, wie er dagestanden und sie erschrocken angeblickt hatte, als sie ihn auf frischer Tat ertappt hatte. Seine Kleider waren zerrissen gewesen und sein Gesicht unter all dem Schmutz kaum zu erkennen. Er war abgemagert bis auf die Knochen gewesen und hatte etwas in ihrem Herzen gerührt, was sie zuvor nicht gekannt hatte. Ohne lange darüber nachzudenken, hatte sie ihn in das nächstbeste Badehaus geschleppt, ihm neue Kleider gekauft und zu essen gegeben. Von da an war er ihr nicht mehr von der Seite gewichen. Wohin sie auch ging, der Junge war ihr gefolgt, selbst auf ihre Expeditionen in die Brinasker Marschen.
Nach einer Woche hatte sie ein Einsehen gehabt und den Jungen als ihren Hausdiener und Schüler eingestellt. Er erledigte seitdem für sie Besorgungen und Botengänge und hielt ihr Hausboot in Ordnung. Dafür lehrte sie ihn die Grundzüge der horasischen Allgemeinbildung.
Er war ein pfiffiger Junge und lernte überaus schnell. Für seine Dienste erhielt er von ihr ein paar Kreuzer und Heller zugesteckt. Er hatte sein Glück kaum fassen können und versuchte kein weiteres Mal, sie auszurauben.
»Nun hol erst einmal tief Luft. Ja, gut so. Langsam und tief ein- und ausatmen.«
Alrik tat wie ihm geheißen, und sein schmaler Brustkorb hob und senkte sich nach wenigen Augenblicken sichtbar langsamer und flacher.
»Also gut, mein Junge, warum bist du so außer Atem?«
»Gestern … gestern am späten Abend … ist ein … Schiff einge…laufen. Ein toller Seg…ler aus Havena.«
»Das freut mich ja sehr, dass du dich so für Schiffe begeistern kannst, und eines Tages wirst du ja vielleicht Matrose auf einem Handelsschiff und überquerst die vier Meere.«
»Nein, Ihr versteht nicht, Magistra Balliguri … auf dem Schiff … eine Nachricht für Euch …«
Der Junge hob seine verschwitzte Hand, in der er einen zerknitterten Brief hielt. Ancalita stockte der Atem, da ihr sofort das Siegel der Nordmeer-Compagnie ins Auge stach. Nun war es also so weit. Sie erhielt ihre Versetzung. Oder war es gar eine Entlassung? Vielleicht ein freundliches Schreiben, das die Einstellung sämtlicher Zahlungen an sie verkündete? Es gab nur einen Weg, es herauszufinden.
Sie entriss Alrik das an sie adressierte Schreiben und öffnete mit zittrigen Fingern den Umschlag, indem sie das Wachssiegel erbrach. Sie faltete den Brief auseinander und wurde von Alrik aufmerksam beobachtet, als sie die Zeilen überflog.
»Geschätzte Magistra Ancalita Lutecia Balliguri,
ich möchte mich auf diesem Wege nach dem aktuellen Stand Eurer nandusgefälligen Forschungen erkundigen. Hattet Ihr bereits Gelegenheit, Eure Theorie über hochelfische Siedlungen an der Mündung des Svellt zu verifizieren? Ich hoffe doch sehr, dass Eure Arbeit eine hesindewürdige Richtung genommen hat und in Kürze die Fachwelt begeistern wird. Doch muss ich an dieser Stelle leider einräumen, dass der Grund meines Schreibens ein gänzlich anderer ist und Eure Forschungen nicht in der Art tangiert, wie sowohl ich als auch selbstredend Ihr gehofft habt. Ich muss Euch dazu auffordern, Eure Expedition in den Brinasker Marschen umgehend einzustellen. Dies soll keineswegs eine Beurteilung Eurer bisherigen Forschung sein, vielmehr stellt es sich dergestalt dar, dass ich dringend Eure Hilfe benötige. Vielleicht erinnert Ihr Euch noch an unseren geschätzten Kollegen Magister Gaius Silvolio Scribani? Er teilt mit Euch das Fachgebiet der Hochelfen-Forschung, und ich glaube mich zu erinnern, dass Ihr mehrere seiner Gastvorträge in Methumis verfolgtet. Ihr werdet Euch selbstredend an ihn erinnern, ist er doch eine Koryphäe auf dem Gebiet der expeditionellen Archäologie sowie der Reliktforschung. Er hatte, ganz ähnlich Eurer wissenschaftlichen Arbeit, einen Vertrag mit der Horaskaiserlich Privilegierten Nordmeer-Compagnie geschlossen und führte seine Expedition von Riva aus. Nun wurde ich von der verehrten Dame Svelinya Kuyfhoff darüber in Kenntnis gesetzt, dass Magister Scribani etwas zugestoßen sei und er seine Forschungen nicht weiterführen könne. Dies ist neben der persönlichen Tragödie aus noch weiterführenden Gründen durchaus tragisch. Nach meinem Wissensstand hat ein regelrechter Goldrausch auf antike Relikte im nahegelegenen Riedemoor Einzug gehalten. Die letzten Nachrichten, welche ich von Gaius Silvolio Scribani erhalten habe, deuteten auf einen hochelfischen Ursprung hin. Ich möchte Euch nun bitten, umgehend ein Schiff zu besteigen und nach Riva aufzubrechen, um in dieser kritischen Phase die Arbeit unseres hochgeschätzten Kollegen zu übernehmen. Ich hoffe inständig, dass es Euch möglich sein wird, seine Arbeiten nahtlos fortzuführen, da ich sonst eine beträchtliche Einbuße in dem zu erwarteten Profit befürchte.
Hochachtungsvoll
Erste Vize-Directorin Uswina Liegerfeld
(H.P.N.C.)
Ancalita las den Brief ein zweites und ein drittes Mal, ehe sie ihn enttäuscht zur Seite legte.
Riva! Warum ausgerechnet Riva!?
Nicht nur, dass sie ihre angefangenen Studien abbrechen musste, nun sollte sie auch noch einen weiteren unzivilisierten Ort in der Kälte des Nordens aufsuchen, wo selbst der Sommer das Eis kaum verdrängte.
Hätte es nicht Kuslik oder Bethana sein können?
Die Erkundigung nach ihren bisherigen Forschungen in Enqui seitens der ersten Vize-Directorin empfand sie eher als Affront denn als wahres Interesse. Wäre die Wissbegierde aufrichtig gewesen, dann würde Ancalita sicherlich nicht aufbrechen und ihre Forschungen abrupt beenden müssen. Sicherlich konnte die Nordmeer-Compagnie nicht zufrieden sein mit dem bisher erwirtschafteten Profit, doch jetzt, wo sie das entsprechende Schreiben in den Händen hielt, war sie den Tränen nah.
Einen ganzen Götterlauf ihres noch jungen Lebens hatte sie in der thorwalschen Stadt verbracht, und das alles vergebens. Ihre Forschungen waren auf dem Stand, wie ihn ein ungebildeter Glücksritter in einem Mond hätte erbringen können. Die Zwölf waren ungerecht zu ihr! Jetzt sollte sie sich auch noch in das Haifischmeer aus dumpfen Tölpeln begeben, die einer Reliktjagd im Riedemoor nachgingen, und das, nachdem ihrem geschätzten Kollegen Gaius bereits ein Unglück widerfahren war!
Sie malte sich aus, wie Magister Scribani bei den Untersuchungen eines wertvollen Artefakts von hinten einen Knüppel von hartherzigen Reliktjägern übergezogen bekam und anschließend gut vertäut im Moor versenkt wurde. Nein, das war nicht die Art von wissenschaftlicher Arbeit, die sie sich vorstellte.
»Ist alles in Ordnung, Magistra Balliguri?«, fragte Alrik mit sorgenvollem Blick.
»Was? Jaja, ich bin nur nicht sehr erfreut über den Inhalt dieses Schreibens. Meine Zeit in Enqui ist wohl abgelaufen, mein kleiner Freund. Ich werde diese Stadt umgehend verlassen müssen.«
Tränen schossen dem jungen Tobrier in die Augen, und er bemerkte sie erst, als sie ihm über die Wangen liefen.
»Aber was ist denn nur, Alrik? Warum weinst du?«
Er wollte sie am liebsten anschreien, ihr all die Dinge entgegenschleudern, die in diesem Moment seine gepeinigte Seele zerrissen. Sie anspringen und mit seinen kleinen Fäusten immer und immer wieder schlagen. Ihr auf irgendeine erdenkliche Art wehtun, so wie sie ihn in diesem Moment verletzte. Denn erneut wurde er verlassen. Es war die wiederkehrende Konstante in seinem noch jungen Leben, dass er im Stich und zurückgelassen wurde, auf dass er für sich selbst sorgen musste.
Das Muster war immer das gleiche. Jedesmal, wenn er einem Erwachsenen vertraute und glaubte, zurück in Travias Schoß zu gelangen, passierte ein Unglück und die Götter verschworen sich gegen ihn. Erst waren es seine Eltern gewesen, die morgens aufgebrochen waren, um auf den Feldern zu arbeiten, und am Abend nicht wiedergekommen waren. Tagelang hatte er auf ihre Rückkehr gewartet und dann die Suche nach ihnen begonnen. Erst zwei Wochen später hatte er seinen Vater gefunden, doch tot war er nicht gewesen. Vielmehr war er beseelt von niederhöllischem Leben gewesen und als Leichnam im Gefolge eines bösen Mannes gewandelt, wie Alrik schnell klar geworden war. So schnell er konnte, war er geflohen, und auf seiner Odyssee durch Tobrien und das Mittelreich war er auf unzählige Halsabschneider getroffen, die ihm nach seinem kargen Besitz, seiner Gesundheit und seinem Leben trachteten. Nie wieder hatte er einem Erwachsenen trauen wollen, die ihm doch nur Böses wollten oder ihn im Stich ließen.
Dann hatte er Ancalita getroffen, und nach anfänglichem Zaudern hatte sie ihn mehr und mehr überzeugt, dass sie für ihn da war und bei ihm blieb. Die gebildete Frau hatte ihm Kleidung, Nahrung und ein Dach über dem Kopf gegeben. Selbst ein paar Buchstaben hatte sie ihn zu lesen und zu schreiben gelehrt. Und nun wollte auch sie ihn verlassen.
Alriks Welt brach zusammen, und dies wollte er ihr entgegenbrüllen. Doch mehr als ein Schluchzen brachte er nicht hervor, was ihn nur noch wütender werden ließ. In diesem Moment schwor er bei allen zwölf Göttern, dass es das letzte Mal gewesen sein sollte, dass er einem Erwachsenen vertraute.
»Was ist denn nur, Junge? Natürlich, ich wäre auch lieber in Enqui geblieben und hätte meine Forschungen fortgesetzt, als nach Riva zu reisen und ganz von vorne zu beginnen. Aber dies ist nun wirklich kein Grund für dich, Tränen zu vergießen. Wenn hier jemand ausreichend Grund zur Trauer hätte, dann bin das ja wohl ich. All meine Mühen und Strapazen waren vergebens. Ich habe einen vollen Götterlauf verloren, wenn du verstehen kannst, was ich meine. Nun wisch dir die Tränen aus den Augen und schnäuz dir mal anständig die Nase, du gibst ja ein geradezu erbärmliches Bild ab. So ist es schon besser. Und nun lauf los zum Hafen und erfrage, wann das nächste Schiff nach Riva ausläuft und buche zwei Plätze auf selbigem. Anschließend packst du unsere Siebensachen auf dem Hausboot …«
Alrik hörte ihre weiteren Anweisungen nicht mehr. Dem Jungen wurde schwindlig, und seine Knie schienen aus Grießpudding zu bestehen.
Hatte sie ebenzweiPlätze gesagt?
Sein Herz begann aufgeregt im doppelten Takt zu schlagen, und in seinen Ohren hörte er nicht mehr die Worte der Magistra, sondern nur noch das laute Rauschen seines eigenen Blutes.
Zwei Plätze!?!
»Alrik? Alrik, hast du alles verstanden? Junge, was ist denn nur mit dir?«
»Zwei«, war das einzige Wort, was er herausbekam.
»Zwei? Ja, natürlich zwei Plätze! Du kommst selbstredend mit mir. Ich werde dich doch nicht hier alleine zurücklassen, da müsste es schon mit dem Namenlosen zugehen. Oder möchtest du mich nicht weiter begleiten?«
»Zwei!«, schrie er ihr freudestrahlend entgegen und umarmte sie stürmisch. Ancalita wusste gar nicht, wie ihr geschah, als der schmächtige Körper des Jungen an ihrem Hals hing und er sich innig an sie presste. Bevor sie etwas sagen konnte, flitzte er bereits zur Tür hinaus. Auch Momente später hörte sie noch seine Rufe: »Sie hatzweiPlätze gesagt!«
Kopfschüttelnd bedeutete sie dem Wirt, ihr zu sagen, was sie ihm schuldete.
Kapitel 2
Erneut entledigte sich Alrik seines Mageninhaltes in den Golf von Riva. Schon die gesamte Überfahrt auf derSturmbraut, einem großen Handelsschiff unter kaiserlicher Flagge, verbrachte Ancalitas Dienstjunge an der Reling. Kaum hatte er eine karge, trockene Mahlzeit zu sich genommen, trieb ihn das Schaukeln der Kogge in der stürmischen See wieder an Deck, wo er unter kläglichem Würgen sein Essen den Fischen übergab. Seine Gesichtsfarbe blieb die vergangenen zwei Tage bei einem kränklichen Blassgrün, was Ancalita zunehmend beunruhigte. Doch Kapitän Geinhart Haberbichel, ein echter Perricumer Seebär vom alten Schlage, versicherte ihr, dass dem Jungen nichts Schlimmeres widerfahren würde, als ihm eh schon geschehen war.
Ancalita stand mit dem unrasierten, nach altem Schweiß stinkenden Mittfünfziger in der Nähe des Ruders und warf besorgte Blicke zu Alrik.
»Noch ein paar Tage länger auf See, dann wäre der Kleine für immer von der Seekrankheit geheilt und er würde nicht mehr unser kostbares Essen dem Herrn Efferd opfern, meine Liebe. Leider laufen wir bereits am frühen Morgen in den Hafen ein, sodass ich befürchte, dass es bei Eurer nächsten Überfahrt für die kleine Landratte nicht viel angenehmer wird. Wenn er denn überhaupt noch mal die Planken eines Schiffes besteigt.«
Der Seemann kratzte sich ungeniert im Schritt, und Ancalita fragte sich erneut, womit sie es nur verdient hatte, in diesen Gefilden ihrer Arbeit nachkommen zu müssen. Ein horasischer Capitano hätte sich gegenüber einer Signora niemals so ungebührlich verhalten.
»Der gute Alrik ist schon arg gestraft vom Herrn Efferd. Er dient mir seit einem Götterlauf, und seitdem ist er an jedem Tag im Hafen gewesen und hat das Ein- und Auslaufen der Schiffe beobachtet. Er liebt die Seefahrt und träumt seit jeher davon, die Meere auf einem Schiff zu besegeln. Nun hat er einmal die Gelegenheit zu einer kurzen Schiffsreise und verbringt diese in solch einem jammervollen Zustand. Und er wollte doch einstmals Matrose werden …«
»Harr, das kann sich noch legen. Der Herr der See bereitet ihm eine besonders harte Prüfung, doch wenn er sie besteht, kann er sich gerne bei mir melden. Scheint mir ein feiner Junge zu sein, und ich suche immer nach Matrosen, die nicht nur Saufen und Huren im Kopf haben.«
»Danke für Euer Angebot, Capitano, ich werde es ihm beizeiten mitteilen. Doch so schnell gebe ich Alrik nicht wieder her. Zuallererst soll er etwas über Buchstaben, Zahlen und die Geschichte der Welt lernen. Vielleicht hat er eines Tages sogar Aussichten auf ein Stipendium an der Universität von Methumis.«
»Was auch immer Ihr mit dem Jungen vorhabt, er wird zu Beginn froh sein, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Dabei war meine letzte Überfahrt nach Riva noch viel unruhiger als diese hier. Der Herr Efferd scheint bereits etwas länger seinen Sommerschlaf zu halten.«
Ancalita sah den raubeinigen Kapitän verständnislos an.
»Was meint Ihr damit, dass der Herr Efferd schläft?«
»In den Sommermonden ist die See deutlich ruhiger als im Winter. In dieser Zeit macht der Herr Efferd ein kleines Nickerchen, ehe er im Herbst wieder erwacht. Sein morgendliches Gähnen lässt die Meere in den Herbststürmen erzittern, wenn Rondrikan und Firunsatem über die Wellen toben. Dieses Jahr ist der Herr früh entschlummert und hat seinen Bruder Firun gleich mitgenommen. Ihr müsst wissen, in den letzten Götterläufen waren die Winter hart und lang, selbst im Rahja konnte man noch Ifirnsdaunen sehen. Die dreimal verfluchte Eishexe Glorana steckte dahinter. Sie soll so grausam sein, dass der Winter selbst sich nicht nach Norden in das ewige Eis zurückziehen wollte, sondern noch lange die Städte und Dörfer im Golf plagte, aus Furcht, auf Glorana zu treffen. Doch dieses Jahr gibt es etwas Hoffnung. Die Schneeschmelze hat so früh eingesetzt wie seit Jahren nicht mehr, und das Eis hat den Golf von Riva verlassen. Selbst die Schiffer, die bis Leskari hinauffahren, berichten vom Frühling.«
»Diese zugige Kälte nennt Ihr Frühling?«, entfuhr es Ancalita, die sich immer noch nicht an die Witterungen des Nordens gewöhnt hatte.
»Nein, gute Frau Balliguri. Diese sanfte Brise nennen wir Sommer!«
Schallend erklang das rasselnde Lachen des alten Seebären über das Deck. Diese einfältigen Südländer waren das reinste Vergnügen für ihn. Nicht ohne Grund hatte er im Frachtraum Platz für Passagiere gelassen, denn er genoss es sehr, sich mit seinen Fahrgästen auszutauschen und mit ihnen zu lachen. Viel zu selten, fand er, konnte er sich mit Menschen austauschen, die nicht zur See fuhren. Diese Landratten betrachteten ihn mit überbordendem Respekt, und selbst das hesindefreieste Seemannsgarn war für sie noch eine feststehende Wahrheit. Diese junge Horasierin machte da keine große Ausnahme. Zwar hatte sie einige nautische Grundkenntnisse, doch als er am vergangenen Abend angefangen hatte, über das alles verschlingende Seeungeheuer Braa‘zuul zu referieren, da war die Magistra ganz blass geworden – und das Gelächter seiner Mannschaft umso größer.
Ja, dachte der Kapitän,meine ersponnenen Geschichten über die inselfressende Braa‘zuul bringt noch jeden Passagier dazu, ängstlich über die Reling zu blicken.