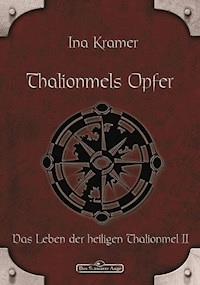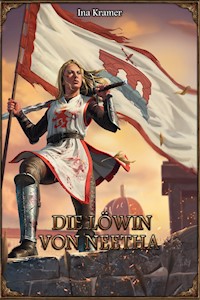Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ulisses Medien und Spiel Distribution GmbH
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Das Schwarze Auge
- Sprache: Deutsch
Thalionmel - dieser Name gebietet Ehrfurcht in den Tempeln und an den Feuern Aventuriens, denn unter den furchtlosen Heiligen der Kriegsgöttin Rondra war Thalionmel die tapferste, als es darum ging, die Heimat gegen den Ansturm der Feinde zu verteidigen. Dieser Roman beschreibt die frühen Jahre der aventurischen Landadeligen - ein heiteres, behütetes Leben, bis eine schreckliche Tat die Idylle für immer zerstört ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 381
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Titel
Ina Kramer
Die Löwin von Neetha
Das Leben der heiligen Thalionmel erzählt von einem Freunde
Teil 1
Vierter Roman in der Welt von Das Schwarze Auge©
Originalausgabe
Impressum
Ulisses SpieleBand 4
Buchgestaltung: Ralf BerszuckE-Book-Gestaltung: Michael Mingers
Copyright ©2012 by Ulisses Spiele GmbH, Waldems. DAS SCHWARZE AUGE, AVENTURIEN, DERE, MYRANOR, RIESLAND, THARUN und UTHURIA sind eingetragene Marken der Significant GbR.Alle Rechte von Ulisses Spiele GmbH vorbehalten.
Titel und Inhalte dieses Werkes sind urheberrechtlich geschützt. Der Nachdruck, auch auszugsweise, die Bearbeitung, Verarbeitung, Verbreitung und Vervielfältigung des Werkes in jedweder Form, insbesondere die Vervielfältigung auf photomechanischem, elektronischem oder ähnlichem Weg, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der Ulisses Spiele GmbH, Waldems, gestattet.
Print-ISBN: 978-3-08679-1 (vergriffen)E-Book-ISBN: 978-3-86889-637-4
Danksagung
Den Freunden gewidmet, die mich unterstützt und mir Mut gemacht haben
DAS LIED DER LÖWIN VON NEETHA
Thalionmel - Wer ist Thalionmel?* *Dank sei dem irdischen Dichter Theodor Fontäne, dessen Ballade vom tapferen Steuermann den aventurischen Poeten inspirierte.
Thalionmel war eine Kriegerin, Sie hielt unsre Brücke mit tapferem Sinn, Sie hat uns gerettet, sie trägt die Kron, Sie starb für uns, unsre Liebe ihr Lohn. Thalionmel.
Einst hatte ein Bauer ein Töchterlein hold, Die Augen so blau und die Haare wie Gold, Gar schön von Gestalt und von aufrechter Art, Eine bessere Maid nie gesehen ward. Thalionmel.
Zu Neetha im Tempel der Löwin so kühn, Dort sah man die Jungfrau beim Standbilde knien. Der Göttin Gefallen erregte sie bald, Denn stolz war ihr Sinn, hoch ihre Gestalt. Thalionmel.
Rastullah, der Wüstendämon, voll Neid, Mißgönnte Frau Rondra die mutige Maid, »Vernichtet dies Weib und brennt nieder die Stadt«, So befahl er im Grimme den Beni Novad. Thalionmel.
Und der Wüstensöhne finsterer Hauf, Zu Hunderten brachen gen Neetha sie auf, Bedeckten das Land mit Feuer und Tod, Getreu ihres grausamen Götzen Gebot. Thalionmel.
Und als sie sich endlich Neetha genaht, Da hatten gehalten sie blutige Mahd, Und sie riefen voll Wut: »Nun soll fallen die Stadt, Wie Rastullah, der Eine, geboten uns hat!« Thalionmel.
Und die Bürger von Neetha, die fragten verzagt: »Gibt es einen hier, der zu kämpfen wagt?« Da rief Thalionmel: »Frau Rondra zur Ehr Will aufhalten ich der Ungläub‘gen Heer!« Thalionmel.
Und sie hielt unsre Brücke, der Leuin gleich, Und ihr blinkendes Schwert führte manchen Streich, Und sie focht bis zum Abend mit Löwinnenmut, Und der Chabab ward rot von der Feinde Blut. Thalionmel.
Von Wunden bedeckt und von Pfeilen durchbohrt, Focht sie bis zum Tode getreu ihrem Wort. »Hilf, Herrin Rondra, und steh uns bei!« So hallte zum Ufer ihr letzter Schrei. Thalionmel.
Da machte Frau Rondra in göttlicher Wut Das Wasser des Chabab zur reißenden Flut, Die der Ungläub‘gen Heerschar wohl mit sich nahm, Und nicht einen gab es, der ihr entkam. Thalionmel.
So ward Neetha gerettet nach Rondras Rat, Und durch Ihrer Dienerin Opfertat, Du blühende Blume, du Kriegerin hell, Unsre Liebe dein Lohn, heil‘ge Thalionmel.
Prolog
Nun, da ich das Ende nahen fühle und mir nicht mehr viel Zeit bleibt, will ich alles so aufschreiben, wie es sich wirklich zugetragen hat. Viele Jahre war ich in ihrer Nähe, viel näher vielleicht, als sie je vermutete, und ich glaube, sagen zu dürfen: Ich habe sie wirklich gekannt. Auch bei ihrem Opfergang war ich zugegen, nicht auf der Brücke - natürlich nicht! - und auch nicht unmittelbar dahinter. Aber ich sah sie, konnte den Blick nicht abwenden von diesem Bild, so gleißend schön und grauenhaft. Damals, als alles vorüber war, da wünschte ich mir in meinem erstorbenen Herzen, die Pfeile der Ungläubigen hätten auch mich durchbohrt, und die Flutwelle hätte auch mich hinfortgespült. Ja, so empfindet man wohl, wenn man zwanzig ist. Nun bin ich zweiundneunzig und fühle: Alles ist vollbracht, und die hitzige Jugend mit ihren Hoffnungen, Sehnsüchten und Leidenschaften ist fern und fremd und kaum mehr Teil meiner selbst. Alles noch einmal heraufzubeschwören, das wird nicht einfach werden, denn meine Seele ist die eines alten Mannes, der sich nach Ruhe sehnt - der Ruhe in Borons Schlafgemach.
Wie wird der Übergang sein? Ob es ein Kampf wird? O nein, ich mag nicht mehr kämpfen. Ich bin des Kämpfens müde, will schlafen, schlafen, schlafen...
Doch muß ich dies Werk noch vollbringen, bevor ich mich zur Ruhe legen kann, denn wer wird es tun, wenn nicht ich? Wer kann es tun? Vielleicht bin ich der einzige Überlebende aus jener fernen Zeit, der einzige Augenzeuge ihrer großen Tat und mancher ihrer geringeren, der einzige, der ihre Geschichte kennt.
Vergib mir, Harika, geliebtes Weib, getreue Gefährtin so vieler Jahre, daß ich nicht über dich schreibe, die du doch auch eine Heldin warst und ebensowenig eine Heilige wie sie. Hast du nicht unter Schmerzen fünf Kinder zur Welt gebracht, sie unter Entbehrungen aufgezogen, sie ohne Murren und Wehklagen in die Welt entlassen, damit sie dort umkommen...
Doch weder von dir soll ich schreiben noch von mir, denn unser Lebensweg war so, wie viele Lebenswege sind, so einzigartig er uns auch erscheinen mochte: Unsere Freuden waren gewöhnlich, unsere Leiden gering und unsere Opfer ohne Belang. Und keiner der Zwölf hat je auf uns geschaut oder nach uns gerufen. Wir mußten - oder durften - nicht Werkzeug der Götter sein, waren nicht Teil eines göttlichen Planes und konnten viele lange Jahre auf Deres Antlitz wandeln, ich um so viele Jahre mehr als du, wie mein Alter betrug, als sie fiel. Aber vielleicht war auch das Teil eines göttlichen Planes...
Welch für seltsame Berechnungen und Gedanken sind das? Oh, Hesinde, vergib mir meine greisenhafte Geschwätzigkeit! Verhüte, daß ich mich hinreißen lasse, mein Leben zu erzählen statt das ihre!
Was war ich wohl für sie, was habe ich ihr bedeutet? Das habe ich mich oft gefragt. War ich ihr Seelenfreund, ihr Vertrauter? Ach, ich glaube, sie hat in mir nie mehr gesehen als einen dummen Bub, dem man sich getrost öffnen und bei dem man das Herz erleichtern mag, ohne Rat zu erwarten oder sich eine Blöße zu geben, so wie man wohl zu einem freundlichen Hund über seine Nöte und seinen Kummer spricht. Und doch bewahre ich jedes ihrer Worte in meinem Herzen wie einen Schatz, denn ich habe sie geliebt.
Als ich sie das erste Mal sah - ich war zehn damals und sie elf -, da wußte ich, daß ich sie liebe und daß diese Liebe niemals erwidert werden würde. Dabei war sie gar nicht so schön, wie uns die Legenden und Balladen weismachen wollen, und auch nicht immer so tapfer. Was rede ich, natürlich war sie schön - groß, schlank und hell -, nur eben nicht so schön wie auf dem Wandbild im Ratssaal zu Neetha. Dazu war ihre Nase ein wenig zu spitz, und ihre Augen standen ein wenig zu dicht beieinander. Oh, diese wunderbaren Augen! Hellblau wie der Morgenhimmel an einem kalten Herbsttag und mit goldenen Lichtern darin. Und wie sie einen anschaute - so aufmerksam und eindring-lich, als wolle sie auf den Grund der Seele blicken. Wahrscheinlich war es nur eine Angewohnheit und hatte nichts zu bedeuten. Meine Seele wollte sie gewißlich nicht ergründen.
Ja, die Legenden und Balladen, ›Das Lied der Löwin von Neetha‹, diese Unsäglichkeit in Reimen! Warum erzählen Lieder nie die Wahrheit? Weder war sie ein Bauernkind -oder doch nur insoweit, wie man einen Gutsherrn einen Bauern nennen mag -, noch war sie eine Jungfrau. Sie war eine Frau, schon damals, als ich ihr zum zweitenmal begegnete. Doch was tut es zur Sache? Schmälert es ihre Tat? Wird ihr Opfer geringer dadurch? Und sie war auch keine ›eben erblühte Blume‹, oder wie auch immer es in dem Machwerk heißen mag. Als sie ihr Leben hingab, um Neetha zu retten, da war sie eine erfahrene Kriegerin von einundzwanzig Jahren.
Wer ich bin, willst du wissen, lieber Leser? Ich bin ein Nichts ohne Namen, ein fortgelaufener Praiosschüler, ein kleiner Schreiberling, ein unbedeutender Kalligraph. Aber vielleicht bin ja auch ich Teil eines Planes und der göttlichen Fügung. Vielleicht hat sie mir nur deshalb ihr Leben erzählt, mir ihr Herz offenbart und mich in ihrer Nähe geduldet, damit ich dermaleinst niederschreibe, was ich sah und hörte. Und vielleicht bin ich nur deshalb Schreiber geworden, damit ich es auch niederschreiben kann.
Doch nun will ich mein Werk beginnen, denn viel Zeit bleibt mir nicht, es zu vollenden.
Das erste Mal traf ich sie zur Praiosstunde im Tsamond am Hafen von Neetha. Das zweite Mal begegnete ich ihr in einer stinkenden Gasse in Eldoret. Ihr Leben währte damals dreizehn Götterläufe und sechs Monde. Und es begann in einer stürmischen Firunsnacht in einem Gutshaus nahe Neetha: Das Leben der heiligen Thalionmel.
1. Kapitel
Der Firun war ungewöhnlich hart in diesem Jahr: Seit Wochen schon blies der Beleman unverändert heftig von Efferd her, zerrte am Schilf der Dächer, drückte Bäume und Sträucher zu Boden, zauste das struppige Winterfell der genügsamen Brelak-Ziegen, trieb eisige Gischtfetzen durch die Hafengassen von Neetha und verbarg Praios‘ Antlitz hinter grauen Wolkenbahnen, die wie ein endloser Zug von Himmelsreitern vom Meer zu den Eternen flogen. »Sie tändeln wieder«, sagten die Leute mit besorgtem Blick und machten sogleich das Zeichen gegen Lästerung - ein kurzes Wedeln der Rechten vor dem Mund - als die Worte verwehten, und die Götter nicht wüßten, wer sie gesprochen hatte, auf daß Ihr Zorn den Lästerer nicht treffe. Doch war es mehr eine gut geübte und fast gedankenlose Geste - so wie man die Mütze zieht vor einer Edelfrau oder einem Edelmann und ›Praios zum Gruße‹ murmelt - als wirkliche Sorge vor dem göttlichen Zorn; schließlich wußte jedes Kind, daß der Herr Efferd wieder einmal um die stolze Frau Rondra warb, wenn er die Meere aufwühlte und Stürme über Land und Wasser trieb, und alle wünschten insgeheim, die kühne Löwin möge das Werben ihres göttlichen Freiers recht bald erhören, damit Er in seiner Liebesraserei nicht Unglück über die Menschen bringe.
»Ein böses Vorzeichen«, sagte Hilgert und kniff die Augen zusammen, als könne er so die grauen Schwaden besser durchdringen, die die nahen Hügelkuppen verhüllten.
»Schämt Euch, Alter, wie könnt Ihr so reden«, erwiderte Damilla aufrichtig empört, »die Frau liegt in den Wehen, und jeden Moment kann sie niederkommen, und Ihr faselt von schlechten Omen.« Die dralle junge Magd war um Feuerholz für die Wochenstube geschickt worden; im Hof hatte sie den alten Stallmeister getroffen, der dort mit gespreizten Beinen und in die Seiten gestemmten Armen aufrecht dem Sturme trotzte und unverwandt nach Osten blickte. Der Wind zerrte an seiner schweren Jacke, zauste sein langes graues Haar und blies ihm die Strähnen vors Gesicht, so daß er immer wieder unwirsch den Kopf schüttelte, um den Blick zu befreien, obwohl es nach Damillas Ansicht dort, wohin er so verbissen starrte, auch nichts anderes zu sehen gab als ringsumher: treibende Wolken und Nebelfetzen, schwankende Bäume und wirbelndes Laub, Staub und Unrat, die der Sturm vor sich her trieb. Das Mädchen hatte Mühe, die Scheite, die unter dem Vordach des Pferdestalles ordentlich gestapelt lagen, in ihre Kiepe und den großen Henkelkorb zu schichten, denn immer wieder versuchte der Wind, ihr die noch unbeschwerten Körbe zu entreißen. Auch war sie ängstlich darauf bedacht, ihre Röcke zu raffen und zwischen die Schenkel zu klemmen, damit kein Windstoß sie unschicklich entblößte. Ärgerlich und hastig raffte sie die Scheite zusammen, während der Wind mit ihrem langen Zopf spielte und ihn zu lösen begann. »Was schaut Ihr nur immer nach Osten«, rief sie, »dort ist doch nichts! Nach Westen solltet Ihr blicken und für die armen Fischer und Seefahrer beten, damit Efferd sie verschont.«
»Es ist ein böses Vorzeichen«, beharrte Hilgert, »siebenundzwanzig Tage lang hat er noch nie gewütet, so lange ich lebe nicht. Das ist nicht der Beleman und auch nicht Efferds Leidenschaft...« Wieder warf er das Haar zurück und zog grimmig die buschigen dunklen Brauen zusammen.
»Was soll‘s denn dann sein, wenn‘s nicht der Beleman ist«, entgegnete Damilla patzig, »der Baltrir vielleicht, oder der Horoban oder der...« Sie überlegte, ob ihr noch weitere der sieben Winde einfallen wollten. »Na, jedenfalls bläst der Beleman doch immer im Firun, wenn er‘s auch diesmal etwas arg treibt.«
»Du bist ein Kind, du verstehst nichts.« Hilgert starrte weiter in die Ferne. Mit seinen siebenundsechzig Jahren war er zwar der Älteste des freiherrlichen Gesindes, aber wäre nicht sein graues Haar gewesen, wohl niemand hätte ihm so viele Götterläufe zugemessen. Der Stallmeister war ein hochgewachsener, ungebeugter Mann von ernster, strenger Wesensart, der Geselligkeit, Trunk und Würfelspiel mied, wenig sprach und kaum jemals lachte, weswegen die meisten ihn Firutim nannten (sofern sie nicht einfach ›Alter‹ oder ›alter Mann‹ zu ihm sagten). Seine dunklen Brauen, die große gebogene Nase und die schwarzen Augen ließen vermuten, daß Tulamidenblut in seinen Adern floß und daß sein graues Haar einstmals schwarz gewesen war. »Dort drüben wird es geschehen, weit hinter den Eternen«, sprach er mehr zu sich selbst als zu dem Mädchen. »Unheil wird kommen und Umwälzung...«
»Umwälzung?« Damilla hielt fragend inne. »Was meint Ihr damit?«
»Ich weiß es nicht, Mädchen, ich weiß es nicht. Aber es wird aus der Wüste kommen, dorther, wohin die Geister eilen und wo die Elementare sich sammeln, um es zu verhindern... Doch zu spät, zu spät...«
»Habt Ihr getrunken, das ist doch sonst nicht Eure Art, oder ist der Sturm Euch aufs Gemüt geschlagen, daß Ihr so redet?« Damilla beobachtete den alten Stallmeister ein wenig besorgt. »Warum geht Ihr nicht in Eure Stube, wärmt Euch ein wenig und betet für die Frau, daß Tsa es ihr leichtmachen möge. Und auch für das Kind, damit‘s ein schöner und gesunder Knabe wird.« Sie packte die letzten Scheite in den Korb, griff nach den Riemen der Kiepe und zog sie über die Schultern. Dabei löste sich ihr Rock aus der Umklammerung der Schenkel, und ein kräftiger Windstoß hob ihn hoch bis über den Kopf. Die Kälte und der scharfe Wind trafen ihren unter den Gewändern nackten Körper so unvermittelt und fast schmerzhaft, daß die Magd einen lei-sen Schrei ausstieß. »Bei Efferd, was für ein garstiges Wetter! Und jetzt fängt es auch noch an zu regnen!« rief sie empört, während sie hastig und wenig erfolgreich versuchte, ihre Kleider zu ordnen. Sie blickte verstohlen zu Hilgert, um zu sehen, ob er ihr kleines Mißgeschick bemerkt hätte, doch der Alte stand da so ungerührt und trotzig wie zuvor. »Ich muß mich nun sputen«, sagte Damilla, »und auch Ihr solltet besser ins Haus gehen, alter Mann, und das Spintisieren sein lassen.« Sie packte den Korb und stapfte, den Kopf eingezogen und die Augen halb zugekniffen, eilig zum Gutshaus zurück.
»Das ist kein Regen, das ist Schnee«, vernahm sie Hilgerts Stimme hinter sich.
»Schnee?!« Fast hätte das Mädchen den Korb fallen gelassen. Ungläubig riß sie die Augen auf. Tatsächlich, dort im Lichtschein der Laterne sah sie winzige weiße Kristalle tanzen. Und von Westen her trieb der Sturm weitere Schwaden des weißen Gewirbels herüber. »Schnee, Schnee, sieh nur, Alter, es schneit! Das muß ich der Frau erzählen.« Damilla war so aufgeregt, daß sie Wind und Kälte vergaß und gebannt das seltene Naturereignis beobachtete.
»Ja, Schnee - Geister und Elementare sammeln sich in der Wüste. Mögen die Zwölfe geben, daß es nicht zu spät ist. Dem Mädchen jedoch droht keine Gefahr bislang - ich hoffe es zumindest...«
›Welchem Mädchen?‹ wollte Damilla fragen, doch als sie die Tür zur Küche aufgestoßen und sich schnaufend ihrer Last entledigt hatte, war die Frage vergessen. »Es schneit, es schneit!« rief sie den um das Feuer versammelten Mägden und Knechten zu.
Seit Stunden streifte Freiherr Durenald von Brelak rastlos durch die Räume seines Hauses. Wo immer er sich blicken ließ, wurde er von der Dienerschaft mit so zartfühlender Freundlichkeit begrüßt und mit so leiser Stimme und so mitleidsvollem Lächeln nach seinen Wünschen gefragt, daß er sich vorkam wie ein Schwerkranker. Dabei strotzte er vor Kraft und Gesundheit.
Durenald von Brelak war ein etwas untersetzter Mann Anfang der Dreißig. Braune Locken umrahmten eine breite Stirn, braun waren auch die Augen, in denen nicht selten ein schalkhaftes Lachen blitzte, und die glattgeschabten, etwas vollen Wangen und der erste Ansatz eines kleinen Bauches verliehen ihm das Aussehen eines Mannes, der mit sich und der Welt im Einklang lebt. Sein ausgeglichenes Temperament, seine Milde und Grundehrlichkeit und sein Ernst in allen geistlichen Belangen machten ihn zu einem beliebten und geachteten Herrn. Zwar hatte er in seiner Jugend, den Konventionen und Traditionen des hiesigen Landadels folgend, ein paar Jahre lang die Garnisonsschule zu Neetha besucht, hatte recht ordentlich das Fechten gelernt und ein wenig über die Kriegskunst erfahren, hatte den Rondrakult studiert und mit großem Ernst und voller Hingabe bei den Schwertfeiern im Tempel des Sieges die heiligen Lieder gesungen, doch galt seine wahre Liebe der gütigen Frau Peraine: Wenn der Herr von Brelak seine Ländereien inspizierte, den Boden prüfte, die Krume nachdenklich zwischen den Fingern zerrieb und zugleich voller Stolz und Sorge die Keimlinge der neuen Saat betrachtete, dann unterschied er sich nur durch den größeren Ernst seines Tuns und das bessere Tuch seiner Gewänder von seinen Bauern.
Die günstige Lage seines Gutes - zum Meer hin durch ausgedehnte Wälder vor den allzu rauhen Winden geschützt und von Nordosten her vom beständigen, auf der langen Reise jedoch von allem Sengenden befreiten heißen Lufthauch aus der Khom gestreift, zugleich mit Efferds Gaben reich, doch nicht überreichlich gesegnet, erlaubte es dem Freiherrn, neben den üblichen Feldfrüchten wie Rüben, Flachs und Korn, die stets ausnehmend gut gerieten und reiche Ernten einbrachten, auch seltene Gemüse güldenländischen Ursprungs anzubauen, wie die rotwangige saftige Tomate und die längliche, gerippte süß-herbe Paprika, denn die wenigen Frostnächte des Jahres beschränkten sich auf den Firun, und zumeist konnte schon Ende Tsa mit der Aussaat begonnen werden.
Gut Brelak war noch nicht sehr lange in Familien-besitz. Durenalds Großvater waren die Ländereien in seinem achtundvierzigsten Jahre als Dank und Anerkennung für seine tätige und furchtlose Hilfe bei der Aufdeckung eines Komplottes gegen den Markgrafen von diesem als Lehen verliehen worden, wodurch der alte Robak vom landlosen Edlen zum Freiherrn aufstieg. Durenalds Mutter hatte das Gut von ihrem Vater geerbt, hatte das Lehen sorgfältig, aber ohne große Begeisterung gepflegt, hatte sich vermählt und Durenald das Leben geschenkt, hatte das Gutshaus im Arivorer Stil erbaut und war so still gestorben, wie sie gelebt hatte.
Das war vor zwölf Jahren gewesen, und seitdem war Durenald Herr über Brelak. Auf seiner ruhelosen Wanderung durch das Haus hatte der Freiherr nun das anheimelnd kleine warme Zimmer erreicht, das zum Spielen, Plaudern, Teetrinken und dergleichen diente und das Bibliothek genannt wurde -wegen des nicht allzu großen Bücherschrankes, in dem sich neben einigen geistlichen Büchern, ein paar Reiseberichten und Romanen, wenigen ausgewählten Werken über Kriegskunst, Staatskunst und Rechtskunde eine erkleckliche Anzahl Bände zu landwirtschaftlichen Themen befand. Achtlos nahm er ein Buch aus dem Schrank und begann darin zu blättern, während draußen der Sturm an den verschlossenen Fensterläden zerrte. Es war ein schön illuminiertes Brevier der Zwölfgöttlichen Unterweisungen, doch Durenald konnte sich weder auf den Text konzentrieren, noch entlockten ihm die zierlichen Malereien das ehrfürchtige Staunen, das er gewöhnlich empfand, wenn er sie betrachtete. Nein, er war nicht in der rechten Stimmung für eine fromme Lektüre, obwohl er doch im Augenblick nichts dringlicher brauchte als den Beistand der Götter. Viel lieber wäre er jetzt ausgeritten, doch das war nicht möglich, und er wünschte es sich auch nicht wirklich. Oder nach Holzhacken stand ihm der Sinn, doch das hatten die Knechte bereits besorgt. Ach Kusmine, liebes Herz, könnte ich doch bei dir sein und dir helfen, dachte er, aber natürlich war es ihm verboten, die Wochenstube zu betreten.
Vor zwei Tagen nach dem Mittagsmahl hatte sein Weib ihm zugeraunt: »Durenald, Liebster, ich glaube, nun ist es bald soweit.« Und seitdem war er nicht mehr zur Ruhe gekommen. Nicht, daß Kusmine nicht gut vorbereitet gewesen wäre, o nein, sie war eine umsichtige, vorausplanende Frau, und vor Wochen schon hatte sie sich mit der Hebamme aus dem Dorf besprochen, Unterredungen voller weiblicher Geheimnisse, bei denen seine Gegenwart unerwünscht war. Und auch nach einem Medicus aus Neetha war schon geschickt worden, denn schließlich handelte es sich um die Geburt eines edlen Kindes, und es machte einfach einen besseren Eindruck, sich nicht mit der guten Danja allein zu begnügen, die ihr Handwerk von ihrer Mutter erlernt hatte und den Bauernkindern aus Brelak auf die Welt verhalf, sondern ihr einen Studierten zur Seite zu stellen. Der junge Mann - Durenald war der Name entfallen, aber Kusmine hatte den fähigsten gewählt, dessen war er sich gewiß - wohnte nun schon seit fünf Praiosläufen in einem der Gästezimmer und wartete darauf, daß man ihn rief. Und auch die Wochenstube war schon lange vorbereitet. Im Grunde gab es keinen Anlaß zur Sorge - Kusmine war eine gesunde Frau und viel stärker, als ihr schlanker Wuchs vermuten ließ, und die Schwangerschaft war reibungslos verlaufen, mit ro-sigen Wangen, einem bis zur Unförmigkeit schwellenden Leib und zum Schluß diesem seltsam verträumten und nach innen gerichteten Blick, den er so sehr liebte und so wenig verstand. »Wie bei einem achtzehnjährigen Ding«, hatte Danja ihm strahlend mitgeteilt, und wäre er nicht der Herr gewesen, sie hätte ihn gewiß in die Seite geknufft, denn schließlich war die Herrin schon dreißig, ein Jahr jünger als er und vier Finger größer, fügte er in Gedanken hinzu.
Es war dieser ungewöhnlich hartnäckige Sturm, der ihn beunruhigte und der Kusmine nicht weniger Sorgen bereitete. Zwar hatten die Gatten, wenn sie Belanglosigkeiten über das Wetter tauschten, aus gegenseitiger Rücksichtnahme sich niemals ihre Befürchtungen eingestanden, doch kannten sie sich so gut, daß jeder um des anderen Sorgen wußte. Und dann die Schmerzen, die sie würde erleiden müssen... Heute morgen hatte er seine Frau zum letztenmal gesehen, als sie sich vor der Wochenstube feierlich von ihm verabschiedet hatte: »Leb wohl, mein lieber Mann, wir sehen uns wieder, wenn du Vater geworden bist. Bete für unser Kind und mich«, hatte sie gesagt, und dann, um die vierte Stunde nach Mittag, als der ohnehin schon dunkle Tag noch mehr verdunkelte, hatte er ihren ersten Schrei gehört, dem inzwischen weitere in immer geringeren Abständen gefolgt waren. Es lag ein grausamer Widersinn darin, daß die stolze und beherrschte Kusmine bei etwas so Alltäglichem wie einer Geburt mehr leiden mußte, als sie bei ihren wilden Schulgefechten, Mut- und Selbstbeherrschungs proben und ihrem einzigen Duell je gelitten hatte, und fast haßte Durenald das Kind dafür, daß es ihr solche Schmerzen bereitete.
Der Herr von Brelak erhob sich aus dem Sessel, auf dem er sich für einen Augenblick niedergelassen hatte, und stellte das Buch an seinen Platz zurück. Nein, er konnte jetzt nicht lesen, und auch das Beten war ihm unmöglich, obwohl er unablässig »Boron, verschone sie« und »Tsa, erbarme dich ihrer« vor sich hinmurmelte. Während er rastlos das Zimmer durchmaß und sich zwang, nicht voller Grauen des nächsten gräßlichen Schreis zu harren, beschwor er in seinem Geiste das Bild der Gemahlin. Er hatte Kusmine kennengelernt, als sie eben zwanzig war, doch wie sehr hatte er sich immer gewünscht, daß er ihr schon früher begegnet wäre. Zu gern hätte er das wilde blonde Mädchen gekannt und später dann die strahlende Absolventin der Vinsalter Akademie. Und wenn Durenald sich insgeheim eine Tochter wünschte, obwohl er seiner Frau einen Sohn wohl gönnte und auch oft und aufrichtig darum gebetet hatte, so deshalb, weil er dann eine kleine Kusmine heranwachsen sähe.
Kusmines Familie entstammte einem alten Adelsgeschlecht aus der Domäne Malur. Da die hohe Begabung der Tochter für die rondrianischen Fertigkeiten schon früh erkannt worden war, hatte man das Mädchen mit neun Jahren auf die Vinsalter Akademie für Kriegs- und Lebenskunst geschickt. Dort war sie zu einer stolzen jungen Frau herangewachsen, im Schwertkampf stets die Jahrgangsbeste, und hatte mit siebzehn Jahren ihr Abschlußexamen bestanden, mit Auszeichnungen nicht nur im Fechten, sondern auch in Etikette und rondrianischer Poesie. Ihre adelige alte Herkunft, ihr zu erwartendes, nicht eben unbedeutendes Erbteil, ihre vorzügliche Ausbildung und nicht zuletzt ihre Schönheit machten die junge Frau zu einer begehrten Partie bei den Adelshäusern des Reiches, und nicht wenige Freier warben um sie, so daß sie bald eine stattliche Sammlung von Miniaturen und Liebesbriefen in der Lade ihres Schreibtisches verwahrte. Doch bevor Kusmine ihre Wahl treffen konnte (da sie wußte, daß eine Liebesheirat eher unwahrscheinlich wäre, hatte sie sich vorgenommen, die Bewerber sorgsam zu prüfen, um einen ihr an Stand, Charakter und Gestalt ebenbürtigen Bräutigam zu finden), wurde die Familie von zwei furchtbaren Schicksalsschlägen heimgesucht: Vier Monde nach Kusmines glanzvollem Examen wurde ihr geliebter und verehrter älterer Bruder Roderick, Hauptmann bei den Kusliker Seesöldnern, von den Zorgan-Pocken dahingerafft, und kaum einen halben Götterlauf später stand die Familie am Rande des Ruins. Der alte Baron, aus Trauer um den Sohn halb umnachtet, hatte fast seine gesamte Habe in ein betrügerisches Unternehmen gesteckt, das hohe Gewinne abzuwerfen versprach -eine gepflasterte Straße durch die Khom, die natürlich niemals gebaut wurde. An Heirat war nun nicht mehr zu denken, das verbot Kusmines Stolz. Und so begab die junge Frau sich in die Obhut ihrer Tante Melsine, die bei den Truppen der markgräflichen Garnison zu Neetha den Rang einer Hauptfrau bekleidete. Ihr ausgezeichnetes Zeugnis, ihr Stand und ihr sicheres Auftreten verschafften Kusmine sogleich eine Stellung als Weibelin, und da sie strebsam und diszipliniert war, hätte sie es gewiß zur Obristin gebracht, wäre sie nicht Durenald begegnet.
Sich an seine erste Begegnung mit Kusmine zu erinnern, bereitete Durenald immer eine besondere Freude. Es geschah in einer Hafengasse in Neetha. Dort erblickte er die junge Soldatin, als er nach einem ausgedehnten Mahl bei einem Geschäftsfreunde müßig durch die Stadt schlenderte. Sie führte einen kleinen Trupp Bewaffneter in den Uniformen der markgräflichen Gardisten, und ihre blinkende Brünne und der Federbusch auf ihrem Helm zeigten Durenald, daß sie den Rang einer Weibelin bekleidete. Zwar war der junge Freiherr nicht ganz unerfahren im Umgang mit dem anderen Geschlecht, doch eine so plötzlich aufwallende Leidenschaft - er war geneigt, es Liebeskrampf zu nennen -wie beim Anblick dieser Dame hatte ihn zuvor noch niemals heimgesucht. Waren es ihr hoher Wuchs, ihre helle Haut, ihre schlanke Gestalt, die von der Brünne nicht verunstaltet, sondern vielmehr ron-dragleich erhöht wurde, oder war es der kühne Blick ihrer blauen Augen unter den leicht zusammengezogenen Brauen, der dieses unerwartete Gefühl in ihm erweckte? Durenald wußte es nicht zu sagen. Er wußte nur, daß er die Weibelin unbedingt kennenlernen mußte, und der Abstand zwischen ihnen verringerte sich zusehends. So fiel ihm, als sie sich etwa auf gleicher Höhe befanden, nichts Besseres ein, als einen zierlichen Kratzfuß zu machen, das Barett zu ziehen und mit einem schalkhaften Lächeln die Worte zu sprechen: »Schönes Fräulein, darf ich Euch meinen Schutz und Geleit antragen?« Zu Durenalds Überraschung ließ die Gardistin ihn nicht unbeachtet stehen, sondern hielt inne, maß ihn von Kopf bis Fuß und erwiderte mit einem mühsam unterdrückten Lächeln: »Wenn ich einmal Eures Schutzes und Eurer Begleitung bedarf, werde ich es Euch wissen lassen, werter Herr.«
Am folgenden Tag schickte der Herr von Brelak ein Entschuldigungsschreiben zum Garnisonsgebäude zu-sammen mit einer beim besten Zuckerbäcker der Stadt eilig in Auftrag gegebenen Torte, die, aus Zuckerguß und Marzipan gestaltet, mit dem Bild einer brüllenden, krallenbewehrten Löwin geschmückt war (soweit das mit Zuckerguß und Marzipan eben möglich ist). So begann die Liebesgeschichte von Kusmine und Durenald.
»Es war die Torte, mit der ich dein Herz erobert habe«, pflegte Durenald zu sagen, wenn die Gatten sich den Beginn ihrer Liebe ins Gedächtnis riefen.
»Nein, die Locken«, erwiderte Kusmine dann wohl, »braune Locken machen mich nun einmal schwach. Aber ich habe sogleich gesehen, daß du einen halben Spann kleiner bist als ich.«
»Vier Finger, liebes Herz, vier Finger«, bekam sie stets zur Antwort.
Geradlinig, wie sie war, bat Kusmine um ihren Abschied, als ihr klar wurde, daß sie den Rest ihres Lebens an Durenalds Seite verbringen wollte. Es fiel ihr nicht leicht, sich vom soldatischen Leben zu trennen, doch die Aussicht, in Brelak eine Bürgerwehr zu errichten, erleichterte ihr den Abschied von Neetha, der Garnison und ihrer Tante. Zudem hoffte sie, Durenald eine Schar von Kindern zu schenken, die sie selbst in den rondrianischen Künsten unterweisen wollte, bevor sie nach Neetha auf die Schule geschickt würden. Schon sah sie im Geiste die lockenköpfigen kleinen Krieger und Kriegerinnen vor sich, wie sie mit ihren Holzschwertern fochten und auf ihren Ponys wilde Tjosten ritten. Doch Tsa hatte es anders entschieden. Fünf Jahre lang lebten die Gatten zusammen, bevor der kleine Tsafried Praios‘ Licht erblickte. Und er sollte die vier Jahre, die ihm vergönnt waren, geschwisterlos bleiben.
Klein-Tsafried war seiner Eltern Glück und Sonnenschein. Braungelockt wie der Vater und mit den strahlendblauen Augen der Mutter, hatte es nie ein schöneres Kind gegeben, weder in Brelak noch in der gesamten Markgrafschaft, wie alle, die ihn sahen, Kusmine und Durenald gern bestätigten. Von seinem Vater hatte er die Liebe zu allem Lebendigen geerbt, und gleichermaßen andächtig bestaunte er die sprießende Saat und die neugeborenen Kätzchen. Doch war er nicht weichlich, wie Kusmine mit Genugtuung bemerkte. Schon früh maß er seine Kräfte mit den Dorfkindern, und wenn er bei den kindlichen Raufereien auch manche Schramme davontrug, so sah man ihn doch nur selten weinen. Und auch das Reiten machte ihm große Freude: Schon mit drei Jahren saß er sicher im Sattel seines Ponys, und wenn Kusmine ihn beobachtete, wie er mit wilden Rufen und heftigen Hieben der kleinen Schenkel sein winziges Pferd zu schnellerem Trab zu zwingen trachtete, so mischte sich in ihrem Herzen Stolz auf die rondragefällige Kühnheit ihres Sohnes mit mütterlicher Sorge.
Beim Reiten geschah es dann auch. Niemand wußte, warum das Pferdchen gescheut und seinen kleinen Reiter abgeworfen hatte - Dörfler fanden den leblosen Knaben und das friedlich grasende Tier auf einer Wiese am Wald und brachten beide mit kummervoller Miene zum elterlichen Gutshaus. Drei Tage währte es, bis Boron Klein-Tsafrieds Leiden ein Ende setzte und ihn zu sich rief, und weder der Medicus noch der Eltern verzweifelte Gebete vermochten ihn zu retten.
Nach dem Verlust ihres Kindes war Kusmine nicht mehr dieselbe wie zuvor. Sie zerraufte sich nicht das Haar und zerkratzte sich nicht den Busen, sie schrie nicht und zerfloß nicht in Tränen, noch haderte sie mit den Göttern - jedenfalls nicht so, daß man es hätte sehen oder hören können. Nein, ihr Herz schien erstorben, und obwohl auch Durenald um seinen Sohn trauerte und manche Träne um ihn weinte, so war ihm das Ausmaß ihres Kummers fremd und fast unheimlich. Fünfzehn trostlose Monde vergingen, in denen Kusmine ihrem Gemahl kein Lächeln oder Scherzwort schenkte und ohne Lust und Freude sein Lager teilte, so daß der Freiherr allmählich an ihrer Liebe zweifelte, da segnete Tsa von neuem ihren Leib.
Und mit dem neuen Leben, das in ihr wuchs, kehrten auch Mut, Tatkraft und Zuversicht zu ihr zurück.
Ja, die vergangenen neun Monde sind eine schöne Zeit gewesen, dachte Durenald. Und nur die letzten Wochen, seit der Sturm so unablässig und unbarmherzig wütete, waren von einem zarten Nebel der Sorge verdunkelt worden. Warum nur gönnten der unberechenbare Herr Efferd und die stolze Frau Rondra seinem armen Weib keine ruhige Niederkunft? Zornig ballte der Freiherr die Faust und hieb auf das Schreibpult beim Fenster. Dabei fiel sein Blick auf einen Brief, der seit dem Morgen, als der Bote ihn gebracht hatte, ungeöffnet dort lag. Er kam von Zordan Fuxfell, dem Halbbruder Kusmines. Was mochte der Bursche wollen? Durenald war ihm erst zweimal begegnet und schätzte ihn nicht sonderlich, aber das hatte nichts zu bedeuten -er liebte nun einmal keine stutzerhaft gekleideten Männer mit aufgezwirbeltem Schnurrbart. Die Lektüre wird mich ablenken, dachte er, während er das Siegel erbrach. Fuxfell weiß ebenso geschmeidig zu schreiben, wie er zu reden versteht, und es wird eine knifflige Aufgabe werden, aus dem Geklingel der vielen schönen Worte Sinn und Absicht des Schreibens herauszufiltern. Doch er hatte sich geirrt. Der Brief war kurz, und nach den üblichen Begrüßungsfloskeln stand dort: ›...wird es mir eine Freude sein, sobald das Wetter das Reisen wieder erlaubt, Euch, lieber Schwager, und Dir, schöne Schwester, und auch dem neuen Prinzchen oder Prinzeßchen meine Aufwartung zu machen.‹ Nun, das ist freundlich, dachte Durenald, und es wird auch Kusmine freuen.
Die Tür wurde aufgerissen, und Danja stürmte ins Zimmer -rot, verschwitzt und strahlend. »Euer Edelgeboren, Tsa sei Dank, es ist vorüber! Und meine allerherzlichsten Glückwünsche zu der schönen Tochter!«
Durenald brauchte einen Augenblick, um die Worte der Hebamme zu begreifen. Dann spürte er plötzlich, wie ihm das Wasser in die Augen schoß, und blinzelnd schloß er die kräftige Frau in die Arme und drückte ihr einen Kuß auf die Wange. »Wie geht es meiner Frau?« flüsterte er.
»Ausgezeichnet, Herr, nur ein wenig matt ist sie noch. Aber kommt doch nur - Ihr dürft die Wöchnerin besuchen, und sie freut sich schon darauf, Euch das Kindchen zu zeigen.«
Halb benommen stapfte Durenald hinter Danja zur Wochenstube. Dort, in dem großen, mit weißem Linnen frisch bezogenen Bett saß halb aufgerichtet seine Frau und lächelte ihn glücklich und müde an. Im Schein der Kerzen und des Feuers wirkte sie nicht so blaß, wie er erwartet hatte, und nur das feucht am Kopfe klebende Haar kündete von der überstandenen Anstrengung. Ein kleines, gut verschnürtes Bündel ruhte in ihrem Arm. Beim Anblick seiner Kusmine erfaßte ihn eine Woge von Liebe, und rasch eilte er zu ihr und barg den Kopf an ihrer Schulter, damit sie seine Tränen nicht bemerkte. »Ich danke dir, mein liebes Herz«, stammelte er flüsternd, »ich danke dir für diese schöne Tochter.«
»Dann schau sie dir doch einmal an, ob sie auch wirklich schön ist.« Kusmine reichte Durenald lächelnd das Bündel. Unsicher betrachtete er das rote, von der Geburt ein wenig verschwollene Gesichtchen, das sich eben zum Greinen verzog. Nein, schön ist sie nicht, dachte er, aber sie wird es, so die Götter wollen, noch werden. Und er fühlte, daß er das Kind schon jetzt liebte. Gerührt lauschte er dem dünnen Schrei, der dem zahnlosen Mündchen entwich. Doch was war das? Etwas war anders als zuvor, doch wußte er zunächst nicht zu sagen, was es war. Das Greinen war deutlich zu hören und auch das Knistern des Feuers, aber sonst
-nichts. Es war still, der Sturm hatte sich gelegt!
Auch die anderen hatten es bemerkt, doch ergriff Kusmine als erste das Wort. »Es hat aufgehört zu stürmen, endlich, Rondra sei Dank«, sagte sie mit einem Seufzer der Erleichterung. »Ich will es als gutes Omen nehmen. Damilla, bitte öffne das Fenster und laß ein wenig frische Luft herein, das wird mir guttun.«
Die Magd gehorchte, öffnete Fenster und Läden, dann stieß sie einen Schrei aus. »Weiß! Alles ist weiß!« rief sie aufgeregt. »Schaut nur, alles ist weiß!«
Danja, die ihr am nächsten stand und die den Wunsch der Herrin mit leiser Mißbilligung aufgenommen hatte - als erfahrene Hebamme hielt sie gar nichts von winterlicher Frischluft in der Wochenstube -, trat ans Fenster und blickte hinaus. »Bei Firun, welche Pracht«, murmelte sie bewegt, »soviel Schnee hab ich mein Lebtag nicht gesehen.«
Das ganze Land war wie verzaubert: Alle Wolken hatten sich verzogen, und im silbrigen Schein des fast vollen Madamales glitzerten allüberall die zarten Kristalle, aus denen die weiße Decke bestand, die sich über Wiesen und Äcker, Häuser und Katen, Büsche und Bäume gebreitet und alle Formen gerundet hatte. Und eine unwirkliche Ruhe lag über dem Land - fast glaubte man die Stille zu hören.
»Was ist das?« fragte Danja plötzlich. »Dort steht ein Tier, aber ich erkenne nicht genau, was es ist - ein Hirsch vielleicht...?«
»Wo?« fragte Damilla, und die Hebamme wies ihr mit der Hand die Richtung. »Das ist ja ein Löwe!« rief das Mädchen erschrocken. »Nein, eine Löwin, sie hat ja keine Mähne!« Mit angstgeweiteten Augen wich sie vom Fenster zurück.
Durenald, der, seit er von dem Schnee gehört hatte, eine unbändige Begierde verspürte, das seltene Naturwunder zu betrachten, und sich zugleich nicht lösen mochte von Frau und Tochter, warf Kusmine einen fragenden Blick zu. »Nun, geh schon, lieber Mann, und sieh dir den Schnee an«, sagte sie lächelnd. »Doch gib mir zuvor unsere Tochter wieder - die kalte Luft mag ihr schaden. Und sag mir, welch seltenes Tier dort draußen wandelt.« Durenald trat ans Fenster und blickte hinaus.
Lange schwieg er, ganz ergriffen von der Schönheit des Anblicks. Ein Tier jedoch war nicht zu sehen. »Dort ist nichts«, sagte er, »außer Firuns ganzer Pracht. Es gibt auch keine Löwen in Brelak«, wandte er sich belehrend an Damilla, »du wirst einen Schakal gesehen haben, der sich aus den Bergen hierher verirrt hat. Morgen werden wir seine Fährte aufnehmen und ihn, so Firun will, zur Strecke bringen, auf daß er uns nicht die Ziegen reißt. Und nun möchte ich für ein Weilchen mit meiner Frau und meiner Tochter allein sein.«
Als alle den Raum verlassen hatten, ließ Durenald sich auf einem Schemel neben dem Wochenbett nieder und ergriff die Hand seiner Gemahlin. »Mein liebes Herz, ich bin so stolz auf dich, meine tapfere, kleine, große Kriegerin.« Zärtlich betrachtete er ihr schönes Antlitz. »Hast du schon einen Namen für sie gewählt? Tsaiane vielleicht...?«
»Tsaiane ist ein schöner Name«, erwiderte Kusmine, »und seit ich weiß, daß du dir all die Monde lang eine Tochter gewünscht hast, habe ich recht oft über ihren Namen nachgedacht. Ich finde, wir sollten sie nach meiner Tante Melsine und nach deinem Vater Thalion nennen. Melsine und Thalion - Thalionmel.«
2. Kapitel
Die Tribüne der Rennbahn vor den Toren von Methumis war mit Wimpeln, Girlanden und Buketten aus Firunsglöckchen und dem ersten Ilmengrün aufs prächtigste geschmückt, denn zum diesjährigen großen Phex-Rennen erwartete man nicht nur den Herzog
-auch der Erzherrscher aus Arivor hatte seinen Besuch angekündigt. Und auch die Götter schienen dem Rennen gewogen: Seit Tagen ließ Herr Praios Sein Antlitz hell erstrahlen, die gütige Frau Peraine hatte die Auen in ein Gewand aus frischem Grün mit winzigen bunten Farbtupfern darin gehüllt, Herr Efferd hatte den Fischern einen reichen Fang beschert, und die Luft war erfüllt vom Duft der gebratenen Meerbarsche, Perlbeißer und Silberaale, die an kleinen Ständen rings um die Rennbahn feilgeboten wurden. Herr Phex, dem zu Ehren das Rennen veranstaltet wurde, ließ Kaufleute, Diebe und Bettler zufrieden schmunzeln über die bereits getätigten oder noch zu erwartenden günstigen Geschäfte, und der sinnenfrohen Frau Rahja Gebot hieß heute ganz besonders viele verliebte Paare und Pärchen zum Liebesspiel ins nahe Wäldchen schlendern...
Da Phex der neunte Monat ist, waren, wie jedes Jahr, neun Rennen angesetzt, sechs Bürger- und drei Adelsrennen. Die Bürgerrennen begannen üblicherweise um die zehnte Stunde und endeten, wenn alles gutging und nicht zu viele Unfälle geschahen, um die zweite Stunde nach Mittag. Es waren derbe Volksbelustigungen, und die wenigsten Gäule, die man auf der Rennbahn sah, waren wirkliche Reittiere - von Rennpferden ganz zu schweigen. Da gab es struppige Ponys, magere Karrengäule, Kaltblüter, deren wahre Bestimmung es war, einen Pflug zu ziehen, aber alle waren, genau wie ihre Reiter, aufs schönste geschmückt und herausgeputzt. Teilnehmen durfte ein jeder, sofern er ein Reittier besaß, das nur entfernt an ein Pferd erinnerte, und falls er es schaffte, sich rechtzeitig einen Platz unter den Startenden zu sichern, denn deren Anzahl war auf zehn für jedes Rennen beschränkt.
Für die meisten war die Teilnahme nicht mehr als ein Spaß, und nur die Besitzer der besseren Pferde -wie Fuhrleute, Botenreiter und Pferdehändler -mochten hoffen, die Siegesprämie zu gewinnen: wahlweise ein Faß Bier, gestiftet von der Geweihtenschaft des Phextempels, oder ein Fäßlein Wein, das die Rahjapriesterinnen für den heutigen Tag gespendet hatten. Doch mußte niemand darben, Verlierer nicht und auch nicht die große Schar der Schaulustigen, denn das herzogliche Freibier floß beim großen Phex-Rennen stets in Strömen.
Natürlich blieben die Adelslogen leer bei diesem groben Treiben, und auch die vornehmen Handelsherren und -damen zogen es vor, erst später zu erscheinen. Doch um die dritte Stunde nach Mittag, wenn der Rennplatz längst geräumt war von trunkenen Schustergesellen und zottigen Mähren, füllte die Tribüne sich allmählich. Das war nun für das Volk ein fast noch größeres Ereignis als die vorausgegangene Belustigung - so hohe Herrschaften von Angesicht zu sehen und so prächtige Gewänder zu bestaunen, das war ihm wahrlich nicht alle Tage vergönnt.
Am begierigsten erwarteten die Leute das Erscheinen des Erzherrschers und seiner Gemahlin. Er hatte sich auf seine alten Tage - die Sechzig mochte er bald erreicht haben - noch einmal vermählt, und zwar, wie es hieß, mit einer blutjungen ehemaligen Rahja-Geweihten aus Belhanka. Und so drängte sich jedermann so dicht zur Tribüne, wie Büttel und Gardisten es eben zuließen.
Unterdessen wurde die Rennbahn für die letzten drei Rennen, die Adelsrennen und das wahre Ereignis des Tages hergerichtet: Nachdem der Platz vom Kot gereinigt war, schleppten livrierte Helfer und Helferinnen buntbemalte hölzerne Gerüste herbei, die zu unterschiedlich hohen Hürden zusammengesetzt wurden. An anderer Stelle wurden schwere Eichenbohlen aus dem Boden der Rennbahn entfernt, und nun sah man, daß sich darunter wassergefüllte Gräben befanden. Die schönsten Hindernisse jedoch waren die Hecken. Dazu wurden immergrüne Sträucher und Äste der Goldpinie so zusammengesteckt und mit Schleifen aus roter Seide geschmückt, daß sie tatsächlich blühenden Rosenhecken glichen. Insgesamt galt es neun Hindernisse zu überwinden: drei Hürden, drei Gräben, zwei Hecken und als letztes und schwierigstes Hindernis eine Hecke, hinter der sich, unsichtbar für das Pferd, ein weiterer Wassergraben befand. Dieser war allerdings so flach, daß ein Pferd auch hineinspringen und hindurchwaten konnte - schließlich sollte nach Möglichkeit keines der kostbaren Tiere verletzt werden.
Das erste Rennen war für die vierte Stunde angesetzt, und die Tribüne hatte sich inzwischen gefüllt. Einzig die für den Herzog und den Erzherrscher reservierten Logen waren leer geblieben. Doch wurde das Volk aufs beste entschädigt durch den Anblick der in ihre kostbarsten Gewänder gehüllten Herrschaften, die je nach Stand, Vermögen und Temperament in prächtigen Kutschen, vergoldeten Sänften oder auf geschmückten Pferden zum Rennplatz gereist waren. Und als nun die Hochgeweihte des hiesigen Rahjatempels, eine zierliche Tulamidin, das Podest am Fuße der Tribüne bestieg, auf dem die Sieger der drei letzten Rennen geehrt werden sollten, da lief ein Raunen durch die Menge, und die Gemahlin des Erzherrschers war vergessen. Hochwürden Ludilla - wie schlecht sich doch der Titel zu Gebaren und Gewandung der Dame fügen wollte!
-ist gewiß um vieles schöner als die Erzherrscherin, so dachten die meisten. Die schwarzhaarige Priesterin war dem Brauch des Kultes gemäß in ein kurzes Gewand aus durchscheinender roter Seide gekleidet. Das hüftlange Haar trug sie teils offen, teils zu dünnen Zöpfen geflochten, von denen jeder mit einer goldenen Schleife befestigt war. Goldene Sandaletten umschlossen die zarten Füße, und golden waren auch der Gürtel, dessen Schließe wie eine Weinrebe mit Blättern und Trauben geformt war, und die Armreifen und Fußkettchen, die sie trug. Lächelnd grüßte Ludilla die Gäste auf der Tribüne, die sieben Reiterinnen und Reiter, die soeben ihre Plätze hinter einer markierten Linie bezogen hatten, und schließlich die jubelnde Menge. Dann füllte sie einen von vier reichverzierten silbernen Bechern, die neben ihr auf einem Tischchen standen, mit rotem Wein. Es war ungeweihter Tharf aus dem Tempel, denn den geweihten Wein darf auch eine Priesterin nur in-nerhalb der Tempelmauern trinken.
»Herrn Phex, dem listigen, zu Ehren und Frau Rahja, der schönen, zur Freude soll das heutige Adelsrennen ausgetragen werden!« rief Ludilla mit dunkler, weittra-gender Stimme. »Mögen die Götter darüber wachen, daß weder Reiter noch Tiere zu Schaden kommen, und mögen die besten drei den Sieg erringen. Hiermit« -bei diesen Worten hob sie den Becher gen Himmel und leerte ihn anschließend in einem Zuge -»erkläre ich das Rennen für eröffnet. Reiter und Reiterinnen, macht Euch bereit!«
Die Menge hatte der kurzen Ansprache schweigend gelauscht, nun erklangen Hochrufe, Pfiffe und Schreie, Mützen und Tücher wurden geschwenkt, so daß die Pferde an der Markierungslinie nervös zu tänzeln begannen. Dem Jubel zum Trotze gab es kaum einen unter den Schaulustigen, der aufrichtig wünschte, die Rennen sollten völlig ereignislos verlaufen. Denn darin bestand ja gerade das Vergnügen: einmal so ein Herrensöhnchen im Wasser oder Schlamme landen zu sehen, zu erleben, wie es vom Platze humpelte, sich verstohlen den schmerzenden Steiß reibend, und ach, die feinen Kleider - vollständig ruiniert. Aber ein Phex-Rennen ohne Rempeleien, ohne scheuende Pferde und ohne aufsehenerregende Abwürfe hatte es kaum jemals gegeben, und so waren alle zuversichtlich, daß sie nicht um ihren Spaß betrogen werden würden.
Fuxfell tätschelte den Hals seiner Rappstute. »Ganz ruhig, Meriban, braves Mädchen«, sprach er begütigend auf sie ein, »wir werden es ihnen schon zeigen, nicht wahr, meine Schöne?«
In der Tat war Fuxfells Stute das schönste und edelste Tier auf dem Rennplatz - ein echtes Shadif aus der Zucht eines Hairans aus Achan. Fuxfell ärgerte sich, daß er für das erste Rennen ausgelost worden war, denn ein Sieg im letzten Rennen würde, seiner Erfahrung nach, mehr gefeiert und beachtet werden.
Zordan Fuxfell war ein zartgliedriger Mann Mitte der Zwanzig und von mittlerem Wuchs, dem man sein tulamidisches Erbteil deutlich ansah: Das rabenschwarze Haar trug er zum Zopf geflochten, schwarz waren die großen Augen mit den schweren Lidern, die ihnen einen stets etwas müden oder gelangweilten Ausdruck verliehen, schwarz waren die fein geschwungenen Brauen, und schwarz war der sorgfältig gezwirbelte Schnurrbart. Auch die gelbbräunliche Haut hatte er von seiner Mutter ererbt, und einzig die kurze, an der Spitze etwas rundliche Nase ging auf seinen Vater zurück. Zum heutigen Phex-Rennen hatte er sein bestes Reitkleid angelegt, rote, enganliegende Beinkleider und ein dunkelgrünes pelzverbrämtes Wams, das, wie er fand, seine schlanke und dennoch muskulöse Gestalt besonders gut zur Geltung brachte. Ein federge-schmücktes schwarzes Barett, schwarze Handschuhe und sorgfältig polierte schwarze Reitstiefel rundeten seine Erscheinung ab.
Statt zu hadern, sollte ich mich lieber auf das Rennen konzentrieren, dachte er, und froh sein, daß sie mir nach all dem Hin und Her die Teilnahme schließlich doch noch gestattet haben. Denn nur der Fürsprache und dem Einfluß seines Vaters, des alten Irineius, hatte er es zu verdanken, daß er, ein Bastard, zum Rennen zugelassen worden war. Lächerlich, dachte er, nachdem der Alte mich doch schon vor Jahren anerkannt hat. Aber er würde es ihnen zeigen, er und seine schöne Meriban!