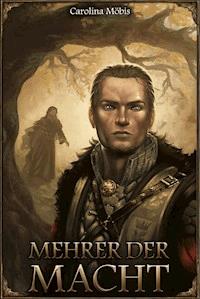
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ulisses Medien und Spiel Distribution GmbH
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Das Schwarze Auge
- Sprache: Deutsch
Prinz Wendelmir von Andergast hat es nicht leicht: Seine Familie will alsbald eine Ehefrau sehen, die Geliebte Nägel mit Köpfen machen, und überhaupt gehört endlich wieder ein echter Andergaster auf den Thron! Helmbrecht, der tumbe Söldner, und sein schweigsamer Gefährte Melanor scheinen perfekt in die Pläne des Prinzen zu passen - zumindest solange, bis sie ganz eigene Ambitionen entwickeln. In Nostria müssen unterdessen Königin Yolande und der Waldritter Eilert Rheideryan ihre eigenen Schlachten schlagen, die das Königreich bis an den Rand eines Bürgerkriegs führen. Und während sich Wendelmir in Andergast für einen begnadeten Puppenspieler hält, weben im Verborgenen die Druiden ihre Ränke, die wahren Mehrer der Macht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 452
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Autorin
Carolina Möbis wurde 1979 im heutigen Wirtschaftsministerium geboren. Einen Großteil ihres Jugendlebens verbrachte sie nahe eines Ortes, der für lange Zeit für eine Atomraketenbasis gehalten wurde. Während ihres Studiums beschäftigte sie sich mit DSA, Shadowrun, Legend of the Five Rings und anderen subversiven Rollenspielen. Trotz allem schaffte sie es, ihr Studium erfolgreich abzuschließen. Der nächste Fehler ihres Lebens vertrieb sie in den Westen, wo sie als Besitzerin eines Gartens, einer Flasche Rotwein und eines schwarzen Hundes ein Leben als Schmuckeremit führt. Da diese alte Branche heutzutage nicht besonders gut entlohnt wird, machte sie ihr Hobby zum Beruf und schreibt begeistert Science-Fiction und Fantasy.
Für Das Schwarze Auge übernahm sie die Redaktion der Novellenreihe Hundstage, zu der sie auch zwei Bände beisteuerte. Seit Februar 2015 betreut sie den Aventurischen Boten.
Mit Dank an
Krister Berends, Dorothea Bergermann, Eevie Demirtel
und
Michael Masberg
für seine grandiosen Berichte zur Bombastenfehde,
Carolina Möbis
Mehrer der Macht
Ein Roman in der Welt vonDas Schwarze Auge©
Originalausgabe
Impressum
Ulisses Spiele Band US25701 Titelbild: Tristan Denecke Bild Rückseite: Jennifer S. Lange Aventurien-Karte:Daniel Jödemann Andergast-Karte: Ben Maier Lektorat:Michael Fehrenschild Korrektorat: Kristina Pflugmacher Umschlaggestaltung und Illustrationen: Nadine Schäkel Layout und Satz: Michael Mingers
Copyright © 2015 by Ulisses Spiele GmbH, Waldems. DAS SCHWARZE AUGE, AVENTURIEN und DERE, MYRANOR, RIESLAND, THARUN und UTHURIA sind eingetragene Marken der Significant GbR. Alle Rechte von Ulisses Spiele GmbH vorbehalten.
Titel und Inhalte dieses Werkes sind urheberrechtlich geschützt. Der Nachdruck, auch auszugsweise, die Bearbeitung, Verarbeitung, Verbreitung und Vervielfältigung des Werkes in jedweder Form, insbesondere die Vervielfältigung auf photomechanischem, elektronischem oder ähnlichem Weg, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der Ulisses Spiele GmbH, Waldems, gestattet.
Kapitel 1
24. Phex 1035 BF
Helmbrecht
Radeborst, der Wirt, beobachtete seine unliebsamen Gäste misstrauisch. Für gewöhnlich herrschte um die Mittagszeit träge Ruhe im Dorfkrug des Steinborner Weilers. Nur ausnahmsweise sorgten schon um diese frühe Stunde zwei Holzköpfe für ein fragwürdiges Spektakel.
»Ach Kleiner, du hältst dein Schwert wie einen Bratspieß. Kein Wunder, es hat ja auch mächtig Ähnlichkeit damit.«
Der fahrende Söldner, der sich Helmbrecht nannte, machte sich über Jock, den halbstarken Bengel des Schmieds, lustig. Und drei Krüge Bier hatten seine Zunge so weit gelockert, dass er sich einen Spaß daraus machte, den Burschen zur Weißglut zu treiben. Das rotblonde, strubbelige Haar, die Sommersprossen auf Wangen und Armen, energische Wangenknochen und breite Schultern verwiesen auf thorwalsches Blut. Solche Kerle gab es zuhauf in Andergast. Ein Kurzschwert und ein Kriegshammer steckten in seinem Gürtel, zwei Messer im Stiefel.
Wirt Radeborst kannte die Sorte Mischling ohne ehrbare Familie. Halunken ohne Anstand und Ehre, die durchs Land zogen und vergeblich darauf hofften, als Soldklinge in eines Ritters Dienst zu kommen.
Dieser Helmbrecht wollte sich wohl bei den vornehmen Herrschaften beliebt machen, die hinter ihrem Tisch wie auf einer Ehrentribüne saßen. Das waren echte Edelleute. Prinz Wendelmir Zornbold aus dem Andergaster Königshaus nebst ritterlichem Gefolge. Es war eine große Ehre, dass sie geruhten, ihr Mittagsmahl in Radeborsts Dorfkrug einzunehmen. Und ein Unglück, dass diese zwei Streithähne auf die gleiche Idee gekommen waren.
Der Wirt scheuchte Mari, seine Schankmaid, einen Eimer Wasser aus der Regentraufe zu holen. Ein wohlgezielter kalter Guss bewahrte das Gasthaus regelmäßig vor der vernichtenden Wirkung des Starkbiers.
Mari huschte zur Küchentür hinaus. Sie warf Jock dem Schmiedesohn einen besorgten Blick zu. Seit dem letzten Tanz auf dem Heuschober verbrachte der junge Narr jede freie Minute in ihrer Nähe. Doch in diesem Augenblick hatte er nur Augen für den fremden Söldner. Er baute sich vor dem Lumpenhund auf, der sein Gesellenstück, ein drei Tage altes Kurzschwert, beleidigt hatte. Seit seiner Gesellenprobe trug der Junge es mit sich herum, stolz wie ein Ritter. »Sag das nochmal, du Sohn einer Ziege!«
»Was, dass deine Waffe so viel wert ist wie ein Andrataler in einer Hafenkneipe in Salza?« Der Söldner erhob sich mit der hinterlistigen Trägheit eines Mannes, der Ärger erwartete und zu sich einlud, wenn ihm langweilig war. Seine Hand ruhte wie zufällig auf dem Griff des Kriegshammers. Er grinste von einem Ohr bis zum anderen. »Sei froh, dass du Schmied lernst. Dann musst du mit dieser brüchigen Pflugschar, die du Schwert nennst, nicht auch noch kämpfen. Nur üben solltest du schon noch ein wenig, bevor du das Geschäft übernimmst. Oder vielleicht beschlägst du lieber Pferdehufe.«
Radeborst setzte ein grimmiges Gesicht auf und zog seinen Knüppel hinter dem Tresen hervor. Bei einem Krawallmacher mit Piratenblut mochte ein Wasserschwall nicht ausreichen.
Der Söldner bemerkte die Bewegung und wusste sie zu deuten. Er nickte dem Wirt unmerklich zu. Augenscheinlich war er klug genug, um zu begreifen, dass man sich in Anwesenheit ehrbarer Wirtsleute und so hoher Herrschaften halbwegs anständig benehmen musste.
Seine Hand glitt von der Waffe fort, er entspannte sich. »Ach lass gut sein, Kleiner. Ich hab’s nicht so gemeint.« Gutmütig klopfte er Jock auf die Schulter. Das war zuviel. Der Junge hatte den Jähzorn seines Vaters geerbt. Und leider auch seine Sturheit. Er übersah, dass der Söldner im Begriff war, sich wieder zu setzen und die Sache auf sich beruhen zu lassen. Er packte den Wamskragen des Söldlings.
»Winde dich jetzt nicht heraus du Feigling!«, schnauzte der Junge mit der eindrucksvollen tiefen Stimme, über die er seit einem Mondlauf verfügte. »Du willst wohl kneifen, du Sohn einer thorwalschen Laus.«
Die friedfertige Stimmung des Söldners kippte. Er betrachtete die schwielige junge Hand an seinem Kragen wie ein lästiges Insekt.
»Du kleiner Hosenscheißer fängst an, mir auf die Nerven zu gehen. Verzieh dich und spiel mit Knaben in deinem Alter.« Mit einer schnellen Bewegung griff Helmbrecht nach Jocks Hand und verdrehte sie so, dass der Junge loslassen musste, wollte er sich nicht die Finger brechen. Der Söldner stieß den Jungen von sich.
»Du ...« Jock fehlten die Worte. Und als er sie fand, waren es die Falschen. »Deine Mutter ist eine Hure!«
Das linke Augenlid des Söldners zuckte. »Und deine Mutter ist eine Nostrierin.«
In diesem Augenblick kehrte Mari mit dem Eimer zurück. Radeborst zog ihn ihr aus den Händen. Doch ein kurzer Wink vom Tisch des Prinzen hielt ihn zurück.
»Welch eine Beleidigung.« Prinz Wendelmir führte seinen Weinbecher an die Lippen. Dabei musterte er aus schmalen Augen den Sohn des Schmieds. Sein Blick verweilte jedoch nicht länger als einen Herzschlag, dann prostete er seinen Kameraden zu. »Das verdient eine Lektion, findet ihr nicht? Wenn ich dieser Kerl wäre ...«
Der Prinz musste seinen Satz nicht vollenden. Mit einem Gebrüll wie ein Auerochse zog Jock seine Klinge und hieb auf den Söldner ein.
Die Sonne stand noch immer hoch im Mittag, doch war der Tag nicht mehr derselbe. Mit ausdruckslosem Gesicht starrte Helmbrecht auf den zusammengekrümmten Körper des Jungen herab. Unter dem letzten und unglücklichsten aller Hiebe war der Junge über den umgestürzten Stuhl gestolpert und hatte mit seinem Genick die Tischkante begrüßt. Er rührte sich nicht mehr, und Helmbrecht kannte den Anblick gut genug, um zu wissen, dass er sich nie wieder rühren würde.
Die Stille im Schankraum verkündete es bereits lauter als jede Totenglocke. Warum hatte dieser Tölpel ihn auch mit einer scharfen Klinge angreifen müssen? Das halbe Kind.
Der Wirt war versteinert. Ebenso die Magd. Sie standen in einer Pfütze aus Wasser. Zwischen ihnen lag ein vergessener hölzerner Eimer. Aber es war nur eine Frage der Zeit, bis die beiden und auch alle anderen Gäste zu neuem Leben erwachten. Und dann sah es nicht gut aus für einen einzelnen Söldner, der gerade ein Mitglied der Dorfjugend zu Boron befördert hatte.
Helmbrecht ging, bevor sich der Pöbel formierte.
»He, du!« Der Ruf erreichte ihn an der Tür. Helmbrecht wandte sich um. Die hohen Herrschaften betrachteten ihn mit herablassendem Wohlwollen, wie man einem Tanzbären zusah, der brav ein paar Kunststücke aufgeführt hatte.
»Er hat uns unterhalten. Dies sei für seine Dienste.« Auf einen Wink Prinz Wendelmirs warf einer der Adeligen einen kleinen Beutel in Helmbrechts Richtung. Der Söldner fischte ihn aus der Luft. Den Beutel begleitete der unverkennbare Klang von Silbermünzen.
Helmbrecht verneigte sich kurz. Dann verließ er die Wirtschaft und das Dorf, so schnell er konnte. Er war bereits auf der Straße, als das Geschrei anhob.
»Du Rindvieh«, schalt er sich selbst, »Irgendwann bringt dich deine große Klappe noch um.«
10. Peraine 1035 BF
Wendelmir
Der Morgen des Prinzen begann abrupt mit einer knarrenden Tür und Gernots weinerlichem Singsang. Das übliche Gemisch aus Lobhudeleien und unterwürfigem Betteln, dass »seine Königliche Hoheit doch bitte aufstehen möge, da der ehrwürdige Wolorion ...«
Wendelmir hörte nicht zu. Rumelias Hände, die zärtlich über seinen Bauch und seine Schenkel strichen, hatten viel mehr zu bieten als der nervtötende Kammerdiener. »Wolorion kann mich.«
Er zog Rumelia an sich und vergaß auch nicht, Melissa zu küssen. Sie massierte ganz vorzüglich. In Andergast verstanden die Huren vomWilden Eberihr Handwerk am besten. Selbst ihr albernstes Kichern gab einem Mann das Gefühl, ein wilder Auerochse zu sein.
Gernot verstummte plötzlich. Warum, kümmerte Wendelmir erst, als eine zweite Stimme das monotone Jammern des Leibdieners ersetzte. Ein Klang wie Samt und Seide. Verführerisch, befehlsgewohnt, kokett und ganz Weib. Allerdings war der Tonfall nicht im Geringsten lieblich. »Keine Sorge. Seine Königliche Hoheit wird aufstehen.«
Ohne weitere Vorwarnung wurde die Daunendecke zurückgezogen. Wendelmir grunzte unwillig.
»Und sie da. Das Hurenpack. Sie können jetzt gehen. Ein Lakai wird sie für ihre Dienste angemessen entlohnen.«
Die Mädchen zögerten, aber Wendelmir brachte nicht die Kraft auf, sie festzuhalten. Also beugten sich seine kleinen Gespielinnen der höheren Gewalt und verflüchtigten sich wie ein feuchter Traum.
»War das nötig?« Wendelmir setzte sich auf und warf seiner ungebetenen Anstandsdame einen ungnädigen Blick zu. »Warum bist du darauf aus, mir den Morgen zu verderben?«
Sie stemmte die weißen Hände in die schlanken Hüften. Das grüne Kleid, das er ihr im letzten Sommer geschenkt hatte, stand ihr noch immer gut. Er bedauerte nur, dass es so bieder war. Vielleicht war es ratsam, noch einmal den Schneider kommen zu lassen, damit er für etwas Aufreizenderes Maß nehmen konnte. Aber das geziemte sich nicht bei Hofe. Zumindest nicht in Andergast.
Die Morgensonne zauberte einen silbernen Schimmer auf ihr weizenblondes Haar und verlieh ihrer hellen Haut jene vornehme Blässe, für die die Schabracken des Hofs Berge von Puder benutzten. Seine schöne Geliebte hingegen erfreute sich aller Gaben der Jugend. Sie ließ ihr hüftlanges Haar wie einen Schleier aus Goldgespinst über den Rücken fallen. Die verführerische Hexe wusste nur zu genau, was ihm gefiel. War doch jede noch so kleine Geste, vom lieblichen Schmollmund bis zu den halb streng, halb kokett hochgezogenen Brauen, geneigt, ihn willenlos und gefügig zu halten.
In Augenblicken wie diesen, erschien sie vor seinem bierseeligen Blick wie ein glitzerndes Juwel zwischen Kieselsteinen. Er ließ ihre sanft schaukelnden Hüften und die Rundungen ihres Busens nicht aus den Augen, während sie ihm mit einer Waschschüssel zu Leibe rückte. Gernot hatte sich diskret zurückgezogen.
Die sanfte Liebkosung des Schwamms und zarte Küsse in Wendelmirs Nacken täuschten jedoch nicht über Silvanas schlechte Laune hinweg. Wie immer, wenn sie ihn mit den Dirnen vomEbererwischte, schwieg sie sich aus oder nörgelte. Diesmal war sein Haar ihr nicht recht. Auf einmal war es wieder zu lang. Ob er denn in ganz Andergast auf seinen Reisen keinen ordentlichen Barbier finden könne? Und überhaupt waren ihr seine Reisen zu ausgedehnt, und ob es ihn gänzlich kalt lasse, dass sie sich der Nachstellungen des jüngsten Sprosses der von Eschfurt-Lilienbachs erwehren müsse?
»Wenn du nicht eingreifst, wird er noch bei Vater um meine Hand anhalten.« Auf dem Höhepunkt ihrer Tirade angekommen, schleuderte sie den nassen Schwamm in seinen Schoß.
Wendelmir schnaubte. Mit einer schnellen Bewegung entsorgte er Schwamm nebst Waschschüssel auf die Dielen und angelte sich ein Leinentuch, das Gernot vorsorglich auf seinem Nachttisch zurückgelassen hatte. »Worauf willst du hinaus?«
Sie brachte ihm frische Wäsche und ein Obergewand. Dramatische Seufzer und theatralische Augenaufschläge begleiteten das Knöpfen seines Wamses. »Ich werde nicht jünger.« Mit geübter Routine richtete sie seinen Spitzenkragen. »Mein Vater wird langsam ungeduldig. Natürlich ahnt er das mit uns. Aber solange du nicht offiziell um meine Hand anhältst, wird er dem Arrangement nicht trauen. Seine Laune wird schlechter und er ist ungnädig, seit Base Traviagund geheiratet hat. Sie ist erst siebzehn, und ihr Vater hat sich pausenlos darüber beschwert, wie spät er sie an den Mann gebracht hat.
»Du hast zwanzig Lenze gesehen. Na und?«
»Aber wenn du so weitermachst, werde ich eine alte Jungfer.«
Unvermittelt schlang sie ihre Arme um seinen Hals und schmiegte sich an ihn. Der süße Duft von Ingerimmsglöckchen stieg ihm in die Nase. »Was spricht denn dagegen, dass du mir einen Antrag machst?« Ihre Lippen hauchten ihm süße Küsse aufs Schlüsselbein. »Dein Vater wäre einverstanden. Meiner wäre am Ziel seiner Träume. Und du müsstest nicht mehr vor der schrecklichen Wieselinde flüchten.«
»Und du wärst endlich eine ehrbare Matrone.«
»Matrone? Das verbitte ich mir. Aber ehrbar. Dagegen hätte ich nichts. Falls wir doch einmal Tsas Segen empfangen, dann ...«
Er schob sie von sich. »Wie kommst du jetzt darauf? Eben planst du noch unsere Hochzeit. Nun schon die ersten Blagen.«
Er trat vor den polierten Silberspiegel über seiner Ankleide und überprüfte selbst noch einmal den Sitz des elenden liebfeldischen Spitzenhemdes und des Brokatwamses, das jeden Mann wie einen liebeskranken Fasanenhäher erscheinen ließ. »Wir sind noch jung.« Eine tiefe Furche erschien auf der Stirn seines Spiegelbilds. »Ich habe dir doch gesagt, dass wir nichts überstürzen. Wenn wir erst einmal den Traviabund eingegangen sind und der erste Braten in deinem Ofen schmort, der dir deine Zähne nimmt und stattdessen Hüftspeck zurücklässt, dann werden wir noch genug Zeit haben, einander das Leben zu verderben. Warum habt ihr Weiber es nur so verflucht eilig damit?«
Sie stolzierte hinter seinem Rücken auf und ab wie ein aufgeregtes Perlhuhn und gackerte ebenso laut. »Aber wenn du mich doch liebst! Hast du etwa eine andere?«
Nun ging diese Leier wieder los. Er zählte stumm bis zwanzig.
»Oder kannst du nicht von den Huren lassen?« Sie keckerte wie ein wütendes Eichhörnchen. »Ist es das? Die Zwölfe wissen, dass es mir egal wäre, solange du mir keine Krankheiten ins Bett und keine Bastarde ins Haus schleppst. Von mir aus kannst du auch wie gehabt mit deinen Freunden saufend umherziehen und Andrafaller Bräute umgarnen.«
»Kann ich nicht.« Er fuhr herum. »Vater wird dann darauf drängen, dass ich seine Nachfolge antrete. Dann geht es mir wie meinem Schwager, dem armen Tropf. Gefesselt an ein Stück Dreck mit Gemüse drauf, eingesperrt in einem mittelmäßigen Kerker, der sich Burg nennt. Während dieser liebfeldische Kuckuck das Schloss mit seinen Blagen überschwemmt und seine Brut mein Erbrecht stiehlt. Wenigstens hatten seine Bälger bisher den Anstand früh genug zu verrecken! Und überhaupt, wer bin ich denn, dass ich mir das anhören muss?«
Wendelmir suhlte sich in seinem Zorn. Genussvoll ließ er seine Stimme anschwellen. Mit ein paar Schritten war er bei ihr und hatte sie am Oberarm gepackt. Sie schrak zurück. Ihre Augen schimmerten feucht und die Lippen zitterten. An diesem verdorbenen Morgen bereitete ihm ihr Schrecken Vergnügen. Ja, in seinem schönen, schmalen Gesicht, das die Weiber so anzog, verbarg sich auch eine hässliche Fratze. Es gab Nächte, in denen er es genoss, das Biest zum Spielen hinauszulassen. Oder an einem Tag, der wie saurer Wein schmeckte.
Silvana wurde blass. »Schrei doch nicht so.«
»Was wagst du es, mir Befehle zu erteilen?«
Sein Blick fiel auf die garethische Vase, die sie ihm vor wenigen Tagen zum Saatfest geschenkt hatte. Im nächsten Augenblick zerschellte der gebrannte Ton zu ihren Füßen.
Sie zuckte zusammen und duckte sich unwillkürlich. Doch er hob die Hand nicht gegen sie, denn es würde ihr auch so eine Lehre sein.
Er ließ sie los. »Daran ist nur dieser fremdländische Geck schuld! Setzt euch Weibern diese Flausen in den Kopf. Base Irinia redet daher, als ob Hesinde, diese Horasiergöttin, unser aller Rettung wäre. Das Miststück von Teshkal maßt sich nun ebenfalls noch an, im Rat der Recken mitzumischen und du glaubst, du entscheidest, wann geheiratet wird.«
Der Damm brach. Silvana schluchzte. Die vom Weinen geschwollene Nase und rote Wangen ruinierten ihren edlen Teint.
Zufrieden trat er zurück. »Wag es ja nicht wieder zu vergessen, wo du stehst. Ich räume dir ohnehin bereits viel zu viele Freiheiten ein.« Ohne seine Geliebte noch eines Blickes zu würdigen, verließ er die Kammer.
Draußen zwang er sich, ein paar Mal tief durchzuatmen. Dieses Weibstück. Anstrengend, anmaßend und arrogant. Und dennoch wusste er ebenso wie Silvana, dass sie in dieser Nacht wieder bei ihm liegen würde. Und er würde nicht auf sie verzichten können, selbst wenn er sich felsenfest vornahm, sie diesmal leiden zu lassen. Er würde schwach werden. Wie immer.
Der königliche Empfang zog sich in die Länge, bis die Langweile an einem klebte wie Fennschlamm an den Stiefeln.
Wendelmir hielt sich mit einem Krug Wein über Wasser. Immerhin war es tröstlich zu sehen, dass seine Kameraden noch schlimmer litten als er. Osgar war sechs Schattierungen blasser als am Abend zuvor. Gwinnling hatte Augenringe so groß und dunkel wie der Thuransee. Eichward war bereits zum dritten Mal weggenickt und nur ein paar kameradschaftliche Ellenbogen in seine Rippen hatten ihn vor einer peinlichen Szene bewahrt. Er konnte nach drei Flaschen Wein beeindruckend laut schnarchen.
Die Truppe hatte imEbernoch bis in den Morgen weitergefeiert. Nun zahlten die Zecher einen Preis, der sich mit Gold nicht aus der Welt schaffen ließ.
König Efferdan hatte bereits mehrfach die Stirn gerunzelt, und der halbe Hof ächtete die jungen Wilden mit gerümpften Nasen und tadelnden Blicken. Der anderen Hälfte war die allgemeine Empörung so egal wie Wendelmir.
Er hatte sich vorerst mit seinem Platz hinter dem Thron abgefunden und genehmigte sich hin und wieder einen unauffälligen Schluck Rotwein. Das war ja alles nüchtern nicht auszuhalten. Während ein paar Gesandte der albernischen Krone ihre wortreiche und beeindruckend belanglose Aufwartung machten, hing er seinen eigenen düsteren Gedanken nach. Silvana legte in den letzten Wochen in Sachen Heirat eine verdächtige Hartnäckigkeit an den Tag.
Dann trugen zwei Viehbarone von hinter dem Wald einen langweiligen und nicht minder langwierigen Streitfall vor. Der Krug ging bereits zur Neige, der Vormittag jedoch zog sich. Selbst seine Majestät, der liebfeldische Thronräuber, sah aus, als wünschte er sich, woanders zu sein. Wäre er doch nur im Lieblichen Feld geblieben. Aber seit König Wendolyns Ermordung durch den eigenen Sohn war die königliche Erblinie nun einmal den Bach heruntergegangen. Als Wendolyns älteste Tochter Varena damals einen horasischen Baronssohn geheiratet hatte, hatte niemand ahnen können, dass ihr Vater und ihre Brüder innerhalb weniger Jahre sterben und sie und vor allem ihren Ehegatten als Erben des Throns zurücklassen würden.
Wie Efferdan schon dasaß, den Rücken trotz stundenlangem Sitzen gerade, den Bart stets manierlich gestutzt, die klaren grünen Augen aufmerksam auf den noch so langweiligsten Bittsteller gerichtet. Die Gewänder scheinbar bescheiden, aber doch auf subtile Art protzig. Die Goldborte am Kragen war viel zu fein gewebt, um aus Andergast zu stammen. Das war doch pure Provokation! Und Efferdan ein nervtötender Streber durch und durch.
Wenn Vater doch damals nur genug Mut aufgebracht hätte, als Wendolyns Bruder seinen eigenen Erbanspruch durchzusetzen. Nominell war Varena zwar die nächste in der Reihe gewesen, aber sie war eine Frau und damit undenkbar auf dem Angergaster Thron. Und ihr Mann war eben kein echter Zornbold. Ansonsten wären die Audienzstunden garantiert wesentlich kürzer ausgefallen, weil ein Zornbold sich eben auf das Wesentliche beschränkte.
Sonnenstrahlen, die durch die engen Fenster in den Thronsaal fielen, krochen gemächlich über die Eichenbohlen.
Als endlich eine Silberglocke hell und fröhlich die mittägliche Pause zur Praiosstunde ankündigte, huschte ein verhaltener, aber mehrstimmiger Seufzer durch den Saal. Mit würdevoller Eile strebte der Hofstaat nach draußen. Ein Großteil tat es der königlichen Familie gleich und flüchtete in die eigenen Gemächer, um dort ein Mittagsmahl einzunehmen.
Doch ein paar Leute schlenderten gemächlich an der Ahnengalerie vorbei in den Innenhof, um dort die wärmende Sonne zu genießen. Wieder andere zogen sich mehr oder weniger diskret in die Vorzimmer zurück, um dort bei Wein und Bier Tratsch und große Politik auszutauschen.
Früher waren die königlichen Versammlungen kürzer. Vieles ließ sich bei Wildbret und Bier zum Abend in froher und vertrauter Runde besser aushandeln als bei dieser drögen Verschwendung von Lebenszeit. Aber seit der Liebfelder das Ruder an sich gerissen hatte, erhielt auch der niedere Adel Zugang zum Hof. Neuerdings sah man Gestalten, die bei den früheren Herrschergenerationen höchstens für Gelächter gesorgt hätten. Die von Gossendrecks und Hintertorfs scharwenzelten um den königlichen Stuhl wie Fliegen um einen Haufen Dung. Sie verdrängten Stück für Stück die stolzen Geschlechter, die seit jeher dem König im Rat der Recken und mit Schwert und Schild zur Seite gestanden hatten. Der Pöbel hielt Hof in Andergast. Gefolgt von einem Haufen irritierender Ausländer. Die großen Familien hingegen zogen sich mehr und mehr zurück. Vielleicht um abzuwarten und auf besseres Wetter zu hoffen.
Aber ein Wetterwechsel war nicht in Sicht. Die königliche Qualle erfreute sich bester Gesundheit. Kein einziges Wölkchen trübte den blauen Himmel der liebfeldischen Regentschaft. Nicht einmal die Nostriaken schienen noch den Mumm für einen anständigen Krieg zu besitzen, seit sich auf ihrem Thron eine Magierin das Hinterteil breit hockte. Wenn Efferdan erst einen Erben hatte, war sein Geschlecht kaum noch auszutilgen.
Missmutig starrten die Ahnen aus der Finsternis ihrer von Fackelrauch verdunkelten Gemälde auf Wendelmir herab. Manchmal glaubte er Verachtung in den Augen der stolzen Zornbolds zu lesen, ein anderes Mal Mitleid für die Generation der Beraubten und der Zukurzgekommenen.
Ein einziger Trost blieb den trauernden Hinterbliebenen der alten Tradition. Das gemeinsame Leid vereinte alle, die das Pech hatten, nicht rechtzeitig eine gelegene Ausrede für etwaige Abwesenheit gefunden zu haben.
Obwohl es seinen üblichen Gewohnheiten widersprach, entschied Wendelmir, die Pause im Innenhof zu verbringen. Die Sonne verlieh den Frühlingstagen eine besondere Süße. Ein wenig frischer Wind konnte seinem noch halb verkaterten Schädel nicht schaden.
Er bereute die Entscheidung jedoch, kaum dass er auf die Freitreppe trat. Denn im Hof hatte sich ein Schwarm Harpyien niedergelassen: die unverheirateten Jungfern. Wendelmirs Gefahrensinn schlug an. Doch die Schrecklichste und Hässlichste hatte ihn bereits erspäht.
Wieselinde von Otternpfot, Osgars Schwester, wuchtete ihre allzu üppigen Rundungen auf ihn zu. »Eure Hoheit, wie schön, dass Ihr Euch zu uns gesellt.« Sie gab etwas von sich, das vermutlich ein kokettes Kichern sein sollte.
Dumpfer Kopfschmerz breitete sich zwischen seinen Schläfen aus. Sein erster Impuls war, sich auf der Stelle umzudrehen und das Weite zu suchen, dann ließ sich später immer noch behaupten, er habe die Begrüßung nicht gehört.
Doch in diesem Augenblick spuckte das Hauptportal den allseits beliebten Turniermarschall Wolorion von Kolburg nebst den albernischen Gesandten aus.
Wolorion, das kalte Reptil, erkannte mit einem Blick den Zusammenhang zwischen Wendelmirs gehetztem Blick und dem begehrlichen Hüsteln der Schreckgestalt. Was für ein Zufall, dass Wolorion justament stehen blieb, um nicht erkennbaren Staub von seinem Wams zu zupfen. Er blockierte die Tür lange genug, um jede halbwegs unauffällige Fluchtmöglichkeit zu ruinieren. Diese Ratte! Von allen niederadeligen Emporkömmlingen hasste Wendelmir diesen von Kolburg am innigsten. Der Kerl hatte stets einen wissenden Blick.
Unter den wachsamen Augen der Weiblichkeit und der Gesandten rang sich Wendelmir ein Lächeln ab. »Fräulein von Otternpfot.«
Sie reckte ihm ihre Hand hin. Er ignorierte die Geste so gut er konnte, doch schließlich zwang ihn ein Hüsteln Wolorions, die Wurstfinger zu ergreifen und seine Lippen in die Nähe ihres Handrückens zu bringen. Rosenduft stieg ihm in die Nase. Zu süß. Zu üppig. So etwas trugen doch nur alte Matronen. Aber davon war Wieselinde von Otternpfot leider nicht sehr weit entfernt.
Ihre Augen glitzerten triumphal. Sie reckte ihr Doppelkinn, wohl um ihr neues Goldkollier zur Geltung zu bringen. Die Arbeit war zu fein und zu verspielt, um aus einer Andergaster Schmiede zu stammen. »Manche der südlichen Sitten sind doch recht reizvoll, findet Ihr nicht?« Sie gurrte wie eine sterbende Taube. »Gewagt. Aber charmant, nicht wahr?«
Die albernischen Gesandten grinsten. Bloß Wolorion behielt seine verkniffene Miene bei.
Wendelmir blieb eine Antwort schuldig. »Habt ihr Euren Bruder gesehen?«, wagte er ein Ablenkungsmanöver. »Ich muss etwas mit ihm besprechen. Es ist von äußerster Dringlichkeit. Wenn Ihr mir in dieser Angelegenheit behilflich ...«
In diesem Augenblick erspähte Wendelmir seinen Bastardbruder Bogumil. Er schlenderte von den Stallungen herüber. Wendelmir gab ihm einen unauffälligen Wink. Glücklicherweise verfügte Brüderchen über gute Augen. Bogumil nickte unmerklich und beschleunigte seine Schritte.
»Euer Königliche Hoheit?«, unterbrach er die kümmerlichen Reste einer höflichen Konversation mit einer impertinent nachlässigen Verbeugung. »Euer Vater wünscht, das Mittagsmahl mit Euch einzunehmen. Im Jagdsaal sind die Speisen bereits aufgetragen.«
Wendelmir nickte wohlwollend. Eine gute Ausrede. Seiner Verfolgerin warf er lediglich einen kurzen, ausdruckslosen Blick zu. »Entschuldigt mich bitte.« Für die Diplomaten und Wolorion blieb sogar ein kurzes, falsches Lächeln übrig. »Die Herren.«
Die Männer deuteten eine Verbeugung an. Wendelmir folgte seinem Bruder, dabei ließ er es sich nicht nehmen, ein fröhliches Liedchen zu pfeifen.
»Eine gute Ausrede«, lobte er, sobald sie außer Hörweite waren.
»Ihr werdet Euch wünschen, es wäre eine, mein werter ...« Bogumil geriet ins Stocken und überspielte die Lücke mit einem allzu offensichtlichen Räuspern. »Prinz«, beendete er schließlich seinen Satz.
Weil dieser Bastard ihn immerhin vor dem Burggespenst bewahrt hatte, ließ ihm Wendelmir die seltsame Anrede und auch den Beinahe-Versprecher durchgehen. Der arme Kerl legte viel zu viel Gewicht auf ihre Blutsverwandtschaft. Er begriff nicht, dass ein Wendelmir von Zornbold nie der Bruder eines Mägdebalgs sein würde. Doch in seiner offensichtlichen Hoffnung, die Anerkennung der Zornbolds zu finden, war Bogumil immerhin ein nützliches Werkzeug. Ein wenig zu frech mit der Zunge, aber ein loyaler Diener. Man ernährte ihn, räumte ihm ein paar Privilegien ein und hatte ihn das Waffenhandwerk gelehrt. Wenn Vater gnädig war, dann winkte nach einem Offizierspatent vielleicht sogar eine gute Heirat in eine niedere Adelsfamilie. Aber das war das Ende der Karriereleiter für einen armen Hund, der das Pech hatte, nobles und gemeines Blut zugleich in seinen Adern herumzutragen.
Auch Wendelmir bediente sich des Bastards bei Bedarf. Bogumil besaß aufgrund seiner gewöhnlichen Natur ein paar Kontakte in die Niederungen Andergasts, die ein ums andere Mal durchaus gelegen kamen.
Am Ende dieser Betrachtungen angekommen, drängte sich der andere, eigentlich bemerkenswertere Teil des Gesprächs in Wendelmirs Überlegungen. »Was soll das heißen,ich wünschte?«
»Vater verlangt tatsächlich nach Euch. Und ich nehme an, er wird ungehalten über Eure Abwesenheit sein.«
»Du hast dich mit der Suche nach mir ja nicht gerade beeilt.«
»Vergebt mir, dass ich Euch nicht früher fand.« Bogumils Reue war so ehrlich wie ein Fasarer Würfelspiel. »Ich hatte den Eindruck, ich erwischte Euch gerade noch rechtzeitig.«
»Und deswegen darfst du jetzt auch verschwinden, oder ich setze mich dafür ein, dass Vater dich mit der grauenvollen Wieselinde verheiratet. Ich finde schon allein zum Essen.«
»Ich zweifle nicht daran, dass das Fräulein von Otternpfot viel zu gut für einen wie mich ist.« Bogumil verneigte sich grinsend. »Sie hat ihre Ziele eindeutig höher gesteckt. Aber wie Ihr wünscht, Königliche Hoheit. Ich werde die Damen ein wenig unterhalten.«
»Es heißtEuerKönigliche Hoheit«, rief Wendelmir ihm nach. Dann verfiel er in einen langsamen Trott. Der Weg zum Mittagstisch mochte sich ruhig ein wenig ziehen. Er verspürte kein gesteigertes Bedürfnis nach einem Gespräch. Wahrscheinlich hagelte es ohnehin wieder nur Beschwerden.«
Wenzeslaus von Zornbold glich selbst im edlen pelzbesetztem Tabbert mehr einer krummen Kiefer, denn einer stolzen Eiche. Bier, Wein und Speck hatten seinen Bauch gerundet, die Wangen waren voll, aber beinahe so grau wie das schüttere Haar. Seinen Händen fehlte die alte Kraft. Das leichte Zittern, das sie seit einem Götterlauf befallen hatte, war kaum zu verbergen. Auf den Wangen des alternden Ritters zeichneten sich blaue Äderchen ab, das Haar wurde spärlicher.
Auf einmal erschien Wendelmir der große Jagdsaal wie eine Gruft. Die Schädel mächtiger Zwölfender starrten von den Wänden blicklos ins Leere. Die dicken Webteppiche, die die Wände zierten und den Raum vor der Kälte des alten Gemäuers schützten, wirkten ausgeblichen. Den darauf abgebildeten Jägern und ihrer Hundemeute fehlte jegliches Leben. Selbst die aus Horn geschnitzten Kronleuchter schienen ein Zeichen des Todes und der Schwäche. Sogar Vaters Kammerdiener, der devot neben dem Kamin wartete, erschien gebeugt und gebrechlich.
Der alte Mann saß im Schatten seines eigenen früheren Glanzes allein an der langen Tafel, die bequem zwei Dutzend Männern Platz bot. Aber Efferdan jagte nicht mit der gleichen Leidenschaft wie seine Vorgänger und so verwaiste das Zimmer.
Wenzeslaus passte in diese Totenkammer. Lustlos stocherte er in einem gefüllten Hecht herum. Ein zweiter wartete auf den Neuankömmling. Der große Fisch glotzte mit seinen blinden Augen vorwurfsvoll vor sich hin.
Wendelmir nahm Platz. Sofort eilte der Kammerdiener herbei, doch Wendelmir winkte ab und scheuchte den aufdringlichen Lakaien mit einem warnenden Blick fort.
»Wie erfreulich, dass du es noch schaffst, deinem eigenen Vater die Aufwartung zu machen, Junge. Ich habe schon befürchtet, die Niederhöllen hätten dich endgültig zu sich geholt, weil du dort schon vermisst wirst.«
Wendelmir zog sich einen Stuhl heran. Der Alte war ja wieder bestens gelaunt.
»Ich bin eben viel unterwegs.«
»Du schlägst dich so durch. Bisher hattest du Glück. Aber irgendwann werden dich deine Dummheiten Kopf und Kragen kosten.«
Ging die alte Leier schon wieder los? An Vater war neuerdings ein Praiospfaffe verloren gegangen. Diesmal gab Wendelmir dem alten Mann nicht die Genugtuung, sich auf eine Diskussion einzulassen.
»Hat mein verehrter Herr Vater wenigstens einen Becher Wein für mich?«
»Hast du nicht schon genug getrunken? Bediene dich lieber an der Ochsenschwanzsuppe. Sie ist köstlich.« Ein gichtgekrümmter Finger deutete auf eine irdene Terrine. Ihr entströmte der Geruch fetter Brühe.
Wendelmir lächelte spöttisch. »Ist ein entmannter Stier tatsächlich das Beste, das man hier bekommen kann?«
Wenzeslaus runzelte die Stirn. Doch sein strafender Blick prallte kraftlos an der bissigen guten Laune seines Sprösslings ab.
Ohne eine Aufforderung abzuwarten, bediente sich Wendelmir am irdenen Weinkrug, der zwischen ihnen auf dem Tisch stand. »Ich habe für meinen Teil noch nicht einmal annähernd genug getrunken, um diesen Thronräuber zu ertragen.« Wendelmir leerte den Becher in einem Zug und schnitt eine Grimasse. Sein Vater hatte immer noch den gleichen scheußlichen Geschmack. Engasasaler Nordhang. Ungesüßt. Es gab nur einen Grund diese Kreuzung aus Wein und Pferdepisse ohne Honig und wohlschmeckende Kräuterzusätze hinunterzuschütten. Wenigstens trug man beim Trinken nicht das abgeschmackte Liebliche Feld auf der Zunge.
Die Mundwinkel des Alten zuckten amüsiert. Wendelmir setzte seinen Becher mit übertriebener Sorgfalt ab, dabei lehnte er sich vor und sah seinem Vater tief in die Augen.
Die Zeiten, da er noch einen Tropfen Respekt für den Alten übrig gehabt hatte, waren so vergangen wie die glorreichen Tage des Hauses Zornbold. Die Wut des Stieres war erloschen. Der alte Mann war nur noch ein lahmer Ochse.
»Warum wolltest du mich sprechen, Vater?«
Wenzeslaus legte eine bedeutsame Pause ein, die Wendelmir mit ein paar Bissen Fisch überbrückte.
»Deine Schwester hat geschrieben«, verkündete der alte Mann schließlich.
Wendelmir wartete auf die Pointe, aber sie kam nicht. »Und?«
»Sie wird uns bald einen Besuch abstatten.«
»Tatsächlich?«
»Und es wird deine Aufgabe sein, dich um sie zu kümmern. Mach mit ihr ein paar Ausflüge. Zeig ihr Andergast und die Umgebung. Unterhalte sie ein wenig. Du bist noch jung, du hast Kraft und Energie. Mir steckt Borons Gruß schon in den Knochen. Du weißt ja, wie es um meine Füße steht.«
Oh ja. Wendelmir bewunderte die bemerkenswerte Eigenschaft dieser kranken Knochen. Sie schmerzten stets, wenn unwillkommene Aufgaben im Anflug waren. Und die gute Wenzeslausia gehörte eindeutig dazu. Insbesondere seit ihrer Vermählung.
»Bringt sie ihren Tölpel von Ehemann mit?«
»Sprich nicht so von deinem Schwager!« Wenzeslaus ließ sich Suppe nachschenken. »Er ist ein rechtschaffener Mann.«
»Er ist ein rechtschaffener Idiot, der ohne seine Frau kaum einen Fronhof verwalten könnte. Deswegen hat sie ihn ja genommen, nehme ich an.«
»Wie dem auch sei. Du wirst dich um sie kümmern.« Der Alte legte sein Besteck zur Seite. Der Kammerdiener eilte dienstbeflissen herbei und schenkte beiden Männern Wein nach. Diesmal ließ Wendelmir ihn gewähren, führte aber den Becher nicht zum Mund. Der Auftrag schmeckte so sauer wie der Wein.
»Wann?«
»In wenigen Tagen wird sie uns beehren«, verkündete Wenzeslaus zufrieden. »Ich gehe davon aus, dass du keine Verpflichtungen hast, die du nicht absagen könntest.«
»War das dann alles?«
»Alles andere ist ohnehin längst gesagt, meinst du nicht?« Der Alte grinste verschlagen. Zum ersten Mal während dieses Essens glaubte Wendelmir, eine Ähnlichkeit zwischen sich und diesem Greis zu erkennen.
»So ist es.« Wendelmir stand auf, verneigte sich und verließ den Jagdsaal. Im Flur war es wie immer zugig und dunkel. Das Sonnenlicht drang nicht bis hierher durch. An seiner statt rußten Fackeln und Talglichter duldsam vor sich hin.
Zum Glück dauerte es nicht lange, bis Osgar und Eichward auftauchten. Da König Efferdan die jungen Wilden bei seinem Empfang wohl kaum vermisste, verließen sie das alte Gemäuer und machten dort weiter, wo sie in der Nacht zuvor aufgehört hatten.
Kapitel 2
12. Peraine 1035 BF
Helmbrecht
Grübelnd betrachtete Helmbrecht das Stück Wildnis, das die Bewohner der kleinen Dörfer am Oberlauf des Ornib für eine gepflegte Straße hielten.
Licht auf dem glitzernden Wasser des Flusses und Frühjahrsschlamm unter den Schuhen. Zudem eine kühle Frühlingsbrise, die in den Steineichen rauschte, dornige Schlehenbüsche, blühende Haselsträucher und duftende Bärlauchwiesen.
So sah also das Ende der Welt aus. Zumindest, wenn man der Joborner Redewendung Glauben schenkte, dass nach Nibquell die Welt aufhörte. Danach kam nur noch Goblinland. Selbst die Holzfäller und Fischer wagten sich kaum weiter in die Waldwildnis als die paar Meilen den Ornib hinauf, wo er laut Steinrich, dem buckligen Kerl, den Helmbrecht im Gasthaus angeheuert hatte, »als kleines Rinnsal aus einer Felswand« plätscherte, »so wie wenn Efferds Schafe pinkeln würden.« Doch spätestens dann bestand die spärliche Gesellschaft höchstens aus Waldschraten, Schwarzpelzen oder nostrischen Wegelagerern.
Händler und fahrendes Volk verirrten sich nie so tief in die Wildnis. Hier waren selbst Joborn und die Ornibsmündung in weite Ferne gerückt.
Steinrich deutete auf einen halb zugewachsenen Pfad. Weit ausladende Gesten begleiteten seine Ausführungen, seit bei einem Handschlag ein paar Heller den Besitzer gewechselt hatten.
Einzelne von Moos überwucherte Feldsteine ließen erahnen, dass hier früher einmal Karren entlanggefahren sein mochten. »Machste mal einen flotten Schritt und hälste dich östlich«, erklärte der Bucklige in so breitem Dialekt, dass selbst der Joborner Söldner Mühe hatte, den Silben eine Bedeutung zu entreißen. »Immer weiter, als willste die Morgensonne einholn. Dann kommst in paar Togn nach Weiersboch, dann nach Waldkönigen und dann zum großen See. Aber lass dou nit von Schwarzpelzen einfang. Und jahste nie inner Nacht, denn da sinds unterwegs, das dunkle Volk von Hexen und Irrlichtern. Nur immer mit de Sonne.«
»Wieviele Tage?«
»Kommt drauf an, wie joot deine Stiefel sind, näch? Ach ja, in Waldkönigen, die Leut sind da verschrobn. Machen wohl Geschäfte mit der Schwarzpelzbrut. So redn die auch. Die verstehst fast nit.«
Steinrich bedachte den Söldner mit einem aufmunternden Schulterklopfen, dann war die Wegbeschreibung des Nibqueller Schankburschen vollendet. Er nickte Helmbrecht noch einmal freundlich zu. Dabei entblößte er ein paar beachtliche Zahnlücken. Schließlich schlurfte er die Dorfstraße in Richtung Gasthaus zurück.
Seufzend betrachte Helmbrecht den ihm gewiesenen Weg. »Breite Straße, kann man gar nicht übersehen …« Er schüttelte den Kopf.
Bis Beilstatt war die Strecke noch einigermaßen erträglich gewesen, danach war die Landstraße immer mehr zum Waldpfad verkommen. Kein Wunder, Nibquell lag bereits auf der nostrischen Seite. Anscheinend hatte man hier seit Jahren kaum Zeit gehabt, sich um die Instandhaltung der Wege zu kümmern. Insbesondere nicht die, die nach Andergast führten. Umgekehrt setzten auch die Beilstätter freiwillig keinen Fuß ins Feindesland. Das wiederum ersparte den ortsansässigen Adeligen beider Seiten die Unterhaltung eines teuren Grenzpostens.
Aber es hatte auch zur Folge, dass die Pfade am Rande des großen Waldes eher Wildwechseln glichen als befestigten Wegstücken. Jeder, der einigermaßen bei Verstand war, reiste von Joborn aus über Andergast zum Thuransee.
Aber der unglückliche Zwischenfall in Steinborn hatte eine Änderung der Route erfordert. Wer wusste schon zu sagen, ob der Dorfschmied nicht etwas auf der hohen Kante hatte und dem vermeintlichen Mörder seines Jungen irgendeinen üblen Spießgesellen hinterherschickte. Und wer in Andergast jemanden suchte, der lauerte seiner Beute stets zwischen Andergast und Joborn auf. Da musste jeder irgendwann vorbei.
Es sei denn, man war so verrückt, mit den Ottern den Ornib hinaufzuziehen und sich wie ein Rotpelz in die Wälder zu schlagen.
Die Joborner Abstammung half dem Grenzgänger. Die nostrischen Hinterwäldler betrachteten die Holzflößerstadt noch als angestammten Teil ihres Reiches, und daher galt der allgemeine Groll gegen die Andergaster weniger für die Joborner. Im Gegenteil. Selbst Steinrich hatte Helmbrecht aufrichtig dafür bedauert, dass er nun unter den Andergarstigen leben musste.
Je länger der Söldner am Ufer des schmalen Flusses stand und in die undurchdringliche Waldwildnis starrte, umso irrsinniger erschien ihm sein Plan, Andergast zu umgehen und dennoch rechtzeitig zum großen Markt in Thurana zu sein. Doch um sich einem Handelszug nach Winhall oder Greifenfurt anzuschließen, bot der Frühjahrsmarkt in Thurana die einzige Möglichkeit. Die Alternative bestand darin, den Sommer über in Nibquell, Beilstatt oder irgendeinem anderen kleinen Waldkaff zu versauern. Einen Sommer lang brauchte das Gras für gewöhnlich zum Wachsen.
Plötzlich spürte der Söldner einen Blick in seinem Rücken.Er fuhr herum, hatte das Kurzschwert schon halb gezogen.
Doch die Bedrohung hielt sich in Grenzen. Ein schmächtiger junger Mann mit straßenköterblondem Haar und einfacher Kleidung war hinter ihm die Dorfstraße hinaufgekommen. Sommersprossen zierten seine Nase und Wangen. Das Haar hing ihm in einem losen Zopf über die Schultern.
Er hielt ein paar Schritte Abstand und musterte den Söldner so offen wie gelangweilt. Unter einer Weste aus Lammfell lugte eine braune Leinentunika hervor. Seine Hose war abgewetzt, die flachen Schuhe waren aus einfachem Leder gefertigt und mussten auf eine teure, genagelte Sohle verzichten. Eine bestickte Tasche beherbergte seine Habseligkeiten.
Helmbrecht setzte eine grimmige Miene auf. So einen neugierigen Dorfburschen konnte er gerade nicht brauchen. Nicht schon wieder. »Was willst du?«
Der halbstarke Bengel zuckte die Achseln. Dabei gähnte er ungeniert. »Ich frage mich nur, ob du da Wurzeln schlagen willst.«
»Was geht’s dich an?«
Eine Elster hüpfte in den Zweigen eines Haselstrauchs umher. Offensichtlich auf der Suche nach kleinen Ästchen für ihr Nest. Ihr galt nun die Aufmerksamkeit des jungen Mannes. »Du hast doch mit dem Gequatsche angefangen«, murmelte er abweisend.
»Na, weil du mich angestarrt hast«, verteidigte sich der Söldner. Die Gesprächsführung verwirrte ihn. Und was war an dieser Elster überhaupt so interessant? Oder an den jungen Gnitzen, die das Knäblein plötzlich im Wasser entdeckte.
»Kriegt man einen Schatz, wenn man lange genug in den Fluss starrt?«
Der junge Mann sah nicht einmal auf. Stattdessen hockte er sich am Ufer nieder, streckte die linke Hand aus und berührte die Wasseroberfläche mit den Fingerspitzen. »Weiß ich nicht.«
Etwas an seiner Art beunruhigte Helmbrecht. Auch wenn er nicht zu sagen wusste, was genau ihn an dem Jungen störte. War es die träumerische Weise, wie er sich bewegte?
»Was soll das werden?«
»Wenn du so viel reden willst, warum gehst du nicht zurück in das Gasthaus?«, schlug der Junge vor. »Da kommst du doch her, oder?«
Helmbrechts Hand wich nicht vom Heft seines Kurzschwertes. Die rau-weiche Lederwicklung unter seinen Fingern besänftigte die seltsame Unruhe, die ihn ergriffen hatte. Dabei trug der Knabe außer einem primitiven Steinmesser in einer Lederscheide keine erkennbaren Waffen mit sich. »Und wo kommst du her?«
Endlich wandte sich ihm der Junge wieder zu. Aber er schwieg. Er hatte eine komische Art, herüberzustarren. Aufmerksam, aber nicht interessiert. Neugierig und gelangweilt zugleich.
»Was ist mit dir los?«, machte sich der Söldner Luft.
»Nichts. Aber du scheinst nervös zu sein, so wie du deine Waffe umklammerst.«
Verdammt, der Kleine war ein guter Beobachter. »Ich mag es eben nicht, wenn man hinter mir herumschleicht.«
»Vielleicht solltest du dann gehen«, schlug der Junge vor und fuhr fort: »Das werde ich jetzt auch tun.« Unvermittelt sprang er auf und schlenderte weiter den Fluss hinauf. Ohne Gruß oder einen einzigen Blick zurück.
Helmbrecht sah ihm nach. Er merkte erst, dass ihm der Mund offen stand, als eine Fliege einen Landeversuch auf seiner Lippe machte. Verärgert scheuchte er das lästige Insekt fort. »He!«, rief er dem Jungen nach. »Warte!«
Aber der seltsame Knabe ließ nicht erkennen, ob er den Ruf gehört hatte. Er verschwand zwischen zwei großen Eichen. Eine Weile hörte Helmbrecht ihn noch durchs Unterholz rascheln, dann wurde es wieder still.
Schließlich tat der Söldner die merkwürdige Begegnung mit einem Schulterzucken ab. »Typisch Dorf«, brummte er vor sich hin. »Das kommt davon, wenn alle miteinander verwandt sind.«
Dann beschloss er, dem Rat des Jungen zu folgen und trat seinen Weg durch die Wildnis an. Wenn so ein schmächtiger Kerl mit einem Messer das konnte, wovor fürchtete er sich dann eigentlich?
Wovor man sich in der Waldwildnis fürchten musste, begriff er erst ein paar Tage später, als er sich unvermittelt der blitzenden Klinge eines Langschwerts gegenübersah.
15. Peraine 1035 BF
Melanor
Melanor schlenderte durch den nächtlichen Wald wie die Unwissenden durch ihre Wohnstube. Ihm, dem Sumen, hingegen war vertraut, wovor andere sich fürchteten. Er war eins mit der Natur. Die angeblichen Schrecken der Wildnis machten ihm keine Angst.
Weiß und kalt thronte die Mondsichel über der Welt und schimmerte durch die schwach belaubten Frühjahrswipfel. Ihr war es egal, ob man sie betrachtete oder nicht. Sie kannte weder Schwäche noch Ermüdung. Fern, schweigend und erhaben trotzte sie jeder Frage, jedem Wort, jedem irdischen Gedanken.
Manche sahen in dem hellsten aller Himmelslichter eine Göttin, andere eine Dienerin der Götter. Melanor jedoch verspürte kein besonderes Wirken, wenn er zum Himmel sah.
Er spürte die Gezeiten der Welt, den schweren Atem der Erde unter seinen Füßen und hörte den leisen, geheimnisvollen Gesang der Nacht.
Manchmal ahnte er, mit welcher Macht der sich wandelnde Mond an allem was lebte, zog. Er spürte die Kraft des Madalichts in den Säften der Pflanzen, oder das besondere Kribbeln von Tau in Vollmondnächten und genoss die ruhevolle Leere, wenn Mada ihr Antlitz vor der Welt verbarg.
Aber nie hatte er das Bedürfnis empfunden, dem Wirken jener uralten Kraft in seinen Gedanken eine andere Gestalt zu verleihen, als die, die er in der Stille des Nachtwaldes erspürte.
Einmal hatte er das Lied eines fahrenden Sängers gehört, der das Madamal mit seiner Liebsten verglich. Aber was um alles in der Welt das Mysterium des Nachthimmels mit irgendeiner vergänglichen Schönheit zu tun hatte, die so oder so in ein paar Götterläufen wieder zu Erde verrottete, das hatte sein Lied nicht erklärt.
Mada erklärte sich nicht. Mada musste sich nicht erklären. Man konnte zuhören, anschauen, fühlen und verstehen oder auch nicht. Die meisten verstanden gar nichts. So wie dieser waffenstarrende Möchtegernkrieger, der weder die Sprache der Vögel kannte, noch dem Plaudern des Baches lauschen wollte. Er war so schnelllebig, so blind und so taub, wie alle, die sich am liebsten nachts in ihren stinkenden Bretterbuden versteckten und die wahre Welt aussperrten.
Melanor senkte den Blick wieder auf den schwarzen Waldboden. Gerade, als er seinen Weg fortsetzen wollte, kroch eine Kröte über seinen linken Fuß. Er ließ sie passieren. Ohne ihn überhaupt wahrgenommen zu haben, setzte das Tier seinen Weg fort.
Melanor sog prüfend die Luft ein. Ein kühler feuchter Hauch streifte ihn, trug den leichten Duft von Frühlingsblüten und nassem Gras. Die Lichtung konnte nicht mehr weit sein.
Er folgte dem Geräusch der Gräser, bis sich der Wald lichtete und eine Kräuterwiese enthüllte. Donf und Egelschreck wuchsen in blühenden Moosbetten, geschützt durch die tauschweren Halme des Waldgrases.
Mitten auf der Lichtung wuchs ein einzelner Farnstrauch. Dort hockte ein vom Alter gebeugter Mann. Er trug eine knöchellange, einfache Robe. Sein schlohweißes Haar und der ebenso weiße, volle Bart, schimmerten bleich in Madas Licht und ließen die wettergegerbte, zerfurchte Haut umso dunkler erscheinen. Mit bloßen Fingern grub er eine unter dem Farn versteckte, großblättrige Staude samt Wurzel aus. Obwohl Melanor seine Anwesenheit nicht verbarg, sah der Fremde nicht auf. Behutsam zog er die Wurzel aus dem Erdreich.
»Ein schönes Exemplar.« Seine Stimme war tief und angenehm. Sie erinnerte an einen gut gelaunten Bären. Doch das harmlose Äußere täuschte nicht über die Aura von Autorität hinweg, die ihn umgab. Melanor fühlte die Macht, die dieser einsame Wanderer ausstrahlte, wie man Sonnenstrahlen auf der Haut spürte. Wie kaum ein anderer verfügte dieser Fremde über die Kraft, seinem Willen Gestalt zu verleihen. Und der Wald beugte sich und akzeptierte ihn als Herrn und Meister. Fahrende Sänger und Geschichtenerzähler wisperten seinen Namen und nannten ihn den mächtigsten Sumen Andergasts. In diesem Moment wurden alle Geschichten wahr. Melanor atmete tief durch, bevor er seinen Fuß ins Wiesengras setzte.
Zufrieden hielt das Großväterchen die Wurzel ins Licht. Sie war klein, kaum länger als einer seiner knochigen, vom Alter gekrümmten Finger. »Ich warte schon lange darauf, dass sie heranreift.« Mit liebevoller Sorgfalt reinigte der alte Sume die Furchen des kleinen Gewächses. Mit einem schwarzglänzenden Dolch trennte er die grüne Staude ab und verteilte die Blätter um den Farn. »Wusstest du, dass die Kräfte der Joruga am stärksten sind, wenn man sie im Licht des zunehmenden Mondes pflückt?«
»So wie viele Kräuter ihre heilenden Kräfte bei Nacht besser entfalten.« Melanor hockte sich zu dem Greis, um die Wurzel besser betrachten zu können. Sie war in der Tat gut und breit gewachsen. Der Augenblick der Andacht ging vorüber. »Ich bin Melanor.«
Der Alte rieb die Wurzel mit einem Tuch ab, bevor er sie in einem Lederbeutel verwahrte. »Ich weiß. Du hast dich ja bereits angekündigt.«
»Dann hat dich meine Nachricht erreicht, Meister.« Einen Herzschlag lang schwebte ein stolzes Lächeln auf den Lippen des jungen Mannes.
»Natürlich.« Der Alte hob eine schlohweiße Augenbraue. »Hast du daran gezweifelt?«
»Noch nie hat einer meiner Diener eine solche Entfernung überbrückt«, gestand Melanor.
Beide Männer machten es sich auf dem Waldboden bequem. Die Nachtnässe störte keinen von ihnen. Der Wald war der Wald, der Tau nicht mehr als ein wenig Schweiß auf der Haut.
Der Alte stopfte ein Pfeifchen. Mit Ruhe entzündete er den nach Kräutern duftenden Tabak und inhalierte einige Male tief. »Deine Fortschritte sind mir zu Ohren gekommen. Deine Kraft und dein Wissen sind gemessen an deinem Alter beachtlich.«
»Ich will noch mehr lernen, Meister Arbogast! Und dein Schüler sein.«
»Deine Leidenschaft entspricht durchaus deinem Alter.« Ein feines Lächeln umspielte die Mundwinkel des betagten Großväterchens.
Melanor spürte einen Nadelstich des Ärgers. Seine Hände suchten eine Tätigkeit, doch der junge Sume ballte sie zu Fäusten und zwang sie, ruhig auf seinen Oberschenkeln zu verharren. »Warum sollte ich meinen Wunsch, mein Wissen zu mehren, verhehlen?« Die Gelassenheit seiner Stimme brachte einen Funken Stolz zum Glimmen. Er war kein Kind mehr und auch der mächtige Arbogast musste das anerkennen. »Das wäre doch eine Lüge.«
»Wunsch?« Der Alte neigte den Kopf und musterte Melanor eindringlich. Sein Gesicht war verschlossen. Nicht einmal die Augen verrieten einen Gedanken. »Oder Hunger?«
Ein Herzschlag genügte, und Melanor begriff, dass er bereits geprüft wurde. Aber was erwartete der Alte? Ehrlichkeit hoffentlich. Denn zwischen Meister und Schüler durfte kein Platz sein für falsches Spiel. »Was wäre schlecht an Hunger?«, erwiderte Melanor schließlich. »Ist das nicht ein natürliches Bedürfnis? Warum sollte ich es mir verwehren?«
»Warum braucht eine mächtige Steineiche Zeit, um zu wachsen? Selbst auf dem besten Boden, am schönsten Platz, mit Wind in den Wipfeln, Humus an den Wurzeln und Sonne im Herzen braucht sie ihre Zeit. Warum willst du schneller wachsen als die Eiche?« Arbogast wiegte nachdenklich das Haupt.
Was wollte er denn hören? »Ich will so schnell wachsen, wie ich kann.«
»Aber das Wachstum reicht nicht nur in die Höhe, Melanor. Es bedeutet auch Reife. Die Wurzeln müssen sich ausbreiten, in die Tiefe greifen, ein Netz bilden. Sonst wankt irgendwann der ganze Baum.«
»Dann hilf mir, Wurzeln zu schlagen. Und wenn es mir an Einsicht mangelt, dann lehr sie mich. Da du von meiner Jugend sprichst, weißt du auch, dass die Jugend schnell zu lernen vermag.«
Wieder neigte der Alte sein greises Haupt. Doch diesmal erschien sein Schmunzeln Melanor als Ausdruck von Zufriedenheit. »Nun gut. Dann werden wir sehen, wie gut du deine Lektionen durchdringst. Ich habe eine Aufgabe für dich.«
Melanor spürte, wie Hitze in seine Wangen stieg. War es geglückt? Nahm ihn Arbogast als Schüler an? Seine Hände zuckten, sie wollten nicht länger untätig im Schoß liegen.
»Du wirst bis zur Zeit der Reife diese Wälder bereisen«, befahl der alte Sume. »Sieh dich auch ruhig in den Dörfern und Städten um. Wenn die Zeit der Kälte kommt, sprechen wir uns wieder.«
Menalor runzelte die Stirn. »Das ist alles?«
»Deine Prüfung wird dennoch keine einfache sein.« Mit derselben Sorgfalt, mit der er den Jorugawurz behandelt hatte, klopfte Arbogast seine Pfeife aus. »Denn du wirst darauf verzichten, die unsichtbare Macht Sumus zu deinem Vorteil zu nutzen. Deinen Willen wirst du allein mit der Schärfe deines Verstandes und der Kraft deiner Hände durchsetzen. Lebe wie ein gewöhnlicher Mensch. Du wirst bald spüren, wie deine Wurzeln wachsen. Vielleicht setzt du auch ein wenig mehr Rinde an.«
Der Alte erhob sich gewandter, als man es seinem krummen Rücken zutraute. »Du könntest sie brauchen, wenn du dir die Kraft zu wachsen und zu reifen auch in vielen kommenden großen Sonnenläufen erhalten willst.«
Mit einem kurzen Nicken verabschiedete sich der Greis und ließ seinen Bittsteller verwirrt und verloren zurück.
Wie ein gewöhnlicher Mensch? Melanor schluckte. Wie sollte das denn gehen? Sumus Kraft war Leben und Atem. Auf seine magischen Fähigkeiten zu verzichten, kam einer Verstümmelung gleich. Zugegebenermaßen hatte er sich die außergewöhnlichen Lektionen des Meistersumen Arbogast anders vorgestellt.
Die Hast war aus seinen Fingern gewichen. Plötzlich erschienen ihm seine Hände kraftlos und welk. Viel zu schmal und hässlich. Die Sterne blinkten geheimnisvoll und schienen ferner denn je. Von ihnen war kein Ratschluss zu erwarten. Das Rauschen der Wipfel erinnerte an höhnisches Kichern.
Melanor blieb reglos im Gras sitzen, bis die erste Dämmerung den Horizont grau färbte. Als die Vögel ihr viel zu fröhliches Morgenlied anstimmten, war es Zeit zu gehen. Der Wald war nicht mehr derselbe. Melanor verschloss seine Sinne fest und plötzlich sang das Leben um ihn nicht mehr. Was eine Melodie gewesen war, glich nur noch einem fernen Rauschen. So musste sich jemand fühlen, der plötzlich taub geworden war.
Ein paar Herzschläge lang bedauerte der junge Sume die armen Geschöpfe, die ihr ganzes Dasein so fristen mussten. Dann galt sein Bedauern hauptsächlich ihm selbst. Noch nie war ein Sommer so lang gewesen. Und er hatte noch nicht einmal richtig begonnen.
Er wanderte nicht lange, bis er auf die ersten »gewöhnlichen Menschen« traf, deren Gesellschaft er nun suchen musste. »Na, mein Kleiner? So allein?«
Zwei mit Schwertern und Äxten bewaffnete Strauchdiebe
traten aus dem Schatten zweier Birken an ihn heran und versperrten ihm grinsend den Weg.
Als Melanor den Dritten hinter sich bemerkte, sah er nur noch einen herabsausenden Knüppel aus den Augenwinkeln, dann wurde die Welt um ihn schwarz.
Kapitel 3
15. Peraine 1035 BF
Wendelmir
»Liebster, so hör mir doch zu. Es ist wichtig.« Sanft, aber energisch schob Silvana seine Hände von der Schnürung ihres Unterkleides fort.
»Ich habe jetzt keine Zeit für langes Geschwätz.« Zielsicher fanden seine Finger ihren Weg zu ihren schönen, runden Schenkeln. »Du weißt, dass ich gleich Wenzeslausia und ihrem Schlappschwanz von Ehegespons die Aufwartung machen muss. Wir können später reden.«
»Das sagst du seit Wochen.« Sie seufzte, als ginge es um etwas Wichtiges und reagierte nicht auf seine rauen Zärtlichkeiten. Schließlich fasste sie seine Hände und schob sie energisch von sich. »Tsa hat uns gesegnet.«
Erst ein paar Augenblicke atemlosen Schweigens später begriff er, was sie ihm damit sagen wollte. Er ließ sich auf die mit Teppichen belegte Fensterbank sinken, die sie sonst zum Sticken benutzte. Hinter dem milchigen Butzenglas färbte sich der Himmel dunkel. Eine Gewitterfront zog drohend näher.
Er sah nach draußen und lauschte ihren zaghaften Schritten. Auf Zehenspitzen pirschte sie sich an und kuschelte sich schließlich neben ihn. Gutwillig legte er einen Arm um ihre Schultern. Ein leises Pochen machte sich zwischen seinen Schläfen breit. Vielleicht tat ein Abend ohne Wein ganz gut.
Sie saßen eine Weile stumm beieinander, während die Dunkelheit aschgrauer Wolken die Stadt einhüllte.
Schließlich brach er das Schweigen. »Noch sieht man nichts. Wie lange weißt du es schon?«
Sie vergrub ihr Gesicht in seiner Halsbeuge. »Ich habe es schon im Tsa geahnt, und seit Phex den Schnee geschmolzen hat, bin ich mir sicher. Aber du warst so oft weg. Ich fand keinen passenden Zeitpunkt, es dir zu sagen.«
»Wie konnte das überhaupt geschehen? Die Kräuterhexe verkauft doch die besten Mittel hast du gesagt. Damit kann nichts schiefgehen.«
»Ja, schon.« Sie hatte immerhin den Anstand schuldbewusst zu klingen. »Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Wahrscheinlich habe ich irgendwann vergessen, es zu nehmen. Denkst du, es ist schön, das jedes Mal zu tun, wenn wir uns geliebt haben?«
Er tätschelte ihr sanft den Rücken. »Passiert ist passiert«, gestand er ihr zu. »Daran können wir nichts mehr ändern. Natürlich übernehme ich die Verantwortung«, tröstete er sie. »Wie viel brauchst du?«
Silvana hob den Kopf. Ihr weiches Haar strich sanft über seine Wange. »Was meinst du?« Ihre Stimme erinnerte an das zitternde Rascheln von Schilfgras.
Er wandte sich ihr zu. »Wie viel du brauchst«, erklärte er geduldig. »Andrataler. Um es wegmachen zu lassen.«
Seine Worte verfügten über erstaunliche Magie. Innerhalb eines Augenblickes verwandelte sich das sanfte Geschöpf in eine wilde Harpyie. Wütend sprang sie auf. Es fehlte nicht viel, dass sie fauchte und spuckte. »Das ist alles, was dir dazu einfällt? Es wegmachen lassen? Wir reden hier über unser gemeinsames Kind! Deinen Erstgeborenen.« Sie begann, im Zimmer auf und ab zu wandern. Ihre kleinen Füßchen trippelten hektisch über das Parkett. »Wie kannst du nur so verflucht kaltschnäuzig sein!«
»Hier wird nicht so schnell geboren«, erwiderte er lachend. »Du nimmst das viel zu schwer. Du bist doch nicht die Erste, der so etwas zustößt. Es passt jetzt wirklich nicht. Das hatten wir doch geklärt. Also lässt du es wegmachen. Irgendwann ...«
»Hier ist gar nichts geklärt«, spuckte sie. Ihre Gesichtsfarbe wechselte zwischen Kalkweiß und Kirschrot. »Freust du dich denn kein bisschen?«
Nun stimmten auch noch Schluchzer und dicke Tränen in das Konzert weiblicher Hysterie ein.
Langsam ging ihm ihre Leidenschaft für das Dramatische auf die Nerven. »Liebchen.« Er folgte ihr, um sie in seine Arme zu ziehen. Sie wehrte sich halbherzig. Aber schließlich schmiegte sie sich doch an ihn. »Ich will dein Kind zur Welt bringen. Und deine Frau sein.«
»Aber das wirst du doch.« Er strich ihr über den Kopf. »Nur nicht jetzt.«
»Und wann?«
»Irgendwann eben. Wenn die Zeit dafür reif ist.«
»Und wann ist sie das?« Sie löste sich wieder aus der Umarmung und verlegte sich wieder aufs Schmollen. »Nenn mir doch endlich einen Zeitpunkt. Leg dich doch endlich fest.«





























