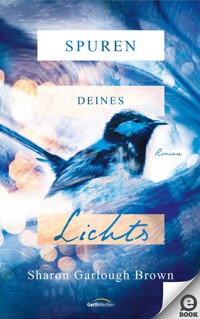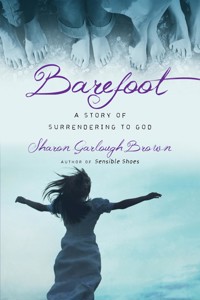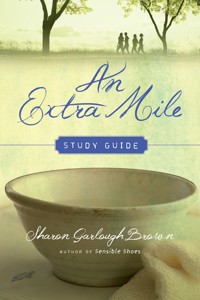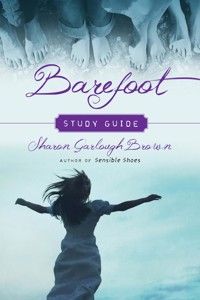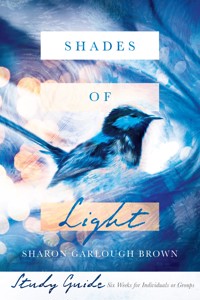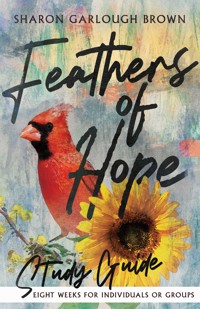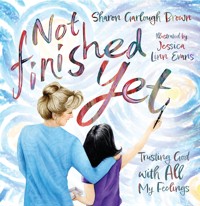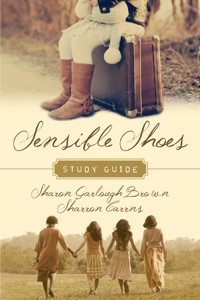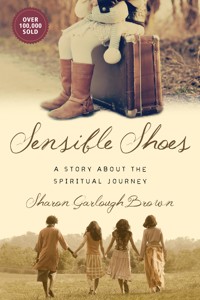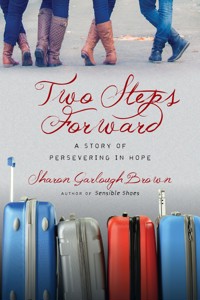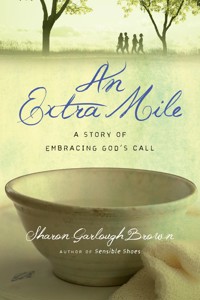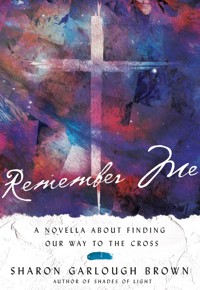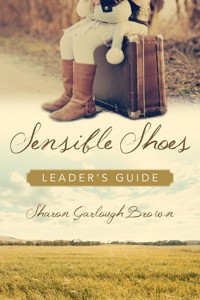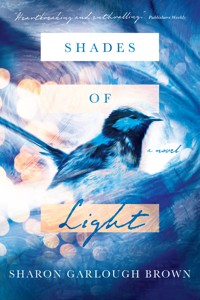Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gerth Medien
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Vier Frauen auf einer Glaubensreise
- Sprache: Deutsch
Die Reise der vier ungleichen Freundinnen Meg, Hannah, Charissa und Mara nimmt in diesem dritten Band der Serie für jede der Frauen eine unerwartete Wendung. Mara hat mit der bevorstehenden Scheidung und den Herausforderungen zu kämpfen, die das Leben als alleinerziehende Mutter mit sich bringt. Hannahs Beziehung zu Nathan wird immer ernster, und gleichzeitig stellt sich die Pastorin die Frage, ob sie den neuen Kurs annehmen kann, den ihr Leben dadurch möglicherweise nehmen wird. Charissa hadert mit ihrem Kontrollzwang und mit der Tatsache, dass sich ihre Schwangerschaft und ihre Karriereziele nur schwer miteinander vereinbaren lassen. Und Meg hat mit der Enttäuschung über kaputte Beziehungen und unerfüllte Träume zu kämpfen - nicht ahnend, dass ihr die größte Herausforderung ihres Lebens noch bevorsteht ... Begleiten Sie die vier Frauen auf ihrem Weg in eine ungewisse Zukunft, auf dem einmal mehr bedingungsloses Vertrauen in Gottes Führung gefordert ist. Die praktischen geistlichen Übungen im Anhang bieten Gelegenheit zur persönlichen Reflexion.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 583
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über die Autorin
Sharon Garlough Brown ist Pastorin. Gemeinsam mit ihrem Mann leitet sie eine Gemeinde in West Michigan. Ihren reichen Erfahrungsschatz aus vielen Jahren geistlicher Retraiten und Kursen über geistliche Übungen hat sie in diesem Buch meisterhaft eingewoben.
Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden.
2.Mose 3,5
* * *
Für Jack, meinen liebsten Gefährten. Gemeinsam haben wir die Herrlichkeit Gottes gesehen. Ich liebe dich.
Inhalt
Teil 1: Die Pilgerschaft
Meditation zu Psalm 131: Ein Gebet der Ruhe
Teil 2: Schwellen und Wegkreuzungen
Meditation zu Römer 8,31–39: Auf Gottes Liebe vertrauen
Teil 3: Heiliger Boden
Meditation zu Johannes 13,1–15.21: Lieben bis zum Schluss
Leitfaden für Gebets- und Gesprächsrunden
Anmerkungen
Ein Pilger zu sein bedeutet, sich langsam vorwärtszubewegen,zu spüren, wie dein Gepäck immer leichter wird,nach Schätzen mit Ewigkeitswert zu suchen,die Fragen deines Herzens zuzulassen,unterwegs zu sein in Richtung des heiligen Bodens deiner ewigen Heimatmit leeren Händen und nackten Füßen.Aus dem Gedicht „Tourist or Pilgrim“ vonMacrina Wiederkehr
Teil 1
Die Pilgerschaft
* * *
Wie glücklich sind sie, die bei dir ihre Stärke finden und denen es am Herzen liegt, zu deinem Heiligtum zu ziehen.
Psalm 84,6
1
Meg
Widerstandsfähig. Das war das Wort, nach dem Meg Crane gesucht hatte.
„Du bist nicht widerstandsfähig“, hatte Mutter häufig gesagt, und ihr anklagender Tonfall klang selbst ein Jahr nach ihrem Tod noch in Megs Ohren nach. „Du musst lernen, dich nicht unterkriegen zu lassen. Lernen weiterzugehen.“
Meg drehte sich in ihrem Bett um. Es war noch dasselbe Bett, in dem sie bereits als kleines Mädchen geschlafen hatte. In den 46 Jahren ihres bisherigen Lebens war es ihr nie gelungen, Kummer oder eine traumatische Erfahrung schnell zu überwinden, sich mühelos auf Veränderungen einzulassen oder eine Enttäuschung einfach so hinzunehmen. Einige ihrer Bekannten konnten Druck und Stress mit bemerkenswerter Gelassenheit aushalten. Sie schienen sich mühelos zu strecken, zu beugen und sich dem Leid anmutig und voller Hoffnung entgegenzustellen. Sie besaß diese Gabe leider nicht.
Vielleicht wäre „widerstandsfähig“ ein gutes Wort, um sich für das neue Jahr zu rüsten. Widerstandsfähig in der Hoffnung – und ganz besonders in Anbetracht der Ereignisse des vergangenen Monats.
Sie stützte sich auf ihre Ellbogen, während die Matratzenfedern unter ihrem schlanken, knapp 1,60 Meter großen Körper protestierend quietschten, und schaute aus dem Schlafzimmerfenster hinaus in die trübe Morgendämmerung. Die knorrige Wildkirsche im Nachbargarten, die schon in Megs Kindertagen dort gestanden hatte, erschien ihr wie ein Bild für widerstandsfähige Hoffnung. Vor vielen Jahren, als Mr und Mrs Anderson noch in diesem Haus gewohnt hatten, hatte ein Sturm den Baum eines Abends beinahe umgerissen und die Wurzeln an die Oberfläche geholt. Am nächsten Tag waren die Nachbarn gekommen, und während einige von ihnen den Baumstamm wieder gerade geschoben hatten, hatten die anderen die Wurzeln in den Boden getrampelt. Mutter hatte ihnen aus einem Fenster im oberen Stock zugesehen und darüber geschimpft, wie töricht es doch sei, einen solchen Aufwand für einen Baum zu betreiben. Meg hingegen hatte ihnen insgeheim applaudiert. Seitdem hatte sich der Baum zwar bei jedem Sturm zur Seite geneigt, aber immer überlebt. Seine Schieflage zeugte von Widerstandsfähigkeit und die Blüten, die ihn jeden Frühling aufs Neue zierten, von Hoffnung.
Nicht immun gegen Leid, sondern widerstandsfähig im Leiden: Das war das stumme Zeugnis des zur Seite geneigten Baumes. Keine Leugnung des Sturmes, sondern mehr Durchhaltevermögen, ein gestärkter Charakter und neue Hoffnung als Folge davon.
Wie sehr sie ihn für dieses Zeugnis bewunderte!
Der Wasserhahn im Bad am Ende des Flurs wurde aufgedreht, was die altersschwachen Rohrleitungen mit einem energischen Scheppern quittierten. Hannah war schon aufgestanden. Seltsam, wie schnell sich Meg daran gewöhnt hatte, ihr Haus wieder mit einem anderen Menschen zu teilen. Der Kaffeebecher mit Blumenmuster auf der Küchentheke, das Handtuch über der Tür der Duschkabine, die zweite Zahnbürste neben dem Waschbecken – das alles erinnerte Meg daran, dass sie endlich nicht mehr allein war. Auch wenn Hannah nur vorübergehend und nicht die ganze Woche über bei ihr wohnte, war Meg für ihre Gesellschaft dankbar.
In den wenigen Monaten, seit sie sich im New Hope-Einkehrzentrum kennengelernt hatten, war Hannah wie eine Schwester für sie geworden. Und nicht nur Hannah, sondern auch Mara und Charissa. Sie alle verband eine innige Freundschaft, und Meg, die im Dezember für einige Wochen ihre Tochter in England besucht hatte, freute sich schon sehr darauf, ihre Freundinnen endlich wiederzutreffen und sich mit ihnen auszutauschen. Sie brauchte vertrauenswürdige Gefährtinnen auf ihrer geistlichen Reise, die sie Gott – und auch sich selbst – näherbringen sollte. Sie brauchte Menschen, vor denen sie vorbehaltlos aussprechen konnte, wie schwer es ihr fiel, die Gegenwart Gottes inmitten ihrer Angst, Enttäuschung und ihres Kummers zu erkennen.
Aber sobald Hannahs neunmonatige Sabbatzeit vorbei war, würde sich ihre neu gefundene und innige Gemeinschaft zwangsläufig verändern. Und was dann?
Meinst du, sie bleibt vielleicht für immer hier?, hatte Mara Meg gefragt, als sie am ersten Weihnachtstag gemeinsam das Essen im Crossroads-Haus ausgeteilt hatten. Sie ist nicht dazu verpflichtet, nach Chicago zurückzukehren, oder? Sie könnte ihrem Chef doch einfach sagen, dass sie die Liebe ihres Lebens wiedergetroffen hat und in Kingsbury bleiben möchte.
Meg kannte sich mit den Regularien für eine solche Sabbatzeit nicht aus, und sie wusste auch nicht, ob es vielleicht die Regel gab, dass man danach erst einmal in die Gemeinde zurückkehren musste. Du kennst Hannah doch, hatte sie Mara geantwortet, und du weißt, wie sehr sie ihre Arbeit liebt. Ich denke nicht, dass sie ein so großes Geschenk annimmt und dann nicht in ihre Gemeinde zurückkehrt.
Wie aufs Stichwort erschien Hannah in ihrem Frottee-Bademantel in der Tür. Ihre hellbraunen, von ein paar wenigen grauen Strähnen durchzogenen Haare waren noch zerzaust vom Schlafen. „Guten Morgen, Meg. Wie geht es dir?“
Meg richtete sich auf und lehnte sich gegen das Kopfteil ihres Bettes. „Entschuldige bitte, falls ich dich heute Nacht mit meinem Husten wach gehalten habe.“
„Das hast du nicht. Ich habe dich erst heute Morgen gehört, als ich schon wach war.“
„Diese blöden Flugzeugkeime!“, schniefte Meg. „Ich hoffe nur, ich habe sie nicht an dich weitergegeben.“
„Ich habe das Immunsystem einer Pastorin“, witzelte Hannah. „Gestärkt durch unzählige Krankenhausbesuche.“ Sie rollte Megs Schreibtischstuhl zum Bett hinüber und ließ sich darauf nieder. „Irgendeine Nachricht von Becca?“
„Nein. Ich muss dringend lernen, wie man eine SMS schreibt. Ich denke, sie wird anrufen, wenn ihr danach ist.“ Meg hoffte, dass Becca inzwischen wieder unversehrt in London angekommen war, nachdem sie ihren 21. Geburtstag mit ihrem 42-jährigen Freund Simon in Paris gefeiert hatte.
Meg brauchte nur seinen Namen zu hören und sofort stand ihr die unangenehme Begegnung mit ihm wieder lebhaft vor Augen. Wie er in seinem Tweed-Mantel und mit diesem angeberischen Hut auf dem Kopf am Eingang zum London Eye gestanden hatte und seine Hände ununterbrochen über Beccas Körper gewandert waren. Wie seine tiefe Stimme vor Sarkasmus regelrecht getrieft hatte und seine Lippen zu einem hämischen Grinsen verzogen gewesen waren. Sie hoffte nur, dass er Becca bald überdrüssig werden und sich ein anderes junges, unschuldiges Mädchen suchen würde, das er manipulieren konnte. Du verstehst es einfach nicht, stimmt’s?, würde Becca dagegenhalten. Ich bin kein Opfer! Und ich bin auch kein kleines Mädchen mehr. Ich bin glücklicher als je zuvor in meinem Leben. Akzeptiere das endlich, okay?
Nein. Meg würde es niemals akzeptieren! Und sie wusste genau, was ihre Mutter dazu sagen würde. So unempfindlich sie Schmerz gegenüber auch gewesen war, unangemessenes Verhalten hatte sie niemals geduldet, denn in dieser Hinsicht war sie sehr wohl empfindlich gewesen. Warum um alles in der Welt duldest du, dass sie sich mit ihm einlässt?, würde sie Meg fragen. Warum hast du ihr erlaubt, nach Paris zu fahren? Du hättest lieber in London bleiben und auf sie aufpassen sollen!
„Alles in Ordnung?“, fragte Hannah besorgt.
Meg zuckte mit den Schultern. „Ich führe gerade wieder einmal imaginäre Gespräche mit Personen, die nicht anwesend sind.“
„Du meinst mit Becca?“
„Und mit meiner Mutter. Sie hätte wegen der Sache mit Simon einen Wutanfall bekommen.“ Meg zupfte nervös an der Decke. „Sag mir ehrlich, was du denkst, Hannah. Hätte ich in London bleiben sollen? Hätte ich kämpfen und Becca die Reise nach Paris verbieten sollen?“
Meg hatte ihr diese Frage bisher noch nicht gestellt und Hannah hatte ihre Meinung nicht ungefragt geäußert. „Ich bin nicht sicher, ob du damit etwas erreicht hättest“, erwiderte sie nach einer Weile. „Vermutlich hättest du nur ihren Trotz geweckt, ihre Entschlossenheit gestärkt und sie noch mehr gegen dich aufgebracht. Und außerdem hast du Gott doch darum gebeten, dich in Liebe zu leiten und dir klarzumachen, wie du Becca deine Liebe zeigen kannst. Ich finde, es war sehr mutig von dir, ihr ihren Willen zu lassen und nicht zu versuchen, ihr deinen Willen aufzuzwängen – so schwer das für dich auch gewesen sein mag.“
Es war sogar unglaublich schwer für Meg gewesen! Darauf zu vertrauen, dass die Angelegenheit noch nicht endgültig entschieden war und dass Gott ein Komma der Hoffnung setzte, wo Meg wohl eher ein Ausrufezeichen der Verzweiflung gewählt hätte. „Ich werde immer wieder von Albträumen gequält. Manchmal steht Becca am Rand einer Klippe, und ich will sie warnen, aber es kommt kein Ton über meine Lippen. Ein anderes Mal will ich auf sie zurennen, aber meine Beine bewegen sich einfach nicht. Ich bin vollkommen hilflos und das macht mir große Angst.“ Sie drückte die Knie an ihre Brust. „Manchmal kommt es mir vor, als würden meine Gebete an der Zimmerdecke abprallen. Bitte bete weiter für Becca, ja?“
„Das mache ich. Und ich bete auch für dich, Meg.“
„Danke.“ Meg zog ein Taschentuch aus der Schachtel auf ihrem Nachttisch. „So leid es mir auch tut, aber ich glaube, ich bleibe heute lieber zu Hause, anstatt mit euch zur Essensausgabe ins Crossroads-Haus zu gehen. Ich möchte niemanden anstecken.“
„Dafür hat Mara sicher Verständnis“, beruhigte Hannah sie. „Wir werden noch oft genug die Gelegenheit haben, gemeinsam dort zu sein. Du brauchst jetzt erst mal Ruhe.“
Meg nickte. Vielleicht war ein Tag im Bett eine Notwendigkeit und kein Luxus.
„Ich setze schon mal Wasser auf“, sagte Hannah und stand auf, „und koche dir eine Tasse Tee.“ Bevor Meg protestieren konnte, war Hannah aus dem Zimmer verschwunden, stieg die Treppe hinunter und sang mit ihrer warmen Altstimme eine Melodie, die Meg nicht kannte.
Sie griff nach dem Andachtskalender, den Charissa ihr geschenkt hatte („Als kleines Dankeschön“, hatte Charissa erklärt, „weil du uns darauf aufmerksam gemacht hast, dass dein früheres Haus zum Verkauf steht“), und schlug den 31. Dezember auf. In fünf Wochen würden Charissa und John in das Haus einziehen, in dem sie mit Jim gewohnt hatte, das Haus, in dem sie eine Familie gründen und gemeinsam hatten alt werden wollen. Und nun, 21 Jahre später, würden Charissa und John in diesem Haus ihren Träumen nachhängen und, so Gott wollte, im Juli ihr Baby nach Hause holen und in jenem Zimmer zum Schlafen legen, das Jim einmal liebevoll für Becca hergerichtet hatte. Doch er hatte die Geburt seiner Tochter nicht mehr erlebt, er hatte sie nicht mehr kennenlernen und im Arm halten können. Er war gestorben, bevor sie das Licht der Welt erblickt hatte.
Vertrau auf Gott, dann findest du Ruhe, stand auf dem Kalenderblatt, er allein gibt dir Hoffnung.
Hoffnung. Dieses Wort tauchte immer wieder auf, als würde Gott selbst es ihr ins Ohr flüstern. Hoffnung, die man nicht auf ein bestimmtes Ergebnis, sondern auf Gottes Güte und Treue setzte, was auch immer geschehen mochte. Hoffnung, die man nicht auf eine Antwort oder Lösung, sondern auf eine Person setzte. Hoffnung auf ihn, durch ihn, von ihm.
„Sieh mal“, erklärte Meg, als Hannah mit dem Tee zurückkam.
Hannah stellte das Tablett auf Megs Bett ab und nahm den Kalender zur Hand, um den Spruch zu lesen. „Dieses Wort scheint dich wirklich zu verfolgen.“
„Stimmt, es kommt mir fast schon so vor, als würde ich in einer Echokammer leben.“
Hannah grinste. „Das Gefühl kenne ich gut.“ Sie gab Meg den Kalender zurück und zog den Schreibtischstuhl näher ans Bett heran. „Zum Glück geht Gott nicht davon aus, dass wir ihn gleich beim ersten Mal verstehen.“
Meg trank einen Schluck Tee und der Geschmack von Honig legte sich sanft auf ihre Zunge. Ja, Gott sei Dank!
Doch die Realität sah anders aus. Wenn sie ehrlich war, musste der Spruch in ihrem Fall eher lauten: Du vertraust nicht auf Gott und findest keine Ruhe, denn du hast keine Hoffnung. Anstatt voller Hoffnung und Frieden auf Gott zu warten, war Meg innerlich aufgewühlt, unruhig und ängstlich. Obwohl sie Gottes Treue bereits so oft erlebt und seine Gegenwart und Liebe so oft gespürt hatte, fiel es ihr noch immer schwer zu vertrauen. Aber immerhin hatte sie mittlerweile gelernt, Gott, ihren Freundinnen und sich selbst gegenüber ehrlich zu sein, ihre Ängste nicht mehr zu leugnen und ihren Kummer nicht mehr zu verdrängen. Ihre Furcht und ihren Schmerz, ihr Bedauern und ihre Schuldgefühle, ihre Sehnsüchte und ihre Wünsche, ihre Kämpfe und ihre Fehler, ihre Vergangenheit, ihre Gegenwart und ihre Zukunft – alles durfte sie Jesus zu Füßen legen, denn dort gehörte es hin.
Meg wollte ein Atem-Gebet sprechen, wurde beim Einatmen jedoch von einem Hustenanfall gepackt.
„Das hört sich gar nicht gut an“, bemerkte Hannah. „Soll ich dir Hustensaft holen?“
Meg war schon lange nicht mehr richtig krank gewesen, sie hatte nicht einmal einen Schnupfen gehabt. „Ich glaube, ich habe gar nichts im Haus“, erwiderte sie.
„Kein Problem, ich springe schnell unter die Dusche und fahre dann in die Apotheke.“
„Das ist doch nicht nötig –“
Aber Hannah war bereits aufgestanden. „Ich weiß, dass das nicht nötig ist. Aber ich tue es gern für dich.“ Sie holte einen Block und einen Stift aus Megs Schreibtischschublade. „Hier – schreib auf, was du sonst noch brauchst, okay?“
„Hannah, ich –“
„Keine Widerrede!“ Hannah drohte ihr mit dem Finger und ihre Stimme war gespielt streng. „Du gehörst sonst immer zu denen, die mir sagen, dass ich mich darin üben soll, mich auszuruhen und auch mal etwas anzunehmen. Nun kannst du dich mit mir zusammen darin üben.“
Meg salutierte scherzhaft.
„Und schreib gleich auch ein paar Dinge mit auf die Liste, an denen du einfach nur Freude hast“, ermahnte Hannah ihre Freundin. „Auch du musst dich im Spielen üben.“
„Früher durfte ich nie spielen, wenn ich krank war, das verstieß gegen die Regeln.“
In Hannahs Blick lag tiefes Mitgefühl. „Umso mehr ein Grund, es jetzt zu tun.“
Meg legte sich wieder hin und starrte an die Decke. Die Erinnerung an die einsamen Krankheitstage in ihrem Kinderzimmer, in dem sie sich immer vorgekommen war wie in einer Gefängniszelle, war noch sehr lebendig. Erlaubt gewesen waren nur Ausflüge ins Badezimmer oder in die Küche, um etwas zu essen zu holen. Wie viele Stunden hatte sie im Bett gelegen, mit dem Finger das Blumenmuster der Tapete nachgezeichnet und sich Geschichten ausgedacht, weil es ihr verboten gewesen war, ein Buch zu lesen?
Es gab noch so viel mehr, was sie Jesus zu Füßen würde legen müssen – wenn sie nur den Mut aufbrachte, sich all dem zu stellen.
Mara
Das leise Kläffen, das schließlich in ein klagendes Winseln überging, war für Mara Garrison der erste Hinweis darauf, dass der Karton und die silbergraue Tasche, die der 13-jährige Brian mit nach Hause gebracht hatte, etwas anderes enthalten musste als nur die schmutzige Wäsche der vergangenen Tage.
„Hey!“, rief sie ihrem jüngsten Sohn zu, der beim Betreten des Hauses weder seine dreckigen Schuhe ausgezogen noch seine Kopfhörer von den Ohren genommen hatte. „Brian!“ Mara zog ihre Hand aus dem Spülwasser und hielt ihn am Ärmel fest, als er an ihr vorbeimarschierte. Doch er riss sich los und trampelte weiter durch die Küche, ohne sie auch nur eines Blickes zu würdigen, wobei er die Brust genauso prahlerisch vorgereckt hatte wie sein Vater. „Warte mal!“ Sie trocknete ihre nassen Hände eilig an ihrer Jeans ab, rannte ihm nach und erreichte die Tür zum Wohnzimmer gerade noch früh genug, um ihm den Weg mit ihrem wohlbeleibten Körper zu versperren. Sie breitete die Arme aus, damit er sich nicht an ihr vorbeidrängen konnte, und bedeutete ihm, die Kopfhörer von den Ohren zu nehmen. Nur widerwillig zog Brian einen der Hörer ein paar Zentimeter vom Ohr weg.
„Wie wäre es mit einem ‚Schön, dich zu sehen, Mama!‘?“
Wenn Blicke töten könnten, wäre Mara auf der Stelle aus dem Leben geschieden.
„Was ist da drin?“, fragte sie und deutete mit dem Kinn auf den Karton in Brians Armen. „Gar nichts.“
„Gar nichts“ gab ein protestierendes Kläffen von sich.
„Papa hat ihm einen Hund geschenkt“, erklärte Kevin, knallte die Tür zur Garage hinter sich zu und streifte seine Schuhe von den Füßen.
Brian wirbelte herum und funkelte seinen älteren Bruder böse an.
„Sei doch nicht so blöd“, zischte Kevin ihn an. „Hast du etwa gedacht, du könntest es geheim halten?“
„Mach den Karton auf“, befahl Mara mit erstaunlich ruhiger Stimme.
Brian wollte sich an ihr vorbeidrücken, doch sie rührte sich nicht vom Fleck. „Ich habe gesagt, du sollst den Karton aufmachen!“
Brian zog die Augenbrauen zusammen, seine Mundwinkel zuckten und die Ader an seiner Schläfe pulsierte – genau wie bei seinem Vater.
„Mach endlich diese blöde Kiste auf!“, forderte nun auch Kevin, riss sie seinem Bruder aus den Armen, stellte sie auf den braunen Fliesenboden und schlug die Klappen zurück.
Ein zusammengekauertes braunes Fellknäuel starrte Mara mit ängstlich aufgerissenen Augen an.
In diesem Moment hörte sie Tom, ihren zukünftigen Ex-Mann, in ihrem Kopf säuseln: Frohes neues Jahr!
Kevin bückte sich und hob den zitternden Welpen aus dem Karton, wofür ihm das struppige Kerlchen mit den Schlappohren zum Dank die Finger leckte. Doch Brian riss ihm den Hund augenblicklich aus den Armen. „Bailey gehört mir“, knurrte er und stieß Kevin mit der flachen Hand zurück.
Kevin schubste ihn ebenfalls. „Dann solltest du lieber aufpassen, dass er nicht in der Kiste erstickt.“
Brian versetzte seinem großen Bruder erneut einen kräftigen Stoß.
„Hey!“, ging Mara schließlich dazwischen. „Aufhören! Alle beide.“ Sie hatte zwar befürchtet, dass sich Tom in den Weihnachtsferien irgendetwas ausdenken würde, um sie zu ärgern, aber damit hatte sie nun wirklich nicht gerechnet!
Jahrelang hatte sie sich dem Wunsch ihrer Söhne nach einem Hund erfolgreich widersetzt, weil sie genau wusste, an wem die Pflege des Tieres am Ende hängen bleiben würde, und sie hatte auch so genug zu tun. Tom war beruflich viel unterwegs, die Jungen hatten neben der Schule noch jede Menge Hobbys, und Mara schaffte es schon jetzt kaum, ihren Aufgaben als alleinerziehende Mutter gerecht zu werden.
Nachdem Tom nun die Scheidung eingereicht hatte und ausgezogen war, um ein neues Leben in Cleveland zu beginnen, musste er Brian ausgerechnet jetzt seinen Herzenswunsch erfüllen. Jetzt, wo Mara sich vermutlich einen Job suchen musste und nicht einmal wusste, ob sie das Haus halten konnte, wenn im Juni die Scheidung vollzogen würde. Das war ein kluger Schachzug von Tom gewesen, um sich Brians Loyalität zu sichern und noch mehr Feindseligkeit zwischen ihr und ihrem Sohn zu schaffen, falls Mara ihm den Hund verbieten sollte. Sie konnte sich Toms triumphierende Schadenfreude lebhaft vorstellen, als er mit seinem Wagen rückwärts aus der Einfahrt gerollt war, nachdem er die Jungen zu Hause abgesetzt hatte. Bestimmt rieb er sich auf dem ganzen Weg von Michigan nach Ohio gedanklich die Hände.
Während Brian mit dem Hund und seiner Tasche verschwand, blieb Kevin noch in der Küche und inspizierte den Apfelkuchen, der gerade auf dem Herd auskühlte.
„Willst du mich vielleicht mal aufklären?“, fragte Mara ihren Sohn, die Hände in die Hüften gestemmt. Seit Kevin ihr vor ein paar Wochen von Toms Beförderung und seiner neuen Stelle in Cleveland erzählt hatte, hatte er sich zu einem relativ verlässlichen Informanten für sie entwickelt. Er brach sich ein kleines Stück von der goldbraunen Kruste ab, bevor er ihr erklärte, dass sein Vater den Welpen über eine Kleinanzeige gekauft habe, nachdem Brian ein großes Theater veranstaltet und ihn davon überzeugt hatte, dass er unbedingt einen Hund wolle, ja, ihn sogar dringend brauche. „Ich habe Papa schon gesagt, dass dir das sicher nicht gefallen wird.“
Ganz genau!
Einige Schimpfwörter murmelnd, griff Mara nach ihrem Telefon, hielt dann aber mitten im Wählen inne.
Das war doch genau das, was Tom erreichen wollte. Vermutlich wartete er gerade darauf, dass sein Telefon läutete.
Sollte er doch weiter warten und sich wundern!
Mara würde unterdessen überlegen, wie sie am besten Rache üben konnte. Irgendeine Schwachstelle würde sie schon finden und sie zu ihrem Vorteil nutzen können. Vielleicht würde sie den Hund auch als Druckmittel einsetzen, um das Haus zu behalten. Tom wollte Spielchen spielen? Gut, dann würde sie eben mitspielen. Wenn sie und die Jungen gezwungen wären, in eine Mietwohnung zu ziehen, könnte Brian den Hund nicht behalten, wodurch sie ihn gegen seinen Vater würde aufwiegeln können. Gewöhne dich nur nicht zu sehr an ihn, würde sie sagen, denn wenn die Scheidung erst mal vollzogen ist, müssen wir vermutlich in eine kleine Wohnung ziehen, in der keine Haustiere erlaubt sind – und das nur, weil dein Vater zu selbstsüchtig ist, um uns hier wohnen zu lassen.
Doch jetzt würde Mara erst mal gelassen reagieren, nur für den Fall, dass Kevin vielleicht als Doppelagent agierte. „Hat dein Vater auch eine Hundebox besorgt?“
„Nein, nur Futter und eine Leine.“
„Okay, dann müssen wir wohl einkaufen fahren.“ In einer alten Brieftasche hatte Mara kürzlich eine von Toms Kreditkarten gefunden, die sie länger nicht mehr benutzt hatte. Und der Hund brauchte nun mal eine Menge teurer Sachen, wie beispielsweise die teuerste Hundebox, die sie würde auftreiben können, und außerdem noch Spielzeug und ein flauschiges Hundekörbchen mit aufgesticktem Monogramm. Und vielleicht müssten sie mit ihm auch noch in eine Hundeschule gehen ... Tom würde jedenfalls sehr schnell feststellen, wie teuer sein Geschenk war – selbst ohne die ganzen Tierarztrechnungen. Und falls er sich deswegen beschweren sollte, müssten sie den Hund eben wieder abgeben. Es tut mir leid, Brian, würde Mara dann sagen, aber wir können uns das Tier nicht leisten. Sprich doch mal mit deinem Vater darüber.
„Und was ist mit dir, Kev?“, fragte sie betont fröhlich. „Was hast du von deinem Vater bekommen?“ Tom würde Brian niemals etwas schenken, ohne auch etwas für Kevin zu haben.
„Eine Surfausrüstung.“
Das war zu erwarten gewesen. Vermutlich hatte Tom bereits einen teuren Sommerurlaub für sich und die Jungen geplant – vielleicht auf Hawaii oder in irgendeinem anderen Urlaubsparadies. Aber daran wollte sie jetzt nicht denken. Im Augenblick gab es nur zwei Dinge, die ihre unmittelbare Aufmerksamkeit erforderten: das Gebäck für das Abendessen mit der Familie fertigzustellen und pünktlich um halb elf mit Kevin im Crossroads-Haus zu sein.
Mara war sehr stolz auf ihren Zweitältesten. Coach Conrad hatte ihm zehn Sozialstunden aufgebrummt, weil er nach einem Baseballspiel im Dezember eine handgreifliche Auseinandersetzung mit einem Mannschaftskameraden gehabt hatte, und diese hatte er im Crossroads-Haus abgeleistet. Doch heute wollte Kevin auf eigenen Wunsch sogar noch drei weitere Stunden dort aushelfen. „Sobald die Schule wieder anfängt, kann ich die Kinder nicht mehr so oft sehen“, hatte er ihr erklärt. „Und einige von ihnen ziehen bestimmt bald aus, meinst du nicht?“
Es hatte Mara überrascht, wie schnell der 15-jährige Kevin Kontakt zu den Kindern aufgenommen hatte. Er spielte mit ihnen und hatte sogar Freude daran, obwohl er in der Vergangenheit nur selten mit jüngeren Kindern zu tun gehabt hatte. Als Brian auf die Welt gekommen war, hatte er noch Windeln getragen, und Mara, die um seine Eifersucht auf das neue Baby wusste, hatte ihn immer besonders gut im Auge behalten. Doch im Crossroads-Haus hatte sie voller Freude beobachtet, wie er den Vorschulkindern vorlas, während sie auf ihm herumturnten und wie Kletten an ihm hingen. Sie hatte seine Zahnspange aufblitzen sehen (die seit Neuestem in Grün und Gold, den Farben seiner Lieblings-Baseballmannschaft, glänzte), wenn sich sein Mund zu einem für ihn ungewöhnlich breiten Grinsen verzog. Und selbst wenn er den Kindern mit der strengen Stimme eines großen Bruders sagte, dass sie sich hinsetzen und ihm zuhören sollten, machte er keine Anstalten, sich aus ihrer Umklammerung zu befreien. Für einige dieser heimatlosen Kinder war Kevin eine der wenigen männlichen Bezugspersonen in ihrem Leben und sie genossen seine Aufmerksamkeit in vollen Zügen. Jeremy, ihr ältester Sohn, war vor 27 Jahren ebenfalls einer dieser ausgelassen tobenden Kinder gewesen.
Sie schaute auf die Uhr an der Mikrowelle. Es blieb noch genug Zeit, um den Tisch im Esszimmer mit ihrem besten Porzellan zu decken, eine Ladung ihrer berühmten Zimtplätzchen zu backen und etwas Rohkost zur Vorspeise zurechtzuschneiden – oder „Gemüsesticks“, wie die Frauen in ihrer Nachbarschaft es nannten. Es waren dieselben Frauen, die damit prahlten, die Kräuter für ihre Dips, Dressings und Soßen im eigenen Garten zu ziehen. Doch wenn Mara irgendetwas anderes als ein Fertigdressing für ihre Dips und Salatsoßen verwendete, gab es lautstarken Protest von den Jungs.
Sobald die Kekse im Ofen waren, bügelte Mara das grün karierte Tischtuch und die Servietten auf. Sie hatte vor Jahren, nach dem Tod ihrer Mutter, das Porzellan ihrer Großmutter geerbt, und es gehörte zu den wenigen Schätzen aus ihrer Kindheit, die Mara noch besaß. Sie konnte sich noch gut an einige ihrer seltenen Familientreffen erinnern, die immer etwas ganz Besonderes für sie gewesen waren. Ihre Großmutter hatte in ihrer Wohnung zwei wacklige Tische zusammengeschoben, eine Leinendecke darübergelegt und die Tische mit ihrem feinen geblümten Porzellan und Kristallgläsern eingedeckt. Während Maras ältere Cousins die Kerzen anzünden durften, überließ Nana es Mara, die Servietten zu falten und das Silberbesteck neben die Teller zu legen. Mara durfte auch immer etwas früher kommen, um ihr beim Kochen zu helfen – ein echtes Privileg, denn keine ihrer Cousinen oder Cousins wurden in Nanas kulinarische Geheimnisse eingeweiht.
Mara sah sie noch in ihrer gepunkteten Schürze vor sich, wie sie sich über den Herd beugte und braunen Zucker und Ingwer zu der schmelzenden Butter gab. Nana passte auf die Süßkartoffeln auf, bis sie genau die richtige Konsistenz hatten und Mara sie zerstampfen konnte. Dann strichen sie die cremige Masse in die Auflaufform und verteilten Marshmallows darauf. Anschließend durfte Mara immer drei Marshmallows aus der Tüte naschen.
Noch eine Tradition, die sie eines Tages an ihre Enkelin Madeleine weitergeben konnte.
Sie strich das Tischtuch glatt und stellte sich vor, wie sich ihre Familie in einigen Stunden um den Tisch versammelte. Auch wenn Brian wie üblich mit langem Gesicht dabeisitzen würde, wäre diesmal wenigstens Tom nicht dabei, der das Essen kritisieren, Jeremy mit seinen spitzen Bemerkungen provozieren oder ihre Schwiegertochter Abby mit seinen sexistischen und rassistischen Scherzen aufs Korn nehmen würde.
Frohes neues Jahr!
Mara öffnete den Geschirrschrank und nahm die Teller ihrer Großmutter heraus. Fröhlich summend zählte sie fünf ab, nicht sechs. Doch als sie sich zum Tisch umdrehte, stolperte sie über etwas und geriet ins Taumeln. Bevor sie ihr Gleichgewicht wiedergewinnen konnte, rutschten ihr zwei Teller aus den Händen und zerschellten klirrend auf dem Fliesenboden.
Was um alles in der Welt –
Unter einem der Stühle kauerte Brians Hund.
„Brian!“, brüllte sie und zitterte vor Zorn.
Sie war so vertieft in die Essensvorbereitungen gewesen, dass sie ihren neuen vierbeinigen Mitbewohner vollkommen vergessen hatte. Sie funkelte zuerst das Tier an, dann starrte sie auf die zerbrochenen Teller ihrer Großmutter. „Brian!“, schrie sie so laut, dass der Hund vor Schreck hinters Sofa flüchtete. Kevin kam die Kellertreppe hochgeeilt, warf einen Blick auf seine Mutter und die Scherben auf dem Boden und rief wütend nach seinem Bruder, der sich schließlich dazu bequemte, nach oben zu kommen.
„Was ist?“, fragte er mit vor der Brust verschränkten Armen. Als Bailey Brians Stimme hörte, kam er aus seinem Versteck gekrochen.
„Nimm deinen Hund mit runter. Und zwar sofort!“ Doch noch bevor Brian ihn im Nacken greifen konnte, hob der Welpe das Bein und pinkelte an einen Sessel. „Sofort!“
Brian warf sich nach vorn, doch das Tier entwischte ihm, rannte bellend los und schoss im Zickzack durch das Wohnzimmer und die Küche. Zu zornig, um zu reden, ließ sich Mara auf einen Stuhl an dem noch nicht fertig gedeckten Tisch fallen und vergrub ihr Gesicht in den Händen.
Hannah
Hannah Shepley steckte ihr Telefon weg, atmete tief durch und wandte ihre Aufmerksamkeit dann wieder der Kasse zu, an der ein weißhaariger Angestellter mit schief sitzender Brille sich gerade damit abmühte, den Preis der Wimperntusche richtig einzutippen, die laut Kundin im Angebot sein sollte. „Es steht direkt über dem Ständer“, keifte die Frau ungeduldig, ihre mit unzähligen Ringen bestückte Hand in die Hüfte gestemmt. „Beim Kauf von zwei Stück gibt es eine weitere gratis dazu. Zählen Sie nach.“ Sie tippte mit ihrem manikürten Finger auf jedes der drei Päckchen auf dem Kassenband. „Eins, zwei, drei.“
Der Mann nahm einen der Werbeprospekte, die neben der Kasse lagen, strich ihn glatt und überflog die Bilder, auf der Suche nach einem möglichen Treffer. Seine Schultern waren vorgebeugt und mit der linken Hand kratzte er sich nachdenklich am Kopf.
„Um Himmels willen!“, fuhr die Frau ihn an und riss ihm den Prospekt aus der Hand. „Hier! Sehen Sie? Hier steht es. Beim Kauf von zwei Maybelline-Mascaras gibt es eine dritte gratis dazu. Was ist daran so schwierig?“ Sie drehte sich zu den Kunden um, die hinter ihr in der Schlange warteten, und warf ihnen einen bemitleidenden Blick zu.
Zufrieden, dass die Beschreibung im Prospekt mit den Produkten auf dem Kassenband übereinstimmte, tippte der Angestellte den Rabatt-Code in die Kasse und rechnete den Einkauf ab. Dann wünschte er der Frau noch einen schönen Tag, doch diese riss ihm nur den Kassenzettel aus der Hand, stopfte ihn eilig in ihre Plastiktüte und stürmte in die eisige Kälte hinaus.
Auch das Abkassieren der nächsten drei Kunden gestaltete sich schwierig, und da seine Bitte um Verstärkung an der Kasse unbeachtet blieb, wurden die Kunden zunehmend ungeduldiger. Als Hannah an der Reihe war, stand ihm der Schweiß auf der Stirn. „Haben Sie alles gefunden, was Sie brauchen?“, fragte er müde seufzend.
„Ja, danke“, erwiderte Hannah mit einem Lächeln, das ihm vermitteln sollte, dass sie sich nicht an der Verzögerung störte und die Geduld nicht verlieren würde. Zum Glück lag keines der im Prospekt aufgeführten Sonderangebote in ihrem Einkaufskorb.
In diesem Moment kam eine junge Verkäuferin, deren Lippen und Augenbrauen mit mehreren Ringen und Steckern gepierct waren, gemächlich herangeschlendert und öffnete eine zusätzliche Kasse, woraufhin die Kunden hinter Hannah vor Erleichterung aufatmeten und zur zweiten Kasse eilten.
Der ältere Kassierer scannte jedes Teil aus Hannahs Einkaufskorb mit langsamen, beinahe ehrfürchtigen Bewegungen. „Meine Enkelin malt auch sehr gern“, sagte er und scannte die Bunt- und Wachsmalstifte in die Kasse ein, die Hannah auf einem Wühltisch mit Überbleibseln aus dem Weihnachtsgeschäft gefunden hatte. Später, wenn sie mehr Zeit hatte, würde sie in den Bastelladen gehen und bessere Malutensilien für Meg besorgen, die ihr gegenüber einmal erwähnt hatte, wie gern sie als kleines Mädchen im Haus ihrer Nachbarin gemalt hatte, dass sie allerdings seit Jahren keine Farbstifte mehr zur Hand genommen habe. Umso mehr ein Grund, wieder damit anzufangen, hatte Hannah erwidert und in ihren Worten dabei auch die Einladung an sich selbst gehört.
Der Kassierer war noch immer mit dem Einscannen der Einkäufe beschäftigt. Hustenstiller und Nasentropfen, Halstabletten mit Honig-Zitronengeschmack, Vitamin-C-Tabletten, Papiertaschentücher. Ein Buch mit Sudokus und Kreuzworträtseln und ein Kniffel-Spiel, das Hannah schon seit Jahren nicht mehr gespielt hatte. Noch immer hörte sie das Klappern der Würfel, wenn ihr Vater den Würfelbecher kräftig schüttelte und dabei rief: „Na los, ihr Sechsen!“ Vielleicht hatte Nathan ja Lust mitzuspielen.
Der Kassierer suchte nach dem Barcode auf der Verpackung. „Ich glaube, er befindet sich auf dieser Seite“, erklärte Hannah ihm.
Mit ungeschickten Bewegungen drehte er die Schachtel mehrmals um. „Entschuldigen Sie bitte“, erwiderte er mit leiser Stimme.
„Kein Problem. Sie machen das prima.“ Die drei Kunden an der anderen Kasse waren inzwischen gegangen, und Hannah kämpfte gegen den Drang an, ungeduldig auf die Theke zu trommeln. Hatte sie Nathan nicht vor Kurzem erst wegen seiner Ungeduld beim Warten an der Kasse ermahnt? Sie hatte ihm geraten, für die Leute, die gemeinsam mit ihm an der Kasse standen, zu beten. Wenn Nate jetzt hier wäre, würde er sie vielsagend in die Seite boxen. Irgendwie schienen ihre eigenen Worte immer wieder zu ihr zurückzukommen.
Sie sprach ein stummes Gebet, sowohl für sich und ihre wachsende Ungeduld als auch für den Kassierer. Vielleicht hatte er seinen Job gerade erst angetreten. Vielleicht arbeitete er schon seit Jahren in diesem Laden und wurde allmählich senil. Vielleicht –
„Meine Enkelin ist sehr krank“, sagte er und blickte sie traurig an. „Leukämie.“
– wurde er aber auch von anderen, schwerwiegenden Sorgen abgelenkt.
„Das tut mir sehr leid“, sagte Hannah, und ihre Ungeduld löste sich augenblicklich in Luft auf.
„Wir hatten gehofft, sie könnte Weihnachten bei uns zu Hause sein, aber –“ Seine Stimme versagte und er wandte seine Aufmerksamkeit wieder der Arbeit zu. Hannah beobachtete, wie er ihre Einkäufe einpackte, und zückte ihre Kreditkarte. „Möchten Sie die Quittung haben oder soll ich sie in die Tüte stecken?“, fragte er.
„Ich nehme sie“, erwiderte Hannah und griff nach den Tüten. „Wie heißt Ihre Enkelin?“
„Ginny.“
Hannah holte die Buntstifte, Wachsmalstifte und das Kniffel-Spiel aus einer der Tüten heraus und reichte sie ihm. „Bitte nehmen Sie das für Ginny mit.“
„Oh, aber ich kann doch nicht –“
„Bitte“, beharrte Hannah. „Es ist doch nur eine Kleinigkeit.“ Eine winzige Kleinigkeit. Aber nach dem Ausdruck der Verwunderung und Dankbarkeit auf seinem Gesicht zu urteilen, hätte man meinen können, der Kassierer habe soeben ein Königreich geschenkt bekommen.
Jeder hat eine Geschichte zu erzählen, pflegte ihr Vater zu sagen. Du musst nur die richtigen Fragen stellen.
Ihr Vater, ein Vertreter im Ruhestand, hatte immer die richtigen Fragen zu stellen gewusst, um den Kontakt zu einem potenziellen Kunden herzustellen. Er hatte den Small Talk zu einer regelrechten Kunst erhoben, und er hatte immer darauf geachtet, anderen Menschen in tiefer Wertschätzung zu begegnen, was sich in beeindruckenden Verkaufszahlen niedergeschlagen hatte. Er war ein Verkäufer, der selbst Eskimos Eis verkaufen konnte. Aber wenn es darum ging, über ihre Familiengeschichte zu reden, machte er dicht wie Fort Knox.
Wie der Vater, so die Tochter, dachte Hannah auf der Rückfahrt zu Megs Haus. Und nachdem das Verlies in ihrem Inneren inzwischen geöffnet worden war, wurde es höchste Zeit auszuprobieren, ob vielleicht auch ihr Vater dazu bereit war, seines aufzuschließen.
Sie hatte ihren Eltern vor Weihnachten versprochen, im Januar oder Februar zu einem Besuch nach Oregon zu kommen, und hoffte, endlich ein offenes Gespräch über ihre Familiengeheimnisse mit ihnen führen zu können. Sie hatte diese Geheimnisse all die Jahre in sich verschlossen, was ihr jedoch nicht besonders gutgetan hatte, denn sie hatten langsam, aber sicher ihr Gift verströmt und in ihrem Inneren großen Schaden angerichtet. Aber nachdem sie sich zuerst Meg und dann auch Nathan gegenüber geöffnet hatte, fühlte sich Hannah nun dazu bereit, auch vor ihren Eltern die Wahrheit auszusprechen. Sie wollte ihnen endlich sagen, dass sie sich für den Nervenzusammenbruch ihrer Mutter und den darauffolgenden Krankenhausaufenthalt verantwortlich gefühlt hatte und dass sie sich die Bitte ihres Vaters, nicht mit anderen über dieses Familienproblem zu reden, zu Herzen genommen hatte, weil sie sein Vertrauen nicht missbrauchen wollte. Sie hatte all ihre Scham und Furcht verdrängt und daraufhin innerlich zu bluten begonnen. Doch Gott, der große Arzt, hatte die Wunde durch einen radikalen Eingriff freigelegt und gereinigt, damit sie nun endlich verheilen konnte. Vielleicht könnte er ja auch ihrer Familie Heilung bringen.
Hannah würde ihre Reisepläne bald konkretisieren müssen. Aber vielleicht würde sie ihre Eltern ja auch dazu überreden können, nach West Michigan zu kommen. Sie könnte sie beispielsweise zu ihrem 40. Geburtstag einladen, den sie am ersten März feierte, und dann würden sie auch Nathan und seinen Sohn Jake kennenlernen – oder war es noch zu früh, um eine Begegnung zwischen ihnen herbeizuführen?
Sie atmete langsam aus. Es waren noch so viele offene Fragen zu klären, bevor sie nach Chicago zurückkehrte.
Der Fahrer des Wagens, der neben ihr an der Ampel stand, hielt in der einen Hand ein Telefon und in der anderen einen Kaffeebecher. Hannah musste unwillkürlich daran denken, wie sie selbst sich noch vor wenigen Monaten an einer Ampel Erdbeerjoghurt in den Mund geschaufelt hatte oder ungeduldig vor der Mikrowelle hin- und hergelaufen war, weil sogar der Minutenreis für ihren Geschmack noch zu lange brauchte. Würde sie die gemächliche Gangart ihrer Sabbatzeit beibehalten können, wenn sie in ihren Beruf zurückkehrte? Die Entschleunigung, das aufmerksame Wahrnehmen ihrer Umgebung, die Ruhephasen, das Loslassen und die bewusste Abkehr von hektischer Betriebsamkeit hin zum dankbaren Empfangen – all das waren einschneidende Veränderungen, die es zu verarbeiten und in ihr Leben zu integrieren galt. Alle diese Veränderungen würden auf den Prüfstand gestellt werden, sobald sie ihre Arbeit wieder aufnahm. Jetzt, kurz vor Beginn des neuen Jahres, konnte sie den Gedanken an die nächsten Schritte nicht mehr so weit von sich schieben; sie würde dringend darüber beten müssen.
Ihr Telefon läutete, als sie in Megs Einfahrt einbog. Nate. „Hey!“, meldete er sich. „Ich wollte nur mal fragen, wann du kommst. Ich dachte an ein frühes Abendessen und einen Spieleabend, bevor wir zum Gottesdienst gehen.“
Hannah hatte noch nie einen Gottesdienst am Silvesterabend besucht und freute sich darauf, ihn gemeinsam mit Nathan und Jake zu erleben. „Ich denke, dass ich gegen zwei Uhr im Crossroads-Haus fertig bin“, antwortete sie. „Anschließend muss ich noch einige Besorgungen für Meg machen.“
„Dann komm doch einfach danach.“
„Was soll ich mitbringen?“
„Nur dich.“
„Lass mich doch wenigstens ein Dessert vorbereiten.“
„Bei uns sind noch jede Menge Weihnachtsleckereien übrig“, erklärte er. „Ernsthaft. Wir freuen uns auf dich!“
„Ich hasse es, mit leeren Händen zu kommen.“
„Ich weiß, aber es tut dir gut. Stell sie dir als offene Hände vor, die bereit zum Empfangen sind.“
Sie hörte das Lächeln in seiner Stimme, als sie sich voneinander verabschiedeten. Nate hatte wie üblich recht. Sie musste sich darin üben, freundliche Gaben mit offenen Händen zu empfangen. Wie gut, dass ihr noch einige Monate blieben, um diese neuen Disziplinen einzuüben.
Von der Sabbatzeit, die ihre Gemeinde ihr als freundliches und außergewöhnlich großzügiges Geschenk zugedacht hatte, war Hannah anfangs gar nicht begeistert gewesen. Sie war ihr wie eine Art „Verbannung“ von der Arbeit, die sie liebte, vorgekommen. Doch dann hatte ihr der Heilige Geist durch sein treues und unermüdliches Wirken klargemacht, was sie alles hinter ihrer hektischen Betriebsamkeit und ihrer Produktivität versteckt hatte und dass ihre private Identität mit ihrer beruflichen vermischt worden war. Sie hatte sich nur noch über das definiert, was sie für Gott tat. Dass sie sein geliebtes Kind war, hatte sie völlig aus dem Blick verloren. Steve Hernandez, ihr Vorgesetzter, hatte erkannt, was Hannah nicht hatte sehen können, und er hatte drastische Schritte unternommen, um ihr die Zeit und den Raum zu verschaffen, die sie brauchte, um ihre alten, tief verwurzelten Gewohnheiten und Ängste hinter sich zu lassen und ein neues Leben beginnen zu können.
„Du solltest doch im Bett bleiben und dich ausruhen!“, schimpfte sie, als sie Megs noch immer weihnachtlich geschmückten Flur betrat und feststellte, dass diese im Bademantel und mit einer dampfenden Tasse Tee am Küchentisch saß. Meg zuckte mit den Achseln. „Ich konnte die Erinnerungen an meine Kindheit nicht abschütteln, als es mir verboten war, mein Zimmer zu verlassen, wenn ich krank war. Darum bin ich lieber nach unten gekommen.“
Doch die Räume im Erdgeschoss, darunter das mit Antiquitäten vollgestopfte Wohnzimmer, das elegante Esszimmer im viktorianischen Stil und das Musikzimmer, in dem Meg Klavierunterricht gab, luden mit ihrer kalten Eleganz nicht gerade zum Entspannen ein. Meg brauchte dringend ein bequemes Sofa oder einen Sessel. Hannah stellte ihre Einkaufstasche auf die Küchentheke. „Wie wäre es mit einem Umgebungswechsel?“, schlug sie vor. „Wir könnten für ein paar Tage an den See fahren. Nancy hat bestimmt nichts dagegen, wenn ich Gäste in ihr Haus mitbringe.“ Nancy und Doug Johnson, langjährige Freunde von Hannah aus der Westminster Church, hatten Hannah ihr Ferienhaus am Lake Michigan für die Sabbatzeit zur Verfügung gestellt. Auch das war eines dieser großzügigen Geschenke gewesen, das sie nur widerwillig hatte annehmen können. „Heute Abend werde ich allerdings spät zurückkommen“, fuhr Hannah fort. „Der Gottesdienst beginnt erst um 23 Uhr. Aber wir könnten gleich morgen Nachmittag losfahren.“
Meg schien zu zögern.
„Ich habe schon so oft in deinem Haus übernachtet“, drängte Hannah. „Ich würde mich gern dafür revanchieren, und ich denke, die Zeit am See würde dir guttun.“
Meg nieste in ihre Armbeuge. „In Ordnung“, sagte sie schließlich. „Und danke.“
Hannah wusch sich die Hände im Spülbecken. „Ich habe dir ein paar Rätselbücher mitgebracht, mit denen du dir die Zeit vertreiben kannst, solange ich im Crossroads-Haus bin. Malutensilien habe ich nicht bekommen, aber ich fahre später noch im Bastelladen vorbei.“
„Bitte nicht –“
„O nein!“ Hannah hob mahnend die Hand und unterbrach sie. „Wir haben doch schon darüber gesprochen. Jetzt gibt es kein Zurück mehr.“
Sie klang mehr und mehr wie Nate.
* * *
Hannah wartete bereits im Crossroads-Haus, als Mara und Kevin dort eintrafen.
Mara umarmte sie. „Wo ist Meg?“ fragte sie und suchte die Halle ab, während sie sich aus ihrem Mantel schälte.
„Sie ist krank. Sie hustet und schnieft und wollte niemanden anstecken, und ich habe ihr versichert, dass du dafür sicher Verständnis haben wirst.“ Hannah legte ihren Schal ab. „Du musst mich hier erst mal einweisen, Kevin. Deine Mutter sagt, dass du zu den beliebtesten ehrenamtlichen Mitarbeitern gehörst.“
Kevins sommersprossiges Gesicht überzog sich mit einer feinen Röte und er senkte den Blick auf seine Turnschuhe.
„Ich glaube, Kevin will heute mit den Kindern trainieren“, erklärte Mara. „Basketball in der Sporthalle, nicht wahr, Kev?“
„Ja.“
„Hannah, wir beide gehen in die Küche und bereiten das Mittagessen vor. Und dann helfen wir bei der Essensausgabe, wenn das für dich in Ordnung ist.“ Maras Telefon piepte und zeigte an, dass sie eine SMS erhalten hatte. Sie griff unter ihren voluminösen limettengrünen Pullover und versuchte, ihr Telefon aus der Tasche ihrer eng anliegenden Hose zu ziehen, was sich äußerst schwierig gestaltete. „Charissa ist unterwegs“, erklärte Mara, nachdem sie die SMS gelesen hatte. „Sie hat geschrieben, dass sie ungefähr eine halbe Stunde später kommen wird.“
Hannah war jedoch froh, dass Charissa überhaupt kam. Seit Meg Mara an Thanksgiving bei der Essensausgabe im Crossroads-Haus Gesellschaft geleistet hatte, hatte Mara sich darauf gefreut, dass die vier Frauen endlich einmal gemeinsam dort aushelfen würden. Für Hannah und Charissa war dies der erste Ausflug in Maras „altes Leben“, und Hannah wusste, wie sehr sich Mara darauf freute, ihnen das Haus zu zeigen.
Wenn Meg wieder ganz gesund war, würden sie vielleicht noch einmal einen Tag finden, an dem alle Zeit hatten.
„Entschuldigt meine Verspätung!“, sagte Charissa, als sie schließlich den Speisesaal betrat. „Ich habe noch mit dem Makler telefoniert. Keine Sorge, mit dem Haus läuft alles wie geplant, aber dann musste John unser Auto noch vom Schnee befreien. Wir freuen uns wirklich darauf, in fünf Wochen endlich eine eigene Garage zu besitzen.“
„Schön, dass du es geschafft hast!“ Mara stellte eine Salatschüssel auf den langen rechteckigen Tisch und deutete auf den Garderobenständer in der hinteren Ecke des Raumes. „Deinen Mantel kannst du dort drüben aufhängen. Und anschließend musst du deine Haare zusammenbinden.“ Sie deutete auf das Netz über ihren kastanienrot gefärbten Haaren. „Miss Jada besteht darauf, dass du eines dieser schicken Häubchen aufsetzt, bevor du das Essen anrühren darfst.“
„Klingt gut“, erwiderte Charissa und legte ihren eleganten royalblauen Wollmantel ab. Unter ihrem weiten Pullover war nur schwer zu erkennen, ob sie bereits einen Babybauch hatte. Bei ihrer Größe und der schlanken Gestalt würde sie ihre Schwangerschaft noch monatelang verbergen können, wenn sie wollte.
„Du siehst gut aus“, sagte Hannah, als Charissa kurz darauf in die Küche zurückkam. „Fühlst du dich denn auch so?“
Charissa stopfte ihre langen dunklen Haare unter das Netz. „Ja, endlich, Gott sei Dank! Ich denke, jetzt, wo ich das erste Schwangerschaftsdrittel überstanden habe, sollte es auch mit der Morgenübelkeit besser werden. Wenn ihr allerdings seht, dass ich fluchtartig die Küche verlasse, dann wisst ihr, dass mir der Essensgeruch doch zu viel geworden ist.“
„Heute gibt es nur Suppe, Salat und Brot“, erklärte Mara und deutete auf die großen Töpfe auf dem Herd. „Und sonntagsabends versuchen sie dann immer, ein größeres Essen anzubieten. ‚Brot und Fisch werden sich schon vermehren‘, wie Miss Jada zu sagen pflegt. Und irgendwie funktioniert es dann auch tatsächlich.“
Als die ersten Gäste eintrafen, nahmen die drei Frauen zusammen mit den anderen ehrenamtlichen Helfern ihre Plätze hinter dem langen Büfetttisch ein. Mara teilte die Suppe aus, Hannah den Salat, und Charissa schenkte die Getränke ein, wobei sie es vermied, die Leute zu korrigieren, die ihren Namen falsch aussprachen, wenn sie ihr dankten.
Hannah war beeindruckt, wie herzlich Mara mit den Leuten redete, die offensichtlich regelmäßig hier zu Gast waren: mit Sam, der ein faltiges und zahnloses Gesicht hatte und auf dessen Hals nackte Frauen eintätowiert waren. Mit Constance und ihrer kleinen Tochter Lacey, die am Daumen lutschte, während sie, ans Bein ihrer Mutter geklammert, ängstlich zu Mara hinaufspähte, und mit Rickie, einer seit Kurzem arbeitslosen Mutter von drei kleinen Jungen, von denen einer einen besonderen Draht zu Kevin entwickelt hatte. „Er ist in der Sporthalle“, erklärte Mara, als der kleine Junge sie fragte, ob Kevin zum Spielen mitgekommen sei. „Wenn du gegessen hast, kannst du rübergehen und Basketball mit ihm spielen.“
Gerade als die Schlange hungriger Menschen kürzer wurde, kam ein Mann herein und reihte sich an deren Ende ein. Er trug weite Shorts, ein langärmeliges graues T-Shirt und hielt den Blick auf seine Sandalen gesenkt. Aus seinem Ärmel lugte ein handgeschriebenes Preisschild hervor, das mit einer Sicherheitsnadel befestigt war. „Gott segne Sie, Sir. Gott segne Sie, Madam“, murmelte er jedem Ehrenamtlichen zu, an dem er vorbeikam. Aus den Augenwinkeln heraus beobachtete Hannah, wie Charissa ihn begrüßte, ihm ein Glas Wasser einschenkte und ein Gespräch mit ihm begann. Worüber sie sprachen, konnte Hannah allerdings nicht verstehen. Doch als sie das nächste Mal zu ihr herüberblickte, war Charissa verschwunden. Vielleicht war ihr der Geruch doch zu viel geworden.
Charissa
Selbst eine schwangere Frau konnte nur eine gewisse Zeit auf der Toilette verbringen, bis ihre Freundinnen begannen, sich Sorgen um sie zu machen. Charissa Sinclair starrte in den Spiegel und versuchte, ihre Wimperntusche in Ordnung zu bringen, als Mara hereinkam. „Geht es dir gut?“
Alles war wunderbar gelaufen, bis der Mann in Shorts und Sandalen hereingekommen war. In diesem Moment hatte sie die Fassung verloren. Schließlich herrschten dort draußen Minustemperaturen und es lagen gut 20 Zentimeter Schnee, und sein einziger Schutz gegen die Kälte waren seine langen Baumwollstrümpfe. „Sie werden ihm doch sicher helfen, oder?“, fragte Charissa. „Ich meine den Mann in Shorts. Sie werden ihm doch ein paar Kleider oder Schuhe oder irgendetwas anderes geben, das ihn wärmt, nicht? Glaubst du etwa, dass er wirklich so auf der Straße lebt?“
„Ich weiß es nicht“, erwiderte Mara. „Miss Jada ist da sicher besser informiert, sie unterhält sich gerade mit ihm. Ich habe ihn hier noch nie gesehen.“
Sie sehen aus wie meine Schwester, hatte der Mann zu Charissa gesagt. Haben Sie mal in Philly gewohnt? Nein, hatte Charissa erwidert, sie sei noch nie in Philadelphia gewesen.
Als ich sie das letzte Mal gesehen habe, war sie etwa in Ihrem Alter. Sie könnten glatt Ihre Tochter sein. Sind Sie eine geborene Monroe?
Nein, das war sie nicht, der Mädchenname ihrer Mutter war Demetrios. Aber das hatte sie ihm nicht verraten, schließlich konnte er ein Betrüger sein, der sich private Informationen erschleichen wollte.
Die Badezimmertür schob sich langsam auf. „Geht es dir gut?“, fragte nun auch Hannah.
Charissa band sich die Haare noch einmal neu zum Pferdeschwanz zusammen. „Ja, ich musste nur mal durchschnaufen. Der letzte Gast, ich meine den in Shorts und Sandalen und mit diesem kleinen Preisschild am Ärmel, hat mir ziemlich zugesetzt.“
„Es ist zu schade, dass Tom seinen Schrank schon ausgeräumt hat“, sagte Mara. „Ich hätte seine ganzen Sachen nämlich gern hierhergebracht. Ich wünschte, ich wäre früher auf diese Idee gekommen.“
Das ist eine großartige Idee, dachte Charissa. Der Mann hatte in etwa Johns Größe und Statur, klein und schlank, und in ihrem Kleiderschrank hingen bestimmt sechs Mäntel und Jacken von ihm. Sie könnte nach Hause fahren, John bitten, einige davon abzugeben, und sie zum Crossroads-Haus bringen.
Es war seltsam, dass sie fast ihr ganzes Leben lang in Kingsbury wohnte und trotzdem noch nie vom Crossroads-Haus gehört hatte, bevor sie Mara kennengelernt hatte. Nein, es war nicht seltsam, sondern eher traurig. Die frühere Kanzlei ihres Vaters lag nur drei Straßenzüge entfernt, und wann immer sie ihn dort besucht hatten, hatte ihre Mutter sie fest an der Hand gehalten und ihr befohlen, keinen Blickkontakt mit anderen Menschen aufzunehmen und jeden zu ignorieren, der sie ansprach, um Geld von ihr zu erbetteln. Penner und nichtsnutzige, faule Trunkenbolde hatte ihr Vater diese Menschen genannt. Tatsächlich hatten etliche der – wie nannte Miss Jada sie noch? – „Gäste“ in der Schlange stark nach Alkohol gerochen. Womit das bewiesen wäre, wie ihr Vater wohl sagen würde.
Den älteren Mann hatte jedoch keine Alkoholfahne umgeben. Einzig der Gestank von Urin und Schweiß hatte seine Kleider durchdrungen und ein Ausdruck der Verzweiflung hatte seine taubengrauen Augen verdunkelt. Vergesst nicht, hatte Miss Jada die Ehrenamtlichen ermahnt, dass jeder Mensch, den ihr hier trefft, nach Gottes Ebenbild geschaffen wurde. Wenn ihr es nicht auf den ersten Blick erkennen könnt, schaut genauer hin, und bittet Gott darum, dass er euch die Augen öffnet.
Und genau das hatte Charissa getan. Sie hatte versucht, genauer hinzuschauen, und dafür gebetet, es erkennen zu können, während dieselben verurteilenden Stimmen in ihrem Kopf laut geworden waren, die einst Mara wegen ihrer Vergangenheit verunglimpft hatten. Und doch standen sie beide jetzt hier und arbeiteten Seite an Seite als Freundinnen zusammen, was zeigte, dass auch „Pharisäer“ wie sie noch bekehrt werden und Mitgefühl empfinden konnten, auch wenn der Bekehrungsprozess länger dauerte, als es Charissa lieb war.
Als sie in die Küche zurückkamen, wurde dort bereits aufgeräumt. Charissa suchte den Speisesaal nach dem Mann in Shorts ab. „Ich konnte ihn nicht zum Bleiben bewegen“, erwiderte Miss Jada, als Charissa sie nach ihm fragte. „Er wollte nur etwas zu essen und ist dann sofort wieder gegangen.“
„Ohne einen Mantel?“
„Ich hatte leider keinen mehr da, den ich ihm hätte geben können. Die Mäntel aus der Weihnachtsspende habe ich alle verteilt. Allerdings hatte ich noch ein Paar Turnschuhe und eine Hose da, die ihm ganz gut gepasst haben. Die hat er mitgenommen. Und eine Decke.“
„Wird er denn heute Abend noch mal wiederkommen? Und hat er gesagt, ob er einen Ort hat, an dem er bleiben kann?“
„Er weiß, dass wir hier sind, Liebes“, sagte Miss Jada und tätschelte Charissas Schulter. „Mehr können wir leider nicht tun.“
Irgendwie hatte ich gehofft, dass Sie zur Familie gehören, hatte der Mann traurig seufzend zu Charissa gesagt, doch sie hatte es leider versäumt, ihn zu fragen, was denn mit seiner Familie los sei. Wenn sie nur schneller zu Fuß wäre, hätte sie ihm folgen können.
„Wann bist du wieder hier?“, fragte sie Mara, als sie im Foyer ihre Wintermäntel anzogen.
Mara schaute den Flur entlang zu Kevin, der sich gerade von einer Gruppe lebhafter kleiner Jungs verabschiedete. „Ich denke, am kommenden Samstag. Kev wollte vor Schulbeginn gern noch einmal herkommen und ich werde beim Mittagessen helfen. Warum fragst du? Willst du auch kommen?“
„Ja, vielleicht. Ich frage John, was er vorhat.“
Mara beugte sich vor und umarmte Charissa. „Ich habe ganz vergessen, mich bei dir zu bedanken“, sagte sie. „Für deine Spende ans Crossroads-Haus. Miss Jada hat mir die Karte zu Weihnachten gegeben. Noch nie zuvor hat jemand mir zu Ehren so etwas getan – das war eines der schönsten Geschenke, die ich je bekommen habe. Vielen Dank!“
„Gern geschehen. Ich weiß doch, wie sehr dir dieses Haus am Herzen liegt, und nun verstehe ich auch, warum das so ist.“ Charissa behielt den Speisesaal immer noch im Blick und hoffte, dass der Mann vielleicht noch einmal zurückkommen würde, aber die Gäste hatten das Haus mittlerweile verlassen. Einige von ihnen waren wieder auf die Straße zurückgegangen, während andere vermutlich auf dem Bürgersteig in der Nähe der früheren Kanzlei ihres Vaters hockten.
„Richte Meg aus, dass wir sie vermisst haben“, bat Mara Hannah, als sie von der Toilette zurückkam. „Irgendwann schaffen wir es bestimmt mal, uns alle vier hier zu treffen.“
„Ich weiß, dass sich Meg sehr darüber freuen würde“, erwiderte Hannah und wickelte sich ihren locker gestrickten Schal mehrmals um den Hals. „Und wir sollten uns überlegen, ob wir vielleicht noch einmal ein Seminar im New Hope-Einkehrzentrum belegen. Das wäre ein nächster Schritt, den wir gemeinsam tun könnten, denn ich möchte auf jeden Fall weitergehen und tiefer eintauchen.“
„Amen dazu“, stimmte Mara ihrer Freundin zu. „Ich habe mir den Programmplan fürs Frühjahr angeschaut, aber ich glaube nicht, dass ich es in der jetzigen Situation mit Tom und den Jungen schaffen werde. Nicht, solange alles so in der Schwebe hängt.“
Charissa hatte den gleichen Gedanken. Der Umzug, ihr Studium, die Schwangerschaft und alles, was dadurch in den kommenden Monaten anstand, machten es ihr einfach unmöglich, zusätzlich noch ein Seminar zu belegen. Aber Emily, eine ihrer Freundinnen, die sie bereits seit ihrer Kindheit kannte, besuchte eine Frauen-Gebetsgruppe in ihrer Gemeinde, und als Charissa sich im Herbst mit ihr zum Walken getroffen hatte, hatte sie ihr begeistert von ihrer geistlichen Weiterentwicklung erzählt. „Ich rede mal mit einer Freundin“, sagte Charissa. „Sie trifft sich schon seit ein paar Jahren mit einer Gruppe von Frauen, und vielleicht erzählt sie mir ja mal etwas ausführlicher, was sie miteinander erlebt haben.“
„Das klingt doch gut“, bemerkte Mara. „Vielleicht können wir uns dann ein-, zweimal im Monat treffen.“
Charissa nickte. „Wenn wir erst mal in unser neues Haus eingezogen sind, können wir uns gerne bei uns treffen.“
Sie hoffte nur, dass es Meg nichts ausmachte. Obwohl sie betont hatte, wie gern sie sich ihr altes Zuhause noch einmal anschauen würde, könnte es trotzdem schwierig für sie werden, wenn Charissa und John sich erst einmal dort eingerichtet hatten, denn John plante, die Küche und das Bad umzugestalten, womit das Haus ganz anders aussehen würde als damals.
Auf dem Rückweg zu ihrer Wohnung fuhr Charissa noch bei ihrem zukünftigen Haus vorbei und parkte den Wagen in der Einfahrt. Sie musste an John denken. Stell es dir doch nur mal vor, Riss! Hinter diesem Fenster hier vorn, dort wird einmal das Zimmer unseres Babys sein! John war der Träumer unter ihnen, und er redete oft und gern darüber, was einmal sein könnte. Charissa hingegen hatte wenig Zeit für solche Träumereien, denn für sie war es schon schwierig genug, trotz aller Veränderungen, die in den vergangenen Monaten über sie hereingebrochen waren, ihre innere Balance zu halten. Noch vor dreizehn Wochen war sie eine Doktorandin gewesen, die das feste Ziel hatte, einmal Professorin für englische Literatur zu werden und eines Tages vielleicht eine Familie mit John zu gründen. Doch plötzlich schien dieses „Eines Tages“ früher als gedacht Wirklichkeit zu werden, denn am elften Juli stand bereits ihr Entbindungstermin an.
„Zeige meinen Eltern gegenüber doch ein wenig mehr Dankbarkeit und Begeisterung“, hatte John sie während ihres dreitägigen Weihnachtsbesuchs in seiner Heimatstadt Traverse City mehrmals gebeten. Johns Eltern hatten ihnen nämlich das Geld für die Anzahlung des Hauses geschenkt und die Nachricht von Charissas Schwangerschaft mit großer Freude entgegengenommen. Charissa hingegen hatte es beträchtliche Mühe gekostet, die Begeisterung ihrer Schwiegereltern zu teilen. Nach einem gemeinsamen Ausflug ins Möbelhaus – „nur um zu schauen, was es alles gibt“, wie ihre Schwiegereltern beteuert hatten – war es ihr dann endgültig zu viel geworden. „Halte sie einfach bei Laune“, hatte John ihr zugeraunt, als seine Mutter ihre Meinung über Wandfarben und Einbauschränke äußerte und sein Vater ihnen eine bestimmte Holzmaserung für die Schänke empfahl.
„Es ist doch unser Haus, oder etwa nicht?“, hatte Charissa leise erwidert. Doch John hatte sie flüsternd ermahnt, trotzdem lieber den Mund zu halten. „Ich wollte mich auch nur noch mal vergewissern“, hatte sie daraufhin vor sich hin gemurmelt.
Charissa mochte ihre Schwiegereltern wirklich, auch wenn es nicht viele Gemeinsamkeiten zwischen ihnen gab. Sie vermutete, dass ihre Schwiegermutter nie richtig verstanden hatte, warum John sie geheiratet hatte. Judi hatte die Leistungen und Erfolge ihrer Schwiegertochter, ihren Intellekt und ihren Ehrgeiz nie zu schätzen gewusst, weil sie ihr Leben ihren Kindern gewidmet hatte. Sie war Hausfrau gewesen und hatte jedes Spiel der Kinder besucht, sich im Elternbeirat engagiert, sich für die Musikgruppen eingesetzt, Spendensammlungen koordiniert, Klassenfeiern organisiert und regelmäßig gesundes und ausgewogenes Essen auf den Tisch gebracht. Wenn man John so reden hörte, war sie in Traverse eine regelrechte Legende.
Charissas Mutter dagegen war Führungskraft in einer Werbeagentur. Sie hatte nie ehrenamtlich in der Schule mitgeholfen, weil sie beruflich ziemlich eingespannt gewesen war. Aber sie hatte bei jeder Preisverleihung strahlend in der ersten Reihe gesessen und voller Stolz über die Leistungen ihrer Tochter gewacht. Und abends hatte sie dann köstliches mediterranes Essen auf den Tisch gebracht, weil Kochen ihr besonderes Hobby war und sie damit ihr griechisches Erbe erhalten wollte, das zu ihrem Leidwesen jedoch nicht auf Charissa übergegangen war.
Bei ihren Ehevorbereitungsgesprächen hatten sich Charissa und John dann mit ihren Ursprungsfamilien auseinandersetzen und darüber nachdenken müssen, welchen Einfluss ihre Eltern auf ihre eigenen Rollen- und Beziehungsmuster hatten. Sie hatten darüber gesprochen, welche Ähnlichkeiten zu ihren Eltern sie bei sich entdeckten („Analytisches Denken und hohe Belastbarkeit in Drucksituationen wie bei meinem Vater“, hatte Charissa gesagt, „und Ehrgeiz und Erfolgsorientierung, wie beide ihn haben“), aber auch, inwiefern sie sich von ihnen unterschieden („Meine Mutter ist sehr emotional und besitzt eine Art ‚mediterrane Leidenschaft‘ für das Leben. Man merkt immer, wenn sie wütend ist, weil sie es dir laut und deutlich sagt. Ich dagegen bin viel ruhiger“). Johns Elternhaus unterschied sich sehr stark von ihrem, und auch wenn sie eine Übereinkunft in Bezug auf die Rollenverteilung und ihre Verpflichtungen getroffen hatten, würde es vermutlich nicht schaden, ihre Erwartungen aneinander aufgrund ihrer Schwangerschaft noch einmal zu überdenken.
Ihr Telefon vibrierte und zeigte eine SMS von ihrer Mutter an: Ruf mich an.
So viel zum Thema „Erwartungen“ …
Seit sie ihren Eltern von dem Fiasko mit ihrer Semesterabschluss-Präsentation erzählt hatte, gab ihre Mutter ihr ständig Ratschläge, wie sie ihren beschädigten Ruf in der Fakultät und bei ihren Kommilitonen wiederherstellen konnte: Du musst noch härter arbeiten, um dich zu beweisen. Du musst ihnen zeigen, dass du dich engagierst und hervorragende Leistung bringen wirst, egal, was auch geschieht, und dass du dich durch ein Baby nicht ausbremsen lässt. Übernimm zusätzliche Aufgaben, mach einen Artikel aus deiner Präsentation oder irgendetwas in der Art. Wenn du allerdings sicher bist, dass es keine Möglichkeit mehr gibt, noch etwas zu erreichen, dann musst du den Schaden so weit wie möglich eingrenzen. Wir müssen gemeinsam überlegen, wie wir die Sache doch noch zum Guten wenden können.
Charissa hatte ihren Eltern allerdings verschwiegen, dass sie mittlerweile verstand, wie recht Dr. Allen doch hatte, wenn er sagte, dass Perfektionismus eine Form der Gefangenschaft war und dass das, was sie als Versagen wertete, in Wirklichkeit ein Werk der Gnade Gottes in ihrem Leben war, um sie von Scham und Furcht zu befreien. „Alles, was wir erleben, kann uns formen. Es kann uns entweder egozentrischer machen oder uns näher zu Christus hinziehen“, klangen seine Worte noch in ihrem Kopf nach. Durch die Gnade, die sie vor allem während der letzten Wochen erfahren hatte, hatte Charissa schließlich begonnen, ihre gesellschaftlich anerkannte Form des Götzendienstes auch als solchen zu erkennen: ihren Durst nach Anerkennung und Ruhm, ihr Bestreben, immer die Erste sein zu wollen, und die Tatsache, dass sie ihren Wert nicht aus ihrer Identität als Gottes geliebtes Kind schöpfte, sondern aus ihren eigenen Leistungen und ihrem guten Ruf. Aber das würden ihre Eltern wahrscheinlich nie begreifen.
„Christus hat uns befreit“, hatte sie erst heute Morgen im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 1, gelesen, „er will, dass wir jetzt auch frei bleiben. Steht also fest und lasst euch nicht wieder ins Sklavenjoch einspannen!“
Sie nahm ihr Smartphone zur Hand, um Emily eine SMS zu schicken. Hast du vielleicht Material von deiner Gebetsgruppe, das du uns leihen könntest? Wir würden gerne gemeinsam weiterkommen und könnten einige Ideen gebrauchen. Vielen Dank und ein frohes neues Jahr!, schrieb sie und drückte auf „Senden“.
* * *
„Du brauchst alle diese Jacken doch gar nicht, oder?“, fragte Charissa und schob die Bügel im Kleiderschrank zur Seite.
John, der gerade Bücher in einen Karton packte, blickte zu ihr hoch. „Welche meinst du denn?“
Charissa hielt einen Wollmantel in die Höhe, den sie bisher nur einmal an ihm gesehen hatte.
„Das war ein Weihnachtsgeschenk von meiner Mutter.“
„Brauchst du ihn denn?“
„Ja.“