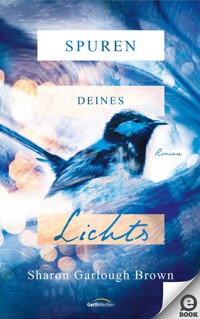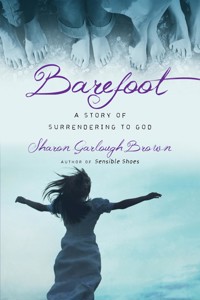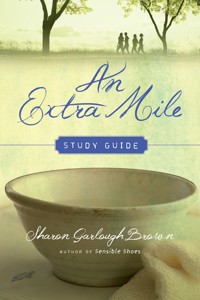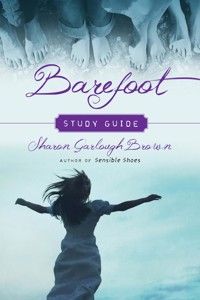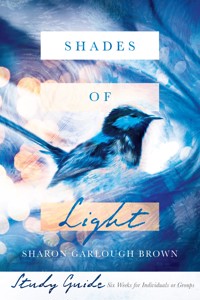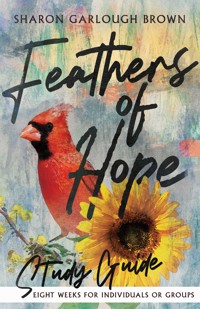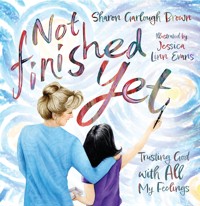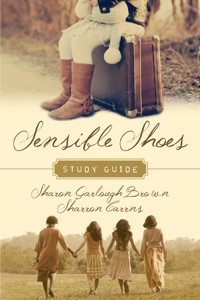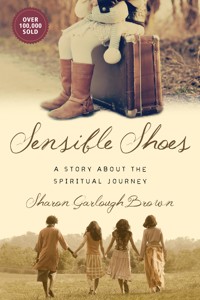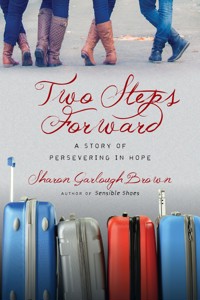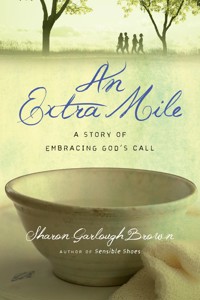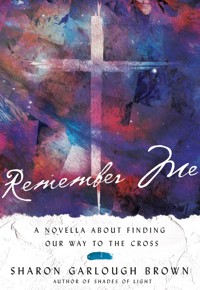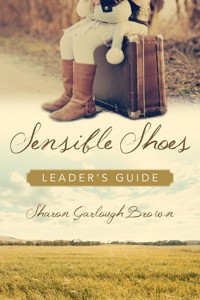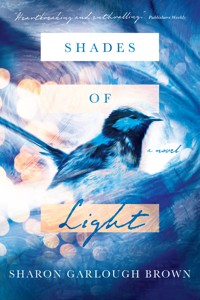Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gerth Medien
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Vier Frauen auf einer Glaubensreise
- Sprache: Deutsch
Vier Frauen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, begegnen sich bei einem wöchentlichen Kurs, der eine Einführung in geistliche Übungen bietet: Hannah, eine engagierte Pastorin, die von ihrer Gemeindeleitung zu einer unfreiwilligen Auszeit verdonnert wird. Meg, verwitwet und nach dem Auszug ihrer erwachsenen Tochter einsam und richtungslos. Mara, die mit sich selbst und ihrer Ehe zu kämpfen hat. Und Charissa, die talentierte, aber von ihrem eigenen Perfektionismus völlig gelähmte Schönheit ... Unter der behutsamen Anleitung der Kursleiterin begeben die vier Frauen sich auf eine geistliche Pilgerreise, in deren Verlauf sie sich gegenseitig näherkommen und jede auf ihre Art Heilungsschritte und neue Hoffnung erleben. Ganz nebenbei erfährt man als Leser viel über Sinn und Zweck der geistlichen Übungen und erhält neue Impulse für den persönlichen Weg mit Gott.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 573
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
InhaltKapitel 1Einladung zu einer Reise
Meg 1967
Hannah, 1976
Mara, 1968
Charissa, 1990
Hannah
Charissa
Mara
MegKapitel 2
Die Pilgerreise beginnt
New HopeKapitel 3
Dem Herzen Gottes näherkommen
Mara
Charissa
Hannah
Mara
Meg
HannahKapitel 4
Verweilen lernen
Lectio divina
Kapitel 5
Komm und sieh
Mara
Hannah
Meg
CharissaKapitel 6
Verstecken und suchen
Meg
Charissa
Sonntag
Charissa
Hannah
MaraKapitel 7
Achtsam unterwegs sein
Zusammen
Meg
Hannah
Mara
HannahKapitel 8
Intimität und Begegnung
Charissa
HannahKapitel 9
An der Kreuzung gefundenKapitel 10
Tiefer in die Wüste
Gemeinsam
Hannah
Meg
Mara
Charissa
Meg
Mara
ZusammenKapitel 11
Die Last leichter machen
Bekenntnis
Meg
Hannah
Meg
Meg
HannahKapitel 12
Gemeinsam in der Liebe Gottes unterwegs
LebensregelEpilog
Für die, die mit mir gegangen sind
Und für den Heiligen Geist, den sanften Offenbarer und treuen Führer
in tiefer Liebe und Dankbarkeit
Kapitel 1
Einladung zu einer Reise
Haltet an auf dem Weg, den ihr geht; seht euch um undfragt, wie es euren Vorfahren ergangen ist! Dann wählt den richtigen Weg und folgt ihm, so wird euer Leben Erfüllung finden!
Jeremia 6,16
Meg 1967
Ein kleines Mädchen in einem grauen Wollmantel und einer roten Strickmütze auf dem Kopf stapfte auf der Suche nach einem goldenen Schimmer allein durch den Schnee. Mama hatte die Schlittenglocken zu Weihnachten geschenkt bekommen, und mit einem Lächeln im Gesicht hatte sie sie an der Haustür aufgehängt. Der Wind hatte die Glocken gepackt und mit sich fortgerissen, aber die fünfjährige Meg war fest entschlossen, sie zu finden und Mama wieder glücklich zu machen.
Vor sich hinsummend suchte Meg die Büsche im Garten ab. Sie liebte es, Verstecken zu spielen. Aber Mama hatte keine Zeit, mit ihr zu spielen, und die elfjährige Rachel fand, für solche Babyspiele sei sie schon zu alt. Wenn nur Papa nicht in den Himmel zu Jesus gegangen wäre! Papa konnte sehr gut Verstecken spielen.
Fast eine Stunde lang suchte Meg geduldig nach den verschwundenen Glocken. Eine davon fand sie schließlich in der Nähe von Mrs Andersons Garage. Sie lugte aus einer Schneewehe hervor. Ihre Trophäe fest an sich gedrückt, hüpfte Meg die Auffahrt zu ihrem Haus hoch.
Mit gerunzelter Stirn stand Mama in der Tür. „Margaret Fowler!“, schimpfte sie. „Hast du denn nicht gehört, dass ich nach dir gerufen habe?“
„Mama, ich hab sie gefunden!“ Mit strahlendem Gesicht überreichte sie ihrer Mutter ihren Fund.
Mama zog Meg die Mütze vom Kopf. Dichte, blonde Locken kamen zum Vorschein. „Zieh deine Stiefel draußen aus. Wie oft muss ich das noch sagen? Ich möchte nicht, dass du den Schnee ins Haus trägst.“
Meg ließ ihre Stiefel auf der Veranda stehen und tänzelte, die Glocke schwenkend, ins Haus. „Guck doch, Mama! Ich habe deine Glocken gefunden!“
Stirnrunzelnd schloss Mama die Tür. „Welche Glocken?“
Meg Crane trat über die Schwelle ihres Elternhauses in Kingsbury in Michigan. Das Klimpern ihrer Schlüssel hallte in dem weitläufigen Flur. Obwohl sie fast 40 ihrer 46 Jahre in dem großen viktorianischen Haus der Familie Fowler verbracht hatte, war es ihr noch nie so unendlich einsam vorgekommen. Meg warf die Tür ins Schloss, rutschte mit dem Rücken an der Wand entlang langsam zu Boden und lehnte den Kopf an die Holzvertäfelung.
Fort. Becca war fort. Ihre geliebte Tochter war fortgegangen.
Meg wünschte, sie hätten mehr Zeit miteinander gehabt. Der 4. August war viel zu schnell angebrochen, und jetzt saß ihr einziges Kind in einem Flugzeug nach London, wo sie ihr erstes Collegejahr verbringen würde.
Beccas Lebendigkeit hatte Meg in Bewegung gehalten. Sie hatten immer so vieles gemeinsam unternommen, so viele Vorbereitungen waren für das Abenteuer in Übersee zu treffen gewesen. Beccas Fröhlichkeit und Begeisterung hatten Megs Trauer in den Hintergrund gedrängt.
Doch jetzt herrschte eine schreckliche Stille in dem leeren Haus.
Mutter war auch fort. Tot.
Monate waren seit Ruth Fowlers Tod vergangen, und noch immer kämpfte Meg gegen den Impuls an, ihrer Mutter einen Gruß zuzurufen, wenn sie das Haus betrat. Noch immer lauschte sie auf ihre Schritte auf der Treppe. Noch immer hielt sie vor der Schlafzimmertür inne und unterdrückte den Drang, ihr gute Nacht zu sagen.
Dass Becca nicht mehr da war, würde sie vermutlich genauso langsam verarbeiten. Sie stellte sich vor, wie sie nach Beccas rosa Wasserflasche auf der Küchentheke Ausschau hielt. Wie sie auf die fröhliche Stimme ihrer Tochter lauschte, die zur Musik aus ihrem iPod summte. Bestimmt würde sie immer noch um Mitternacht aufwachen und auf Beccas Schritte horchen, die von einer Unternehmung nach Hause kam.
Doch jetzt waren die einzigen Geräusche im Haus die melancholischen Seufzer einer alten Großvateruhr und das leise Summen des Kühlschranks.
Meg Crane war allein. Ganz allein.
Und was nun?
Meg sank in sich zusammen, barg ihren Kopf in den Händen und ließ ihren Tränen freien Lauf.
Am Samstagabend stellte Meg pflichtschuldig ihren Wecker. Obwohl sie den Sonntagmorgen lieber im Bett verbracht hätte, betrat sie während des ersten Liedes die Kingsbury Community Church. Seit Jahren machte sie das nun schon so. Es war die sicherste Art, Gesprächen mit den anderen Gottesdienstbesuchern aus dem Weg zu gehen: Sie kam, wenn das erste Lied gesungen wurde, setzte sich in die hinterste Ecke in die Nähe der Tür und verließ den Raum vor dem Segen. Mit ihren 1,52 Metern besaß Meg den einzigartigen Vorteil, dass sie in einen Raum schlüpfen und wieder verschwinden konnte, ohne bemerkt zu werden. An den meisten Sonntagen funktionierte ihre Strategie, sich unsichtbar zu machen, ganz gut.
Doch an diesem Sonntag stand zufällig Sandy an der Tür, die Frau des Pastors, als Meg aus dem Gottesdienstraum kam. Zügigen Schrittes durchquerte Meg das Foyer, als hätte sie es eilig, und hoffte, ihr entschlossener Blick würde bei der Pastorenfrau den Eindruck erwecken, dass dringende andere Verpflichtungen auf sie warteten. Doch als Sandy sie anlächelte und mit Namen begrüßte, war Meg klar, dass ihr Vorhaben gescheitert war.
„Ich hatte gehofft, dich heute Morgen mal zu erwischen, Meg. In den vergangenen Monaten haben wir gar nicht miteinander reden können. Wie geht es dir?“
„Prima, danke, Sandy. Und dir?“
„Ach, gut. Wir genießen das schöne Wetter. Die Sommer in Michigan sind einfach wunderschön, findest du nicht?“
Der Chor stimmte das letzte Lied an, und Meg war klar, dass ihr nicht mehr viel Zeit blieb, bevor sich das Foyer mit Menschen füllte, die sie nicht sehen wollte. Der Kraftaufwand, sich so weit zu beherrschen, dass sie nicht in Tränen ausbrach, war einfach zu groß. Ein mitfühlender Blick, ein liebevolles Wort, und sie verlor ihre mühsam erkämpfte Fassung.
Langsam schob sie sich näher an den Ausgang heran.
„Das hier war neulich in der Post und ich musste dabei an dich denken.“ Sandy reichte ihr einen pflaumenblauen Flyer. „Du kennst doch das New Hope-Zentrum, oder?“
Meg hatte das Einkehrzentrum noch nie betreten, aber schließlich war sie in Kingsbury aufgewachsen und natürlich oft an dem Gebäude und dem Gelände vorbeigefahren. „Ich – äh … ich weiß, wo es ist, aber das ist auch schon alles.“ Die Kirchentüren wurden geöffnet und bald würde sie von Menschen umringt sein.
Sandy hatte es ganz eindeutig nicht so eilig wie sie. „Das New Hope-Zentrum ist eine tolle Einrichtung“, schwärmte sie. „Ich habe schon an vielen Seminaren teilgenommen, die dort angeboten werden, und das hier ist wirklich hervorragend.“
Meg strich sich die aschblonden Locken aus den Augen und heuchelte Interesse, als Sandy ihr den Flyer zeigte, der zu einer „geistlichen Reise“ einlud.
„Dieser Kurs hat zum Ziel, dass man geistliche Disziplinen kennenlernt, mit deren Hilfe man die Beziehung zu Gott vertiefen kann“, erklärte Sandy. „Du hattest in den vergangenen Monaten so viele Veränderungen zu verkraften. Da dachte ich, dass dieser Kurs vielleicht etwas Gutes für dich wäre.“
Meg biss sich auf die Lippe. Offensichtlich hatten der Pastor und seine Frau erkannt, wie schwer der Trauerprozess an ihr nagte.
Sandy sprach mit sanfter Stimme weiter. „Ich erinnere mich noch, wie es mir nach dem Tod meiner Mutter ging. Und ich weiß doch, wie nahe ihr euch gestanden habt.“
Nahe?
Meg spürte, wie die Hitze über den Hals in ihre Wangen hochstieg. Die roten Flecken waren auf ihrer hellen Haut deutlich zu erkennen. Verräter. Sie hasste diese Flecken.
„Vielen Dank, dass du an mich gedacht hast, Sandy“, sagte sie und legte ihre eiskalte Hand an ihren Hals, um ihn zu kühlen. „Bitte richte Dave aus, dass er heute eine sehr gute Predigt gehalten hat.“
Und dann schlüpfte sie schnell durch die Glastüren, bevor jemand sie ansprechen konnte.
Hannah, 1976
Die siebenjährige Hannah Shepley liebte Braunbär, den treuen Verwalter ihrer Geheimnisse und Sorgen, heiß und innig. Als eines der sanften braunen Augen des Teddys ausfiel und nicht mehr zu finden war, brach es ihr das Herz. Miss Betty, die alte Nachbarin, tätschelte mit ihrer arthritischen Hand Hannahs Kopf und sagte, sie solle sich keine Sorgen machen; sie könne Braunbärs Augen wieder in Ordnung bringen. Mit Tränen in den Augen vertraute Hannah ihren Freund Miss Betty an, die versprach, ihn ihr bald zurückzubringen.
Als Braunbär zwei Tage später nach Hause kam, strahlte Miss Betty und sagte: „Hier, Hannah. Siehst du? So gut wie neu!“
Doch als Hannah in Braunbärs Augen blickte, erkannte sie ihn nicht. Und sie wusste, dass auch er sie nicht erkannte. Der allwissende, liebevolle Ausdruck war fort, ersetzt durch den ausdruckslosen, starren Blick von Plastikknöpfen, die keine Erinnerungen hatten. Hannah hatte ihren besten Freund und Vertrauten verloren.
Ihrer Mutter war ihr Schweigen peinlich. „Was sagt man, Hannah? Miss Betty hat sich große Mühe gegeben, deinen Teddy für dich zu reparieren.“
„Vielen Dank, Miss Betty“, flüsterte Hannah. Doch als sie allein in ihrem Zimmer war, brach sie in Tränen aus.
„Wenn ich mit Ihnen gesprochen habe, geht es mir gleich viel besser“, sagte die Stimme am anderen Ende der Leitung tief bewegt.
Die 39-jährige Hannah Shepley lächelte in sich hinein. 15 Jahre lang war sie nun schon zweite Pastorin in der Westminster Church in Chicago, und sie liebte ihre Arbeit noch immer.
„Wir sollten uns treffen, um miteinander zu beten“, bot Hannah an, nahm sich ihren Terminkalender vor und überflog die Termine für diesen Tag: Dienstag, der 5. August. Der Tag war vollständig verplant bis hin zu einer Verabredung zum Abendessen. „Ist zwanzig Uhr heute Abend zu spät für Sie?“, fragte Hannah. „Ich besuche Sie gern zu Hause. Aber natürlich können Sie auch in mein Büro kommen. Wie es Ihnen besser passt.“ Sie verabredeten sich in Hannahs Büro.
Hannah hatte große Sorgfalt darauf verwandt, durch die Ausstattung des Büros eine heimelige Atmosphäre zu schaffen. Eigentlich war es jetzt sogar viel gemütlicher als in ihrer Wohnung, und das war gut so. Menschen, die in einer Krise steckten, sollten ihr Büro als einen Zufluchtsort empfinden, und tatsächlich war es so, dass sie selbst ohnehin viel mehr Zeit hier verbrachte als zu Hause. Einmal hatte sie nachgerechnet, wie viele Stunden sie sich in ihrer Wohnung aufhielt, und sie hatte festgestellt, dass es nicht mal ein Drittel des Tages war.
Selbst die Krankenhäuser lagen weiter vorn.
Hannah warf einen Blick auf die Uhr und schnappte sich ihre Schlüssel. Sie sollte um 10:00 Uhr im Krankenhaus sein, um Ken Walsh zu besuchen, der am offenen Herzen operiert werden sollte. Und wenn sie schon mal da war, konnte sie auch gleich nach Mabel Copeland sehen, die sich von einer Hüftoperation erholte. Wenn sie sich beeilte, bliebe noch genug Zeit, um unterwegs ein paar Blumen zu besorgen.
Im Flur stieß sie beinahe mit Steve Hernandez zusammen, dem Hauptpastor ihrer Gemeinde. „Na, hast du es schon wieder eilig?“, fragte Steve.
Hannah strich sich ihre kinnlangen, braunen Haare hinter die Ohren. „Das ist wieder mal einer von diesen Tagen, an denen ich an drei Orten gleichzeitig sein müsste. Du weißt ja, wie das ist.“
„Kann ich dir heute irgendetwas abnehmen?“, fragte Steve.
Diese Frage stellte Steve immer, und Hannah verneinte sie jedes Mal. Sie hatte alles im Griff. Trotzdem war sie dankbar, dass er fragte. Viele Pastoren nahmen ihre zweiten Pastoren als selbstverständlich hin. Aber Steve nicht. Er behielt den geistlichen Zustand seiner Mitarbeiter im Blick, und sie liebten ihn dafür.
„Achte darauf, dass du dir heute auch mal Zeit zum Verschnaufen nimmst, Hannah.“
Sie lachte. „Der Termin zum Durchatmen ist am Donnerstag in einer Woche.“
Am folgenden Morgen klopfte Steve um kurz vor 8:00 Uhr an ihre geöffnete Bürotür. „Schon wieder so früh bei der Arbeit?“, fragte er mit einem Blick auf seine Uhr.
Hannah blickte von ihren Unterlagen hoch und unterdrückte ein Gähnen. „Ich war schon früh im Krankenhaus, um mit Ted und seiner Familie noch vor seiner Operation heute Morgen zu beten. Eigentlich wollte ich gleich dortbleiben und mit den Angehörigen zusammen warten, aber ich habe um neun eine Besprechung. Ich fahre später noch mal hin, um mich zu erkundigen, wie die Operation gelaufen ist.“ Sie deutete auf ihre braune Couch. „Komm doch rein, Steve. Setz dich.“
Er schob ein Kissen und eine Decke zur Seite. „Hast du etwa hier übernachtet?“
„Ich schlafe nachher noch eine Runde.“ Sie trank einen Schluck Kaffee. „Was gibt’s?“
Steve atmete tief durch. „Hannah, die Ältesten und ich sind zu einer Entscheidung gekommen, die dir sicher nicht gefallen wird. Aber ich hoffe, du kannst sie als Geschenk annehmen.“
Hannah biss die Zähne zusammen und überlegte sofort, was das sein könnte. Erstaunlich, wie viele unterschiedliche Gedanken einem innerhalb von fünf Sekunden durch den Sinn schießen konnten. Sie war aufgeschreckt. Sollte der Mitarbeiterstab neu organisiert werden? Wurde ein Dienstzweig gekürzt? Wollte man ihr ein anderes Team anvertrauen?
„Wir schicken dich in eine neunmonatige Sabbatzeit“, erklärte er. „Ab September.“
Ihre wirbelnden Gedanken kamen abrupt zum Stillstand. „Das … das verstehe ich nicht“, stammelte sie und suchte in seinem Gesicht nach nonverbalen Hinweisen.
„Ich weiß. Aber wir beobachten dich nun schon seit einer Weile, und es wird höchste Zeit. Du arbeitest jetzt seit fast fünfzehn Jahren hier, ohne Pause. Es ist längst überfällig.“
„Aber viele Pastoren arbeiten viel länger und haben nie frei“, hielt sie dagegen. „Außerdem habe ich im vergangenen Jahr sechs Wochen Pause eingelegt!“
Steve lachte. „Um dich von einer größeren Operation zu erholen! Und wenn ich mich recht entsinne, hast du von zu Hause aus weitergearbeitet.“
Sie schüttelte entschieden den Kopf. „Ich brauche keine Sabbatzeit. Ich liebe meine Arbeit, und es geht mir gut.“
„Dieses Mal gibt es kein Herausreden, Hannah. Die Entscheidung ist gefallen. Und weil so viele Leute in der Gemeinde dich sehr schätzen und lieben – und damit du dich wirklich entspannen kannst –, haben wir Geldspenden bekommen, die deine Auszeit auch finanziell absichern.“
Hannah hatte noch nie gehört, dass einer Pastorin eine so lange Sabbatzeit gewährt worden war. Das machte sie misstrauisch. Da man ihr immer sehr schnell ansah, was sie dachte, wandte sie sich ab und studierte eingehend die Topfpflanze und den Luftballon mit der Aufschrift „Gute Besserung!“, die sie Ted später am Tag ins Krankenhaus bringen wollte.
Steve ahnte ihre Reaktion voraus und reagierte auf ihre unausgesprochenen Ängste: „Wir wollen dich nicht loswerden, Hannah. Keine Sorge. Du machst deine Arbeit großartig, die Gemeinde liebt dich und du bist eine prima Kollegin.“
Noch immer hielt sie den Blick abgewandt. Sie traute sich selbst nicht. Aus den Augenwinkeln beobachtete sie, wie er sich vorbeugte, seine Ellbogen auf die Knie stützte und die Hände faltete. Dies war Steves Haltung, wenn er es ernst meinte, und eigentlich war sie reserviert für besonders schwierige Situationen: Ehepaare, die kurz vor einer Scheidung standen; Teenager, die mit Selbstmordgedanken kämpften; Eltern, die nach dem Tod eines Kindes ihren Glauben zu verlieren drohten. Steve drückte dann bildlich gesprochen die Hacken fest in den Boden und zog mit aller Kraft an dem unsichtbaren Seil die Betroffenen vom Abgrund der Verzweiflung zurück in die starken Arme Jesu.
Ganz eindeutig schien Steve der Ansicht zu sein, dass Hannah an einem Abgrund stand. Aber wie kam er darauf? Sie brauchte das Seil nicht. Gar nicht, überhaupt nicht.
„Erinnerst du dich noch an diese wundervolle Predigt über Johannes fünfzehn, die du vor ein paar Monaten gehalten hast?“, sagte er.
Hannah antwortete nicht. Sie hatte das ungute Gefühl, dass ihre Auslegung des Bildes von Jesus als dem Weinstock und Gott als Gärtner gleich von hinten über sie herfallen und sie beißen würde.
„Du hast der Gemeinde zu erklären versucht, dass es keine Strafe ist, wenn ein Weinstock beschnitten wird, sondern dass es seiner Verbesserung dient. Du hast uns daran erinnert, dass Gott uns formt, wenn er uns beschneidet, sodass wir Christus ähnlicher werden. Jesus hat gesagt, dass die Zweige, die beschnitten werden, diejenigen sind, die die beste Frucht bringen. Und du bringst Frucht, Hannah. Viel Frucht. Diese Sabbatzeit ist keine Strafe – sieh sie doch als eine Möglichkeit, dich neu zu formieren. Es ist an der Zeit, dass Gott einmal für dich sorgt, um dich zu erhalten.“
„Aber schon im September?“, rief sie. „Das ist unmöglich! Ich habe die Herbstveranstaltungen doch bereits geplant. Auf keinen Fall kann ich einfach alles stehen und liegen lassen. Und wer soll denn überhaupt für mich einspringen?“
Steve zögerte, und sein Zögern verriet Hannah alles, was sie wissen musste. Das Ganze war schon seit längerer Zeit geplant. Aber sie hatten es ihr verschwiegen. Warum war sie denn nicht vorgewarnt worden? Warum hatten sie sie nicht in die Planung mit einbezogen? Mehr noch, warum war sie gar nicht erst um ihre Meinung gefragt worden?
„Es ist bereits alles geregelt, Hannah. Du brauchst dir keine Gedanken zu machen. Ich verspreche es.“
Das war verrückt. Vollkommen absurd. Wie hatte das passieren können?
Steve sprach mit seiner leisen, beruhigenden Stimme weiter. „Du leistest großartige Arbeit hier. Alle Mitarbeiter und Ältesten sind sich in diesem Punkt einig. Aber wir denken auch, dass du etwas Zeit und Raum brauchst, um deine persönlichen und beruflichen Identitäten zu entwirren. Du weißt nicht mehr, wer du bist, wenn du nicht deinen Beruf ausübst. Du weißt nicht, was du mit dir anfangen sollst, wenn du einmal nicht gebraucht wirst. Und du merkst gar nicht, wie erschöpft du im Grunde genommen bist. Glaub mir. Ich spreche aus Erfahrung.“
Obwohl seine Stimme sanft war, zuckte sie zusammen.
„Vor Jahren hat mein Pastorenkollege dasselbe Gespräch mit mir geführt, Hannah. Er hat Warnzeichen in meinem Leben erkannt, die ich selbst nicht wahrnehmen konnte, und er hat die Initiative ergriffen. Sein Eingreifen hat mir meine Arbeitskraft gerettet, meine Familie und meine Gesundheit. Die Auszeit war ein großer Segen für mich, und ich hoffe, dass sie auch für dich ein Segen sein wird.“
Sie wollte das nicht hören. Sie war nicht ausgebrannt, und sie stand auch nicht am Abgrund. Sie hatte keine Familie, um die sie sich Gedanken machen musste, und mit ihrer Gesundheit war alles in Ordnung. Sie brauchte keine Pause. Gar nicht, überhaupt nicht.
„Kann ich denn nicht einfach nur einen Monat frei nehmen?“
„Nein.“
„Dann drei Monate? Ich werde irgendwo eine Einkehrzeit halten und erfrischt und erneuert zurückkehren.“
Steve ließ nicht mit sich reden. „Wir sprechen hier von einer radikalen Beschneidung. Zwei oder drei Monate reichen nicht aus, dann zählst du nur die Tage, bis du wieder zurückkommen und genau an der Stelle weitermachen kannst, wo du aufgehört hast.“
„Aber ein ganzes Schuljahr! Wie soll ich denn diese ganze freie Zeit füllen?“
Er lächelte sanft. „Mach dir darüber keine Gedanken. Du brauchst ja noch nicht sofort zu planen. Wir können später über ein paar Ideen sprechen, was du in dieser Zeit tun könntest. Aber das Wichtigste ist, dass du irgendwohin fährst, wo du einmal wirklich zur Ruhe kommst, und wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um dir dabei zu helfen.“ Er erhob sich. „Neun Monate, Hannah. Gib Gott neun Monate Zeit.“
Widerspruch hatte keinen Zweck, das wusste sie. Die Entscheidung war gefällt worden, ohne sie mit einzubeziehen – ohne ihr Wissen oder ihre Billigung –, und sie konnte nichts dagegen tun. Während sie Steve beim Verlassen ihres Büros hinterherschaute, begann sie sich zu ärgern. Seine Einmischung war unnötig. Sie wollte das nicht, dieses „Geschenk“, das so ungewöhnlich großzügig sein sollte. Doch sie fühlte nicht nur Verärgerung. Jetzt machten sich auch Schuldgefühle wegen ihrer Undankbarkeit bemerkbar.
Und dieses Gefühl behagte ihr schon gar nicht.
Mara, 1968
Mara Payne biss sich auf die Lippe. Sie hielt den Blick gesenkt und trat mit ihren Turnschuhen nach kleinen Dreckklumpen im Gras. Sie kannte das schon. Diese Rolle hatte sie bereits unzählige Male gespielt, und das Drehbuch beherrschte sie im Schlaf: Nacheinander würden die beiden Mannschaftsführerinnen die Namen ihrer Klassenkameraden aufrufen. Nacheinander würden die Erwählten zu der jeweiligen Seite gehen, sich gegenseitig gratulieren und der Mannschaftsführerin ins Ohr flüstern, wen sie als Nächste wählen sollte.
Mara brauchte nicht hochzublicken, um zu wissen, was gerade passierte. Die Füße neben ihren gehörten zu Eddie Carter. Sie kannte seine Turnschuhe: Blaue Streifen, schmuddelige Schnürriemen und ein kleines Loch am großen Zeh. Eddie wurde immer als Vorletzter ausgewählt, aber er wurde wenigstens gewählt. Mara blieb immer übrig. Wenn die Mannschaftsführerin schließlich mürrisch ihren Namen zwischen den Zähnen hervorstieß, würde sie tief beschämt zu der entsprechenden Mannschaft trotten und sich dabei einreden, dass es ihr nichts ausmachte. Aber die Tränen, die auf ihre Schuhe tropften, erzählten eine andere Geschichte.
An einem warmen Augustabend saßen Mara und Tom Garrison in Michigan auf der Tribüne des Sportplatzes, verspeisten Hotdogs und feuerten die Baseballmannschaft ihres Sohnes, die Kingsbury Knights, an. Der Freitagabend war einer der wenigen Abende, die die Familie gemeinsam verbrachte. In der Woche war Tom von Montag bis Donnerstag geschäftlich unterwegs, und Mara vollführte den Eiertanz eines alleinerziehenden Elternteils. Doch wenn Tom zu Hause war, beschäftigte er sich mit Begeisterung mit ihren beiden Söhnen im Teenageralter.
„Los, los, los!“ Mit einem Satz war Tom auf den Beinen, als der fünfzehnjährige Kevin erst die erste, dann die zweite und schließlich die dritte Base erreichte. „Sicher!“, schrie Tom zusammen mit dem Schiedsrichter. „Ja! Gut gemacht, Kev!“ Er setzte sich wieder, immer noch begeistert klatschend. „Ich sag dir was, Mara, dieser Junge hat Talent. Pass nur auf! Am Ende bekommt er noch irgendwo ein Stipendium. Baseball, Football, Basketball – was es auch sei, er kann es!“
Mara trank einen Schluck von ihrer Cola light und suchte auf der Spielerbank nach dem dreizehnjährigen Brian. Als sie ihn schließlich entdeckte, erhob sie sich. Sie war nicht zu übersehen in ihrer weiten limonengrünen Tunika und dem breitkrempigen Strohhut; aber falls Brian bemerkt hatte, dass sie ihm zuwinkte, dann zeigte er es nicht. Sie ließ sich wieder auf die Bank sinken und hoffte, dass niemand sonst beobachtet hatte, wie er kurz in ihre Richtung gesehen hatte, bevor er sich abwandte.
„Hast du eigentlich schon überlegt“, begann sie und wischte sich die Hände an ihren voluminösen Oberschenkeln ab, „was du morgen mit den Jungs unternehmen willst?“
Tom antwortete nicht, sondern konzentrierte sich demonstrativ auf den Wurf des Werfers und auf Kevin an der dritten Base. Mara wartete, bis der Schlagmann ausholte und den Ball verpasste, bis sie es noch einmal probierte. „Ich würde gern wissen, ob ihr vorhabt, den ganzen Tag unterwegs zu sein, oder ob ihr zum Abendessen wieder zu Hause seid.“
„Keine Ahnung. Das entscheiden wir spontan.“ Sein Blick lag immer noch auf dem Spielfeld.
Mara nahm ihren Hut ab und lockerte ihre frisch gefärbten, dunkelbraunen Haare. Sie rochen immer noch nach Ammoniak. Eines Tages würde sie sich mal eine Haarfarbe aus dem Friseursalon gönnen. Leider waren die kupferfarbenen Strähnchen eher orange geworden. Vielleicht würde sie einen Termin bei einem Friseur vereinbaren, um das in Ordnung zu bringen. Mit 50 konnte sie sich doch ruhig auch mal richtig verwöhnen lassen, was sie sich sonst ja nicht gönnte. Auch wenn Tom nicht damit einverstanden sein würde.
Sie seufzte. „Ich koche gern was, wenn du meinst, dass ihr bis dahin vom Spiel zurück seid.“
Tom biss von seinem Hotdog ab und winkte Brian zu. Brian winkte zurück. „Ich sagte doch, ich weiß es nicht. Wir entscheiden spontan.“
„Es würde mir nur helfen, meinen Samstag zu planen, wenn ich wüsste, wa-“
„Genug jetzt, Mara!“, fuhr er sie an und strich mit den Händen ruppig über seinen grauen Bürstenhaarschnitt. „Würdest du mich jetzt bitte in Ruhe das Spiel anschauen lassen?“ Er sprang auf und jubelte erneut, als Kevin einen Homerun hinlegte. „Gut gemacht, Kev! Weiter so!“ Kevin wandte sein sommersprossiges Gesicht der Tribüne zu und zeigte seinem Vater den hochgereckten Daumen.
Mara setzte ihren Hut wieder auf. „Ich wollte nur-“
Tom wirbelte herum und funkelte sie an. „Mach, was du willst, okay? Wenn wir Hunger bekommen, dann holen wir uns auf dem Heimweg etwas zu essen. Und jetzt hör endlich auf, mich zu löchern!“
Mara beobachtete, wie eine der anderen Mütter sich umdrehte und einen mitfühlenden Blick in ihre Richtung schickte. Mara zwang ein Lächeln auf ihr Gesicht und rollte die Augen. „Männer!“, formte sie mit den Lippen und schüttelte den Kopf.
Nach dem Spiel stand sie auf der Tribüne und sah zu, wie Tom die Jungen auf dem Spielfeld umarmte. Langsam ging sie über den Parkplatz zu ihrem schwarzen SUV und kämpfte gegen die Tränen an.
Traditionell feierten Tom und die Jungen nach einem Spiel im Steakhaus. Als sie nach Hause kamen, lag Mara bereits im Bett und tat so, als würde sie schlafen.
Am Montagabend saß Mara auf dem Bett und sortierte Socken. Andere Frauen hatten ihr erzählt, dass sie die saubere Wäsche im Wäschekorb liegen ließen. Ihre Ehemänner und Kinder mussten sich dann selbst heraussuchen, was sie brauchten. Aber das Wäschefalten machte Mara nichts aus. Das Sortieren der Socken empfand sie als besonders befriedigend. Wenn sie das Gegenstück nicht finden konnte, legte sie die einzelne Socke in ihre oberste Kommodenschublade und wartete darauf, dass deren Partner wieder auftauchte. Aber leider war es so, dass ihre oberste Schublade mittlerweile vollgestopft war mit einzelnen Socken, die früher einmal zu einem Paar gehörten und die sie einfach nicht wegwerfen konnte.
Es sollte einen Song darüber geben. Vielleicht gab es ja einen?
Kevin erschien im Türrahmen, als Mara gerade Toms Unterhemden einräumte. „Ich soll dir von Papa ausrichten, dass er am Donnerstagabend erst spät nach Hause kommt.“
Seit Kevin zu seinem 15. Geburtstag ein Mobiltelefon bekommen hatte, hatte Tom sich angewöhnt, nur noch über ihn mit ihr zu kommunizieren. Oder er schrieb eine SMS. In letzter Zeit hatte Mara kaum einmal persönlich mit Tom gesprochen, wenn er auf Reisen war. Oder auch zu Hause.
Nachdem Kevin seine Botschaft überbracht hatte, verschwand er wieder. Sie wünschte, die Jungen würden nur einmal etwas länger bleiben, um sich mit ihr zu unterhalten – und nicht nur grunzen oder die Achseln zucken, wenn sie nach der Schule oder ihren Freunden fragte. In ganzen Sätzen sprachen sie nur mit ihr, wenn sie nach dem Essen oder der Wäsche fragten oder wenn sie irgendwohin gefahren werden wollten.
„Kevin, vergiss nicht, dass du morgen einen Termin beim Kieferorthopäden hast!“, rief Mara ihm nach. Er antwortete nicht. „Kevin!“
„Ja, ja, ich weiß!“, rief er aus seinem Zimmer.
„Wo ist meine Jeans?“ Jetzt stand Brian in der Tür.
„Ich habe sie in deine Kommode geräumt.“
„Nein, die schwarze.“
„Die habe ich nicht gesehen.“
„Ich habe sie letztens in den Wäschekorb gesteckt!“
„Hm. Heute Morgen habe ich den Wäschekorb geleert und alles gewaschen, was drin war.“
„Und wo ist dann meine Jeans?“ Wie er da im Türrahmen stand, mit gerunzelter Stirn, die Arme vor der Brust verschränkt, sah er genauso aus wie sein Vater.
„Sieh in deinem Zimmer nach. Neben deinem Schreibtisch liegt ein Klamottenhaufen.“
Dawn, ihre Therapeutin, hatte ihr geraten, den Jungen nicht immer nachzugeben. Sie müssen Verantwortung übernehmen, hatte Dawn gesagt. Sie müssen lernen, mit den Konsequenzen ihres Handelns zu leben.
Brian verschwand und kam mit der zu einem Ball zusammengeknüllten Jeans zurück. Er warf sie Mara zu. „Die brauche ich morgen“, sagte er und verließ das Zimmer.
Mara ließ langsam den Atem entweichen und steckte die Jeans in den leeren Wäschekorb. Eines Tages würde alles vielleicht anders werden. Gott, bitte. Sie wusste nicht, wie lange sie noch so weitermachen könnte.
Charissa, 1990
Der Stammplatz der Familie Goodman war die erste Reihe, direkt vor der Kanzel, wo sie von allen gesehen wurden. Die achtjährige Charissa saß zwischen ihren Eltern und tat so, als würde sie aufmerksam der Predigt lauschen. Selbst wenn ihre Oberschenkel juckten oder ihre Taftschleife in der Taille zu fest gebunden war, Charissa rührte sich nicht.
Sie saß auf ihrem Platz wie eine Statue – reglos und stoisch wie die Statuen, die vor vielen Jahrhunderten von Mutters griechischen Vorfahren in Stein gemeißelt worden waren. Auch Papas Vorfahren waren reglos und stoisch gewesen, aber sie waren Briten. Vielleicht sogar adliger Herkunft. Charissa mochte die Vorstellung, sie wäre eine Prinzessin. Papa sagte immer, sie hätte ein Gesicht, das tausend Schiffe bewegt, wie die schöne Helena von Troja.
Charissa von Kingsbury.
Sie mochte den Klang ihres Namens, aber leider musste sie die Leute immer korrigieren, die ihn falsch aussprachen. „Es heißt ‚Ka-Rissa‘“, erklärte sie dann. Ihr Name bedeutete „Anmut, Gunst“, und auch das gefiel Charissa. Sie bemühte sich, sich so anmutig und huldvoll wie möglich zu geben.
In den Gottesdiensten saß Charissa nach außen meistens reglos da, doch ihre Gedanken waren immer in Bewegung. Bücher in die Kirche oder an den Abendbrottisch mitzubringen, erlaubte ihre Mutter ihr nicht, darum speicherte Charissa sie in ihrem Kopf. Dort lagerte eine ganze Bibliothek, und sie konnte die Bücher lesen, wann immer sie wollte. Niemand wusste, dass sie nur so tat, als würde sie auf die Predigt hören. Und jeden Sonntag schüttelte Reverend Hildenberg Charissa die Hand und betonte, was für eine Freude es sei, dass sie so aufmerksam zuhörte. Und ihr Papa legte dann seinen Arm um Charissas Schultern, lächelte und erwiderte: „Danke, Reverend. Wir sind sehr stolz auf sie.“
Die 26-jährige Charissa Sinclair lehnte sich zurück, um ihre verspannten Schultern zu lockern, und erhob sich schließlich. Nur die Doktoranden an der Kingsbury-Universität bekamen kleine Studienräume in der Zentralbibliothek zur Verfügung gestellt, und ihrer war vollgestopft mit den Klassikern der englischen Literatur. Sie überflog die Bücherregale und überlegte, welchen ihrer Lieblinge sie mit nach Hause nehmen sollte. Den Abend würde sie definitiv wieder mit Milton verbringen, und sie brauchte noch Sekundärliteratur über die Kultur und Gesellschaft im elisabethanischen England. Natürlich müsste sie auch langsam mal mit ihrer Arbeit über Shakespeare anfangen, sobald ihre Analyse von Das verlorene Paradies fertig war. Das Herbstsemester hatte gerade erst begonnen, und sie fühlte sich bereits vollkommen ausgelaugt.
Sie band ihre langen dunklen Haare zusammen und warf einen Blick auf ihre Uhr. John wollte sie auf dem Heimweg von der Arbeit abholen. Vielleicht sollte sie ihn anrufen und ihm sagen, dass sie über Nacht in der Bibliothek blieb. Dann hätte sie Zugang zu allen Büchern, die sie vielleicht brauchte.
Aber nein – das ging ja nicht. John müsste dann früh aufstehen und sie holen, damit sie vor ihrem Seminar um 8:00 Uhr noch duschen und sich umziehen könnte. Es war wirklich ärgerlich, dass sie nur ein Auto hatten.
Aber dass sie so mit dem Geld haushalten mussten, war nur eine vorübergehende Phase. John hatte einen guten Job in der Werbeagentur, und Charissa würde bald Dozentin für englische Literatur werden. Noch vier Jahre Studium. Ihr Vater begriff nicht, warum sie sechs Jahre ihres Lebens investierte, um an einer kleinen christlichen Universität zu promovieren, wo sie doch auch an einer der Eliteunis hätte studieren können. Doch an der Englisch-Fakultät von Kingsbury war Charissa gut bekannt. Nachdem sie ihren Bachelor summa cum laude abgeschlossen hatte, genoss sie die Vorteile, die es hatte, ein großer Fisch in einem kleinen Teich zu sein. Obwohl Papa es lieber gesehen hätte, wenn sie eine profitablere Karriere in einer Anwaltskanzlei oder einem großen Unternehmen angestrebt hätte, gefiel es ihm doch, allen Leuten zu erzählen, dass sein kleines Mädchen promovierte. Und Charissa hatte keine Einwände.
Sie packte ihren Laptop und einen Stapel Bücher zusammen, bevor sie nach draußen auf den Parkplatz ging, um auf ihren Mann zu warten.
Am Dienstagabend war Charissa auf dem Weg zu ihrem kleinen Arbeitsraum in der Bibliothek, als ihr ein pflaumenblauer Flyer am Schwarzen Brett ins Auge stach. „Eine Einladung zu einer geistlichen Reise“, stand da. Da mehrere Exemplare davon vorhanden waren, nahm sie einen aus dem Plastikhalter und steckte ihn in ihren Rucksack.
Normalerweise hätte sie diesem Flyer keinerlei Beachtung geschenkt. Sie kannte das New Hope-Einkehrzentrum nicht und wusste auch nicht, welche Kurse dort angeboten wurden. Doch Dr. Allen, dessen Seminar Literatur und die christliche Vorstellungskraft sie besuchte, hatte seinen Studenten nahegelegt, ihrer persönlichen Beziehung zu Gott größere Beachtung zu schenken.
„Auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen wie eine Schallplatte, die einen Sprung hat“, sagte er am Ende des Seminars, „möchte ich euch doch noch einmal sehr ans Herz legen, ergänzend zum Lehrplan zu arbeiten, wenn ihr die Literatur, mit der wir uns in diesem Semester beschäftigen werden, wirklich verstehen wollt. Ihr solltet euch die Mühe machen, euch den Verlauf und die Windungen eurer eigenen geistlichen Reise einmal genau anzuschauen.“
Er nahm seine Brille ab und strich mit der Hand über sein Gesicht und seine graumelierten Haare. „Die Dichter und Autoren, in deren Werke wir uns vertiefen wollen, schöpften aus der Fülle ihrer persönlichen Erfahrungen mit Gott“, fuhr er fort. „In ihren Werken setzen sie sich mit den Fragen auseinander, wer Gott ist und wozu er sie geschaffen hat. Wenn ihr nicht ganz persönlich in diese Auseinandersetzung eintretet, werden die Texte für euch nicht lebendig werden. Darum möchte ich euch noch einmal Mut machen, euch in diesem Semester mit eurem eigenen geistlichen Erleben zu befassen. Achtet darauf, was euch formt und prägt. Wenn ihr euch Gottes Einfluss auf euch neu aussetzt, werden diese Texte euch ganz anders ansprechen.“
Charissa überlegte, ob der im New Hope-Zentrum angebotene Kurs wohl Dr. Allens Vorstellungen entsprach. Sechs Samstagstermine über drei Monate wären machbar für sie. Vielleicht erfüllte der Kurs ja Dr. Allens Anforderungen.
Sie wartete, bis sich der Raum geleert hatte, bevor sie an seinen Tisch trat, um ihn zu fragen, ob ihm der Kurs „Geistliche Reise“, der in dem Flyer beworben wurde, bekannt war.
„Begleiten Sie mich doch ein Stück“, forderte er sie auf und nahm seine Aktentasche und seinen Becher.
Sie folgte ihm durch den Flur zu seinem Büro. „Ich habe diesen Flyer gefunden und frage mich, ob der Kurs die Art von Ergänzung zu ihrem Seminar ist, von der Sie gesprochen haben.“
„Durchaus.“
„Und die Kursleiterin Katherine Rhodes. Kennen Sie sie?“
Er nickte. „Ich kenne Katherine gut.“
Charissa zögerte, suchte die richtigen Worte für ihre nächste Frage. „Und theologisch … ich meine …“
Dr. Allen unterbrach sie lachend. „Haben Sie Sorge, vom rechten Glauben abzukommen, Charissa? In diesen Räumen hier besteht viel eher die Gefahr, mit Irrlehren konfrontiert zu werden, als dort. Bei Katherine sind Sie in guten Händen.“ Er trank einen Schluck aus seinem Becher. „Warum interessieren Sie sich für diesen Kurs, jetzt mal abgesehen von meiner Empfehlung im Seminar?“
Sie überlegte kurz und antwortete dann: „Ich möchte lernen.“
Er blieb stehen und blickte sie mit seinen dunklen Augen an. „Falsche Antwort“, erwiderte er und lächelte geheimnisvoll. Machte er Witze?
Obwohl sie mehrere Zentimeter größer war als der Professor, fühlte sich Charissa auf einmal ziemlich klein. Sie senkte den Blick auf seinen sauber ausrasierten Ziegenbart und wartete darauf, dass er weitersprach.
„Nehmen Sie an dem Kurs teil, um Gott zu begegnen, Charissa, oder lassen Sie es bleiben.“
Hannah
Nur einen Monat, nachdem Steve sie mit der Nachricht von ihrem unerwünschten Urlaub überrascht hatte, händigte Hannah einer Praktikantin von etwa Mitte 20 mit Namen Heather, die von der Gemeinde als Ersatz für sie verpflichtet worden war, ihre Schlüssel aus. Heather hatte im Mai ihr Examen am Seminar abgelegt und freute sich sehr über diese Möglichkeit, ein neunmonatiges Praktikum zu absolvieren, bevor sie sich eine feste Stelle suchte. Sie war noch so jung und voller Eifer und hegte die größten Hoffnungen und Pläne für ihren Dienst.
Als Hannah in die funkelnden Augen ihrer Vertreterin blickte, erhaschte sie einen flüchtigen Blick auf sich selbst, wie sie früher gewesen war, damals, als auch sie noch jung und voller Tatendrang frisch vom Seminar in die Westminster Church gekommen war. Sie war 24 gewesen und wollte etwas bewegen. Doch die vergangenen 15 Jahre hatten ihren Tribut gefordert. Wenn Hannah jetzt in den Spiegel blickte, erkannte sie sich selbst kaum wieder. Silberne Fäden mischten sich in ihre braunen Haare, zu viele, um sie noch zu verstecken, und Müdigkeit lag in ihren Augen. Eine unendlich große Müdigkeit. Ihr Alterungsprozess schien sich beschleunigt zu haben, seit Steve ihr das mit der Auszeit offenbart hatte. Aber vielleicht war sie sich ihrer Erschöpfung auch nur stärker bewusst geworden, seit sie es etwas langsamer angehen ließ.
„Machen Sie sich keine Sorgen“, versicherte Heather ihr. Sie klimperte mit Hannahs Haus- und Büroschlüssel. „Ich habe alles im Griff. Und wenn ich Fragen habe, schreibe ich Ihnen eine E-Mail.“ Die Praktikantin lächelte wissend. „Pastor Steve hat gesagt, dass ich Sie in Ruhe lassen und nicht mit irgendwelchen Fragen belästigen soll.“
„Gott segne Sie, Heather.“ Hannahs Herz hatte so wenig Verbindung zu ihren Lippen, dass sie ihre eigene Stimme kaum erkannte. „Ich hoffe, es wird eine gute Zeit für Sie.“ Ehrlich? Wollte sie wirklich, dass diese junge Anfängerin als ihre Vertretung Erfolg hatte? Oder hoffte sie insgeheim, sie würde elend scheitern, damit Steve sie förmlich anflehte, sofort zurückzukommen?
Sie wusste nicht, wie sie diese Frage beantworten sollte.
Nach einem weiteren flüchtigen Blick zurück folgte Hannah ihrer Freundin Nancy Johnson nach draußen zum Wagen. Hannah hatte ihren alten Honda mit Büchern aus ihrem Büro beladen – so viele, wie hineinpassten. Wenn sie schon zu dieser Pause gezwungen wurde, dann wollte sie die Zeit wenigstens gut nutzen.
Kleidung war nebensächlich. Hannah hatte häufig Scherze darüber gemacht, dass sie sich dank ihrer eintönigen Garderobe selbst im Dunkeln anziehen könnte. Und tatsächlich war sie häufig gezwungen, mitten in der Nacht in ihre Sachen zu steigen, wenn sie zu einem Notfall ins Krankenhaus gerufen wurde. Ihre Garderobe war eindeutig pflegeleicht und reisefreundlich. Die wesentlichen Dinge hatten in einen einzigen Koffer und eine Reisetasche gepasst: ihre Pantoffeln aus Schaffell und die Flanellschlafanzüge, einige Jeans und Sweatshirts, ein paar Pullis und Jogginghosen, ein Wintermantel und zwei Fleecepullover, bequeme Schuhe und Stiefel. Die leichteren Kleidungsstücke würde sie im Frühling holen. So hatte sie auch einen guten Grund, nach Hause zu kommen.
„Das ist sicher sehr schwer für dich“, bemerkte Nancy leise.
Du hast ja keine Ahnung, erwiderte sie still für sich. Sie konnte immer noch nicht fassen, was hier geschah.
Die letzte Kiste verstaute sie hinter dem Fahrersitz, und sie hoffte sehr, dass Nancy ihren Inhalt nicht gesehen hatte, als der Deckel aufsprang. In der Kiste steckten alte Tagebücher und andere persönliche Erinnerungsstücke, die Hannah nicht zurücklassen wollte. Schließlich wusste sie ja nicht, wie neugierig Heather war oder wer sonst noch während ihrer Abwesenheit durch ihr Haus wandern würde.
„Doug und ich beten, dass du zur Ruhe kommen und Gott auf ganz neue Weise begegnen kannst“, sagte Nancy. Sie holte einen Schlüssel aus ihrer Tasche. Nancy und Doug hatten Hannah großzügigerweise für die neun Monate ihr Ferienhaus am Lake Michigan zur Verfügung gestellt. Hannah war bisher noch nicht dort gewesen, doch sie hatte Fotos gesehen. Es sah traumhaft schön aus.
„Dieser Schlüssel ist für die Haustür“, fuhr Nancy fort. „Sie klemmt ein wenig, du musst vermutlich ein bisschen rumprobieren. Und hier ist die Wegbeschreibung. Mal sehen, gibt es sonst noch was? Ach ja – kauf immer genug Wasser in Flaschen ein. Das Wasser aus dem Brunnen schmeckt nicht. Ich habe einen Ordner mit Hinweisen auf den Küchentisch gelegt, und wenn du sonst noch Fragen hast, ruf uns einfach an.“
„Danke, Nancy. Danke für eure unglaubliche Großzügigkeit.“ Hannah seufzte und strich sich ihre widerspenstigen Haare erneut hinter die Ohren. „Irgendwas muss mit mir nicht stimmen. Wer könnte denn etwas gegen neun Monate bezahlten Urlaub einzuwenden haben? Ich bin vermutlich verrückt.“
Nancy legte den Arm um Hannahs Schultern. „Du bist nicht verrückt, nur getrieben. Freude an der Arbeit zu haben ist eine gute Sache. Das ist eines der Dinge, die wir an dir so lieben! Aber Steve hat recht: Du trägst die Last der ganzen Welt auf deinen Schultern. Du musst unbedingt mal zu dir kommen.“ Nancy drückte ihr einen Kuss auf die gerunzelte Stirn. „Außerdem ist es eine besondere Gnade, wenn Gott uns vom Gebenden zum Empfangenden macht. Das zumindest hast du mir nach meiner Operation gesagt.“
Hannah lachte reumütig. „Ich hasse es, wenn meine klugen Sprüche gegen mich verwandt werden!“
Als Hannah im Haus der Johnsons am Lake Michigan eintraf, ging gerade die Sonne über dem See unter. Ein wundervoller Anblick. Sie machte es sich in einem verwitterten grauen Gartenstuhl auf der Veranda gemütlich, ließ ihren Blick über den schimmernden See gleiten und atmete tief durch.
Die schlichte Schönheit des schwindenden Tageslichts rührte sie an. Etwas, das sie erst noch begreifen oder in Worte fassen musste, versank auch am Horizont ihres Lebens, und sie hatte keine Vorstellung davon, was an seiner Stelle wieder aufgehen würde. Hilf mir, Herr, betete sie, während sie zusah, wie sich die feurigen Bänder am Himmel entrollten.
Die letzten Farbkleckse verblassten bereits, als Hannah über die Schwelle ihres vorübergehenden Heims trat. Der etwas modrige Geruch des selten bewohnten Hauses ließ eine Erinnerung in ihr lebendig werden. Sie war wieder acht Jahre alt und hüpfte durch das Ferienhaus an der kalifornischen Küste, das ihre Eltern für eine Woche gemietet hatten.
„Papa, sieh nur!“, quietschte sie, während sie ihr Reich überblickte. „Stockbetten! Ich wollte schon immer mal in einem Stockbett schlafen!“
Jetzt schlenderte sie langsam durch die Räume und überlegte, wo sie sich niederlassen sollte. Nancys ausgeprägter, eleganter Geschmack war überall zu erkennen. Dieses Haus gehörte nicht zu den Ferienhäusern, die mit Möbeln aus Second-Hand-Läden und ausrangierten Sachen vollgestopft waren. Dies war ein Haus, in dem Hannah sich nicht traute, die Füße auf den Tisch zu legen. Auf der anderen Seite hatte Nancy ihr genau das nahegelegt.
Seufzend entfernte Hannah die Folie von einem großen Geschenkkorb, prall gefüllt mit Keksen, Schokolade, selbst gemachter Erdbeermarmelade und einem Dutzend unterschiedlicher Teesorten.
Tee. Genau das brauchte sie jetzt. Eine Tasse Tee würde sie beruhigen und ihr helfen, hier anzukommen. Und dann könnte sie anfangen, ihre Bücher in die Regale einzuräumen, die Nancy für sie frei gemacht hatte.
Sie wählte Chai mit Vanillegeschmack, füllte den Wasserkocher und las die Notiz auf der Küchentheke: „Das ist jetzt dein Zuhause, Hannah. Ruh dich aus, spiele und freu dich!“
Ausruhen, spielen, freuen.
Dies waren Worte, die Hannah niemals verwendete. Zumindest nicht in Bezug auf sich. Ihre Freude war ihre Arbeit. Ihre Freude war es, nützlich und produktiv zu sein. Noch immer sah sie die Praktikantin vor sich stehen, fröhlich mit den Schlüsseln zu ihrem Leben klimpernd.
Wie hatte Steve ihr das antun können?
Während sie darauf wartete, dass das Wasser kochte, blätterte sie gedankenverloren durch den Stapel mit Reise- und Veranstaltungsbroschüren für die Region. Ein pflaumenblauer Flyer erregte ihre Aufmerksamkeit. Vom New Hope-Einkehrzentrum in Kingsbury hatte sie doch schon mal gehört … dann fiel ihr ein, dass Nancy ihr davon erzählt hatte. Sie hatte im Sommer dort einen Kurs besucht. Auf dem Flyer stand: Eine Einladung zu einer geistlichen Reise. „Jesus sagt: ‚Bist du müde? Erschöpft? Unsicher in Bezug auf deinen Glauben? Komm zu mir. Mach dich mit mir auf den Weg, und du wirst dein Leben zurückgewinnen. Ich will dir zeigen, wie du zur Ruhe kommen kannst. Komm mit mir und arbeite mit mir – beobachte, wie ich das tue. Lerne den ungezwungenen Rhythmus der Gnade kennen. Ich werde dir nichts auferlegen, was du nicht tragen kannst. Bleib bei mir, und du wirst lernen, frei und leicht zu leben‘ (Matthäus 11,28-30). Kommen Sie mit auf eine geistliche Reise …“
Hannah lachte tonlos. Diese etwas umformulierten Worte aus der Bibel sprachen sie an, hauchten den ihr so vertrauten Versen neues Leben ein. Müde? Erschöpft? Unsicher? Steve hatte die Antwort für sie bereits gegeben: Ja, ja, ja. Und Jesus lud die erschöpften Menschen ein: Kommt. Macht euch auf den Weg. Kommt mit mir. Arbeitet mit mir. Seht zu. Lernt. Bleibt bei mir. Lebt frei und leicht.
Kommen Sie mit auf eine geistliche Reise.
Mit ihrer Teetasse in der Hand ließ sich Hannah auf der Couch nieder. Doch während sie versuchte, ihre Gedanken zu ordnen, wurde ihr klar, dass es nicht nur der Stress des Packens oder die dreistündige Fahrt von Chicago hierher war, die sie erschöpft hatte. Sie war müde. Zutiefst müde. Müde von 15 Jahren pausenlosen Dienstes.
Noch bevor sie ihren Tee ausgetrunken hatte, war Hannah eingeschlafen.
Charissa
Der Mathematiklehrer gab seiner 8. Klasse die Klassenarbeiten immer nach demselben Schema zurück: Die besten Noten kamen zuerst. An dem Tag, an dem Charissa Goodman nicht als Erste ihre Arbeit zurückbekam, hielt die ganze Klasse verblüfft den Atem an. Langsam reichte er Charissa das Arbeitsblatt. „Für alles gibt es ein erstes Mal, nicht? Dieses Mal war es nicht ganz so perfekt.“
Charissa versteifte sich. Unter den auf sie gerichteten Blicken ihrer Klassenkameraden überflog sie ihre Arbeit. Da war er, ein lächerlicher Fehler, der ihr bei der doppelten und dreifachen Durchsicht nicht aufgefallen war. Wie hatte sie das nur übersehen können? Sie nahm das beleidigende Blatt und stopfte es in ihren Ordner, sodass sie es nicht mehr vor Augen hatte.
Beim nächsten Mal würde sie noch besser aufpassen.
Um kurz vor 20:00 Uhr parkte John Sinclair den Wagen vor der Bibliothek der Universität in Kingsbury. Charissas Abendseminar war gerade zu Ende gegangen. Die vergangenen zwei Stunden hatte er in ihrer gemeinsamen Wohnung das Lieblingsessen seiner Frau vorbereitet: Zitronenhühnchen und Tomatensalat mit Fetakäse. Beim Bäcker hatte er sogar noch ein frisches Focaccia gekauft. Der Mittwoch war ein langer Tag für Charissa, darum versuchte John an diesem Tag immer etwas Besonderes für sie zu kochen.
Während er sie beobachtete, wie sie auf den Wagen zukam, ließ er pfeifend die Luft entweichen. Selbst auf die Distanz war Charissa eine Schönheit: Ihre makellose olivfarbene Haut, ihre wohlgeformte Figur, ihre seidenweichen, pechschwarzen Haare – alles an Charissa war perfekt. Die Leute waren oft erstaunt, dass Charissa und John zusammengehörten. Mit seinem schütteren braunen Haar und den braunen Augen war er absolut unauffällig. Mittelgroß, mittelgewichtig, einfach totaler Durchschnitt. Charissa dagegen war eine Frau, nach der sich alle umdrehten. Es war nicht nur ihre klassische Schönheit, die Aufsehen erregte, sondern auch ihre Anmut und ihr Selbstvertrauen.
Als John Charissa in ihrem zweiten Studienjahr an der Kingsbury kennengelernt hatte, hatten seine Freunde ihn gewarnt: „Die Eisprinzessin lässt niemanden an sich heran. Du hast keine Chance, John.“
Doch John war kein Typ, der so leicht aufgab. Er hatte zwar keinen athletischen Körperbau, doch besaß er das Herz und die Entschlossenheit eines Olympioniken. Er war fest entschlossen, Charissa Goodman zum Lachen zu bringen, und irgendwann brachte Johns warmherziger Humor tatsächlich selbst die berüchtigte Eisprinzessin zum Schmelzen.
Grinsend rief er durch das geöffnete Wagenfenster: „Hey, Schönheit! Brauchst du eine Mitfahrgelegenheit?“ Charissa warf ihre Tasche auf den Rücksitz und glitt neben ihn auf den Beifahrersitz. „Wie wäre es mit einem Kuss für den Kerl, der dich liebt?“, fragte er und beugte sich zu ihr herüber.
Sie gab ihm einen Kuss auf die Wange. „Entschuldige. Abgelenkt.“
„Das merke ich. Was ist los?“
„Erinnerst du dich noch an diesen Kurs, von dem ich erzählt habe? Den mit der geistlichen Reise?“
John nickte, während er nach links abbog. „Ja. Was hat Dr. Allen dazu gesagt? Ist es ungefährlich?“
Sie lachte. „Er meinte, ich sei doch bereits von Häretikern umgeben.“
„Cool! Ich würde gern mal ein paar kennenlernen! Wir könnten sie zum Essen einladen, nachdem wir nun endlich stolze Besitzer eines Tisches sind. Ich würde sogar kochen.“
„Du kochst doch immer.“
„Nun, wir müssen ja schließlich was essen. Hey! Autsch!“ Er grinste, als Charissa ihm spielerisch gegen den Arm boxte. „Es ist eben so, dass du andere Talente hast, Liebling. Große, intellektuelle Talente, zu schade für die Küche.“ Sie gab vor zu schmollen.
„Also“, fuhr er fort, „lohnt es sich, dafür an zwei Samstagen im Monat einen Vormittag zu opfern? Und bevor du antwortest, denk daran, dass dieser Kurs in Konkurrenz steht zu meinen berühmten Schokoladenchips-Pfannkuchen.“
„Ich weiß. Ich wäge die Kosten ab.“ Sie spielte mit ihren langen dunklen Haaren. „Auf jeden Fall hat Dr. Allen mich gefragt, warum ich daran teilnehmen möchte. Ich habe gesagt: ‚Um zu lernen.‘ Und er starrte mich mit seinen eindringlichen Augen an und sagte: ‚Falsche Antwort.‘“
„Meine Frau? Eine falsche Antwort? Unmöglich. Gib mir seine Telefonnummer.“
„John!“
„Entschuldige, Riss. Erzähl weiter. Ich höre zu. Wirklich.“
Sie seufzte. „Er meinte, wenn meine Motivation für den Besuch dieses Kurses nicht die sei, Gott zu begegnen, dann wäre es vertane Zeit. Seine Bemerkung lässt mich nicht los. Schließlich hat er uns doch geraten, sein Seminar durch etwas zu ergänzen, was unsere eigene Beziehung zu Gott vertieft. Und wenn das Ziel dieses Unterfangens nicht ist, etwas zu lernen, dann verstehe ich es nicht. Ich verstehe es einfach nicht.“
John hatte im ersten Jahr ihrer Ehe begonnen, die Rezepte seiner griechischen Schwiegermutter nachzukochen, und er wurde immer besser darin.
„Also, was hältst du von meinem Zitronenhühnchen?“, fragte er und blickte Charissa durch das warme Kerzenlicht an.
„Mama wäre beeindruckt. Es war ganz hervorragend, John. Vielen Dank.“ Während er den Tisch abräumte, holte sie ihren Laptop und einige Bücher. Sie nahm wieder am Tisch Platz und vertiefte sich in ihre Arbeit.
„Kann ich dir noch etwas Gutes tun?“, fragte er, während er das Geschirr in die Spülmaschine räumte. Sie war so konzentriert, dass sie ihn gar nicht hörte.
Er kam aus der Küche, stellte sich hinter sie und schlang die Arme um sie. „Brauchst du etwas?“, fragte er und küsste ihren Nacken. Sie schüttelte den Kopf und tippte weiter, während er ihre Schultern massierte. „Du bist verspannt“, bemerkte er und drückte seine Finger fester in ihre glatte Haut. „Ich habe ein Heilmittel dagegen, falls du interessiert bist.“ Tief atmete er den Duft ihrer Haare ein.
Sie antwortete, ohne ihn anzusehen: „Ich hab so viel zu tun. Vermutlich muss ich die ganze Nacht durcharbeiten, um diesen Aufsatz morgen früh fertig zu haben.“
Sanft ließ er sie los. „Ich weiß“, sagte John. „Das harte Los einer Doktorandin.“ Er drückte ihr einen Kuss auf den Scheitel, bevor er die Kerzen ausblies.
Als Charissa um 4:00 Uhr morgens ihr Essay über Shakespeare fertig hatte, war sie viel zu aufgedreht, um Schlaf finden zu können. Da es noch zu dunkel für ihre morgendliche Walking-Runde war, begann sie zu putzen. Putzen war ihre liebste Form des Stressabbaus. Das kam der Wohnung häufig zugute.
Ihren empfindlichen Nachbarn hatte sie versprochen, den Staubsauger nicht zu früh morgens oder zu spät abends anzuschalten. Nicht dass es viel zu staubsaugen gäbe: Sie hatten nur ein kleines Wohnzimmer und einen Essbereich neben der Küche, ein Schlafzimmer und einen schmalen Flur. Aber Charissa fand das Staubsaugen in einem präzisen Sägezahnmuster unglaublich beruhigend. Manchmal saugte sie zweimal am Tag.
Da es noch zu früh war, nahm sie sich die Speisekammer vor. Ordnung in den Regalen stand bei John nicht ganz oben auf der Prioritätenliste, und da er für das Kochen zuständig war, herrschte in der Vorratskammer meist ein heilloses Chaos. Wenigstens einmal pro Woche räumte sie alles so auf, wie sie es gut fand: die Dosen und Kartons nach Größe geordnet, die Gewürze in alphabetischer Reihenfolge, Soßen nach Farben sortiert. „Für alles einen Platz und alles an seinem Platz.“ Das war Charissas Lebensregel. Wenn sie nicht Dozentin für Literatur hätte werden wollen, dann hätte sie sich vermutlich auch als persönlicher Organisations-Coach ganz gut gemacht.
Während sie Ketchupflaschen und Barbecuesoßen sortierte, ging ihr immer wieder Dr. Allens Aussage durch den Sinn. Falsche Antwort. Falsche Antwort. Falsche Antwort. Warum war „lernen“ die falsche Antwort?
Charissa hasste es, korrigiert zu werden. Gewöhnlich gelang es ihr, sich selbst zu korrigieren, bevor ein anderer die Gelegenheit dazu hatte. Und jetzt hatte Dr. Allen, dessen Meinung für sie persönlich und für ihren akademischen Erfolg so wichtig war, statt des sonst üblichen Lobes einen geheimnisvollen Tadel geäußert. Sie hatte wirklich keine Ahnung, was er meinte. Aber sie würde ihn nicht um eine Erklärung bitten. Charissa zeigte nur selten, dass sie etwas nicht verstanden hatte, indem sie nachfragte. Sie würde an diesem Samstagskurs teilnehmen und damit Dr. Allens Empfehlung folgen.
Nachdem die Speisekammer aufgeräumt war, pflückte sie einen Fussel vom Teppich und überlegte, was vor ihrer Stillen Zeit, die sie streng jeden Morgen einhielt, noch zu tun wäre.
Mara
Mara Garrison nahm den Pfefferminztee von Dawn entgegen und ließ ihren umfangreichen Körper in den ihr vertrauten Sessel sinken. Über welchen wunden Punkt sollte sie heute reden? Jeden Monat saß sie in Dawns Praxis und sprach über dieselben Themen: Vertrauen. Scham. Zurückweisung. Selbstwert.
Sie bewegte sich im Kreis.
„Ich habe das Gefühl festzustecken“, sagte Mara und schüttelte den Kopf. „Ich sitze vollkommen fest. Ich begreife zwar, wie ich hier gelandet bin, aber ich habe keine Ahnung, wie ich da wieder rauskomme. Fünfzig Jahre alt bin ich jetzt, und ich muss mich ernsthaft fragen, ob ich je weiterkommen werde.“
„Sie haben doch schon große Fortschritte gemacht, Mara. Wirklich.“
Dawn machte ihr immer Mut. Mara wünschte, sie hätte eine Freundin wie Dawn – einen Menschen, mit dem sie eine Tasse Tee trinken könnte, ohne ihn am Ende des Besuchs bezahlen zu müssen.
„Sie haben die Mühe auf sich genommen, sich mit den Ursachen Ihrer Probleme auseinanderzusetzen“, sagte Dawn gerade. „Aber die besten Analysen und Erkenntnisse führen noch lange nicht zur Heilung. Man kann nicht alles mit dem Verstand erfassen oder lösen. Ich denke, Sie müssten einen Weg finden, um Gott auf eine ganz neue Weise zu begegnen und sich von ihm helfen zu lassen.“
Mara strich mit ihrem Zeigefinger über den Rand ihres Bechers.
„Eigentlich bin ich ganz froh, dass Sie so frustriert sind“, meinte Dawn.
Mara hielt inne. „Wie bitte?“
So etwas sagte Dawn normalerweise nicht. Normalerweise versuchte sie sie davon zu überzeugen, dass ihre vermeintlichen Kreise eigentlich aufsteigende Spiralen waren, die einen Berg erklommen, nicht unendliche Kreise, die ins Nichts führten. Normalerweise versuchte Dawn ihr begreiflich zu machen, dass die Tatsache, dass sie immer wieder auf dasselbe Problem stieß, nicht zwangsläufig bedeutete, dass sie Rückschritte machte. Ihre Perspektive hatte sich nur verändert. Sie stand ein Stück weiter bergauf und blickte darauf hinunter.
„Sie haben den Zustand einer heiligen Unzufriedenheit erreicht“, erklärte Dawn. „Die Frustration, die Sie empfinden, kann ein Geschenk sein und ein Anstoß für Sie, mehr in die Tiefe zu gehen. Ich spüre eine gewisse Ruhelosigkeit bei Ihnen, und Ruhelosigkeit bedeutet Bewegung. Sie mögen das Gefühl haben festzustecken, aber Ihr Geist ist in Bewegung.“
„Aber ich bin innerlich total aufgewühlt. Ich dachte, der Glaube sollte Frieden und Freude bringen, aber ich empfinde das nicht. Bestimmt mache ich irgendwas falsch.“
Dawn beugte sich vor. „Unruhe ist auch ein Geschenk Gottes an uns, Mara, so seltsam das vielleicht klingen mag. Stellen Sie sich vor, Sie würden in einer Tür stehen, auf der Türschwelle. Ihre Unzufriedenheit kann Sie dazu bewegen, aus dem Alten herauszutreten, in etwas Neues hinein. Wenn Sie selbst am Ende sind und sagen: ‚Ich habe es satt, so zu leben. Ich will mehr!‘, dann ist Gott da und hilft Ihnen, loszulassen und weiterzugehen. Wie klingt das?“
Mara dachte über diese Bemerkung nach. „Ich wünsche mir einfach nur Frieden“, sagte sie schließlich, während sie an dem kaute, was von ihrem Fingernagel noch übrig war.
„Was ist Frieden?“, fragte Dawn.
Ich weiß, ich weiß. Dieses Gespräch hatten sie schon oft geführt. Dawn würde sie gleich daran erinnern, dass Frieden nicht das Nichtvorhandensein von Konflikten bedeutete, sondern das Wissen um die Gegenwart Gottes inmitten des Sturms, dass Frieden nicht abhängig sei von ihren Lebensumständen, dass es beim wahren Frieden um Ganzheitlichkeit ginge und um das Einssein mit Gott. Frieden sei ein Geschenk, die Frucht einer innigen Beziehung zu Jesus. Und so weiter.
Obwohl Mara durchaus begriff, was Frieden war, hatte sie ihn doch nie selbst erlebt. „Ich bin müde“, flüsterte sie. „Ich bin des ständigen Kämpfens müde. Ich sehne mich nach einer Atempause.“
Dawn schwieg lange Zeit, und Mara fragte sich, was sie wohl dachte. Vielleicht hatte auch Dawn sie schließlich aufgegeben. Vielleicht war sie ein hoffnungsloser Fall. Sie starrte auf ihre Schuhe und wappnete sich innerlich für das Urteil.
Dawn erhob sich, ging zu ihrem Schreibtisch und suchte einen pflaumenblauen Flyer heraus. „Ich habe Ihnen ja schon vom New Hope-Zentrum erzählt“, sagte sie und reichte Mara den Flyer. „Jetzt wird dort ein Kurs angeboten, den ich Ihnen sehr empfehlen kann, eine so genannte ‚geistliche Reise‘. In diesem Kurs geht es darum, ganz unterschiedliche Übungen kennenzulernen, die Ihnen helfen, Gott zu begegnen. In einer solchen Gruppe würden Sie auch andere Menschen treffen, die auf demselben geistlichen Weg unterwegs sind. Ich denke, das wäre eine gute Sache für Sie.“
Mara überflog die Beschreibung und suchte nach einem Grund, sich gegen den Kurs zu entscheiden.
„Die geistliche Reise ist eine Pilgerreise für Menschen, die Gott näherkommen wollen. Diese Reise ist für alle gedacht, die unzufrieden sind mit einem Leben an der Oberfläche und die das Herz Gottes besser kennenlernen wollen. Wir möchten Sie mit vielfach erprobten geistlichen Übungen bekannt machen, die dem Zweck dienen, einen heiligen Raum zu schaffen für Gott.“
Mara brach ab. Da. Sie hatte es gefunden. „Das klingt … anstrengend“, wandte sie ein. „Ich fühle mich jetzt schon schuldig, obwohl ich noch nicht mal hingegangen bin.“
„Ich weiß“, erwiderte Dawn. „Aber bei geistlichen Übungen geht es nicht um anstrengende Tätigkeiten oder Regeln oder Gebote, die befolgt werden müssen. Sie sind das Handwerkszeug, das uns hilft, einen Raum in unserem Leben zu schaffen, um Gott zu begegnen. Aus uns selbst heraus können wir uns nicht verändern. Das ist Gottes Werk, seine Gnade. Und die geistlichen Übungen helfen uns, uns für das Wirken Gottes zu öffnen.“
Mara zeigte ihre Skepsis durch ein Stirnrunzeln.
„Sehen Sie es doch einmal so, Mara: Wir haben nicht die Macht, die Sonne aufgehen zu lassen, aber wir können uns entscheiden, aufzuwachen, wenn dies geschieht. Geistliche Übungen helfen uns dabei, innerlich wach zu werden für Gott.“
Mara beschäftigte sich weiter mit dem Flyer, suchte nach anderen Gründen, Nein zu sagen. Im Laufe der Jahre hatte sie viele geistliche Bücher gelesen und Bibelstudienhefte durchgearbeitet. So etwas brauchte sie nicht mehr, aber ob sie bereit war, sich mit anderen Menschen über ihr geistliches Leben auszutauschen, das wagte sie zu bezweifeln. „Ich weiß nicht so recht. Es stört mich, dass es eine Gruppe ist“, gestand sie.
„Warum?“
„Wenn ich solche Dinge allein mache, kann mich wenigstens niemand ablehnen.“ So. Sie hatte es ausgesprochen.
„Sehen Sie doch mal, wie weit Sie bereits gekommen sind“, erwiderte Dawn sanft. „Sie haben mir gegenüber vieles enthüllt, über das Sie vorher nie reden konnten, und ich habe Sie nie abgelehnt.“
Mara lächelte schwach. „Ich bezahle Sie ja auch dafür, dass Sie mich nicht ablehnen.“ Sie suchte in ihrer Tasche nach einem Taschentuch.
„Mara, ich würde diese Gruppe nicht empfehlen, wenn ich nicht glauben würde, dass sie bereit für den nächsten Schritt sind. Ich verspreche Ihnen, Sie brauchen nur das von sich preiszugeben, was Sie möchten. Aber sie würden den Weg mit anderen zusammen gehen. Es ist nicht gut für Sie, allein zu sein, Mara. Und Sie sind fast Ihr ganzes Leben lang allein gewesen, selbst in der Gegenwart von anderen.“
Das stimmte. Mara umgab sich mit Menschen, die sie gar nicht wirklich kannte und auch niemals an sich heranlassen würde: Oberflächliche Bekannte, mit denen sie gemeinsame Interessen hatte; Menschen, die sie bei den außerschulischen Aktivitäten der Jungen kennenlernte, sogar Freunde in der Kirche. Mara hatte eine Person erschaffen, die in diesem Umfeld relativ gut funktionierte. Doch tief in ihrem Inneren war sie immer noch ein kleines Mädchen, das schreckliche Angst davor hatte, von anderen abgelehnt zu werden, wenn sie erkannten, wer sie tatsächlich war.
Als sie Dawns Praxis verließ, wusste sie nicht, was sie tun sollte. Sicher, sie war gefangen in ihren Ängsten, aber diese Gefangenschaft war ihr wenigstens vertraut. Was würde sie wohl entdecken, wenn sie durch die Tür ins Unbekannte trat? War ihre innere Unzufriedenheit so groß, dass sie das wagte? Mehr noch, vertraute sie Gott tatsächlich genug, dass sie die Vergangenheit loslassen und auf etwas Neues zugehen würde?
Sie wusste es nicht. Sie wusste es ehrlich nicht.
Am Donnerstagabend wartete Mara, bis die Jungen in ihren Zimmern verschwunden waren, bevor sie Tom von Dawns Vorschlag erzählte. Er war früh von seiner Geschäftsreise nach Hause gekommen und schien relativ guter Laune zu sein.
„Dawn hat mir einen Kurs im New Hope-Einkehrzentrum empfohlen“, erwähnte sie beiläufig, während sie die Reste des Kartoffelpürees in einen Plastikbehälter löffelte.
Er blickte nicht von seiner Sportzeitschrift hoch. Sie stellte die Reste in den Kühlschrank und versuchte es noch einmal. „Ich war diese Woche bei Dawn, und sie hat mir den Kurs wärmstens ans Herz gelegt. Sie meinte, er würde mir weiterhelfen.“