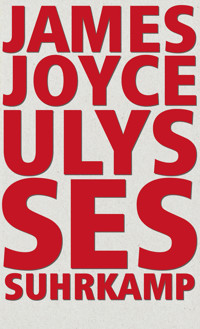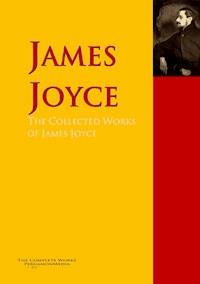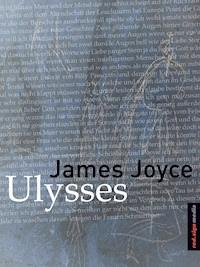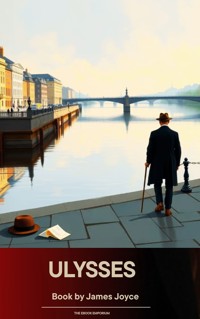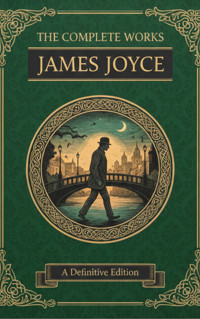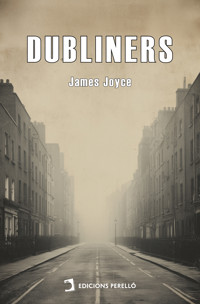Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: red.sign Medien
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit „Ulysses“ wurde James Joyce berühmt, die in „Dubliner“ versammelten 15 Kurzgeschichten sind das erste Prosawerk des irischen Jahrhundertliteraten. Sie bilden einen Fundus, aus dessen Themen und Figuren sich Joyce für spätere Arbeiten immer wieder bediente. Schon deshalb fällt ihnen für das Verständnis des Joyce’schen Gesamtwerks eine besondere Bedeutung zu – der Zyklus gilt als bester Zugang dazu. T.S. Eliot urteilte: „Zuallererst lese man ‘Dubliner’. Das ist die einzige Möglichkeit, das Werk eines der größten Schriftsteller zu verstehen, nicht nur unserer Zeit, sondern aller europäischen Literatur.“ Sämtliche Geschichten spielen in Joyce’ Heimatstadt Dublin. Sie alle bieten mit suggestiver Kraft Einblicke in die in Dublin zu Beginn des 20. Jahrhunderts herrschende lähmende Beengtheit und Erstarrung. Die Sehnsucht nach dem Ausbruch daraus gesteht Joyce seinen in unterschiedlichsten Milieus – der bürgerlichen Mittelschicht, politischen Clubs, der Zuhälterszene usw. – heimischen Figuren zu. Doch verwehrt er ihnen das Gelingen – sie müssen in ihrer aussichtslosen Lage verharren. So zeichnet Joyce das Bild einer ebenso spannungsgeladenen wie paralysierten Stadt. Ins Deutsche übertragen von Georg Goyert, der – in Abstimmung mit James Joyce – auch die erste Übersetzung des „Ulysses“ ins Deutsche besorgte. Für diese E-Book-Ausgabe der „Dubliner“ wurde der zuletzt 1968 im Suhrkamp-Verlag, Frankfurt, erschienene Text behutsam modernisiert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
Coverfotos: Eugen Shevchenko, littleny
James Joyce
»Dubliner«
15 Erzählungen
Aus dem Englischen übersetzt von Georg Goyert. In dieser Übersetzung erschien »Dubliner« in zahlreichen, vom Übersetzer selbst immer wieder intensiv bearbeiteten Ausgaben, zuletzt 1968 im Suhrkamp-Verlag, Frankfurt am Main. Für diese E-Book-Ausgabe wurde der Text neu gesetzt und gemäß den Regeln der neuen deutschen Rechtschreibung behutsam modernisiert.
Mit einem Nachwort von Adolf Schulte aus dem »Jahrbuch für Orts- und Heimatkunde in der Grafschaft Mark«,
(heute: »Märkisches Jahrbuch für Geschichte«) Jg. 88, 1990, S. 85-96
ISBN 978-3-944561-61-5
Dieses Werk ist einschließlich aller seiner Teile urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen
© Alle Rechte an der Übertragung ins Deutsche bei dem Erben des Nachlasses von Georg Goyert
© für das Nachwort: Verein für Orts- und Heimatkunde in der Grafschaft Mark
© Deutsche E-Book-Ausgabe 2017 red.sign medien GbR, Stuttgart
www.redsign-media.de
DIE SCHWESTERN
Diesmal gab‘s für ihn keine Hoffnung mehr: Es war der dritte Anfall. Jeden Abend war ich am Haus vorbeigegangen — (es war Ferienzeit) — und hatte das erhellte Fensterviereck beobachtet; und jeden Abend war es in der gleichen Weise erhellt gewesen, schwach und gleichmäßig. Wenn er tot wäre, so dachte ich, würde ich Kerzenschein auf dem dunklen Vorhang sehen, denn ich wusste, dass man zu Häupten einer Leiche zwei Kerzen aufstellen muss. Oft hatte er zu mir gesagt: Lange mache ich‘s nicht mehr mit, und ich hatte geglaubt, seine Worte seien leeres Gerede. Jetzt aber wusste ich, dass sie wahr waren. Jeden Abend, wenn ich zum Fenster hinaufblickte, sagte ich leise das Wort Paralyse vor mich hin. Es hatte immer so seltsam in meinen Ohren geklungen, genauso wie das Wort Gnomon bei Euklid und das Wort Simonie im Katechismus. Jetzt aber klang es mir wie der Name eines boshaften teuflischen Wesens. Es füllte mich mit Furcht und doch trieb es mich, ihm näher zu sein, sein tödliches Werk zu sehen.
Als ich zum Abendessen nach unten kam, saß der alte Cotter am Fenster und rauchte. Während meine Tante meinen Haferbrei auf den Teller füllte, sagte er, als käme er auf eine vorher gemachte Bemerkung zurück: »Nein, ich will nicht gerade behaupten, dass er … aber etwas stimmte da nicht … hatte sowas Unheimliches.«
Er begann an seiner Pfeife zu saugen und legte sich im Geiste zweifellos seine Meinung zurecht. Langweiliger, alter Narr! Als wir ihn kennenlernten, war er meist ziemlich interessant, redete von Ohnmachten und Würmern; aber ich bekam ihn und seine endlosen Geschichten über Destillation bald leid.
»Ich habe darüber so meine eigene Theorie«, sagte er. »Ich meine, es war einer von diesen … besonderen Fällen … Ja, das ist nicht so leicht zu sagen …«
Wieder sog er an seiner Pfeife, ohne uns aber seine Theorie wissen zu lassen. Mein Onkel sah, wie ich ihn anstarrte, und sagte zu mir:
»Ja, nun ist dein alter Freund nicht mehr; das tut dir sicher sehr leid.«
»Wer?« sagte ich.
»Pater Flynn.«
»Ist er tot?«
»Mr Cotter hat es uns eben erzählt. Er ist am Haus vorbeigegangen.«
Ich wusste, dass man mich beobachtete, und so aß ich denn ruhig weiter, als hätte mich die Nachricht gar nicht interessiert. Mein Onkel sagte zu dem alten Cotter:
»Der Junge und er waren nämlich große Freunde. Der Alte hat ihm allerlei beigebracht; er soll ihn sehr gern gehabt haben.«
»Gott sei seiner Seele gnädig«, sagte fromm meine Tante.
Der alte Cotter sah mich kurze Zeit an. Ich fühlte, dass seine kleinen, schwarzen, runden Augen mich prüfend musterten; aber ich wollte ihm den Gefallen nicht tun, von meinem Teller aufzusehen. Er beschäftigte sich wieder mit seiner Pfeife und spuckte dann frech ins Feuer.
»Ich litte es nicht«, sagte er, »dass meine Kinder zu viel mit so einem zusammen wären.«
»Wie meinen Sie das, Mr Cotter?«fragte meine Tante.
»Nun, ich meine«, entgegnete der alte Cotter, »dass das nichts für Kinder ist. Meine Ansicht ist folgende: Ein Junge soll rumlaufen und mit gleichaltrigen Jungs spielen und nicht … habe ich nicht recht, Jack?«
»Das ist auch mein Grundsatz«, sagte mein Onkel. »Boxen soll er lernen. Das predige ich diesem Rosenkreuzer hier schon lange: soll turnen. Ja, als ich so’n Junge war, wurde jeden Morgen, ob Sommer oder Winter, kalt gebadet. Und deshalb bin ich jetzt auch so gesund. Bildung ist ja ganz schön und gut … Vielleicht nimmt Mr Cotter ein Stück von der Hammelkeule«, sagte er dann zu meiner Tante.
»Nein, nein, nur keine Umstände«, sagte der alte Cotter.
Meine Tante nahm die Schüssel aus dem Büffet und stellte sie auf den Tisch.
»Aber warum scheint Ihnen, Mr Cotter, das nicht gut für Kinder?« fragte sie.
»Es ist für Kinder schädlich«, sagte der alte Cotter, »weil ihr Geist so empfänglich ist. Wenn Kinder so was sehen, verstehen Sie, dann wirkt das …«
Ich stopfte mir Haferbrei in den Mund, weil ich sonst vor Wut losgeplatzt wäre. Alter, langweiliger, rotnasiger Schafskopf!
Es war spät, als ich einschlief. Wenn ich auch auf den alten Cotter wütend war, dass er mich als Kind behandelte, zermarterte ich mir den Kopf, den Sinn seiner unvollendeten Sätze zu ergründen. In der Dunkelheit meines Zimmers glaubte ich, das schwere, graue Gesicht des Gelähmten wiederzusehen. Ich zog mir die Decke über den Kopf und versuchte an Weihnachten zu denken. Aber das graue Gesicht ließ mich nicht los. Es sprach ganz leise; und ich begriff, dass es etwas beichten wollte. Ich fühlte, wie meine Seele zurückwich an einen Ort der Lust und des Lasters, aber auch hier wartete es wieder auf mich. Mit leiser Stimme fing es an, mir zu beichten, und ich wunderte mich, warum es immer lächelte und warum die Lippen so speichelfeucht waren. Aber dann fiel mir ein, dass es an Paralyse gestorben war, und ich fühlte, dass auch ich leicht lächelte, als wollte ich den Simonisten von seiner Sünde lösen.
Am nächsten Morgen ging ich gleich nach dem Frühstück hinaus und beobachtete das kleine Haus in der Great Britain Street. Ein anspruchsloser Laden mit dem alles und nichts besagenden Schild: Weißwaren. Die Weißwaren bestanden hauptsächlich aus wollenen Kinderschuhen und Regenschirmen; sonst hing immer ein Schild im Fenster, auf dem stand: Regenschirme neu überzogen. Jetzt aber war von einem Schild nichts zu sehen, denn die Fensterläden waren zu. Mit Bändern war am Türklopfer ein Trauerbouquet befestigt. Zwei arme Frauen und ein Telegrammbote lasen die Karte, die mit einer Nadel an den Flor gesteckt war. Ich trat auch näher und las:
1. Juli 1895.
Ehrwürden James Flynn (früher tätig an der St.-Kathrinen-Kirche, Meath Street), im Alter von 65 Jahren.
R. I. P.
Als ich die Karte gelesen hatte, war ich überzeugt, dass er tot war, und diese Tatsache verwirrte mich. Wäre er nicht tot gewesen, wäre ich in das kleine, dunkle Zimmer hinter dem Laden gegangen und hätte ihn dort, fest in den dicken Mantel gehüllt, im Lehnstuhl neben dem Feuer sitzend gefunden. Vielleicht hätte mir meine Tante ein Paket High Toast für ihn mitgegeben, und dieses Geschenk hätte ihn vielleicht aus seinem blöden Dösen geweckt. Ich leerte immer das Paket in seine schwarze Schnupftabakdose, denn seine Hände zitterten zu sehr, als dass er dies hätte tun können, ohne die Hälfte des Schnupftabaks zu verschütten. Immer wenn er seine große, zitternde Hand an die Nase hob, rieselten kleine Staubwolken durch seine Finger herab auf die Vorderseite seines Mantels. Vielleicht kam die blassgrüne Farbe seiner alten Priesterkleider von diesem dauernden Schnupftabakregen, denn das rote, von den Schnupftabakflecken einer Woche immer schwarze Taschentuch, mit dem er die heruntergefallenen Krümelchen wegzuwischen versuchte, war ganz wirkungslos.
Gern wäre ich hineingegangen, ihn zu sehen, aber ich hatte nicht den Mut zu klopfen. Langsam ging ich auf der Sonnenseite der Straße weiter und las im Vorübergehen alle Theaterzettel in den Ladenfenstern. Ich fand es seltsam, dass weder ich noch der Tag traurig zu sein schien, und ich ärgerte mich sogar, als ich in mir so etwas wie ein Gefühl der Freiheit entdeckte, als wäre ich durch seinen Tod von etwas befreit worden. Das erstaunte mich sehr, denn er hatte mir doch, wie mein Onkel am Abend vorher gesagt hatte, allerhand beigebracht. Er hatte auf dem irischen Kolleg in Rom studiert und mich eine korrekte lateinische Aussprache gelehrt. Er hatte mir Geschichten über die Katakomben und über Napoleon Bonaparte erzählt, hatte mir die Bedeutung der verschiedenen Zeremonien bei der Messe erklärt und die der verschiedenen Kleider, die der Priester trägt. Manchmal hatte er sich den Spaß gemacht, mir schwierige Fragen zu stellen, hatte mich dann gefragt, was man unter den und den Umständen tun müsste, ob die oder die Sünden Todsünden, Erlassungssünden oder nur Unvollkommenheiten wären. Seine Fragen zeigten mir, wie komplex und geheimnisvoll gewisse Institutionen der Kirche waren, in denen ich immer nur die einfachsten Handlungen gesehen hatte. Die Pflichten des Priesters der Eucharistie und dem Beichtgeheimnis gegenüber schienen mir so schwer, dass ich mich verwundert fragte, wie nur jemand den Mut in sich fände, sie zu übernehmen; und ich war nicht erstaunt, als er mir erzählte, die Kirchenväter hätten Bücher geschrieben, die wären so dick wie das Post Office Directory und so eng gedruckt wie die Prozessnachrichten in der Zeitung, und in ihnen würden all diese verwickelten Fragen behandelt. Wenn ich hieran dachte, konnte ich oft keine oder nur eine sehr dumme oder langsame Antwort geben, bei der er immer lächelte und zwei- oder dreimal nickte. Manchmal jagte er mich durch die Responsorien der Messe, die er mich hatte auswendig lernen lassen, und wenn ich stotterte, lächelte er immer nachdenklich und nickte mit dem Kopf, schob dann und wann große Prisen erst in das eine, dann in das andere Nasenloch. Wenn er lächelte, zeigte er seine großen, missfarbenen Zähne und ließ dabei seine Zunge auf der Unterlippe liegen, eine Gewohnheit, die in mir zu Anfang unserer Bekanntschaft, als ich ihn noch nicht richtig kannte, ein Gefühl des Unbehagens auslöste.
Während ich so in der Sonne einherging, fielen mir die Worte des alten Cotter ein, und ich versuchte, mich auf das, was sich hinterher im Traum ereignet hatte, zu besinnen. Ich erinnerte mich, dass ich lange Samtvorhänge und eine schwingende Lampe von altertümlicher Form gesehen hatte. Ich fühlte, dass ich sehr weit fort, in irgendeinem Land gewesen war, wo die Sitten so seltsam waren — in Persien, glaubte ich … Aber auf das Ende des Traums konnte ich mich nicht besinnen.
Am Abend nahm mich meine Tante mit in das Trauerhaus. Es war nach Sonnenuntergang; die Fensterscheiben der Häuser, die nach Westen sahen, strahlten das gelbe Gold einer großen Wolkenbank wider. Nannie empfing uns im Flur; und da es wenig passend gewesen wäre, laut mit ihr zu sprechen, drückte meine Tante ihr nur die Hand. Fragend zeigte die alte Frau nach oben, und als meine Tante nickte, ging sie müde vor uns her die enge Treppe hinauf, wobei ihr gebeugter Kopf kaum über das Geländer ragte. Auf dem Treppenabsatz blieb sie stehen, winkte uns ermutigend zu und führte uns dann an die offene Tür des Sterbezimmers. Meine Tante trat ein, und als die alte Frau sah, dass ich zögerte, einzutreten, winkte sie mir mit der Hand wiederholt zu.
Auf den Zehen trat ich ein. Durch das Spitzenende des Vorhangs strömte dunkelgoldenes Licht in den Raum, in dem die Kerzen wie blasse, dünne Flammen aussahen. Er war schon eingesargt. Nannie kniete am Fuß des Bettes nieder, wir taten dasselbe. Ich tat so, als ob ich betete, aber ich konnte meine Gedanken nicht sammeln, weil mich das Gemurmel der alten Frau störte. Ich sah, dass ihr Kleid auf dem Rücken unordentlich zugehakt und die Hacken ihrer Zeugschuhe ganz schief getreten waren. Ich meinte die ganze Zeit, der alte Priester lächle, während er da in seinem Sarg lag.
Aber nein. Als wir aufstanden und an das Kopfende des Bettes traten, sah ich, dass er nicht lächelte. Er lag da, feierlich und füllig, gekleidet, als stünde er vor dem Altar, leicht hielten seine großen Hände einen Kelch. Grimmig sein Gesicht, grau und massig, mit schwarzen, höhlenartigen Nasenlöchern, von einem spärlichen weißen Pelz umgeben. Schwerer Duft hing im Zimmer — die Blumen.
Wir schlugen das Zeichen des Kreuzes und gingen dann. In dem kleinen Zimmer unten saß Elisa würdig in seinem Lehnstuhl. Langsam tastete ich mich nach meinem gewohnten Stuhl in der Ecke, während Nannie ans Büffet ging und eine Karaffe mit Sherry und einige Weingläser herausnahm. Sie stellte alles auf den Tisch und lud uns ein, ein Gläschen Wein zu trinken. Dann goss sie auf Aufforderung ihrer Schwester den Sherry in die Gläser und reichte sie uns. Sie drängte mich, doch einige Biskuits zu nehmen, aber ich wollte nicht, weil ich meinte, ich verursachte beim Essen zu viel Geräusch. Meine Weigerung schien sie ein wenig zu enttäuschen; sie ging ruhig zum Sofa, das hinter ihrer Schwester stand, und setzte sich. Niemand sprach: Wir sahen alle in den leeren Kamin.
Meine Tante wartete, bis Elisa seufzte, und sagte dann: »Ah ja, nun ist er in eine bessere Welt eingegangen.«
Elisa seufzte wieder und senkte zustimmend den Kopf. Meine Tante spielte mit dem Fuße ihres Weinglases, bevor sie einen kleinen Schluck nahm.
»Ist er … ruhig …?« fragte sie.
»Oh, ganz ruhig«, sagte Elisa. »Man könnte nicht sagen, wann er den letzten Atemzug tat. Er hatte einen schönen Tod. Gott sei Dank.«
»Und alles …?«
»Pater O‘Rourke hat ihn am Dienstag noch besucht, ihm die Letzte Ölung gegeben und ihn wohl vorbereitet.«
»So wusste er also?«
»Er war ganz ergeben.«
»Er sieht auch ganz ergeben aus«, sagte meine Tante.
»Das sagte auch die Frau, die ihn gewaschen hat. Sie sagte, er sähe aus, als wenn er schliefe, so friedlich und ergeben sah er aus. Niemand hätte geglaubt, dass er mal eine so schöne Leiche sein würde.«
»Ja, wirklich«, sagte meine Tante.
Sie nahm einen etwas größeren Schluck und sagte dann: »Ja, Miss Flynn, auf alle Fälle muss der Gedanke, dass Sie alles für ihn getan haben, was Sie konnten, ein großer Trost für Sie sein. Sie waren doch beide sehr freundlich zu ihm.«
Elisa strich ihr Kleid über den Knien glatt.
»Ach, der arme James«, sagte sie. »Der liebe Gott weiß, dass wir alles getan haben, was wir konnten, so arm wir auch waren; solange er lebte, sollte ihm wenigstens nichts fehlen.«
Nannie hatte den Kopf gegen das Sofakissen gelegt und schlief fast ein.
»Sehen Sie nur mal die arme Nannie«, sagte Elisa und sah hin zu ihr, »sie ist ganz kaputt. Haben wir beide eine Arbeit gehabt! Zuerst die Leichenwäscherin und dann das Ankleiden und dann den Sarg und dann die Besprechung wegen der Messe in der Kapelle. Hätte Pater O’Rourke uns nicht geholfen, ich weiß nicht, wie wir fertig geworden wären. Er hat uns alle Blumen und die beiden Kerzenleuchter aus der Kapelle besorgt, er hat auch die Anzeige für den Freeman‘s General aufgesetzt und alle Papiere für die Beerdigung und die Versicherung des armen James beschafft.«
»Das war wirklich nett von ihm«, sagte meine Tante.
Elisa schloss die Augen und bewegte langsam den Kopf. »Ach ja, alte Freunde sind doch immer die besten«, sagte sie, »ich meine Freunde, auf die man sich wirklich verlassen kann.«
»Ja, da haben Sie recht«, sagte meine Tante. »Und ich bin sicher, dass er jetzt, wo er seinen Lohn in der Ewigkeit empfangen hat, weder Sie noch alle Ihre Freundlichkeit ihm gegenüber vergessen wird.«
»Ach, der arme James«, sagte Elisa. »Er war uns wirklich nicht beschwerlich. Man merkte von ihm nicht mehr im Haus als jetzt. Aber ich weiß es ja, dass er nun fort ist, und zwar …«
»Erst wenn alles vorbei ist, werden Sie ihn vermissen«, sagte meine Tante.
»Das weiß ich«, sagte Elisa. »Nun bringe ich ihm seine Bouillon nicht mehr, und Sie schicken ihm keinen Schnupftabak mehr. Ach, der arme James.« Sie hielt inne, als beschäftige sie sich mit der Vergangenheit, und sagte dann fast verschmitzt: »Denken Sie mal, ich habe es doch gemerkt, dass in der letzten Zeit was Seltsames mit ihm vorging. Jedes Mal, wenn ich ihm seine Suppe hereinbrachte, lag er zurückgelehnt mit offenem Mund im Sessel, und sein Brevier war auf die Erde gefallen.«
Sie legte einen Finger an die Nase, runzelte die Brauen; dann fuhr sie fort: »Aber immer wieder sagte er, ehe der Sommer vorüber wäre, möchte er an einem schönen Tag nach Irishtown rausfahren, unser altes Geburtshaus noch mal sehen und mich und Nannie mitnehmen. Wenn wir für den Tag nur billig einen von diesen neumodischen Wagen kriegen könnten, die keinen Lärm machen, von denen Pater O‘Rourke ihm erzählt hätte, die mit den rheumatischen Rädern — bei‘ Johnny Rush, grade gegenüber gäb‘s solche, sagte er, dann wollten wir alle drei an einem Sonntagnachmittag mal hinausfahren. Davon redete er immer wieder … Der arme James.«
»Der Herr sei seiner Seele gnädig«, sagte meine Tante.
Elisa zog ihr Taschentuch heraus und wischte sich damit die Augen. Dann steckte sie es wieder ein und sah ohne zu sprechen einige Zeit in den leeren Kamin.
»Er war immer zu gewissenhaft«, sagte sie. »Die Pflichten der Priesterschaft waren für ihn zu schwer. Und dann war sein Leben, das kann man wohl sagen, durchkreuzt.«
»Ja«, sagte meine Tante. »Er war ein Mann, der seine Enttäuschungen gehabt hat. Das sah man ihm an.«
Im Schutz des Schweigens, das sich über das kleine Zimmer senkte, näherte ich mich dem Tisch, probierte meinen Sherry und kehrte dann ruhig auf meinen Stuhl in der Ecke zurück. Elisa schien in tiefe Träumerei versunken. Wir warteten respektvoll, dass sie das Schweigen bräche; und nach einer langen Pause sagte sie langsam:
»Der Kelch, den er zerbrach … Damit fing‘s an. Natürlich sagte man, das wäre weiter nicht schlimm, ich meine, dass er leer war. Aber immerhin … Der Knabe soll ja schuld haben. Aber der arme James war so nervös, Gott sei ihm gnädig.«
»Und wie war‘s denn eigentlich?« sagte meine Tante. »Ich habe wohl so allerhand gehört …«
Elisa nickte. »Das hat ihn doch schwer getroffen«, sagte sie. »Hernach wurde er so schweigsam, redete mit niemandem und lief allein umher. Eines Abends wurde er gerufen, war aber nirgendwo zu finden. Das ganze Haus wurde abgesucht, von oben bis unten, nirgendwo war auch nur eine Spur von ihm zu entdecken. Da sagte der Küster, man sollte mal in der Kapelle nachsehen. Man holte die Schlüssel und öffnete die Kapelle, und der Küster und Pater O‘Rourke und noch ein Priester, der da war, holten ein Licht, um ihn zu suchen … Und was glauben Sie, wo er war? Ganz allein saß er im Dunkeln, in seinem Beichtstuhl, hellwach, und schien leise vor sich hin zu lächeln.«
Plötzlich war sie still, als lausche sie. Ich horchte auch; aber im Haus war kein Laut zu hören: Und ich wusste, dass der alte Priester noch in seinem Sarg lag, wie wir ihn gesehen hatten, feierlich und grimmig im Tod, einen leeren Kelch auf der Brust. Elisa wiederholte:
»Hellwach und schien leise vor sich hin zu lächeln. Als sie das sahen, glaubten sie natürlich, dass es nicht ganz mit ihm stimmte …«
EINE BEGEGNUNG
Joe Dillon machte uns mit dem Wild West bekannt. Er hatte eine kleine Bibliothek, die aus alten Nummern des Union Jack, Pluck und Half Penny Marvel bestand. Jeden Abend nach der Schule trafen wir uns in seinem Garten hinter dem Haus und veranstalteten Indianerkämpfe. Er und sein junger Bruder, der fette, faule Leo, verteidigten den Speicher über dem Stall, während wir ihn zu stürmen versuchten; oder wir schlugen eine regelrechte Schlacht auf dem Rasen. Aber so tapfer wir auch kämpften, nie gewannen wir bei der Belagerung oder in der Schlacht, und unsere Kämpfe endeten immer mit einem Siegestanz von Joe Dillon. Jeden Morgen gingen seine Eltern in die Acht-Uhr-Messe in der Gardiner Street, und der Flur des Hauses duftete nach der friedlichen Frau Dillon. Für uns, die wir jünger und ängstlicher waren, spielte er zu wild. Er sah wirklich aus wie ein Indianer, wenn er mit einer alten Teemütze auf dem Kopf durch den Garten sprang, wobei er mit der Faust auf eine Blechdose schlug und schrie:
»Ya! yaka yaka, yaka!«
Jeder schüttelte ungläubig den Kopf, wenn erzählt wurde, er wolle Priester werden. Aber deshalb war es doch wahr.
Ein Geist der Widerspenstigkeit war bei uns eingeschlichen, und sein Einfluss ließ die Unterschiede der Bildung und des Temperaments verschwinden. Wir scharten uns zusammen, einige in frechem Übermut, andere aus Spaß und wieder andere aus Angst; und zu diesen letzteren, den Indianern wider Willen, die sich fürchteten, als Streber oder Angsthasen angesehen zu werden, gehörte auch ich. Die Abenteuer, die in der Literatur des Wild West berichtet wurden, lagen mir gar nicht, aber wenigstens öffneten sie mir Tore, durch die ich entwischen konnte. Viel besser gefielen mir gewisse amerikanische Detektivgeschichten, in denen dann und wann ungekämmte, wilde und schöne Mädchen vorkamen. Wenn auch nichts Schlimmes in diesen Geschichten passierte und ihre Absicht manchmal literarisch war, wurden sie in der Schule doch nur heimlich herumgegeben. Eines Tages, als Pater Butler die vier Seiten römische Geschichte abhörte, fiel der ungeschickte Leo Dillon mit einer Nummer des Half Penny Marvel auf.
»Diese Seite oder diese Seite? Diese Seite? Nun Dillon, du! Kaum war der Tag … Weiter! Welcher Tag? Kaum war der Tag angebrochen … Hast du gelernt? Was hast du denn da in der Tasche?«
Wir bekamen alle Herzklopfen, als Leo Dillon ihm das Heftchen reichte, und machten alle ein unschuldiges Gesicht. Pater Butler schlug die Seiten um, runzelte die Stirn.
»Was ist denn das für Zeug?« sagte er. »Der Apachenhäuptling! So was also liest du, anstatt deine römische Geschichte zu lernen! Dass ich in der Schule nie wieder solches Dreckzeug finde! Wer so was schreibt, kann nur ein ganz elender Kerl sein, der sich mit seinem Mist ein paar Saufgroschen verdienen will. Ich bin überrascht, dass so gebildete Jungen wie ihr solchen Dreck lesen. Ich könnte das verstehen, wenn ihr in … die National School ginget. Also, Dillon, das rate ich dir allen Ernstes, setz‘ dich auf die Hosen, oder …«
Dieser Tadel während der trockenen Schulstunde ließ in meinen Augen den Glanz des Wild-West verblassen, und Leo Dillons verwirrtes, aufgedunsenes Gesicht brachte mich etwas zur Selbstbesinnung. Als aber der hemmende Einfluss der Schule hinter mir lag, hungerte ich wieder nach wilden Sensationen, nach einem Entrinnen, was mir beides nur diese wilden Geschichten zu geben vermochten. Die abendlichen Kriegsspiele waren mir schließlich ebenso langweilig wie der morgendliche Betrieb in der Schule; ich sehnte mich nach wirklichen Abenteuern. Aber wirkliche Abenteuer, so überlegte ich, erleben die nicht, die zu Hause bleiben: Man muss sie draußen suchen.
Die Sommerferien standen vor der Tür, als ich mich entschloss, wenigstens für einen Tag der Öde des Schullebens zu entfliehen. Mit Leo Dillon und einem andern Jungen namens Mahony plante ich ein eintägiges Schwänzen. Jeder von uns sparte sich Sixpence. Um zehn Uhr morgens wollten wir uns auf der Canal Bridge treffen. Mahonys große Schwester sollte für diesen eine Entschuldigung schreiben, und Leo Dillons Bruder sollte bestellen, er sei krank. Wir verabredeten, die Wharf Road hinunterzugehen bis zu den Schiffen; dort wollten wir mit der Fähre übersetzen und zum Pigeon House hinaus wandern. Leo Dillon hatte Angst, wir könnten Pater Butler oder sonst jemandem aus dem College begegnen; aber Mahony fragte ganz richtig, was Pater Butler denn wohl beim Pigeon House zu suchen hätte. Wir beruhigten uns wieder; und ich erledigte den ersten Teil der Verschwörung, indem ich von den beiden andern die Sixpence einsammelte und ihnen auch mein eigenes Sixpencestück zeigte. Als wir am Abend die letzten Vorbereitungen trafen, waren wir alle doch ein bisschen aufgeregt.
Lachend schüttelten wir einander die Hände, und Mahony sagte: »Na, dann also bis morgen, Kameraden!«
Diese Nacht schlief ich schlecht. Am Morgen war ich der Erste an der Brücke, da ich ihr am nächsten wohnte. Ich versteckte meine Bücher in dem langen Gras neben der Abfallgrube am Ende des Gartens, wo nie jemand hinkam, und lief dann am Kanalufer entlang. Es war ein milder, sonniger Morgen in der ersten Juniwoche. Ich setzte mich auf das Brückensims, bewunderte meine dünnen Zeugschuhe, die ich am Abend vorher mit Pfeifenton geweißt hatte, und beobachtete die willigen Pferde, die einen ganzen Wagen voll Geschäftsleute den Hügel hinaufzogen. Alle Zweige der großen Bäume, die am Rand der Straße standen, waren voll lustiger, kleiner, hellgrüner Blätter, und schräg fiel das Sonnenlicht durch sie herab auf das Wasser. Der Granit der Brücke fing an, warm zu werden, und ich trommelte darauf zu einer Melodie, die ich im Kopf hatte, den Takt. Ich war sehr glücklich.
Als ich fünf bis zehn Minuten so dagesessen hatte, sah ich Mahony in seinem grauen Anzug näher kommen. Lächelnd kam er den Hügel herauf und kletterte neben mich auf die Brücke. Während wir warteten, zog er die Schleuder hervor, die aus der inneren Tasche herausguckte, und erklärte mir einige Verbesserungen, die er an ihr angebracht hatte. Ich fragte ihn, warum er sie mitgenommen hätte, und er erklärte mir, er wolle nur mit den Vögeln so’n bisschen Blödsinn machen. Mahony gebrauchte gern Straßenausdrücke und nannte Pater Butler immer nur den alten Wanst. Wir warteten noch eine Viertelstunde, aber von Leo Dillon war immer noch nichts zu sehen. Schließlich sprang Mahony runter und sagte:
»Los! Wusste ja, dass der Dicke Schiss hatte.«
»Und seine Sixpence?« sagte ich.
»Sind verfallen,« sagte Mahony. »Um so besser für uns — ein Shilling und Sixpence anstatt eines Shillings.«
Wir gingen die North Strand Road entlang, bis wir an die Vitriolwerke kamen, und wandten uns dann nach rechts, die Wharf Road entlang. Sobald uns niemand mehr sehen konnte, fing Mahony an, Indianer zu spielen. Er jagte hinter einer Schar zerlumpter Mädchen her, schwang seine ungeladene Schleuder, und als zwei zerlumpte Jungs aus Ritterlichkeit anfingen, uns mit Steinen zu werfen, schlug er einen Angriff auf sie vor. Ich entgegnete, die Jungen wären zu klein, und so gingen wir denn weiter, während die zerlumpte Schar hinter uns her rief: »Evangelische Ratten«, denn sie hielten uns für Protestanten, weil Mahony, der eine dunkle Gesichtsfarbe hatte, an seiner Mütze das silberne Abzeichen eines Cricketklubs trug. Als wir zum Smoothing Iron kamen, spielten wir Belagerung; aber es war ein Fehlschlag, weil dazu doch mindestens drei nötig sind. Wir rächten uns an Leo Dillon, schimpften ihn einen ganz gemeinen Schisser und rieten, wieviel er um drei Uhr von Mr Ryan übergezogen bekommen würde.
Dann kamen wir an den Fluss. Lange gingen wir über die lärmenden Straßen, die hohe Steinmauern einfassten, beobachteten das Arbeiten der Kräne und Maschinen und wurden oft von den Kutschern ächzender Wagen angeschrien, weil wir so unbeweglich im Weg standen. Es war Mittag, als wir die Kais erreichten, und da alle Arbeiter zu frühstücken schienen, kauften wir zwei große Korinthenbrötchen und setzten uns, um sie zu essen, auf ein Metallrohr neben dem Fluss. Wir erfreuten uns am Anblick des Dubliner Handels: Von weit her kündigten sich die Schiffe durch ihren krausen, wolligen Rauch an, die braune Fischerflotte fuhr jenseits Ringsend, und am gegenüberliegenden Kai wurde das große, weiße Segelschiff ausgeladen. Mahony meinte, es wäre ein herrlicher Spaß, auf einem der großen Schiffe durchzubrennen, und als ich die hohen Masten betrachtete, sah oder glaubte sogar ich zu sehen, wie die Geografie, die ich in so kleinen Dosen in der Schule verabreicht bekommen hatte, in meinen Augen allmählich Substanz annahm. Schule und Haus schienen zurückzuweichen und beider Einfluss auf uns zu schwinden.
Mit der Fähre fuhren wir über den Liffey, zahlten unser Fahrgeld, und wurden zusammen mit zwei Arbeitern und einem kleinen Juden, der einen Sack trug, hinübergefahren. Wir waren ernst bis zur Feierlichkeit, aber einmal begegneten sich während der kurzen Überfahrt unsere Augen, und wir lachten. Als wir landeten, beobachteten wir das Ausladen des schmucken Dreimasters, den wir vom andern Kai aus schon gesehen hatten. Einer der Zuschauer sagte, es sei ein norwegisches Schiff. Ich ging an das Hinterteil und wollte seinen Namen entziffern; da mir das aber nicht gelang, kam ich zurück und betrachtete genau die ausländischen Matrosen, denn ich wollte feststellen, ob welche von ihnen grüne Augen hätten, mir schwebte nämlich vor … Die Augen der Matrosen waren blau, grau und sogar schwarz. Der einzige Matrose, dessen Augen man hätte grün nennen können, war ein großer Mann, der die Menge auf dem Kai dadurch erfreute, dass er jedes Mal, wenn die Planken fielen, lustig rief: »Allright! Allright!«
Als wir dieses Schauspiels müde waren, schlenderten wir nach Ringsend hinein. Es war schwül geworden, und in den Fenstern der Krämerläden schimmelten bleiche Biskuits. Wir kauften, ein paar Biskuits und Schokolade, die wir unverdrossen aßen, während wir durch die schmutzigen Straßen wanderten, in denen die Familien der Fischer wohnen. Wir konnten keine Milchwirtschaft finden und gingen deshalb in einen Hökerladen, wo wir für jeden eine Flasche Himbeerlimonade erstanden. Nach dieser Erfrischung jagte Mahony in einer Gasse hinter einer Katze her, aber die Katze entkam auf ein weites Feld. Wir waren beide ziemlich müde, und als wir das Feld erreichten, gingen wir gleich auf eine abfallende Böschung zu, über die hinweg wir den Dodder sehen konnten.
Es war zu spät, und wir waren zu müde, unsern Plan, das Pigeon House zu besuchen, auszuführen. Vor vier Uhr mussten wir zu Hause sein, sollte unser Abenteuer nicht entdeckt werden. Voll Bedauern betrachtete Mahony seine Schleuder, und erst als ich ihm vorschlug, wir wollten mit dem Zug nach Hause fahren, wurde er wieder einigermaßen froh. Die Sonne verbarg sich hinter einigen Wolken und überließ uns unseren müden Gedanken und den Resten unserer Vorräte.
Außer uns war niemand auf dem Feld. Als wir einige Zeit ohne ein Wort zu sagen am Abhang gelegen hatten, sah ich einen Mann, der vom andern Ende des Feldes her näher kam. Ich beobachtete ihn lässig, während ich an einem jener grünen Halme kaute, mit deren Hilfe die Mädchen wahrsagen. Langsam kam er die Böschung entlang. Beim Gehen stützte er die eine Hand in die Hüfte, in der andern Hand hielt er einen Stock, mit dem er leicht auf den Rasen schlug. Er trug einen schäbigen, grün-schwarzen Anzug und dazu einen sogenannten Schriliber mit hohem Kopf. Er sah ziemlich alt aus, denn sein Schnurrbart war aschgrau. Als er an unsern Füßen vorbeikam, warf er uns einen schnellen Blick zu und ging dann weiter. Wir blickten hinter ihm her und sahen, dass er nach ungefähr fünfzig Schritten umkehrte und wieder zurückkam. Ganz langsam schritt er auf uns zu, schlug dabei immer mit dem Stock auf den Boden; er ging so langsam, dass ich glaubte, er suche etwas im Gras.
Als er vor uns stand, machte er halt und sagte uns guten Tag. Wir erwiderten den Gruß; langsam und sehr sorgfältig setzte er sich auf den Abhang. Zuerst sprach er vom Wetter, sagte, es würde ein sehr heißer Sommer, und fügte hinzu, dass sich seit seiner Knabenzeit die Jahreszeiten sehr geändert hätten — aber das wäre schon lange her. Er sagte, die schönste Zeit des Lebens sei zweifellos die Schulzeit, und alles würde er darangeben, könnte er noch einmal jung sein. Während er diesen Gefühlen, die uns ein wenig langweilten, so Ausdruck verlieh, sagten wir kein Wort. Dann fing er an, über Schule und Bücher zu sprechen. Er fragte uns, ob wir die Gedichte des Thomas Moore oder die Werke von Sir Walter Scott und Lord Lytton gelesen hätten. Ich tat so, als hätte ich jedes Buch, das er erwähnte, gelesen, sodass er schließlich sagte:
»Sieh mal an, du bist genauso ein Bücherwurm wie ich. Aber der«, fügte er, auf Mahony zeigend, hinzu, der uns mit offenen Augen anstierte, »der ist ganz anders, er spielt lieber.«
Er sagte, er hätte zu Hause alle Bücher von Sir Walter Scott und von Lord Lytton und läse sie immer wieder. »Natürlich«, sagte er, »dürfen kleine Jungen gewisse Bücher des Lord Lytton nicht lesen.« Mahony fragte, warum Jungs sie denn nicht lesen dürften — welche Frage mich aufregte und ärgerte, weil ich fürchtete, der Mann könnte mich für so stupide halten wie Mahony. Der Mann aber lächelte nur. Ich sah, dass er zwischen den gelben Zähnen im Mund große Lücken hatte. Dann fragte er uns, wer von uns die meisten Liebchen hätte. Mahony erwähnte so leichthin, er hätte drei Puttchen. Der Mann fragte mich, wieviel ich denn hätte. Ich antwortete, ich hätte keine einzige. Er glaubte mir nicht und sagte, er wäre sicher, dass ich doch eine hätte. Ich antwortete nichts.
»Erzählen Sie uns doch mal«, sagte Mahony keck zu dem Mann, »wie viele Sie selbst haben.«
Wieder lächelte der Mann und sagte, dass er, als er in unserm Alter war, eine Menge Liebchen gehabt habe.
»Jeder Junge«, sagte er, »hat ein kleines Liebchen.«
Seine Einstellung in dieser Sache kam mir für einen Mann seines Alters ziemlich frei vor. In meinem Herzen dachte ich, dass das, was er über Jungs und Liebchen sagte, vernünftig war. Aber aus seinem Mund missfielen mir diese Worte, und ich fragte mich, warum er zwei- oder dreimal zusammenschauderte, als hätte er vor etwas Angst oder fühlte plötzliche Kälte. Als er weiter redete, bemerkte ich, dass er eine gute Aussprache hatte. Jetzt sprach er mit uns über die Mädchen, sagte, was für schönes, weiches Haar sie hätten, wie weich ihre Hände wären, und dass alle Mädchen gar nicht so brav wären wie sie täten, man müsste nur Bescheid wissen. Nichts betrachte er so gern, sagte er, wie ein schönes, junges Mädchen, ihre schönen, weißen Hände und ihr schönes, weiches Haar. Ich hatte dabei den Eindruck, als wiederhole er etwas, was er auswendig gelernt hatte oder um das sich sein Geist, von denselben Worten magnetisiert, immer wieder langsam im selben Kreis drehte. Manchmal klang es, als spiele er auf eine Tatsache an, die jeder wüsste, und dann wieder dämpfte er seine Stimme und sprach geheimnisvoll, als erzähle er uns ein Geheimnis, das kein anderer hören dürfe. Er wiederholte seine Sätze immer wieder, variierte sie und hüllte sie in seine monotone Stimme. Ich sah immer zum Fuß des Abhangs, hörte auf seine Worte.
Nach langer Zeit war sein Monolog zu Ende. Langsam stand er auf, sagte, er müsse uns eine Minute oder so verlassen, und ohne dass ich die Richtung meines Blickes zu ändern brauchte, sah ich ihn langsam zum nahen Ende des Feldes zu fortgehen. Wir sagten nichts, als er gegangen war. Nach einem Schweigen, das einige Minuten gedauert hatte, hörte ich Mahony rufen:
»Ne, so was! Sieh mal, was der macht!«
Als ich weder antwortete noch aufsah, rief Mahony wieder: »Ne, so was! Der hat sie nicht alle auf der Latte!«
»Wenn er uns nach unserm Namen fragen sollte«, sagte ich, »dann heißt du Murphy und ich Smith.«
Weiter sagten wir nichts zueinander. Ich überlegte noch, ob ich fortgehen sollte oder nicht, als der Mann zurückkam und sich wieder neben uns setzte. Kaum hatte er sich gesetzt, als Mahony die Katze sah, die ihm vorhin entwischt war, aufsprang und querfeldein hinter ihr her lief. Der Mann und ich beobachteten die Jagd. Wieder entwischte die Katze, und Mahony warf mit Steinen nach der Mauer, über die sie geklettert war. Dann gab er auch das auf und bummelte ziellos am andern Ende des Feldes umher.
Nach einer Pause sprach mich der Mann wieder an. Er sagte, mein Freund wäre ein arger Schlingel, und fragte mich, ob er in der Schule oft Prügel bekäme. Ich wollte ihm gerade empört antworten, wir seien keine Schüler der National School, die Prügel bekämen, wie er es nannte; aber ich sagte nichts. Jetzt redete er über Züchtigung von Knaben. Wieder schien sich sein Geist, von seinen eigenen Worten magnetisiert, fortwährend langsam in diesem neuen Kreis zu drehen. Er sagte, wenn Jungs so wären, müssten sie Prügel, gehörig Prügel haben. Wenn ein Junge grob und widerspenstig wäre, bekäme ihm nichts so gut wie eine gehörige Tracht Prügel. Ein Schlag in die Hand oder eine Ohrfeige, das wäre nichts: Eine leckere Tracht Prügel, das wäre das Richtige. Ich war von dieser Ansicht überrascht und sah ihm unwillkürlich ins Gesicht. Dabei begegnete ich dem Blick von zwei flaschengrünen Augen, die mich unter zuckender Stirn her ansahen. Ich sah wieder weg.
Der Mann setzte seinen Monolog fort. Er schien seine freien Anschauungen von eben ganz vergessen zu haben. Er sagte, er würde jeden Jungen, der mit Mädchen redete oder ein Mädchen zum Liebchen hätte, verprügeln, ganz gehörig verprügeln, und das würde ihn lehren, nicht mit Mädchen zu sprechen. Und hätte ein Junge ein Liebchen und erzählte darüber Lügen, dann würde er ihn so verprügeln, wie noch nie ein Junge verprügelt worden wäre. Er sagte, nichts auf der Welt würde er so gern tun. Er beschrieb mir, wie er einen solchen Jungen verprügeln würde, als handle es sich um die Enthüllung eines mannigfaltigen Geheimnisses. Nichts auf der Welt täte er lieber als das, sagte er; und während er mich monoton durch das Geheimnis führte, wurde seine Stimme fast liebevoll und schien mich anzuflehen, ihn doch zu verstehen.
Ich wartete, bis wieder eine Pause in seinem Monolog eintrat. Dann stand ich plötzlich auf. Um meine Erregung nicht zu verraten, blieb ich noch ein paar Augenblicke und tat so, als schnürte ich mir den Schuh zu; dann sagte ich, ich müsse gehen, und wünschte ihm guten Tag. Ruhig ging ich die Böschung hinauf, aber mir schlug das Herz schneller, denn ich fürchtete, er würde mich bei den Knöcheln fassen. Als ich oben auf der Böschung stand, drehte ich mich um und rief, ohne ihn anzusehen, laut über das Feld:
»Murphy.«
Meine Stimme klang gemacht mutig, und ich schämte mich meiner erbärmlichen List. Noch einmal musste ich den Namen rufen, ehe Mahony mich sah und dann »Hallo!« rief. Wie schlug mir das Herz, als er über das Feld auf mich zu gelaufen kam. Er lief, als brächte er mir Hilfe. Und ich empfand Reue; denn in meinem Herzen hatte ich ihn immer ein wenig verachtet.
ARABIEN
Da die North Richmond Street eine Sackgasse ist, war sie, abgesehen von der Stunde, zu der die Christian Brothers’ School ihre Schüler entließ, eine stille Straße. Am Ende der Sackgasse stand auf einem viereckigen Grundstück ein einzelnes, unbewohntes, zweistöckiges Haus. Die anderen Häuser der Straße, die sich des anständigen Lebens in ihrem Innern bewusst waren, sahen einander mit braunen, unerschütterlichen Gesichtern an.
Der frühere Mieter unseres Hauses, ein Priester, war in dem hinteren Wohnzimmer gestorben. Muffige Luft hing in den Räumen, die lange nicht geöffnet worden waren, und in dem großen Raum hinter der Küche lag altes, wertloses Papier umher. Unter diesem fand ich einige broschierte Bücher, deren Seiten kraus und feucht waren: The Abbot von Walter Scott, The Devout Communicant und The Memoirs of Vidocq. Letzteres mochte ich am liebsten, weil seine Blätter gelb waren. Der wilde Garten hinter dem Haus hatte in der Mitte einen Apfelbaum und ein paar vereinzelte Büsche; unter einem von ihnen fand ich die rostige Fahrradpumpe des verstorbenen Mieters. Er war ein sehr mildtätiger Priester gewesen. In seinem Testament hatte er sein ganzes Geld Instituten und die Einrichtung seines Hauses seiner Schwester vermacht.
Als die kurzen Wintertage kamen, war es schon dunkel, ehe wir noch mit dem Abendessen fertig waren. Und wenn wir uns dann auf der Straße zusammenfanden, waren die Häuser schwarz geworden. Das Stück Himmel über uns wechselte in mannigfachem Violett, und die Straßenlaternen reckten ihm ihr schwaches Licht entgegen. Die kalte Luft stach uns, und wir spielten, bis uns der Körper glühte. Unsere Rufe hallten in der stillen Straße wider. Unser Spiel führte uns durch die dunklen, schmutzigen Gassen hinter den Häusern, wo wir die wilden Stämme aus den Hütten zum Kampf herausforderten, bis an die Hintertüren der dunklen, feuchten Gärten, wo aus den Abfallgruben Düfte aufstiegen, bis an die dunklen, stinkenden Ställe, wo der Kutscher das Pferd striegelte und kämmte oder Musik aus den Schnallen des Geschirrs schüttelte. Wenn wir auf die Straße zurückkehrten, hatte Licht aus den Küchenfenstern die Vorgärten erfüllt. Wenn wir meinen Onkel um die Ecke kommen sahen, versteckten wir uns im Dunkeln, bis wir gesehen hatten, dass er glücklich im Haus war. Oder wenn Mangans Schwester auf der Türschwelle erschien und ihren Bruder zum Tee hereinrief, beobachteten wir sie aus unserem Dunkel, wie sie die Straße auf und ab sah. Wir warteten, ob sie blieb oder wieder hineinging, und wenn sie blieb, verließen wir resigniert unser Versteck und gingen bis an Mangans Tür. Sie wartete auf uns, ihre Gestalt umrissen vom Licht, das aus der halboffenen Tür strömte. Ihr Bruder neckte sie immer, bevor er gehorchte, und ich stand am Gitter und sah hinüber zu ihr. Ihr Kleid pendelte, wenn sie ihren Körper bewegte, hin und her, und hin und her pendelte auch die weiche Flechte ihres Haares.