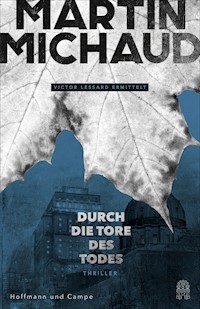
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Neues vom kanadischen Meister des Thrillers Als der Kopf eines hohen Beamten der Polizei von Montreal gefunden wird, muss Victor Lessard in einem heiklen Fall ermitteln, denn Verdächtige gibt es genug – und nicht zuletzt in den eigenen Reihen. Ausgerechnet als Sergent-Détective Victor Lessard während der Abwesenheit seines Vorgesetzten vertretungsweise die Mordkommission von Montreal leitet, wird im Müll der Kopf eines hochrangigen Polizeibeamten gefunden, für den Lessard früher einmal gearbeitet hat. Nun müssen Lessard und seine Partnerin Jacinthe Taillon ermitteln – und zwar so schnell wie möglich, denn der Mörder hat einen Brief hinterlassen, in dem er nicht nur Philosophen zitiert, sondern auch ankündigt, dass weitere Köpfe rollen werden …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 460
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Martin Michaud
Durch die Tore des Todes
Thriller
Aus dem kanadischen Französisch von Reiner Pfleiderer und Sabine Reinhardus
Hoffmann und Campe
An die Meinen, verzeiht mir die vielen versäumten Stunden, aus denen Worte wurden.
Der Perverse sucht das Wahre und erhebt einen Anspruch darauf, jenseits der vielfältigen Formen der Täuschung. Er ist auf der Jagd nach der Wahrheit, immer auf der Seite der Realität, des Begehrens und des Genusses.
LUCIE CANTIN
Wir müssen unser Dasein so weit, als es irgend geht, annehmen; alles, auch das Unerhörte, muss darin möglich sein.
RAINER MARIA RILKE, Briefe an einen jungen Dichter
Es gibt nur eine Welt, und diese ist falsch, grausam, widersprüchlich, verführerisch, ohne Sinn. Eine so beschaffene Welt ist die wahre Welt. Wir haben Lüge nötig, um über diese Realität, diese Wahrheit zum Sieg zu kommen.
FRIEDRICH NIETZSCHE, Die Geburt der Tragödie
Maxime
Am Nachmittag hatte heftiger Schneefall eingesetzt. Maxime trabte auf dem Heimweg die mit weißen Flocken bestäubte Rue Rachel entlang. Zwischen seiner Schule und der Wohnungstür lagen nur ein paar Hundert Meter. Um ihm klarzumachen, warum er niemals mit Fremden sprechen durfte, hatte seine Mama ihm mehrmals eine entsetzliche Geschichte erzählt: Sie handelte von einem kleinen Jungen, der die Fratze des Teufels sah, als er in das Auto eines Unbekannten einstieg. Aber als ihn der Mann im roten Mantel und mit dem langen weißen Bart ansprach, hellte die Miene des Jungen sich auf. Der Weihnachtsmann! Er nahm die Hand des Fremden, ohne auch nur zu ahnen, dass er soeben die Fratze des Teufels gesehen hatte. Dann verschwanden die beiden Gestalten im dichten Schneegestöber. Das geschah am 18. Dezember 1981. Maxime war sechs Jahre alt, und seine Mama sollte ihn nie wiedersehen.
48.Unter der Erde
Die Waffe in der Hand, richtete Victor Lessard den Lichtstrahl seiner Taschenlampe in die Dunkelheit und tastete sich mit vorsichtigen Schritten in den Kanalisationsschacht hinein. Der Lichtstrahl glitt über die Betonwände mit den Ablagerungen und ließ das schlammige Wasser im Schacht aufblitzen. Ein ekelhafter Geruch stieg ihm in die Nase; er verzog das Gesicht und biss in die Zitrone, die zwischen seinen Zähnen klemmte. Er war noch nie in einen Abwasserkanal hinuntergestiegen und hatte Angst vor den Ratten, die sich hier vermutlich herumtrieben.
Jacinthe Taillons ungeduldige Stimme knisterte in seinem Hörer.
»Na und? Kannst du was sehen?«
Das Donnergrollen im Hintergrund deutete er als böses Omen. Ein Gewitter braute sich zusammen.
Victor spuckte den Zitronenschnitz aus.
»Bis jetzt noch nicht.«
Jacinthe leitete die Operation von oben und wartete dort auf Verstärkung ihres Teams und die Arbeiter, die für die Instandhaltung des Tunnels zuständig waren.
»Hey, Lessard … pass da unten bloß auf deine neuen Sneaker auf. Du weißt schon, du würdest ja noch in den einzigen Hundehaufen in der Wüste reintreten.«
Das etwas bemühte Lachen seiner Partnerin bohrte sich in sein Ohr. Offenbar ein gutgemeinter Versuch, die angespannte Stimmung etwas zu lockern. Ihre Bemerkung spielte auf die roten Converse aus Leder an, die er vor zehn Tagen zu seinem Geburtstag geschenkt bekommen hatte. Victor sah lieber gar nicht erst hin: Das schmutzige Abwasser stand ihm bis zu den Waden.
Seit er die gezückte Waffe in der Hand hielt, hatte sich sein Puls beschleunigt, und das flaue Gefühl in seinem Magen wurde merklich stärker. Und er wusste auch, woran das lag: Es war die Angst. Eine Angst, die sich mit dem Adrenalin in seinen Venen zu einem explosiven Gebräu mischte. Er ließ den Lichtstrahl über die Betonwände wandern: Die Kalkablagerungen hatten sich zu Stalaktiten geformt. Während er sich langsam vorwärtsbewegte, zeigte sich ihm im Lichtkreis der Taschenlampe stets das gleiche Bild: bräunliche Pfützen auf dem Boden des Abwasserkanals und ansonsten nur schwarze Leere. Er blieb stehen, atmete tief ein und hielt die Luft an.
Dass jede Leere letztlich immer etwas enthielt, wusste er. Sobald man die Lider schloss und Bilder vor dem inneren Auge auftauchten, wurden die Schatten in der Dunkelheit deutlicher. Vor allen Dingen aber war ihm klar, dass diese Bilder, wenn man sie zuließ, einen mit Haut und Haaren zu verschlingen drohten.
Jacinthes Stimme holte ihn in die Wirklichkeit zurück.
»Hey, hast du ihn gefunden, oder was?«
»Nein. Und brüll nicht so rum, Jacinthe. Mir platzt gleich das Trommelfell.«
»Okay, okay. Stell dich nicht so an, Weichei.«
Victor ging langsam weiter, als der Lichtstrahl seiner Taschenlampe plötzlich aufflackerte. Er stieß die Lampe zweimal gegen den Lauf seiner Waffe, und besorgt fiel ihm ein, dass er die Batterien seit langer Zeit nicht ausgewechselt hatte. Vor ihm, in Sichtweite, bog der Kanal nach links ab, weiter konnte er nicht sehen. Als er nur noch ein paar Schritte entfernt war, hörte er Trappeln und nahm undeutlich eine Bewegung wahr. Er zuckte zusammen und schrie leise auf.
»Lessard? Was quiekst du denn?«
Sein Herz pochte heftig.
»Irgendwas ist gerade zwischen meinen Beinen durchgehuscht.«
Den Finger am Abzug, ließ er den Lichtstrahl über das Wasser am Boden wandern, bereit, den Nager in der Luft zu zerfetzen. Es war jedoch nichts zu sehen.
Wieder vernahm er die gepresste Stimme seiner Kollegin.
»Was war das denn?«
»Weiß ich nicht. Wahrscheinlich eine widerliche Ratte.«
Schwer atmend legte Victor die restlichen Meter bis zur Kurve zurück und hielt dort abrupt inne. Hier war der Gestank noch durchdringender: Der Dunst nach fauligem Fleisch und Exkrementen schlug ihm entgegen.
Ein heftiger Hustenanfall schüttelte ihn. Die Nase in die Armbeuge gepresst ging er weiter und unterdrückte einen Anfall von Übelkeit. Jacinthe fragte ihn unaufhörlich, was los sei, aber er nahm ihre Stimme nur noch als ein fernes Rauschen wahr. Seine Zweifel waren schlagartig verflogen. Er wusste jetzt, was ihn erwartete. Und er fürchtete es mehr als alles andere.
Obwohl es Victor nicht gelang, eine innere Stimme auszublenden, die ihm befahl umzukehren, und obwohl ihm klar war, dass ihn jeder Schritt der Welt der Schatten näher brachte, wagte er sich weiter vor. Bis das, was er erwartet hatte, schließlich im Lichtkegel seiner Lampe vor ihm auftauchte.
Die menschliche Gestalt saß unmittelbar vor ihm auf dem Boden, mit dem Rücken gegen die Betonwand gelehnt, Hüfte und Gesäß im Wasser. Von den steif ausgestreckten Beinen der Leiche ragten nur noch zwei Schuhspitzen aus dem Wasser hervor. Victor richtete den Lichtstrahl auf die Schuhe und ließ ihn dann langsam nach oben wandern, bis zum Oberkörper des Toten. Erst als er die Brust der Leiche sah, fiel ihm auf, dass irgendwas nicht stimmte. Der Brustkorb hob und senkte sich leicht. Das Opfer atmete noch! Victor wich zurück und wäre um ein Haar rücklings umgekippt.
Er konnte sich gerade noch an der Mauer abstützen, aber seine Taschenlampe rutschte ihm aus der Hand, fiel in die Dunkelheit und erlosch, als sie ins Wasser eintauchte.
Es war mit einem Mal so dunkel, als hätte jemand ein blickdichtes Tuch über seine Augen gezogen.
»Lessard, was machst du eigentlich da unten? Du zerrst an meinen Nerven!«
Victor setzte den Ohrhörer ab und legte ihn über die Schulter. Er musste unbedingt diese überlebenswichtige Lampe wiederfinden, Jacinthes Fragen konnten erst mal warten. Er schob die Glock zwischen Hüfte und Gürtel, hockte sich nieder und tastete blind im schlammigen Wasser umher. Währenddessen, jedenfalls solange ihn keine Ratte biss, überstürzten sich die Gedanken in seinem Kopf.
Schließlich stießen seine Finger gegen etwas Festes. Er schloss die Hand um die Taschenlampe, fischte sie aus dem Wasser, schickte ein Stoßgebet zum Himmel und schüttelte sie. Dann schob er den Schalter mehrmals nach oben. Nichts. Wütend schlug er das Metallgehäuse gegen seinen Schenkel.
»Verdammt! Du lässt mich jetzt nicht einfach im Stich.«
Victor seufzte erleichtert auf, als der Lichtstrahl aufblitzte. Vorsichtig ging er näher an das Opfer heran und bemerkte, dass er in der Aufregung nicht auf das merkwürdige leise Rumoren geachtet hatte, das jetzt ganz deutlich an sein Ohr drang. Erst als er unmittelbar vor dem Toten stand, begriff er die Ursache des Geräusches: Eine ganze Rattenkolonie hatte sich über den Toten hergemacht und bedeckte seinen Körper wie eine zweite Haut. Das erklärte auch, warum er zuerst geglaubt hatte, der Tote atme noch.
Obwohl er Jacinthe mitteilen wollte, welchen Fund er gemacht hatte, zog ihn der widerwärtige Anblick derart in seinen Bann, dass er kein einziges der vielen Worte herausbrachte, die durch sein Hirn rasten.
Der Kopf der Leiche – offenbar ein Mann – war am Nacken abgetrennt worden. Victor schrie auf, versuchte, seinen Ekel zu überwinden und schlug die Taschenlampe gegen die Betonwand, um die Ratten zu verscheuchen, die in der durch die Enthauptung entstandenen Öffnung wimmelten. Sie ließen sich aber nicht weiter davon stören und benagten gierig den Toten, rissen Fleischfetzen ab und verschlangen sie auf der Stelle.
Der Ohrhörer spuckte Jacinthes weit entfernt klingende Stimme aus, während Victor mit dem Lauf der Glock herumfuchtelte, um ein paar Ratten zu vertreiben, bis er schließlich die Schulter des Toten so lange genug von den Tieren befreien konnte, dass er die mit Abzeichen geschmückte Paradeuniform des Toten erkannte. Victor stöpselte den Hörer in sein Ohr und unterbrach seine Kollegin, die ihn mit einer Litanei an Vorwürfen überschüttete.
»Jacinthe?«
»Was zum Teufel treibst du da unten? Mit wem hast du …«
Er schnitt ihr kurzerhand das Wort ab.
»Hier liegt die Leiche des Commandant. Die Ratten fressen ihn gerade.«
Jacinthe schwieg einen Augenblick.
»Bist du sicher, dass es nicht der Weihnachtsmann ist?«, fragte sie dann.
Paradeuniform und Enthauptung ließen keinerlei Zweifel an der Identität des Toten. Genau das wollte er Jacinthe gerade mitteilen, als ihn eine Welle der Übelkeit überkam und sein Magen sich von neuem verknotete. Diesmal konnte er sich nicht zurückhalten. Er wandte sich ab, um den Tatort nicht zu verunreinigen und erbrach sich ins Wasser.
Als er nach der Zigarettenpackung in seiner Tasche tastete, fiel der Strahl seiner Taschenlampe auf die Betonwand. Er kniff die Augen zusammen, aber sein erster Eindruck hatte ihn nicht getäuscht. Es stand tatsächlich dort.
»Scheiße«.
»Wo liegt das Problem? Los, erzähl schon, Lessard.«
Dicht neben dem Toten schmückte ein gigantisches Graffiti die Betonmauer des Tunnels. Es war rechteckig und ungefähr zwei Meter breit. Ein Skelett mit smaragdgrünen Augen fixierte darauf einen Mann mit weißem Rauschebart und roter Weihnachtsmannmütze, der an ein mit Lichtern bestecktes Metallkreuz genagelt war. Einen Augenblick lang starrte Victor mit offenem Mund auf das Machwerk. Makaber, verstörend und dennoch irgendwie ergreifend. Ohne auf die Stimmen seiner Kollegen zu hören, betrachtete der Polizist die Wandmalerei einige Sekunden lang. Dann wirbelte er herum und jagte so schnell in Richtung Ausgang davon, dass mit jedem Schritt eine Wolke aus Gischt aufsprühte.
»Sie sind am Mont Royal, Jacinthe.«
Die Schicksalsfrage der Menschheit scheint mir zu sein, ob und in welchem Maße es ihrer Kulturentwicklung gelingen wird, der Störung des Zusammenlebens durch den menschlichen Aggressions- und Selbstvernichtungstrieb Herr zu werden. (…) Die Menschen haben es jetzt in der Beherrschung der Naturkräfte so weit gebracht, dass sie es mit deren Hilfe leicht haben, einander bis auf den letzten Mann auszurotten.
Sigmund Freud
49.Das schwarze Zimmer
»Nein! Ich will es aus Ihrem eigenen Mund hören!«
»Die Angst ist das reinste und aufrichtigste Gefühl. Sie lässt sich mit nichts anderem vergleichen. Im Leid und im Schmerz zeigen sich die edelsten Eigenschaften des Menschen. Sind Sie jetzt zufrieden? Möchten Sie noch mehr darüber hören?«
»Nein, nicht nötig.«
»Wie Sie wollen. Sie entscheiden selbst, wann Sie ein neues Kapitel aufschlagen.«
»Und das heißt?«
»Das heißt gar nichts.«
»Halten Sie sich vielleicht für etwas Besseres? Warum sind Sie Lehrer geworden?«
»Und warum sind Sie ein Versager?«
»Man sagt Ihnen nach, Sie hätten im Unterricht Alkohol getrunken, den Sie in Milchpackungen umgefüllt haben. Ganz schön jämmerlich, finden Sie nicht?«
»Die Leute reden viel, wenn der Tag lang ist. Und sobald etwas ihr Verständnis übersteigt, greifen sie gern auf Hilfskonstruktionen zurück. Aber bleiben wir beim Thema. Ich gestehe offen, dass die Symbolik, die Sie eingesetzt haben, mich beeindruckt hat. Eine gelungene Verschleierungstaktik.«
»Der Vorschlag, ihnen einen Orientierungspunkt anzubieten, etwas Absehbares, stammt von Ihnen. Sie sagten, ich solle ihnen das geben, was sie erwarten und eine Art Mechanismus bedienen …«
»Jedenfalls haben Sie es geschafft, dass sie Ihnen aus der Hand fressen. Aber Sie haben meine Frage noch nicht beantwortet: Sind Sie der Ansicht, manche Menschen hätten den Tod verdient?«
»Ich versuche, nicht darüber nachzudenken.«
»Na los … Sie halten es doch für gerechtfertigt, sobald ein triftiger Grund vorliegt?«
»Ja, das denke ich.«
»Sind Sie der Meinung, dass der Wunsch, etwas Gutes zu bewirken, eine solche Rechtfertigung wäre? Und dass jemand, der etwas Abscheuliches im Dienst der guten Sache oder höherer Interessen wegen begeht, kein Monster ist?«
»Ich weiß, wer ich bin. Hören Sie …«
»Nein, jetzt hören Sie mir zu! Glauben Sie wirklich, Sie würden sich von den anderen unterscheiden? Halten Sie sich allen Ernstes für etwas Besonderes? Meinen Sie, die Kriminellen in Handschellen, deren Fotos die Titelseiten schmücken, seien Gesindel, mit dem Sie nichts gemein haben? Falls Sie das denken, irren Sie sich. Diese Leute haben dieselbe Eingangstür benutzt wie Sie, und was sie anschließend gesehen haben, hat Sie daran gehindert umzukehren. Inzwischen wissen Sie es selbst am besten: Wer einmal im schwarzen Zimmer war, für den gibt es keinen Weg zurück. Wenn Sie das nächste Mal eine Zeitung aufschlagen, sehen Sie sich die Fotos genau an. Denken Sie tatsächlich, Sie würden dort den Teufel in Menschengestalt sehen oder die Fratze des Bösen? Aber nein, natürlich nicht! Wenn Sie die Fotos aufmerksam betrachten, werden Sie auf den Gesichtern nichts anderes sehen als Erleichterung. Die Erleichterung eines Menschen, der den Kampf gegen seine Urinstinkte aufgegeben hat.«
»So wie Sie?«
»Man erzählt sich vieles. Und verschweigt ebenso vieles. Jeder strickt an seiner eigenen Legende, aber wir sind eben allesamt notorische Lügner. Wir heben bestimmte Erinnerungen hervor, schmücken sie aus, verleihen ihnen mehr Glanz. Langweilige und unbedeutende Ereignisse verwandeln sich mit einem Mal in strahlende, unvergessliche Momente, weil die Erinnerung im Lauf der Zeit die Wirklichkeit vergrößert. Vor allem aber ist in jedem von uns jenes schwarze Zimmer, in unserem tiefsten Inneren, in den Eingeweiden unseres Bewusstseins, und dort, hinter doppelt gesicherten Türen, sperren wir sie ein: Unsere Arrangements, unsere Lügen, unsere Halbwahrheiten. Denn sie könnten uns ja daran hindern, vorwärtszukommen, oder uns dazu zwingen, so sehr wir ihnen auch auszuweichen versuchen, unserem wahren Selbst ins Auge zu sehen, in seiner ganzen umfassenden, prächtigen Scheußlichkeit und Reinheit …«
Erster Tag
(Montag, 15. Juli)
2.Weiße Farbfächer
Schon an der Eingangstür des Hobbymarktes schlug Victor ein Schwall eiskalter Luft der Klimaanlage entgegen. Er trat ein und begrüßte den Angestellten. Der Mann mit dem zerfurchten Gesicht und den blutunterlaufenen Augen erkannte ihn sofort und erwiderte das Lächeln. Das war ein Vorteil der kleinen Läden des Viertels: Die Auswahl war zwar begrenzt, aber man wurde persönlich bedient. Die beiden Männer hatten sich vor rund zwei Monaten kennengelernt und gemeinsam eine Zigarette auf dem Bürgersteig vor der Auslage geraucht. Der Polizist lief den Gang entlang und blieb vor dem Verkaufsständer mit den Farbfächern stehen.
Während er sie durchblätterte, trat der Angestellte zu ihm und eröffnete das Gespräch mit seinem Lieblingsthema.
»Bei der Luftfeuchtigkeit wird es heute Nachmittag bestimmt 40 Grad heiß.«
Montréal erlebte gerade eine der schlimmsten Hitzewellen der letzten Jahrzehnte. Ohne sich umzudrehen erwiderte Victor:
»Anscheinend soll es die ganze Woche über so bleiben.«
Der Mann lachte auf.
»Im Sommer zu heiß, im Winter zu kalt … es gibt immer was zu meckern, stimmt’s? Und Sie wollen renovieren?«
»Wir haben uns in Terrebonne eine Maisonette-Wohnung gekauft. Ein neuer Anstrich könnte nicht schaden.«
»Suchen Sie eine bestimmte Farbe?«
Victor lächelte verschmitzt und zwinkerte dem Angestellten zu.
»Das dürfte nicht allzu schwierig werden. Wir streichen nämlich alles weiß.«
»Theoretisch klingt das einfach, aber in der Praxis hängt es ganz davon ab …«
Der Sergeant-Détective runzelte die Stirn.
»Wovon hängt es ab?«
Der Angestellte pustete sich eine Strähne aus der Stirn.
»Na ja, es gibt sehr viele verschiedene Weißtöne.«
Victor tippte auf das erste beste weiße Farbmuster und las die Artikelbezeichnung:
»Polar Bear 1875. Genau das Richtige.«
»In Ordnung. Und wie viel brauchen Sie?«
In Victors Augen trat ein Ausdruck leiser Verzweiflung.
»Wie viel benötige ich denn, Ihrer Meinung nach?«
»Für welches Zimmer?«
»Na, für alle Zimmer.«
Der Angestellte schmunzelte nachsichtig.
»Also, erst mal muss ich natürlich wissen, wie viel Quadratmeter das sind.«
Der Polizist machte ein finsteres Gesicht.
»Ein ganz normales Apartment eben. Drei Zimmer, Arbeitsraum und so.«
»Und wie soll ich den Farbverbrauch berechnen, wenn ich nicht weiß, wie viel Wandfläche gestrichen werden soll?«
Darauf wusste Victor auch keine Antwort. Der andere fuhr fort:
»Streichen Sie auch die Decken?«
Der Sergeant-Détective nickte.
»Dann brauchen Sie auch Deckenfarbe, nicht wahr?«
Victor fischte das Handy aus der Tasche und las die Textnachricht, die gerade eingetroffen war. Dann tippte er: »In 30 min da.«
»Ich muss los, aber ich werde einfach meine Freundin bitten, Ihnen die genauen Abmessungen telefonisch durchzugeben. Und Sie machen dann alles genau so, als würden Sie Ihre eigene Wohnung streichen, einverstanden?«
Was für Victor der reinste Hindernis-Parcours war, würde Nadja im Handumdrehen regeln. Er fragte sich ohnehin, aus welchem Grund sie ausgerechnet ihn gebeten hatte, die Farbe zu kaufen. Woher der plötzliche Vertrauensbeweis? Bei handwerklichen Tätigkeiten war ihm seine Liebste nämlich haushoch überlegen. Noch dazu besaß sie drei Werkzeugkästen, während er selbst bloß einen Hammer, ein Maßband, das nicht mehr von selbst aufrollte, und ein paar altersschwache Schraubenzieher sein Eigen nannte. Es war keine Überraschung, dass sie bereits die Renovierung der Küche übernommen hatte und die nötigen Handwerker organisierte.
Der Angestellte kratzte sich am Kopf.
»Ähh … okay.«
»Ich komme dann heute Abend nach der Arbeit vorbei und hole alles ab.«
»Brauchen Sie noch Pinsel oder Farbroller?«
Victor war bereits an der Ladentür. Er blieb stehen und warf einen Blick über die Schulter.
»Eine Grundausrüstung wäre prima. Wir sind ja keine Profis.«
Ohne die Antwort abzuwarten, trat er hinaus in die glühende Sonne. Die Hitze stand kompakt vor ihm wie eine Wand.
Victor ging über den Parkplatz am Place Versailles, Standort des Dezernats für Kapitalverbrechen und von den Polizisten kurz als »Versailles« bezeichnet. Nur das geübte Auge hätte sein leichtes Humpeln erkannt – die Folge eines Unfalls bei einer früheren Ermittlung. Die frisch angezündete Zigarette zwischen seinen Lippen zitterte. Kurz vor der gläsernen Eingangstür nahm er einen letzten Zug und trat sie mit den abgenutzten Profilsohlen seiner blauen Sportschuhe aus. Im Gehen zog er ein Fläschchen Purell aus der Tasche, gab ein wenig Gel in seine Hand und rieb sich Hände und Wangen damit ein. Der desinfizierende, leicht alkoholische Geruch stieg ihm in die Nase und prickelte auf seiner Haut.
Victor durchquerte die Ladenpassage des Einkaufszentrums und blieb nur stehen, um sich einen koffeinfreien Kaffee zu gönnen und Kaugummi zu kaufen. Im leeren Aufzug riss er das Päckchen auf und schob sich zwei Kaugummistreifen in den Mund. Der Spiegel warf sein athletisches, einen Meter neunzig großes Abbild zurück: stoppelkurze Haare, grüne Augen, Dreitagebart, energisches Kinn. Die Adern an seinen muskulösen Oberarmen zeichneten sich deutlich ab, und er trug ein dunkelblaues Poloshirt und Jeans.
Auf dem Weg zu seinem Schreibtisch stopfte er sich vier weitere Kaugummis in den Mund, und sobald er aufhörte zu kauen, beulte sich seine Wange unnatürlich aus. Unterwegs kam er an dem noch leeren Arbeitsplatz von Gilles Lemaire vorbei. Auf dem Schreibtisch stand ein wackelig aussehender Turm aus Kaffeepappbechern. Lemaire, von seinen Kollegen nur »der Gnom« genannt, hielt geradezu manisch auf Ordnung und Sauberkeit und würde bei seiner Rückkehr aus den Ferien wahrscheinlich außer sich vor Entsetzen sein, wenn er das »Kunstwerk« seiner Kollegen vorfand.
Victor drehte eine Runde durch das Großraumbüro und sah auf seine Uhr. Loïc Blouin-Dubois und Jacinthe Taillon glänzten durch Abwesenheit. Überhaupt fand er es seltsam, dass noch niemand hier war. Dabei hatte ihm seine Partnerin doch vor dreißig Minuten geschrieben, sie warte auf ihn, um mit ihm gemeinsam den Abschlussbericht der letzten Ermittlung durchzugehen.
Vor einigen Wochen hatte eine Fünfunddreißigjährige namens Patricia Chávez ihren Mann mit einer Blankwaffe getötet.
Am Tatort hatten Jacinthe und Victor mit den Technikern der Spurensicherung vermutet, dass rund fünfzigmal auf das Opfer eingestochen worden sein musste, aber die Laboranalyse hatte gezeigt, dass die Anzahl der Verletzungen noch weit höher lag; Jacob Berger, der Gerichtsmediziner, hatte am Ende zweifelsfrei hundertachtzehn »mit einem Küchenmesser ausgeübte« Stichverletzungen festgestellt, und zwar hauptsächlich am Hals des Opfers.
Obwohl der Sergent-Détective Patricia Chávez alle Möglichkeiten offengelassen hatte, ihre Tat zu erklären, hatte sie die Fakten zwar nicht bestritten, jede weitere Aussage jedoch verweigert und unentwegt wiederholt, er könne ihre Motive ohnehin nicht verstehen. Kurz vor Ende der Vernehmung hatte sich Victor vorgebeugt und etwas ins Ohr der Tatverdächtigen geflüstert. Sie hatte daraufhin genickt. Und obwohl Jacinthe ihn anschließend mit Fragen nur so löcherte, verriet er ihr nicht, was er damals zu Chávez gesagt hatte.
»Das betrifft nur sie und mich«, hatte er geantwortet, und mehr war nicht aus ihm herauszukriegen.
Aufgrund der Zeugenaussagen von Familie und Nachbarn hatten die beiden Beamten ermittelt, dass es zwischen dem Ehepaar regelmäßig zu Streitigkeiten gekommen war. Keine der Aussagen hatte allerdings auch nur ansatzweise darauf hingedeutet, dass dabei körperliche Gewalt im Spiel gewesen war.
Das Ehepaar hatte einen sechsjährigen Sohn, der schlief, während sein Vater getötet worden war. Am Abend nach dem Mord hatte Victor den Jungen zum ersten Mal getroffen und war ihm während der darauffolgenden Ermittlung mehrmals begegnet. Victor, der einzige Überlebende einer Familientragödie, bei der sein Vater, seine Mutter und seine beiden Brüder getötet hatte, bevor er sich selbst das Leben nahm, hatte sofort großes Mitgefühl mit dem Kleinen empfunden. Er wusste nur zu genau, dass der Junge, während er heranwuchs, nicht nur mit dem Verlust des Vaters zurechtkommen musste, sondern auch in dem Wissen, dass ein Elternteil ein Monster war.
Der Junge wurde zuerst im Krankenhaus beobachtet und anschließend der Obhut des Jugendamtes übergeben. Im besten Fall würde er nach einer Beobachtungsphase und dem abschließenden Gutachten des Jugendamtes bei einem Mitglied der Familie leben. Für Victor hatte es diese Möglichkeit damals nicht gegeben.
Der Polizist steuerte auf den Besprechungsraum zu. Die Tür war geschlossen, aber vielleicht wartete Jacinthe ja hier auf ihn. Er öffnete die Tür, doch es brannte kein Licht. Er knipste es an, um festzustellen, ob seine Kollegin das Dossier von Chávez vielleicht für ihn auf den Tisch gelegt hatte. Licht erstrahlte, gleichzeitig brandeten Hochrufe auf, und mit einem Mal geriet sein Herzschlag völlig aus dem Takt.
3.Ein Problem
»Herzlichen Glückwunsch!«
Lächelnd bauten sich Jacinthe, Nadja und Loïc vor Victor auf, der wie angewurzelt in der Tür stehen geblieben war. Er brauchte einen Augenblick, um zu begreifen, was er vor sich sah: Auf dem Tisch lag eine viereckige eingepackte Schachtel, rote Luftballons schwebten neben der Plexiglastafel, an die sie Fotografien und Unterlagen der laufenden Ermittlungen hefteten.
»Ihr habt mich vielleicht erschreckt! Und außerdem hab ich heute gar nicht Geburtstag!«
Jacinthe fuhr sich durch das kurz geschnittene Haar.
»Du Unschuldslamm! Das ist doch das Geniale! An deinem Geburtstag können wir dich ja wohl kaum überraschen!«
Victor musste unwillkürlich lächeln. Inzwischen hatte er sich an den Sarkasmus seiner Partnerin gewöhnt. Und während der langen Auszeit, die sie genommen hatte, um eine Motorradtour durch Kanada und die Vereinigten Staaten zu machen, hatte sie ihm tatsächlich gefehlt. Jacinthe war nicht nur besonders grob, sondern ihr brannten auch schnell mal die Sicherungen durch. Und seit sie mit ihrer Diät begonnen und inzwischen schon rund fünfzehn Kilo abgenommen hatte, ging sie noch häufiger als früher in die Luft.
Kopfschüttelnd musterte Victor nacheinander seine Kollegen.
»Ihr … ihr habt wirklich ein Rad ab!«
Mit eisernem Griff packte Jacinthe ihn bei der Schulter, zog ihn an sich und drückte ihm knallende Küsse auf die Wangen.
»Alles Gute, Lessard!«
»Danke, Jacinthe.«
»Ach, und übrigens, dein Fünfzigster rückt näher.«
»Immer mit der Ruhe, ich bin schließlich erst knapp Mitte vierzig.«
Loïc, der sein langes blondes Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden hatte, löste die verschränkten Arme und reichte Victor die Hand, der sie herzlich schüttelte.
»Alles Gute, Chef.«
»Danke, Kid.«
Loïc hörte auf zu kauen und blies eine gewaltige Kaugummiblase, die mit saftigem Ploppgeräusch zerplatzte und als Fetzen an seiner Nase kleben blieb. Obwohl er sehr jung wirkte, war er beinahe dreißig Jahre alt. Er hatte vorher als verdeckter Ermittler im Sitten- und Drogendezernat gearbeitet und eine Weile gebraucht, bis er seinen Platz im Team gefunden hatte; Seite an Seite mit seinem Partner Gilles Lemaire hatte sich Loïc inzwischen zu einem wertvollen Mitarbeiter der Abteilung gemausert.
Victor tauschte einen verschwörerischen Blick mit Nadja Fernandez, seiner Freundin.
»Alles Gute, mein Schatz.«
Das Haar, schwarz wie Ebenholz, fiel ihr in lässigen Wellen über die Schultern, und der kupferfarbene Teint verriet ihre südamerikanischen Wurzeln. Als sie ihn verführerisch anlächelte, blitzte eine Reihe perlweißer Zähne auf. Nadja war zwölf Jahre jünger als er, und ihre Schönheit verschlug ihm den Atem.
Im vergangenen Jahr hatte es in der Beziehung ziemlich gekriselt, denn Victor hatte Nadjas Bruder wegen einer finsteren Geschichte, die seinen Sohn Martin betraf, die Nase gebrochen. Aber inzwischen war die Sache beigelegt. Natürlich hatten sie im Lauf der Zeit die Fehler am anderen kennengelernt, die anfangs nicht so deutlich gewesen waren, aber sie waren verliebter als je zuvor.
»Jetzt verstehe ich auch, warum du mich heute Morgen in das Eisenwarengeschäft geschickt hast.«
Victor nahm seine lachende Freundin in den Arm und küsste sie. Es war eine schöne Überraschung, dass sie ebenfalls mit von der Partie war. Eigentlich hätte sie im 11. Revier sein sollen, wo sie nach wie vor als Ermittlerin für Commandant Tanguay arbeitete, mit dem Victor in der Vergangenheit schon mehrfach aneinandergeraten war. So leise, dass niemand sonst es hörte, flüsterte sie in sein Ohr:
»Dein neues Parfüm riecht einfach toll, Schatz. Fast wie eine Mischung aus Tabak und Purell.«
Victor senkte den Blick. Bei jedem Rückfall und ganz gleich, welche Vorsichtsmaßnahmen er traf, Nadja wusste immer Bescheid, wenn er heimlich geraucht hatte. Die Akupunktur hatte anfangs recht gut gewirkt, aber seine Angstattacken hatten ihn allmählich wieder zur Zigarette greifen lassen. Seit einigen Monaten rauchte er phasenweise, hatte sich aber geschworen, es einmal mit den elektronischen Zigaretten zu versuchen, die sie ihm geschenkt hatte.
Jacinthe hatte unterdessen angefangen, gleichmäßig in die Hände zu klatschen, was gleichzeitig begeistert und entnervend klang.
»Na schön! Und jetzt setz dich mal, es ist Zeit fürs Geschenk.«
Als er Platz genommen hatte, nahm sie eine auf dem Stuhl liegende Plastiktüte, holte eine rechteckige Schachtel heraus und legte sie auf den Tisch vor ihn. Die Schachtel war sorgfältig in Geschenkpapier eingepackt. Neugierig hob er sie an, prüfte das Gewicht, hielt sie ans Ohr, schüttelte sie und lauschte. Er musterte seine Freunde gespannt.
Nadja legte ihm eine Hand auf den Arm.
»Jacinthe hat sich darum gekümmert …«
Victor zog den Kopf zwischen die Schultern und schnitt eine Grimasse.
»Komisch, ich krieg plötzlich Angst. Ich hab echt keine Ahnung, warum …«
Ein Faustschlag landete auf seiner Schulter, ausgeführt von seiner Teamkollegin.
»He, lass den Quatsch.«
Gelächter. Victor riss das Papier auf, ohne weiter Zeit zu verschwenden. An einer Seite der Schachtel stand der Name eines Sportschuhherstellers. Als er den Deckel anhob, schien ein Leuchten vom Inhalt der Schachtel auszugehen und sich auf seinem Gesicht auszubreiten.
»Waaas? Ein Paar Converse?«
Er nahm die Schuhe in die Hände und drehte sie bewundernd.
»Und auch noch aus rotem Leder! Die sind ja wunderschön.«
Jacinthe, zufrieden mit der Wirkung des Geschenkes, warf sich stolz in die Brust.
»Freut mich, dass sie dir gefallen.«
»Und das Geschenk hast wirklich du gekauft, Jacinthe?«
Sie zwinkerte Nadja zu.
»Na ja, das ist nicht ganz allein auf meinem Mist gewachsen, wir haben alle zusammengelegt.«
»Wow. Danke! Ich bin total überwältigt.«
»Keine Ursache. Die Karte kriegst du später, die hab ich im Auto vergessen.«
Vornübergebeugt zog Victor seine Sportschuhe aus und schlüpfte in die neuen Converse.
»Größe 12 … Passen wie angegossen.«
Gerührt stand er auf und bedankte sich erneut bei seinen Kollegen. Nachdem er alle umarmt hatte, frotzelten sie ein bisschen herum, und dann verkündete Jacinthe den nächsten Programmteil.
»Los, auf geht’s! Wir haben einen Tisch bei Cora bestellt, neben dem Stadion.«
»Echt?«
»Und ob, Monsieur! Du hast VIP-Status. Very Important Penis!«
Wieder brach Gelächter aus. Victor griff nach der eckigen Schachtel, die er beim Eintreten auf dem Tisch liegen sehen hatte.
»Was ist das hier eigentlich?«
»Weiß ich nicht. Kid hat es mitgebracht.«
Loïc schob den Stuhl zurück und stand langsam auf, während er die Nachrichten auf seinem Handy überprüfte.
»Das war heute Morgen in der Post.«
Jacinthe verdrehte die Augen und schüttelte den Kopf.
»Das kannst du noch früh genug öffnen, Lessard. Komm schon, ich hab Kohldampf.«
Aber die Neugier hatte bereits die Oberhand gewonnen. Mit dem Autoschlüssel zerriss Victor das Klebeband am Deckel.
»Warte mal, das ist ja interessant. Da steht kein Name drauf.«
Jacinthe hielt bereits ihren Rucksack in der Hand.
»Ich sage doch ständig, dass wir Pakete nicht selbst öffnen sollen. Irgendwann ist noch mal eine Bombe drin, Anthrax oder eine noch schlimmere Schweinerei.«
Loïc hielt Nadja die Tür auf.
»Das wäre eine komische Verpackung für Anthrax. Ich finde, es sieht eher aus wie ein Basketball.«
In der Schachtel lag etwas Rundes, eingepackt in Luftpolsterfolie. Victor nahm es heraus und nickte zustimmend.
»Ein Basketball? Dafür ist es aber ganz schön schwer … Fang mal!«
Loïc streckte die Hände aus, als Victor zum Wurf ausholte. Ein Handy klingelte. Jacinthe zog sich in eine Ecke des Raumes zurück, um den Anruf entgegenzunehmen. Nachdem Victor den Klebestreifen von der Folie abgezogen hatte, entfernte er sie und bemerkte, dass sich in der Verpackung ein Schild befand. Das Erste, was ihm auffiel, war das Wort »Ukraine«, das in Türkis auf dem geprägten Papier stand.
Nadja war an der Tür stehen geblieben und warf ihm jetzt einen fragenden Blick zu.
»Was ist es denn?«
Victor wickelte die Folie komplett ab und hielt das Objekt über seinen Kopf.
»Ein Globus!«
Loïc schob die Daumen in den Gürtel und zog sich die zerlöcherten Jeans hoch.
»Das hat Gilles im Internet bestellt, als Deko für seinen Schreibtisch.«
Jacinthe hatte inzwischen das Gespräch beendet und kam mit ernstem Gesicht zu ihnen zurück.
»Mir ist jedenfalls der Appetit vergangen.«
Wenn Victor eines genau wusste, dann, dass etwas Wichtiges geschehen sein musste. Obwohl seine Partnerin Protein-Diät hielt, gab es nicht viel, was ihr den Appetit verderben konnte.
»Was ist los?«
»Wir haben ein Problem.«
Nadja trat in den Flur hinaus.
»Ich lasse euch lieber allein.«
»Nein, bleib hier, Nadja. Das betrifft dich auch. Gerade hat Nadeau vom 38. Revier angerufen. Ein Pärchen hat in einem Container mit Bäckereiabfall einen Kopf gefunden.«
Victor runzelte die Stirn.
»Und wo?«
»In einer Seitenstraße der Rue Duluth.«
Er hob die Schultern. Das klang ebenso finster wie tragisch, aber als Polizist musste man auf alles gefasst sein.
»Und was genau ist das Problem?«, fragte er.
»Das Opfer wurde bereits identifiziert.«
»Und wer ist es?«
Jacinthe blickte sie der Reihe nach an.
»Tanguay. Commandant Maurice Tanguay.«
4.Die Mülltaucher
Die pralle Sonne spiegelte sich auf den Motorhauben der Einsatzfahrzeuge, die die Kreuzung zwischen dem Boulevard Saint-Laurent und der Avenue Duluth absperrten. Und an der Ecke der Rue Saint-Dominique und Napoléon bot sich genau der gleiche Anblick. Absperrbänder hinderten die Fußgänger daran, auf dem Bürgersteig weiterzugehen. Im flackernden Warnlicht schirmten die Polizisten den gesicherten Bereich vor Schaulustigen ab. Falls es sich nicht bereits herumgesprochen hatte, würde das Gerücht sich in Windeseile verbreiten: In einem Abfallcontainer hatte man einen Kopf entdeckt. Deutlich mehr Polizeibeamte als sonst waren zum Einsatz abkommandiert worden. Das war immer dann der Fall, wenn ein Polizist getötet worden war. Die Polizei ist eine Gemeinschaft. Wird einer von ihnen im Dienst getötet, rückt das Rudel zusammen und schließt die Reihen.
Auf dem Straßenabschnitt, in dem sich der Container befand, wimmelte es nur so von Technikern der Spurensicherung. Noch bevor Jacinthe und Victor dort ankamen, hatten sie die Schachtel mit dem Kopf in Eis gelagert und ins Labor des Gerichtsmediziners Jacob Berger in die Rue Parthenais bringen lassen. Berger, mit dem die beiden Ermittler häufig zusammenarbeiteten, war bereits mit der Autopsie beschäftigt.
Eine junge Frau saß an der Bürgersteigkante und beantwortete seit kurzem die Fragen des Sergent-Détective. Sie war ungefähr zwanzig Jahre alt, trug weinrote ziemlich abgewetzte Doc Martens, einen schwarzen Taftrock und ein Hemd in den Farben des Vereinigten Königreiches.
»Mein Freund und ich gehen kein Risiko ein, Fleisch und Milchprodukte rühren wir nicht an. Normalerweise ist der Container hier einer der besten Plätze. Bäckereiabfall ist am saubersten. Alles, was sie tagsüber nicht verkaufen, packen sie in eine Tüte. Sonst nichts. Sie wissen, dass wir vorbeikommen.«
Eine Laufmasche in ihren roten Strumpfhosen gab den Blick auf ein Stück ihres Knies frei; offenbar hatte sie geweint, ihre mit Khôl umrandeten Augen waren schwarz verschmiert, und als sie sich die Augen wischte, hatte sie die restliche Schminke über ihr bleiches Gesicht verteilt.
»Die Eigentümer der Bäckerei sind Portugiesen … Sie lassen uns die Brioches, Kuchen, und manchmal ist sogar frisches Brot in der Tüte. Das schmeckt super. Als ich die Schachtel gesehen habe, dachte ich erst, da sei ein Kuchen drin.«
Den makabren Fund hatte das junge Pärchen im Container hinter der Bäckerei gemacht, in der Rue Duluth. Jacinthe befragte den jungen Mann, während Victor sich mit seiner Freundin unterhielt.
»Weißt du noch, ob du Fliegen bemerkt hast, als du die Schachtel geöffnet hast?«
Er hatte ihr eine Zigarette angeboten, die jetzt zwischen den Fingern der jungen Frau zitterte, als sie sie an den Mund führte. Sie nahm einen Zug.
»Nein«, erwiderte sie mit erstickter Stimme, »weder im Container noch in der Schachtel. Wenn Fliegen dran sind, lassen wir die Hände davon.«
Sie starrte auf den Boden zwischen ihren Stiefelspitzen, öffnete den Mund, als wollte sie etwas sagen, und klappte ihn dann wieder zu. In ihren weit aufgerissenen Augen schimmerten Tränen. Beruhigend legte ihr Victor eine Hand auf den Arm.
»Lass dir Zeit, Miranda. Kein Problem.«
Sie holte tief Luft.
»Am schlimmsten ist, dass ich es zuerst nicht mal so besonders eklig fand. Ich habe ganz instinktiv reagiert, noch bevor ich überhaupt kapiert habe, was ich da sehe. Ich wusste, dass irgendwas nicht stimmt, aber erst nachdem ich die Schachtel wieder zugemacht habe, wurde mir klar, was da drin ist.«
Schweigend wartete Victor, bis sie weitersprach. Miranda trat die Zigarette mit dem Schuh aus. Dann hob sie den Kopf und sah ihm direkt in die Augen.
»Allein der Gedanke, dass ein Mensch einem anderen so was antut. Ich … ich kann es einfach nicht fassen, nicht verstehen. Ich habe immer gedacht, Leute, die so verrückt sind, würden nur im Film vorkommen, nicht in meiner Welt. Nicht direkt vor meiner Nase. Wenn ich mir vorstelle, es könnte jemand gewesen sein, dem ich schon auf der Straße begegnet bin, wird mir richtig schlecht.«
Victor nickte. Miranda erinnerte ihn an Charlotte, seine Tochter. Am liebsten hätte er sie in den Arm genommen und getröstet, ihr gesagt, dass einer, der zu dicht am Abgrund stand, Gefahr lief abzustürzen; er hätte ihr leise von den alten Gesetzen der Welt erzählt, die so ungerecht und erbarmungslos waren, hätte ihr zugeraunt, dass nichts existierte, dass alles existierte. Victor wusste, wie gerade jene Bilder, die man angestrengt zu vergessen suchte, immer wieder aufs Neue auftauchten, beschmutzt von der Zeit und den Erinnerungen. Im Unterschied zu der jungen Frau hatte sich Victor jedoch längst an diese Bilder gewöhnt.
»Weißt du, Miranda, niemand dürfte je so etwas sehen wie das, was ihr beide in dieser Schachtel entdeckt habt. Und jetzt möchte ich, dass du zusammen mit deinem Freund nach Hause gehst. Vergesst alles, was ihr erlebt habt und versucht, auf andere Gedanken zu kommen.«
Sie starrte vor sich hin und nickte. In der Straße waren Motorengeräusche zu hören, Autotüren fielen zu. Weitere Einsatzfahrzeuge waren eingetroffen.
»Außerdem möchte ich dir ein Versprechen abnehmen«, fuhr Victor fort.
»Ein Versprechen?«
»Ja. Sobald du wieder an diese furchtbaren Bilder denken musst, stellst du dir stattdessen einfach ein Flusspferd vor. Versprich mir das.«
Sie musterte ihn fragend mit zusammengeschobenen Brauen, wurde aber nicht recht schlau aus seiner Miene. Dann lächelte sie zaghaft.
»Ein Flusspferd?«
Mit aufgeblasenen Backen und ausgebreiteten Armen verdeutlichte Victor, was er meinte.
»Ja, genau, ein Flusspferd.«
Miranda lächelte über das ganze Gesicht.
»In Ordnung.«
»Versprochen?«
Sie nickte bekräftigend. Er reichte ihr seine Visitenkarte und bedachte sie zum Abschied mit einem väterlich besorgten Blick.
»Wenn dir noch was einfällt, rufst du mich sofort an, egal zu welcher Uhrzeit.«
Victor erhob sich und reichte ihr die Hand, um ihr beim Aufstehen zu helfen. Miranda bedankte sich, drehte sich um und ging in Richtung Bäckerei davon. Der Polizist schob sich die Ray-Ban auf die Nase und sah ihr nach, als sie zu ihrem Freund hinüberging, der bereits auf sie wartete, an die Mauer gelehnt und die Hände in den Taschen. Jacinthe hatte offenbar erheblich weniger Zeit für ihre Befragung gebraucht. Jetzt musste er seine Partnerin nur noch finden.
Zuerst hielt er in der Nähe des Streifenwagens Ausschau nach ihr und dann am Tatort, konnte sie aber nirgends entdecken. Blitzlichter flackerten durch die schmale Straße, als die Spurensicherung Aufnahmen des Müllcontainers und der direkten Umgebung machte. Rings um den Container waren an allen Objekten, bei denen es sich möglicherweise um Indizien handelte, nummerierte Markierungskegel platziert, unter anderem an zwei Dosen Farbspray, einer alten Socke, einer Kopfhörerverpackung sowie gebrauchten Batterien.
Victor umrundete das Gebäude und steuerte auf den Eingang der Bäckerei zu. An der Tür blieb er stehen und grinste spöttisch. An der Ladentheke deutete Jacinthe auf die kleinen Törtchen, die in einer Kühlvitrine lagen. Hinter der gläsernen Theke war der Besitzer des Ladens bereits eifrig damit beschäftigt, alles, was sie auswählte, in einer Schachtel anzuordnen. Als Victor näher kam, bezahlte sie gerade.
»Und deine Diät?«
Auf frischer Tat ertappt wich Jacinthe einen Schritt zurück, war aber gleich wieder obenauf und musterte ihn angriffslustig.
»Die sind natürlich für Lucie!«
Jacinthes Freundin, vegetarisch und asketisch lebend, war ein ebenso sanftmütiges wie geduldiges Wesen und arbeitete als Bibliothekarin in der Stadtbücherei. Victor hielt sich zwar mit einem Kommentar zurück, ließ sich aber nicht zum Narren halten: Lucie machte sich nichts aus Süßigkeiten.
Seine Teamkollegin beugte sich zu ihm vor und schnupperte bedeutungsvoll.
»Und selbst? Wieder heimlich gequalmt?«
»Das war ich nicht«, log er. »Miranda hat eine geraucht.«
Jacinthe grinste.
»Miranda? Ihr habt euch ja schnell angefreunde t… Ich wette, du hast ihr deinen berühmten Flusspferdtrick verraten.«
Victor überging den Spott.
»Und wie war’s mit ihrem Freund?«
»Na ja, der typische kleine Anarcho-Hipster vom Plateau. Hat mich total zugetextet. Solche Leute ertrag ich einfach nicht! Verdammt, was für Scheißtypen.«
Mit gesenkter Stimme fuhr sie fort: »Wir suchen uns das Essen doch nicht im Abfall zusammen, weil wir kein Geld haben, Mann. Nein, damit wollen wir zeigen, dass der beschissene Kapitalismus einfach versagt hat.«
Sie lachte etwas gekünstelt.
»Hast du eigentlich gewusst, dass es schon eine Bezeichnung für dieses Herumwühlen im Abfall gibt? Das nennt sich nämlich …«
Sie zog ihr Notizbuch aus der Tasche und fing auf der Suche nach dem Eintrag an zu blättern. Victor konnte helfen.
»Dumpster diving«, sagte er.
»Ach, du kennst das? Hm, wer so was macht, muss schon richtig scharf auf Ärger sein, oder?«
Victor zuckte die Schultern und verkniff sich die Antwort. Dass er die Idee ganz interessant fand, führte doch nur zu endlosen Diskussionen.
»Und sonst? Hast du den Besitzer der Bäckerei befragt?«
Sie nickte und rollte mit den Augen. Natürlich hatte sie sich den vorgenommen.
»Erst den Besitzer, dann seine Frau. Sie wohnen direkt über dem Laden. Er hat den Sack mit Abfall zwischen 23 Uhr und Mitternacht in den Müll geworfen und nichts Ungewöhnliches bemerkt. Anschließend hat er sich noch einen Film im Fernsehen angesehen und sich danach ins Bett gelegt. So gegen 1 Uhr morgens.«
»Welchen Film?«
Jacinthe zog einen verächtlichen Flunsch.
»Der Knüller, von Woody Allen. Hab ich schon überprüft, der lief gestern Abend tatsächlich im Kabelfernsehen. Am Morgen, als er den Laden öffnen wollte, hat er gehört, wie die beiden in der Straße herumschrien.«
»Wann war das?«
»Gegen 6 Uhr. Und während Monsieur Lessard Liebesbriefe an sein Schätzchen schreiben musste, habe ich Zeit genug gehabt, um auch gleich noch die Angestellten der Bäckerei zu befragen.«
Das Handy in Victors Tasche vibrierte. Nadjas Name stand auf dem Display. Widerstrebend ließ er die Nachricht in seine Sprachbox eingehen.
»Und weiter?«
»Das gleiche Lied: Nichts gesehen und nichts gehört.«
»Wer hat Tanguay erkannt?«
»Brown, von der Spurensicherung, er war als einer der Ersten hier. Der hat schon in Tanguays Abteilung gearbeitet. Was ist mit dir? Irgendwas Neues?«
»Sein Kopf hat mindestens 24 Stunden lang in dem Container gelegen.«
»Woher willst du das wissen?«
»Als Miranda die Schachtel geöffnet hat, waren keine Fliegen drin. Weißt du, was das bedeutet?«
Jacinthe zögerte.
»Hilf mir auf die Sprünge …«
»Soweit ich mich erinnere, hat Élaine Segato mir damals bei den Ermittlungen gegen den König der Fliegen erklärt, dass sich Fliegen schon nach wenigen Minuten über einen Kadaver hermachen, wenn er sich an der freien Luft befindet. Ist er jedoch mehr oder weniger hermetisch abgeschlossen gelagert, wie in der Schachtel und dem Container, kann es bis zu vierundzwanzig Stunden dauern, bevor Fliegen kommen.«
»Wenn mich mein Gedächtnis nicht im Stich lässt, war Élaine Segato doch diese Anthropologin, mit der du was hattest, oder?«
»Ich dachte, wir hätten uns darauf verständigt, solche Themen in Zukunft zu vermeiden? Und nebenbei bemerkt war Élaine Entomologin.«
Jacinthe grinste anzüglich.
»War ja nicht persönlich gemeint, Schätzchen. Und denk immer schön dran, dass Tante Jacinthe dir ein Paar tolle rote Converse zum Geburtstag geschenkt hat.«
»Und jetzt auch noch emotionale Erpressung?«
»Auf jeden Fall! Da kenne ich nichts.«
Sie wischte sich mit dem Daumen den Schweiß von der Lippe und fuhr fort: »Wenn das eine Folge von CSI wäre, würde ich dich jetzt fragen, ob nicht vielleicht das junge Pärchen selbst den Kopf in den Container gelegt hat.«
»Aber das ist eben nicht CSI. Das junge Mädchen hatte jedenfalls einen Schock, und diese Bilder werden sie für den Rest ihres Lebens verfolgen. Außerdem, welches Motiv sollten sie denn haben?«
»Was weiß ich. Sich ein Alibi verschaffen oder so?«
Schulterzuckend winkte Victor ab.
»Blödsinn. Neuigkeiten von Kid?«
Der Sergent-Détective hatte Loïc und einige Streifenpolizisten beauftragt, sich in der Nachbarschaft umzuhören, während er mit Jacinthe das Pärchen befragte. Er hoffte, dass sich dadurch Zeugen fanden, jemand, der irgendetwas Ungewöhnliches bemerkt hatte.
»Ich hab eben mit ihm gesprochen. Im Moment noch nichts. Er beschafft sich gerade die Aufzeichnungen der Überwachungskameras aus den Geschäften ringsum, aber meiner Ansicht nach wird das nicht viel bringen.«
»Warum nicht?«
»Keine davon war in der Seitenstraße.«
Jacinthe warf einen Blick über Victors Schulter und kniff dann die Augen zusammen.
»Aufgepasst, gleich gibt’s Ärger.«
5.Grant Emerson
Das von der Vergangenheit gezeichnete Gesicht des hochgewachsenen Mannes, der die Rue Notre-Dame Ouest im Viertel Saint-Henri heraufkam, wirkte älter als das eines Achtundsechzigjährigen. Eine erloschene Zigarre zwischen den Lippen lief Grant Emerson gesenkten Hauptes voran, vielleicht lag es an der Last seiner Phantome, dass er sich so gebeugt hielt. Sein Anzug, eine unförmige Hose und die Jacke mit durchgescheuerten Ellenbogen, hatte zwar schon bessere Tage gesehen, aber der Krawattenknoten war tadellos gebunden. Unter seinem Arm klemmte ein Stapel in Plastik eingeschweißter Werbezettel. Während die Sonnenstrahlen auf seinen Rücken brannten, stapfte er langsam voran, den schweren Rucksack über die Schulter geschlungen, und in den schrägen Schaufensterscheiben der Geschäfte spiegelte sich sein verzerrtes Abbild wider.
An einem Telefonmast blieb er stehen, holte einen Hefter aus seinem Rucksack und tackerte den Zettel an jeder Ecke fest. Anschließend trat Grant zurück und musterte kritisch sein Werk. Auf dem Zettel war das Schwarz-Weiß-Foto einer lächelnden jungen Frau zu sehen und darunter stand auf Englisch und Französisch:
Der SPVM, Service de police de la Ville de Montréal, bittet um die Mithilfe der Einwohner. Seit dem 15. Februar wird Myriam Cummings vermisst, 21 Jahre alt, weiß, 1,60 groß, Gewicht 45 kg; sie spricht sowohl französisch als auch englisch. Sie hat lange braune Haare und dunkelbraune Augen. Die Vermisste trug zuletzt einen schwarzen Wollmantel, Jeans, grüne Schuhe und eine Umhängetasche aus Leder. Möglicherweise hält sie sich noch im Raum Montréal auf. Falls Sie diese junge Frau sehen, rufen Sie bitte schnellstmöglich die Nummer 911 an.
Unzählige Male hatte Grant schon darüber nachgedacht, was sich an jenen Tagen unmittelbar vor dem Verschwinden Myriams zugetragen hatte und war irgendwann zu dem Schluss gekommen, dass er selbst ein Großteil der Verantwortung dafür trug. Nach jener schwierigen Phase, in der Myriam seine Gegenwart in ihrem Leben zunehmend schlechter ertrug und nach den darauffolgenden Monaten, als er wieder leise Hoffnung auf Versöhnung schöpfte, war sie plötzlich verschwunden. Grant machte sich Vorwürfe, zu starrsinnig, zu unnachgiebig gewesen zu sein; er konnte ja nicht ahnen, dass sein Verhalten dabei überhaupt keine Rolle gespielt hatte. Ein böses Schicksal, das jahrelang anderswo sein Unwesen getrieben hatte, verfolgte sie von neuem.
Myriam … er träumte oft von ihr, und in seinen Träumen erschien sie ihm noch kleiner und zerbrechlicher als in Wirklichkeit.
Grant nahm seine alte Nikon aus dem Rucksack und stellte sie geschickt ein. Digitalkameras kamen für ihn nicht infrage. Wie konnte sich jemand, der seine Negative nicht selbst entwickelte, überhaupt als Fotograf bezeichnen? Er kniff ein Auge zu, und im Sucher erschien die Anzeige, die er soeben am Mast befestigt hatte. Gerade als er im Begriff war, den Auslöser zu betätigen, traf ihn Myriams Lächeln wie ein Faustschlag in den Magen und zwang ihn innezuhalten.
Um sich seine Brötchen zu verdienen, hatte Grant früher als Kriminalfotograf gearbeitet. Einer der besten, wie es hieß, so gut, dass er während der großen Zeit der Zeitschrift Allô Police beinahe zu einer Legende geworden wäre. Aber eben nur beinahe, denn aus einer ganzen Reihe von Gründen hatte er damals angefangen, mehr zu trinken, als gut für ihn war, und Kokain zu schnupfen – und er hatte Anik kennengelernt.
Grant schüttelte sich aus seiner Erstarrung, stellte erneut den Sucher ein, machte ein Bild der Anzeige und hielt in seinem Notizbuch genau fest, wo sich der Telefonmast befand. In den vergangenen Wochen hatte er mehrere Viertel der Stadt durchstreift und die Suchmeldung überall in Montréal aufgehängt.
Er strich sich über den zerzausten Bart. Die vielen Zigarren hatten im Lauf der Zeit einen gelben Halbkreis in den weißen Haaren hinterlassen. Für die wenigen Passanten, die vorbeikamen, war er bloß ein Abgestürzter, einer der vielen armen Schlucker, die mit ihrem Leben nicht zurechtkamen und die Straßen von Montréal bevölkerten.
Erst in diesem Augenblick wurde ihm bewusst, dass ihn jemand beobachtete. Eine junge Frau auf der gegenüberliegenden Straßenseite sah voller Mitgefühl zu ihm herüber. Geblendet von der grellen Sonne hob Grant die linke Hand und stieß sie Richtung Himmel, als wollte er dem Feuerball dort oben einen Schlag versetzen.
Diese junge Frau, ihr Gesicht … ohne zu zögern, stürzte er auf sie zu und schwenkte aufgeregt die Arme.
»Myriam! Bist du’s, Myriam?«
Alles andere vergessend und wie von Sinnen lief Grant über die Straße. Dort stand Myriam, seine kleine Myriam, direkt vor ihm. Ein Auto streifte ihn leicht, hupte, ein anderes konnte ihn gerade noch rechtzeitig umkurven, aber immerhin kam er heil auf der anderen Straßenseite an. Die junge Frau, die er gesehen hatte, eilte auf ihn zu und hielt ihn stützend am Arm. Sein Atem ging schwer und laut.
»Monsieur … Monsieur, ist alles in Ordnung mit Ihnen?«
Grant legte seine zitternden Hände an die Wangen der jungen Frau und sah ihr in die Augen.
»Geht es Ihnen besser, Monsieur?«
Er musterte sie wie betäubt.
»Sie wären beinahe angefahren worden! Monsieur? Monsieur?«
Mit einem Schlag war er wieder zurück in der Wirklichkeit; er nickte zustimmend und lächelte angestrengt.
Als er sich zum Gehen wandte, verspürte er plötzlich das Bedürfnis, das Missverständnis aufzuklären.
»Entschuldige, meine Schöne … Ich habe dich mit jemandem verwechselt.«
In ein Selbstgespräch versunken, ging Grant die Rue Greene entlang und stieß die Tür zum Greenspot auf, einem rund um die Uhr geöffneten Schnellimbiss. Einige Stammgäste saßen an den langen Tischen, an deren Ende antiquierte Juke-Boxen prangten. Grant nahm an der Theke auf einem mit rotem Skai bezogenen Aluminiumbarhocker Platz und legte die Anzeige neben sich. Eigentlich hatte er zwar Lust auf einen Whiskey, entschied aber, dass es dafür noch zu früh war, und bestellte sich eine Cola, zwei Hot-dogs und eine Portion Pommes frites.
Der Kellner stellte die Dose und ein Glas mit Eiswürfeln vor ihm ab und schob einen Bierdeckel darunter. Grant schenkte sich ein und nahm einige Schlucke. Gedankenverloren kaute er auf seiner erloschenen Zigarre herum. Seit Myriam verschwunden war, hatte sich ein fester Tagesablauf bei ihm eingebürgert: Er brach früh am Morgen auf, lief bis zum Nachmittag durch die Straßen und hängte seine Suchanzeigen auf. Anschließend ging er kurz in ein Bistro oder eine Bar, wo er finster vor sich hin brütete. Dann kehrte er nach Hause zurück und rauchte seine spuckefeuchten Zigarrenstummel.
Auch der heutige Tag war nach genau demselben Muster verlaufen. Draußen war es noch warm, und an die Wand des Restaurants gelehnt, zündete sich Grant eine Zigarre an und betrachtete die Straße, die sich langsam belebte, während grüne Neonschrift die einsetzende Dunkelheit erhellte. Hin und wieder verschwand sein verwittertes Gesicht hinter einer Rauchwolke, während er mit der Fußspitze in dem achtlos weggeworfenen Papier auf dem Bürgersteig stocherte.
Einer plötzlichen Eingebung folgend wechselte er dann die Straßenseite und ging die Rue Greene hinunter Richtung Marché Atwater. Der Kirchturm mit der Uhr hob sich vor dem nächtlichen Himmel ab. An der Stelle, wo die Straße sich verzweigte, befand sich ein kleiner, um diese Tageszeit verlassener Park. Grant setzte sich auf eine Bank und verstaute seinen Rucksack unter der Sitzfläche. Anschließend nahm er die Pistole, die in seinem Gürtel steckte und legte sie neben sich.
Die Ellbogen auf die Schenkel gestützt, legte er das Gesicht in die Hände. Dann bedeckte er die Augen mit einer Hand, und seine Schultern bebten. Lange Zeit schluchzte er stumm vor sich hin, während Fragen auf ihn einstürmten.
Myriam … Wo würde er sie finden?
Grant Emerson war nicht gläubig, aber jetzt wandte er sich an Gott und verfluchte ihn inbrünstig, drängte ihn, ihm ein Zeichen zu geben. Schließlich nahm er die Pistole und steckte den Lauf in seinen Mund. Zitternd näherte sich sein Zeigefinger dem Abzug.
War das wirklich alles, was die Menschheit ihm zu bieten hatte?
6.Gipfeltreffen
Auf den vielsagenden Blick seiner Partnerin hin, drehte sich Victor um und setzte die Sonnenbrille ab. Ein mittelgroßer Mann kam gemeinsam mit Commandant Rozon, dem Verantwortlichen für Öffentlichkeitsarbeit, auf sie zugesteuert. Er war hager und sehnig, trug ein weißes mit Auszeichnungen geschmücktes Kurzarmhemd und eine dunkelblaue Krawatte mit Nadel. Der Sergent-Détective erkannte ihn sofort: Marc Piché, Leiter des SPVM. Da das Opfer zur Führungsspitze der Polizei gehörte, überraschte es Victor nicht sonderlich, dass der Chef höchstpersönlich, der lange im Feld gearbeitet hatte, den Schauplatz des Verbrechens in Augenschein nahm. Piché ergriff das Wort.
»Lessard, Taillon.«
Sie schüttelten sich zur Begrüßung die Hand. Die beiden Ermittler trafen zum ersten Mal mit Piché zusammen, der schon allein durch seine Erscheinung Eindruck machte. Victor musterte ihn unauffällig: weiße akkurat gescheitelte Haare, Brille mit schwarzer Fassung, energisches frisch rasiertes Kinn. Piché war der Inbegriff des Polizisten und entsprach exakt dem Bild, das sich die Öffentlichkeit von einem Polizeichef machte: Er wirkte beruhigend, streng und porentief sauber.
Piché sah Jacinthe und Victor nacheinander an und erklärte:
»Ich habe schon von Ihnen gehört, wollte die Untersuchung des Falles aber persönlich mit Ihnen besprechen.«
Obgleich er einen höflichen Ton angeschlagen hatte, war am durchdringenden Blick des Polizeichefs unschwer zu erkennen, dass er nicht die geringste Infragestellung seiner Autorität dulden würde. Commandant Rozon war ein wenig zurückgetreten und starrte vor sich hin, ohne Interesse an der Unterhaltung zu bekunden. Jacinthe, neben Victor, trat von einem Fuß auf den anderen, demonstrativ um Gelassenheit bemüht.
Der Polizeichef legte dem Sergent-Détective eine Hand auf den Rücken.
»Gehen wir ein paar Schritte, Lessard.«
Die beiden Männer liefen die Rue Duluth hinauf Richtung Boulevard Saint-Laurent. Das Rauschen des dichten Verkehrs auf der Zentralachse war gedämpft zu hören.
»Ich will Ihnen nicht verschweigen, dass diese Ermittlung von besonderer Bedeutung ist, Victor.«
Piché hob den Kopf und lächelte ihn kurz an.
»Ich darf Sie doch Victor nennen?«
»Selbstverständlich, Monsieur.«
Es klingelte leise. Der Sergent-Détective warf einen unauffälligen Blick auf das Display seines Handys.
»Muss dich DRINGEND sprechen.«
Besorgt schob er das Handy in die Tasche. Nadja ließ nicht locker. Das war ungewöhnlich.
»Wie gesagt, eine ganz besondere Ermittlung. Maurice Tanguay war nicht einfach nur ein Bürger, sondern insbesondere und vor allem anderen Polizist. Ihnen ist sicherlich klar, was das bedeutet?«
»Absolut. Der Mord eines Polizisten darf nicht ungestraft bleiben. Wir werden nichts unversucht lassen, um den oder die Schuldigen zu fassen.«
»Aller Augen sind auf uns gerichtet. Wir müssen schnell reagieren und zeigen, dass wir die Situation im Griff haben. Worüber werden die Medien Ihrer Ansicht nach in den nächsten Stunden berichten? Über den Mord an einem einfachen Bürger oder an einem hochrangigen Beamten des SPVM? Meinen Sie, die Medien werden sich zurückhalten und keinen Zusammenhang zwischen seinem Tod und den Funktionen, die er ausübte, herstellen? Sie werden es als eine Art Abrechnung darstellen, nahelegen, dass die Tat mit einer laufenden Ermittlung zusammenhängt oder irgendwas in der Art. Wir sprechen hier von einem Mann, der während seiner gesamten Laufbahn immer wieder mit Banden und kriminellen Organisationen aneinandergeraten ist.«
Piché straffte sich und blickte Victor an, der ihn um etliche Zentimeter überragte.
»Einer der Unseren ist gefallen. Und wenn ein Polizist in dieser Stadt ermordet wird, ist das System in seiner Gesamtheit bedroht. Jeder Tag, der vergeht, ohne dass wir den Schuldigen gefasst haben, ist ein Tag, an dem das Chaos den Sieg über die Ordnung davonträgt. Das können wir uns einfach nicht erlauben. Wir müssen das Gleichgewicht herstellen, um jeden Preis.«
Victor nickte zustimmend, und Piché fuhr fort:
»Ihnen wird mit Sicherheit nicht entgangen sein, dass in diesem Fall die Art, wie das Verbrechen verübt wurde, ebenso bedeutsam ist wie die eigentliche Tat.«
Der Polizeichef sah ihn durchdringend an.
»Man hat ihn enthauptet, Victor. Ihnen ist gewiss klar, dass die Enthauptung eines Commandant des SPVM eine unmissverständliche Botschaft ist. Es ist ein Angriff auf unsere Autorität.«
Insgeheim hielt der Sergent-Détective die Tatsache, dass ebendieser Kopf in einen Abfallcontainer in einer kleinen Seitenstraße geworfen worden war zwar für eine weitaus unmissverständlichere Botschaft, aber das behielt er für sich. Selbst wenn er die Hypothese, das Verbrechen sei ein Angriff auf die Polizei als Repräsentant für Recht und Ordnung, durchaus in Betracht zog, hielt er die Schlussfolgerung des Polizeichefs in jedem Fall für voreilig.
An der Kreuzung zum Boulevard zog Victor Piché am Arm zurück, der um ein Haar mit einem jungen Mädchen, das auf Rollschuhen angesaust kam, zusammengeprallt wäre.
»Sie haben Zugriff auf alle Ermittlungsakten der Fälle, mit denen Maurice beschäftigt war. Sollte der Mord an ihm etwas mit seiner Funktion zu tun haben, finden Sie dort vielleicht eine Spur.«
Die Hände in den Taschen beobachtete Piché einen Augenblick lang sinnierend den dichten Verkehr und wandte sich dann wieder dem Sergent-Détective zu.
»Mir ist bekannt, dass Sie eine Weile unter Maurice im 11. Revier gearbeitet haben und Ihre Lebensgefährtin nach wie vor dort in Dienst ist.«
Victor richtete sich mit einem Ruck auf, plötzlich auf der Hut. Ihm war zwar klar, dass er sich wahrscheinlich über seine ziemlich schwierige Beziehung zu Tanguay würde äußern müssen, aber was Nadja damit zu tun hatte, begriff er nicht so recht.
»Das ist richtig, Monsieur. Ich verstehe trotzdem nicht ganz …«
Mit einer kurzen Handbewegung brachte ihn Piché zum Schweigen.
»Nadja Fernandez ist die dienstälteste Ermittlerin im 11





























