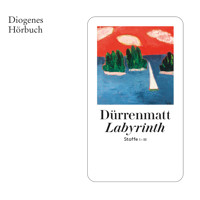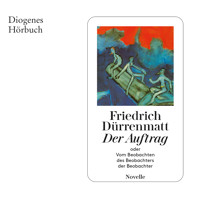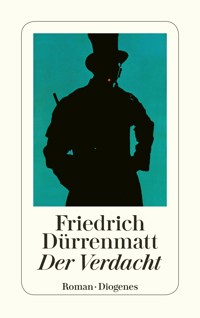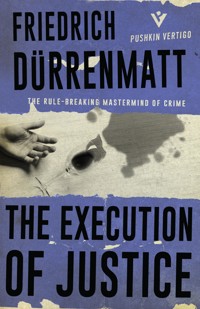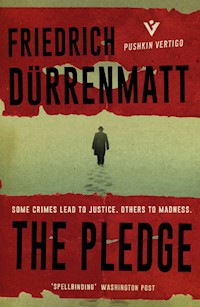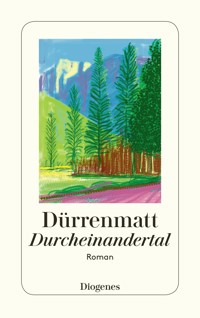
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Moses Melker – selber steinreich – hat eine ›Theologie der Armut‹ entwickelt. Er möchte die Reichen von der Last des schnöden Mammons erlösen, damit sie der Gnade Gottes teilhaftig werden. Ein Gangster-Syndikat nimmt den Gedanken auf, erwirbt im Schweizer Durcheinandertal ein Kurhotel für Millionäre und läßt es zum ›Haus der Armut‹ umbauen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 165
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Friedrich Dürrenmatt
Durcheinandertal
Roman
Diogenes
Durcheinandertal
Roman [1959/1986–89]
Er sah aus wie der Gott des Alten Testaments ohne Bart. Er saß auf der Mauer der Straße, die im Durcheinandertal zum Kurhaus hinaufführt, als das Mädchen ihn bemerkte. Es hielt Mani an. Der Hund war größer als ein Bernhardiner, kurzhaarig, schwarz mit weißer Brust. Er zog den Karren mit dem Milchkessel, hinter dem das Mädchen stand. Das Mädchen war vierzehn. Es öffnete den Milchkessel und entnahm mit dem Schöpfer Milch und ging zu ihm. Es wußte nicht, warum. Der Gott ohne Bart nahm den Schöpfer, trank ihn leer. Plötzlich fürchtete sich das Mädchen. Es verschloß den Milchkessel, hängte den Schöpfer ein, gab Mani ein Zeichen, und der Hund rannte mit dem Mädchen und dem Karren so schnell zum Kurhaus hinauf, als fürchte er sich auch.
Der Gott ohne Bart hatte Humor. Nach dem Anliegen, das ihm Moses Melker vorgebracht hatte, brach er in ein Gelächter aus, das die noch tanzenden Gäste aus dem Takt und die drei musizierenden Tschechen – Klavierspieler, Geiger und Cellist – zum Verstummen brachte. Freilich erst, nachdem sich Melker entfernt hatte, überzeugt, abgewiesen worden zu sein. Der Gott ohne Bart hatte mit keiner Wimper gezuckt. Der Grund seines nachträglichen Gelächters lag wohl vor allem darin, daß Melker vom Großen Alten sprach und daß der Gott ohne Bart meinte, Melker meine damit ihn, bis er dahinterkam, daß Melker mit dem Großen Alten Gott meinte. Den Gott mit Bart. Das Mißverständnis war verständlich. Moses Melker scheute sich, das Wort ›Gott‹ auszusprechen, und so sprach er denn stets vom Großen Alten, denn er konnte sich Gott nur als mächtigen uralten Mann mit einem gewaltigen Bart vorstellen, und daß der Mensch sich Gott vorstellen durfte, war für Melker das »christliche Glaubensaxiom schlechthin«. Das dem Glauben Feindliche, ihn Zersetzende, war die Abstraktion, nur an einen persönlichen Gott konnte man glauben, und eine Person konnte nicht abstrakt sein, darum scheute er sich auch vor dem Wort ›Gott‹, es war abgenutzt, die meisten verstanden darunter etwas Unbestimmtes, Vages, für Melker dagegen war es der »Große Alte«. Es war daher nicht verwunderlich, daß der Große Alte verwirrt wurde, als Moses Melker ihn fragte, ob er sich bewußt sei, in der Gnade des Großen Alten zu leben, und ob er helfen wolle, aus Dankbarkeit dem Großen Alten gegenüber eine Erholungsstätte für die vom Großen Alten begnadeten Millionäre zu errichten. Erst im weiteren Verlauf des Gesprächs legte sich die Verblüffung des Gottes ohne Bart und wich einer staunenden Heiterkeit, war er doch mächtiger als der Gott mit. Nicht daß er die Welt in sechs Tagen geschaffen und sie darauf gut gefunden hätte wie der Gott mit Bart, er hätte sie in einigen Minuten, in Sekunden, besser, in einem Bruchteil von Sekunden, genauer, in Bruchteilen von Bruchteilen von Bruchteilen davon, mit einem Wort plötzlich, auf der Stelle, sofort geschaffen und sie auch für einen guten Witz befunden. Auch sonst – nimmt man ihn aus dem theologischen Bereich – war der Gott ohne mächtiger als der Gott mit Bart, stellten sich doch bei ihm nicht solche Fragen wie die, ob er, wenn er allmächtig sei, einen Stein schaffen, den er nicht aufheben, oder ob er Geschehenes ungeschehen machen könne: Seiner Macht grübelte kein Theologe nach, und was seine Allmacht betrifft, so äußerte sie sich mehr in seiner Unfaßbarkeit. Keine Regierung und keine Polizei versuchte ihn zu ergreifen, zu viele Fäden liefen bei ihm zusammen. Wem allem hatten nicht seine Banken und die Banken, die mit den seinen in Verbindung standen, Nummernkonten verschafft, bei welchen Multis besaß er nicht die Aktienmehrheit, und bei welchen Waffenschiebungen großen Stils hatte er nicht die Hände im Spiel, welche Regierung korrumpierte er nicht, und welcher Papst fragte nicht bei ihm um eine Audienz nach? Seine Herkunft lag im Ungewissen. Es gab nur Legenden darüber. Eine wollte wissen, er sei 1910 oder 1911 aus Riga oder Reval mausearm nach New York gekommen, wo er in Brooklyn »zehn Jahre lang auf nacktem Fußboden geschlafen« habe. Dann sei er Kaftanschneider geworden und habe bald darauf die Textilbranche beherrscht, doch stamme sein sagenhaftes Vermögen aus dem Zusammenbruch der New Yorker Börse im Oktober 1929, er habe eingesackt, was pleite ging. Niemand wußte, wie er hieß, die, welche wußten, daß es ihn gab, nannten ihn den Großen Alten. Er sprach nur Jiddisch, schien aber sämtliche Sprachen zu verstehen, so wie sein Sekretär Gabriel, ein wimpernloser Albino in Smoking und mit langen weißen Haaren, stets um die Dreißig herum, alle Sprachen beherrschte, denn er übersetzte die kurzen jiddischen Anweisungen seines Herrn in die Sprache derer, die den Großen Alten um Rat fragten. Sie taten es zitternd. Nicht ohne Grund. Sein Rat konnte gut sein oder tückisch. Der Große Alte war unberechenbar und nicht einzuordnen. Viele vermuteten, er sei unter anderem der Boss der Ost- und Westküste. Unter anderem. Freilich ohne Beweis. Einige hielten Jeremiah Belial für seinen Stellvertreter, einen aus Buchara über die Bering-Straße eingeschleusten Teppichhändler. Andere meinten, die beiden seien identisch, während es Kenner gab, die behaupteten, es gebe keinen von beiden. So war es denn auch zweifelhaft, ob irgend jemand wußte, wer der schweigsame alte Mann war, der mit seinem Sekretär im riesigen und vergiebelten Kurhaus im Unteren Durcheinandertal abgestiegen war, gebaut in der Mitte des vorigen Jahrhunderts, und den obersten Stock des Ostturms belegt hatte. Er war auf seltsame Weise gekommen. Auf einmal war er da. Die Kellner bedienten ihn und Gabriel automatisch. Sie nahmen an, er gehöre zu den Gästen, auch der Portier, auch Direktor Göbeli, dem das Kurhaus gehörte, nahmen es an. Er fiel niemandem auf, und als er wieder verschwand, vergaß man, daß er dagewesen war. Er war ein Gast unter Gästen. Außer Form, die Verdauung in Unordnung, das Herz mochte nicht recht, der Alterszucker machte zu schaffen. Die stillen Wälder, der Spaziergang zur Heilquelle, von der er jeden Morgen drei Gläser trank, stets von Gabriel begleitet, das Vieruhrkonzert mit vorwiegend klassischer Musik taten ihm wohl.
Wenn schon im Kurhaus niemand ahnte, daß sich der Große Alte unter den Gästen befand, um so weniger konnte im Durcheinandertal das Dorf, ein Genist von alten, baufälligen Häusern, von seinem Aufenthalt wissen. Der Glaube an ihn wäre sonst wieder etwas aufgeflackert. Jetzt schrieben nur einige Weiblein hin und wieder seitenlange Ergüsse, aber es war fraglich, ob die Briefe auf den Gesellschaftsinseln, in Nieder-Kalifornien, in Westaustralien, ja gar auf dem König-Haakon-Plateau der Antarktis ankamen, wohin sie adressiert waren, sie wurden weder zurückgeschickt noch beantwortet. So vermochte denn auch die alte Witwe Hungerbühler ihren täglichen einseitigen Briefwechsel nur aufrechtzuerhalten, weil sie die einzige wohlhabende, wenn nicht gar reiche Frau im Dorfe war. Ihr Mann, Ivo Hungerbühler, hatte vor vier Jahrzehnten seine Schuhfabrik im Sankt-Gallischen verkauft und war der einzige gewesen, der im Dorf eine Villa gebaut hatte, die sich nur schwer ins Tal einfügte. Den Schuhfabrikanten hielten alle für verrückt, wer zog schon in dieses Dorf und baute sich eine Villa. Daß er verrückt war, zeigte sich nach der Einweihung des Hauses, die sehr harmonisch verlief, sah man von der Tatsache ab, daß Frau Babette Hungerbühler ihrem Gatten eine Szene machte, als er mit der Zigarette ein Loch in den alten Kirman brannte. Sie sagte vor allen Gästen zu ihm: »Aber, aber, Vati.« Kaum hatten sich die letzten Gäste verzogen, knüpfte er seine Frau und dann sich am Sturz der Türe auf, die vom Salon in den Garten führte. Ein Gast, der seinen Autoschlüssel vergessen hatte, kehrte zurück und schnitt die beiden ab. Der Schuhfabrikant war tot, wobei der Arzt freilich meinte, Ivo Hungerbühler habe sich erst beim Herunterfallen das Genick gebrochen, während die Witwe zwar noch lebte, aber nicht mehr reden konnte. Seitdem schrieb sie an den Großen Alten Briefe. Das Dorf selber, bewohnt von etwa achtzig Familien, lag dem Kurhaus gegenüber auf der andern Seite der Schlucht, die der Fluß gesägt hatte. Das Tal war sonderbar verquer gestaltet. Die Sonnenseite war bewaldet, nur das Plateau mit dem Kurhaus, dem Park, dem Schwimmbad und den Tennisplätzen war frei, der Wald war steil, unten ein Tannen-, wurde er oben ein Lärchenwald und endete unter der Felswand des Spitzen Bonders, eines dolomitenartigen Kletterberges. Dagegen war die Schattenseite des Dorfes unbewaldet, einige Hütten standen weiter oben sinnlos herum, alles zu steil, um bebaut zu werden, und zu tief gelegen, um für den Wintersport in Frage zu kommen. Von den Familien, die aus dem Dorf stammten, waren nur die Pretánders und die Zavanettis etwas bekannt. Ein Pretánder war einmal Nationalrat und ein Zavanetti Kantonstierarzt gewesen. Jetzt hieß nur der Gemeindepräsident Pretánder, vor langen Jahren noch der Pfarrer, der mit leiser Stimme Gottes Wort verkündet hatte. Wie solle einer dieses verstehen, wenn er Pretánder nicht verstehe, hatte achselzuckend der Kantonale Kirchenpfleger geseufzt, ihn aber gelassen. Doch nach des alten Pretánders Tod meldete sich niemand mehr, so daß einmal im Monat einander abwechselnde Pfarrherren aus dem Kanton vor leeren Bänken predigten, in denen nur hin und wieder ein Kurgast saß. Die alte schiefe, regendurchlässige Kirche war zu unbedeutend, um unter Denkmalschutz zu kommen, und zu leer, um renoviert werden zu müssen, während der Bischof in der Kantonshauptstadt mit dem Gedanken spielte, bei der Kurhausquelle eine Wallfahrtskapelle zu errichten, trotz der stockprotestantischen Gegend. Der Kurhausdirektor und -besitzer Göbeli garantierte ein Wunder, seine Tochter hinke bereits, doch Rom winkte ab. So wurde eine katholische Kapelle nicht gebaut und die protestantische Kirche langsam abmontiert, brauchte man Holz. Und man brauchte Holz, lebten doch viele davon, daß sie alte Bauernkommoden, Schränke und Stühle verfertigten, aber auch Spazierstöcke und Hirsche, in großer Ausführung als Schirmständer zu benutzen, in kleiner als Aschenbecher, ans Geweih konnte man bei den großen die Hüte hängen, bei den kleinen die Asche abstreifen. An die Kirche schmiegten sich das verfallene Pfarrhaus, an das lehnten sich die Dorfpinten ›Zum Spitzen Bonder‹, ›Zum Eidgenossen‹, ›Zur Schlacht am Morgarten‹, ›Zum General Guisan‹ und ›Zum Hirschen‹. Im Genist der Häuser waren nur die Konfiserien, die Garage, der Hof des Gemeindepräsidenten und das Feuerwehrdepot intakt. Die Konfiserien, weil sie das Kurhaus mit Brot und Brötchen, Semmeln und Hörnchen versorgten und sich in ihren Tea-Rooms die vielen Diabetiker, die seit jeher einen Teil der Sommergäste ausmachten, ungenierter mit Süßigkeiten vollstopften, als das im Kurhaus schicklich gewesen wäre; die Garage, weil die Abgelegenheit des Kurhauses einen Taxistand notwendig machte; der Hof des Gemeindepräsidenten, weil dieser die Milch lieferte, sommers mit einem Karren, winters mit einem Schlitten, gezogen vom kurzhaarigen Hundeungetüm, schwarz mit weißer Brust und mächtigem Kopf. Der Gemeindepräsident wußte nicht, woher das Vieh stammte. Niemand wußte es, und es hatte auch niemand je so ein Tier gesehen. Es war auf einmal da, als Pretánder den Stall betrat, und schmiegte sich so heftig an ihn, daß er hinfiel. Der Gemeindepräsident fürchtete sich auch zuerst vor dem Hund, gewöhnte sich aber an ihn und konnte endlich nicht mehr ohne ihn leben. Das Feuerwehrdepot endlich war noch brauchbar, weil es eine vom Kanton gespendete moderne Motorfeuerspritze enthielt. Nicht um das Dorf zu schützen, da hätte der Kantonalen Feuerpolizei die alte Handpumpenspritze vollauf genügt, sondern des Kurhauses wegen, wozu das Kantonale Tiefbauamt dessen Hauptgebäude mit seinen zwei mit je einem Turm ausgestatteten Nebenflügeln mit Hydranten umstellt hatte. Das Dorf lebte vom Kurhaus, stellte ihm den Sommer über das nötige Personal für Wäscherei, Roomservice, Liftboys, Kofferträger, Gärtnerei und Parkdienst, Kutschenfahrten und 1.-August-Feier (Pyramide des Turnvereins) und wurde von Kurgästen durchstöbert, die, was das Dorf produzierte, als Heimatkunst abschleppten. Stand das Kurhaus im Winter leer, sank das Dorf in seine Bedeutungslosigkeit zurück.
Moses Melker hatte sich an den Gott ohne Bart, am Abend bevor dieser aus dem Kurhaus verschwand, mit seinem Anliegen herangemacht. Genauer gegen Mitternacht. Der Große Alte saß neben seinem Sekretär und betrachtete die Gesellschaft, die sich angesammelt hatte, nicht eigentlich reich, aber wohlhabend, alle gesundheitlich angeschlagen, tapfere herumhumpelnde Skisportgeschädigte, alte, im Tanz sich drehende oder müde in den Polstersesseln versunkene Paare, während die drei Tschechen, die jede Saison kamen und denen das Kurhaus, das Dorf samt dem Durcheinandertal und dem Spitzen Bonder längst zum Halse heraushingen, gleichsam im Tiefschlaf weiterspielten und nach den letzten Tangos und sogar Boogie-Woogies ein Schubert-Potpourri anstimmten, ›Im Bache die Forelle‹, ›Leise flehen meine Lieder‹, ›Das Wandern ist des Müllers Lust‹, ›Ave Maria‹. Melker glich einem weißen Buschneger, war kleingewachsen, hatte wulstige Lippen und einen kurzgestutzten krausen und schwarzen Bart. Daß es seine theologischen Gedanken waren, die den Großen Alten nachträglich in ein Gelächter ausbrechen ließen, ist möglich, wie ihn ja all die Spekulationen amüsierten, die über den Gott mit Bart aufgestellt wurden, auch möglich, daß der psychologische Grund, der zu Melkers Theologie führte, den gerissenen Menschenkenner zum Lachen brachte. Melker war im Emmental aufgewachsen als unehelicher Sohn einer evangelischen Magd. Sein Vater war ein katholischer Knecht gewesen. Seine Pflegeeltern, die er als Waisenkind lange als seine echten Eltern betrachtet hatte, waren Säufer gewesen, aber sie hatten ihn nie verprügelt, sondern nur einander, so sehr, daß ihnen die Kraft fehlte, ihn auch noch zu verprügeln; nie mehr im Leben war er seither so glücklich gewesen wie in jenen Nächten, wo die beiden sich blutig geschlagen hatten, das Gefühl nichts zu besitzen und nichts zu sein, bloß in Sicherheit zu sein. Dann nahm sich der Dorfpfarrer seiner an. Er war der einzige, der während der Kinderlehre und des Konfirmandenunterrichts nicht Unfug trieb oder einschlief. Der Dorfpfarrer schickte ihn nach Basel. Er wurde in der Pilgermissionsanstalt Sankt Chrischona als Missionar ausgebildet, aber aus Furcht, die Heiden könnten vor ihm erschrecken, nicht auf diese losgelassen. Doch Moses Melker hatte andere Heiden im Sinn als die Pilgermission. Er war durch die Erkenntnis erleuchtet worden, das Bibelwort »selig sind, die da arm am Geiste sind, denn das Himmelreich ist ihr« bedeute, nur der sei glücklich, der materiell arm sei, weil ihn der Große Alte (womit er den Gott mit Bart meinte) zu dieser Armut bestimmt habe, wogegen nur der Reiche der Gnade Gottes bedürfe, um glücklich zu werden. Moses Melker beschloß, die Reichen zu bekehren. Seine Bücher Der rätselhafte Nazarener, Himmlische Hölle, Der positive Tod, Die tapfere Sünde und vor allem seine Theologie des Reichtums erregten Aufsehen. Während Barth ihn ablehnte und Bultmann schrieb, es sei ihm herzlich gleichgültig, aus welchen Gründen er in den Himmel komme, wenn er nur komme, entdeckten einige in Melkers Theologie des Reichtums eine Theologie der Armut, des Unerbittlichen nämlich, die Erkenntnis, daß die Gnade durch nichts berechtigt werden könne, mache ihre Unerbittlichkeit aus. Nur der Verworfenste könne der Gnade voll und ganz teilhaftig werden (Cajetan Sensemann S.J. zog daraus die absonderlichsten Schlüsse über das Vorleben der Jungfrau Maria und wurde exkommuniziert), indem Melker die Armut aus der Gnade nehme, aus der Unberechenbarkeit ins Berechenbare, Berechtigte transponiere, werde sie an sich selig, geheiligt, werde der Arme als der Erlöste erkannt, damit aber als der allein Mündige, zur Revolution Berechtigte, so daß Moses Melkers Theologie sich gleichsam wie die Philosophie Hegels in einen rechten und einen linken Flügel aufspaltete. Melker nahm dazu nicht Stellung. Seine Theologie stellte ein Brett über einen Abgrund dar. Doch weil aus dem Abgrund der Schweiß dampfte, den der Clinch verursachte, in welchem seine enorme Häßlichkeit mit seiner monströsen Sinnlichkeit lag, hatte er noch ein zweites Brett über den Abgrund nötig: seine an die Marienverehrung der Päpste gemahnende Vergötterung seiner zwei verstorbenen Ehefrauen Emilie Lauber und Ottilie Räuchlin und seiner lebenden Gattin Cäcilie Räuchlin, der Schwester der Verstorbenen. Er verdankte den dreien die feudale Villa, in welcher er im Emmental ob Grienwil hauste. Die Toten waren ebenso reich wie häßlich gewesen, die dritte reicher und häßlicher als ihre Vorgängerinnen; die erste Besitzerin einer Gummiwarenfabrik, die zweite Mitinhaberin eines Zigarrenkonzerns, die dritte nach dem Tod ihrer Schwester Alleininhaberin. Seine erste brach sich das Genick, als sie in einer Eiche herumkletternd behauptete, sie sei der Erzengel Michael, und die zweite ertrank auf der Hochzeitsreise im Nil. Doch war Moses Melker seines erworbenen Reichtums nicht froh, wer heiratet schon aus reiner Liebe hintereinander gleich drei mächtige, schwerreiche, aber häßliche Frauen. Er fühlte das blinzelnde Mißtrauen, ließ er sich mit seinem Rolls-Royce vorfahren, um den Verdacht zu widerlegen, erklärte sich Moses Melker als mittellos, ja nannte sich selber den Armen Moses. Sein angeblicher Reichtum gehöre immer noch teils seinen zwei gottseligen Witwen, wie er sich ausdrückte, da die zwei Verstorbenen im Himmel gleichsam seine Witwen seien, teils seiner nicht minder geliebten, noch lebenden Cäcilie. Sogar was er von seinen Büchern erhalte, falle seinen Gattinnen zu, da er ohne ihr Geld seine Wälzer nie hätte schreiben können. Der Große Alte sah genauer. Bretter über einen Abgrund stürzen unvermutet ein. Moses Melker konnte sich nicht vorstellen, daß gerade häßliche Männer auf die schönsten Frauen erotisch zu wirken vermögen. Sein sexuelles Minderwertigkeitsgefühl war so enorm, daß ihn sogar die Eroberung gleich zweier Millionärinnen deprimierte, die ebenso häßlich waren wie er und sich mit Leichtigkeit mit schönen Männern hätten eindecken können. Denn kaum hatte er eine erobert, begann es im Abgrund wieder zu brodeln. Finsterer Verdacht stieg auf, Emilie Lauber habe ihn nicht seiner männlichen Vorzüge, seiner sexuellen Gier wegen geheiratet, die in ihm wütete, sondern seine religiöse Hilfskonstruktion habe sie verführt, womit er aus dem Sumpf seiner Komplexe zu klettern versuchte. Daß sie sich dann noch einbildete, der Erzengel Michael zu sein, mußte ihn zur Raserei bringen. Hielt der Große Alte Moses Melkers Beihilfe am Absturz von einer Eiche seiner ersten für wahrscheinlich, sei es, daß er ihr nachgeklettert war, sei es, daß er den Ast, auf dem sie zu sitzen pflegte, angesägt hatte (wer forscht bei einem Gottesmann schon nach), so war der Große Alte sicher, daß Melker seine zweite Gattin persönlich in den Nil gestoßen hatte. Eine Hochzeitsreise von Assuan nach Luxor, der ein Besuch von Abu Simbel voranging, konnte nur Ottilie Räuchlin eingefallen sein. Moses Melker mußte angesichts der Monumentalstatuen Ramses’ II. wie ein genmanipulierter Schimpanse gewirkt haben. Der Große Alte sah im Geiste Ottilie Räuchlin vor sich. Sie war erhaben, mächtig und häßlich. Der Große Alte achtete sie so, wie er Moses Melker belachte. Er liebte deren Souveränität, sie hätte sich Männer je nach Laune und Gusto halten können, wer wäre nicht gern mit Hilfe ihrer Millionen in ein angenehmeres Leben gestartet. Doch mit einem Schönling als Gatten hätte sie ihre Häßlichkeit betont, mit Moses Melker zeigte sie, daß sie sich nichts aus ihr machte. Diese Demütigung vermochte Melker nicht zu ertragen. In der Nähe von Edfu stand der Mond über dem Nil. Melker befand sich mit Ottilie Räuchlin allein auf Deck. Moses Melker nahm zähnefletschend einen Anlauf und wäre beinahe ihr nachgefallen. Niemand hörte das mächtige Platschen. Sie war so überrascht, daß sie nicht einmal schrie. Schmuckbeschwert ging sie wie ein Stein unter. Moses Melker vergaß seine Tat augenblicklich. Die Bretter der Theologie klappten den Abgrund zu, kaum hatte er gehandelt. Er ging in seine Kabine und begann Von zwei Engeln geführt zu schreiben, seinen Bestseller, in über dreißig Sprachen übersetzt, eine Huldigung an seine zwei ermordeten Frauen und ihnen gewidmet. Erst am nächsten Morgen, gegen Mittag, meldete er verstört dem Kapitän, seine Frau sei aus ihrer Kabine verschwunden. Man suchte, fand nichts und schöpfte keinen Verdacht. Seine Trauer war echt. Er hatte keine Ahnung mehr. Doch als er ob Grienwil in seine Villa zurückkehrte und das Schlafzimmer betrat, kam ihm die Erinnerung wieder. Im Ehebett lag gewaltigen Busens, dreikinnhoch seine Schwägerin Cäcilie Räuchlin, in einem durchsichtigen Seidenhemd, auf ihren Bäuchen lagen Pralinenschachteln, und sie rauchte Zigarren und las einen Kriminalroman. Cäcilie Räuchlin schaute Moses Melker an, rauchte und las weiter. An ihrem Blick hatte Melker erkannt, daß sie alles wußte. Er kroch zu ihr ins Bett und in seine dritte Ehe.