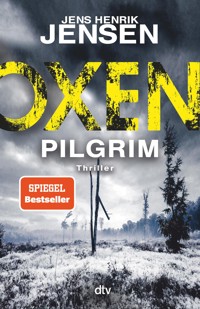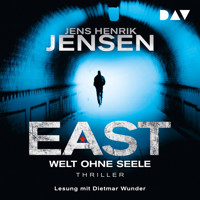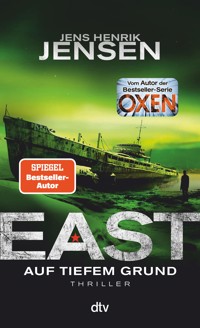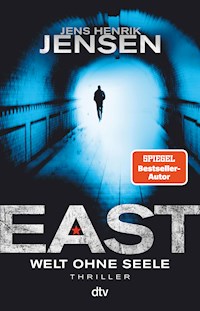9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Fall für Jan Jordi Kazanski
- Sprache: Deutsch
Das atemberaubende Finale der EAST-Trilogie Kazanski jagt Schatten in der Dunkelheit. Aber was ihn antreibt, ist die Hoffnung: Wird er seine große Liebe lebend finden? Jan Jordi Kazanski verschlägt es in das vom Bürgerkrieg zerrüttete Bosnien-Herzegowina. Hier verliert sich auch die Spur seiner Geliebten Ewa, nach der er verzweifelt sucht … im letzten Fall für den CIA-Agenten mit polnischen Wurzeln geht es um alles: kann es für ihn Rettung geben? Ein visionärer Thriller aus der Feder von Bestsellerautor Jens Henrik Jensen »Thrillerkunst auf höchstem Spannungslevel – für Jens Henrik Jensens Bücher braucht man Nerven, die noch weitaus stärker sind als Drahtseile.« LITERATURMARKT.INFO Alle Bände der EAST-Reihe: Band 1: Welt ohne Seele Band 2: Auf tiefem Grund Band 3: Jagd im Zwielicht Von Jens Henrik Jensen sind bei dtv außerdem die skandinavischen Thriller-Serien OXEN und SØG erschienen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 698
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Als Jan Jordi Kazanskis Geliebte Ewa auf dem Balkan spurlos verschwindet, zwingt das Kriegsverbrechertribunal in Den Haag den CIA-Agenten dazu, ihre Mission zu übernehmen. Der Auftrag: Er muss einen geheimnisumwobenen Akteur der serbischen Unterwelt aufspüren, der unter dem Decknamen »Der Wolf« bekannt ist. Mit etlichen Verfolgern auf den Fersen begibt Kazanski sich auf eine dramatische Jagd. Doch wenn er seine Mission erfüllen und Ewa lebend finden will, muss er äußerst zielgerichtet vorgehen …
Jens Henrik Jensen
EAST
Jagd im Zwielicht
Thriller
Aus dem Dänischen von Ulrich Sonnenberg
PROLOG
Der Mythos lebt in dem Nebel, der sich über die Jahre legt und ihm erlaubt, eine unkontrollierbare Form anzunehmen. Er nährt sich von der dunklen Schnittmenge, in der sich Wahrheit, Lüge und Wunsch gegenseitig aufheben. Im Gegensatz zu den Menschen schwächt ihn das Alter nicht, sondern er wird mit jedem Augenblick größer und immer kraftvoller.
Der Mythos ist das überlieferte Wort, unser gemeinsames Gut, es bereichert und betrügt uns, die wir ihm folgen.
Diese Geschichte über den Wolf von Banja Luka hat ihre Wurzeln in den Mythen des Balkans, dieser von Kriegen gepeinigten Region, deren Zivilisation die Augen vor der Barbarei verschloss, sodass Nachbarn sich gegenseitig töteten. Dort bekam der Mythos eine rastlose Gefährtin, eine alte Bekannte – die Schuld.
Mancher mag sich die Frage stellen: Wie konnte aus guter Nachbarschaft Leid und Schmerz werden? Die Antwort liegt irgendwo in dem Nebel, der die Jahre verschleiert und alles unbegreiflich werden lässt. Deshalb wissen die Nachbarn nicht mehr genau, warum das Leben sich so fatal entwickelt hat.
Bis zu seinem Tod im Jahr 1980 gelang es Josip Broz Tito, die Illusion Jugoslawien mit den Republiken Kroatien, Slowenien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Mazedonien und Serbien mit seinen beiden Provinzen Wojwodina im Norden und Kosovo im Süden zusammenzuhalten. Aber Illusionen spiegeln nicht unbedingt die Realität wider, und die Bevölkerung hatte ihr Selbstverständnis nie aufgegeben. Ein Kroate war ein Kroate und ein Serbe ein Serbe, nur wenige sahen sich als Jugoslawen.
Trotz einer mit Blut geschriebenen Vergangenheit lebten sie friedlich zusammen. Unabhängig von Identität und Religion heiratete man untereinander und nahm an Begräbnissen teil. Muslime, Orthodoxe und Katholiken wohnten Seite an Seite, bis die Demagogen zum Klang vergessener Kampflieder aufmarschierten. Unwissenheit und die Sünden der Vergangenheit wurden ihre geschliffenen Werkzeuge im Streben nach Macht; und keine der Wunden scheint geheilt zu sein.
Diese Geschichte handelt von der Jagd nach der Schuld und der Suche nach Glück, denn was kann man anderes tun? Die Spur führt über Meere und Berge und durch den Nebel der Mythen, in dem Recht und Unrecht verschwimmen.
Die Spur führt auf das Territorium des Wolfes.
1
Den Haag, Niederlande
Dieser salzige Geschmack des Meeres.
Er atmete tief durch, um mehr davon zu spüren. Der Seenebel schmiegte sich an die Ringmauer und legte sich wie ein Brautschleier über seinen Kopf, getragen von einer leichten Brise unter den unsichtbaren Schreien der Möwen.
Ja, in der Luft lag ein salziger Geschmack. Er genoss es jedes Mal. Vielleicht weil er auch nach Freiheit schmeckte. Wie lächerlich, sich selbst weismachen zu wollen, dass sich die Freiheit schmecken ließ. Damals, als er tief im Landesinneren aufgewachsen war, hatte das Meer ihn nicht sonderlich interessiert. Erst jetzt, wo es unerreichbar für ihn war.
Es war früher Morgen. Dragan Subotić hatte gerade mit den anderen Häftlingen in diesem speziellen Gebäudetrakt gefrühstückt. Glücklicherweise wollte niemand mit ihm hinaus, sodass er den ganzen Hof für sich hatte. Er konnte ungestört träumen – und dem salzigen Geschmack einer Welt ohne Grenzen nachspüren.
Dragan Subotić wusste nur etwas über die Welt da draußen, weil sein jüngerer Bruder ihn besucht und ihm erzählt hatte, wie es dort aussah. Dragan wusste, wenn er ein paar Hundert Meter die Zwolsesstraat hinaufging, würde er zur Strandpromenade von Scheveningen gelangen, einem Vorort oder eher einem Stadtteil von Den Haag. Von der Promenade aus konnte man über das Meer blicken.
Er meinte auch, von ganz oben in seiner Zelle das Meer erahnen zu können, gleich hinter den Silhouetten der Hotels. Dort draußen wurde der Horizont so weit, wie es nur über dem Meer möglich war. Vielleicht bildete er es sich aber auch nur ein, weil er wusste, dass dort das Meer war.
Er atmete mehrmals tief durch. Es hatte geregnet. Die Steinplatten waren nass, auf ihnen klebten braune Blätter. Plötzlich schwankte er. Er war kurz davor, das Gleichgewicht zu verlieren. Die Platten unter seinen Schuhsohlen drehten sich immer schneller. Sie kamen seinem Gesicht gefährlich nahe. Angst packte ihn. Jetzt passierte es wieder … Er blickte auf. Die roten Backsteine und die Gebäude wirbelten umher. Er konnte sich gerade noch an der Rückenlehne einer Bank festhalten. Dann verwischten Farben und Konturen in einem reißenden Mahlstrom, und alles wurde schwarz.
Es roch sauber. Nicht mehr nach Salz, Meer und Herbst, sondern nach Seife und frisch gewaschener Bettwäsche. Noch bevor Dragan Subotić die Augen aufschlug, hatte er die Veränderung registriert und war nicht sonderlich überrascht, dass er in einem weißen Nachthemd unter einer weißen Bettdecke in einem Raum mit weißen Wänden und einer weißen Decke lag.
Er war allein in dem Zimmer, in dem nur sein Bett stand. Eine blaue Kunststoffleiste lief an einer der Wände entlang, die Gardinen hatten fast die gleiche blaue Farbe. Ziekenhuis Bronovo war mit blauem Faden in einem schmalen Streifen über die gesamte Länge der Bettdecke und auch auf sein Nachthemd gestickt. Er lag im Bronovo-Krankenhaus. Es stand an derselben Straße wie das Gefängnis, nur einen Kilometer näher am Zentrum, wo die Straße durch einen Kasernenbereich verlief und zur Van Alkemadelaan wurde. Der älteste der kroatischen Häftlinge hatte im letzten Sommer über vierzehn Tage hier verbracht. Verlegt wurde man nur, wenn die Behandlung zu kompliziert war, um von der gefängniseigenen Krankenstation durchgeführt zu werden.
Dragan Subotić tastete seinen gesamten Körper ab und atmete tief durch. Er hatte keine Beschwerden, fühlte sich müde, aber ganz in Ordnung. Als er sich unter der Bettdecke bewegte, spürte er einen Schmerz im rechten Knie und in der rechten Pobacke. Er fuhr sich mit den Fingern durchs Gesicht und fühlte ein Pflaster auf der Stirn.
Er musste gefallen sein. Er erinnerte sich, dass ihm im Hof schwindelig geworden war, an nichts weiter. Sie hatten ihn offenbar ins Krankenhaus gebracht – vermutlich weil er in der letzten Woche bereits einen ähnlichen Anfall gehabt hatte, nur nicht so schlimm.
»Stress«, hatte der Gefängnisarzt beim letzten Mal gesagt. »Das ist Stress, weil es bald zum Prozess kommt. Es ist die natürliche Reaktion des Körpers.«
Dragan Subotić schloss die Augen. Diese Woche war schrecklich gewesen. Er rief sich die glotzenden Augen auf der anderen Seite des Panzerglases in Erinnerung. Journalisten, Juristen, gewöhnliche Menschen – und sogar ein Kunstmaler, der ihn mit seinem Malkasten auf den Knien angestarrt hatte. Es war die schlimmste Woche seines Lebens gewesen. Als hätte er in einem Käfig aus Glas gesessen. Wie ein Tier im Zoo.
Nach beinahe zwei Jahren Vorbereitung – aufseiten der Anklage wie der Verteidigung – hatte der Prozess am Montag begonnen. Er wurde Dienstag und Mittwoch fortgesetzt und wäre auch am Donnerstag weitergeführt worden – wenn er nicht umgefallen wäre. Möglicherweise würde der Prozess ein Jahr dauern, vielleicht sogar länger, hieß es. Aber schon nach den ersten Zeugenaussagen hatte er das Gefühl gehabt, dass es nur mit einem Urteil enden konnte: schuldig.
Ob er zu fünfundzwanzig, dreißig oder fünfunddreißig Jahren verurteilt wurde, war ihm egal. Er war jetzt dreiunddreißig Jahre alt. Selbst in fünfundzwanzig Jahren würde sein Leben so gut wie vorbei sein, und eine Berufung würde den Schmerz nur in die Länge ziehen. Für Dragan Subotić war die Sache gelaufen. Nicht unbedingt das Leben, das er sich vorgestellt hatte.
Die Tür ging auf, das Geräusch unterbrach seinen Gedankengang. Wieder öffnete er die Augen. Die Krankenschwester beugte sich ein wenig über ihn. Sie lächelte nicht. Sie war barsch, und ihr Blick wirkte ziemlich abweisend, fand er. Wahrscheinlich hatte sie schon erfahren, wer er war und was er getan hatte.
»Wie geht es Ihnen, Herr Subotić?« Er hörte am Ton, dass es dieser Frau völlig egal war, wie es ihm ging.
»Gut«, antwortete er. »Wie lange hier?«
»Ungefähr elf Stunden laut meinen Unterlagen. Sie haben ein Beruhigungsmittel bekommen.«
»Stimmt was nicht mit mir?« Für ein solches Gespräch reichten seine englischen Brocken gerade noch.
»Jedenfalls haben Sie sich bei dem Sturz verletzt. Knie, Hüfte, Gesäß, Stirn … Wir haben die Wunden gereinigt und verbunden. Sie wurden untersucht und geröntgt. Es ist offenbar nichts Ungewöhnliches zu erkennen, aber uns fehlen noch einige Ergebnisse – von den wichtigsten Untersuchungen. Wer weiß? Vielleicht ist es ein Virusinfekt. Vielleicht ist es der Stress. Der Körper kann plötzlich sehr heftig reagieren, wenn er über längere Zeit Stress ausgesetzt ist. Das haben wir schon häufiger erlebt. Und Sie stehen ja unter starkem psychischem Stress, nicht wahr?«
»Weiß nicht. Vielleicht …«
»Hier, nehmen Sie Ihre Tabletten. Sie werden Ihnen helfen, sich zu entspannen – und zu schlafen. Sie werden sehen. Morgen kommen Sie sicher zurück in Ihre gewohnte Umgebung.«
Es klang seiner Meinung nach leicht sarkastisch. Die Krankenschwester stellte eine Plastikschachtel mit Tabletten und ein Glas Wasser auf seinen Nachttisch, dann verschwand sie wieder.
Erst jetzt bemerkte er eine kleine Plastiktasche mit dem Aufdruck Ziekenhuis Bronovo auf dem Nachttisch. Es war ein Kulturbeutel mit einer Zahnbürste und einer kleinen Tube Zahnpasta. Außerdem enthielt die Tasche so überflüssige Dinge wie einen Miniaturspiegel, Zahnstocher, ein Feuchttuch und eine Probepackung mit etwas, das wie Kaugummis aussah, dazu eine kleine Tube Creme.
Subotićs Blick fiel auf die Uhr an der Wand. Es war halb acht Uhr abends. Er ließ sich schwer in das bequeme Bett zurückfallen. Für eine Minute, vielleicht zwei. Um angenehm zu liegen, während er versuchte, die Konsequenzen des teuflischen Gedankens zu überblicken, der rasch in seinem Kopf Gestalt annahm. Dann setzte er sich auf die Bettkante und verschnaufte einen Moment. Er musste herausfinden, wie es um ihn stand. Er konnte sich problemlos bücken, aufstehen, gehen und im Kreis drehen. Er hatte keinerlei Schwindelgefühl. Das Knie schmerzte ebenso wie sein Hintern und die rechte Hüfte.
Als Erstes ging er auf die Toilette und schüttete die Tabletten in die Kloschüssel. Er zog das Pflaster auf der Stirn halb ab und sah im Spiegel eine oberflächliche Wunde. Genauso war es auch bei seinem Knie und der rechten Pobacke. Sein einziges Problem war der Gedanke an einen neuen Anfall. Aber … er hatte nichts zu verlieren.
In dem großen Schrank in seinem Zimmer fand er seine Kleidung ordentlich zusammengelegt in einer Plastiktüte. Auf einem Regalbrett standen seine Schuhe, Joggingschuhe mit Klettverschluss – niemand hatte dort, wo sein Leben sich dahinschleppte, Schuhe mit Schnürsenkeln. Vielleicht war er noch immer ein wenig verwirrt, denn erst jetzt meldete sich die ernste Frage: Wie?
Unendlich vorsichtig drückte er die Türklinke herunter, Millimeter um Millimeter. Dann zog er die Tür ebenso vorsichtig auf. Er musste sie genau so weit öffnen, dass er den kleinen Schminkspiegel aus dem Kulturbeutel durch den Spalt schieben konnte.
Es war ein Wagnis. Im Spiegel erkannte er den Wachtposten einige Meter entfernt auf dem Gang. Er drehte den Spiegel um. Rechts saß ebenfalls eine Wache, beides kräftige UN-Beamte in hellblauen Hemden und dunkelblauen Hosen. Genau wie im Gerichtsgebäude.
Behutsam schloss er die Tür. Er hätte es vorhersehen können. Sie gingen kein Risiko ein. Subotić trat an die Zimmerfenster, öffnete das breite Fenster in der Mitte und lehnte sich hinaus. Es war unmöglich. Er befand sich im fünften Stock, offenbar auf der Rückseite des Gebäudes, denn unten war kein Eingangsbereich, kein Parkplatz – nur eine Grasfläche mit Beeten und Büschen. Das Mauerwerk wurde unterbrochen von zirka zehn Zentimeter breiten Vorsprüngen. Sie markierten offenbar die Decken der einzelnen Stockwerke auf der flachen Fassade und zogen sich über die gesamte Länge des Gebäudes. Kein Mensch hätte darauf stehen, geschweige denn balancieren können.
Sie hatten an alles gedacht.
Er fing an, die drei Schränke minutiös zu durchsuchen, zwei im Patientenzimmer und einer im Badezimmer. Alles war entfernt worden, nicht einmal ein zusätzliches sauberes Laken oder einen Bettbezug hatten sie liegen lassen.
Subotić setzte sich auf die Bettkante und ließ den Blick langsam durchs Zimmer schweifen. Sämtliche Leitungen lagen unter der Wandverkleidung. Die beiden kleinen Gardinen waren nicht zu gebrauchen, ebenso wenig das Kunststoffrollo. Die einzige Schnur im Raum diente dazu, das Personal zu rufen. Sie war dünn und nur wenige Zentimeter lang. Er wollte den Gedanken bereits aufgeben, als sein Blick noch einmal auf den kleinen Fernseher fiel, der an einem Metallbügel an der gegenüberliegenden Wand hing.
Er trug den einzigen Stuhl dorthin und stieg darauf. Hinter dem Fernseher gab es ein Verlängerungskabel, das aufgerollt an einer dafür vorgesehenen Halterung hing. Das Kabel war lang, und es verschwand hinter den Kunststoffpaneelen an der Zimmerdecke. Vielleicht hatte er doch Glück …
Wieder lehnte sich Subotić aus dem Fenster. Das Fenster in der Etage unter ihm war geschlossen, aber ein paar Meter weiter rechts war eines nur angelehnt. Tatsächlich waren mehrere Fenster nur angelehnt, entdeckte er jetzt. Aber nur eins in Reichweite.
Ja, es könnte gelingen, wenn das Stromkabel lang genug war und er es aus der Steckdose hinter den Paneelen reißen konnte. Wenn man das Risiko eingehen wollte, und mit ein wenig Glück wäre es möglich. Nun betete er nur, dass nicht irgendein Idiot im Laufe des Abends das Fenster schloss.
Es war 01:30 Uhr, als er aufstand, sich leise anzog und in die Schuhe schlüpfte.
Die Krankenschwester hatte gerade nach ihm gesehen. Er hatte auf der eingerollten Verlängerungsschnur gelegen. Sie war zirka acht Meter lang, zusammen mit dem Stück, das er hinter der Deckenverkleidung herausgerissen hatte. Als die Tür aufging, hatte er schwer geatmet und ein wenig geschnarcht. Sekunden später hatte die Krankenschwester die Tür wieder geschlossen.
Subotić öffnete das Fenster und beugte sich hinaus. Das untere Fenster stand immer noch einen Spaltbreit offen, er seufzte erleichtert. Dann richtete er das Bett her, so gut er konnte. Ein zusammengerolltes Handtuch füllte einen Ärmel des Krankenhaus-Nachthemds aus. Er ließ ihn leicht unter der Bettdecke herausragen. Das andere Handtuch diente als Kopf, und schließlich formte er die Konturen eines Körpers unter der Bettdecke mit dem zerknüllten Papier von ein paar alten Zeitungen, die er im Nachttisch gefunden hatte.
Er betrachtete einen Moment lang das Ergebnis. Gar nicht schlecht. Die Dunkelheit würde helfen, und wenn es gelang, könnte der alte Trick ihm bis morgen früh um sechs, sieben Uhr Zeit verschaffen, hoffte er.
Sorgfältig knotete er das Verlängerungskabel an den Heizkörper unter dem Fenster, zog mehrmals prüfend daran und versuchte sich vorzustellen, ob es sein Körpergewicht halten könnte. Am Ende beschloss er, sich das Kabel unter den Armbeugen einmal um den Körper zu schlingen. Dann führte er es über die Brust und noch einmal hinter dem Rücken durch, direkt über den Lenden, sodass er es kontrollieren und sich über die rechte Hüfte abfieren konnte. Auf diese Weise kam es einem improvisierten Kletterseil recht nah. Obwohl das Kabel glatt war, würde diese Methode genügend Reibung gegen den Körper erzeugen und einen sicheren Griff gewährleisten, wenn er sich Stück für Stück abseilte.
Die Füße an die Mauer gestemmt und leicht zurückgelehnt, wollte er sich herunterlassen, bis er mit den Fußspitzen den ersten Vorsprung erreicht hatte. Dort müsste er immer noch genug Spielraum haben, um die wenigen Meter bis zu dem offenen Fenster zu balancieren. Er würde die ganze Zeit zu Gott beten.
Eine halbe Stunde später stand er in dem offenen Kellerparkplatz. Es war ein berauschendes Gefühl, die kalte Nachtluft einzuatmen, und er blieb einen Augenblick stehen, um Atem zu schöpfen.
Alles war planmäßig verlaufen. Er war in das Fenster geklettert, offenbar war es ein Büro. Es stank nach Zigarettenrauch, und das Licht war eingeschaltet. Aus einer Handtasche hatte er einen Hundertguldenschein gestohlen, die anderen vier aber nicht angerührt. Jetzt war er so weit gekommen, da sollte ihn ein gewöhnlicher Diebstahl nicht verraten. Er würde auch keine Tankstelle oder irgendeinen Laden auf seinem Weg überfallen, denn genau das erwartete man von ihm.
Dragan Subotić war über eine Hintertreppe bis hinunter in den Werkstattkeller des Krankenhauses gelaufen und trug jetzt einen orangefarbenen Arbeitsanzug – nach einem so auffällig gekleideten Menschen würden sie sicher nicht suchen. Seine eigenen Sachen hatte er in eine kleine Ledertasche gesteckt, die er auf dem Weg gefunden hatte.
Dragan Subotić ging ruhig den gepflasterten Fußweg entlang, bis er den Parkplatz vor dem Krankenhaus erreicht hatte. Er drehte sich kurz um. Wie ein schlafender Riese lag das Krankenhaus vor ihm, aus einigen Fenstern drang Licht, völlig unbeeindruckt von dem Meisterstück, das er gerade vollbracht hatte. Dann ging er langsam über die große Rasenfläche bis zur nächtlich ausgestorbenen Straße.
Jetzt musste er in jeder Sekunde kühlen Kopf bewahren. Er hatte nur eine Chance, wenn er es nach Hause schaffte. Wenn er zu Hause war, musste er den Einzigen finden, der ihm helfen konnte. Der ihm ein Leben verschaffen konnte, das lebenswert war. Er musste Kurjak finden – den Wolf.
2
Madrid, Spanien
Sechs Köpfe, sechs Männer. Drei junge, zwei im mittleren Alter und ein alter. Keiner von ihnen passte auf die Beschreibung.
Jan Jordi Kazanski legte die Fotos zurück in den Umschlag und schrieb eine kurze handschriftliche Nachricht auf ein offizielles Formular mit dem Briefkopf der Central Intelligence Agency. Er konnte Oberst Miramóns Erwartungen nicht erfüllen. Keiner der ETA-Leute, die nach dem dramatischen Schusswechsel nördlich von Bilbao verhaftet worden waren, fand sich in Kazanskis Archiv.
Die Spanier arbeiteten mit der Theorie einer amerikanisch-spanischen Verbindung bei der Bombenkampagne der Terroristen, und Kazanski war das aktive Bindeglied der Zusammenarbeit der CIA mit dem Centro Superior de Información de la Defensa, CESID. Doch das Resultat war negativ. Er hatte die Verhafteten mit dem großen Fotoalbum in Langley abgeglichen. Der gute Oberst im Geheimdienst würde enttäuscht sein.
»Ann, ich habe Post. Könntest du bitte einen Boten rufen?«
»Augenblick, Kaz. Einen Moment.«
Die sanfte Stimme der Sekretärin verstummte. Manchmal fiel ihm auf, dass die Wände hier trist, weiß und beinahe nackt waren. Das Büro war spartanisch eingerichtet, es erinnerte an einen Wartesaal, in den die Sekretärin regelmäßig über Lautsprecher Informationen schickte. An einer Wand hing ein Kalender der Fluggesellschaft Iberia, an der anderen eine kleine Skizze eines hübschen Frauenkörpers, die er irgendwo von einem Straßenkünstler gekauft hatte. Vielleicht war er ein Reisender, der vergeblich auf seinen Aufruf wartete, weil er sein Reiseziel nicht kannte und deshalb in diesem Büro bleiben musste. Er verdrängte den Gedanken.
Es gab zwei Fenster und damit zwei Möglichkeiten, in Kontakt mit der Außenwelt zu treten. Er drehte sich mit seinem Stuhl herum und betrachtete das Leben auf der Serrano. Jetzt, am späten Nachmittag, war der Verkehr heftig. Wenigstens gab es Menschen, die ein Ziel hatten, es gab Menschen, die die Stadt verließen und nach Hause wollten.
Er drehte sich mit dem Stuhl weiter und sah nun aus dem Fenster, durch das man das Nachbargebäude erblicken konnte, den spanischen Hauptsitz der Banco do Brasil aus Stein und Rauchglas. Viele seiner männlichen Kollegen bedauerten, dass die hübsche Olivia nicht mehr nach Feierabend die Treppe hinuntertanzte. Sie war nach São Paulo zurückgekehrt. Kazanski hatte sie nur wenige Male gegrüßt, seit sie vor langer Zeit einmal gemeinsam Mittag gegessen hatten. Er hatte den Kontakt nicht intensivieren wollen.
Jan Jordi Kazanski warf einen Blick auf die Zeichnung an der Wand. Die nackte Schulter kam ihm bekannt vor. Die Zeit damals war die Hölle gewesen. Es war ihm allerdings erst sehr viel später klar geworden. Damals hatte er ständig befürchtet, dass er es nicht schaffen würde. Dass er es überhaupt nie wieder schaffen würde. Die Trennung von Ewa, der Tochter der Witwe von Krakau, hatte ihn in die Dunkelheit zurückgeworfen und seine Tage eintönig werden lassen. Nun ging sie ihm wieder durch den Kopf – auf eine viel schönere Art und Weise. Statt sich ihre Streitereien ins Gedächtnis zu rufen, genoss er die Erinnerung an ihre Augen, das Lächeln, den feinen Nacken und die runden Schultern. Schlechtes in Gutes zu verwandeln, war wohl eine Art gesunde Verarbeitung. Und ja, er war bereit. Er hatte sich etwas vorgemacht und sich schon die ganze Zeit eingeredet, bereit gewesen zu sein, aber erst jetzt war er sich sicher.
Nach dem Einsatz in Murmansk war ihm einiges klar geworden, und manches, das er vorher für sinnlos gehalten hatte, ergab für ihn inzwischen einen Sinn. Vielleicht war es wirklich so, dass er bis ans Ende der Welt hatte reisen müssen, nur um festzustellen, dass er von dort aus nicht weiterkam, dass er erst in den Abgrund blicken musste, um sich selbst in die Augen sehen zu können.
Er hatte die Ruhe bereits auf der Zugfahrt gespürt, als er aus Murmansk zurückkam. Ulf hatte gesagt, es könnte durchaus einen Zusammenhang geben. Er meinte, die Reise sei auch eine innere Reise gewesen, und der Schwede kannte sich mit solchen Dingen aus – wie mit vielen anderen. Ulf konnte die Dinge benennen, die Kazanski nicht genau beschreiben konnte. Und nach Murmansk hatte sich der Ton in Ewas Briefen nach und nach verändert. Sie schrieb, eine Balance gefunden zu haben, die ihre verpfuschte Kindheit ihr nicht habe geben können. Heute sehe sie den Versuch ihres Zusammenlebens in Madrid in einem anderen Licht. Sie sprach davon, mehr zu verstehen und sich besser gerüstet zu fühlen. Und sie glaube, nun auch etwas geben zu können und dass allein die Zeit ihr geholfen habe. Ja, sie waren auf dem Weg zurück zueinander, vielleicht in einer neuen Form, umgegossen und poliert, aber auf dem Weg zurück. Er spürte es. Die Wartezeit war bald vorbei.
Sie hatte gefragt, ob sie sich nicht schon bald einmal wiedersehen sollten. Er hatte den Überblick verloren und konnte sich nicht an all die Orte erinnern, an denen sie gewesen war. Nach der Trennung hatte lange Schweigen geherrscht, dann war gelegentlich eine Postkarte gekommen. Ewa irrte ziellos umher, ihr Ratgeber war der Zufall. Geld hatte sie nach dem Tod ihrer Mutter genug. Sie hatte deren Geschäfte und die meisten Immobilien verkauft und ihre Konten geleert. Sie hatte Unterricht bei irgendeinem Geigenvirtuosen in Wien und einem in London genommen. Sie hatte in Deutschland ein Semester Philosophie studiert, war aber vorzeitig abgesprungen. Sie hatte einen miesen Job als Kellnerin auf Kreta angenommen, von dem sie begeistert erzählte, und einen anderen auf Teneriffa. Die Planlosigkeit erfüllte sie mit Zufriedenheit, und das war der Sinn des Ganzen, erzählte sie, als die Postkarten allmählich von Briefen abgelöst wurden.
Zweimal hatten sie sich gesehen, seit sie ihre Sachen gepackt und Madrid verlassen hatte. Kurze Begegnungen auf seinen Wunsch hin, die sie eher beiläufig absolviert hatte. Besuche, die ihn in einem Vakuum zurückließen. Einige wenige Stunden, ehe sie sich geschickt von seinen Annäherungsversuchen befreit und mit einem flüchtigen Kuss auf die Wange verabschiedet hatte, um dann begierig ihre Suche fortzusetzen. Doch bald änderten die Briefe ihren Charakter, und sie fing an, ihn anzurufen … Beim letzten Mal hatte sie gesagt, sie würde nachts von ihm träumen. Sie wollten sich Mitte des nächsten Monats wieder treffen, wenn sie von einer Reise quer durch die USA zurückgekehrt war, ihrer letzten Reise, sagte sie. Sie musste bald von sich hören lassen. Es war jetzt über einen Monat her, länger als sonst, und er hoffte jeden Tag auf eine Nachricht. Vielleicht wartete ein Brief auf ihn im Flur? Ein Lebenszeichen auf einem Blatt Papier mit ein paar Worten, die ihn darin bestätigten, dass ihr Treffen der Anfang sein könnte von …
Es klopfte an der Tür, und ein junger Mann in einer Lederjacke und mit einem Sturzhelm unter dem Arm trat ein.
»Hallo, Powers! Hier, die Adresse steht auf dem Umschlag. Es ist drüben bei den Jungs vom CESID.«
»Okay, das schaffe ich gerade noch, bevor sie Feierabend machen.« Der Motorradbote steckte den Umschlag unter die Jacke und verschwand.
Eine junge Mutter pflügte energisch mit einem schaukelnden Kinderwagen durch den Kies, zwei ältere Männer eilten bemerkenswert rasch mit hochgeschlagenen Kragen vorbei, und ein Mädchen im Teenageralter zerrte ihren Hund hinter sich her. Es sah aus, als ob die Menschen nicht schnell genug durch den Parque del Retiro kommen könnten. Der Wind, der in den letzten Tagen aus der westlichen Meseta kam, war ungewöhnlich kalt, und nun regnete es auch noch.
Die hübsche Olivia von der brasilianischen Bank hatte Madrid nicht als Einzige verlassen. Kazanskis treue Freundin, die alte Gitana Sonia, war ebenfalls verreist. Er hatte sich letzte Woche bei einer Tasse Kaffee unter ihrem Sonnenschirm am See von ihr verabschiedet.
»Vaya con Dios – geh mit Gott, mein amerikanischer Freund, aber vertrau nur dir selbst«, hatte sie mit ihrem üblichen theatralischen Gesichtsausdruck gesagt, während sie seine Hand hielt und darauf bestand, ihm ein letztes Mal daraus zu lesen.
»Und pass auf die Drachen auf«, hatte sie spöttisch hinzugefügt, während sie einen Finger zärtlich über seinen linken kleinen Finger und den Ringfinger gleiten ließ, denen das letzte Glied fehlte.
Sonia gefiel der Gedanke, dass ein Drache am Ende der Welt seine Finger gefressen hatte. Das hatte er ihr mit einem scherzhaften Lächeln erzählt, als er aus Murmansk zurückkam. Sie hatte ihn nie wieder danach gefragt.
Die richtige Antwort entbehrte jeglicher prophetischen Mystik. Ein Handlanger der GRU, des russischen militärischen Geheimdienstes, hatte seine Finger in der schneebedeckten Tundra mit einem Bolzenschneider abgekniffen. Es war eine seltsame Vorstellung: Der Mensch verspürte immer und überall den Wunsch, eine Spur zu hinterlassen und der Welt zu vermitteln, dass er genau hier an diesem Ort gewesen war. Auch Alicia und er hatten auf ihrer Hochzeitsreise nach Argentinien vor vielen Jahren auf Feuerland am Ufer des Beagle-Kanals ein kleines Steinmännchen aufgetürmt, so weit südlich, wie man nur gelangen konnte. Er war die bizarre Version eines Entdeckungsreisenden, der einen Haufen Steine am einen Ende der Welt und zwei Fingerkuppen am anderen hinterlassen hatte …
Sonias Platz unter den Platanen hatte bereits eine andere Wahrsagerin eingenommen, und im Vorbeigehen bemerkte er, dass Sonias Sonnenschirm-Nachfolgerin ihm ein zahnloses Lächeln schenkte. Bestimmt würde sie ihn gern erobern und eine neue Kaffee-Allianz eingehen, aber vorerst war er nicht käuflich. Sonia konnte nicht ohne Weiteres ersetzt werden, und er beschloss, sie am ausgetrockneten Flussbett des Río Turia zu besuchen, sobald er das nächste Mal nach Valencia kam. Sonia hatte ihm erzählt, dass sie ihr Geschäft in der Nähe des Kongresszentrums eröffnen wollte.
Kazanski überquerte die Avenida de Menéndez Pelayo und ging direkt ins Café Chico, um vor dem Regen Schutz zu suchen. Das Café lag an der Ecke der Calle del Alcalde Sainz de Baranda, direkt gegenüber der hässlichen Kirche Santísimo Sacramento, deren knallrote Konstruktion ihn immer an ein makabres, blutiges A erinnerte, das der Generalinquisitor Torquemada vermutlich mit Wohlgefallen betrachtet hätte. Kazanski war ein Ketzer, der es längst aufgegeben hatte, das Schöne in dieser modernen Architektur zu sehen.
So groß ihre Gegensätze auch waren, das Café und die Kirche bildeten den Eingang zu seinem Viertel, wo zwischen den beiden Fahrbahnen ein stilvoll mit Steinplatten gepflasterter Fußgängerstreifen lag, gesäumt von Platanen und blühenden Büschen. Das erste Stück überwucherte saftiger Efeu, der über ein Drahtskelett wuchs und Kazanski beinahe die Illusion vermittelte, er schleiche jeden Tag nach Feierabend in seine grüne Höhle.
Im Café Chico gehörte er zu den Stammgästen – genau wie in den übrigen Geschäften der Straße.
»Ah, J. J. Willkommen, was für ein Mistwetter!«
Alberto, der Wirt, streckte die Arme aus und lächelte breit. J. J., Jan Jordi oder Kaz. Es gab viele Möglichkeiten, aber hier hieß er stets J. J. Ein J. war ebenso polnisch wie sein Vater. Das andere so spanisch wie seine Mutter, oder eher katalanisch, denn das war durchaus ein Unterschied. Er war am 23. April geboren, dem Tag, an dem Sankt Jordi, der Schutzheilige Kataloniens, gefeiert wurde. Dem Tag, an dem die Tradition gebot, seiner oder seinem Liebsten eine Rose als Zeichen der Liebe zu schenken – und ein Buch, um den Verstand der oder des Auserkorenen zu würdigen. In den letzten Jahren hatte es eine Menge Bücher für die langen Abende gegeben – aber keine Rosen.
»Ja, verflucht kalt. Ich denke, es ist Zeit für eine heiße Schokolade und eine Portion Churros.«
»Okay, J. J. Passend zum Wetter. Du bist nicht der Erste, der das heute bestellt. Einen Moment …« Alberto verschwand in der Küche.
Kazanski nahm sich die El País vom Tresen und setzte sich. Auf der Titelseite ging es um den gewaltsamen Angriff auf ein ETA-Nest in Bilbao, aber von dem Verdacht auf eine spanisch-amerikanische Verbindung wussten die Journalisten natürlich nichts.
Alberto respektierte seine Zeitungslektüre und stellte ihm ohne Kommentar einen kleinen Teller Churros und eine Tasse heißer Schokolade zum darin Eintauchen hin.
Die leichte Mahlzeit musste reichen, bis er heute Abend um neun zum Essen bei Carlos und Carmen eingeladen war. Nicht wie gewöhnlich in einem Restaurant, nein, bei ihnen zu Hause, gleich um die Ecke.
Carlos, el Caudillo, hatte ihn und Ulf feierlich eingeladen – seine beiden treuen Fußballkameraden aus der amerikanischen und schwedischen Botschaft. Und in einem Augenblick der Großzügigkeit auch Once-Marta, die bucklige Göttin des Glücks, das kleinwüchsige Geschöpf, das in der Hütte der Blindenlotterie ONCE vor seiner Haustür saß.
Ja, so sollte es sein. Für den alten und ehemals hochgeachteten Psychologen und glühenden Franco-Anhänger Carlos war es eine ungewöhnliche Geste, jemanden von der Straße zum Abendessen einzuladen. Andererseits zeigte es, dass er nicht nur ein alter Griesgram war, sondern auch herzlich sein konnte – nicht zuletzt genoss er den täglichen Plausch mit Once-Marta.
Der Anlass für die Einladung blieb wie immer bei el Caudillo vage. Er behauptete, es sei ein Abendessen zu Francos Ehren und zur Erinnerung an seinen Tod am 20. November. Allerdings hatte er auch schon zu Ehren von Puskás, Di Stéfano und Gento eingeladen, alle drei Real-Madrid-Helden, die seinem Herzen nahestanden.
Es hörte nicht auf, zu regnen. Kazanski trank den letzten Schluck Schokolade, ließ aber einige Churros liegen. So war es jedes Mal. Er freute sich im Herbst auf den ersten Bissen der hellbraunen frittierten Teigstangen, aber wenn er sie dann endlich bekam, hatte er auch schnell wieder genug davon.
Kazanski faltete die Zeitung zusammen, wechselte ein paar Worte mit Alberto und hob die Hand zu einem Abschiedsgruß, um die letzten hundert Meter zu seiner Wohnung zu gehen. Bevor er sich für das große Ereignis am Abend umzog, wollte er noch ein Bad nehmen.
Die Straße glänzte unter den Laternen. Die Pfützen in dem unebenen und rissigen Asphalt sahen in der sternenklaren Nacht wie die Splitter eines Spiegels aus, der Regen hatte endlich aufgehört. Er atmete tief ein. An einem wärmeren Tag hätte der Regen diese wunderbar reinigende Wirkung gehabt, die beinahe zu schmecken war, aber nicht in dieser Nacht, dazu war es zu kalt.
Es war spät geworden. Die Uhr zeigte halb zwei, und Kazanski hatte sich gerade von Ulf und Once-Marta verabschiedet, die ein Taxi nehmen wollten, während er ein Stück die Calle de Antonio Arias hinaufging. Er wollte noch einen kleinen Spaziergang in seinem Viertel machen, um nach dem Abend, an dem viel geraucht worden war, ein bisschen frische Luft zu schnappen.
Es war ein perfekter Abend gewesen. El Caudillo hatte sich in glänzender Laune als großer Gastgeber der Gedenkfeier präsentiert – bestens unterstützt von seiner Ehefrau Carmen, die trotz ihrer gewaltigen Körperfülle mit dem unverzichtbaren spanisch-zärtlichen Diminutiv Carmencita angesprochen wurde und mit verblüffender Eleganz in die Küche glitt, um mit üppigen Platten zurückzukehren.
Nun war es überall still im Vogelviertel, wie Kazanski es nannte. Die Ampel am Fußgängerübergang an der großen Kreuzung war abgeschaltet. Wenn man auf die Knöpfe drückte, ertönte frühlingshaftes Gezwitscher, um die Blinden über die Straße zu geleiten. Sogar hoch oben in seiner Wohnung konnte er die Ampel hören, aber jetzt herrschte eine erlösende Stille, als sammelte das Viertel Kräfte für einen neuen, hektischen Morgen.
»Lasst uns auf den Großen anstoßen! Ja, das machen wir. Francisco Paulino Hermenegildo Teódulo Franco Bahamonde lebe hoch! Äh, auch wenn er schon tot ist. Prost, Freunde!«
Kazanski rief sich die Worte des Alten lächelnd in Erinnerung, während er die Straße überquerte. Alle hatten geschmunzelt, denn obwohl niemand an Carlos’ Ergebenheit Franco gegenüber zweifelte, besaß er doch so viel Selbstironie, dass er das Komische in seiner Aufforderung erkannte – ach, eigentlich war er doch nur ein alter Mann, der sich über die Gesellschaft seiner Freunde freute.
Für Once-Marta, die bucklige Lotterieverkäuferin, war es ein einzigartiger Besuch in einem anderen Universum gewesen. Sie wohnte in einer engen Zweizimmerwohnung in einer von Latinos dominierten Vorstadt im Süden. Sie hatte den Abend in ihrem besten Kleid und mit vergnügten Augen genossen.
Auf die übliche spanische Art hatten sie in Maßen getrunken, und auch Kazanski hatte nicht mehr das Gefühl, ein Glas nach dem anderen trinken zu müssen. Inzwischen spielte Alkohol eine so untergeordnete Rolle, dass er nicht einmal einen Gedanken daran verschwenden musste. Er brauchte sich nicht mehr wie früher strenge Restriktionen aufzuerlegen.
An Ulfs breitem Lächeln und seinen glänzenden Augen hatte er abgelesen, dass der Schwede vermutlich derjenige war, der am meisten getrunken hatte. Es war jetzt ein Jahr her, dass Ulf von einem Krankenwagen abtransportiert worden war, nachdem man ihn bewusstlos in Kazanskis Hauseingang gefunden hatte. Kazanski erinnerte sich schmerzlich an den Schein des Blaulichts, der unheilverkündend über die Fassade jagte, und er spürte erneut dieses intuitive Gefühl im Magen – dass er der Grund für alles gewesen war.
Der Überfall auf Ulf hatte ihn ans Ende der Welt gebracht, nach Murmansk. Er hatte dort oben etwas gefunden, ohne genau zu wissen, was es war – und er hatte etwas verloren. Gefunden hatte er den Respekt vor dem Leben und einem Volk, das dort unter rauesten Bedingungen lebte. Er hatte mit der Milizionärin Walentina Freundschaft geschlossen, und vielleicht hätte er sich sogar in sie verliebt, wenn es in seinem Herzen nicht Ewa gegeben hätte. Walentina würde er nie wiedersehen, doch das schärfte nur seine Erinnerung an diese kettenrauchende Zynikerin, die im Geheimen davon träumte, die Welt zu entdecken, die sich aber damit begnügen musste, Postkarten zu sammeln. Er hätte sich auch mit Wiktor anfreunden können, Walentinas geliebtem Witja, der in einer abgrundtief schlechten Welt hoch gepokert – und verloren hatte. Wiktor würde er in Erinnerung behalten. Mit beiden wäre er in Kontakt geblieben, wenn die Umstände es ihm ermöglicht hätten.
Aber Ulf hatte er noch. Der groß gewachsene Kulturattaché war damals aus dem Koma erwacht, ohne sich an irgendetwas erinnern zu können. Kazanski erzählte seinem schwedischen Freund, dass es um einen Betrug mit Atommüll ging – mehr sagte er nicht. Viele Menschen veränderten sich, wenn sie lange im Koma gelegen hatten und niemals den wahren Grund dafür erfuhren, aber nicht Ulf Nyström. Er war ein warmherziger Hüne mit einer angeborenen Empathie und Klugheit, die sich über die Jahre noch weiterentwickelt hatten. Sie hatten beide ihre Liebsten verloren, aus natürlichen und unnatürlichen Ursachen, aber sie verband keine gemeinsame Trauer, eher ihre Unterschiedlichkeit. Kazanski wusste um sein reserviertes Wesen, das Dinge unausgesprochen ließ, während der Schwede sanftmütig und offen wirkte – vielleicht ein stilles, aber sehr tiefes Wasser, wie der Waldsee in Blekinge, an dessen Ufer er mitansehen musste, wie der Krebs den langen Kampf gegen seine Ulla gewann.
Für Ulla war es eine Erlösung gewesen. Sie starb friedlich. Alicia und Rosa waren jäh aus dem Leben gerissen worden, von einer höheren, verbrecherischen Macht, die sich nicht um Recht und Gerechtigkeit scherte. Sie starben an ihren Verletzungen, nachdem russische Mafiosniki ihr Auto von der Straße gedrängt hatten. Sie waren schon tot, ehe sie Opfer der Flammen wurden, das hatten die Ärzte im rechtsmedizinischen Institut in Moskau bekräftigt. Kazanski konnte diesen Gedanken jetzt zulassen – ohne dass ihm schwindelig wurde und er sich fast übergeben musste.
Er überquerte die Straße und kam an dem Laden vorbei, der Secondhandkleidung für einen guten Zweck verkaufte. Den hatte er einen Tag nach seiner Rückkehr aus Murmansk aufgesucht. Zögernd hatte er Rosas kleines geblümtes Sommerkleid und Alicias schlichtes schwarzes aus der Kommode geholt, das sie angehabt hatte, als sie La Moreneta besuchten, die Schwarze Madonna im Kloster Montserrat, um den Apfel zu küssen und ihren Segen zu erbitten.
Er hatte die beiden Kleider eingepackt, die einzigen, die er behalten hatte, und war geradewegs zu dem Secondhandladen gegangen – fest entschlossen, einen endgültigen Schlussstrich zu ziehen. Aber kurz vor der Tür hatte ihn der Mut verlassen. Mit klopfendem Herzen war er auf dem Bürgersteig stehen geblieben, schwankend zwischen Schmerz und Demütigung. Er hatte sich für die Demütigung entschieden. Und erkannt, dass er es nicht fertigbrachte. Er hatte eingesehen, dass manche Kriege zu groß waren, um sie zu gewinnen. Stattdessen schickte er die beiden Kleider seinen Eltern in New York. So blieben sie erhalten – und waren dennoch fort.
Das Leben konnte neu beginnen. Und es hatte bereits begonnen. Murmansk hatte ihm die Augen geöffnet, und er war als klügerer Mann zurückgekehrt, wie ein Wandergeselle, der seine Unruhe überwunden hatte und bereit war, sich mit neuem Wissen in der Heimat niederzulassen. Er musste das nicht aussprechen. Ewa würde es sehr schnell spüren.
Kazanski bog um die Ecke in die kleine Allee und schlug den Heimweg ein. Ja, vor allem hatte er Ruhe gefunden und erkannt, dass es an der Zeit war, loszulassen. Nach einem Abend wie diesem war er glücklich, nicht überschwänglich, eher ruhig und dankbar. Er hatte Freunde. Er hatte el Caudillo und Carmen, die Glücksgöttin und Ulf.
Während er nach Hause schlenderte, ging ihm eine dieser kleinen irrationalen Rechenaufgaben durch den Kopf, vor denen niemand gefeit ist. Einer seiner jungen Kollegen zählte Frauen und konnte aufführen, wo er überall die Hosen heruntergelassen hatte. Andere konnten exakt benennen, wie viele Autos sie schon gehabt hatten. Er zählte im Augenblick seine Freunde. Es waren nicht viele. Ulf war der einzige Vertraute, aber das reichte. Wenn er das Ehepaar Ortega miteinbezog, die das kleine Delikatessengeschäft in seinem Haus führten, konnte er seine Freunde an zwei Händen abzählen. Und weltweit waren es vier, fünf Kollegen, die ihn in seinem Kampf um Rehabilitation unterstützt hatten. Aber enge Freunde … Höchstens die vier von dem Abendessen. Nicht sonderlich viele, aber andererseits war es ein Privileg, sich seine Freunde selbst aussuchen zu können. Wenige – aber gute. So sollte es sein. Und einen, der einen bis zum Ende des Lebens begleitete, wenn Körper und Geist verbraucht waren und die Zeit gekommen war.
Er wollte von Ewa begleitet werden. Aber wollte sie das auch? Wenn sie daran zweifelte, wäre er in der Lage, sie zu überzeugen?
Es war halb drei, als Kazanski die letzte Stufe hinaufstieg und seine Wohnung aufschloss, den Kopf von lästigen Grübeleien befreit. Er hängte seinen Mantel auf einen Bügel, schaltete das Licht im Wohnzimmer und in der Küche an, goss sich ein Glas Milch ein, überprüfte den Anrufbeantworter – keine Anrufe – und ging zurück in den Flur.
Erst als er sich bückte, um seine Schuhe auszuziehen, sah er den weißen Umschlag, der so schräg auf dem Boden gelandet war, dass er hochkant an der Wand stand.
3
Auf dem Umschlag stand sein Name. Er riss ihn auf und las: »Lieber Jan Jordi Kazanski, leider habe ich Sie nicht zu Hause angetroffen, daher diese Nachricht. Mein Name ist Claude Pignon, ich bin Jurist. Ich würde Sie gern auf ein kurzes Gespräch treffen und bitte Sie, mich morgen in meinem Hotel anzurufen, um einen Zeitpunkt zu vereinbaren. Mit freundlichen Grüßen C. Pignon«
Die Nachricht war auf einen Briefbogen des Gran Hotel Reina Victoria an der Plaza del Ángel geschrieben. Kazanski kannte das Hotel in dem alten, imposanten Gebäude gut – es war nicht der billigste Ort, um in Madrid zu übernachten. Was zum Henker wollte dieser Mann, offenbar ein Franzose, und weshalb war sein Anliegen so wichtig, dass er zu seiner Wohnung kam, ohne zu wissen, ob Kazanski überhaupt zu Hause war?
Kazanski trank die kalte Milch in einem Zug. Am liebsten hätte er diese merkwürdige Bitte ignoriert, aber es gelang ihm nicht. Die Nachricht löste auf der Stelle alle möglichen Gedanken aus. Stand sie vielleicht in Verbindung mit seinem aktuellen Job, die Aufdeckung von amerikanischen ETA-Kontakten? Ein Anwerbeversuch war ausgeschlossen. Man hatte nur ein einziges Mal versucht, ihn zu überzeugen, die Seiten zu wechseln, und kein Geheimdienst würde sich so plump anstellen. So etwas war ein langwieriger Prozess, der häufig im kollegialen Umfeld seinen Anfang nahm.
Es war ein perfekter Abend gewesen, und es hatte ihn mit innerer Ruhe erfüllt, dort draußen in der kühlen Nacht Bilanz über seine Freundschaften zu ziehen. Umso mehr ärgerte es ihn, dass ihm diese Freude verdorben worden war, weil ein Fremder sich einfach aufdrängte und Fragen hinterließ – aber keine Antworten.
Es ließ ihm keine Ruhe. Diese Nachricht war nichts anderes als Hausfriedensbruch, und obwohl es schon spät war, griff er zum Telefon.
»Gran Hotel Reina Victoria, guten Abend, wie können wir Ihnen behilflich sein?«
»Ich würde gern einen Gast namens Claude Pignon sprechen.«
»Äh, ich denke, es ist schon ziemlich spät …«
»Na und? Wohnt bei Ihnen ein Claude Pignon?«
»Augenblick, der Herr. Ja … Claude Pignon, Zimmer 310.«
»Dann stellen Sie mich bitte durch.«
»Es ist fast drei Uhr, also …«
»Es ist wichtig! Bitte, stellen Sie mich durch. Danke …« Er versuchte sich zu beherrschen, und es war ihm klar, dass er auch Pech haben könnte. Wenn er an einen Prinzipienreiter an der Rezeption geraten war, könnte der sich schon bei einem falschen Wort aufblasen wie eine Rettungsinsel mit Selbstauslöser.
»Wichtig … Einen Augenblick, mein Herr.«
Das Telefon klingelte eine Weile, bevor abgenommen wurde.
»Pignon …«, ertönte eine schlaftrunkene Stimme.
»Kazanski, Jan Jordi Kazanski.« Mehr sagte er nicht. Den Rest durfte gern der Fremde übernehmen.
»Ah, ja. Ich hatte Ihren Anruf nicht vor morgen früh erwartet.«
»Hm …«
»Könnten wir einen Zeitpunkt vereinbaren, um uns zu treffen, sagen wir, hier im Hotel? Es ist ein bisschen spät …«
»Spät? Sie kennen mich nicht, Sie hinterlassen eine Nachricht – und jetzt sagen Sie, es ist spät? Was zum Teufel soll das?«
»Entschuldigen Sie. Ich will nicht unhöflich erscheinen, und ich weiß, dass meine Bitte überraschend kam. Ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel, aber …«
»Kommen Sie zur Sache.«
»Die Sache ist die, dass wir die Angelegenheit leider nicht am Telefon besprechen können.«
»In welche Richtung bewegen wir uns?«
»Es geht um einen Job, den ich Ihnen anbieten will.«
»Ich habe kein Interesse an irgendwelchen Jobs. Ich habe bereits einen.«
»Lassen Sie mich doch wenigstens versuchen, es Ihnen morgen zu erklären. Es ist ein sehr wichtiger Job, und ich bin bereit, Ihnen ein, sagen wir, Beratungshonorar zu bezahlen, wenn Sie mir zunächst einmal zuhören.«
»Hm, okay. Parque del Retiro, die Bank am Springbrunnen, am anderen Ende des Bootshauses, um 17:00 Uhr. Kommen Sie allein.«
»Ich bin allein. Parque del Retiro, Bank … Die finde ich. Gut, einverstanden.«
»Haben Sie eine Mobilnummer?«
»Ja«, antwortete Pignon.
Kazanski notierte die Nummer auf dem Umschlag. Er machte sich nicht die Mühe, das Gespräch höflich zu beenden, sondern legte einfach auf. Er war immer noch verärgert, verspürte aber gleichzeitig ein wachsendes Gefühl von Unruhe. Er hatte eine erste Vorsichtsmaßnahme getroffen – das Treffen fand unter freiem Himmel und nicht im Hotel statt.
Niemand in seinem Umfeld wusste, dass er bei der CIA beschäftigt war – der Firma. Alle glaubten, er wäre ein Mitarbeiter des Sonderberaters für Wirtschaftsfragen in der Botschaft an der Calle de Serrano. Gab es etwas Langweiligeres? Aber wie oft bekam ein grauer Durchschnittsmitarbeiter in einem langweiligen Büro in der diskreten Diplomatie eine solche Anfrage? Selten – und wenn man einen Diplomaten in Versuchung bringen wollte, wurde ganz anders vorgegangen. Deshalb war die Bitte dieses Claude Pignon so verdammt beunruhigend.
Der Tag schleppte sich dahin. Aber vielleicht wurde ihm jetzt auch nur bewusst, dass das gesamte letzte Jahr in einem gemächlichen Tempo verstrichen war.
Spanien und Madrid waren für die Aktivitäten der Firma nie die erste Priorität, und so würde es auch weiterhin bleiben. Als Kazanski sich die Hauptstadt auf der kastilischen Hochebene ausgesucht hatte, entschied er sich bewusst für einen Ort, an dem er nicht im Mittelpunkt stand. Den ganzen Vormittag hatte er gegrübelt, ob es wohl an der Zeit wäre, zu wechseln – den Einsatzort, den Job –, und dazwischen schob sich immer wieder der Gedanke an das Treffen am Nachmittag. Er wusste, er würde jeden inoffiziellen Auftrag ablehnen, vor allem falls er nicht unter der Leitung der Firma stattfinden sollte, aber er war neugierig und wollte unbedingt die Dämonen aus seinem Bewusstsein verbannen.
Kurz vor der Mittagspause rief Ulf an. Er wollte ihm nur Bescheid geben, dass er heute Abend im Estadio Bernabéu dabei sein werde, wenn die Königlichen gegen Santander spielten. Ulf hatte befürchtet, dass er wegen des Besuchs einer Delegation des schwedischen Kulturministeriums nicht ins Stadion mitkommen könne. Wie üblich wollten sie sich mit el Caudillo bei Pablo treffen, der die kleine Cafeteria Dominguez gegenüber von Kazanskis Wohnung führte.
Kazanski hatte mit zwei jüngeren Kollegen in einer Seitengasse zu Mittag gegessen, wo auch die Angestellten der Banco do Brasil regelmäßig aßen. Während die beiden Schnösel ein paar brasilianische Frauen beäugten und bei Salat und Mineralwasser todsichere Karrieretipps austauschten, war er bei einem Stück Tortilla in seine Gedanken vertieft gewesen. Er freute sich auf den Moment, in dem das Gespräch mit dem Fremden vorbei war und wieder Ruhe hinter den Palisaden des Forts Kazanski einkehrte.
Aber die mysteriöse Nachricht warf noch weitere Fragen auf, die nicht so einfach zu beantworten waren. Wenn ein kleiner Zettel genügte, um ihn nervös und ängstlich werden zu lassen – war das nicht ein Zeichen dafür, dass er zu sehr in Routine und Sicherheit versunken war? Seit Murmansk hatte er nicht die geringste Dosis Adrenalin ausgeschüttet. Höchstens wenn er auf der Straße versehentlich vor ein Auto gelaufen war … Versuchte er, das zu vermeiden? Wollte er deshalb einen operativen Job ablehnen? Näherte er sich etwa der Schar unscheinbarer Männer mittleren Alters, die am liebsten nur noch Papier auf ihrem Schreibtisch umschichteten, um die Zeit totzuschlagen? Die aus Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen, gar nichts mehr entschieden? Die sofort einen Muskelfaserriss bekamen, wenn sie zeigen sollten, wie gut sie früher einmal beim Sport gewesen waren? Er stemmte Gewichte von annähernd einhundert Kilo und drückte sie spielend leicht von seinem Brustkasten weg – das würde er also jederzeit abstreiten. Aber möglicherweise war seine hervorragende physische Verfassung nur ein Vorwand? Er wollte mit Ewa fünfzig, sechzig, siebzig, vielleicht sogar achtzig Jahre alt werden, aber wie sollte er das machen? Sollte er es einfach darauf ankommen lassen und warten? Warten worauf? Dass der Sensenmann eines Tages kam, ihn auf seiner Liste abhakte und bat, mitzukommen?
Allem Anschein nach diskutierte er mit sich selbst, doch es war eine Diskussion, die sich für eine ungeduldige Seele wie ihn fatalerweise in die Länge ziehen würde. Denn auch wenn der französische Jurist wieder abgereist war, würde sie sich in seinem Kopf fortsetzen. Wofür lebte er? Wohl kaum für den Job. Er konnte ohne Weiteres die Rolle seines eigenen Großinquisitors übernehmen – aber er konnte einfach keine Antworten liefern.
Kazanski sah auf seine Armbanduhr. Endlich. Es blieb nicht mehr viel Zeit. 16:15 Uhr. Er fuhr den Computer herunter, um den viereckigen Kasten zu verlassen, die Vertretung der Vereinigten Staaten, den Hort der Diplomatie auf eigenem Grund und Boden – umgeben von einem Zaun mit einem riesigen elektrischen Gittertor, das dem Sesam-öffne-dich der Wachtposten gehorchte und zuverlässig am späten Nachmittag der Sklaverei ein Ende setzte.
Verborgen hinter einem der Büsche des Parks beobachtete Kazanski aus weiter Entfernung einen Mann mittleren Alters mit spärlichem Haar, der auf der Bank saß. Er trug einen dunklen Baumwollmantel, wie ihn auch ein Minister, ein Jurist oder ein Auftragskiller hätte tragen können.
Kazanski zog sein Handy aus der Tasche und gab die Nummer ein. Sekunden später nahm der Mann sein Telefon zur Hand und hielt es ans Ohr. Das also war der Franzose, der wie vereinbart auf seinem Platz saß.
»Pignon …«
»Stehen Sie auf und gehen Sie nach links. Nehmen Sie den breiten Weg und gehen Sie über die Plaza de Honduras, den runden Kiesplatz.«
»Verstanden.«
»Der Weg heißt Paseo de Cuba. Gehen Sie weiter bis zum nächsten Platz, Glorieta del Ángel Caído, und setzen Sie sich dort auf eine Bank.«
Der Franzose gehorchte, und Kazanski folgte ihm langsam in gehörigem Abstand auf einem der kleinen Wege, die parallel verliefen. Er achtete ununterbrochen auf das geringste verdächtige Anzeichen – aber es war alles in Ordnung. Der Park war weitgehend leer, und die wenigen Besucher, die er sah, waren junge oder alte Menschen. Niemand, der seinen inneren Alarm auslöste.
Schließlich erreichte der Franzose sein Ziel und setzte sich. Drei Bänke weiter saß ein Teenagerpärchen und alberte herum, daneben eine ältere Frau, die Tauben fütterte. Es hätte nicht besser sein können.
»Pignon, Claude Pignon … Guten Tag, Herr Kazanski.« Der große Mann war aufgestanden und streckte lächelnd eine Hand aus.
Kazanski nickte schweigend und setzte sich, ohne Pignons Hand zu beachten. Die Situation kam ihm wie ein Déjà-vu vor, und das minderte sein Unbehagen in keiner Weise. Ein Vertrauter des Senators hatte ihn hier im Park auf einer dieser Bänke abgepasst und ihm einen Zusatzauftrag für seine Mission mit auf den Weg nach Murmansk gegeben. Eine Mission, die streng geheim sein sollte, ohne es zu sein. Daher war eine Parkbank eine Art trügerische Einrichtung, aber andererseits war der Parque del Retiro auch ein sicherer Ort, an dem er selbst die Regie führen konnte.
Wie am Vorabend am Telefon schwieg Kazanski. Er überließ dem Franzosen die Eröffnung.
»Wie ich schon sagte, geht es um einen Job. Sie sagten ja bereits, dass Sie nicht interessiert sind. Aber ich bitte Sie, sich mein Anliegen zumindest anzuhören.«
Kazanski nickte.
»Haben Sie irgendwelche Erfahrungen mit dem Balkan?«
»Nicht speziell. Ich bin Diplomat, und Diplomaten sind eher allgemein informiert.«
»Natürlich, aber Sie haben dort nie gearbeitet, oder?«
»Nein …«
»Bei diesem Job geht es um den Balkan. Ich vertrete eine Organisation, und mir wurde aufgetragen, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. Sie besitzen Qualitäten, die für meine Vorgesetzten interessant sind, deshalb …«
»Was wissen Sie denn über meine Qualifikationen?«
»Hm, sagen wir, wir haben im Vorfeld einige Erkundigungen eingeholt, nicht wahr? Bei dem Job geht es, schlicht gesagt, darum, eine Person zu finden, von der wir glauben, dass sie sich irgendwo auf dem Balkan befindet. Wir sind eine Art unabhängige humanitäre Organisation, weshalb Sie sich keine Gedanken darüber machen müssen, ob Sie eventuell Ihren Arbeitgeber kompromittieren.«
»Was wissen Sie über meinen Arbeitgeber?«
»Wie ich schon sagte, haben wir einige Erkundigungen eingeholt …«
»Und wer ist Ihre ›Organisation‹?«
Kazanski zündete sich eine Zigarette an. Er war verwirrt und überaus beunruhigt. Der Fremde kannte offenbar seinen Status in der Firma – schlimmer konnte es nicht mehr werden. Selbst in der Botschaft waren nur einige wenige über seinen wirklichen Job informiert – und nun also dieser Mann. Für einen Agenten war das ein Dolchstoß. Seine Identität musste absolut geheim sein, andernfalls stellte er ein Sicherheitsrisiko und ein eindeutiges Ziel dar. Dieser Claude Pignon hatte gerade ein Wissen preisgegeben, das Kazanski in letzter Konsequenz disqualifizierte.
»Ich kann keine Details nennen, bevor Sie nicht zugesagt haben. Es ist bedauerlich, aber in dieser Hinsicht ist mein Mandat beschränkt. Die Person, die wir suchen, ist ein Mann, mit dem wir uns gern unterhalten würden. Wenn Sie ihn finden, erhalten Sie dreihunderttausend Dollar.«
»Ich bin kein Kopfgeldjäger. Ich bin Diplomat und in der Abteilung für Wirtschaft und Handel angestellt. Und wenn ich Diplomat sage, dann meine ich Diplomat …«
»Ja, natürlich, aber wollen Sie nicht wenigstens über mein Angebot nachdenken?«
»Nein. Meine Antwort lautet Nein. Sagen Sie Ihrem Vorgesetzten, Sie hätten es versucht – aber vergeblich. So etwas liegt weit entfernt von meinem Arbeitsbereich. Das hat nichts mit Wirtschaft zu tun, und der Balkan interessiert mich absolut nicht.«
»Hm, nun gut. Meine Aufgabe ist es nicht, Sie unter Druck zu setzen. Ich werde Ihre Antwort weiterleiten. Ich kann jedoch nicht versprechen, dass ich es nicht noch einmal versuche werde, wenn es mir aufgetragen wird.«
»Nur zu. Meine Antwort wird dann immer noch Nein sein.«
Es wurde einer dieser berauschenden Fußballabende, die in dieser Saison so selten geworden waren. Reals Angriff wogte unablässig über den Rasen, als würde die Mannschaft jeden Gegner für immer schlagen wollen. Mal griffen sie über den linken Flügel an, dann über den rechten – und manchmal kombinierten sie mit einer einzigen blitzschnellen, geradezu magischen Aktion zwischen beiden Seiten, sodass die Verteidigung der Gäste auseinanderfiel.
In der Halbzeitpause redete el Caudillo über Puskás und zeigte mit einem gekrümmten Finger, wie der effektive Ungar seine Gegner überrumpelt hatte. Ulf lachte wie immer ausgelassen. Sie hatten es schon tausendmal gehört. Der Schwede hatte keine echten Idole, während Kazanski voller Wehmut in Erinnerungen an den Dänen Michael Laudrup und den Bulgaren Christo Stoitschkow schwelgte. Es war albern, die beiden jedes Mal in den Himmel zu loben, immerhin war es inzwischen etliche Jahre her, dass sie aktiv gespielt hatten, aber hin und wieder musste er sich gegen den noch nostalgischeren el Caudillo behaupten, der das liebte und erwartete, dass Kazanski auf den Spaß einging.
Die zweite Halbzeit verlief ähnlich, und das Fußballspiel endete mit einem unglaublichen 7:1 für Real. Der Jubel auf den Tribünen hatte sich in Kazanskis Ohren noch nicht gelegt, als er nach Hause kam, The Joshua Tree von U2 in den CD-Spieler einlegte und sich in den Sessel neben der Stehlampe fallen ließ. Manchmal konnte man fast meinen, der Mensch wäre nur auf der Erde, um sich selbst zu quälen und sich mit Fragen über das Dasein und den Sinn des Lebens zu martern, auf die es keine Antworten gab. Aber in diesem Moment waren seine inneren Diskussionen des Tages vergessen, und nicht einmal der Song »I Still Haven’t Found What I’m Looking For« brachte ihn ins Grübeln. Stattdessen schlug er voller Vorfreude das zwölfte Kapitel in dem neuen Buch über Bill Clinton auf – dem Mann, der ein göttliches rhetorisches Talent besaß und dessen nachlässiger Umgang mit Zigarren die Gabe eines republikanischen Teufels war. Charismatisch und korrumpiert, vermutlich würde der Mann diesen Eindruck hinterlassen, aber das Buch war auf jeden Fall interessant.
Kazanski las gerade über Clintons erste Begegnung mit Jassir Arafat, als das Telefon klingelte. Es klingelte selten, und schon gar nicht so spät. Er spürte ein leichtes Kribbeln im Magen, als er den Hörer abnahm. Ließ Ewa vielleicht endlich von sich hören?
»Kazanski«, meldete er sich.
»Guten Abend. Claude Pignon. Entschuldigen Sie, dass ich so spät störe.«
»Ich dachte, wir wären fertig?«
»Ich habe Ihre Antwort weitergegeben, wurde aber beauftragt, es noch einmal bei Ihnen zu versuchen.«
»Das ist Zeitverschwendung. Auf Wieder…«
»Halt, einen Augenblick, bleiben Sie am Apparat! Würde es etwas ändern, wenn ich Ihnen sage, dass der Job in Verbindung mit einer Frau steht, einer gewissen Ewa Siwonia … Ich glaube, Sie kennen sie.«
4
Den Haag, Niederlande
»Sieh zu, dass du bald nach Hause zu deinem Kleinen kommst, Boyd. Vielen Dank und bis morgen, Jungs.« Die burschikose Frau hob eine Hand zum Gruß, während einer der uniformierten Beamten ihr die Tür aufhielt.
»Aber gern, Frau Sterling«, erwiderten die Beamten wie aus einem Mund, und Boyd, der Mann hinter dem Gepäckscanner, nickte mit einem breiten Lächeln.
Patricia Sterling war beliebt bei dem Personal des imposanten Gebäudes, in dem früher eine Versicherungsgesellschaft untergebracht gewesen war. Die Frau mit den Sommersprossen und den flammend roten Haaren gehörte zur Führungsspitze, aber sie war sich nicht zu fein, mit gewöhnlichen Sterblichen zu reden. Natürlich kannte sie nicht alle der fast eintausendzweihundert Angestellten, aber sie bemühte sich hartnäckig und hatte sich damit rasch Respekt verschafft.
Die Australierin war die Stabschefin der Chefanklägerin und hatte gerade zwei Jahre auf diesem herausfordernden Posten des Internationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien hinter sich. The Cattle Queen hatte die Presse sie getauft, nachdem die Journalisten ein wenig in ihrer Vergangenheit gegraben hatten. Patricia Sterling war ebenso robust wie ihre Statur, und mit ihrer manchmal etwas brüsken Art hatte die Frau aus Down Under für neue Zeiten in dem gewaltigen Gebäude am Den Haager Churchillplein Nummer 1 gesorgt – jedenfalls bei den mehreren Hundert Angestellten der Chefanklage. Es gab ein Gerücht, dass sie lieber Bier als ein Glas Rotwein trank, und diese Geschichte schmälerte keineswegs ihre Popularität.
Dass eine Frau diesen wichtigen Posten bekleidete, erregte längst keine Aufmerksamkeit mehr, denn es gab inzwischen eine gewisse Tradition weiblicher Power in dieser Institution, die von der Chefanklägerin Carla Del Ponte aus der Schweiz und vor ihr von der Kanadierin Louise Arbour geleitet wurde.
Patricia Sterling blieb kurz vor dem Kontrollposten stehen und spannte ihren Regenschirm auf, bevor sie mit federnden Schritten an dem großen Becken mit dem Springbrunnen und den schmiedeeisernen Gespenstern entlangging, die wohl Skulpturen darstellen sollten. Sie ging, sooft sie konnte, zu Fuß nach Hause, das Wetter war ihr egal. Auch diese Gewohnheit trug dazu bei, dass sie als eher ungewöhnlich wahrgenommen wurde.
Sie hatte es nicht weit. Sie ging die Johan de Wittlaan entlang und dann die Seitengassen hinauf zur President Kennedylaan, um dem Verkehr auszuweichen, und stand zehn Minuten später vor ihrer Haustür am Kranenburgweg direkt am Afvoerkanaal.
Die Stufen knarrten unter ihrem Gewicht, als sie mit unvermindertem Tempo die alte, geschwungene Treppe hochstieg. Sie wohnte in einer frisch renovierten Vierzimmerwohnung im dritten Stock, und kaum war sie eingetreten, bot sich ihr ein Anblick, den sie am Morgen verdrängt hatte: totales Chaos. Auf dem Wohnzimmerboden vor dem Sofa lagen kleine und große Stapel von roten Ringordnern, roten Mappen und Unterlagen. Sie musste ein wenig aufräumen, bevor er kam. Es war ohnehin schon höchst ungewöhnlich, einen Mitarbeiter nach Hause einzuladen, aber sie hätte es nicht ertragen, wenn er den Eindruck bekäme, seine Chefin sei unordentlich.
Sie holte sich ein Dosenbier aus dem Kühlschrank, kramte ihre Zigaretten aus der Aktentasche und ließ sich seufzend aufs Sofa fallen. Die Dose war ein Klassiker, gelb mit vier roten Kreuzen: ein Four-X aus Queensland, wo sie geboren und aufgewachsen war. Der Ort auf der Welt, den sie am meisten liebte. Sie konnte auf den Sportpark Houtrust blicken, wo sie mindestens einmal pro Woche Tennis spielte. Ihr Gewicht war seit ihrer Teenagerzeit ein verdammtes Problem, und es war mit den Jahren nicht besser geworden. Sie war, so hieß es wohl, in den mittleren Jahren, fünfundvierzig Jahre alt, und eine gewisse Anzahl Kilo verteilten sich ein bisschen zu großzügig auf ihrem Körper.
Die ersten beiden Jahre waren wie im Flug vergangen, und jetzt gab es nur noch einen Fall zu klären, daher ging sie davon aus, dass sie noch drei Jahre lang Stabschefin bleiben würde. In dieser Zeit wollte sie die Resultate liefern, die ihre beiden männlichen Vorgänger nicht vorzuweisen hatten, dann konnte die Schweizerin die Ernte einfahren und sich in ihrem strahlenden Erfolg sonnen, bevor das Tribunal sich allmählich selbst auflöste.
Wenn ihr das gelang, würde sie sich damit für den Posten der Chefanklägerin am Internationalen Strafgerichtshof der UN empfehlen, der ebenfalls in Den Haag angesiedelt werden sollte. Ein Job, für den sie ihrer Meinung nach qualifizierter war als ihre derzeitige Chefin für den Posten des Jugoslawien-Tribunals. Und wenn es anders lief, könnten die Europäer ihr gestohlen bleiben, und sie würde nach Queensland in die Sonne zurückkehren.
Die Angewohnheit, Four-X zu trinken, behielt sie für sich. Im Grunde hatte sie nichts dazu beigetragen, den Mythos der taffen »Vieh-Königin« zu befeuern. Die Presse war von allein auf den Spitznamen gekommen, den sie sich zu eigen gemacht hatte, nachdem ihr bei näherem Hinsehen bewusst geworden war, dass Durchsetzungsvermögen und ein scharfes Profil in den Medien unverzichtbar waren – vor allem für eine Frau mit Ambitionen. Sie nutzte die Presse sehr bewusst, und umgekehrt brauchte die Presse sie. Allerdings war es ein Balanceakt.
In kurzer Zeit hatte sie ein so markantes Profil erlangt, dass sie mehrfach mit ihren Vorgesetzten, dem stellvertretenden Ankläger und der Chefanklägerin, aneinandergeraten war, denen es gar nicht gefiel, im Schatten ihrer Stabschefin zu stehen. Und Patricia Sterling wusste, dass die beiden ihre versnobten Bekanntenkreise mit unterhaltsamen Geschichten über die Cattle Queen versorgten. Aber sie wusste auch, dass sie ihr nichts anhaben konnten, weil sie allein für den Erfolg des Tribunals verantwortlich war, der exakt mit ihrer Ankunft eingetreten war. Sie goss täglich das Fundament dafür und leitete die zahlreichen Teams von juristischen Ratgebern, Ermittlern, Kriminaltechnikern, Rechtsmedizinern, Korrespondenten und Dolmetschern. Sie sorgte dafür, dass ihre Anklageschriften zugelassen wurden und dass sie genügend Substanz enthielten, um bis zum Urteil zu tragen. Und dass in den letzten zwei Jahren die Kriegsverbrecher wie am Fließband in Haag abgefertigt werden konnten, war einzig und allein ihr und ihren Mitarbeitern zu verdanken. Nicht diesen beiden Dekofiguren.
Denn die Wahrheit hatte nichts mit Rindern zu tun. Patricia Sterling hatte die University of Melbourne mit Spitzennoten im internationalen Strafrecht absolviert. Nach ihrer Zeit in Brisbane bei der Staatsanwaltschaft von Queensland hatte sie ihre Karriere im Australian Institute for Criminology in Canberra fortgesetzt. Dann wurde sie Staatsanwältin für das Commonwealth und schließlich beim Außenministerium angestellt. Nebenher unterrichtete sie an der Monash University.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: