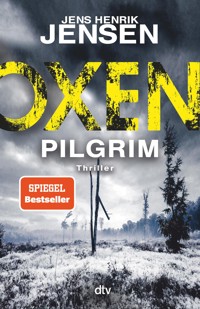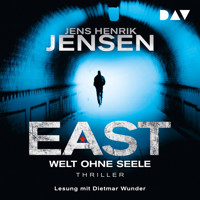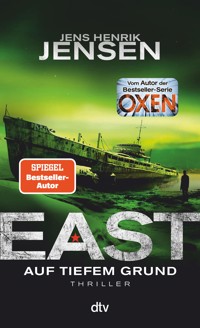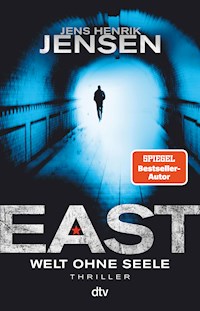9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Niels-Oxen-Reihe
- Sprache: Deutsch
Der Nr. 1-Bestseller aus Dänemark Der erste Teil einer atemberaubenden Trilogie um die Abgründe von Macht und Machtmissbrauch, angesiedelt in der trauten skandinavischen Demokratie. »Wer Stieg Larsson mag, wird Jens Henrik Jensen lieben!« wasliestdu.de Niels Oxen, ein schwer traumatisierter Elitesoldat, zieht sich in die Einsamkeit der dänischen Wälder zurück, um seinen inneren Dämonen zu entkommen. Doch bei einem nächtlichen Besuch des Schlosses Nørlund wird er zum Hauptverdächtigen in einem Mordfall: Hans-Otto Corfitzen, Exbotschafter und Gründer eines Thinktanks, wurde auf dem Schloss zu Tode gefoltert. Oxen gerät in die Fänge des dänischen Geheimdienstes. Seine einzige Chance: Zusammen mit der toughen Geheimdienstmitarbeiterin Margrethe Franck muss er die wahren Täter ausfindig machen. Die Spuren führen zu einem übermächtigen Geheimbund. Ein hochkarätiger Skandinavien-Thriller »Skandinavische Kriminalliteratur wird künftig mit neuen Maßstäben gemessen. Jensen ist der neue Standard.« thrillerzone.nl »Noch niemals wurde ein dänischer Thriller auf solch hohem Niveau geschrieben wie Jensens 'Das erste Opfer'.« Horsens Folkeblad Alle Bände der Niels-Oxen-Reihe: Band 1: OXEN. Das erste Opfer Band 2: OXEN. Der dunkle Mann Band 3: OXEN. Gefrorene Flammen Band 4: OXEN. Lupus Band 5: OXEN. Noctis Band 6: OXEN. Pilgrim Von Jens Henrik Jensen sind bei dtv außerdem die skandinavischen Thriller-Serien SØG und EAST erschienen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 615
Veröffentlichungsjahr: 2017
Sammlungen
Ähnliche
Jens Henrik Jensen
Oxen
Das erste Opfer
Thriller
Aus dem Dänischen von Friederike Buchinger
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
1.
Es sah aus, als hätte der Hund den Hals gereckt, in einem verzweifelten Versuch, den Duft des Lebens ein letztes Mal einzuatmen. Doch vergeblich, seine Schnauze konnte die Mandelblüten nicht erreichen.
Die Erkenntnis spiegelte sich im schwachen Licht der Morgendämmerung in seinen matten Augen. Es war schon lange vorbei, sein Gewicht hatte die Schlinge um seinen Hals schon vor Stunden zugezogen.
Der scharfe andalusische Februarwind fuhr über den Stausee Guadalhorce-Guadalteba und wiegte den schweren Körper des Hundes hin und her. Eine Wolke aus Blüten wirbelte auf, wie rosa schimmernde Schneeflocken.
Ein Blütenblatt legte sich sanft wie ein Gnadenkuss auf die heraushängende Zunge des Hundes – viel zu spät.
Allmählich drang das Sonnenlicht durch die wogende Blütendecke und die braune Silhouette war immer deutlicher zu erkennen. Es war ein großer Hund. Ein Rottweiler, ein Rüde.
Ein Stück den Hang hinauf, hinter dem Wäldchen aus Mandelbäumen und einigen hohen Pinien, lag eine Ansammlung weißer Gebäude. Zu dem Grundstück führte eine Zufahrt, die von einem eisernen Tor versperrt wurde. Auf einem Schild stand »Finca Frederiksen«.
Die Einheimischen – und von denen gab es trotz der Invasion finanzstarker Ausländer einige – erinnerten sich noch daran, dass die Finca mit dem märchenhaften Ausblick früher »Finca Fernandez« geheißen hatte. Der neue Name war wohl schwedisch, norwegisch, deutsch – oder dänisch. Auf jeden Fall kamen die Bewohner, die inzwischen schon seit vier oder fünf Jahren am See residierten, irgendwo aus dem Norden. In Wirklichkeit war es den Leuten hier ziemlich egal, woher sie stammten. Die Änderung des Namens war in ihren Augen respektlos, und niemand hatte etwas mit den Fremden zu tun. Diese Reichen waren einfach da, umgeben von ihren hohen Zäunen, und trugen nichts zur Gemeinschaft bei.
Kurz nach Mitternacht war Hannibal Frederiksen, der Besitzer der Finca, nach draußen gegangen, um seinen Hund zu rufen. Doch vergeblich. Señor war zum allerersten Mal nach seiner üblichen Abendrunde nicht ins Haus zurückgekommen. Das hatte Hannibal Frederiksen Angst gemacht.
Nachdem er am nächsten Morgen gegen sieben Uhr nach einer unruhigen Nacht aufgewacht war, zog er sich leise an, um seine Frau nicht zu wecken, und ging wieder nach draußen. Er wollte nach seinem Hund suchen.
Doch als er nach einer halben Stunde die letzte Reihe der Mandelbäume am Seeufer erreichte, wusste er, warum Señor nicht nach Hause gekommen war.
Der Anblick des Hundes ließ ihn wie gelähmt zurück.
2.
Die reflexartigen Bewegungen, mit denen er seine Umgebung wie ein Radar erkundete, erinnerten an die eines gewöhnlichen Einbrechers. Er zog sich die Kapuze über sein Barett und sah sich um. Nach rechts, nach links, nach hinten. Und noch einmal. Dann überwand er spielend leicht den hohen Drahtzaun, während sein weißer Samojedenhund brav im Schatten der Mauer lag und sich nahezu unsichtbar machte.
Er sprang und landete geschmeidig auf beiden Füßen. Gut, vielleicht nicht ganz so geschmeidig wie früher – doch zumindest fast ohne zu wackeln. Er wusste, wo er hinwollte, und huschte zum nächstgelegenen Container, um seine selbst gebaute Zange an die kurze, dreikantige Eisenstange anzusetzen, das Ganze nach links zu drehen und so den schweren Deckel zu öffnen.
Beim ersten Mal war es die reinste Folter gewesen. Eine buchstäblich grenzüberschreitende Erfahrung. Mental gesehen ein Trip der Erniedrigung, der ihn innerhalb weniger Sekunden handlungsunfähig gemacht hatte. Die Demütigung war wie ein Parasit unter seine Haut gekrochen, wo sie wochenlang verharrte und an ihm nagte.
Irgendwann war sie verschwunden und seither nicht wiedergekommen. Zurück blieb nur ein rationales »Wenn du Hunger hast, iss!«.
Er kletterte über die beschämende Schwelle der Wohlstandsgesellschaft, dorthin, wo der Überfluss sich ihm wie ein Goldschatz entgegenreckte. Im ersten Container war das Gemüse.
Er knipste seine Taschenlampe an und fing an zu suchen. Die tastenden Hände weckten eine alte Erinnerung, er dachte daran, wie es gewesen war, im Supermarkt einzukaufen, an einem vollen Samstagvormittag zwischen lärmenden Familien. Genau wie jetzt. Nur der Einkaufswagen fehlte und sein Kind im Klappsitz. Seine Wahl war jedes Mal eine reine Impulsentscheidung.
Gurken? Wieso nicht. Tomaten? Tja … Kopfsalat? Super Idee. Zwiebeln? Okay. Und natürlich Kartoffeln.
Alles wanderte in die Tiefe seines Rucksacks. Als Letztes folgte eine Schale Freilandchampignons, die drei Tage drüber waren.
Er kletterte wieder hinaus, öffnete den nächsten Container und sprang rein. Fleischwaren. Das Verfallsdatum verbreitete die Pest hier im Dunkeln, aber das kümmerte ihn nicht. Bei Fleisch musste man bloß ein bisschen vorsichtiger sein, das war alles. Er nahm die Packungen in die Hand, drehte und wendete sie im Schein der Taschenlampe, hob den Daumen – oder senkte ihn. Es sah danach aus, als würde es morgen Abend Frikadellen geben. Vermutlich mit geschmorten Zwiebeln.
Er stahl und aß mit Freude das, was kaum ein anderer Däne auch nur im Traum in den Mund genommen hätte. Alles, was ein oder zwei Tage zu alt geworden war, auch weil seine Landsleute es sich zur Gewohnheit gemacht hatten, tief in den Regalen zu graben und die hintersten – und frischesten – Produkte herauszuziehen, statt das zu nehmen, was ganz vorn stand und das kürzeste Haltbarkeitsdatum hatte. Auf diese Weise trug jeder von ihnen zum Müllberg eigentlich noch essbarer Sachen bei. So gesehen war sein eigenes Handeln alles andere als kriminell.
Er ließ ein halbes Kilo Hackfleisch in den Rucksack gleiten. Aus ihm war ein professioneller Mülltaucher geworden.
So nannten die jungen Leute jemanden wie ihn – Mülltaucher. Er war auf die Idee gekommen, als er an der Bushaltestelle ein Gespräch zwischen zwei Jungs mit angehört hatte. Der Begriff hatte ihn zu einer Internetseite geführt und von dort zu einer Facebook-Gruppe, wo man sich gegenseitig Tipps gab und geeignete Plätze zum »Mülltauchen« empfahl. Und so war er hier gelandet, in einem Hinterhof eines Discounters im Kopenhagener Nordwesten.
Es blieb ihm aber auch nichts anderes übrig. Sein letztes Geld war längst verbraucht. Seine Miete hatte er in den letzten Monaten bezahlt, indem er Flaschen gesammelt und seinem dämlichen Vermieter bei diversen Reparaturen in dem baufälligen Haus geholfen hatte.
Es war immer dasselbe. Jeden Tag nach Einbruch der Dämmerung ein ewiges Suchen entlang der bekannten Routen. Der heutige Tag, der jetzt bald vorbei war, hatte ihm fast hundert Kronen an Flaschenpfand eingebracht. Vom Treffpunkt der Säufernasen in Utterslev Mose zum Bispebjerg Friedhof, hinunter zum Fælledpark und dann wieder hoch zum Nordhavn. Er wusste, wo er suchen musste. An den Parkbänken, in den Tiefgaragen und bei den Unterständen an den Bushaltestellen. Im Schutz der Dunkelheit. Flasche für Flasche. Krone für Krone.
Er sprang aus dem Container und wollte gerade zum dritten weiter, um sich noch ein paar Eier oder etwas Käse zu holen, als ihn jemand anbrüllte: »He, du! Was soll das hier deiner Meinung nach werden?«
Zwei Gestalten tauchten am letzten Container auf. Einer klein und so breit wie hoch, der andere groß und schlaksig. Er hatte nicht gehört, wie die beiden über den Zaun geklettert waren.
»Hallo? Bist du stumm? Oder dämlich? Das hier ist unser Revier. Verpiss dich oder es setzt was, du elender kleiner Penner …«
Der Breite hob drohend die Faust.
Seine Kapuze musste heruntergerutscht sein, als er aus dem Container gesprungen war, denn jetzt flötete der Typ übertrieben süßlich: »Was sehe ich denn da …? Hast du etwa einen Pferdeschwanz? Du bist ja ein richtiges kleines Ponymädchen. Ich wollte es schon immer mal mit einem Ponymädchen treiben.«
Einen Moment lang stand er unentschlossen da. Eine Stimme in seinem Kopf schrie mit einer zweiten schrill um die Wette, und er merkte, wie sich seine Muskeln spannten.
»Na komm schon, kleines Pony«, säuselte der Breite.
»Lass ihn«, murmelte der Schlaksige leise, dann drehte er die Lautstärke hoch: »He, du Arsch! Zum letzten Mal – hier bestimmen wir. Also verpiss dich, fuckin’ motherfucker!«
Der Entschluss war gefallen. Er zog seine Kapuze hoch, warf sich den Rucksack über die Schulter und duckte sich unterwürfig.
»Okay, sorry … Bin schon weg.«
Der kleine Breite pöbelte trotzdem weiter. »Sollte das etwa eine Entschuldigung sein, Pony?«
»Tut mir leid. Echt, Entschuldigung.«
Wie ein räudiger Köter kroch er in großem Bogen um die beiden bedrohlichen Gestalten herum, kletterte den Zaun hoch und ließ sich auf der anderen Seite auf die Straße fallen.
Mit einem kurzen Pfiff erweckte er seinen Hund zum Leben und verschwand in der Dunkelheit.
Leise vor sich hin murmelnd lobte er sich selbst, während er mit dem Hund an seiner Seite den Heimweg antrat. Allein die Tatsache, dass er in der Lage gewesen war, durch kühles Abwägen eine Entscheidung zu treffen, kam ihm wie ein Triumph vor.
»Was sagst du, Whitey? Das war ziemlich gut, was? Dabei haben die total provoziert, oder? Du hättest sie hören sollen. Was für Rotzblagen!«
Der Hund hörte ihm zu und nickte.
Er bog durch das Hoftor und nahm den Hintereingang.
Die Vordertür lag im Dunkel eines Kellerabgangs und war mit mehreren Brettern am Türstock festgenagelt. Das war schon so gewesen, als er sein herrschaftliches Domizil vor einer gefühlten Ewigkeit bezogen hatte.
Die Hintertür schleifte über den rauen Betonboden, und es erforderte einige Kraft, sie ganz zu öffnen. Er betrat den Flur und konnte den ständig wachsenden Stapel aus Werbeblättern und Wochenzeitungen, der sich hier auftürmte, nur undeutlich erkennen.
Vor langer Zeit, in einer anderen Welt, in einem anderen Flur hatte er seine Post sortiert. Ja, anfangs hatte er sie sogar wirklich noch geöffnet …
Wann er damit aufgehört hatte, die Post zu lesen, wusste er nicht mehr, aber er konnte keinen Unterschied feststellen. Bisher hatte er noch nie einen Brief vermisst, und an seine jetzige Adresse hatte er noch keinen einzigen bekommen. Allerdings hatte er den Behörden auch nie mitgeteilt, dass er umgezogen war.
»Rein mit dir, Whitey!«
Der Hund gehorchte bereitwillig, trabte durch die offene Tür, sprang aufs Sofa und legte sich mit einem müden Seufzen hin.
In der engen Teeküche leerte er seinen Rucksack und zog auf dem Weg ins Zimmer seine Sachen aus, erst die Jacke, dann den Pulli. Am Ende kickte er die Stiefel in eine Ecke und ließ sich neben Mr White aufs Sofa fallen. »Mr White«, so lautete der korrekte Name seines Begleiters, wenn man es ganz genau nehmen wollte. Das kleine »Mr« verlieh seiner Anrede einen Hauch von altmodischer Höflichkeit und Respekt. »Whitey« war das informelle Gegenstück, und manchmal blieb es auch beim prosaischen »White«.
Es war ein einträglicher Abend gewesen, nur leicht getrübt durch die beiden aggressiven Idioten, die ihn daran gehindert hatten, sich Eier und Käse zu besorgen.
Er schaltete den Fernseher an, zappte herum und blieb an einer Sendung auf Animal Planet hängen, wo ein paar Geier in der Serengeti gerade ein Stück Aas eroberten.
Bald würde er in die Küche gehen und für sie beide eine Klappstulle mit Leberwurst herrichten.
Er starrte für ein paar Minuten auf das afrikanische Drama, bis seine Konzentration erlahmte und sein Blick zu dem Zufluchtsort an der schmutzig weißen Wand wanderte, wo er mit zwei Reißzwecken einen Zeitungsausschnitt aufgehängt hatte. Überschrift und Einleitung konnte er auswendig.
Der Ausschnitt hing schon sehr lange dort, aber er dachte immer noch darüber nach. Könnte das seine Rettung sein?
Wäre es sein Tod – oder seine Erlösung? Oder würde er an einem gnädigen Ort irgendwo dazwischen landen?
3.
Das eiserne Tor zur »Finca Frederiksen« glitt automatisch auf, als Hannibal Frederiksen auf die Fernbedienung drückte. Er bog nach links auf die Gebirgsstraße ein und beschleunigte den Wagen.
Unter normalen Umständen hätte er das Gefühl puren Fahrvergnügens genossen. Der kräftige Motor des anthrazitgrauen Mercedes CLS350 gehorchte bereitwillig, und das Automatikgetriebe katapultierte ihn stufenlos den langen, geraden Abschnitt vor der ersten Kurve hinunter.
Er registrierte das Blütenmeer, das sich links von ihm bis zum See erstreckte. Einer plötzlichen Eingebung folgend bremste er ab und hielt am Straßenrand an.
Es blieben nur noch wenige Tage, um die Mandelbäume zu bewundern. Ein Anblick, der ihm nun schon seit fünf Jahren vergönnt war. Die Leute reisten aus aller Welt in die verschiedenen Landesteile Spaniens, nur um die überirdische Schönheit dieser Bäume zu sehen. Es war sein eigener Mandelwald am Ufer des Embalse del Guadalhorce-Guadalteba, der förmlich mit der schimmernden Wasseroberfläche verschmolz, die heute fast reglos vor ihm lag.
Es lief ihm kalt den Rücken hinunter.
Der Blütenteppich barg ein Geheimnis. Zwei Wochen waren vergangen. Er hatte seiner Frau nicht erzählt, was er an jenem Morgen im Mandelhain entdeckt hatte. Für solche Dinge war sie nicht robust genug.
Die Frage war nur, wie es um seine eigene Robustheit bestellt war. Alles, was dieser Sache vorausgegangen war … Und dann Señor, der im Wind geschaukelt hatte … Er konnte an nichts anderes mehr denken. Wäre er doch nur wie früher, als er noch jung war. Tatkräftig, streng und gnadenlos. Jetzt quälte ihn die Erinnerung so sehr, dass er kaum einen klaren Gedanken fassen konnte.
Er fuhr wieder los und gab bergab ordentlich Gas. Nur wegen dieser verfluchten Angst und Unentschlossenheit war er an diesem Morgen auf dem Weg zum Flughafen von Málaga, um Gäste abzuholen. Sie sollten das, was ihn jede Nacht wach hielt, gründlich untersuchen.
Als er den Felsvorsprung und die scharfe Rechtskurve erreichte, bremste er hart ab. Vor ihm lag ein langes Stück mit vielen engen Haarnadelkurven, die ihm keinen Spaß machten, und er ließ den Wagen langsamer weiterfahren. Er war mehr für die geraden Streckenabschnitte mit gutem Überblick zu haben. Und wieder – lag es daran, dass er alt und unsicher geworden war?
Er war für einen Moment in Gedanken über seine verlorene Jugend versunken und näherte sich gerade der ersten Kurve, als der Schock ihn traf. Das Krachen und Knirschen hinter ihm, der Aufprall, bei dem sich der Gurt über seiner Brust straffte.
Erschrocken blickte er in den Rückspiegel und sah ein kleines rotes Auto. Der Fahrer hatte offenbar die Kontrolle verloren und war ihm direkt hinten aufgefahren. Hoffentlich war der Mann gut versichert. Frederiksen bremste ab und war geistesgegenwärtig genug, zu blinken. Vor ihm lag eine mit Gras bewachsene Ausbuchtung, da konnten sie das regeln …
Ein erneutes Krachen, und wieder wurde er im Sitz nach vorn geworfen. Was zur Hölle war da los?
Er bemerkte, dass seine Knie unkontrolliert zitterten. Seine Hände krallten sich krampfhaft am Lenkrad fest, das Auto brach nach rechts aus, doch es gelang ihm, es wieder nach vorn auszurichten.
Das war Absicht. Das rote Auto rammte ihn absichtlich. Er musste hier weg.
Den Blick fest auf die Straße gerichtet, trat er auf der geraden Strecke vor der nächsten Kurve das Gaspedal durch. Er schielte in den Rückspiegel. Er hatte Abstand gewonnen. Aber jetzt – jetzt musste er abbremsen. Der Wagen schlingerte. Trotzdem bekam er die Kurve noch gut.
Sekunden später klebte ihm das kleine rote Auto schon wieder am Hintern. Und jetzt rammte es ihn zum dritten Mal. Felswand und Leitplanke flimmerten vor seinen Augen. Auf dem geraden Abschnitt gewann er wieder etwas Luft, aber er war viel zu schnell für die nächste Kurve. Der Vorderreifen erwischte den Randstreifen, noch ehe es ihm gelang, den schweren Wagen abzubremsen. Flüchtig bemerkte er etwas Rotes im Außenspiegel. Dann krachte es wieder, und der Gurt straffte sich. Seine Fingerknöchel waren kreideweiß.
Dann war das rote Auto wieder da. Diesmal erwischte es ihn seitlich und drängte seinen großen Mercedes vom Kurs ab.
Er schmeckte Blut. Hatte er sich die Lippe aufgebissen? Verzweifelt versuchte er gegenzusteuern, als er erneut gerammt wurde. Der Mittelstreifen verschwand aus seinem Blickfeld. Er riss das Lenkrad herum, nach links, dann nach rechts. Er konnte den Mercedes nicht mehr kontrollieren, er brach nach links aus. Immer weiter, auf die weiße Leitplanke zu.
Das nächste Krachen erreichte sein Bewusstsein nur noch peripher. Er schwebte ins Nichts, war schwerelos, ohne Verbindung zum Erdboden. Das Lenkrad fühlte sich leicht wie eine Schneeflocke an. Der blaue Himmel erfüllte die ganze Windschutzscheibe. Und so schwebte er immer weiter, während sein Körper zu Eis gefror.
Der Fahrer des kleinen roten Wagens bremste abrupt und stieg hastig aus. Er sah gerade noch, wie der Mercedes gegen die Felsen prallte, gewaltige Saltos schlug und einen kleinen Wald durchpflügte, bevor er seitlich zum Liegen kam, auf einem Felsvorsprung oberhalb der Talsohle.
Es gab keine Explosion und auch keinen Feuerball wie im Film. Als die Staubwolke sich gesenkt hatte, lag das Autowrack totenstill da, nur ein dunkler, verbeulter Blechhaufen.
Der Fahrer des roten Wagens stieg wieder ein und verschwand in aller Ruhe hinter der nächsten Kurve.
Zu diesem Zeitpunkt war Hannibal Frederiksen schon lange tot. Sein Genick war mit einem Knacken gebrochen, als der anthrazitfarbene Mercedes auf der ersten Klippe aufprallte.
4.
Das war kein richtiges Frühjahr. Er fühlte sich betrogen. Die Landschaft jenseits der schmutzigen Zugfenster war immer noch braun und kahl.
Er saß angespannt auf seinem Platz, sein altes armeegrünes Barett tief in die Stirn gezogen. Mr White lag wachsam zwischen seinen Füßen. Sie fühlten sich beide bedrängt von den vielen Fahrgästen, die so unerschütterlich gut gelaunt wirkten, als würde der Zug sie in eine neue, bessere Zukunft bringen.
Die Leute, die in Hadsten und Langå in Feierlaune zugestiegen waren, hatten den Zug in Randers wieder verlassen. Neue kamen in Hobro dazu, und in Arden gleich ein ganzer Trupp, der das Abteil lärmend in Beschlag nahm, mit roten Fahnen und klirrenden Plastiktüten. Es war der erste Mai. Also war tatsächlich Frühling. Und der internationale Kampftag der Arbeiter.
Sie stimmten ihre Gesänge an und schlossen mit »Prooost – und scheiß drauf!«.
Es hätte ihn schon interessiert, wofür die eigentlich kämpften. Abgesehen davon, dass sie wohl erst mal dafür kämpfen sollten, überhaupt eine Arbeit zu finden. Gab es denn noch so was wie ehrliche Arbeiter in Dänemark? War der ganze Kram nicht längst in billigere Hände nach Asien outgesourct worden?
»… zur Arbeit, lebend oder tot!«
Er sah keine wettergegerbten Gesichter oder schrundigen Hände, als er unauffällig den Blick schweifen ließ. Keine Helden der Arbeiterklasse, stattdessen lauwarmes Dosenbier in speckigen Fingern, feiste Wangen und breite Ärsche in Jeans.
Er hätte gern gewusst, wohin sie fuhren. Vermutlich nach Aalborg …
Mr White schreckte hoch, nachdem ihm ein angetrunkener Mittvierziger auf den Schwanz getreten war. Aber als er merkte, was Sache war, legte er sich wieder hin. Sein Hund fühlte sich anscheinend trotz allem sicher. Ihm dagegen war es unbehaglich. Hier waren entschieden zu viele Menschen.
Er warf einen Blick auf den klebrigen Fahrplan in seiner Hand. An der nächsten Station musste er raus. Die Stimme aus dem Lautsprecher würde ihn erlösen und den nächsten Halt ankündigen, und er würde wissen, dass er gleich aussteigen konnte. Dann würde die Zukunft beginnen. Schlechtes Frühjahr hin oder her.
Er lehnte sich in seinem Sitz zurück und versuchte so zu tun, als existierten die vielen anderen Fahrgäste überhaupt nicht. Er wollte in sich selbst versinken, immer tiefer und tiefer – und unsichtbar werden …
Da spürte er eine nasse Zunge an seiner Handfläche. Mr White brauchte eine kleine Aufmunterung. Sein Buddy, der ihn treu begleitete und nicht mehr dafür haben wollte als ein wenig Anerkennung.
Sein Hund war weiß. Deshalb hieß er White. Er war ein Rüde. Und deshalb lautete sein voller Name Mr White. Das war ganz einfach. Auch wenn es etwas ähnlich Überschaubares in seinem Leben sonst nicht gab, folgte zumindest seine Freundschaft zu dem Samojeden einer klaren Logik.
Seine Gedanken wurden vom Klirren einiger Flaschenhälse unterbrochen und dem Grölen eines Arbeiterhelden, der hinter seiner Rückenlehne den »Musketier-Eid« in den Raum brüllte: »Proooost …!«
Endlich ertönte die befreiende Nachricht: »Nächster Halt Skørping. In wenigen Minuten erreichen wir Skørping. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.«
Es kam ihm vor wie eine Ewigkeit, bis der Zug endlich stillstand und die Türen sich öffneten. Mr White war mit einem Satz auf dem Bahnsteig und zog ihn mit. Er schulterte seinen Rucksack und die lange Plastikbox und stellte sich an die Backsteinmauer des Bahnhofsgebäudes.
Erst als das Zugende immer kleiner wurde und der letzte Fahrgast den Bahnsteig verlassen hatte, zog er Mr White auf die andere Seite des Bahnhofs.
Dort gab es ein großes pastellgelbes Gebäude mit einem Schild, auf dem »Kulturbahnhof« stand. Hatten die so viel Kultur hier oben in Skørping, dass sie ein ganzes Haus damit füllen konnten? Aber was wusste er schon. Er war in seinem Leben nur wenige Male durch diesen kleinen Ort gefahren.
Es fing an zu regnen, gerade als er die Gleise überquert hatte und sich auf den Weg durch die Stadt machte.
Der Regen wurde stärker. Er blieb stehen, nahm seine alten Regensachen aus dem Rucksack und zog sie über. Er hatte sie beim Flascheneinsammeln oft gebraucht, und an ein paar Stellen waren sie schon löchrig. Dann setzte er seine Wanderung auf dem Radweg fort, der nach Rebild führte, einem kleinen Ort ein paar Kilometer weiter.
Sein Kopf war leer, nicht mal der Regen störte ihn. Er war nur damit beschäftigt, vorwärtszukommen. Genau wie der eifrige Mr White. Irgendwo in seinem Hinterkopf streifte ihn der Gedanke an den Zeitungsartikel, der sicher noch einige Zeit an der Wand in dem feuchten Kellerzimmer hängen würde. Bis zu dem Tag, an dem ein anderer die schwergängige Tür aufdrücken und sich mit der Situation dort abfinden würde.
Er dagegen hatte den Rentemestervej für immer hinter sich gelassen.
Und der Zeitungsartikel hatte ihn auf die entsprechende Idee gebracht. Dass es ausgerechnet Skørping geworden war, lag vermutlich daran, dass man es mit dem Zug erreichen konnte. Kopenhagen-Skørping, nicht gerade ein Katzensprung. Doch entscheidend waren die Vorteile dieser Gegend, mit denen er in seiner Vergangenheit die eine oder andere Erfahrung gemacht hatte.
Keine Menschenseele ahnte, dass er die alte Umgebung verlassen hatte. Wem hätte er auch davon erzählen sollen? Außer L. T. Fritsen fiel ihm niemand ein. Ihm gegenüber hatte er die Idee irgendwann einmal erwähnt, als sie nach Feierabend zusammen in Fritsens kleiner Autowerkstatt saßen und sich unterhielten. Die Idee, auszusteigen … Doch das war mindestens ein Jahr her. Fritsen und er waren Freunde, aber sie hockten sich nicht ständig auf der Pelle.
Er blinzelte nach oben. Die Regendecke war schwer und blauschwarz, ohne eine einzige Wolkenlücke. Es würde noch lange weiterschütten. Vielleicht den ganzen restlichen Tag.
Bald hatten sie Rebild erreicht. Sie marschierten aber auch im Stechschritt voran, und jetzt hasteten sie an dem großen von Heidekraut überwucherten Parkplatz des Nationalparks vorbei, wo man sich jedes Jahr am Unabhängigkeitstag der Amerikaner zum dänisch-amerikanischen Freundschaftsfest traf.
Im Regen waren kein Auto und kein Mensch zu sehen. Perfekt. Mit dem Ortsschild im Rücken begannen sie jetzt die letzte, lange Etappe ihrer Reise. Sie hatten die Richtung eingeschlagen, die sie in das riesige Waldgebiet führen würde, wo im Laufe der Geschichte schon immer Wilderer, Räuber und anderes Gesindel Unterschlupf gefunden hatten. Es gab etwa dreißig Wälder hier, jeder mit einem eigenen Namen, und zusammen bildeten sie den größten zusammenhängenden Wald Dänemarks – den mächtigen Rold Skov.
5.
Mit bedrohlich gefletschten Zähnen knurrte der Schäferhund die schwarz gekleidete Gestalt an, die ihn im Hundezwinger überrascht hatte. Er sträubte vor Angst die Nackenhaare, was ihn aber nicht weniger gefährlich machte. Dann fing er an zu bellen.
Die bullige Gestalt machte ein paar schnelle Schritte vorwärts, kehrte plötzlich um und rannte dann in die andere Richtung los. Genau das reizte den Hund. Der Mann drehte sich zu ihm um und machte sich bereit. Gleich hatte das Tier ihn erreicht.
Der Schäferhund sprang mit einem großen Satz nach vorn, auf seinen linken Arm zu, den er schützend vor den Körper hielt. Die Kiefer des Hundes schlossen sich um den gut gepolsterten Unterarm.
Ein kurzes Knacken war zu hören, als der Nacken des Hundes brach. Sofort löste sich die Klammer um seinen Arm, und der Hund fiel leblos zu Boden.
Der Mann blieb eine Weile stehen. Er verspürte den Drang, sich die Sturmhaube vom Kopf zu ziehen, um sich etwas abzukühlen, aber er wollte kein Risiko eingehen. In dieser Montur war er eins mit der Dunkelheit, bis auf den schmalen Schlitz vor den Augen und das Loch für den Mund. Er spürte seinen Puls, obwohl er keine Angst gehabt hatte. Zufrieden betrachtete er den toten Hund in der Gewissheit, dass man, was einem einmal in Fleisch und Blut übergegangen war, niemals verlernte.
Am Ende des riesigen Gartens brannte eine Reihe von Lampen, und dahinter stand ein Gebäude, das wohl das Badehaus sein musste. Der Garten war ringsum von hohen Bäumen und Büschen umgeben. Die nächsten Nachbarn waren zum Glück weit weg, auch wenn es sich nicht ganz ausschließen ließ, dass der eine oder andere das Bellen gehört hatte. Er sah sich um. Die Lichter dieses offenbar sehr exklusiven Stadtteils, der Sejs-Svejbæk hieß, leuchteten in der Dunkelheit wie Juwelen, am Hügel und die Straße entlang, die parallel zum Seeufer des Borre Sø verlief.
Er hatte seine Basis in Silkeborg eingerichtet, nur fünf Kilometer entfernt, und war einige Tage in der Gegend geblieben, um sich gründlich auf seine Aktion vorzubereiten.
Er packte den Hund an den Hinterbeinen und zog ihn über die Wiese zu der luxuriösen Villa, die dunkel vor ihm lag. Auf der Terrasse legte er den Hund ab. Schon gestern hatte er die ideale Stelle dafür entdeckt, als er in einem gemieteten Kanu das Ufer mit einem Fernglas ausgekundschaftet hatte. Vor der großen Fensterfront des Hauses stand eine Buche. Wie geschaffen für seine Zwecke.
Er richtete die Taschenlampe auf das Fenster. Dahinter war die Küche zu erkennen. Es war keine gewöhnliche Küche, wie man sie sonst sah, sondern ein weitläufiger Raum, in dem blank polierter Stahl und dunkles Holz dominierten. Sogar das Weinregal war von stattlicher Größe.
Der Besitzer der Villa hieß Mogens Bergsøe, er war Anwalt und lebte allein – so viel wusste er. Und offenbar war er ein äußerst wohlhabender Mann. Sogar in der Küche hing Kunst an der Wand.
Er zog den Hund bis zu dem Baum, legte ihm die Schlinge um den Hals und warf das lose Seilende über den untersten Ast. Dann hievte er den Hund mit ein paar langen, kräftigen Zügen hoch und knotete das Seil um den Stamm.
Wenn der Herr Anwalt nach Hause kam, den Porsche in den Carport rollen ließ und die Haustür aufschloss, würde es nicht allzu lange dauern, bis er in die Küche ging. Vielleicht würde er sich ein Glas Milch einschenken, sich ein Gute-Nacht-Bier genehmigen oder einfach nur ein Butterbrot schmieren.
Und sobald er das Licht einschaltete, würde er sehen, was direkt vor seinem Fenster hing.
6.
Mit angehaltenem Atem beobachtete er, wie das Reh auf dem matschigen Wildwechsel näher trippelte, zu der Stelle an der kleinen Quelle, wo es bereits zahlreiche Spuren gab.
Es war ein Bock, wenn auch kein besonders großer. Nach dem Gesetz durfte man ihn erst in einer Woche jagen, aber mit solchen Details konnte er sich jetzt nicht aufhalten. Er hatte wirklich Hunger.
Vollkommen still saß er in seinem Versteck aus Zweigen, Wurzeln und allem, was er sonst noch gefunden hatte. Er war ungefähr zwanzig Meter von der Wasserstelle entfernt. Vorn in seinem Versteck war ein Loch, gerade groß genug, dass er hindurchschießen konnte, wenn der Winkel stimmte. Und es würde gleich so weit sein, sobald der Bock noch einen Meter nach vorn kam.
Das Tier zögerte, doch dann machte es endlich einen weiteren Schritt. Oxen legte den Pfeil ein, platzierte die Nocke sorgfältig auf der Bogensehne – und wartete. Noch einen Schritt, und der Winkel wäre perfekt.
Mit einem Anflug von Nervosität trippelte der Bock ein kleines Stück weiter und stand einen Moment reglos da, bevor er anfing zu trinken. Oxen spannte den Bogen. Das Tier hob den Kopf und drehte seine Ohren. Aber ausgerechnet in dem Augenblick, als Oxen die Sehne freigab, zuckte sein ausgestreckter Arm kaum merklich. Der Pfeil rauschte über sein Ziel hinweg und verschwand im Gestrüpp. Der Bock ebenso.
Er war eingerostet. Es war viel zu lange her. Wie hatte er so naiv sein können, zu denken, er könne die schwierige Jagd mit Pfeil und Bogen nach so vielen Jahren einfach wieder aufnehmen? Hatte er wirklich geglaubt, dass seine Sinne für diese Art der Jagd ausreichend geschärft und seine Motorik fein genug wären?
Wie idiotisch von ihm, sich in einen Zug zu setzen und Kopenhagen zu verlassen mit der geradezu kindlichen Vorstellung, dass alles wie früher werden würde, wenn er nur draußen in der Natur wäre. Wenn er seine Ruhe hätte, dort, wo Fuchs und Hase sich Gute Nacht sagten.
Es dämmerte bereits, und es begann zu nieseln. In den acht Tagen seit seiner Ankunft hatte es beinahe durchgehend geregnet. Der Wald und das ganze Tal trieften vor Nässe, und wenn er durch die sumpfige Landschaft streifte und von Grasbüschel zu Grasbüschel sprang, stieg ihm der Gestank von Fäulnis in die Nase.
Er blieb in seinem Versteck sitzen und überprüfte seufzend seinen Bogen. Das Gerät war völlig in Ordnung. An dem Fehlschuss war nur er selbst schuld. Sein Bogen war ein Compoundbogen der High Country Archery. Die Pfeile waren speziell für die Jagd konstruiert und mit einer mechanischen Innerloc-Spitze versehen. Bogen und Pfeile hatten einige Tausend Kronen gekostet. Sie waren die letzten wertvollen Dinge, die er aus seinem alten Leben besaß. Wieso er die Ausrüstung nicht schon längst gegen Whisky und Gras eingetauscht hatte, war ihm selbst ein Rätsel.
Er zog sich die Kapuze über die Strickmütze und kroch aus seinem Versteck. Dann hängte er sich Bogen und Köcher über die Schulter und machte sich auf den Heimweg. Er hatte seine alten Gummistiefel an, die er sich im Wertstoffhof besorgt hatte, und watete in der Mitte eines kleinen Wasserlaufs. Der Bach war nur wenige Zentimeter tief, und sein Grund war einigermaßen fest, sodass er einen gangbaren Weg darstellte, in diesem Sumpf und dem Dschungel aus Weiden, die ein nahezu undurchdringliches Dickicht bildeten.
Er folgte dem Bach bis zu seiner Mündung in den Lindenborg Å. Er befand sich weit oben im Tal, das hier zwischen hohen bewaldeten Hängen lag. Der Fluss war noch nicht sehr breit und kräftig, er ähnelte eher einem hübsch gewundenen und schnell fließenden Wildbach. Zurzeit war er so braun wie Trinkschokolade, aber falls der Regen doch irgendwann aufhörte, würde das Wasser schnell wieder klar werden.
Er erinnerte sich daran, dass der Lindenborg Å das beste und sauberste Wasser führte, es wurde von einer Vielzahl schmaler Wasserläufe herangetragen. Im Rold Skov konnte man aus jeder Quelle trinken, denn das Wasser kam aus gewaltigem unterirdischem Kalkgestein. Rold Skov war der Wald der Quellen.
Auf dem Rückweg blieb er mehrmals an der Uferböschung stehen. Er hatte gestern zehn Haken ins Wasser geworfen, jeden mit einer Schnur an einem Stock befestigt, den er in den weichen Erdboden gesteckt hatte. Bei den ersten neun Stellen konnte er die schlaffe Schnur einfach aus dem schlammigen Wasser ziehen, zusammenrollen und in seine Tasche stecken. Das mit dem Fischen war denkbar schlecht gelaufen. Nur zwei kleine Bachforellen hatte er bislang aus dem Wasser angeln können. Als er zu Hause in seinem Keller im Vorfeld alles kalkulierte, hatte er mit einem erheblich größeren Fang pro Tag gerechnet. Dieser verfluchte Regen musste jetzt wirklich langsam ein Ende haben.
Er blieb stehen, um die letzte Leine einzuholen. Am Haken zappelte eine weitere kleine Bachforelle. Viel zu klein. Aber essen würde er sie trotzdem. Er tötete den Fisch mit einem gezielten Stich in den Nacken und setzte seinen Heimweg fort.
Mr White leckte ihm über die Nase. Erst merkte er es gar nicht, so tief war er noch im Schlaf, aber während er langsam zu sich kam, dämmerte ihm, dass sein treuer Gefährte ihn wieder einmal freundlich darauf hinwies, dass es langsam Zeit war, aufzuwachen.
Als er die Augen öffnete, schleckte Mr White ihm ein letztes Mal übers Gesicht, dann drehte der Hund sich um und lugte unter der Plane nach draußen. Oxen machte die Augen wieder zu und zog sich die Decke über den Kopf. Unbarmherzig trommelte der Regen auf das Dach ihres Lagers. Es war nicht auszuhalten. Heute war der neunte Mai, es sollte Frühling sein – und stattdessen pisste es nonstop.
Er war die ganze Nacht wach gewesen. Es gab keinen konkreten Grund dafür. Jeder Versuch, Schlaf zu finden, war gescheitert. In dieser Hinsicht spürte er keine Veränderung. Nordwestquartier oder Rold Skov – das Muster war dasselbe. Deshalb schlief er wie gewöhnlich ab dem späten Vormittag.
Vor dem Schlafen hatte er sich eine halbe Dose Hackbällchen in Curry mit Mr White geteilt. Das Frühstück hatte aus einer Handvoll Reis und einer halben gebratenen Bachforelle für jeden von ihnen bestanden. Er bemühte sich um strenge Disziplin, was seine letzten Lebensmittel betraf. Sie mussten reichen, bis Sonne und Wärme kamen.
Wieder verspürte er das bohrende Hungergefühl im Magen, vor dem er sich in den Schlaf geflüchtet hatte. Das Leben als Mülltaucher war geradezu luxuriös gewesen im Vergleich zu dem hier.
Es überraschte ihn nicht, dass die Natur so gnadenlos sein konnte. Das hatte er schon vor einigen Jahren in Alaska erlebt. Es war ebenfalls im frühen Frühjahr gewesen, während einer Periode heftiger Niederschläge in Form von Schnee, Hagel und Regen. Die Wildnis hatte alles zu bieten, was das Herz begehrte – Fisch, Wild und Beeren, solange man nur wusste, wie man es anstellen musste. Und wenn er etwas wusste, dann das. Trotzdem hungerte er jetzt schon über eine Woche lang, weil alles schiefging.
Er drehte sich wieder um. Mr White saß absolut reglos da und blickte über das Tal. Oxen lag auf einer einfachen Pritsche aus Fichtenholz, etwas erhöht, um die Kälte abzuhalten. Er hatte sie mit einer dicken Schicht aus Fichtenzweigen gepolstert und seine alte Isomatte darübergelegt.
Vor fünf Tagen hatte er dieses Lager eingerichtet. Nachdem er eine Weile die Hänge im oberen Teil des Tals abgesucht hatte, hatte er hier, wo der Ersted Skov an den Vesterskov grenzte, eine geeignete Stelle gefunden. Ein trockener, fester Hügel im Westen, auf der Ersted-Seite des Tals.
Von Skørping und Rebild waren sie zunächst in südwestlicher Richtung gewandert und hatten dann den Hobrovej überquert, der mitten durch das riesige Waldgebiet führte.
Rold Skov erstreckte sich über ungefähr achttausend Hektar. Er wusste aus seiner Zeit in Aalborg noch einiges über den Wald, den Rest hatte er sich angelesen, als er noch in seinem Kellerloch im Nordwestquartier Pläne schmiedete.
Fünfundsiebzig Prozent des Waldes waren in Privatbesitz. Der größte Teil davon gehörte zu den drei Gütern Lindenborg, Nørlund und Willestrup – auf dem Rest hockte der Staat. Oxen befand sich im Augenblick auf dem Grund, der zu Nørlund Slot gehörte. Die ersten Tage, während sie nach einer dauerhaften Bleibe suchten, hatten er und Mr White sich mit einem provisorischen Unterschlupf begnügt.
Dann hatten sie ihr Lager an einem riesigen vom Wind gefällten Baum aufgeschlagen. Die gewaltige Wurzel der Eiche war in der obersten Schicht des sandigen Moränenbodens verankert gewesen, und als die Eiche umgestürzt war, hatte sie ein großes kesselförmiges Loch zurückgelassen. Dennoch hielt ihre Wurzel an der Erde fest und erhob sich wie eine Wand von ungefähr zweieinhalb Metern Durchmesser über der Grube.
Auf der einen Seite bildete die Wurzel einen Giebel, an dem man die große Tarnplane vernünftig verankern konnte. Es war eine dieser billigen Nylonplanen, die man für ein paar Kröten in jedem Baumarkt bekam. Er hatte sie quer über einen langen Fichtenstamm gehängt. Fast drei Meter breit und ungefähr vier Meter lang war ihr überdachtes Lager. Die Pritsche hatte er an der Wurzelwand aufgebaut, um sich bestmöglich vor dem Wind zu schützen. Am gegenüberliegenden Ende des Sandkessels hatten sie ihre Feuerstelle. Mr White schlief neben ihm, in einem eigenen kleinen Bett aus Fichtenzweigen.
Er hatte den Unterschlupf mit allem getarnt, was charakteristisch für dieses sumpfige Tal war: Zweige und Triebe junger Laubbäume und von ein paar Birken, die mit ihrer gefleckten Rinde die Tarnung vollendeten.
Ein ungeübtes Auge konnte von der Böschung aus ihr Lager nicht ausmachen, und das ganze Gebiet bis zum Lindenborg Å war ohnehin so undurchdringlich, dass es als das unwegsamste Gelände des ganzen Königreichs bezeichnet wurde.
Wenn es nur endlich aufhören würde zu regnen.
Er schlug die Decke zurück und setzte sich in seinem Schlafsack auf. Er hatte den Großteil seiner Klamotten an. Regen und Wind hielten die milde Mailuft auf Abstand.
Sein Magen knurrte lautstark. Unter seinem Bett lag eine leere Whiskyflasche, ein Dreiviertelliter Burke & Barrys Slave-Scotch, der eine ganze Woche gehalten hatte. Selbst der war rationiert. Und jetzt war nur noch eine Flasche übrig. Zusammen mit der kleinen Tüte, in der er Zigarettenpapier und etwas Gras aufbewahrte, bildete sie seinen selbstverordneten Medizinvorrat. Er hatte keine Ahnung, was er machen sollte, wenn der irgendwann aufgebraucht sein würde. Vielleicht war das in Wahrheit die größte Herausforderung – die einzige Frage, die sein Rückzug in den Wald ernsthaft aufwarf. Würde er leben? Oder würde er zugrunde gehen?
Wieder rumorte sein Magen. Er fröstelte. Früher war er nie krank gewesen, aber im Nordwestquartier hatte es ihn ein paarmal erwischt.
Allmählich nahm ein neuer Plan in seinem Kopf Form an. Er würde bei Einbruch der Dämmerung einen längeren Ausflug machen.
7.
Die Konferenzen in Kopenhagen zogen sich in die Länge. Vor allem was die Wamberg-Kommission anging, hatte er sich verschätzt. Sie hatte fast eine Stunde länger gedauert, was wirklich ein starkes Stück war. Daher war es schon spät am Abend, als Mogens Bergsøe in seine Villa im idyllischen Sejs-Svejbæk zurückkehrte.
Der Anwalt hatte nur eine Nacht in der Hauptstadt verbracht, wie gewöhnlich im Copenhagen Admiral in der Toldbogade. Er liebte diesen alten Hafenspeicher, der so behutsam umgestaltet worden war.
Sein Schäferhund Hermann konnte so lange gut auf sich selbst aufpassen. Er hatte reichlich Futter und Wasser und einen gemütlichen Platz im Hundezwinger, den er ihm eingerichtet hatte, nachdem Jytte ausgezogen war.
Er lenkte den Cayenne in die Auffahrt und registrierte mit einem Blick in den Rückspiegel, dass das zweite Paar Scheinwerfer direkt hinter ihm war. Sein Leibwächter.
Der Mann, der offiziell keinen Namen trug, aber mit dem Spitznamen »Madsen« einverstanden gewesen war, folgte ihm mittlerweile schon ziemlich lange wie ein Schatten.
Das Haus war dunkel. Nur die Lampen in der Auffahrt, die mit einer Zeitschaltung verbunden waren, brannten, und er konnte den Hundezwinger hinter dem Haus erahnen. Alles war, wie es sein sollte. Und doch … er vermisste Jytte. Das Haus war ohne sie so leer. Es war ihm schleierhaft, warum ältere Frauen, die eine gewisse »künstlerische Ader« besaßen, sich unbedingt »befreien« mussten, sobald sie die sechzig hinter sich gelassen hatten. Herrgott noch mal, für solche Albernheiten war es doch ohnehin zu spät.
Jetzt wohnte Jytte in einer kleinen Wohnung in Silkeborg und verbrachte ihre Tage im Hinterhofatelier einiger äußerst reifer und befreiter Künstlerinnen. Jytte fertigte Glasmosaike, ohne auch nur den Hauch eines erkennbaren Talents.
Sie waren immer noch die besten Freunde. Gingen gemeinsam ins Theater, in die Oper oder zu Jazzkonzerten. Er hatte gehofft, dass sie ihre fixe Idee bald wieder verwerfen würde, aber jetzt wohnte sie schon über ein Jahr allein. Verrücktes Frauenzimmer.
Er parkte den Wagen, stieg aus und verriegelte ihn mit einem Druck auf den Autoschlüssel. »Komm mit«, sagte er zu seinem Leibwächter, ging über den Gartenweg zum Hintereingang und schloss die Tür auf. »Ich habe die weltbeste Salami zu Hause, und dazu genehmigen wir uns noch ein Gute-Nacht-Bier, was meinst du?«
Er knipste das Licht im Flur an und ging in die Küche, wo er als Erstes die Lampe über dem großen Esstisch anmachte.
»Setz dich, Madsen«, murmelte er. »Ich geh nur schnell raus und sehe nach Hermann. Ich bin gleich wieder da.«
Bergsøe drehte sich um und erstarrte im selben Moment. Er blieb mitten in der Küche stehen, den Blick auf das große Fenster gerichtet.
Mit einem Satz war sein Leibwächter bei ihm, drückte ihn auf den Küchenboden und befahl ihm mit gezogener Waffe, in Deckung zu bleiben.
Aber es passierte nichts. Es war kein Laut zu hören. Da war nur die große Silhouette, die reglos in der Buche vor dem Küchenfenster hing. Gerade so gut beleuchtet, dass man sie nicht übersehen konnte.
Sie blieben auf dem Boden sitzen und drückten sich an die Küchenschränke. Dann klingelte Bergsøes Handy. Eine Männerstimme meldete sich, sie sprach Englisch mit einem ziemlich ausgeprägten Akzent. Der Anwalt hörte konzentriert zu.
»Go to hell!«, brüllte er voller Wut, und die Hand, in der er sein Telefon hielt, zitterte.
»That is a stupid answer, Mr Bergsøe. I will …«
»I said: Go to hell!«
Er beendete das Gespräch und schleuderte das Handy von sich.
8.
Der Mond war groß und rund und zeigte ihnen bereitwillig den Weg. Er schätzte, dass sie ungefähr sechs oder sieben Kilometer zurückgelegt hatten. Jetzt waren sie bald am Ziel.
Sie gingen auf dem Hobrovej nach Norden. Jedes Mal, wenn er Autoscheinwerfer kommen sah, zog er Mr White sofort mit sich in den Schatten des Waldes, ging in die Hocke und nahm den Hund in den Arm, um sein weißes Fell zu verdecken, das im Dunkeln wie ein Reflektor wirkte. Oxen wollte unsichtbar bleiben.
Am Vælderskoven bogen sie rechts ab. Er zog den Hund näher zu sich, während sie die Einfahrt zum Hotelrestaurant Rold Storkro hinaufgingen.
»Jetzt müssen wir vorsichtig sein, Whitey. Bleib schön dicht bei mir.«
Als er eine Autotür hörte, versteckte er sich blitzschnell hinter einem Bretterzaun. Er ließ den Wagen vorbeifahren und ging dann weiter zum Hotel. Davor befand sich eine Minigolfbahn, dann kam der Eingang und dann eine überdachte Terrasse mit kleinen Bistro-Tischen. Drinnen saßen einige Gäste.
Er stand hinter einem Baum, und sein Verhalten war dem seines geschätzten Begleiters nicht unähnlich: Er streckte die Nase in die kühle Abendluft und witterte, in der Hoffnung, eine Duftspur aufzunehmen, die sie ihrem Ziel näher bringen würde: der Hotelküche. Doch es gab keine Duftspur, also umrundeten sie in einem großen Bogen das Hotelgebäude.
Als sein Blick auf eine Reihe von Abfallcontainern auf der Hinterseite des Hotels fiel, hatte er keinen Zweifel mehr. Jetzt galt es nur noch, sich nicht erwischen zu lassen und die Augen offen zu halten.
Allerdings wurde ihm plötzlich bewusst, dass er sich möglicherweise verrechnet hatte – bei dem Gedanken an kalte, klebrige Soße in Plastiktüten mit rohen Kartoffel- und Fleischresten lief ihm nicht gerade das Wasser im Mund zusammen. Aber irgendwo musste das Küchenpersonal das Essen doch loswerden, das auf den Tellern übrig blieb, oder die sonstigen Reste, die man den Leuten nicht servieren konnte. Es war nur eine Frage der Geduld.
Nach einer Weile tauchte ein junger Mann auf, der zwei Mülltüten in den hintersten Container warf. Oxen stürzte sich sofort darauf. Im Schein der Taschenlampe untersuchte er den Inhalt. In der ersten Tüte waren Kartoffelschalen. In der zweiten nur leere Dosen, in denen geschälte Tomaten gewesen waren. Er leuchtete in den Abfallcontainer. Es gab nichts, was ihm ins Auge sprang – oder in den Mund.
Ihre Expedition zu dem Landgasthof war eine absolut dämliche Idee gewesen. Exakt genauso dämlich wie dieser ganze Trip in den ewigen Regen.
Plötzlich ging hinter ihm eine Tür auf, und er knallte erschrocken den Containerdeckel zu. Im Licht, das durch die Tür nach draußen fiel, stand eine schlanke Gestalt. Eine Frau.
»He!«
Ihr Ausruf hing in der Luft. Vermutlich war sie genauso überrascht wie er.
»Was in aller Welt machst du da?«, sagte sie schließlich und kam ein paar Schritte auf ihn zu, was ihn ihre Gesichtszüge erkennen ließ. Sie war jung, Anfang zwanzig.
Er suchte immer noch nach einigermaßen passenden Worten. Er war nicht mehr daran gewöhnt, mit jemandem zu reden. Der letzte Mensch, mit dem er sich unterhalten hatte, war ein alter Mann gewesen, dem er aufgeholfen hatte, als er mit seinem Fahrrad gestürzt war. Sie hatten ein paar belanglose Sätze gewechselt, aber das war Monate her. Genau genommen war es kurz nach Neujahr gewesen.
Nein, er war wirklich nicht mehr daran gewöhnt, mit jemandem zu reden. Und schon gar nicht mit einer Frau. Er unterhielt sich ja noch nicht mal mit Mr White.
»Nichts …«
Er merkte selbst, wie lächerlich das klang. Er zog sein Barett tiefer in die Stirn.
»Wühlst du in unserem Müll? Gräbst du tatsächlich in den Küchenabfällen?« Die Frau klang ernsthaft verblüfft.
»Äh …«
»Das ist doch nicht zu fassen.«
Er zuckte mit den Schultern.
»Ist das dein Hund?«
Er nickte.
»Wie heißt er?«
»Mr White.«
Sie kam näher und musterte Oxen im Licht der offenen Tür – ohne erkennbare Scheu.
»Hast du Hunger?«
»Etwas«, murmelte er.
»Na ja, ganz offensichtlich mehr als das. Und der Hund auch?«
Er nickte.
Sie blieb einen Moment stehen und musterte ihn von Neuem. Dann sagte sie energisch: »Na gut. Hier draußen wirst du nichts Essbares finden. Warte, dann bring ich dir was. Zum hier Essen oder zum Mitnehmen?« Sie grinste.
Er war sich nicht sicher, ob das ein Witz gewesen war.
»Zum Mitnehmen. Danke. Das ist nett von …«
Sie war schon verschwunden. Sie klang fröhlich. Und sie hatte ein schönes Lächeln. Würde sie ihn verraten? Nein, sie nicht. Sie würde bestimmt wieder rauskommen.
Es vergingen ein paar Minuten, vielleicht zehn. Sie hatte die Tür nur angelehnt. Er redete sich ein, dass in der Küche wahrscheinlich viel los war und sie sich nicht so schnell wieder loseisen konnte. Dann hörte er hastige Schritte auf den Fliesen im Haus. Und dann war sie wieder da. Lächelnd. Sie hielt ihm eine große Plastiktüte hin.
»Hier, Wildgulasch … Eine Spezialität des Hauses, Reste von heute Abend. Das sollte für euch beide reichen. Ich habe es in ein paar Aluschälchen getan.«
Er nahm die schwere Tüte entgegen und erwiderte ihr Lächeln.
»Tausend Dank, das ist nett von dir.«
»Ist schon okay. Ich habe auch Besteck dazugepackt. Altes Zeug, also behalt es einfach.«
»Danke.«
»Was machst du eigentlich hier draußen am Ende der Welt?« Sie breitete fragend die Arme aus.
»Ich … wir … sind auf der Reise – ins Frühjahr. Um ein bisschen rauszukommen.«
»Bist du ein Landstreicher?«
»Nein, eher nicht.«
»Obdachlos?«
Er zuckte mit den Schultern und räusperte sich. »Auch nicht so richtig. Auf der Reise, wie gesagt. Nach Aalborg.«
»Aalborg? Okay … Darf ich ihn streicheln?« Sie ging in die Hocke.
»Sag Guten Tag, Whitey.«
Der Hund kam vorsichtig näher und ließ sich streicheln und kraulen.
»Was für ein hübscher Kerl. Also … Wir haben viel zu tun, aufräumen und so. Ich muss wieder rein.«
»Natürlich.« Er streckte die Hand aus, und sie nahm sie, ohne zu zögern. »Vielen Dank.«
»Ach, ist schon in Ordnung. Gute Reise – und guten Appetit.«
Sie winkte, dann zog sie schwungvoll die Tür hinter sich zu. Er winkte auch. Es sah nur niemand.
9.
Das gelbe Seekajak war ein edles, renntaugliches Sportgerät. Er hatte es erst seit ein paar Wochen, fühlte sich aber bereits vertraut mit dem schlanken Rumpf und dem ungewohnten Kipppunkt. Hätte er geahnt, welchen Unterschied es machte, hätte er das alte, schwerfällige Anfängermodell, mit dem er sich seit ein paar Jahren zufriedengegeben hatte, schon lange abgeschafft.
Jetzt durfte stattdessen sein Leibwächter Madsen sich mit dem alten Ding herumschlagen.
Es regnete. Schätzungsweise seit hundert Tagen ohne Unterbrechung. Wo zur Hölle blieb eigentlich der Frühling? Er wischte sich das Gesicht mit dem Handschuh ab.
Aber eigentlich war ihm der Regen egal. Es zog ihn aufs Wasser, mit oder ohne Regen. Er musste raus. Die letzten Tage waren eine einzige nervenaufreibende Angelegenheit gewesen. Er war nicht sentimental, was Tiere betraf. Anders als Jytte betrachtete er sie nicht als vierbeinige Menschen. Deshalb war der erhängte Hermann vor seinem Küchenfenster aus seinen Gedanken verschwunden, sobald er ihn zwischen den Birken beerdigt hatte. Was ihn viel mehr quälte, war das, was Hermanns spektakulärer Tod ausgelöst hatte.
Fünf Tage waren seither vergangen. Fünf Tage wie im Gefängnis. Er hatte die Rückendeckung darüber informiert, dass er sein Grundstück vorläufig nicht verlassen würde, und man hatte ihn mit zwei weiteren Wachmännern ausgestattet. Jetzt standen die beiden auf der Badebrücke, jeder mit einem Fernglas in der Hand. Und sie ließen sich verdammt viel Zeit, obwohl sie wussten, wie sehr er darauf brannte, sich zu bewegen.
Endlich ließ der Ältere sein Fernglas sinken und nickte.
»Na dann – gute Fahrt, Bergsøe! Und bleiben Sie in diesem Teil des Sees«, ermahnte ihn der Mann ernst.
Er legte mit einigen langsamen, sanften Paddelschlägen ab. Es war wichtig, sich aufzuwärmen und den Körper gut vorzubereiten, bevor man Tempo aufnahm. Besonders in seinem Alter.
Sie waren erst ein paar Bootslängen draußen, als ein rotes Kajak hinter dem Schilf auftauchte. Es hatte ordentlich Fahrt drauf. Eine Frau saß darin, eine jüngere Frau. Er drosselte das Tempo und wartete höflich, bis sie an ihnen vorbei war.
Er schaute ihr nach. Diese Frau war nicht nur jung, sondern vor allem ausgesprochen hübsch. Ihre glänzenden schwarzen Haare waren im Nacken straff zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, nur eine kleine Strähne stand widerspenstig ab. Sie trug eine dieser neumodischen Sportbrillen, deren Gläser dunkle Spiegel waren. Ihr Gesicht war fein geschnitten und ebenmäßig, die Lippen glänzten rot. Mehr konnte er – bedauerlicherweise – nicht erkennen.
Er grinste breit und winkte. Und sie nahm sich die Zeit, das auch zu tun. Dann legte sie wieder an Tempo zu und glitt an ihnen vorüber.
Frauen, Frauen, Frauen … Er meinte es ehrlich, wenn er sagte, dass er Jytte vermisste und sich wünschte, sie käme wieder nach Hause. Aber es hatte auch seine Vorteile, getrennt zu leben. Seit sie ausgezogen war, hatte er dreimal die Gelegenheit ergriffen, den Rausch vergangener Zeiten neu zu erleben. Das hatte seiner schwindenden Männlichkeit einen gewaltigen … Kick verpasst. Sagte man das nicht neuerdings so?
Normalerweise gab es drei Möglichkeiten: nördlich durch die Sejs-Engstelle raus auf den Brassø, nach Südosten durch die schmale Stelle bei Svejbæk in den Julsø oder nach Westen in den Teil des Borre Sø, der auch Paradies genannt wurde, weil vier hübsche kleine Inseln darin lagen, wie eine Perlenkette in Richtung Østerskov und Virklund aneinandergereiht. Seiner Meinung nach war diese letzte auch die schönste Route, und außerdem war sie gut zu schaffen.
Sie hielten ein moderates Tempo und steuerten direkt auf die große, bewaldete Landspitze auf der gegenüberliegenden Seite zu; von hier aus konnten sie dem Ufer folgen und die vier Inseln der Reihe nach abklappern. Er folgte, wann immer es ging, dem Ufer.
Der Regen lag wie ein Schleier über dem Land und verschlechterte die Sicht, aber vermutlich war auf dem Wasser ohnehin nicht viel los. Sie glitten an der größten der Inseln vorbei, Borre Ø, die ein Stück links von ihnen lag. Er fühlte sich inzwischen gut aufgewärmt und erhöhte den Takt. Er blickte über seine Schulter. Ohne jegliche Anzeichen von Anstrengung folgte ihm sein Schatten, Madsen. Er hatte am Badesteg gesehen, wie der Mann das Pistolenholster unter seiner Jacke zurechtgerückt hatte. Das war bestimmt unbequem.
Er hatte in seinem Leben schon viel durchgemacht und über die Jahre nicht selten mit besonders heiklen Informationen zu tun gehabt, vor allem was die nationale Sicherheit betraf. Gerade in den letzten Jahren seiner Mitgliedschaft in der Wamberg-Kommission war das noch viel heftiger geworden als jemals zuvor. Aber nichts hatte je dazu geführt, dass er mit bewaffneten Wachleuten ausgestattet werden musste, niemals.
Er wollte die düstere Perspektive dieser prekären Angelegenheit, in die sie geraten waren, nicht in Abrede stellen. Es war ein beunruhigender Anschlag auf sie alle, eine offenkundig ernst zu nehmende Bedrohung ihrer Sicherheit, doch es gab einen Grund, weshalb er sich trotzdem sicher fühlte: Der Rückhalt, das gesamte Netzwerk einflussreicher Kräfte, das niemand sehen oder hören konnte, diese große, lautlose Maschinerie arbeitete bereits unter Hochdruck daran, die Gefahr zu lokalisieren und zu eliminieren.
Deshalb war sein Optimismus ungebrochen. Es brauchte schon mehr als einen toten Hund, um ihn zu erschüttern.
Sie fuhren rechts an Langø vorbei und weiter auf die dritte der Inseln zu, Bredø, die nur ungefähr zweihundertfünfzig Meter entfernt ganz dicht an einer schmalen Landzunge am Südufer des Sees lag. Die letzte und kleinste Perle in der Inselreihe war Annekens Ø, und die wollte er gern umrunden.
Er korrigierte den Kurs ein wenig, um links an Bredø vorbeizukommen und die schmale Durchfahrt zwischen der Südspitze der Insel und der Landzunge zu nehmen. An dieser Stelle war das Wasser tief. Im Sommer sah man hier oft Segler, die vor der Insel ankerten, um zu baden. Er ließ das Paddel einen Augenblick ruhen. Ein Haubentaucher verschwand im Schilf, als sie näher kamen, und er glaubte, über der Landzunge einen Mäusebussard kreisen zu sehen. Er schaute zurück. Madsen war nur ein paar Längen hinter ihm. Auch er machte Pause.
Lautlos glitten sie weiter durchs Wasser. Er spähte zu der Insel und glaubte fast, das Lachen des Sommers zu hören, das Quietschen und Planschen der Kinder. Es war ein wunderbares …
Da wurde die Wasseroberfläche vor der Spitze des Kajaks jäh durchbrochen. Eine schwarze Gestalt schoss in einer Wasserfontäne senkrecht aus der Tiefe wie ein Monster.
Ein Taucher. Mit Maske, Schläuchen und Flasche auf dem Rücken. Bergsøe blieb das Herz stehen. Oder es zerriss vor Schreck. Dann ging alles blitzschnell.
Er sah, wie ein schwarzer Arm den gelben Rumpf des Kajaks umklammerte, während sich der zweite Arm nach oben streckte. Er bemerkte irgendetwas in der Hand des Tauchers, hörte ein Rauschen – und konnte sich gerade noch so weit umdrehen, dass er mitbekam, wie die Spitze der Harpune in Madsens bloßem Hals stecken blieb.
Dann verlor er das Gleichgewicht und fiel ins Wasser.
In seinem Kopf herrschte das blanke Chaos. Er hatte Wasser im Mund, vor seinen Augen stiegen Luftbläschen auf. Schließlich spürte er einen harten Griff um den Hals, und als er wieder auftauchte, sah er eine glänzende Messerklinge vor seinem Gesicht.
Das war’s.
Der Mann hielt ihn von hinten eisern fest. Er erkannte seine Stimme, es war dieselbe wie neulich am Telefon, derselbe Akzent. Sie hatten ihre geheimnisvollen Gegner unterschätzt.
Gleich war es vorbei.
Die Fragen zischten scharf in sein Ohr. Schon beim ersten Zögern bekam er die Klinge zu spüren. Also versuchte er prustend, seine Antworten herauszupressen.
Er war erledigt. Er antwortete, so gut er konnte. Ganz ohne abzuwägen, ob der Mann ihn im Gegenzug verschonen würde oder nicht. Auf Befehl des Tauchers stöhnte er eine Reihe neuer Antworten hervor.
Aber … er konnte nicht alles beantworten. Er kannte die Antwort auf die Frage nicht, die der Taucher ihm wieder und wieder stellte. Er konnte es ihm ganz einfach nicht sagen.
Und dann war da nur noch Chaos. Chaos und Luftblasen.
Der Taucher drückte Anwalt Bergsøes Kopf unter Wasser und sorgte dafür, dass er dort auch blieb. Erst fing Bergsøe wild zu zappeln an. Dann ließ der Widerstand nach. Und schließlich lag der Körper leblos im Wasser.
Der Taucher schob die Leiche von sich weg und schwamm zu der Stelle im Schilf, wo er seine Jolle versteckt hatte.
Die Antwort hatte er nicht bekommen – aber er wusste jetzt genug, um weitermachen zu können. Damit musste er sich zufriedengeben. Er nahm seine Ausrüstung aus dem Wasser, legte sie ins Boot und kletterte an Bord. Dann ließ er den Motor an.
Der nächste Schritt musste gut überlegt sein. Es wurde immer gefährlicher, je näher sie ihrem Ziel kamen.
Aus dem Augenwinkel sah er die Leiche des Anwalts, die dicht am Rand des Schilfgürtels der kleinen Insel trieb. Die gelbe Schwimmweste leuchtete förmlich. Das Gesicht war unter Wasser, die Arme waren zur Seite gestreckt.
10.
Er robbte durch das nasse Gras, das Kampfmesser zwischen den Zähnen. Dann lag er still und lauschte intensiv, bis er sich langsam weiter vorwärtsbewegte, auf die Ellenbogen gestützt. In dieser Nacht war die Dunkelheit undurchdringlich.
Das Einzige, was er gerade noch erkennen konnte, waren die Umrisse der kleinen Baumgruppe, auf die er zusteuerte. Von dort war das Geräusch gekommen. Oder nicht? Ein Geräusch, das nicht in den Wald gehörte, ein metallischer Laut. Ja, das Klicken zweier Metallteile. Ein Magazin, das einrastete? Ein Maschinengewehrständer, der ausgeklappt wurde?
Er blieb lange reglos liegen. Rollte sich auf den Rücken und starrte in den pechschwarzen Nachthimmel, aus dem es vermutlich am Morgen wieder regnen würde.
Hier war nichts zu hören. Nicht mal das Schmatzen einer Haselmaus, das Rülpsen einer Eule oder das ferne Furzen eines Damhirschs.
Es war – wie immer – falscher Alarm.
So war das auch gewesen, wenn er sich mitten in der Nacht geduckt in einem Hinterhof des Nordwestquartiers wiedergefunden hatte, bewaffnet mit seinem Kampfmesser, das immer griffbereit unter seinem Kopfkissen lag.
Er stand auf und schlich zurück in sein Lager, zog die Regensachen aus und kroch in seinen Schlafsack. Mr White schnarchte ungerührt weiter in seinem Bett aus Fichtengrün. Oxen konnte spüren, dass eine seiner unruhigen Phasen heranrollte. Sie kamen in Wellen.
Es war fast fünf Uhr. Die Nacht war die Hölle gewesen. Er hatte wieder Besuch von einem der Sieben bekommen. Vielleicht von dem Grauenhaftesten von allen: dem Kuhmann.
Der faltige Alte trat immer aus dem Nebel unten am Fluss. Erst konnte man nur erahnen, dass sich dort etwas bewegte. Dann war er immer deutlicher zu erkennen, je näher er kam. Er zog seine Kuh hinter sich her über die kleine Hauptstraße des Dorfes. Links und rechts der Straße standen Ruinen. Mauerreste und Brandstätten, wohin man auch sah.
Nur ein einziges Haus im ganzen Dorf war unversehrt, als würde es von einer hohen, unsichtbaren Mauer geschützt, die kein Krieg zerstören konnte.
Das kleine Anwesen lag auf der anderen Straßenseite, schräg gegenüber. Es war hellgelb gestrichen. An den Fenstern blühten sogar ein paar Blumen. Ein grünes Tor führte in den Innenhof.
Oxen saß oben auf dem gepanzerten Mannschaftswagen und beobachtete, wie der Alte aus dem Nebel auftauchte und auf das gelbe Haus zuging.
Einer der anderen kam zu ihm und zündete sich eine Zigarette an.
»Oxe, schau mal der alte Opi … Und wie zur Hölle ist das da eigentlich möglich?«
Verwundert zeigte sein Kamerad zu der unversehrten gelben Hausmauer. Neben der Haustür hatte jemand mit roter Farbe ein paar Zeichen an die Wand gemalt. Ein Kreuz mit vier C rundherum, die beiden linken spiegelverkehrt.
Nur dass die vier kyrillischen Buchstaben keine C waren, sondern S. Sie standen für Samo sloga Srbina spasava.
»Deshalb ist das möglich«, hörte er sich selbst wieder und wieder und wieder antworten. Deshalb war das gelbe Haus unversehrt.
Der Alte war jetzt ganz nah.
»Samo sloga Srbina spasava – das heißt übersetzt: ›Nur Eintracht rettet den Serben.‹ Das ist ein Schutzmantra.«
Als der Kuhmann direkt vor ihnen stand, verzog er den Mund zu einem boshaften Grinsen voller verrotteter Zahnstummel.
Das war der Moment, in dem Oxen aufwachte. Diesmal mit dem Gefühl, laut und durchdringend geschrien zu haben, doch ohne jede Erlösung. So war es oft. Schreie und Warnungen, die nicht aus seinem Hals wollten, sondern ihn am Rand des Fegefeuers weckten.
Macht war gut. Macht war notwendig. Ohnmacht war die Hölle. Obwohl sie Zeugen ethnischer Säuberungen geworden waren, hatten sie nichts anderes getan, als harmlose Papierberichte nach Hause zu schicken.
Sie waren so etwas wie sieben Familienmitglieder geworden, der Kuhmann und die anderen, die ihn heimsuchten. Er kannte jeden von ihnen in- und auswendig. Sie hatten alle ihre Eigenheiten. Sie taten nie etwas Unerwartetes – und dennoch konnte er sie nicht überlisten oder bezwingen.
Es war eine höllische Nacht gewesen, gefolgt von höllischen Morgenstunden mit einem falschen Alarm in der Dunkelheit.
Er setzte sich auf, knipste die Taschenlampe an und griff nach der Tüte mit dem Zigarettenpapier und dem Gras. Er drehte sich hastig einen Joint, zündete ihn an, inhalierte tief und hielt die Luft an, solange er konnte.
Licht … ein gleißendes Licht. Und ein vages Gefühl von Wärme. Ganz langsam erwachten seine Sinne, wie kleine Blasen, die den langen Weg aus dem schlammigen Meeresboden emporstiegen.
Er zwang sich, die Augen einen Spaltbreit zu öffnen. Von oben, durch ein Loch zwischen der Wurzelmauer und der Plane, fiel ein lebenspendender Streifen Sonne auf sein Gesicht. Er drehte sich um, hob die Plane an und warf einen Blick nach draußen. Die strahlende Landschaft blendete ihn. Er schielte auf seine Armbanduhr und stellte fest, dass es elf Uhr war. Er hatte sehr lange und ruhig geschlafen – einen leeren Schlaf. Sein Körper fühlte sich schwer und schlaff an. Das kam manchmal vor. Wenn extremer Schlafmangel dadurch ausgeglichen wurde, dass eine unsichtbare Kraft, oft unterstützt von Whisky oder richtig gutem Gras, ein Gewicht auf die Seite der Waagschale fallen ließ, die bei ihm viel zu lange leicht gewesen war.
Er rollte sich auf den Rücken, bis er den Sonnenstrahl wiedergefunden hatte. Blieb einfach liegen, ohne sich zu rühren, und nahm Licht und Wärme mit seinem Gesicht auf.
Endlich. Die Sonne war gekommen. Jetzt würde es wirklich Frühling werden.
11.
Die vierundzwanzig Stunden des Tages hatten Hans-Otto Corfitzen noch nie gereicht. Das war schon seit seiner frühesten Kindheit so gewesen und hatte sich in all den Jahren seiner beispiellosen Diplomatenkarriere auch nicht geändert – bis heute, da er seinen Titel schon lange mit den beiden Buchstaben »Ex« ergänzt hatte.
Exbotschafter Corfitzen fuhr sich mit der Hand durch das weiße Haar, legte die Lesebrille auf die Zeitung und blickte aus dem Fenster. Endlich, die Sonne war gekommen. Jetzt würde es wirklich Frühling werden.