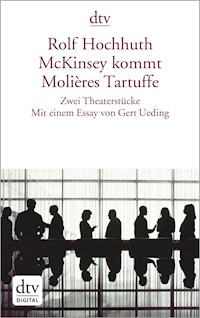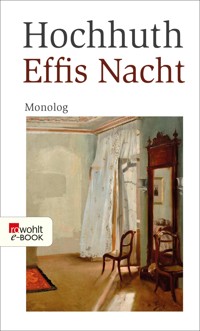
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Theodor Fontane läßt Effi Briest als junge Frau sterben. Effis Vorbild hingegen, Elisabeth (Else) Baronin Ardenne, starb 1952, achtundneunzig Jahre alt. Wie Effi Briest Ehebrecherin, wie sie durch gefundene Briefe verraten, nach dem Duell zwischen Mann und Liebhaber geschieden, von der Familie verstoßen und mittellos, ist sie später Krankenschwester geworden. In einer Nacht des Kriegsjahres 1943 wacht sie in Lindau am Bett eines Schwerverwundeten. Und als sei sie es, die stirbt, läßt sie ihr Leben an sich vorüberzíehen. «Es gibt kein überzeugenderes literarisches Mittel, als anhand eines langen Lebens das Zeitalter zu beleuchten, dessen Zeuge dieser Mensch war.» (Rolf Hochhuth)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 98
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Rolf Hochhuth
Effis Nacht
Monolog
Über dieses Buch
Theodor Fontane läßt Effi Briest als junge Frau sterben. Effis Vorbild hingegen, Elisabeth (Else) Baronin Ardenne, starb 1952, achtundneunzig Jahre alt. Wie Effi Briest Ehebrecherin, wie sie durch gefundene Briefe verraten, nach dem Duell zwischen Mann und Liebhaber geschieden, von der Familie verstoßen und mittellos, ist sie später Krankenschwester geworden. In einer Nacht des Kriegsjahres 1943 wacht sie in Lindau am Bett eines Schwerverwundeten. Und als sei sie es, die stirbt, läßt sie ihr Leben an sich vorüberziehen. «Es gibt kein überzeugenderes literarisches Mittel, als anhand eines langen Lebens das Zeitalter zu beleuchten, dessen Zeuge dieser Mensch war.» Rolf Hochhuth
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg bei Reinbek, April 2019
Copyright © 1996 by Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Alle Rechte der Bühnenaufführung, der Verfilmung und der Sendung in Rundfunk und Fernsehen sowie des öffentlichen Vortrags liegen beim Rowohlt Theater Verlag, Hamburg
Umschlaggestaltung any.way, Walter Hellmann
Umschlagabbildung akg-images (Adolph von Menzel, Das Balkonzimmer, 1845)
ISBN 978-3-644-00400-9
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Zwei Freunden gewidmet
in Dankbarkeit:
Herrn Walter Scheiterle
Herrn Erich Fischer
«Ich lese noch einmal Ihren letzten Brief … was Sie über Fontane und die vergangene Literatur sagten … Und dann lese ich Ihre Zeilen weiter und dann sinken die Schatten. Und in ihrem Dunkel sehe ich noch einmal die Gestalten meiner Generation, die Figuren, mit denen ich großwurde, die Gesichter mit den gleichen Zügen; auch höre ich sie, sie sagen: ‹zurückblicken und allein sein; alles noch einmal überdenken und dann mit seltsamen Erkenntnissen von dannen gehen. Keine Rechtfertigung vor irgendwas und vor irgendwem; keine Bestätigung, allerdings auch keine Unruhe mehr. Das also war es –? Gut, daß man es nicht wußte!›»
Gottfried Benn an F.W. Oelze, Berlin, 13.8.1939
«Effi Briests Enkel, Professor Manfred von Ardenne, der berühmteste Wissenschaftler der DDR, schrieb über seine Großmutter: «Im Alter von etwa fünfzig Jahren bestieg sie als erste Frau den an der Schweizer Grenze, dicht bei Liechtenstein gelegenen 2970 m hohen Berg Scesaplana, zu dessen Gipfel meine Frau und ich 1969 bei einem Abstecher nach Klosters mit bewunderndem Erinnern emporblickten. Mit sechzig Jahren lernte sie Skilaufen und mit achtzig Radfahren. Am 4. Februar 1952 starb sie neunundneunzigjährig in Lindau am Bodensee.»
Die – heute hier, 1943 – Neunzigjährige sieht mehr als zehn Jahre jünger aus und hat auch bis vor kurzem noch Nachtdienste bei Schwerkranken geleistet, damit hat sie ja seit ihrer Scheidung vor fast sechzig Jahren ihr Brot verdienen müssen, jahrzehntelang. Denn an Elisabeth Freifrau von Ardenne, geborene Edle Freiin von Plotho, als Ehebrecherin hat natürlich ihr geschiedener Mann, der General, nichts gezahlt, so wenig er ihr siebzehn Jahre lang erlaubte, ihre Tochter Margot und dreiundzwanzig Jahre lang ihren Sohn Egmont zu sehen.
Jetzt macht sie Nachtdienst nur noch ausnahmsweise …
Der fast bühnengroße Wohnraum hat einen breiten Balkon mit Flügeltüre zum Bodensee hin. Für den Sohn des Hauses, den die Wehrmacht Hitlers zum Sterben aus dem Lazarett zu seinen Eltern, seiner Schwester entlassen hat – das kam vor, wenn Familien Beziehungen zu Militärärzten hatten –, ist ein schweres, hohes, fahrbares Klinikbett ins Balkonzimmer gestellt worden.
Großes Waschbecken rechts vorn. So oft Elisabeth am Waschbecken ist, verdeckt sie so auch ein wenig das Bett. Jugendstilmöbel, sehr langes Bücherregal, darüber Thoma- und Leistikow-Drucke, auch gute Aquarelle, wie sie in den dreißiger Jahren gemalt wurden, einheitlich geschmackvoll mit schmalen holzfarbenen Leisten gerahmt – vielleicht malt sie eines der Familienmitglieder. Den Studenten (hier ein wortloser Statist) betreut heute deshalb die alte Dame, weil seine Schwester, die das sonst tut, irgendwohin in ein Lazarett reiste, um ihren dort auch schwer verwundet eingelieferten Bräutigam zu besuchen.
Verdunkelung: Die breite Türe ist sorgfältig durch zwei Rouleaus abgedunkelt, wie seit Kriegsbeginn am 1.9.1939 für jedes Fenster im Deutschen Reich verordnet; links und rechts müssen neuerdings sogar laut streng überwachter Vorschriften Klammern an der Wand dafür sorgen, daß selbst Lichtspalten unmöglich sind … Es dauert noch ein Jahr, bis britische Bomber – die amerikanischen fliegen ihre Angriffe auf Deutschland am Tage und zielen Fabriken und Bahnhöfe an – selbst bei Nacht ihre Opfer, die Innenstädte, in die sie ungezielt hineinbomben, dank neuer Geräte so mühelos anpeilen können, als lägen sie im Sonnenlicht unter ihnen.
Der Regisseurin oder dem Regisseur zur Hand gehen sollte ein Neurochirurg – zumindest ein Pfleger oder eine Pflegerin, die langjährige Berufserfahrung auf dem Gebiet der Neurochirurgie gesammelt haben. Denn der stumme Patient ist andauernd hilfebedürftig, was die Nachtwache oder Tagwache bei ihm nicht nur für Else von Ardenne, sondern auch für Zuschauer auf eine makabre Weise ‹kurzweilig› macht. Der Patient liegt nicht flach; er sitzt fast. Das Kopfteil des Betts ist hochgestellt. Es ist klar, daß nie der Monolog – daß immer die Beobachtung des Schwerverwundeten und Hilfe für ihn den Vorrang haben. Der Autor, die Regisseurin, der Regisseur können nicht ohne ärztlichen oder pflegerischen Rat den Rhythmus der Hilfstätigkeiten für den Kranken festlegen; das können nur medizinisch Erfahrene. Denn da ist sehr viel Verschiedenes, und es ist oft zu tun: Er erhält Magenkost durch die Sonde in der Nase. (Die Ernährung fließt aus einer Infusionsflasche, die an einem Infusionsständer über dem Bett hängt. So auch der Tee, denn der Kranke ist sehr durstig.)
Der Husten, der ihn quält; die Notwendigkeit, das Bettuch zu wechseln, denn fast jedesmal, wenn er stark husten muß – weil die Kanüle, die er im Hals hat, in der Luftröhre, er bekam einen Luftröhrenschnitt (Tracheotomie), verschleimt –, macht er unter sich; die flüssige Nahrung (Sondenkost) verursacht Durchfall. Dann muß ihm Frau von Ardenne ein neues Leintuch unterlegen, den Studenten, der nur ein kurzes Turnhemd anhat, umlagern. Er ist rechtsseitig gelähmt, es bedarf also einiger Anstrengung, ihn zunächst auf die gelähmte, dann auf die gesunde Seite zu wälzen und das Tuch unterzuschieben. Sie gibt ihm Opiumtropfen.
Sie muß ihm hin und wieder Ellenbogen und Beine beugen, weil er das wegen der Lähmung nicht kann.
Die Luftwege müssen, wenn sie verschleimt sind, mit einem Sauggerät durch einen dünnen Schlauch abgesaugt werden, immer dann, wenn sein Röcheln zeigt, daß der künstliche Atemweg – die Sonde im Hals – verstopft ist, durch Schleim.
Sein Kopf ist bandagiert, auch die – herausgeschossenen – Augen; frei sind nur Ohren, Nase, Mund und Kinn.
Es ist durchaus fraglich, ob der Patient noch hört; Else von Ardenne hält das für möglich, denn Bewußtlose haben keinen Hustenreflex, weshalb sie ihn anspricht, ihm vorliest, Musik macht.
Sie wäscht ihm einmal auch den Rücken. Sie wäscht ihn, so oft sie das Tuch wechselt, unterhalb des Nabels. Sie hat eine Waschschüssel mit mehreren Lappen. Sie reibt ihm einmal mit Wacholdergeist das Kreuz ein, sie mißt dreimal unter der Achsel sein Fieber. Sie hält ihm die Hand, spricht zu ihm …
Elisabeth tritt aus dem halbdunklen Hintergrund an der rechten Wand, wo sie sich über den fast schon leblosen Kopf im Bett gebeugt hat, in die durch eine Stehlampe erhellte Mitte des Raumes. Sie sagt so selbstverständlich zu sich, wie andere zu anderen sprechen, denn Selbstgespräche haben seit Jahrzehnten die Nachtwachende davor bewahrt, einzuschlafen; und sie weiß, der Zerschossene hört vermutlich nichts mehr; ist dessen aber keineswegs sicher:
Endlich schläft er – noch nicht zum letztenmal,
obgleich er heute – bis jetzt – ganz ohne Angst war.
Schrecklich, daß ich die Nachrichten … die englischen,
ganz unbesorgt hören darf,
weil ja der arme Junge nicht mehr denunzieren könnte,
daß ich den «Feind»-Sender höre,
heute hier in diesem fremden Hause …
Sie geht zu dem ihr nicht vertrauten Radio und dreht ein wenig an ihm herum, bis sie BBC gefunden hat, sieht dann aber auf die Uhr und murmelt:
Noch nicht zehn … vor dem Haus kann keiner stehen,
der mich belauscht, wegen des großen Vorgartens …
ich spüre wie oft nun schon
und mache doch immer unbelehrbar weiter:
mit über neunzig soll man eben keine Wache mehr
bei Sterbenden übernehmen – je näher selber dem Grab,
je strikter meidet man den Anblick Dahingehender …
Und dann: Wer ist man schon,
fragt man sich immer öfter,
daß man aufbewahrt wurde, verschont blieb
– um sogar Jungen, ja Kindern beizustehen, zuletzt,
die siebzig Jahre jünger sind als man selbst …
Und doch, ungelebt, ungeliebt: schon wegmüssen!
Wie zwei – bisher schon zwei, wer weiß,
wer ihnen noch folgt –
meiner Enkel … Jetzt BBC!
Sie stellt nach einem Blick auf die Armbanduhr das Radio an, einen kleinen sogenannten Volksempfänger («Volks-Einfänger!»), nachdem sie sich dicht vor ihn gesetzt hat, sozusagen das Ohr am Apparat – und schrickt zurück und dreht rasch leiser, weil das Motiv aus Beethovens Fünfter mit Macht einsetzt, dieser weitaus spektakulärste aller Symphonien-Einsätze, den die britische Propaganda mit gutem Instinkt ausgewählt hat, um deutsche Hörer zu verlocken, den britischen Rundfunk einzuschalten. Obgleich doch das Abhören des «feindlichen Rundfunks» mit Einweisung ins KZ bestraft wird, und sogar die Guillotine wartet auf jene «Volksgenossen», die herumerzählen, was die Briten meldeten.
Jetzt hört sie; es spricht in tadelfreiem «hannoverschem» Hochdeutsch ein Emigrant:
«Deutsche Hörer!
In Nordafrika ist der Krieg zu Ende: Sämtliche Deutschen, die seit zwei Jahren auf Befehl Hitlers in das einst als unbesiegbar gerühmte Afrika-Korps des Marschalls Rommel eingerückt waren, sind in britischer Gefangenschaft oder – tot. Premierminister Churchill hat alle britischen Kirchen um dreitägiges Glockenläuten gebeten.
Und er nannte heute früh im Unterhaus die totale Vernichtung der Rommeltruppen durch die Achte Armee des Feldmarschalls Montgomery den ‹triumphalsten Sieg, den in ihrer mehr als tausendjährigen Geschichte britische Landstreitkräfte über einen Feind errungen haben›. Mr. Churchill fügte hinzu: ‹Auch für die Deutschen ist ihre Kapitulation in der Wüste ein alarmierender Tag. Denn nie zuvor sind die einst so ruhmreichen Armeen Friedrichs des Großen in solchen Massen getötet oder gefangen worden wie heute hier durch englische Soldaten und wie vor erst einem halben Jahr durch Marschall Stalins Rote Armee in Stalingrad. Während der vier Jahre des Ersten Weltkrieges gab es nirgendwo eine Schlacht, in der auch nur annähernd so viele Deutsche gefangengenommen worden wären wie im Winter in Stalingrad und nun heute in der Wüste. Das deutsche Volk›, setzte Mr. Churchill hinzu, ‹hat längst begriffen, in welche Niederlage die Nazi-Banditen es hineinführen durch ihren Führer.›
Mr. Churchill fragte im Unterhaus, ob nun endlich sogar die Preußenpriesterschaft, der angeblich so ehrenhaft gebliebene Berliner Generalstab, begreife, welchem blutigen Dilettanten er sich an den Hals geworfen habe, als er eidbrüchig die Weimarer Republik verriet? Die Generale hatten doch der Republik – wie einst dem Kaiser – die Treue geschworen! Schwuren sie nun aber zum drittenmal einem anderen – jenem Hitler, einem obskuren Halbösterreicher, Halbtschechen, dem der Feldmarschall Hindenburg stets mit ahnungsvollem Mißtrauen begegnet ist, so daß er Hitler niemals anders genannt als ‹den böhmischen Gefreiten›.
‹Wo aber sonst, in welchem Lande sonst›, schloß
Mr. Churchill, ‹hätte je eine kleine, an ihrem Volk verbrecherisch gewordene Kaste, die Generalität, so viele Untertanen ermordet wie diese längst ehrlos gewordene preußische Armeeführung? Und sie schlachtet ihre tapferen deutschen Soldaten für den Landfremden Hitler!›
In Großbritannien läuten drei Tage lang die Glocken!»