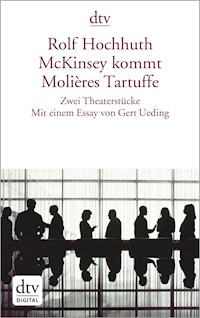9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
«Demonstrationen, welche die Polizei erlaubt, sollten von den Veranstaltern verboten werden», rief Rolf Hochhuth 1968 den Notstandsgegnern zu, die sich in Frankfurt versammelt hatten. 1965 veröffentlichte er seinen Aufruf «Der Klassenkampf ist nicht zu Ende». An dem von Christlicher Union und Sozialdemokratie fünfundzwanzig Jahre erfolgreich diffamierten Begriff wurde die bundesdeutsche Wirklichkeit gemessen. Der Bundestag debattierte über Hochhuths Thesen, der Theologe Hans Werner Bartsch schrieb: «Seit über zehn Jahren regelmäßiger ‹Spiegel›-Lektüre habe ich noch keinen besseren, aufrüttelnderen Artikel gelesen. Die Eigentumsdenkschrift der Evangelischen Kirche liest sich, damit verglichen, wie ein Ammenmärchen.» Die Forderung des politischen Außenseiters – die Arbeiter und Angestellten an den Produktionsmitteln zu beteiligen – hat Eingang in Bonner Gesetzesvorlagen gefunden. Hier erweist sich die Funktion des kritischen Geistes im Gesellschaftsprozeß. Hochhuth hat wieder dafür gesorgt, daß, wer Klassenkampf sagt, nicht mehr Hohnlachen, sondern Beunruhigung und Zorn bei den Mächtigen auslöst. Doch der Autor greift in diesen, 1971 zum erstenmal in Buchform veröffentlichten zeitkritischen Essays nicht nur an, er will auch kommunizieren, er sucht das Gespräch mit dem Gegner. So wird die Geschichte seiner Dramen auch Teil der politischen Geschichte seiner Zeit. Daß nach langem Schweigen selbst Papst Paul VI. an der «Stellvertreter»-Diskussion teilnahm, gehört ebenso in die politische Bilanz wie die Reaktion des britischen Premiers auf «Soldaten». Der politische Moralist Hochhuth zwingt durch sein Engagement die Zeitgenossen zu Stellungnahme und Umdenken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 477
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Rolf Hochhuth
Krieg und Klassenkrieg
Studien
Ihr Verlagsname
Mit einem Vorwort von Fritz J. Raddatz
Über dieses Buch
«Demonstrationen, welche die Polizei erlaubt, sollten von den Veranstaltern verboten werden», rief Rolf Hochhuth 1968 den Notstandsgegnern zu, die sich in Frankfurt versammelt hatten. 1965 veröffentlichte er seinen Aufruf «Der Klassenkampf ist nicht zu Ende». An dem von Christlicher Union und Sozialdemokratie fünfundzwanzig Jahre erfolgreich diffamierten Begriff wurde die bundesdeutsche Wirklichkeit gemessen. Der Bundestag debattierte über Hochhuths Thesen, der Theologe Hans Werner Bartsch schrieb: «Seit über zehn Jahren regelmäßiger ‹Spiegel›-Lektüre habe ich noch keinen besseren, aufrüttelnderen Artikel gelesen. Die Eigentumsdenkschrift der Evangelischen Kirche liest sich, damit verglichen, wie ein Ammenmärchen.» Die Forderung des politischen Außenseiters – die Arbeiter und Angestellten an den Produktionsmitteln zu beteiligen – hat Eingang in Bonner Gesetzesvorlagen gefunden. Hier erweist sich die Funktion des kritischen Geistes im Gesellschaftsprozeß.
Hochhuth hat wieder dafür gesorgt, daß, wer Klassenkampf sagt, nicht mehr Hohnlachen, sondern Beunruhigung und Zorn bei den Mächtigen auslöst. Doch der Autor greift in diesen, 1971 zum erstenmal in Buchform veröffentlichten zeitkritischen Essays nicht nur an, er will auch kommunizieren, er sucht das Gespräch mit dem Gegner. So wird die Geschichte seiner Dramen auch Teil der politischen Geschichte seiner Zeit. Daß nach langem Schweigen selbst Papst Paul VI. an der «Stellvertreter»-Diskussion teilnahm, gehört ebenso in die politische Bilanz wie die Reaktion des britischen Premiers auf «Soldaten». Der politische Moralist Hochhuth zwingt durch sein Engagement die Zeitgenossen zu Stellungnahme und Umdenken.
Über Rolf Hochhuth
Rolf Hochhuth, geboren am 1. April 1931 in Eschwege, war Verlagslektor, als er 1959 während eines Rom-Aufenthalts sein erstes Drama «Der Stellvertreter» konzipierte, das, 1963 in Berlin von Erwin Piscator uraufgeführt, weltweites Aufsehen erregte. Hochhuth blickt auf ein umfangreiches dramatisches, essayistisches und lyrisches Werk zurück. Er lebt in Berlin.
Ausgezeichnet wurde Hochhuth u.a. mit dem Kunstpreis der Stadt Basel (1976), dem Geschwister-Scholl-Preis (1980), dem Lessing-Preis der Freien Hansestadt Hamburg (1981), dem Elisabeth-Langgässer-Preis (1990) und dem Jacob-Grimm-Preis für Deutsche Sprache (2001).
Inhaltsübersicht
MEINEM FREUND
ROBERT DAVID MACDONALD
Ein Schriftsteller, wo er politisch auch schreibt, in Deutschland ein Schuft unter Schurken bleibt.
Frank Wedekind
«Es gibt keinen subalterneren Hohn als den auf den Dichter, der ‹in die politische Arena hinabsteigt›. Was aus ihm spricht, ist im Grunde das Interesse, das im Schweigen und im Dunkel walten möchte, unbeaufsichtigt durch den Geist, von dem es wünscht, daß er sich hübsch im ‹Geistigen›, im ‹Kulturellen› halte, und dem es dafür erlaubt, das Politische als unter seiner Würde zu betrachten. Daß er eben damit zum Knecht des Interesses, zu seinem mit falscher Würde bezahlten Helfershelfer und Parteigänger wird; daß er überdies mit solchem vornehmen Rückzug auf den Elfenbeinturm eine anachronistische Albernheit begeht, soll er nicht merken …»
Thomas Mann
Die Verantwortung des Intellektuellen
Zum Impetus der Arbeiten Rolf Hochhuths
Es sei alles gesagt?
Es ist nicht alles gesagt; Noam Chomsky – dessen Aufsatz ‹Die Verantwortlichkeit des Intellektuellen› nicht nur dem Titel nach Modell zu diesen Überlegungen war – ist auf die Banalität dieses Arguments von der Banalität eingegangen: Der Scheu, einen Satz hinzuschreiben wie «Die Intellektuellen haben die Verantwortung, die Wahrheit zu sagen und Lügen aufzudecken», dieser Scheu entspricht die Kraft der Denunziation: dieses sei ein Gemeinplatz. Das Versammlungsvolumen dieses gemeinen Platzes anzuzeigen bedürfte es einer Liste vom Umfange des New Yorker Telefonbuches; das Beispiel Arthur Schlesinger ist pars pro toto: Der erklärte – auf die Diskrepanz zwischen seinem später veröffentlichten Bericht über die Schweinebucht-Affäre und seine erste Pressedarstellung angesprochen – schlicht, er habe gelogen. Im nationalen Interesse, versteht sich.
Die Frage ist zu stellen nach Platz und Rolle des Individuums, nach seiner Möglichkeit der Selbstbestimmung, damit den Koordinaten und Kausalitäten, die es bestimmt. ‹Es bestimmt›: nicht nur grammatikalisch, auch logisch eine aktive wie passive Konstruktion. Das Individuum als Subjekt wie als Objekt, das war nicht zufällig Kern der Auseinandersetzung zwischen Adorno und Rolf Hochhuth, und nicht zufällig entzündet an Georg Lukács. Adorno, bis hin zum fatalen Ausgang der Debatte mit seinen Studenten, die ihren ikonographierten Messianismus in Aktivität (oder Aktivismus) übertrugen, leugnete Kraft und Sinn dieses ‹Tuns›; in einem Text, der bezeichnenderweise ‹Resignation› heißt, denunziert er – übrigens ganz unbewiesen – die 11. Feuerbachthese als «autoritär, weil Marx sich ihrer nicht ganz sicher wußte». Hochhuth, nicht nur in seinen Stücken, sondern auch in nahezu allen hier vorliegenden Streitschriften, argumentiert ad personam; ob offener oder eingeschriebener Brief, Kritik an Herbert Marcuse oder Nekrolog: Personen werden als veränderbar, Zustände als durch sie beeinflußbar begriffen. Hochhuths Satz «Die Philosophen haben Marx bisher nur verschieden interpretiert, es kommt aber darauf an, ihn zu verändern» ist mehr als indirekte – abermalige – Antwort auf Adorno, ist Schlüssel zu seinem Politikverständnis. Georg Lukács, dessen eigenartig ungleichzeitige Rolle zwischen Fortschritt und Reaktion in der deutschen Literatur hier nicht ausführlich erörtert werden kann, hat natürlich ein streng deterministisches Bild von der Rolle des Individuums in der Gesellschaft; jenes Bild, das Robert Havemann, beispielsweise, hervorragend auf seine Rechtfertigungsfunktion hin untersucht hat. Hochhuth, eifervoller Protestant, führt eine als altmodisch inzwischen denunzierte Kategorie ein: Moral. Habermas hat, gegen Gehlens Diffamierung der Humanitas als «Humanitarismus» Bloch zitierend, darauf hingewiesen, daß «die Befriedigung des Hungers, sosehr sie als Bedingung der Freiheit eine moralische Forderung sein kann, nicht selber – wie die Errichtung der Freiheit – eine politisch-moralische Kategorie ist … Biblisch gesprochen: Einst waren die Mühseligen und die Beladenen auch die Erniedrigten und die Beleidigten; aber heute sind die Entlasteten und von Mühsal Freigesetzten nicht eo ipso auch schon die Aufgerichteten und die Versöhnten.»
Die Anmaßung, mit der Moral leichthin als untauglicher Begriff, untaugliches Mittel in der Politik gemaßregelt wird, will untersucht sein. Dem klassischen marxistischen ‹Ideologieverdacht› – daß nämlich im Sinne von Calvins Wort über den menschlichen Geist als einer ständig arbeitenden Götzenfabrik die Menschen im Zustand der Entfremdung ständig Ideologien produzieren, um ihre Tätigkeit zu rechtfertigen – diesem von Marx geprägten wie belasteten Begriff der Ideologie entspricht der neue ‹Moral-Verdacht›: Pragmatiker der Politik, deren Denkvokabular nur von A wie Abgeordnetenkauf über Hammelsprung bis Z wie Zuwahl reicht, hämen ihn als irreal. Das entspricht der politischen Logik, mit der Stalin ‹groß› genannt wird – eine Quantifizierung à la ‹Peter der Große›; daß Stalin nur groß in einem ‹alten› Begriffssinne war, der Geschichte nicht als Prozeß der Emanzipation begreift, sondern Großmächte, Staatsraison, Geopolitik meint, wenn er von Historie spricht, wird da nicht mitgedacht. Die Abwesenheit ‹moralischer› Kategorien – sozialistischer, in diesem Beispielsfall – hat einen Begriff inhaltsloser Realpolitik perpetuiert. Linksaußenkritiker sehen in dem inkriminierten Begriff Moral jene Utopie, gegen die Marx sich angeblich gewandt habe; sie verwenden den Begriff Utopie aber nicht im historischen Bezugsrahmen. Paul Tillich hat das einmal analysiert:
«… es handelt sich um die Ewigkeits-Dimension im Selbstverständnis des Menschen in seiner Welt. Das Fehlen dieser Dimension im Marxismus macht den Marxismus in all seinen Formen utopisch. Wenn ich vom Utopismus der marxistischen Bewegung spreche, so bedarf das einer Rechtfertigung. Denn Marx hat ja das, was er den utopischen Sozialismus nannte, bekämpft und besiegt. Aber was Marx utopisch nannte, ist etwas anderes als das, wovon wir reden. Utopisch ist für ihn der optimistische Glaube an den guten Willen der herrschenden Klassen, die Situation der sozialen Entfremdung zu überwinden. Solchen Glauben verwirft Marx im Einklang mit seiner existentiellen Analyse der menschlichen Natur. Marx’ Ideologienlehre macht solchen ethischen Optimismus unmöglich. Und doch bleibt ein utopisches Element im Marxismus. Es ist der Glaube, daß wir auf eine Periode der Geschichte zugehen, in der die Entfremdung überwunden und der Mensch wieder in sein Wesen gekommen sein wird. Die ‹klassenlose Gesellschaft› ist das Symbol, das dem Glauben der christlichen Sekte an das Tausendjährige Reich entspricht. Wo aber ein solcher utopischer Glaube vorliegt, kommt es notwendig zu einer ins Religiöse reichenden Enttäuschung. Diese ‹metaphysische Enttäuschung› über die utopischen Elemente des Marxismus ist einer der verhängnisvollen Züge unserer Zeit.»
Dieser Begriff der metaphysischen Enttäuschung läßt sich vielfältig ausfüllen, kann als Interpretationshilfe dienen. Es beginnt mit der komplexen Wortbedeutung: Ent-täuschen, also eigentlich Wahrheit erfahren, einer Täuschung nicht mehr aufsitzen, ist groteskerweise ein Negativbegriff. Das Wort in sich ist bereits Postulat eines Menschenkonzepts: Der Mensch kann nicht in der Wahrheit leben. Sprache verrät hier nicht, sondern verschleiert Evidenzen: ähnlich der Verkehrtheit, mit der Arbeitnehmer heißt, wer anderen seine Arbeit gibt (verkauft); und mit der Arbeitgeber sich nennt, wer davon lebt, die Arbeit anderer (für sich in Anspruch) zu nehmen.
Dem ordnen sich zeitliche Abläufe zu – vom schon 1924 aus der KPD ausgeschlossenen Karl Korsch (dessen ‹Marxismus und Philosophie› im selben Jahr wie Lukács’ ‹Geschichte und Klassenbewußtsein› erschien) bis zu Garaudy: Der Versuch, den Marxismus seinem eigenen historischmaterialistischen Entwicklungsgesetz zu unterwerfen und kritisch zu revidieren, wurde immer gleichsam mit Panzern beantwortet. Die dritte mögliche Position, in der metaphysischen Enttäuschung sich einzurichten, ist die der kognitiven Unschuld. Das kann sich «große Verweigerung» nennen oder ‹Easy Rider›; die neue literarische Rechtfertigung derer, die aus der Gesellschaft aussteigen wollen, heißt Hermann Hesse, der als strohbehüteter, nickelbebrillter Regenmacher in allen Campus Poster Shops zwischen Yoko Ono und Che Guevara hängt und dessen Bücher zu Plakaten verkamen: ‹Grooving beneath the wheel?› (‹Wonnig unterm Rad?›). Der Weg nach innen, psychedelisch oder nicht, ist nicht der Ausweg, sondern das Ausbiegen vor Informationen, gar Erkenntnissen.
Wo, wenn nicht im Ernstnehmen seiner Möglichkeit, mehr Information mehr Menschen zugänglich zu machen – Information dabei als kritische Reflexion verstanden –, liegt die Funktion des Intellektuellen heute? Da er eben keine Klasse ist, da er von Klasseninteressen und Klassengegensätzen zwar geprägt, meist aber keiner zugehörig ist, hat er eine Chance wahrzunehmen wie zu verspielen. Wenn das Wort, schließlich in seiner Bedeutung des Differenzierens, ‹Dazwischenlesens› nicht jenseits aller Werte, Sinn haben soll, dann den: in Ordnungen die Unordnung, in Macht die Ohnmacht, in Hierarchien Anarchien zu zeigen, auch hineinzutragen. Thomas Mann, sieben Jahre nach dem, was im bundesdeutschen Rechtfertigungsvokabular ‹Zusammenbruch› heißt, begann seinen Salzburger Vortrag ‹Der Künstler und die Gesellschaft› bezeichnenderweise mit der Feststellung: «Auf seinen vollen Namen gebracht, müßte das Thema lauten: ‹Der Künstler und die Moral›»; was er eine boshafte Feststellung nannte, was er aber auch ergänzte mit der eher militanten These, das Ästhetische, das Moralische, das Politisch-Gesellschaftliche seien eines, etwa bei Goethe. Und mit der skeptischen Distanz zu eigenen Positionen und deren Proklamation fügt er hinzu:
«Unleugbar hat ja das politische Moralisieren eines Künstlers etwas Komisches, und die Propagierung humanitärer Ideale bringt ihn fast unwiderruflich in die Nähe – und nicht nur in die Nähe – der Platitüde.»
Thomas Mann bezieht sich ein in diese leicht doppelt zu deutende Rolle, in die des «Wanderredners der Demokratie» – und übernahm sie doch. Damit aber, in jenem Sinne, in dem auch Hochhuth seine Individuen wieder ‹freisetzt›, entscheidet sich der ‹unpolitische› Autor zahlloser Rundfunkansprachen und militanter Vorträge an amerikanischen Universitäten für eine personale Freiheit; sie hebt sich nicht heraus aus Kritik, und auch nicht aus Verantwortung, spricht sich Mündigkeit nicht ab, sondern zu. Rolf Hochhuths argumentativer Versuch – manifest sogar in den umständlichen Fixativen seiner Personen- wie Regieanweisungen –, der Person die Freiheit, sich zu entscheiden, zurückzugeben, entspricht dieser neu in Anspruch genommenen, aufgegriffenen wie angegriffenen Würde. Der ewige Hinweis auf den Marquis Posa, spricht man von Hochhuth in der Premierennacht – der sollte nun wirklich vom Tisch: als nenne nur einen Namen, decke nicht eben Mechanismen und Kausalitäten auf, wer Lenin sagt, etwa.
Mir scheint es dagegen eine Antiaufklärerkoketterie, ein wort-mokierender Zierat, mit Karl Kraus darauf hinzuweisen, daß Pater Noster ein Lift und Bethlehem die Stadt genannt wird, in der sich Amerikas größte Munitionsfabrik befindet; das benennt allenfalls, erklärt nichts, setzt nichts in Gang. Wem die Fabrik gehört und wer den Lift betreibt und ob es auch anders sein könnte, wird in die Lösungsmöglichkeiten dieses Worträtsels nicht mit eingebaut. Reinhard Baumgart hat in einem Aufsatz «Unmenschlichkeit beschreiben», Adorno fortschreibend, versucht, damit das Unbeschreibliche der Unmenschlichkeit zu belegen, zu beweisen:
«Der verfügbare Tod war über menschliche Entscheidung und folglich auch über menschliche Vorstellung endgültig hinausgewachsen. Hinter der technischen Kriegsmaschine ließen sich Täter nicht mehr fixieren.»
Das klingt plausibel – aber es stimmt nicht. Von den cahiers der französischen Vorrevolutionszeit bis zur simplen ‹Schreibhilfe› für Willy Brandt, von Baldwins ‹The Fire Next Time› oder Fanons ‹Les damnés de la terre› zu Allendes Chile, das natürlich ohne Traum und Utopie des gemordeten Che nicht entstanden wäre: ohne diesen vorausgreifenden Traum der Ratio, ohne die vorformulierende Vernunft der Hoffnung keine Realität. Man darf sich an den berühmten Eingangssatz von Kropotkins Geschichte der Französischen Revolution erinnern:
«Zwei große Strömungen bereiteten die Revolution vor, führten sie herbei und führten sie durch. Die eine Strömung, die ideelle – die Flut neuer Ideen über die politische Erneuerung der Staaten – kam von der Bourgeoisie. Die andere, die des Handelns, kam von den Volksmassen – den Bauern und den städtischen Proletariern, die unverzügliche und durchschlagende Verbesserungen ihrer wirtschaftlichen Lage zu erreichen suchten. Und als diese beiden Strömungen sich in einem gemeinsamen Ziele trafen, als sie sich eine Zeitlang gegenseitigen Beistand leisteten, da war es zur Revolution gekommen.»
In einem sonderbar immateriellen Materialismus, der Phänomene anerkennt, deren Ursachen kaum, die Verursacher überhaupt nicht mehr, negieren Adorno und manche seiner Schüler die ‹Kategorie der Person›; in einem Offenen Brief an Rolf Hochhuth, den die FAZ druckte, hieß es:
«Überall wird personalisiert, um anonyme Zusammenhänge, die dem theoretisch nicht Gewitzigten nicht länger durchschaubar sind und deren Höllenkälte das verängstigte Bewußtsein nicht mehr ertragen kann, lebendigen Menschen zuzurechnen und dadurch etwas von spontaner Erfahrung zu erretten; auch Sie sind nicht anders verfahren. Daß immer noch spontan Handelnde existieren, und ihre Darstellung, durch die ihrem Handeln entscheidender Einfluß bestätigt wird, ist aber zweierlei. Wollte man dagegen das Grauen an den Opfern darstellen, so überhöht es sich, ohne Durchblick auf die Machtverhältnisse, die es bedingen, in unausweichliches Schicksal; irre ich nicht, so hat das Sie zur Stoffwahl Ihrer Stücke gebracht. Aus dem Schreckenszirkel führt nichts hinaus. Es liegen dafür gleichsam experimentelle Proben vor. Menschen guten Willens haben versucht, dem Unheil zu widerstehen, indem sie an Prominente, wirkliche Schlüsselfiguren der Katastrophen oder jenen Nahestehende, Hilfe heischend sich wandten; wenn ich recht sehe, sind diese Versuche gescheitert.»
Adorno irrte tatsächlich. Was die Appellfähigkeit (und damit das Recht zum Appell) betrifft, genügt der Hinweis auf wenige jüngste von vielen möglichen Beispielen, ob Rostropowitschs Brief in Sachen Solschenizyn oder Pablo Casals’ und Pablo Picassos Intervention wegen der Urteile von Burgos. Und ob jener unbekannte Postmeister Drouet, der die Postkutsche mit dem fliehenden Ludwig XVI. in Varenne aufhielt, nicht tatsächlich den Verlauf der Französischen Revolution mit bestimmt hat? Und ob die Ermordung Rosa Luxemburgs, der eigentlichen Begründerin eines demokratischen Sozialismus, nicht für die ganze sozialistische und demokratische Bewegung bis hin zu den Ereignissen in der ČSSR von großer, nur auf diese Person einzuzirkelnder Bedeutung war?
Was wichtiger ist: Auch die ästhetische Position ist nicht haltbar. Die Theorie von der Undurchschaubarkeit von Mechanismen, der Unmöglichkeit, sie ‹anschaulich› zu machen, entspringt eben jener kognitiven Unschuld. Mit dieses Agnostizismus Hilfe wird eher ein Ohnmachtsritual fixiert, das schließlich formale Postulate aufstellt, die schlichtweg nirgendwo begründet werden. Natürlich wissen wir, daß Becketts Menschenstümpfe «realistische Abbilder» sind. Aber: «realistischer als die Abbilder einer Realität, welche diese durch ihre Abbildlichkeit bereits sänftigen»? Wieso? Wo «sänftigt» die Mutter Courage, und inwiefern wäre der ‹Galilei› Beweis, daß Brecht «das politische Drama von dessen Subjekten auf die Objekte verschob»? Das stimmt schlichtweg alles nicht – Adorno, der die Verlagerung vom «traditionellen Pathos der Tragödienform» auf die Episode begründen will mit der Verlagerung des dramatischen Subjekts auf Objekte («Bevölkerung») in Brechts ‹Furcht und Elend des Dritten Reiches›, hatte sicherlich in seiner Bibliothek den schmalen Band ‹24Szenen aus dem Dritten Reich›, der 1945 im Aurora-Verlag in New York erschienen war. Aus dieser Erstveröffentlichung geht nämlich hervor, daß die Texte ursprünglich als Filmskript angelegt waren, also ganz anderen dramaturgischen und szenischen Gesetzen zu folgen hatten.
Brechts größte politische Dramen sind sämtlich, ausnahmslos, ‹Personenstücke›. Die wirrselige Dialektik Subjekt als Objekt macht er gerade an der «großen Person» fest (wie Hochhuth am Papst oder Churchill, dabei ebensowenig den Papst oder Churchill meinend – als Subjekt eher und immer wieder sogar exkulpierend –, sondern den augenfälligen Verantwortungsträger). Kein Zufall, daß in der unmittelbaren Brecht-Nachfolge, nämlich der jüngeren DDR-Dramatik, Zentrum der theoretischen Auseinandersetzung die Debatte um die «große Person» ist, um ihre funktionelle Transparenz, die Fähigkeit, an ihr historische wie ideologische Prozesse durchsichtig machen zu können. Eben gerade der Versuch, nicht mehr nur gesellschaftliche Vorgänge, sondern Personen glaubhaft zu machen, zeigt sich beispielsweise in der Entwicklung von Dramentiteln. Was bei Hacks 1955‹Eröffnung des indischen Zeitalters› hieß, heißt 1964‹Moritz Tasso›; was bei Heiner Müller 1958‹Klettwitzer Bericht› hieß, heißt 1966‹Philoktet›; und was bei Hartmut Lange 1960‹Senftenberger Erzählungen› hieß, heißt 1963‹Marski›. Peter Hacks hat einmal in einem Aufsatz diese neue Tragfähigkeit der Person untersucht:
«Es gelingt wieder, Personen glaubhaft zu machen, deren Individualität so wesentlich und deren Unverwechselbarkeit so reich an Allgemeinem ist, daß der bloße, unkommentierte Name Programm wird. Es gab schon Zeiten, wo das Subjekt in der Gesellschaft sein Recht hatte und die Stücktitel Namen waren. Aus diesen Zeiten, der Antike und der Renaissance, stammt die Liste der Utopien in Menschengestalt, also jener Helden, die durch vollkommene Ausprägung einer Seite des humanen Wesens (einer gesellschiaftlichen Haltung oder eines anthropischen Vermögens), die Idee der Vollkommenheit überhaupt verkörpern. Prometheus ist die Utopie der Revolution, Helena die der Schönheit, Don Juan die der Sinnlichkeit, Faust die des Denkens, Gargantua die des niederen Begehrens. Marski ist natürlich vom Samen Gargantuas. Aber er übt außer der Tätigkeit riesenmäßigen Verdauens auch die Tätigkeit riesenmäßigen Anpflanzens; er verschlingt nicht nur Welt, er erzeugt Welt; dieser Fresser arbeitet.»
Aber es geht hier nicht um dramaturgische Modelle. Daß Jürgen Beckers hör- und sehbare Zitatmontagen, bei allem ennui ihres Autors vor dem gepeinigten Wort ‹Aufklärung›, Welt einbringen so gut wie Handkes nur scheinbar monologische Bewegungsabläufe, ist ebenso einsichtig und unbestreitbar, wie es bestreitbar und uneinsichtig ist, mit Max Frisch Brechts Werk mit der «durchschlagenden Wirkungslosigkeit eines Klassikers» abzutun. Hier, mit der Verweigerung, dem Artisten Wirkung zuzubilligen, wird die eigene Unbehaglichkeit zur Volte gedreht – zurück zum Kulinarischen. Dabei ist es natürlich nicht wahr – um dieselbe Rede Frischs beim Worte zu nehmen –, daß «Guernica, Name einer spanischen Stadt, die als erste bombardiert worden ist, für Picasso begeistert. Was bleibt, ist Kunst.» Die winzigen Verschübe, «Umverteilungen» in Vorstellungen und Verhaltensweisen, langsam wirkend, manchmal – gewiß – verpuffend, rückschlagend, die ‹Urheber› verzehrend – das wird geleugnet unter dem Vorwand, Großes, Wahrnehmbares könne der Intellektuelle nicht erreichen? Heißt das nicht den Code Napoléon zwar als noch heute gültige Rechtsbasis westlicher Demokratien akzeptieren, aber die Enzyklopädisten nicht wahrnehmen? Das ist ein künstliches Auseinanderspleißen von in Wahrheit ineinanderwirkenden Energien: Es erinnert an Sartres töricht-aktivistischen Satz, jedes Buch sei überflüssig, wöge man es an einer einzigen Kinderleiche, und Claude Simons töricht-balancierende Antwort, seit wann man Bücher mit Kinderleichen aufwöge. Natürlich blieb von ‹Guernica› (da es Kunst ist) mehr als ‹nur› Kunst. Es blieb Autorität; nicht eine, die einsetzbar wie ein Handfeuerlöscher im politischen Alarmfall ist, aber die – ableitbare, zielsetzende – des Intellektuellen als citoyen. Nicht als Instanz – nicht, ganz gewißlich nicht, als ‹Gewissen der Nation›. Aber ein Seismograph – ein Laut-Sprecher, ein Mundwerksbursche, von mir aus – muß auch Inhalte anzeigen können; nicht nur Strukturen nachzeichnen, auch vorzeichnen.
Man sagt, ein Mensch, der nicht träumt, wird verrückt. Eine Gesellschaft, der nicht vorangeträumt wird, wird wahnsinnig. Wer aber die Person auslöschen will als Kategorie – auch als Artisten –, verbannt Wahrheit und Erkenntnis, verbannt schließlich den Traum, die Gerechtigkeit. Als sei Josef K. keine Person – und als habe jene Konferenz vom 27. und 28. Mai 1963 in Liblice gleichsam ohne Kafka stattgefunden. Ein exemplarischer Fall für jenes Gewirr aus Traum, Illusion, konkreter Utopie und Rückschlag. Denn es ist ja nicht nur der Prager Frühling so geendet wie die Aufbruchsbewegungen in allen Staaten des sozialistischen ‹Lagers› bisher (die ausnahmslos, ob der 17. Juni 1953, Polen oder Ungarn 1956, ihren Ausgangspunkt in ‹intellektuellen Bewegungen› hatten) – es gibt inzwischen auch einen nicht-verhafteten Robert Havemann, einen nicht-deportierten Solschenizyn, und Rostropowitsch gab nach diesem Brief mit David Oistrach und Swjatoslaw Richter, die den gemeinsamen Auftritt in Moskau erzwangen, ein Konzert. Mehr als Gesten – das sind Inhalte. Gerade sie bzw. die Möglichkeit, sie zu erkennen, kennbar zu machen, leugnet das Konzept vom «endgültigen Versagen der alten Kategorie der Person». Der entsprechende Absatz in Reinhard Baumgarts Artikel beginnt bezeichnenderweise:
«Es scheint also, daß nicht die Inhalte unserer politischen Vergangenheit, dieser oder jener Akt des Terrors, sondern daß seine Methode und sein System Gegenstände jeder Nacherzählung sein sollten. Die Inhalte liegen ja als Herausforderungen für jede Phantasie in unübersehbaren Dokumentationen bereit.»
Der Autor ersetzt durch Tonabnehmer und Xerox-Apparat: eine seltsame Faktengläubigkeit, eine nur Systeme und Methoden aufspürende impassibilité. In der Literatur: Kluge allenfalls, und Borowski. Baumgart selber gibt eine Seite später zu, daß diese Literatur den bloßen Dokumenten schon wieder überlegen sei. Und Bobrowskis ‹Mäusefest›, Jurek Beckers ‹Jakob der Lügner›, Jakov Linds ‹Selbstporträt› – um nur wenige von vielen möglichen Gegenbeispielen zu nennen, die alle das ‹alte Modell› einer personenträchtigen, Haltungen und nicht Methoden nachziehenden Literatur benutzen? Das alles stimmt nicht in der Kunsttheorie, es stimmt nicht in der Kunstpraxis. Diese Konstruktion eines literarischen Konsensus erinnert an die eines gesellschaftlichen Konsensus, wie ihn Daniel Bells Essay über das ‹Ende der Ideologie› vortrug und der die «Verwandlung von Ideen in gesellschaftliche Hebel» leugnete (für die westlichen, eben im pluralistischen Konsensus der Wohlfahrtsstaaten abgefundenen Gesellschaften). Der impassibilité als verbindlichem artistischem Kodex entspricht dieser gesellschaftliche Konsensus; kurz: Tropismen.
Genau dieses Problem hat Sartre neuerdings erörtert, sich damit der Grundfrage aussetzend: An welchem Punkt hält man selber, nach Dutschke und Cohn-Bendit, nach Berlin, San Francisco, Tokio und Paris? Kann man, ohne Überanstrengung der Subjektivität, überhaupt noch zu einem Selbstverständnis kommen über die eigene Rolle, seine Pflichten und Rechte? Die habgieriger, brutaler, ekelhafter werdende Welt der westlichen Selbstmordgesellschaften, regiert von Buchhaltern, die sich für das entgangene Stalingrad oder Tobruk noch immer zu rächen wissen – die Ohnmacht von Sprache und Gebärde, darauf noch zu reagieren; die Ohnmacht des eigenen Gewissens auch: Wie leben wir eigentlich, verbal jenen Konsensus denunzierend, aber Steuervorteile ausnutzend, Häuser bauend, Aktien kaufend? Wo liegt, wenn man nun ‹die Person›, ‹das Individuum› als mögliche Wachheit, als reizbaren Indikator des gesellschaftlichen Mißstands (ein singulare tantum) begreift – wo liegt nun unsere Konsequenz? Darf – nur mal angenommen – Rudolf Augstein Mietshäuser besitzen? Darf – nur mal angenommen – Rolf Hochhuth Aktien haben, Dow Chemical zum Beispiel? Darf – nur mal angenommen – Fritz Raddatz nach Portugal oder Griechenland oder Spanien fahren? Es ist so reaktionslos selbstverständlich geworden, sich von den Ferien im Algarve zu erzählen und im Winter, während man das ‹Schwarzbuch der Diktatur in Griechenland› liest, Fotos von der Akropolis zu zeigen. Wie etwa soll der Schüler reagieren, der – gesetzt den unwahrscheinlichen Fall – Richtiges über die Länder der Dritten Welt im Unterricht erfuhr oder über Faschismus – und dessen Lehrer nach den Sommerferien Dias aus Angola vorführt? Bekommt da keiner von uns mehr eine Gänsehaut? Aber was nützt der Brief an Mňačko, die Polemik gegen Marcuses «Weg nach innen», die Kenntnis einiger Bücher mehr oder weniger – wenn Erkenntnis und Interesse als permanente Diskrepanz akzeptiert werden? Tun wir was? Wir leben – viele von uns – komfortabel, manche haben Häuser, große Wohnungen – ein vietnamesisches Adoptivkind sah ich noch bei keinem von uns. Wir kennen und zitieren gern Heinrich Manns Satz:
«Lieber gleichgeschaltet als ausgeschaltet, damit kann ein Bankier zur Not durchkommen, ein Schriftsteller nicht. Ihn schließt gerade sein Verzicht auf innere Ehrenhaftigkeit von seinem Beruf aus. Wer das Unehrenhafte einer solchen Lage nicht empfindet, kommt für die Literatur überhaupt nicht in Betracht. Wer es aber empfindet und dennoch hinnimmt, wird persönlich uninteressant und bringt bestimmt nur Unwirksames hervor.»
Ist es altmodisch, nach Konsequenz zu fragen? (Und was ist altmodisch – der korrelierende Begriff heißt: modisch.) Es ist vergleichsweise einfach, das Wort ‹Megatonnen› obszön zu nennen; und nach Madeira ins Luxushotel zu reisen. Ich habe das getan – ‹eigentlich› geht es nicht, aber man tut es (und der Einwand «Man muß ja nicht ins Reids Hotel» ist wohl keiner – der Campingplatz bei Amalfi ist dasselbe). Abends Dinner im Smoking, am Schwarzen Brett in der Halle voller Mimosen ein Zettel «Platin-Lorgnon verloren», am Tage Buffet am Swimming-pool mit etwa 25 verschiedenen Speisen – und hundert Meter daneben führen Familien sich gegenseitig auf den Strich, weil sie hungern, keine Arbeit haben, Analphabeten sind. Ich habe dort gesessen und wollte einen Aufsatz über die Black Panthers schreiben – alles wurde schief, falsch, schlecht. Jede Bewegung läuft schließlich falsch ab, wie in einem falsch eingelegten Film – essen gehen, nicht essen gehen, «zu den ein fachen Fischern gehen», Geld verschenken, kein Geld verschenken, jemandem eine Ausbildung bezahlen – wie kläglich. Abreisen, schließlich, ist so falsch wie hinfahren. Das alles ‹sagt man nicht›, ich weiß, es ist auch taktlos, und privat ist an dieser Welt nichts zu ändern …
Wer spricht da eigentlich? Darf da nicht mal gefragt werden, wenigstens? Die sechzig Millionen D-Mark, die in der letzten Silvesternacht in der Bundesrepublik in den Himmel gejagt wurden, die Brillanten von Liz Taylor, die Jacht von Jackie Onassis – ‹privat ist da nichts zu machen›. Ich weiß es – aber ich weiß auch, wie viele Menschen davon zur Schule gehen oder essen könnten. Hier geht nicht die Rede von Caritas-Sentimentalität; nicht einer Dritten-Welt-Variante von «Dein Päckchen nach drüben» wird das Wort geredet, sondern von jener ganz persönlichen Erfahrung und Konsequenz, die theoretische Einsichten sensibilisiert. Lenin schildert einmal eine solche Szene aus einem Arbeiterhaus, in dem er sich nach dem Juliaufstand 1917 verbarg. Das Brot wird gebracht, und der Familienvater sagt: «Schau dir das ausgezeichnete Brot an. Sie wagen es jetzt wohl nicht, schlechtes Brot zu geben, wir hatten fast vergessen, daß es in Petrograd auch gutes Brot geben kann.» Und Lenin, dem man wohl Einsicht in Strukturen und Strategien wie taktische Pläne zu ihrer Veränderung nicht absprechen kann und der in gerade diesem Arbeiterhaus saß und eine Analyse der Julitage schrieb, sagt zu dieser Szene:
«An das Brot hatte ich, ein Mensch, der nie Not gekannt hatte, nicht gedacht. Das Brot stellte sich für mich irgendwie von selbst ein, etwa wie eine Art Nebenprodukt der schriftstellerischen Arbeit. Zu dem, was allem zugrunde liegt, zum Klassenkampf ums Brot, gelangt das Denken durch die politische Analyse auf einem ungewöhnlich komplizierten und verwickelten Wege.»
Was wäre eigentlich, wenn es tatsächlich eine Grenze für Einkommen gäbe – die bekannten ‹Fachleute› werden lachen mit dem Gestus, mit dem sie Oppenheimer sagten «Mach du die Bombe – die Politik machen wir». Und mit dem der Fachmann Erhard den ‹naiven» Hochhuth einen Pinscher nannte, als er von Klassenkampf sprach. Die Diskrepanz zwischen öffentlicher und privater Moral – wir sollten wenigstens uns einbeziehen, nicht nur aufrufen. Die Frage nach der Verantwortung des Intellektuellen ist, scheint mir, die Frage, wem wir verantwortlich sein wollen, antworten wollen. Die Antwort nicht zu wissen ist Bestandteil dieses Prozesses; es gibt das nacheiferbare Modell nicht, nicht einmal ein funktionierendes sozialistischer Wirtschaft. Es gibt aber eine Art Schamwirkung, die man wohl nur hervorrufen kann, wenn man sich ihr selber unterzieht. Die Abhängigkeiten, Demütigungen, der Würdeverlust, dem Menschen in unserem täglichen Weltablauf ausgesetzt sind; der geheimnisvolle Zwangsmechanismus zwischen Unternehmer und Angestelltem – der nicht auflösbar ist durch ‹Enteignen› –, durch den Menschen verwüstet werden, die Puntilas so sehr wie die Knechte Matti; jene klägliche List und witzelnde Schläue, die winzigen Knechthaftigkeiten unten und die haarfeinen, tiefschneidenden Vulgarismen, Wölfischkeiten oben mit denen, lächelnd oft und bei guten Weinen selten, zerstört, unmenschlich gemacht wird – haben wir uns da hindurchzutaktieren, oder müssen wir nicht herausskandieren den Skandal dieser ‹Überlebenschancen›, die statt Lebenschancen angeboten werden? Eine Episode mag die Verkümmerungen benennen, die hier gemeint sind: Kurz vor meiner Flucht aus Ost-Berlin, der offizielle und halboffizielle politische Auseinandersetzungen vorausgegangen waren, sagte mir ein vorgesetzter Funktionär, mit dem ich seit Jahren befreundet war: «Wenn du abhauen willst, lasse ich dich vorher verhaften.» Und er meinte beides, das dieser Satz enthält: die Warnung und die Drohung. Diesen Satz könnte ich mühelos ins ‹Westdeutsche› übersetzen. Hier läßt man bloß nicht verhaften – Warnung und Drohung bleiben. Diesen Warn- und Drohmechanismus bloßzulegen, die Verwüstungen bei uns selber abzufragen, die er in seinen vielfachen Variationen angerichtet hat – das ist eine der Möglichkeiten, das ist die ‹Freiheit› des Intellektuellen. Noam Chomsky beruft sich in seinem Aufsatz auf eine berühmte Artikelfolge von dem amerikanischen Trotzkisten Dwight Macdonald, die später in seine Essaysammlung ‹Memoirs of a Revolutionist› aufgenommen wurde, und endet mit dessen Fragestellung seine Überlegungen:
«Macdonald erwähnt ein Interview mit dem Zahlmeister eines deutschen Vernichtungslagers, der in Tränen ausbrach, als er erfuhr, daß ihn die Russen hängen lassen würden. ‹Warum nur? Was habe ich getan?› fragte er. Macdonald folgert: ‹Nur wer bereit ist, sich persönlich der Autorität zu widersetzen, nur der hat das Recht, den Zahlmeister des Vernichtungslagers zu verurteilen.› Die Frage ‹Was habe ich getan?› sollten wir in der Tat an uns selber richten, die wir jeden Tag von den jüngsten Grausamkeiten in Vietnam lesen – die wir die Täuschungen ersinnen, aussprechen oder tolerieren, die dazu dienen werden, die nächste Verteidigung der Freiheit zu rechtfertigen.»
Sartre hat die schwierige dialektische Spannung der Fragestellung aufzulösen versucht. In einem großen Interview mit der maoistischen Zeitung L’idiot international unterzog er den Begriff ‹Intellektueller› einer aktuellen Überprüfung. Ist der ‹klassische Intellektuelle›, der gut verdienende Protestierer, der Bildung produzierende und reproduzierende Individualist, der Vietnam-Erklärungen unterschreibt, aber seine Mathematikvorlesungen wie eh und je hält – ist der nicht noch immer im Teufelskreis der Lüge? Gewiß, sein Bewußtsein eines Widerspruchs, der ja nichts anderes ist als der Widerspruch der ganzen Gesellschaft, macht eben den einsichtig. Aber er löst ihn nicht. Er schafft ihn sogar: Sein gutes Gewissen gewinnt er aus seinem schlechten Gewissen. Das Resultat sind ‹Taten› – Bücher. Sich selber, in dieser Intellektuellenexistenz, stellt er nicht in Frage. Ein circulus vitiosus – die Studenten des Mai 1968 in Paris lehnten den Begriff, die Existenz des klassischen Intellektuellen, des Ideenlieferanten, ab. Sie wollten nicht einen partikularistischen, sondern einen universalen Intellektuellen: Taten. Aber eben diese Taten hätten dringend der intellektuellen Überprüfung bedurft, denunzierten sich in ihrer Spontaneität (damit: Erfolglosigkeit) intensiver, als Lenin jemals jegliche Spontaneitätstheorie verdammt hatte; denn das spontane «L’imagination au pouvoir» schaffte, planlose Geste einer politique pure, keine Macht ab. Die Verliebtheit in Pflastersteine blieb Dada-Liebe zu ready-mades.
Sartre sieht den Widerspruch, am deutlichsten in der eigenen Person. Er kann sich nicht selber ‹abschaffen› – er kann, beispielsweise, nicht aufhören, an seinem Flaubert-Buch zu schreiben, an dem er seit fünfzehn Jahren arbeitet, ein mit Sicherheit unpopuläres, un-aktives, wohl auch un-aktivierendes Buch im engeren Sinne des Wortes. «Ich kann dieses Problem nicht lösen», sagt er; denn seine Lösung, ‹nebenbei› bestimmten politischen Unternehmungen Schutz und Autorität seines Namens zu geben, ist keine; vielmehr: ist die des ‹klassischen Intellektuellen». Das Interview selber hätte keinen Sinn, wäre der neue, ‹universalistische› Intellektuelle – also der von den Massen integrierte Mann der Tat – Jean-Paul Sartre da. Die Forderung nach ihm ist gewissermaßen bereits ein Leugnen seiner Existenz, seiner Möglichkeit.
Sartre hat den Begriff Moral nicht benutzt, aber er hat ihn ‹ausgelagert›; seine Frage nach der existentiellen Selbstvernichtung des Intellektuellen, nach Tun und Konsequenz aus eigenen Erkenntnissen, ist die Frage nach der Moral, wohlverstanden. Die Frage ist die Antwort; es gibt sie nicht anders.
Hamburg, Januar 1971
Fritz J. Raddatz
Der Klassenkampf ist nicht zu Ende
1965
«Ich habe als einfacher Arbeiter angefangen. Ich kann heute noch nicht sehen, wenn mein Chauffeur ein anderes Essen hat als ich. Aber was Sie unter Sozialismus verstehen, das ist einfach krasser Marxismus. Sehen Sie, die große Masse der Arbeiter will nichts anderes als Brot und Spiele, die hat kein Verständnis für irgendwelche Ideale, und wir werden nie damit rechnen können, die Arbeiter in erheblichem Maße zu gewinnen … Sehen Sie, der Besitzer einer Fabrik ist doch von der Arbeitskraft und dem Arbeitswillen seiner Arbeiter abhängig, wenn die streiken, dann ist sein sogenannter Besitz völlig wertlos. Außerdem aber, mit welchem Recht verlangen diese Leute Anteil am Besitz oder gar an der Leitung? Der Unternehmer, der die Verantwortung für die Produktion trägt, der schafft auch den Arbeitern Brot. Gerade unseren großen Unternehmern kommt es nicht auf das Zusammenraffen von Geld an, auf Wohlleben usw., sondern denen ist die Verantwortung und Macht das Wichtigste. Sie haben auf Grund ihrer Tüchtigkeit sich an die Spitze gearbeitet, und auf Grund dieser Auslese, die wiederum nur die höhere Rasse beweist, haben sie ein Recht zu führen. Sie sollen nun einen unfähigen Regierungsrat oder einen Betriebsrat, der von nichts eine Ahnung hat, mitreden lassen; das wird sich jeder Wirtschaftsführer verbitten.»
Adolf Hitler im Mai 1930 zu Otto Strasser
«Eigentumsbildung der Niditunternehmer oder … der Haushalte ist nicht möglich auf Kosten des Verbrauchs dieser Kreise, sondern nur zu Lasten der Unternehmergewinne.»
Professor Oswald von Nell-Breuning SJ im Jahre 1958
Selbst in Bonn, der Residenz jenes Staates, dem Kanzler Erhard öffentlich nachsagt, er habe ihn dank seiner sogenannten sozialen Marktwirtschaft von allen Proletariern gesäubert, gibt es am Dransdorfer Weg ein Großfamilien-Ghetto. Hier heißt es «das graue Lager». An den Müllrändern der anderen westdeutschen Städte haben die Baracken andere Namen, etwa «Sanssouci». Wer an ihnen vorüberfährt – aber taktvollerweise sind die Ghettos fast stets weitab von Autostraßen ‹beheimatet›, sind oft so gut getarnt wie früher die Flakstellungen, aus deren Mannschaftsunterkünften sie nicht selten hervorgingen –, wer sie dennoch wahrnimmt, die Baracken, etwa anläßlich einer Treibjagd, der fühlt sich, so er etwas fühlt, zu der Feststellung veranlaßt, Asoziale gebe es halt selbst in Deutschland noch – oder wieder. Wieder. «Denn das muß man ja den Nazis lassen, für Ordnung haben sie gesorgt, nicht wahr. Halbstarke wurden im RAD geschliffen. Und asoziale Elemente – nun, man wünscht sich keine KZs zurück, aber auf Asoziale stieß man jedenfalls nicht, wenn man damals Rebhühner schoß …»
Die Klage des Nimrod, eines Herrn der schweren Industrie, gegenüber seinem Büchsenspanner, dem Grafen Soundso, der dem Konzern den Wald verkaufen und die Jagd dem Habenichts von Kreisarzt aufkündigen mußte, der sie dreißig Jahre lang gepachtet hatte, solange er finanziell noch mitkam, der Doktor – diese Klage des Industriellen darf nicht als Kritik an Bonn verstanden werden, Gott bewahre. Denn Bonn ist nicht nur der Industrie, Bonn ist auch gegenüber dem Weidmann (er muß allerdings identisch sein mit dem Industriellen) viel aufgeschlossener als die Nazis. Die hatten zwar auch ein Herz für das ‹deutsche› Wild, weil ja der Reichsmarschall … Aber Gesetze, wie Bonn sie ratifizierte und die – zum Beispiel – der AEG und Mannesmann gestatten, jährlich siebzig- bis achtzigtausend Mark allein für Wildschaden von der Steuer abzuschreiben, weil ja die Jagd – wer könnte daran zweifeln – nicht zum Privatvergnügen gekauft oder gepachtet wurde, sondern nur um Geschäftsbesuchern etwas bieten zu können, solche Gesetze haben die verdammten Nazis nicht begünstigt. Sie waren eben doch Verbrecher …
Die Hamburger Welt, keine ausgesprochen kommunistische Zeitung, berichtete im Mai 1964 mit vielen ekelerregenden Details über das Bonner Elendsquartier am Dransdorfer Weg. Fast ein Jahr später ging ihr Berichterstatter Albert Müller wieder ins Ghetto. Hatte sich dort etwas geändert?
Oh, die Stadtverwaltung Bonn hatte einhundertfünfzigtausend Mark investiert, um die grauen Baracken gelb zu streichen und um sie winterfest zu machen. Die Wände waren jetzt geflickt und mit Glaswolle isoliert, sogar die Klos waren fast zugänglich: Früher war eines für je sechs kinderreiche Familien da, heute müssen nur mehr vier Familien das gleiche aufsuchen … (Zur Renovierung der Baracken waren die Handwerker erst bereit, als ihnen die ständige Anwesenheit von Spezialisten für Ungeziefervertilgung garantiert worden war.) Aber ein großer Fortschritt war doch erzielt: Dreiundzwanzig Familien mit zusammen fünfzig Kindern hatten das Ghetto verlassen und umsiedeln dürfen. Sie wohnten jetzt, die Arrivierten, in Notunterkünften aus Stein statt aus Holz, und jede Familie hatte einen Kellerplatz.
Freilich, die kinderreichen Eltern (hier dreiundvierzig Familien, einhundertfünfundsiebzig Kinder) müssen weiter in den Baracken bleiben. Immerhin, auch für sie hat es Luft gegeben. Zwar schlafen die Kinder noch immer zwei- und dreistöckig übereinander in den niedrigen Hütten, aber sie müssen nicht mehr zusehen, wie Geschwister gezeugt werden, die Eltern schlafen nicht mehr im gleichen Raum: Auf eine elfköpfige Familie kommen jetzt zwei Räume, 42 Quadratmeter Wohnfläche. Diese Untergebrachten werden noch beneidet von den Menschen im nahe gelegenen «Depot» oder «Belgierlager», wo einige kleinere Baracken einundsiebzig Familien mit dreihundertzehn Kindern ‹fassen› müssen.
Die Welt versichert, in rheinisch-westfälischen Städten – also im reichsten Landstrich nicht nur Deutschlands, sondern Europas, wahrscheinlich der Erde – steige die Zahl der als obdachlos gemeldeten Personen jährlich um 13 Prozent. Wer weiß, was Neubauwohnungen kosten, der glaubt das. In Köln, wo die Stadtverwaltung bekanntermaßen soziales Gewissen hat, gibt es trotzdem jährlich einen absoluten Zuwachs von tausend Obdachlosen. Eine Stadt von der Größe Mannheims wäre in dem Land, dessen Kanzler dank seiner Regierungs-Geschäftigkeit keinen Proletariern mehr begegnet, vollauf mit Obdachlosen der Ghettos zu besetzen.
Ein Zitat aus dem Flugblatt «Fördergemeinschaft Kinder in Not», deren Mitarbeiter am 14. November 1964 aus einer der üppig blühenden westdeutschen Städte berichten – zitiert wiederum nach der Welt:
«Eine Reihe unglaublich überbelegter Baracken steht seit zehn Jahren in einem ausgebaggerten Loch. Hier werden die Familien eingewiesen, dieaus irgendeinem Grunde – ihre Wohnung verloren haben (Ausbombung, Verdrängung durch Behörden, Unglücksfälle, Krankheiten). Alles ist halb verfault, naß, stinkig: die Wände, die Möbel, die Matratzen. Kinder mit fahlen, grauen, alten Gesichtern spielen im Schlamm zwischen Wasserstelle und Abort. Bei Frost kommt nur wenig Wasser durch die Leitung. Waschen und baden ist kaum möglich. Und das bei Familien mit sechs, acht, elf Kindern. Alle Bewohner der Baracken sind nervös, gereizt, niedergeschlagen. Man betäubt sich, so gut man kann. Zum Essen setzen sich die Kinder mit dem Rücken an die Wand auf den Fußboden. Wo sollen sie Schularbeiten machen? Wann können sie einmal ausschlafen? Den Männern graut es davor, nach der Arbeit heimzukommen …
‹Unser Haus war baufällig; man hat uns gesagt, hier seien wir höchstens für drei Wochen … Hier werden alle verrückt, darüber brauchen Sie sich nicht zu wundern … Seit Jahren macht man uns leere Versprechungen, nur damit wir ruhig sind … Müssen unsere Kinder verdorben werden? Man behandelt uns wie Anstaltsinsassen … Wir fühlen uns wie Pestkranke … Wie wir aussehen, trauen wir uns nicht in die Stadt. Schon unsere Kinder werden in der Schule lächerlich gemacht … Wir sind abgeschrieben.›»
Sind diese Abfälle im Brackwasser Babyloniens unerheblich? Zugegeben, daß ‹nur› 2 Prozent der Westdeutschen in solchen Ghettos wohnen. Aber 1932, nach Jahren umfassendster Arbeitslosigkeit, war nur 1 Prozent obdachlos. Ob ein Parlamentarier wie Gerstenmaier, da er doch Christ sogar von Beruf ist und in Bonn Regierungsneubauten plant, auf denen fast eine Milliarde verputzt werden soll, ein solches rheinisches Ghetto schon einmal betreten hat? Kurt Schumachers letztes Wort, unmittelbar vor seinem Tod notiert, war die Feststellung, das Schlimmste, was unserem Volk in der Spaltung Deutschlands zugestoßen sei, hätten nicht die Alliierten ihm angetan. Das Schlimmste sei die parteipolitische Demagogie, im praktischen Leben, hier auf Erden, zu unterscheiden zwischen Christen und Marxisten.
Einige Zahlen: nur acht Konzerne kontrollierten schon 1958 wieder vier Fünftel der westdeutschen Roheisenproduktion, drei Viertel der Stahlproduktion und ein Drittel der Kohleförderung. Bereits damals beherrschten Alfried Krupp und seine Manager wieder vierundneunzigtausend Arbeiter und Angestellte, ohne daß an der Konzernspitze das Mitbestimmungsrecht praktiziert wurde. Die nach seinem Kriegsverbrecherprozeß von Krupp eingegangene Verpflichtung, binnen weniger Jahre seinen Konzern zu entflechten, wurde nicht erfüllt. Der Siemens-Konzern – auch Siemens hatte ein Werk in Auschwitz mit weiblichen Häftlingen – beschäftigte zwölf Jahre nach Kriegsschluß hundertfünfzigtausend Arbeiter und Angestellte und beherrschte weitgehend mit sehr wenigen anderen Giganten wie AEG, Bosch, BBC und Philips den Elektromarkt. Im deutschen Automobilbau wurden 1957 siebzig Prozent – heute sind es viel mehr – der gesamten Produktion von drei Firmen bestritten. Das von Flick kontrollierte Daimler Benz-Werk konnte sich inzwischen die Auto-Union noch einverleiben.
Auf 58 Westdeutsche kam 1959 ein einziger vermögender. Zwar gab es 1953 eine halbe Million Privatpersonen mit einem versteuerbaren Vermögen von 41,4 Milliarden Mark. Innerhalb dieser Gruppe waren es aber wiederum nur 2 Prozent, denen die bedeutenden Vermögen gehören. Heute drehen höchstens noch zweitausendfünfhundert Bundesbürger (und ihre Zahl verringert sich schnell) kraft ihres Besitzes oder ihrer Kommandogewalt über die anonymen Kapitalgesellschaften die Lenkräder der Wirtschaft und damit der Regierung.
Einer der Tricks der Besitzer-Gazetten (die anderen haben keine) besteht in der Behauptung, der SPD-Kanzlerkandidat gefährde die deutsche Wirtschaft, wenn er gegen den Mißbrauch der Macht in Großunternehmen angehe. Man unterstellt, Brandt stemme sich unzeitgemäß und wider alle Gesetze wirtschaftlicher Rationalisierung gegen die Konzernbildung schlechthin. Das tut er nicht. Er weiß sehr genau, daß dem Trend zum Großbetrieb, ob es sich nun um private oder auch gewerkschaftliche und staatliche Unternehmen handelt, nicht auf Kosten der Konkurrenzfähigkeit dieser Werke gegenüber den Mammut-Industrien des Auslands entgegengearbeitet werden darf. Nötig wie Brot aber ist, daß Brandt die Gefahren anvisiert, die sich aus der unkontrollierten Ballung von Werken zu Konzernen erstens für den freien Wettbewerb ergeben und zweitens für die Freiheit des Bürgers selber. Wieweit das Bundeskartellamt als Anwalt wirtschaftlicher Freiheit die Energie oder auch nur den Wunsch hat, sich durchzusetzen, da ja die westdeutschen Anti-Trust-Gesetze bewußt noch wesentlich grobmaschiger geklöppelt sind als selbst die amerikanischen, das bleibe hier unerörtert. Als der Industrie-Anwalt und CDU-Politiker Dufhues, wie der Spiegel berichtet, kürzlich einen durch ‹Knebelvertrag› an einen amerikanischen Öltrust geketteten deutschen Konzern von dieser als «lebensgefährlich» bezeichneten Bindung befreien wollte, da hoffte er, die Amerikaner kraft der Kartellgesetze ihres eigenen Landes zum Verzicht auf ihr Erdrosselungsgeschäft zwingen zu können. Der Chef der Deutschen Bank indessen, Direktor Abs, zerstörte diese Illusion – und sein ‹Erfahrungssatz› wirft Licht in die dschungeldunklen Lobbies des Hochkapitalismus: «Wenn das (US-)Kartellamt den Vertrag auflöst, wird 24 Stunden später Nicherson (der Boss der amerikanischen Firma) bei Präsident Johnson sein. Weitere 24 Stunden später spricht (der USA-Botschafter in Bonn) McGhee bei Erhard vor – und nach nochmals 24 Stunden ist Erhard umgefallen.»
Werden nun die großen Raubfische von den größten nach dieser Manier allmählich gefressen, so ist das nicht tragisch, sondern entspricht dem Gesetz, das sie selber, solange sie konnten, zum Schaden der Schwächeren praktiziert haben. Wer aber schützt den einzelnen Angestellten oder Arbeiter, der sich als Person den Giganten so anonym verkaufen muß, wie die unter sich die Aktien verkaufen? Die gefürchteten Reden Otto Brenners, viele konzipiert von dem Katholiken Dr. Werner Thönnessen, dem heute fünfunddreißigjährigen Sohn eines Industriellen und Präsidenten des Arbeitgeberverbandes des Saarlandes, machen keinen Hehl aus der Erfahrung dieses Gewerkschaftsführers, daß in Deutschland die Demokratie an den Toren der Großbetriebe endet. Daher fordert Brenner die (bezahlte) Verstaatlichung der Schlüsselindustrien, fordert eine Ausdehnung des Mitbestimmungsrechts auf alle Betriebe mit mehr als zwanzigtausend Arbeitnehmern und fordert eine dem Einzelegoismus des Unternehmens übergeordnete Gesamtplanung der Volkswirtschaft zur Verhinderung von Katastrophen wie jene der Jahre 1929 bis 1932. Damit verknüpft ist, wie Brenner hofft, auch die Abwehr der politischen Diktatur.
Vor genau achtzig Jahren schrieb Nietzsche: «Damit der Besitz fürderhin mehr Vertrauen einflöße und moralischer werde, halte man alle Arbeitswege zum kleinen Vermögen offen, aber verhindere die mühelose, die plötzliche Bereicherung; man ziehe alle Zweige …, welche der Anhäufung großer Vermögen günstig sind …, aus den Händen der Privaten und Privatgesellschaften – und betrachte ebenso die Zuvielwie die Nicht-Besitzer als gemeingefährliche Wesen.» Und: «Die Demokratie will möglichst vielen Unabhängigkeit schaffen und verbürgen, Unabhängigkeit der Meinungen, der Lebensart und des Erwerbs. Dazu hat sie nötig, sowohl den Besitzlosen als den eigentlich Reichen das politische Stimmrecht abzusprechen: als den zwei unerlaubten Menschenklassen, an deren Beseitigung sie stetig arbeiten muß, weil diese ihre Aufgabe immer wieder in Frage stellen.»
Nicht weniger unbedingt wurde das von der CDU selbst formuliert in ihrem Programm von Ahlen aus dem Jahre 1947, das sie dann Punkt nach Punkt verraten hat. Heute sagt man dem Besitzlosen nach, er sei nicht mehr gemeingefährlich – und nicht einmal unsere Besitzlosen selber merken, daß dies die schändlichste Beleidigung ist, die man ihnen anhängen kann. Ein Unternehmer würde sich mit Recht verbitten, für harmlos gehalten zu werden, für demütig und fernlenkbar. Daß jene, die, ungehindert von den Übervorteilten, seit Jahren ihre industriellen Hausmächte aufbauen, die narkotisierende Parole versprühen, unsere Gesellschaft sei klassenlos geworden, das hat seine Logik. Daß die Deklassierten es glauben, nur weil sie inzwischen auf Raten einen Kühlschrank kaufen konnten, ist würdelos. Psychologen sagen vom Löwen im Zoo, er sei so zufrieden, sein Futter risikolos zu erhalten, daß er die Unfreiheit gar nicht empfinde. Das mögen Schulkinder glauben. Es heißt aber dem Arbeiter, da der ja noch nicht wieder hinter Gittern sitzt, sondern durchaus beißen könnte, nicht einmal mehr die Würde eines gefangenen Löwen zuzugestehen, sondern ihn nur gutmütig verachten wie einen in Freiheit nutzbaren Esel, wenn man in der momentanen Friedfertigkeit der weitaus meisten schon die Garantie sieht, daß er auf ewig zu träge und stumpf geworden sei, um – wie in Großbritannien – den Klassenkampf auch seinerseits wiederaufzunehmen. Denn die Unternehmer in Deutschland haben ihn niemals abgebrochen; sie haben deshalb mit Recht gesiegt!
Sofort nach dem Krieg zerstörten sie das humane Ahlener Programm der CDU; sie brachten den Roßtäuscher-Trick fertig, Erhards Währungsreform den dadurch total Verarmten unter dem Anschein erträglich zu machen, auch Herr Krupp habe, wie jeder Postbote und Friseur, mit nichts als 40 Mark in der Tasche wieder von vorn beginnen müssen; sie beseitigten 1954 das Gesetz, welches bis dahin die Konzerne verpflichtete, wenigstens an einem Teil der zu ihrer Expansion von der Steuer befreiten Riesen-Investitionssummen die Mitarbeiter zu beteiligen; die Großen konnten ihre Werke wegen der – meist schnell behobenen – Bombenschäden als derart wertlos ‹abschreiben›, daß sie nur geringen Lastenausgleich bezahlen mußten, während der verarmte Althausbesitzer, der zehn Jahre lang die Miete trotz steigender Reparaturkosten nicht erhöhen durfte, diesen Lastenausgleich kaum aufbringen konnte. Die Unternehmer verhinderten nicht nur die Ausweitung des Mitbestimmungsrechts, sondern wiesen das Parlament an, Tricks zu seiner Einschränkung zu legalisieren; und neuerdings ist selbst die sozialdemokratische Landesregierung von Hessen bereit, ihre Verfassung zu brechen, nur um Herrn Flick zwecks Abrundung seines 1946 entflochtenen Konzerns die Hessische Hütten- und Bergwerks-AG in Wetzlar zurückzugeben – das weitaus interessanteste Werk, das damals sozialisiert wurde.
Diese Beispiele ließen sich vermehren. Es genügt eine Zahl: siebzehn Jahre nach Beginn von Erhards vergoldetem Zeitalter besitzen 76 Prozent der Westdeutschen überhaupt kein Vermögen, das der Steuer auch nur gemeldet werden müßte. Das ist folgerichtig. Und die Verarmung ist progressiv, wie eine «Kreislaufanalytische Untersuchung der Vermögensbildung» durch Professor Föhl, kürzlich angestellt im Namen der Bundesregierung, ergeben hat: Da von kleinen bis mittleren Einkommen nichts erspart werden kann, während ein sehr bedeutender Teil der großen Verdienste kontinuierlich zurückgelegt wird, fällt stets die Masse des jeweils neugeschaffenen «Volks»-vermögens wieder jenen zu, die bereits besitzen. Inzwischen klettern – zum Beispiel – Land- und Baupreise so affenschnell, daß selbst Sparer höherer Einkommensklassen ihre Bausparverträge nicht realisieren können; hatten sie sich unter Entbehrungen bemüht, für ein Haus und damit auf krisensicheren Besitz hin zu sparen, so müssen sie jetzt darauf verzichten, das hundert Mark auf hundert Mark gelegte Geld zu verbauen und somit wertbeständig anzulegen. Wieder sinkt die Zahl jener, die früher den ‹Mittelstand› bildeten.
Im Gegensatz zur Weimarer enthält die Bonner Verfassung keinerlei Vorschriften über die Wirtschafts- und Sozialordnung; sie schweigt sich sogar aus über das betriebliche oder überbetriebliche Mitbestimmungsrecht. Zwei Basler Juristen, die Professoren Stratenwerth und Vischer, erörterten kürzlich die Unentbehrlichkeit einer bis heute nicht geschaffenen Wirtschaftsverfassung, zum Schutz der Demokratie. Denn vor ihren weitaus gefährlichsten Gegnern, den Interessenverbänden der Großindustrie und Springers Presse-Trust, steht sie machtlos.
Peter Grubbe schrieb neulich: «… bilden die 88 Prozent der überregionalen deutschen Tages- und Sonntagspresse, die dem Springer-Konzern heute gehören, einen politisch straff ausgerichteten Block von Berlin über Hamburg bis nach Düsseldorf, dessen Blätter einen konsequenten Rechtskurs steuern … Es ist genau das entstanden, was die Engländer (1945) hatten verhindern wollen: ein mächtiger Pressekonzern, wie ihn Hugenberg besaß, der eine rechtsgerichtete, nationalistische Politik vertritt. Nur daß Hugenberg seinerzeit lediglich einen der drei großen Konzerne besaß. Neben ihm standen und gegen ihn kämpften die Häuser Ullstein und Mosse. Springer dagegen hat heute, insbesondere nach Ankauf des Ullstein-Verlages und des Düsseldorfer Mittag, in der Bundesrepublik keinen auch nur annähernd ebenbürtigen Konkurrenten.»
Man überprüfe an diesem Tatbestand die ‹Begründung›, mit der ‹Volks›-kanzler Erhard Lebers Arbeitern die Bildung eines gemeinsamen Sparfonds verweigerte: «Die Bundesregierung lehnt die Konzentration massenhaften Vermögens in der Verfügung weniger … ab.» Mr. Profumo flog schon wegen einer nur galanten Lüge aus Kabinett und Unterhaus. Unser fränkischer Biedermann blieb Regierungschef, obwohl er nicht einmal zugunsten eines schönen Mädchens, sondern auf Kosten der Mehrheit log. Warum schrie das Parlament Erhards folgenschwere Ausrede nicht nieder? Eine Diplomarbeit (Walter Wellner) an der Hochschule für Politische Wissenschaften in München untersuchte den Anteil der Abgeordneten, die als Vertreter nicht der Wähler, sondern der Verbände im Bundestag arbeiten. Ergebnis: die Arbeitnehmer-Organisationen werden durch die CDU/CSU von 26 Abgeordneten, durch die FDP von keinem, in der SPD von 29 Parlamentariern repräsentiert. Hingegen haben die Arbeitgeber- und Bauernverbände in der SPD-Fraktion 3 Repräsentanten, in der FDP 17 und in der CDU/CSU31 Interessensprecher – und weitaus mächtigere. Mit anderen Worten: die wirtschaftlichen Anliegen von nur 17 Prozent der Bevölkerung, von den Arbeitgebern, werden also von 51; die von den übrigen 83 Prozent von nur 55 Abgeordneten wahrgenommen. War nicht, damit verglichen, das Drei-Klassen-Wahlrecht ehrlicher?
Der Marburger Professor Abendroth, für den die SPD momentan keinen Platz hat, weil er Sozialist ist, schrieb: «Wer … in seinem täglichen Leben als Wirtschaftsbürger nicht an der Entscheidung über das ihn betreffende Geschehen beteiligt ist, kann auch in der politischen Entscheidung, an der er im demokratischen Staat beteiligt sein soll, nur frei sein, wenn er ständig um diese Beteiligung in Freiheit bewußt kämpft.»
Daß der Arbeiter heute nicht kämpfen will, das werden ihm seine Kinder schwerlich verzeihen. Scheinbar für immer desertiert in die Unmündigkeit, aus der nur einzelne Verantwortungsbewußte wie Otto Brenner ihn hin und wieder herausreißen, scheint unser deutscher «Unselbständiger», wie er ja offiziell genannt wird, die sarkastische Prophezeiung des alten Stalin zu bestätigen: In Deutschland fänden deshalb keine Revolutionen statt, weil dort verboten sei, den Rasen zu betreten.
Es kann aber durchaus zu einer Schlächterei führen, sollte die Vernunft derer am Drücker wie die der Unterdrückten sich erst dann wieder zu Wort melden, wenn Vollbeschäftigung nicht mehr möglich ist und die Besitzlosen, dann auch noch stellenlos geworden, endlich begreifen, wie sehr man sie seit Kriegsende – zwar nicht betrogen hat, aber übervorteilt. Ist aber die Not erst da, so sind auch die Unternehmer vermutlich nicht mehr frei, wie sie es heute wären, den Millionen von Habenichtsen etwas abzugeben. Dann aber werden die heute so bequem Abzufütternden radikal werden und könnten mit der Demokratie durch Terror auch jene hinwegfegen, die zum zweitenmal in Deutschland für ihre Abschaffung haftbar sind. Wer behauptet – fast jeder behauptet das heute –, der Klassenkampf sei beendet, der könnte auch feststellen, die Geschichte sei beendet.
Wer gut ißt, der gut schläft – wie aber, wenn auch bei uns die Millionen in den Städten, die nicht einmal einen Kartoffelacker ihr eigen nennen, eines Tages nicht mehr satt werden, weil Automation und andere Ursachen, von denen wir heute noch nicht träumen und wissen, zu umfassender Arbeitslosigkeit führen? Wie schnell kann sie kommen. Hätten denn die Amerikaner während der späten Lebensjahre des großen sozialen Millionärs Franklin Roosevelt geahnt, schon so bald ein solches Ausmaß an Armut und Arbeitslosigkeit verkraften zu müssen? Immerhin liegen dort bereits fünf Millionen Arbeitsfähige brach, und mehr als ein Fünftel aller Bewohner dieser reichsten Republik lebt konstant «unterhalb der Armutsgrenze». Es ist aktuelle Schönrednerei, wenn etwa der Franzose Raymond Aron die augenblicklich in den blühenden Ländern des Westens geglückte Dressur des Arbeiters zum handzahmen Haustier in den Produktionsstätten seiner Ausbeuter schon als Dauerzustand verklärt, als ewiges Einverständnis der Übervorteilten mit der gegenwärtigen Gesellschafts- und Vermögensstruktur. Schon ein Blick auf unsere Verfassung wie auf unsere kongruenten Parteiprogramme enthüllt als Illusion die Hoffnung der katholischen Soziallehre wie aller Gewerkschaften, außer der IG Metall: den Traum, kampflos falle dem Arbeiter und Angestellten mit steigenden Löhnen ein Anteil an haltbaren materiellen Werten zu, an Produktionsmitteln und Häusern und Grund. Im Gegenteil: man verführt ihn mit staatlicher Unterstützung raffiniert zum noch abhängiger machenden Konsum, so daß der Spiegel kürzlich berichten konnte: «Nordhoff (Volkswagenwerk), Siemens und die AEG sind an höheren Löhnen – bei den anderen – interessiert.»
Sie wissen, was davon für sie abfällt.
So wird Georg Lebers Unterschrift unter den sinnleer gewordenen Vertrag zur Vermögensbildung der Arbeiter, dieser Namenszug, der vermutlich zum erneuten Wahlsieg der zwei Unternehmer-Parteien im Herbst erheblich beitragen wird, später oder bald als verteufeltes Verhängnis beurteilt werden, als das ‹München› der deutschen Arbeiterklasse, während unsere letzten Sozialisten, die heute in Ehren scheitern, Männer wie Wolfgang Abendroth und Otto Brenner als ebenso tragische wie wegweisende Erscheinungen in der Geschichte des Klassenkampfes verzeichnet bleiben. Diese Geschichte ist nicht zu Ende. Läßt auch der melancholisch stimmende Anblick des gegenwärtigen Pantoffel-Proletariers zwischen seinen Sofakissen gegenüber der Fernsehtruhe die Vermutung zu, er sei für immer gezähmt – mit neuer Not wird er erwachen. Dann freilich hat er es schwer, sich sein Recht zu holen – hat es viel schwerer dann, als er es heute hätte, heute, da man ihm nicht mit Entlassung drohen kann, sondern ihn braucht, da man jeden einzelnen von ihnen, jede Hand benötigt zur Aufrechterhaltung der Hochkonjunktur. Jetzt, in diesen Jahren müßte er sich die Mitbestimmung erstreiken und seinen Anteil am Eigentum. Wenn erst weltweite Depressionen Betriebe stillegen, wird er es teuer bezahlen müssen, daß er heute nichts tut als schuften und schlafen. Wie kann er ausgerechnet von seinen Brotherren – auch so ein Wort, guckt ihnen auf die Wörter, nicht auf die Finger, da seht ihr nichts! –, wie kann er von denen ausgerechnet verlangen, sie rückten irgend etwas freiwillig heraus? Wie kommt er überhaupt dazu, der Arbeitnehmer, zu erwarten, daß ihm kampflos zufällt, wofür sein Vater alle Risiken eingehen, streiken, ja hungern und im Gefängnis sitzen mußte? Glaubt er das deshalb, weil die Propagandisten der Arbeitgeber ihm das erzählen?
‹Sozialpartnerschaft›, dies böseste Wort ist eine Schlaftablette, in jedem Betrieb gratis verteilt, die den fleißigen, brauchbaren Habenichts in den Traum vom sozialen Frieden entrücken soll, währenddessen die reichen Asozialen die totale Machtergreifung vollziehen. Nur der Michel, nur der Deutsche samt jenen Professoren der Sozialwissenschaft, die ihm einreden, es gebe in der spätkapitalistischen Massengesellschaft keine sozialen, keine prinzipiellen Spannungen, keine politische Freiheit und Alternativen mehr, ja die Personen selber seien nichts mehr als «Bestandteile der Maschinerie» (Adorno) – nur der Deutsche sieht nicht, daß dieser Traum zum Albtraum wird. Denn er hat nicht erfaßt, daß Burckhardts vielzitierte Erfahrung «nun ist die Macht an sich böse, gleichviel, wer sie ausübt», mindestens so sehr als Warnung vor dem innenpolitischen wie vor dem außenpolitischen Gegner gedacht ist. Erstens erkennt man den ausländischen, den Feind in Waffen, leichter als den nur wirtschaftlichen im eigenen Land, der aber doch, was oft übersehen wird, von einer bestimmten Größenordnung an immer auch ein politischer Gegner ist. Friede mit Nachbarstaaten ist problematisch, Friede im Inneren des Landes ist trügerisch schlechthin, ist immer Täuschung. Denn weil die Mächte im eigenen Land fast stets unblutig und subkutan sich erweitern, ja meist ohne einen offenen Anschlag auf die Verfassung, so expandieren sie unentwegt. Dagegen ist nichts einzuwenden, dieser Kampf ist Demokratie – oder er wäre es, würde er nicht, wie bei uns heute, nur noch von einer Mächtegruppe, von jener der Truste praktiziert, während der Michel, der Arbeiter und Angestellte, von Ausgleich und Partnerschaft träumt, wie ihm geheißen. Abendroth bestätigt: «In England lassen sich Labour und Konservative sowenig auf einen gemeinsamen Nenner bringen wie in Frankreich und Italien Kommunisten, Sozialdemokraten und bürgerliche Mittelparteien, Gaullisten und rechte Christdemokraten. In Skandinavien ist der Gegensatz zwischen den sozialistischen Linksparteien, den sozialdemokratischen Regierungsparteien und den bürgerlichen Rechtsparteien so groß wie vor Jahrzehnten. Es gibt also objektiv durchaus die Möglichkeit, dem konformistischen Trend der spätkapitalistischen Gesellschaft politisch entgegenzuwirken … Die Gefahr eines Verlustes der Freiheit, der wir uns gegenübersehen, ist deshalb kein unabwendbares Schicksal. In der Bundesrepublik sind die Traditionen des Dritten Reiches, die in innenpolitischen Gegensätzen nicht die Garantie der Freiheit des Bürgers und die Vorbedingung der Demokratie sahen, sondern eine verbrecherische Gefährdung des Vertrauens auf den ‹Führer›, und die Bedürfnisse der Propaganda des Kalten Krieges (gegen den Osten) zusammengetroffen … Unsere Parteien bestehen organisatorisch fort, dürfen aber keine politischen Gegensätze mehr ausdrücken. Das Grundgesetz ist ausgehöhlt und eine Situation geschaffen worden, in der es schon bei unbedeutenden Konflikten jederzeit zerstört werden kann.»
Einseitig geführt wie seit Jahren, muß der Klassenkampf die deutsche Demokratie zerstören. Wenn aber endlich auch der Arbeiter und Angestellte ihn wiederaufnähme, wenn er seinen Gegner annähme, statt zu kapitulieren, so würde er damit nicht nur sich selber verteidigen, sondern die Freiheit für alle. Wann endlich wird er sich auf diese seine oberste Pflicht gegenüber der Nation wieder besinnen?
Wie Martin Niemöller der letzte – namhafte – Protestant, so ist Otto Brenner der letzte – machtvolle – Sozialist in der westlichen Hälfte Deutschlands; und hat aus diesem Grund nicht die geringste Chance, von den Sozialdemokraten, sollten sie die Wahl mitgewinnen, in die Regierung berufen zu werden.