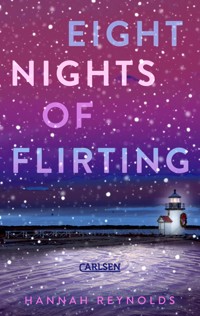
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Flirtnachhilfe auf einer verschneiten Insel: In diesem Winterschmöker knistert es gewaltig! Eigentlich wollte Shira mit ihrer Familie Chanukka auf Nantucket feiern. Und sich bei der Gelegenheit den charmanten Isaak angeln. Obwohl sie noch nicht so genau weiß, wie, denn in Sachen Flirten hat sie null Talent. Doch ein Schneesturm legt den gesamten Flugverkehr lahm und Shira ist die einzige, die es auf die Insel schafft. Nur Tyler ist noch da, ihr Erzfeind von nebenan, den sie aber gnädigerweise aufnimmt, als bei ihm die Heizung ausfällt. Der Deal: Flirtnachhilfe gegen ein warmes Haus. Nach acht Nächten Flirttraining muss Shira allerdings einsehen, dass das Glück manchmal unerwartete Wege nimmt. ***Eight Nights of Flirting –ideal für kuschelige Leseabende am Kamin!***
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Hannah Reynolds: Eight Nights of Flirting
Wie jedes Jahr will Shira mit ihrer Großfamilie Chanukka auf Nantucket feiern. Und sich bei der Gelegenheit den charmanten Isaac angeln, den Junior-Assistenten ihres Onkels. Auch wenn sie noch nicht so genau weiß, wie, denn in Sachen Flirten hat sie null Talent. Doch wegen eines Schneesturms ist Shira zunächst die einzige, die es auf die Insel schafft. Nur Tyler ist noch da, ihr Erzfeind von nebenan, den sie aber gnädig aufnimmt, als bei ihm die Heizung ausfällt. Vielleicht könnte er ja Shira ein bisschen Flirtnachhilfe geben? Gegen ein Praktikum im Unternehmen ihres Onkels? Deal! Und dann reist Isaac an ...
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
Für meine wunderbarenFreundinnen und Freunde,
die mich durch dieses wahnsinnigeletzte Jahr getragen haben.
1.
ALS ICH TYLER NELSON im winzigen Flughafen von Nantucket sah, ignorierte ich ihn, denn Tyler Nelson war das absolut Allerletzte. Ich gab mich gleichgültig, wischte mir ein paar Schneeflocken vom Mantel, die beim Überqueren des Rollfelds auf dem Stoff gelandet waren, und beobachtete Tyler aus dem Augenwinkel. Er brachte sich ganz vorne am Kofferband in Position, also eilte ich ans andere Ende und drehte ihm den Rücken zu. Draußen tobte ein irres weißes Schneegestöber. Der Wind – der uns nervenzerfetzende Turbulenzen beschert hatte – heulte wie ein einsamer Wolf und verwirbelte die Schneeflocken zu grotesken Gestalten.
Mein Handy vibrierte, und ich zog es hervor. »Hi, Mom.«
»Shira?« Nur zwei Silben, aber vollgepackt mit Sorge und schlechten Neuigkeiten. »Wo bist du? Seid ihr schon gelandet?«
»Ich bin am Flughafen. Und ihr – seid ihr im Haus?«
»Wir sind noch in Boston. Unser Flug wurde gecancelt.«
»Was?« Ich war davon ausgegangen, dass sie längst in Golden Doors war, zusammen mit dem Rest der Familie, und das Haus meiner Großeltern mit Gelächter erhellte. Ihre Maschine hatte eine Stunde vor meiner landen sollen. »Habt ihr einen Ersatzflug?«
»Alle Flüge sind gestrichen – der Wind ist zu stark. Wir nehmen morgen die Hy-Line, sofern die Fähren fahren. Kommst du über Nacht allein zurecht?«
Ich hatte mich auf das Wiedersehen mit meiner Familie gefreut – darauf, mich in ihre Wärme zu vergraben. Bei dem Gedanken daran, einen weiteren Tag allein zu verbringen, beschlich mich ein hohles Gefühl im Bauch. Aber Mom das zu verraten und sie aufzuregen war die Sache nicht wert. »Ich werde es überleben.«
»Vergiss nicht, dir etwas zu essen zu holen, ja?«
Ich spähte wieder nach draußen. Bei diesem Sturm hatte ich Glück, wenn ich es heil zum Haus schaffte; an ein Abendessen zum Mitnehmen oder per Lieferdienst war überhaupt nicht zu denken. Aber die Vorratskammer in Golden Doors war sicher reichlich gefüllt. »Mach ich. Wie war Noahs Ehrung?«
»Gut – jede Menge Reden. Noah sah sehr erwachsen aus. Wie liefen deine Prüfungen?«
»Mit Bravour bestanden«, antwortete ich, denn wenn die Tochter sündhaft teure Privatlehrer bezahlt bekommt, ist alles andere keine Option. »Ist bei Grandma und Grandpa alles im Lot?«
»Ach, du kennst sie ja.« Mom seufzte. »Grandpa nörgelt herum, dass das Wetterchaos absehbar war, und Grandma schimpft ihn einen alten Dummkopf. Aber sie macht sich Sorgen wegen der Dekoration – sie hatte damit gerechnet, dass sie heute schon alles aufhängen kann, bevor morgen die Kleinen ankommen, aber jetzt trudeln wir alle gleichzeitig ein …«
Mom mangelte es an jeglichem taktischen Fingerspitzengefühl. »Womit du sagen willst: Ich soll schmücken.«
»Nur wenn du Zeit hast … aber ich meine, du bist immerhin vor Ort …«
Das wärst du normalerweise auch, hätte ich am liebsten gekontert, wenn ihr zu Hause geblieben und von JFK aus geflogen wärt, statt zu Noahs Feier in Boston zu gehen. Aber ich hatte schließlich erklärt, dass das in Ordnung für mich sei, also war es auch in Ordnung. »Klar doch.«
»Okay, wunderbar, Schatz. Wir sollten morgen gegen drei da sein. Und du bist sicher, dass du bis dahin zurechtkommst?«
»Keine Sorge«, sagte ich. »Wir sehen uns morgen!«
Kaum hatten wir aufgelegt, rutschte mir das falsche Lächeln aus dem Gesicht, und ich starrte blicklos hinaus ins Schneegestöber. Allein am ersten Ferienabend.
Das würde ich schon schaffen.
Aber ich fühlte mich so, so einsam.
Nope. Nope, alles war gut. Außerdem hatte ich überhaupt keine Zeit, einsam zu sein. Ich konnte an meinen Plänen für diese Ferien tüfteln. Immerhin hatte ich große Pläne. Pläne, in denen Isaac Lehrer eine entscheidende Rolle spielte.
Wäre mein Leben ein Filmtrailer gewesen, hätte die Stimme aus dem Off es folgendermaßen kommentiert: In diesen Winterferien ist Shira Barbanel fest entschlossen, Isaac Lehrer zu erobern, koste es, was es wolle. Zu sehen wäre dann eine Reihe von Momentaufnahmen: wie wir uns zufällig im Central Park treffen, einander in meiner Küche mit Latkes-Teig bespritzen und vor dem Rockefeller Center Schlittschuh laufen (wobei er mit offenem Mund meinen tadellos gelandeten dreifachen Axel bewundern würde).
Die Off-Stimme könnte noch Anmerkungen hinzufügen wie In Sachen Liebe ist Shira Barbanel ein hoffnungsloser Fall – die allgemeinverträgliche Version von Shira Barbanel ist eine verdammt heiße Braut, allerdings vollkommen kopflos und unfähig, sich einen Kerl zu angeln. Ein Zustand, den ich über die Winterferien ändern würde.
Isaac – dem neunzehnjährigen Praktikanten meines Großonkels – war ich im vergangenen Jahr hin und wieder begegnet, bei Familienfeiern und Firmenveranstaltungen. Er war mindestens eins neunzig groß, schlaksig und verträumt wie Morpheus. Sein Großvater und mein Großonkel waren zusammen auf dem College gewesen, daher hatte mein Großonkel angeboten, Isaac könne die Winterferien in Golden Doors verbringen, als Isaacs Eltern zu einer sechsmonatigen Reise durch Europa und Asien aufgebrochen waren. Und jetzt (in besagten Winterferien) würde ich unseren gelegentlichen Small Talk zur tieferen Verbindung ausbauen.
Schon möglich, dass ich keine allzu gute Bilanz aufzuweisen hatte, wenn es darum ging, Jungs für mich einzunehmen, aber das musste ja nicht so bleiben. Außerdem konnte es einfach nicht jedes Mal so katastrophal laufen wie damals mit Tyler.
Der – grausame Fügung des Schicksals – nun der Einzige war, der noch mit mir am Gepäckband stand. Und während ich ihn weiterhin unverhohlen ignorierte, fühlte ich mich zutiefst gekränkt davon, wie mühelos ihm das Gleiche gelang. Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, plumpsten unsere Gepäckstücke ineinander verkeilt auf das Band. Ich sah demonstrativ in die andere Richtung, als Tyler seine klobige Reisetasche befreite, und wartete dann, bis mein eigener Koffer im Zeitlupentempo bei mir angelangt war, statt hinzugehen und ihn mir zu holen.
Endlich war er da; ich hievte ihn vom Band und zerrte ihn durch die nahezu leere Halle. Nantuckets kleiner Flughafen – kurz ACK – glich eher einem Bahnhof: Der gesamte Komplex hätte mühelos in der Grand Central Station Platz gefunden. Dank einer kaputten Rolle an meinem Koffer war ich dennoch verschwitzt und außer Puste, bis ich die Türen erreichte – und versehentlich Blickkontakt mit Tyler aufnahm.
Er grinste.
Während der Flug meine normalerweise absolut vorzeigbaren Locken ebenso kraus wie speckig hatte werden lassen und ich außerdem einen aufblühenden Pickel am Kinn spürte, sah Tyler aus, als käme er geradewegs von einem Filmcasting. Sein weiches goldenes Haar verlieh ihm die Aura eines Disney-Prinzen, und sogar die Belustigung in seinen blauen Augen tat dem engelsgleichen Look keinen Abbruch. »Hey, Shira.«
»Tyler.« Ich wuchtete meinen Koffer noch einige Meter weiter.
»Brauchst du Hilfe?«
»Nein.«
»Bitte, wie du meinst.« Er wandte sich ab, knöpfte seinen Wollmantel zu und warf sich ein Ende seines Schals über die Schulter. Draußen herrschten beinahe minus zehn Grad – er hätte eine dicke Steppjacke und gefütterte Stiefel tragen sollen, wie ich. Aber Gott bewahre, dass er damit das Risiko einginge, mal nicht wie eine zum Leben erwachte Anzeige für teures Eau de Cologne zu wirken.
Wie auch immer. Mir konnte es gleichgültig sein, ob er erfror oder sich seine schicken Lederschuhe ruinierte. Tyler Nelson belegte Platz eins auf der Liste mit dem glorreichen Titel Shira Barbanels katastrophale Liebesdesaster, und ich wollte nichts mehr mit ihm zu tun haben.
Hier besagte Liste, in willkürlicher Reihenfolge:
1. Jake Alvarez. Ich hatte ihn vergangenes Jahr gefragt, ob er mit mir zum Abschlussball gehen wolle, und er hatte geblinzelt, war rückwärts von mir weggestolpert und hatte dabei stotternd behauptet, er hätte bereits ein Date.
2. Dominic Hoffman aus dem Hebräisch-Camp. Über ihn hatte ich mich erbarmungslos lustig gemacht – als Flirtstrategie. Er war letztlich in Tränen ausgebrochen und verfrüht abgereist.
3. Siddharth Patel aus meinem Fahrschulkurs. Die gesamte Kursdauer lang hatte ich ihn stumm angeschmachtet, bis wir am letzten Tag endlich Handynummern ausgetauscht hatten. Keine Antwort auf meine eine, mutige Nachricht (Hey.)
4. Tyler Nelson. Vier Sommer war ich rettungslos in ihn verliebt gewesen, bis ich den ersten Schritt gewagt und eine absolut vernichtende Abfuhr kassiert hatte.
Isaac dagegen – der gut aussehende, clevere, gebildete Isaac – würde kein weiteres Fallbeispiel meiner Unfähigkeit in Sachen Jungs werden. Er war weitaus reifer als all meine früheren Schwärme, man konnte sich ganz gewiss besser mit ihm unterhalten und müheloser gemeinsam Zeit verbringen. Und diesmal würde ich die Kunst des Flirtens meistern. Oder zumindest der Schritt-für-Schritt-Anleitung folgen, die ich mir ergoogelt hatte und die hoffentlich hielt, was sie versprach. (Schritt drei: Verwickle ihn in ein Gespräch. Womöglich brauchte Google ebenso viel Hilfe beim Flirten wie ich.)
Jedenfalls würde ich mich davor hüten, auch nur einen Funken Energie auf Tyler Nelson zu verschwenden. Ich riss meine Aufmerksamkeit von ihm los, um Uber zu checken, und stöhnte über die horrend angestiegenen Preise. Und –
Kein Auto verfügbar.
Unmöglich. Ich probierte es bei Lyft – mit dem gleichen Ergebnis.
Eine ungute Vorahnung brodelte in meinem Bauch, als ich wieder aus den Fenstern sah. Schnee verhüllte die ganze Welt. Schwer vorstellbar, dass noch vor einem Monat bunte Blätter die Äste der Bäume geschmückt hatten, gelbgrün und orangebraun. Der kühle Hauch in der Luft war gerade ausreichend gewesen, um Stiefel zu rechtfertigen. Heute dagegen hatte ein Schneesturm die Ostküste im gleichen unerbittlichen Tempo überrollt, in dem Elsa Arendelle vereist hatte, und die Welt weiß gefärbt – sogar Nantucket, wo das Meer normalerweise dafür sorgte, dass alles nass und kahl blieb.
Draußen bog ein Auto in die Taxispur, kroch vorsichtig über den schneebestäubten Asphalt. An den automatischen Schiebetüren nahm Tyler seine Tasche in die eine Hand, umfasste mit der anderen fest den Koffergriff und marschierte hinaus in den Schneesturm.
In mir rangen Stolz und Verzweiflung miteinander – und Letztere gewann. Ich hastete ihm hinterher, zerrte meinen Koffer auf der einen intakten Rolle mit. Er schlug gegen mein Bein, und der Schmerz und die Röte, die mir ins Gesicht schoss, wärmten mich gegen die abscheuliche Kälte vor den Türen. Schneeflocken klatschten auf meine Haut und verflüchtigten sich zu eisigen Nadelstichen. »Tyler!«
Er stand am Heck des Taxis und lud gerade seine Tasche in den Kofferraum. »Shira.«
»Können wir uns dein Auto teilen?«
»Lass mich raten.« Sein perfekter Mund verzog sich zu einem Lächeln mit geschlossenen Lippen. »Du kriegst keins. So ein Pech.«
»Komm schon, Tyler. Du wohnst direkt neben mir.«
Der Fahrer schob seinen Kopf aus dem Fenster. »Bist du das, Shira Barbanel?«
»Phil!« Ich strahlte den Mann an, den ich schon seit Jahren kannte. »Wie geht’s dir?«
»Alles gut, alles gut. Wo steckt denn der Rest deiner Familie?«
»Eingeschneit in Boston. Ihr Flug wurde gestrichen.«
»Wirklich?«, fragte Tyler. »Bei meiner Familie genauso. Was haben deine Leute denn in Boston gemacht?«
»Noah hatte da irgend so eine Veranstaltung. Ich musste daheimbleiben, wegen einer Abschlussklausur.«
»Wirf deinen Kram hinten rein«, sagte Phil. »Ich nehme euch alle beide mit.«
Mit triumphierendem Blick in Tylers Richtung hievte ich mein Gepäck in den Kofferraum und rutschte dann auf die Rückbank, da er sich in der Zwischenzeit den Vordersitz gesichert hatte.
Phil fuhr an. »Hattet ihr zwei einen guten Flug?«
»Ein paar Turbulenzen, aber nicht allzu wild«, meinte Tyler. Ich nuschelte meine Zustimmung. Unfassbar, dass er mir im Flugzeug nicht aufgefallen war. Vielleicht war ich nach ihm an Bord gegangen und er hatte ganz hinten gesessen? Oder er hatte erst in letzter Minute geboardet, als ich längst in mein Buch vertieft gewesen war. Oder vielleicht – und dieser Gedanke schoss mir als Hoffnungsfunke durch den Kopf – war ich tatsächlich nicht mehr so auf Tyler fixiert, dass allein seine Gegenwart sofort all meine Antennen zum Schwingen brachte.
Wir rollten die Old South Road hinunter. Auch wenn das Wetter verkehrstechnisch ein Albtraum war, bewunderte ich, wie der Schnee die Gehsteige weiß puderte, als befänden wir uns plötzlich wieder in einer Zeit, zu der Pferdekutschen über unbefestigte Wege rumpelten, Menschen in Samtmänteln mit Pelzmuff durch die Gegend eilten und Schlittengeläut sich mit glockenhellem Gelächter mischte. Der Insel war ohnehin eine etwas schrullige, altertümliche Atmosphäre eigen, und der Winter verstärkte sie nur. Darum war er meine liebste Jahreszeit auf Nantucket: Ich liebte die raue, kalte Schönheit, die schneebedeckten Strände und den klaren Sternenhimmel.
Die Fahrt dauerte nur fünfzehn Minuten, vorbei an mit Zedernholzschindeln gedeckten Inselhäuschen, die schon festlich geschmückt waren: Überall funkelten Lichter und in den Gärten tummelten sich beleuchtete Rentiere. Durch Fenster erkannte man Weihnachtsbäume und Kerzenleuchter, bei denen ich stets die Arme zählte. Dazu kamen Kränze mit Stechpalmenzweigen und Pinienzapfen, und alles schimmerte in Rot und Gold.
Tylers Haus allerdings war dunkel, als wir davor hielten. Der Rasen eine einzige glatte weiße Fläche, darauf die Büsche als Schneehaufen, und das Haus – für gewöhnlich von eleganter Schönheit – ein finsterer Monolith unter dem sich verdunkelnden Himmel.
»Danke«, sagte Tyler zu Phil. Als er ausstieg, rauschte eisige Luft ins Wageninnere und Gänsehaut stellte meine Nackenhaare auf. Tyler warf mir einen Blick zu. »Wir sehen uns, Shir.«
»Shira«, grummelte ich. Die Abkürzung klang für mich nach Schaf oder nach durchscheinenden Tops. Doch er hatte die Tür längst zugeworfen und war mit dem Ausladen seines Gepäcks beschäftigt.
»Wir warten noch, bis er wohlbehalten im Haus ist«, meinte Phil, während Tyler seine Sachen zur Eingangstür schleppte und dann hineinging. Erleichterung überschwemmte mich, als Phil den Rückwärtsgang einlegte. Nun, da Tyler aus dem Weg war, konnte ich mich auf Isaac konzentrieren – auf die Zukunft, nicht die Vergangenheit.
»Wie geht es Aimee?« Phils neunzehnjährige Tochter jobbte im Sommer als Rettungsschwimmerin und hatte gerade ein Studium in Boston begonnen. »Ist sie über Weihnachten zu Hause?«
»Sie ist vor zwei Tagen angekommen. Mit einem Koffer voller Schmutzwäsche.« Phil stieß ein ebenso herzliches wie vertrautes Lachen aus. »Sie liebt die Uni. Nächstes Semester muss sie sich für ein Hauptfach entscheiden, und sie schwankt zwischen Computerwissenschaften und Physik. Ihre Mom und ich sagen ihr immer –« Phil hielt inne, und ich sah im Rückspiegel, wie er die Stirn runzelte. »Huch.«
Ich wandte mich um. Tyler rannte uns hinterher und winkte, um unsere Aufmerksamkeit auf sich zu lenken.
Phil ließ das Fenster hinunter. »Alles klar mit dir?«
Tyler erreichte den Wagen, der Atem kam ihm stoßweise in weißen Wölkchen aus dem Mund. Schneeflocken glitzerten auf seinem goldenen Haar. »Der Strom ist ausgefallen. Die Heizung auch – das Bedienfeld funktioniert nicht.«
Oh nein. Ganz bestimmt wäre es doch unter seiner Würde, jetzt vorzuschlagen …
Er fing meinen Blick auf und lächelte, eher ironisch als charmant. »Also, Shira. Kann ich mich für heute Nacht bei dir einquartieren?«
»Du willst bei mir übernachten. In Golden Doors.« Wieso gehst du nicht in ein Hotel?, hätte ich am liebsten gefragt, wollte aber vor einem Erwachsenen keinen kleinlichen Streit anfangen. Und Tyler hätte es sich zwar leisten können, doch wieso sollte er einen Haufen Kohle für ein Last-Minute-Zimmer berappen, wenn er bei meinen Großeltern umsonst nächtigen konnte? Außerdem hätte Phil Tyler sonst zu einem Hotel kutschieren müssen und wäre noch länger bei diesen Straßenverhältnissen unterwegs gewesen.
Trotzdem …
Nein. Ich konnte ihn nicht abweisen. Unsere Familien bewegten sich in denselben sozialen Kreisen; wir würden Ende der Woche ihre Weihnachtsfeier besuchen, sie ein paar Tage später zu Chanukka bei uns einkehren. »Also schön.«
»Wunderbar.« Er ließ seine strahlend weißen, ebenmäßigen Zähne aufblitzen, und schon war er mitsamt seinem Gepäck zurück im Wagen und klemmte seine langen Beine erneut in den engen Fußraum des Beifahrersitzes. »Das wird ein Spaß.«
Diese Lüge würdigte ich keiner Antwort.
Da das Sommerhausgrundstück von Tylers Moms an das Erbanwesen meiner Familie – die weitläufigen Ländereien von Golden Doors – grenzte, dauerte die Fahrt nur eine knappe Minute. Das Haus ragte über uns auf, als wir in die kreisrunde Einfahrt fuhren, nicht golden, sondern grau: Das ursprüngliche Gebäude aus dem 19. Jahrhundert war, ebenso wie die modernen Anbauten, mit grauen Schindeln gedeckt. In endlosen Fensterreihen spiegelte sich der grauweiße Himmel. Jemand hatte Schnee geräumt und die Stufen zur Veranda gekehrt, doch eine dünne Schneedecke legte sich bereits wieder darüber.
»Vielen, vielen Dank«, wandte ich mich an Phil, und Tyler pflichtete mir bei. Im nächsten Moment kämpften wir uns durch die Schneewehen und hatten dabei Mühe, auf den Beinen zu bleiben. Auf der Veranda, wo nur ein dünner weißer Film die Bohlen bedeckte, klopften wir uns so gut wie möglich ab.
Ich schloss auf, betrat vor Tyler das dunkle Foyer und legte mit enger Brust den Lichtschalter um – was, wenn auch hier der Strom ausgefallen war? Doch der Kronleuchter flammte auf und das Bedienfeld der Klimaanlage erwachte mit dem vertrauten Surren zum Leben, das vom Anspringen der Heizung kündete. Ich trat wieder hinaus auf die Veranda und reckte in Phils Richtung beide Daumen in die Höhe. Er hupte gutmütig und brauste davon.
Somit blieben Tyler Nelson und ich allein zurück.
Wir starrten einander an. Nie zuvor hatte ich jemanden mit auch nur annähernd so perfekten Gesichtszügen getroffen – mit derart blauen Augen und goldblondem Haar. Dieser Junge könnte morden, betrügen oder Herzen brechen, und die Leute würden bloß darüber glucksen und sagen: »So ein Schlingel!«
»Tja, Shira«, meinte Tyler gedehnt, und verdammt, sogar seine Stimme war wunderschön. »Möge der Spaß beginnen.«
2.
FOLGENDES IST PASSIERT, als Tyler und ich uns zum ersten Mal begegnet sind:
Vor fünfeinhalb Jahren, als alberne Elfjährige, erwischte es mich. Ich war noch nie zuvor verknallt gewesen, obwohl ich mitbekommen hatte, wie meine Klassenkameradinnen über Themen wie Küssen gekichert hatten und ganz fasziniert waren von der Aussicht auf die unabwendbar bevorstehenden Wirren der Pubertät. Rein theoretisch verstand ich das, aber ich konnte es nicht nachfühlen.
Bis Tyler Nelson auf Nantucket auftauchte.
Mein Gott – als ich ihn das erste Mal sah. Wie ein Wunder erschien er mir, ebenbürtig mit der Teilung des Meeres, dem Stillstand von Sonne und Mond und Lampenöl, das für acht Nächte reicht. Die Welt drehte sich langsamer, damit jede einzelne Sekunde sich unauslöschlich in meine Seele prägen konnte. Olivia Phan – meine beste Sommerfreundin in diesem Jahr – und ich saßen draußen vor der Juice Bar und aßen Eis. Die Hortensien standen in voller Blüte und die Luft duftete süß und blumig.
Ein Lachen von jemandem in der Schlange erregte meine Aufmerksamkeit.
Normalerweise registrierte ich nur, wenn Leute peinlich laut lachten, wie mein Onkel Jason im Kino. Dieses Lachen allerdings glich eher Musik als irgendetwas sonst. Ich konnte ebenso wenig dem Drang widerstehen, nach seinem Ursprung zu suchen, wie ich Nein zu Regenbogenstreuseln hätte sagen können.
Er stand zusammen mit drei anderen, die in seiner Gegenwart nur noch als Hintergrundrauschen wahrzunehmen waren. Der lachende Junge leuchtete, nicht etwa angestrahlt von Licht, sondern Quelle des Lichts, eine Miniatursonne, glanzvoll und blendend. »Er ist wunderschön«, hauchte ich.
Neben mir rümpfte Olivia die Nase. Sie war elf, genau wie ich, jedoch einerseits schon wesentlich interessierter, andererseits aber auch deutlich argwöhnischer, was Liebesdinge betraf. »Er sieht irgendwie ziemlich nichtssagend aus, oder? Wie ein Disney-Star.«
»Aber du musstest nicht mal nachfragen, wen ich meine.«
»Na ja, nach allgemeinem Maßstab ist er offensichtlich der Attraktivste.«
»Ja«, stimmte ich ihr zu. »Er ist umwerfend.« In Gedanken beschwor ich den Jungen, meinen Blick aufzufangen, obwohl ich keinen blassen Schimmer hatte, was ich tun würde, sollte er tatsächlich herüberschauen. Doch er und seine Freunde nahmen lediglich ihre Eiswaffeln entgegen und schlenderten davon.
»Er muss einfach den ganzen Sommer lang hier sein.« Eine bisher ungekannte Verzweiflung schnürte mir die Brust zusammen. »Wenn er Tagestourist ist, dann sterbe ich.«
Olivia biss krachend die Spitze ihrer Waffel ab. »Dass du stirbst, ist eher unwahrscheinlich.«
Es stellte sich heraus, dass Tyler wirklich bis zum Ende der Ferien bleiben sollte: Seine Moms hatten das alte Anwesen der Johnsons gekauft, westlich von Golden Doors. Was bedeutete, dass ich ihn in diesem Sommer sah und auch im nächsten, und jedes Jahr flammte meine Schwärmerei wieder auf wie eine Trickkerze. Ich verging fast vor bittersüßer Sehnsucht, während ich ihn beim Flirten mit anderen Sommermädchen oder Töchtern von Tagestouristen oder Mädchen von der Insel beobachtete. Er gehörte zum selben Freundeskreis wie Olivias Schwester und mein Cousin Noah, daher verbrachten wir die Sommer damit, uns an ihre Fersen zu heften, dackelten den älteren Kids zum Strand hinterher oder quetschten uns in der Eisdiele an einen Tisch ganz in ihrer Nähe. Ich kannte keine Scham, verfolgte Tyler mit der Finesse einer Sechsjährigen, die glaubt, ihre Eltern würden sie beim Lügen nicht durchschauen. Ich himmelte ihn an, wie also könnte er diese Gefühle nicht erwidern?
Nach dreieinhalb Sommern, in denen ich verrückt nach ihm gewesen war, dachte ich mir – jetzt. Ich war vierzehn und mehr als bereit für meinen ersten Kuss. Beinahe jede Nacht träumte ich mit offenen Augen von Tyler. Mitte Juli sammelte ich schließlich all meinen Mut und die schönsten Muscheln, glattesten Steine und Meerglasscherben. Eines Samstags stand ich früh auf und legte sie am Strand zu halbmetergroßen Buchstaben. Tyler, date mich!
(Ursprünglich hatte ich geplant, Tyler Nelson, willst du mit mir auf ein Date gehen? zu schreiben, realisierte jedoch schnell, dass das viel zu viel Aufwand war.)
Olivia bewachte die Worte, während ich mich auf die Suche nach Tyler machte und ihn beim Volleyballspielen mit einem Haufen älterer Kids fand. Alle sahen erschreckend erwachsen aus; ihre Haut glänzte vor Schweiß und Sonnencreme, die Jungs hatten breite Schultern, die Mädchen wirkten selbstbewusst in ihren Bikinis und Retro-Badeanzügen. Keine Zahnspangen oder Aknelandschaften weit und breit. Als das Spiel zu Ende war, stakste ich zu ihnen hinüber, nervös und panisch – und fühlte mich zugleich unglaublich mutig. Tyler wandte sich von seinen Freunden ab, um seine Wasserflasche zu holen, und ich rückte ihm auf die Pelle.
Er bemerkte mich, wie ich abwartend neben ihm stand. Kurz blitzte etwas in seinem Gesicht auf – (Verärgerung?, fragte ich mich später. Ungeduld?) –, doch dann lächelte er. Er war schon immer, ohne Ausnahme, nett zu den jüngeren Kids gewesen. »Hi, Shira.«
Ich versuchte, etwas zu sagen, aber kein Wort kam mir über die Lippen.
»Suchst du deinen Cousin?«
Ich schüttelte den Kopf.
Er wartete eine Sekunde ab. »Ähm … kann ich dir sonst irgendwie helfen?«
Ich nickte.
Ein halbes Lächeln zuckte um seine Mundwinkel, diesmal aufrichtiger. »Dann musst du mir eventuell verraten, wie.«
Ich holte mehrmals hastig Luft und versuchte, meine noch immer zugeschnürte Brust zu weiten. Entweder würde ich gleich vom Boden abheben, beflügelt von der Unwirklichkeit des Augenblicks – oder unter seinem immensen Gewicht in eintausend Stücke zerspringen. Endlich platzte ich heraus: »Kann ich dir etwas zeigen?«
»Klar.«
Rasch drehte ich mich um und marschierte zurück in Richtung Buchstaben.
»Shira!« Ein gequälter Ausdruck huschte über sein perfektes Gesicht, als ich einen Blick über die Schulter warf, und er strich sich das Haar zurück – das, falls überhaupt möglich, nach einem Monat permanenter Sonnenbestrahlung sogar noch goldener war als zuvor. »Wir müssen dafür irgendwo hingehen?«
»Nicht weit! Es ist supernah.«
Er spähte noch einmal zu seinen Freunden – unter denen heute, Gott sei Dank, nicht Noah war. Ein paar von ihnen beobachteten uns mit breitem Grinsen. »Viel Spaß, Nelson!«, rief einer der Jungen, und Tyler zeigte ihm – mit verdeckter Hand, offenbar in dem Glauben, ich bekäme es so nicht mit – den Mittelfinger.
Dann wandte er sich wieder zu mir um. »Wenn es schnell geht.«
Ich nickte mehrfach, mit wummerndem Herzen. Das hier geschah wirklich. Ich hatte mein Schicksal selbst in die Hand genommen – die Entscheidung getroffen, alles offenzulegen. Ich fühlte mich mächtig und schrecklich.
Ich hastete weiter, einen guten Meter vor Tyler, den Strand hinunter und an Olivia vorbei. Sie salutierte in meine Richtung und spazierte davon, damit wir ein wenig Privatsphäre hatten. Ich glaubte, Tyler seufzen zu hören. Es konnte allerdings auch der Wind gewesen sein.
Wir erreichten die Worte aus Steinen und Muscheln.
Ich wandte mich um. Hier war er: der Moment, auf den ich jahrelang gewartet hatte. Zehntausend Möglichkeiten, wie er verlaufen konnte, hatte ich mir zusammenfantasiert – dieser Augenblick, der den Rest meines Lebens einläuten würde. Tyler und ich würden ein Paar werden. Das Bild grub sich in mich ein, und ich wusste, es würde zu einer perfekten, goldenen Erinnerung werden – der Geruch des Meeres, die heiseren Schreie der Möwen und das Tosen der anbrandenden Wellen, die Sonne auf meiner Haut. Meine Lippen öffneten sich zu einem breiten Grinsen.
Doch anstatt mein Strahlen zu erwidern, starrte Tyler mit einem Ausdruck auf die Worte, der Entsetzen gleichkam. Dann brachte er ein sehr bemüht wirkendes Lächeln zustande. »Aah, Shir – nein.«
Mein Magen sackte mir in die Kniekehlen. Ich versuchte, etwas zu sagen, schaffte es jedoch nicht. Wie konnte er Nein sagen? Ich empfand so viel für ihn. Unmöglich, dass derart starke Gefühle einseitig sein konnten.
Er kratzte sich im Nacken, rang sich noch ein Lächeln ab und schlenderte dann davon.
Bitte was?
Das durfte nicht alles gewesen sein. Ich konnte die Situation retten – mich, ihn, uns retten. Meine Hände ballten sich zu Fäusten, und ich schrie ihm die Worte hinterher, magische Worte, einen Zauberspruch, der unsere Zukunft begründen sollte: »Ich liebe dich!«
Er blieb stehen. Dann schaute er über die Schulter zu mir zurück. Und lachte.
Dieses Lachen hatte ich schon einhundertmal gehört. Und so lieb gewonnen – schließlich war es das Erste gewesen, was mich damals auf ihn aufmerksam gemacht hatte. Diesmal allerdings durchschnitt es mich, als hätte er mich mit einer Glasscherbe angegriffen. »Du liebst mich nicht.«
»Doch. Ich liebe dich – ich liebe dich mehr, als Julia Romeo geliebt hat.«
»Gott im Himmel, das will ich nicht hoffen. Schau mal, du kennst mich doch gar nicht.«
»Sehr wohl!«, entgegnete ich, schrill und panisch.
»Shira, du bist viel zu jung.« Er stand zu weit entfernt, als dass ich das Blau seiner Augen hätte erkennen können, doch sein gereizter Tonfall war nicht zu überhören. »Was willst du – dass wir Händchen halten und uns Küsschen auf die Wange geben? Ich bitte dich, Shira. Komm mal auf den Boden.«
»Ich – nein. Ich will – alles, was du willst!«
Er lachte wieder. »Das bezweifle ich. Und das wird auch dir bald klar werden, deshalb beende ich das Ganze jetzt.«
Und diesmal ließ er mich tatsächlich stehen.
Und ging einfach … davon.
Ich sank im Sand in die Hocke, völlig schockiert. Was war gerade passiert? Ich hatte gedacht, wir würden zusammenkommen. Wir hätten das perfekte Paar abgegeben. Ich war vierzehn und er war sechzehn, und wir hätten uns ineinander verliebt.
Abgrundtief gedemütigt mied ich Tyler den gesamten restlichen Sommer lang. Ich versuchte, all die anderen Mädchen, mit denen er flirtete und die er küsste, auszublenden. Ein heißes, enges Gefühl schnürte mir den Brustkorb ein, wann immer ich ihn sah. Er dagegen wirkte vollkommen unberührt von der ganzen Angelegenheit. Und interessiert an jedem Mädchen – außer an mir.
Bis zum folgenden Sommer hatte sich mein Schmerz in Stolz gewandelt, was mich wieder aufrecht gehen ließ.
Wir trafen nur einmal direkt aufeinander, gegen Ferienende, bei einer chaotischen Party von Olivias älterer Schwester. Ich hatte mich kurz in eines der Gästezimmer zurückziehen wollen, um durchzuatmen. Stattdessen –
»Oh mein Gott.« Ich versuchte, die verschiedenen Gliedmaßen zuzuordnen. Sobald es mir gelungen war, schoss mir feurige Röte in die Wangen. Der Rücken eines Kerls, nackt, mit hervortretenden Muskeln. Ein Mädchen, an ihn gepresst, die Arme um seinen Nacken geschlungen. Das Mädchen erkannte ich: die Beinahe-Ex-Freundin meines Cousins.
Der Junge wandte den Kopf, und es war Tyler – natürlich war es Tyler. Tyler, in den ich unsterblich, unschuldig verliebt gewesen war. Tyler, der mit jedem Mädchen anbandelte – außer mit mir. Er sah sexy aus, makellos, mit glänzender Haut und zerzaustem Haar. »Das hätte ich mir ja denken können.«
Ich gab ein abfälliges Schnauben von mir, wich rückwärts aus dem Zimmer und knallte die Tür zu.
Und damit war mein Verlangen nach Tyler Nelson endgültig erstickt. Ich besaß zu viel Stolz, um mich nach jemandem zu verzehren, der mich nicht mochte, der mir ins Gesicht gelacht hatte, als ich ihm meine Liebe gestanden hatte, der die Freundin meines Cousins flachlegte, ausgerechnet. Schon möglich, dass er oberflächlich gut aussah, aber sobald man an dieser Oberfläche kratzte, kam darunter Pyrit zum Vorschein – Narrengold.
Und eine solche Närrin war ich nicht.
Im darauffolgenden Sommer – dem diesjährigen – war ich endlich gänzlich frei von meiner zwanghaften Schwärmerei gewesen. Tyler Nelson war kein Märchenprinz, sondern lediglich ein Kerl, der meine Zeit nicht wert war. Und deshalb würde ich ihm auch nie wieder Zeit und Aufmerksamkeit schenken.
3.
DOCH NUN WÜRDEN Tyler Nelson und ich eine Nacht lang allein miteinander sein.
Wir standen uns gegenüber, ich im Türrahmen, er eine Stufe unter mir auf der Verandatreppe. Glitzernder Schnee wirbelte um seine Füße. Unter seiner Mütze flatterten ein paar Haarsträhnen hervor, und seine Wangen waren von der Kälte gerötet. Waren seine Augen schon immer so strahlend? Dass es fast unangenehm war, wenn man direkt hineinblickte? »Komm rein.«
»Danke.« Er wuchtete seine Taschen über die Schwelle und brachte einen Schwall Schnee gleich mit ins Foyer. Sein Blick wanderte über die cremeweißen Wände, die gewienerten Holzböden, die gewundene Treppe, die in den ersten Stock hinaufführte. Der Tür gegenüber hing ein Gemälde, das das Meer zeigte – ein Werk meines Großvaters. Auf dem Tisch darunter stand getrockneter Lavendel in einer Vase.
Ohne Tyler weiter zu beachten, setzte ich mich auf die Bank im Eingangsbereich und schnürte meine Stiefel auf. Wann war ich zuletzt allein mit irgendwem gewesen – außer mit Olivia oder jemandem aus meiner Familie? Enge Freundinnen oder Freunde hatte ich nicht; meine Kindheit hatte ich hauptsächlich mit Klavierspielen und Eiskunstlaufen verbracht, und ich hegte die vage Vermutung, dass alle anderen ihre unzertrennlichen Freundschaften geknüpft hatten, während ich beim Training oder Musikunterricht gewesen war. Klar, ich wurde zu Partys eingeladen und war beliebte Tischnachbarin in der Mensa, aber das hing eher mit der Bekanntheit meiner Familie zusammen. Oder damit, dass die Leute mich für besonders cool und unnahbar hielten – zumindest hatte ich einmal zufällig auf dem Schulklo mitbekommen, wie ein Mädel so etwas gesagt hatte. Auch wenn ich in Wirklichkeit schlicht aus hilfloser Befangenheit schwieg.
Und hier saß ich nun also mit Tyler, der eine Million Freunde hatte und der Mittelpunkt jeder Party war. Er war warmherzig und freundlich und beliebt, und ich war kalt und kratzbürstig und verschlossen. Ich hatte keinen blassen Schimmer, wie ich mich allein mit ihm verhalten sollte.
Ich zerrte mir die Stiefel von den Füßen und sprang wieder auf; meinen Mantel behielt ich an, da die Heizung die Kälte noch nicht niedergerungen hatte. Tyler tat es mir nach, warf allerdings seine Mütze auf seinen Koffer. Feine, elektrisch aufgeladene Haarsträhnen flogen in alle Richtungen. »Hast du ein Handtuch, mit dem ich meine Schuhe abtrocknen kann?«
Ich spähte hinunter auf besagte Schuhe, die – zu ihrer Verteidigung – immens teuer wirkten. »Vielleicht hättest du keine Vierhundert-Dollar-Treter im Schneesturm tragen sollen.«
»Sechshundert.«
Ich verdrehte die Augen und schleuderte ein Geschirrtuch aus dem Garderobenschrank in seine Richtung. »Da.«
Behutsam – beinahe liebevoll – polierte er die Feuchtigkeit von seinen Schuhen und blickte dann zu mir hoch, mit einem Lächeln, gegen das ich mich erst wappnen musste. Dieser Junge besaß einfach zu viel Charme. »Also, wie lautet der Plan?«
»Es gibt keinen Plan.« Ich kratzte die Schneekruste von meinen Jeans. Nasse, dunkle Flecken sprenkelten den Stoff. »Wir könnten Tee kochen. Um uns aufzuwärmen.«
»Cool.«
Er folgte mir weiter ins Haus, wo uns die Stille von allen Seiten umfing. Das alte Herrenhaus – über die Jahrhunderte immer wieder erweitert – schien sich endlos auszudehnen. Es war seltsam, hier in Golden Doors zu sein, ohne Cousins und Cousinen, die umherwuselten, ohne Eltern und Tanten und Onkel und Grandpa und Grandma als ruhendem Pol des Ganzen. In New York war ich es gewohnt, allein zu sein, aber hier war ich nie ganz für mich gewesen. Tylers Gesellschaft erleichterte mich darum ein winziges bisschen. Besser gesagt: nicht unbedingt Tylers Gesellschaft. Aber ich war froh, jemanden bei mir zu haben.
Sogar im leeren Zustand versprühte Golden Doors einen Hauch Magie. Ich liebte dieses Gemäuer und empfand es mehr als mein Zuhause, als ich das jemals von Manhattan hatte behaupten können. Es fühlte sich an, als gehörte Golden Doors mir – auch wenn das vielleicht albern klang. Es war immer ein Haus der Barbanel-Frauen gewesen: Die Gärten wurden von Frauen angelegt und instand gehalten, die Baupläne hatte ebenfalls eine Frau entworfen. Und ich war die älteste Enkeltochter der gegenwärtigen Barbanel-Generation. Golden Doors und ich passten zueinander wie Schlüssel und Schloss.
Ich führte Tyler in den Salon, wo meine Familie die meiste Zeit verbrachte: Wohnzimmer, Esszimmer und Küche in einem. Große Fenster und eine breite gläserne Schiebetür nahmen eine Wand komplett ein und gaben den Blick frei auf den Rasen und die ausufernden Gärten, die schließlich über dramatische Klippen zum Meer hin abfielen. Für gewöhnlich war von hier aus ein Streifen Blau zu erkennen, doch heute verwischte der Sturm alles. Obwohl meine Uhr erst vier Uhr nachmittags anzeigte, war die Sonne verschwunden und die Welt bereits in ein bläuliches Dämmerlicht getaucht. Weiterhin fiel Schnee, und der tosende Wind verwehte ihn draußen zu unförmigen Haufen.
Ich schaltete das Licht ein, um die Welt vor den Fenstern auszublenden. Nun sahen wir – anstelle von Schnee und Dunkelheit – die geschmackvolle Inneneinrichtung meiner Großmutter: gemütliche Sitzgruppen, kleine Kaffeetischchen, einen großen Tisch für zwanglose Abendessen, eine Kücheninsel aus Marmor. Ich tappte durch den Raum, rutschte dabei in meinen dicken Wintersocken einmal beinahe auf dem glatten Boden aus und betrat die Speisekammer am anderen Ende. Tyler hielt sich dicht hinter mir. Seine Schritte waren kaum zu hören, aber seine Gegenwart spürte ich umso deutlicher.
»Nimm dir, worauf du Lust hast.« Ich öffnete den Schrank, in dem sich der Tee befand: Celestial-Kräutertee für Grandma, schachtelweise Lipton für Grandpa, Moms Lieblingssorten von Bigelow und dazu etliche Dosen mit losem Tee. Ich griff nach einem Gewürztee mit Orange und Zimt, der nach meinem Empfinden immer irgendwie tröstlich schmeckte. Tyler studierte die Auswahl, als hätte ich ihn gebeten, eine Operation am offenen Herzen durchzuführen, und fuhr dabei mit den Fingern über die fein gemaserten Holzschränke, schnupperte an mehreren Sorten. Er nahm eine geprägte Schachtel vom Regal und drehte sie in den Händen. Endlich füllte er sich eine metallene Teekugel mit einer Portion Earl Grey.
Wäre ich doch bloß mit Isaac hier für eine Nacht gestrandet. Ich konnte mir den Verlauf des Abends mit ihm haargenau vorstellen: Er wäre höflich, nett und charmant; wir würden gemeinsam kochen (auch wenn ich das sonst so gut wie nie tat). Wir würden die Menora entzünden, dabei gemeinsam das Streichholz führen, und unsere Stimmen würden miteinander verschmelzen. Wir würden auf der Couch sitzen und die ganze Nacht reden. Er würde einen Arm um mich legen, und dann, irgendwie, käme es zum ersten Kuss …
Ich linste zu Tyler hinüber und Röte stieg mir ins Gesicht. Ich konnte nicht hier neben ihm stehen und davon träumen, mit jemand anders rumzumachen. Also marschierte ich zurück in den Salon, setzte den Wasserkessel auf und holte zwei Tassen aus dem Schrank und trug sie zur Kücheninsel. Wir ließen uns einander gegenüber auf die Barhocker sinken. »Das bedeutet nicht, dass wir jetzt befreundet sind oder so.«
Er hängte seine Teekugel in die Tasse. »Gott bewahre. Nein.«
»Ich will bloß nicht, dass du erfrierst.«
»Da haben wir etwas gemeinsam.« Er grinste mich an. »Ich habe auch keine Lust, zu erfrieren.«
Wie konnte er so unbekümmert sein, während ich ein lebhaftes Unbehagen in jeder Faser meines Körpers spürte? Andererseits: Locker und selbstbewusst war er schon immer gewesen, wohingegen ich mit den meisten Menschen außerhalb meiner Familie nur schwer warmwurde. Wie sollte ich die Nacht allein hier mit ihm überleben? »Willst du einen Film schauen oder so?«
»Nee. Filme sind langweilig.«
Irgendwie gelang es Tyler, beinahe alles, was ihm aus dem Mund kam, vernünftig klingen zu lassen, und fast hätte ich zustimmend genickt. Ich konnte mich gerade noch beherrschen. »Der einzige Sinn und Zweck von Filmen ist es, nicht langweilig zu sein.«
Er wand sich aus seinem Wollmantel und hängte ihn über seine Stuhllehne. Die Heizung kam endlich auf Touren. »Okay, dann nicht langweilig, aber eher Plan C. Es gibt doch Interessanteres zu tun.«
»Zum Beispiel?«
»Du weißt schon. Wir können unsere Hoffnungen und Träume und Pläne und Geheimnisse miteinander teilen.«
Ich schnaubte. »Und wieso sollte ich dir irgendetwas dergleichen verraten?«
»Weil es Spaß macht, sich zu unterhalten, Shira.«
Ach ja? »Aber nicht mit Fremden.«
»Wir sind keine Fremden.«
»Tja, besonders gut kennen wir uns aber auch nicht. Nicht wirklich.«
Er musterte mich, und um seine Mundwinkel zuckte ein winziges Lächeln – ganz anders als das breite Strahlen, das er für gewöhnlich im Gesicht trug. »Du warst einmal überzeugt, mich gut genug zu kennen, um behaupten zu können, du liebst mich.«
Ich war fassungslos. Darüber, dass er den erniedrigendsten Augenblick meines Lebens so beiläufig aufs Tapet brachte. Selbst nach zweieinhalb Jahren fühlte es sich an, als hätte er den gesamten Inhalt eines Salzstreuers über meinen Eingeweiden ausgekippt.
»Ich war vierzehn. Ich war jede Woche in jemand anders verliebt.«
Er prustete. »Du warst jahrelang in mich verliebt.«
Das stimmte, aber das war nie Thema gewesen zwischen uns. Ich fühlte, wie meine Wangen heiß und schwer wurden, weigerte mich jedoch, eine Miene zu verziehen. »Träum weiter.«
Er lehnte sich nach vorn. »Gib es zu. Ich war der Mittelpunkt deines Universums.«
»Für dreißig Sekunden.« Der Kessel begann zu zischen, und ich beeilte mich, heißes Wasser in unsere Tassen zu gießen. »Bild dir bloß nicht zu viel darauf ein.« Ich legte ebenfalls den Mantel ab, ehe ich mich wieder setzte. Mit einem Mal war mir viel zu heiß. »Und ich mochte dich nicht etwa, weil ich dich kannte. Sondern weil du so –« Ich machte eine vage Handbewegung.
Er schloss die Hände um seine Tasse und der Dampf stieg ihm ins Gesicht. »So – was?«
»So gut aussehend bist«, sagte ich. »Du verdankst alles deinen Genen. Und nicht etwa einer tollen Persönlichkeit oder was auch immer.«
»Shira Barbanel.« Seine Augen weiteten sich und er wirkte wider Willen beeindruckt. »Das tat weh.«
Ich zuckte mit den Schultern, mit minimal schlechtem Gewissen, aber nicht bereit, nachzugeben. »Du bist derjenige, der brutal geworden ist – du hast dich über meine Schwärmerei aus Kindertagen lustig gemacht.«
Immerhin war er anständig genug, ein wenig beschämt auszusehen. »Tut mir leid. Ich wollte nicht, dass du dich schlecht fühlst. Aber die Quittung dafür habe ich wohl kassiert: Nachdem du mich jahrelang angehimmelt hast, verachtest du mich nun schon ebenso lange.«
Ich verdrehte die Augen. »Das muss traumatisch sein, wenn man nicht länger der Nabel der Welt ist.«
»Dann gibst du also zu, dass ich tatsächlich der Nabel deiner Welt war.«
»Aus einem einzigen Grund: Ich war ein dummes Kind.«
Seine Augen verengten sich kaum merklich, doch dann setzte er das Grinsen auf, nach dem ich über Jahre geschmachtet hatte. »Würde ich es ernsthaft darauf anlegen, würdest du zu meinen Füßen dahinschmelzen.«
»Das hättest du wohl gern.« Ich nahm einen großen Schluck Tee, der mir die Kehle verbrannte und Wärme in jede Faser meines Körpers schickte. Für mich war unvorstellbar, wie man nur so vor Selbstbewusstsein strotzen konnte, und ich verspürte das dringende Bedürfnis ihm einen Dämpfer zu verpassen.
Er starrte mich einen langen, bedächtigen Moment an. Dann zuckte sein Blick nach unten. »Du hast winzige Hände.«
»Wie bitte?«, fragte ich, völlig überrumpelt.
»Deine Hände. Sie sind winzig.«
»Sind sie nicht«, entgegnete ich, überkommen von dem plötzlichen absurden Drang, meine Handgröße zu verteidigen. »Ich habe früher Klavier gespielt.«
Er lächelte, diesmal sanfter. »Wirklich? Das wusste ich nicht.«
»Wieso auch?«, murmelte ich, und als er mich weiter bewundernd anschaute, räusperte ich mich. »Ähm. Ja. Mein Dad hat es mir beigebracht.«
»Und was spielst du?«
Wieso redeten wir jetzt über meine Klavierkünste? Ich atmete den Duft nach Orange und Gewürzen aus meiner Teetasse ein. »Keine Ahnung. Vergiss es. Mittlerweile spiele ich sowieso nicht mehr.«
»Aber was mochtest du damals am liebsten?«
Am liebsten. Himmel. Hatte ich Lieblingsstücke gehabt, bevor das Klavierspielen in erster Linie Arbeit geworden war – ein weiterer Tagesordnungspunkt in meinem übervollen Terminkalender, der mich allmählich zu Staub zermahlte? Vivaldi und Debussy und Schumann waren die Komponisten, die ich gespielt hatte, aber gemocht …
»Weißt du, Cats hat mir wirklich gut gefallen.«
Er stieß ein überraschtes Lachen aus. »Im Ernst?«
»Ja, ich habe es geliebt. Von Memory habe ich jedes Mal Gänsehaut bekommen.«
»Wow. Wer hätte das gedacht?«
»Ich war sechs, okay?«
»Das ist jung.« Er hob eine Hand, mit gespreizten Fingern. »Aber zum Klavierspielen braucht man bloß lange Finger, keine großen Hände.«
Ich hielt ebenfalls meine Hand in die Höhe, damit er sie richtig betrachten konnte. »Meine Hand ist vollkommen normal groß!«
Er legte seine an meine, presste unsere Handflächen gegeneinander. Ein Elektroschock durchfuhr mich bei seiner Berührung. Seine Hand war tatsächlich viel größer. Und warm. Er krümmte seine Fingerkuppen um meine. »Siehst du?«
»Hmm.« Wärme flutete meinen ganzen Körper. »Wie auch immer, das ist total egal –«
Er verschlang unsere Finger miteinander.
Ich verlor jegliches Sprachvermögen. Er lächelte. Sein Daumen strich über meine Handfläche.
Und ich riss meine Hand aus seiner. »Du bist ein Arschloch.«
»Komm schon, Shir, du hast mich praktisch herausgefordert. Du hast gesagt, ich hätte keine Persönlichkeit.«
»Ich heiße Shira. Und das war ja wohl keine Demonstration von Persönlichkeit, sondern – du wolltest dich einschleimen.« Ich nippte an meinem Tee und dachte an Isaac, um mich zu beruhigen. Isaac würde niemals solche Spielchen treiben; wann immer wir uns bisher unterhalten hatten, hatte er sehr ernsthaft zu meinen Worten genickt. Natürlich waren das nie lange Gespräche gewesen, und für gewöhnlich hatten sie sich um Themen wie die Schule oder das Wetter gedreht, aber er war einfach nicht der Typ, der sich über mich lustig machen würde. »Und die Fähigkeit, charmant zu sein, ist keine Charaktereigenschaft.«
»Wieso nicht?«
»Keine Ahnung. Weil das nichts Echtes ist. Nur so etwas Oberflächliches.«
»Und was ist dann echt?«
»Was weiß ich?« Offen gestanden war ich mir nicht sicher, ob ich Persönlichkeit besaß – oder mich lediglich in all die Erwartungen der Menschen in meinem Umfeld fügte. »Die eigenen Ziele, schätze ich? Das, wofür man brennt.«
»Okay.« Er lehnte sich nach vorn, stützte die Unterarme auf die Arbeitsplatte. Ich gab mir alle Mühe, dem goldenen Haarflaum auf seiner Haut keine Beachtung zu schenken. »Und das wäre in deinem Fall?«
Oh nein. Meine meistgehasste Frage – und ich war direkt ins offene Messer gelaufen. »Vielleicht rette ich die Meeresschildkröten«, meinte ich leichthin. »Die haben es momentan ziemlich schwer.«
»Die Meeresschildkröten«, wiederholte er.
»Jep.« Ich mochte Meeresschildkröten – sie sahen wie hutzelige alte Männchen mit Flossen aus. Und ich hatte gelernt: Wenn ich Meeresschildkröten erwähnte, lachten die Leute oft und gingen zum nächsten Thema über. Was ich genau genommen bezwecken wollte. Denn ich redete nicht gern über meine Zukunft oder darüber, was ich vom Leben erwartete.
Es gab einmal eine Zeit, da hatte ich geglaubt, meine Träume und Ziele zu kennen. Ich wusste, dass ich jemand Bedeutendes sein wollte. Bloß hatte sich herausgestellt, dass ich das nicht war.
Nicht im Klavierspielen und auch nicht im Eiskunstlaufen, obwohl ich über so viele Jahre so viel Kraft in beides gesteckt hatte. Inzwischen war all das, was ich einmal für die Leidenschaft meines Lebens gehalten hatte, so schmerzhaft geworden, dass ich mich davon fernhielt. Früher hatte mich stechender Neid gepackt, wenn ich den Profis zugesehen hatte; ich hatte nach ihrem Talent gegiert, nach ihren Medaillen, doch der Neid war erträglich gewesen, weil er mich angespornt hatte, selbst immer besser zu werden. Ich konnte mir Dinge von ihnen abschauen, von ihnen lernen, und eines Tages würde ich selbst aus meinem Kokon schlüpfen, völlig verwandelt.
Allerdings war das nie passiert, und nun machten Klavierspielen und Eiskunstlaufen mich nur noch traurig.
Mein Handy vibrierte. Mom, die sich vermutlich vergewissern wollte, dass ich wohlbehalten in Golden Doors angekommen war. Ich sprang von meinem Stuhl und ging in den Flur, damit wir halbwegs ungestört reden konnten. »Hi.«
»Hi. Bist du gut zum Haus gekommen?«
»Ja. Alles bestens. Ich, ähm – ich habe mir ein Taxi mit Tyler Nelson geteilt. Bei ihm zu Hause ist der Strom ausgefallen, deshalb habe ich ihn mit hierhergenommen.«
»Oh.« Mom klang überrascht, aber nicht im unangenehmen Sinn. »Habt ihr zwei etwas zu essen?«
»Ich denke schon. Wir haben noch nicht nachgeschaut.« Ich wand mich ein wenig, das einzugestehen. »Bestimmt ist noch Tiefkühlpizza in der Gefriertruhe oder so.«
»Okay, gut. Und alles funktioniert?«
»Ja, alles vollkommen in Ordnung, Mom. Was treibt ihr so?«
»Wir sind jetzt wieder bei Tante Liz – wir haben uns unterwegs etwas zu essen geholt, weil ja niemand damit gerechnet hatte, dass wir zurückkommen. Wir wollen gerade die Menora entzünden. Hast du Lust auf FaceTime?«
Tief in meinem Bauch riss ein dumpfer Schmerz auf. Ein Teil von mir wollte sie sehen, die ganze Familie sehen. Am ersten Abend von Chanukka sangen wir immer »Sevivon« und das Dreidel-Lied und »Light One Candle«. Die Vorstellung, dass sie all das ohne mich singen würden, tat weh. Doch wenn ich alle aus der Ferne dabei beobachtete, würde ich mich anschließend nur noch elender fühlen. »Nein danke – ich muss sowieso mal mit dem Schmücken anfangen.«
»Bist du sicher? Pass auf, ich –«
»Schon gut, Mom. Wir sehen uns morgen.«
»Wieso bist du so gereizt?«, fragte sie sofort. »Was ist los?«
Ich seufzte. »Nichts ist los. Ich will Tyler nicht so lange allein lassen.«
»Okay. Na ja. Morgen sind wir ja da.«
»Okay. Ich habe dich lieb.«
»Ich habe dich auch lieb«, sagte sie und legte auf.
4.
ZURÜCK IM SALON ließ ich mich wieder Tyler gegenüber auf meinen Barhocker fallen. »Pass auf, die Sache ist die«, sagte ich. »Heute ist der erste Abend von Chanukka und morgen kommt meine Familie.«
»Fröhliche Chanukka.«
»Danke.« Ich bemühte mich um einen munteren, pragmatischen Tonfall. »Also: Wir haben ein paar Sachen zu erledigen.«
»Wir müssen die Menora entzünden?«
Ich zuckte zurück. »Nein. Wir schmücken das Haus.«
Obwohl ich sehr gern die Menora entzündet hätte. Wie schwer mochte sie zu finden sein? Zu Hause stand unsere Menora das ganze Jahr über auf einem Bücherregal im Wohnzimmer: Menora im Bücherregal, Kidduschbecher im Schrank, Schabbatkerzenhalter auf dem Sideboard.
Aber – ich hatte noch nie eine Menora entzündet, ohne dabei meine Familie um mich zu haben. Wäre es komisch, mit Tyler hier? Was würde er tun – mir dabei zusehen, wie ich die Gebete sang? Peinlich. Außerdem war ich nicht unbedingt mit einer bezaubernden Singstimme gesegnet.
Andererseits hatte ich bereits ein schlechtes Gewissen, weil ich meine Mom angefaucht hatte, und es würde nur noch schlimmer werden, wenn ich nun auch nicht die Menora entzündete. Eine Zwickmühle: Schuldgefühle oder Blamage.
Offenbar übertrumpften elterliche Schuldkomplexe alles andere mit Leichtigkeit.
»Vielleicht entzünden wir auch die Menora«, lenkte ich ein. »Aber zuerst müssen wir etliche Kisten vom Dachboden herunterschleppen. Betrachte es als Übernachtungspreis.«
Aus der Speisekammer förderte ich eine Schachtel Kerzen und ein Streichholzbriefchen zutage, und im Esszimmer für förmlichere Abendeinladungen fand ich auch die Menora aus Messing. Als Nächstes führte ich Tyler die Treppe hinauf. Auf unserem Weg nach oben beäugte er neugierig alles, ließ seine Finger über Bilderrahmen und Couchgarnituren gleiten, streichelte sogar die Vorhänge.
»Fasst du immer alles an?«
»Ich bin ein haptischer Typ«, meinte er leichthin. »Wenn ich früher mit meinen Moms shoppen war, habe ich in den Läden immer alle Stoffe berührt.«
»Und hat dir nie jemand gesagt, du sollst deine Finger bei dir behalten?«
»Schon möglich.« Er lachte. »Aber ich fürchte, das habe ich überhört.«
Und ich konnte mir bestens vorstellen, wie die Leute Tyler Nelson – mit seinem einnehmenden Lachen und dem strahlenden Lächeln – alles durchgehen ließen.
Wir erreichten den zweiten Stock – eigentlich nur eine halbe Etage mit niedrigeren Decken. Die Kleinen und Mittleren – alle Cousins und Cousinen unter dreizehn – schliefen hier zusammen in einem riesigen Raum direkt unter dem Dachvorsprung. Ziemlich in der Mitte blieb ich stehen und deutete zu einer Klappe in der Decke. Eine schlanke Kette baumelte herab. »Ich präsentiere: der Dachboden.«
Tyler spähte nach oben. »Und wie kommen wir hoch?«
Nun kniff auch ich die Augen zusammen. »Normalerweise über die Leiter.« Ich ging in die Knie, sprang ab und erhaschte die Kette, zog die Falltür auf und die daran befestigte Leiter herunter.
»Ladys first«, sagte Tyler. Ich zögerte, malte mir aus, wie er mir beim Hochklettern auf den Hintern starren würde … und wenn schon. Ich hatte einen verdammt hübschen Hintern.
Der Dachboden war niedrig und vollgestopft, mit schräg abfallenden Decken. Hier oben heulte der Wind noch lauter und rüttelte an den schlecht isolierten Wänden. Auch die Kälte kroch herein. Im Dunkeln konnten wir gut aus den Fenstern zu allen Seiten des prismenförmigen Raums sehen. Im blauen Licht der Abenddämmerung fiel der Schnee ohne Unterlass.
Tyler folgte meinem Blick. »Das ist wunderschön.«
Ich nickte nur, nicht bereit, einen Moment der Bewunderung für das Naturschauspiel mit diesem Typen zu teilen, und zog erneut an einer Kette. Eine einzelne Glühbirne erhellte den lang gestreckten Raum und warf harte Schatten. »Schauen wir mal, ob wie die Deko finden.«
Wir schritten den Dachboden ab, linsten in die zahllosen Kisten: weiße Briefboxen und braune Kartons, durchsichtige Plastikkisten und die eine oder andere Holztruhe. Dazwischen verteilt waren ausrangierte Möbelstücke – ein Schaukelstuhl und ein Schaukelpferd, einige alte Lampen, ein Spiegel.
»Wie lange wohnt deine Familie schon hier?«
»Seit dem neunzehnten Jahrhundert«, antwortete ich und musste lächeln, als er mir einen Seitenblick zuwarf. »Auf jeden Fall jede Menge Zeit, um Krempel anzuhäufen.«
Im nächsten Moment knallte Tyler auf den Boden. »Au!«, rief er, vollkommen perplex.
Ich schlitterte eilig um einen großen Stapel Kartons, der zwischen uns stand. »Alles in Ordnung? Was war das denn?« War mein Lächeln derart überwältigend gewesen, dass es ihn glatt von den Füßen gerissen hatte? Wow, ich sollte mir wirklich Mühe geben, freundlicher zu sein.
Er setzte sich auf und rieb seinen Knöchel. »Mir geht’s gut. Ich bin bloß gestolpert über …« Er brach ab und starrte auf die Stelle, an der er gestürzt war. Eine Holzdiele stand aus dem Fußboden hervor.
Oh nein. Hatten wir etwas kaputt gemacht? »Darüber bist du gestolpert? Ach herrje.«
»Meinst du, das war Absicht?«
»Ich – was? Ob ich meine, dass die Diele dich mit Absicht zum Stolpern gebracht hat?«
Er lachte. »Ob sie absichtlich locker ist. Ob sie schon mal jemand herausgehebelt hat.«
Jetzt hatte er meine Neugier geweckt. »Um etwas darunter zu verstecken, zum Beispiel?«
»Lass es uns herausfinden.«
Er rutschte hinüber, und ich kniete mich ebenfalls hin, sodass wir beide unter das Brett spähen konnten. Doch dann zögerte ich. »Was, wenn darunter Mäuse wohnen?«
»Du bist größer als sie.«
»Aber nicht halb so furchteinflößend.« Ich atmete tief durch. »Okay. Schauen wir nach.«
Wir spähten in die Dunkelheit. Und dort, eingequetscht in den winzigen staubigen Hohlraum, lag eine Kiste.
Nicht größer als ein Schuhkarton, aber so fein gearbeitet wie ein Schmuckkästchen. Der gewölbte Deckel bestand aus dunklem polierten Holz und die Seiten zierten filigrane Schnitzereien. Ich hob sie aus der Vertiefung und stellte sie auf den Boden. »Schau dir das an«, hauchte ich und ruckelte am Deckel. Er ließ sich nicht aufklappen. »Verborgene Schätze!«
»Sieht alt aus.« Er betrachtete die kleine Truhe eingehender. »Wie lange sie wohl dort drin war?«
»Gibt es einen Schlüssel?« Ich leuchtete mit der Taschenlampen-App meines Handys in die Ecken des Hohlraums, sah allerdings nichts als Staub.
»Wir finden bestimmt eine Möglichkeit, wie wir sie öffnen können. Komm, wir nehmen sie mit nach unten.«
»Okay«, sagte ich mit wachsender Aufregung, rief mir jedoch ins Gedächtnis, dass ich mich nicht ablenken lassen durfte. »Aber zuerst müssen wir die Dekosachen aufspüren.«
Tyler reckte sein Handy in die Höhe, sodass der Lichtstrahl seiner eigenen Taschenlampen-App auf einen Stapel Kisten direkt vor uns fiel und einen Aufkleber mit der Beschriftung Chanukka in der Handschrift meiner Großmutter erfasste. Er ließ das Licht des Handys über ein Dutzend ähnlicher Boxen kreisen. »Ähm, glaubst du, das gehört alles dazu?«
Wir brauchten zwanzig Minuten, um die großen Plastikbehälter nach unten zu schleppen. Zuletzt holten wir noch das Holzkästchen und stellten es neben unsere Teetassen auf die marmorne Kücheninsel. Tyler versuchte, den Deckel mit Gewalt aufzuhebeln. »Vielleicht können wir das Schloss knacken.«
»Klingt brutal. Vermutlich hat jemand die kleine Truhe nicht ohne Grund versteckt.«
»Jaaa, vor etwa einhundert Jahren. Ich denke nicht, dass wir da gegenüber irgendwem Vertrauensbruch begehen.«
Es juckte mich in den Fingern, das Kästchen zu öffnen. Lange hatte ich nicht mehr so auf etwas gebrannt – ganz ähnlich, wie ich einst begeistert und verzaubert vom Eiskunstlaufen und Klavierspielen gewesen war. Nun war mir vielmehr oft unsagbar langweilig, und die mit Hausaufgaben und Aufsätzen und Lernen angefüllten Nachmittage zogen sich ins Unendliche.
Wie schön wäre es, wieder einmal von etwas gefesselt zu sein. Ich googelte Wie knackt man ein Schloss?, und Tyler und ich steckten die Köpfe zusammen und lasen das erste Ergebnis auf dem Display. »Anscheinend brauchen wir einen Spanner«, stellte er fest.
»In einem der Schränke ist ein Werkzeugkasten …«
Ein paar Minuten später waren wir mit einem Schraubenschlüssel ausgerüstet, und mithilfe einiger Haarklemmen und einer ordentlichen Dosis Gefluche klickte das Schloss. Die kleine Truhe schien zu seufzen, als der Deckel seinen eisernen Griff löste.
Tyler und ich starrten einander an. Dann, ganz, ganz behutsam, klappte ich das Kästchen auf.
Ich hatte keine Ahnung, womit ich rechnete – mit etwas Magischem, alle Wünsche Erfüllendem? Einer Schatzkarte, einem Haufen Juwelen? Stattdessen lag im Innern ein Wust aus Gegenständen: ein Pfeil, ein Stück Holz, ein Medaillon und ein winziges, mit Muscheln gefülltes Einmachglas.
»Erinnerungsstücke von irgendwem«, murmelte ich. Irgendein Sohn oder eine Tochter des Hauses musste sie versteckt haben – vermutlich jemand, der entfernt mit mir verwandt war. Ich nahm den Pfeil heraus: Er bestand aus Holz und hatte einen langen, dünnen Schaft. Stirnrunzelnd betrachtete ich ihn und reichte ihn dann an Tyler weiter, damit er das Gleiche tun konnte, ehe ich selbst nach dem Holzstück griff. Es war rund zwanzig Zentimeter lang und halb so breit, an einem Ende spitz und geschliffen, am anderen abgebrochen und splittrig. Zwei Buchstaben, nur noch teilweise zu erkennen, waren eingeritzt: ein R und ein O. »Was, glaubst du, ist das?«
»Keine Ahnung.« Er legte den langen Pfeil mit der winzigen Spitze zur Seite und streckte die Hand nach dem Holz aus. »Sieht aus, als habe es mal zu einem viel größeren Holzstück gehört, wenn man sich die Höhe der Buchstaben anschaut.«
Als Nächstes langte ich nach dem Medaillon; es war etwa fünf mal acht Zentimeter lang und flach, sprang mit einem Klicken auf und enthüllte das winzige Gemälde eines gut aussehenden jungen Mannes. Tyler beugte sich darüber. »Meinst du, er war ein Barbanel?«
»Keine Ahnung«, sagte ich. »Schon möglich. Aber ich glaube eher, dass man ein Porträt von jemandem aufbewahrt, der … den man mochte – und nicht von sich selbst, oder?«
Tyler blickte nachdenklich. »Dann denkst du, das ist ein alter Freund einer deiner Ururgroßmütter, der letztlich nicht den Ansprüchen genügt hat?«
»Könnte sein.« Wir beäugten beide den jungen Mann, der ein weißes Hemd mit breitem Kragen und eine Krawatte trug, deren Enden beide über seine Brust hingen. Ein dramatischer Schnurrbart bedeckte seine Oberlippe. »Vielleicht wollte sie ihn nicht vergessen und hat deshalb alles weggepackt. Eine Trennungsbox.«
»Eine Trennungsbox?« Er grinste mich an. »Das klingt nach etwas, das man Freunden schenkt. Gefüllt mit Schokolade und Alkohol und einem Album von Amy Winehouse.«
Ich musste mir ein Lächeln verkneifen. »Ja. So ähnlich wie diese Babyboxen, die in den skandinavischen Ländern an frischgebackene Eltern ausgegeben werden. Eine Art Willkommensgeschenk vom Staat.«
Seine Augenbrauen wanderten nach oben, und er lächelte mich an. Ein anderes Lächeln als das breite, auf Hochglanz polierte, das er für gewöhnlich in alle Richtungen warf – eigenartiger, verschmitzter. »Genau. Eine Sozialleistung. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute echte Steuergelder löhnen würden, um solche Trennungsboxen zu bekommen.«
Ich schmunzelte nun ebenfalls, wider Willen amüsiert, und betrachtete noch einmal das Porträt. »Was meinst du, wie alt es ist?«
Er besah es sich genauer. »Frag mich was Leichteres. Wann waren solche Miniaturen in Mode? Vermutlich vor der Erfindung der Fotografie, oder?«
Ich rief die entsprechende Wikipedia-Seite auf. »Okay, Fotografie kam so richtig erst nach der Industriellen Revolution auf – also nach 1850. Und wurde in den 1880ern dann immer populärer. Ich muss mal meine Großeltern fragen, wer vor dieser Zeit in Golden Doors gelebt hat.«
»Glaubst du, das wissen sie?«
Behutsam legte ich die Gegenstände zurück in das Kästchen. »Das Haus ist seit seiner Erbauung im Familienbesitz, von daher: ja.«
»Ach richtig, ich hatte kurz vergessen, dass du ja zum Hochadel Nantuckets gehörst.«
»Hör auf!« Meine Familie lebte seit dem frühen 19. Jahrhundert auf der Insel, das stimmte, aber obwohl die hier ansässigen Quäker wesentlich toleranter gewesen waren als die Puritaner auf dem Festland, war meine jüdische Familie dennoch keineswegs mit offenen Armen aufgenommen worden.
Ich griff nach dem Einmachglas und schraubte den Deckel ab. Wie alt die Muscheln wohl sein mochten? Ich hatte fast ein wenig Sorge, sie zu berühren, nahm dann aber vorsichtig ein paar heraus. Es war eine bunte Mischung: kleine weiße Muscheln und große, farbige Schalen, die den auf Nantucket üblichen grauen Kammmuscheln glichen, allerdings orange und golden schimmerten wie der Sonnenuntergang.
»Die sehen nicht aus wie von hier«, bemerkte Tyler. »Aber ich nehme an, im neunzehnten Jahrhundert sind die Leute aus Nantucket durch den Walfang viel herumgereist. Vielleicht waren die Muscheln ein Geschenk. Vielleicht war der Liebhaber des Barbanel-Mädchens Seemann.«
Ende der Leseprobe
Inhalt
Cover
Hannah Reynolds: Eight Nights of Flirting
Wohin soll es gehen?
Widmung
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Auszug aus dem Chatverlaufvon Shira Barbanel und Tyler Nelson
Danksagung
Hannah Reynolds
Fabienne Pfeiffer
Impressum


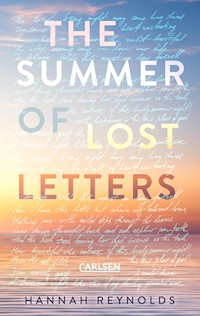













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)












