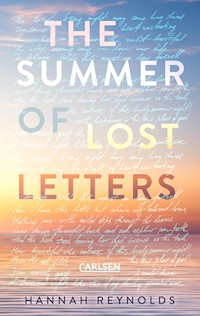
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Abbys Sommerferien drohen eine echte Katastrophe zu werden: Ihr erster Freund hat mit ihr Schluss gemacht und ihre Freundinnen sind alle irgendwo in der Welt unterwegs. Doch dann stößt Abby auf eine Kiste mit alten Liebesbriefen an ihre gerade verstorbene Großmutter. Kurzentschlossen reist sie auf die Insel Nantucket, von wo die Briefe vor langer Zeit abgeschickt wurden – und erlebt den Sommer ihres Lebens. Denn schon bald trifft sie hier auf Noah, den charmanten Enkel des Briefeschreibers – und interessiert sich plötzlich für sehr viel mehr als nur für ihre Familiengeschichte ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Hannah Reynolds: The Summer of Lost Letters
Abbys Sommerferien drohen eine echte Katastrophe zu werden: Ihr erster Freund hat mit ihr Schluss gemacht und ihre Freundinnen sind alle irgendwo in der Welt unterwegs. Doch dann stößt Abby auf eine Kiste mit alten Liebesbriefen an ihre gerade verstorbene Großmutter. Kurzentschlossen reist sie auf die Insel Nantucket, von wo die Briefe vor langer Zeit abgeschickt wurden – und erlebt den Sommer ihres Lebens. Denn schon bald trifft sie hier auf Noah, den charmanten Enkel des Briefeschreibers – und interessiert sich plötzlich für sehr viel mehr als nur für ihre Familiengeschichte ...
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
Für meine Eltern,
die unerschütterlich an mich glauben –
und daran, dass sie Vorbild für sämtliche Elternfiguren
in meinen Büchern sind.
Ersteres bedeutet mir mehr, als ich sagen kann;
Letzteres – okay, damit liegt Ihr diesmal
vermutlich gar nicht so falsch.
Der neue Koloss
VON EMMA LAZARUS
Nicht wie der Griechen eherner Koloss
Die Feinde mit der Waffe unterdrückt;
An unser meerumspültes Tor gerückt
Steht eine mächt’ge Frau, die Mutter der Migranten,
den Blitz als Fackel in der starken Hand,
ein Leuchtturm, der zwei Städte überbrückt.
Sie ruft: »Behaltet den berühmten Tand
Und euren Pomp an euren alten Küsten.
Schickt mir stattdessen eure Mittellosen,
die Heimatlosen, hoffnungslos Zerlumpten,
vom Sturm Gebeutelten, die Abgestumpften,
die Müden, die trotzdem nach Freiheit dürsten.
Den Abschaum schickt vom übervollen Strand.
Am Goldnen Tor erheb ich meine Hand.»
1.
6. April 1958
Ich werde versuchen, Dir alles zu erklären.
Ich bin nicht sicher, ob ich es kann. Ich bin es nicht gewohnt, Dir Dinge zu erklären, vielleicht weil wir einander für gewöhnlich so gut verstehen. Ich stelle mir uns vor wie zwei Rosen am selben Stock, wir beide gegen den Rest der Welt, umgeben von Dornen, die jeden anderen stechen, der uns zu nahe kommt.
Allerdings ist mir klar geworden, dass wir auf einige Dinge stets eine unterschiedliche Sicht haben werden, da wir sie von unterschiedlichen Standpunkten betrachten. Du siehst Familie so anders als ich, weil Du aus einer heileren, glücklicheren Welt stammst. Manchmal ertrinke ich im Neid darauf, als wie selbstverständlich Du Deine Familie betrachtest.
Ich liebe Dich. Leidenschaftlich. Von ganzem Herzen. Meine Liebe zu Dir ist an manchen Tagen das Einzige gewesen, das mich über Wasser hielt.
Aber romantische Liebe ist nur eine Form der Liebe – und nicht die wichtigste. (Ich sehe, wie Du an dieser Stelle den Kopf schüttelst, aber … lass es. Selbst wenn Du anderer Meinung bist, mach Dir bewusst, dass das meine Überzeugung ist. Ich schätze andere Arten von Liebe ebenso hoch wie das Verliebtsein.) Du bist kein Ritter und ich bin nicht Deine Lady, wir leben nicht im Mittelalter und die Welt dreht sich nicht allein um uns. Ich liebe Dich und ich will Dich, aber was ich will und was richtig ist, decken sich nicht immer. Über diesen Unterschied hast Du kaum je nachdenken müssen (das weiß ich mit Sicherheit), aber ich bitte Dich, es jetzt zu tun. Ich treffe die richtige Wahl.
Ich liebe Dich.
Aber ich werde meine Meinung nicht ändern.
Als ich klein war, hatte meine Mom eine merkwürdige Vorliebe für »Hättest du lieber …?«-Spielchen. Sie fing damit an, wenn sie mich von einer meiner Freundinnen abholte – von Niko, deren Mutter Mochi-Kuchen backte, oder von Haley, deren Mutter Schals strickte. Hättest du lieber Nikos Mutter, fragte Mom dann, oder mich? Hättest du lieber Haleys Mom – oder mich?
Sogar mitten im schlimmsten Streit zwischen uns nahm ich mich stets davor in Acht, diese Linie zu übertreten. Unsere Auseinandersetzungen wuchsen sich beinahe zu einer eigenen Kunstform aus: Ich wusste genau, wo jeder Schlag und jede Parade landen würden und wie ich mit meinen Angriffen über oder unter die Gürtellinie zielen konnte. Doch selbst wenn wir einander mit Worten bewusst verletzten, versetzte ich ihr diesen einen Stoß nie. Er träfe das weiche Gewebe hinter der Schädeldecke, wäre wie Wasser für die böse Hexe des Westens, wie ein Stich in Achilles’ ungeschützte Ferse. Es wäre der Todesstoß.
»Dich«, antwortete ich also jedes Mal, wenn wir Nikos perfekt manikürten Rasen hinter uns ließen oder Haleys Veranda mit der Flagge in Rot, Weiß und Blau. »Ich hätte lieber dich.«
Die Türklingel schellte mitten im Sturm.
Regen trommelte auf den Dachvorsprung und ertränkte das Geräusch beinahe. Wasser stürzte in Strömen die gläsernen Balkontüren im Wohnzimmer hinunter und verzerrte den Garten und den Wald dahinter zu wabernden grünbraunen Schemen. Der März mochte auch in Neuengland offiziell zum Frühling zählen, doch tatsächlich war er stets kühl und nass und dunkel.
Ich hatte es mir auf dem Sofa gemütlich gemacht und las Rebecca von Daphne du Maurier. Die Kombination aus Schauerroman und Schauerwetter bescherte mir eine Gänsehaut, gegen die auch die hellen Zimmerlampen und meine dampfende Tasse Pfefferminztee nichts auszurichten vermochten. Es würde noch Stunden dauern, bis Mom und Dad wieder zu Hause wären; sie waren zu einem Bürgerforum gegangen, was nach ihrem Verständnis in etwa einem Date gleichkam. Mein Bruder Dave übernachtete bei seinem besten Kumpel. Mom hatte sich noch Sorgen darum gemacht, mich allein daheim zu lassen, doch ich hatte sie und Dad förmlich aus der Tür gescheucht – meine Eltern hatten sich einen kinderfreien Abend verdient. Außerdem hatte ich ganz gern das Haus einmal für mich.
Meistens.
Wieder schrillte die Klingel, während ich wie erstarrt auf der Couch hockte und mit beiden Händen fest das Buch umklammerte. Mein Herz raste. Niemand hatte mir je vorgeworfen, allzu rational zu sein (»Du hast eine minimal zu lebhafte Fantasie«, meinte Dad des Öfteren und hielt dabei Daumen und Zeigefinger millimeterbreit auseinander) – aber im Ernst, wem ginge nicht zumindest der Gedanke durch den Kopf, dass ein Türklingeln inmitten des übelsten Sturms einen Serienmörder ankündigen könnte?
Tja, dann sollte ich es meinem künftigen Mörder wohl besser nicht zu leicht machen, indem ich als wehrloses Opfer auf der Couch kauerte. Ich tappte durch das Haus zur Eingangstür, presste den Rücken gegen die Wand und verrenkte mir den Hals, um aus dem Fenster zu spähen.
Ein USPS-Truck stand mit laufendem Motor in der Einfahrt, seine Scheinwerfer durchschnitten den Regen, und eine Gestalt hechtete nun wieder auf das Führerhaus zu und sprang hinein. Der Wagen rollte rückwärts und brauste in die Dunkelheit davon.
Oh. Alles klar.
Meine Angst verflüchtigte sich und ich öffnete die Innentür zu unserem Vorraum – einem kleinen, zugigen Bereich voller Regenschirme und Stiefel. Meine Zehen krümmten sich reflexartig zusammen, als ich die Füße auf den kalten Steinboden setzte. Rasch sperrte ich die Haustür auf, und sofort peitschte mir feuchter Wind entgegen. Die Bäume im Vorgarten bogen sich unter den Böen. Auf der Eingangsstufe lag ein regenbesprenkeltes Päckchen. Ich schnappte es mir und huschte wieder hinein, verriegelte beide Türen und nahm den Karton mit ins Wohnzimmer.
Dr. Karen Cohen, 85 Oak Road, South Hadley, Massachusetts stand darauf. Mom. Und als Absender: Cedarwood House.
Das ergab Sinn. Die Mitarbeiter von Omas Pflegeheim hatten uns angekündigt, dass sie eine Kiste mit ihrem Kram schicken würden – Dingen, die aufgetaucht waren, als kürzlich ihr Schrank ausgeräumt wurde. Nun konnte ich einfach warten, bis Mom wieder da war, und mit ihr gemeinsam auspacken. Was eine weniger neugierige, respektvollere Tochter auch sicher tun würde.
Oder …
Das Paket mit Omas Zeug ist da!, textete ich. Falls Goldbarren drin sind, gebe ich dir Bescheid.
Ich schlitzte mit einem Schlüssel aus der Krimskramsschublade in der Küche das Packband auf. Der Karton klappte auf und gab den Blick frei auf eine flüchtige Notiz des Pflegeheims und ein in braunes Kraftpapier eingeschlagenes Bündel. Nun zögerte ich doch. Das hier hatte Oma gehört – dieses mit einer Schnur verknotete Bündel, etwas, das sie offenbar vor so langer Zeit weggepackt hatte, dass es vergessen worden war. Behutsam zupfte ich an der spröden Schleife, bis sie sich löste, und entfaltete dann das braune Papier. Der Schatz ruhte in der Mitte: ein Stapel Umschläge, allesamt adressiert an Ruth Goldman. Omas Mädchenname.
Brennende Neugier durchfuhr mich. Darin konnte sich alles Mögliche verbergen. Wir wussten so wenig über Omas Leben – besonders aus der Zeit, bevor sie Opa kennengelernt hatte. Bevor Ruth Goldman zu Ruth Cohen geworden war. Wer war sie zuvor gewesen?
Ich kniete mich auf den Wohnzimmerboden und breitete die Briefumschläge fächerförmig vor mir aus, staunte über das dicke pergamentartige Papier und darüber, wie die Tinte in die feine Struktur eingezogen war. Gut fünfzig Umschläge, mit einer Adresse in der Lower East Side.
Einen Absender fand ich auf keinem.
Ich griff nach dem ersten Umschlag und fingerte den Brief heraus. Eine ordentliche, leicht geneigte Handschrift füllte die komplette Seite. Meine liebste Ruth, las ich. Ich kann noch immer nicht fassen, dass Du fort bist. Wieder und wieder sehe ich aus dem Fenster und rechne damit, dass das Auto vorfährt und Du aussteigst und sagst, alles sei ein riesengroßer Fehler gewesen. Bitte komm bald nach Hause.
Opa, dachte ich, obwohl das nicht im Entferntesten nach meinem brummigen, witzigen deutschen Großvater klang. Meine Augen schielten nach dem Datum in der oberen rechten Ecke: 1. Juni 1952. Damals war Oma achtzehn gewesen. Ein Jahr älter als ich jetzt.
Ich drehte den Brief um, suchte nach einer Unterschrift. In Liebe – E.
Opas Name war Max gewesen.
Ich überflog den nächsten Brief.
Meine liebe Ruth,
so lange ist es nun schon her, dass ich Dich zuletzt gesehen habe. Gestern bin ich durch den Garten gegangen und habe auf dem Rankgitter einen Rotkardinal entdeckt – da kamen mir all unsere heimlichen Küsse wieder in den Sinn. Ich kann nicht einmal zur Dachterrasse hochschauen, ohne daran zu denken, wie Du dort immer auf- und abgelaufen bist …
Wow. Der romantischste Brief, den ich je erhalten hatte, war letztes Jahr eine Textnachricht von Matt gewesen. Inhalt: Abschlussball: Ja/Nein?
Kein Wunder, dass unsere Beziehung nicht lange gehalten hatte.
Ich schickte Mom ein Foto des letzten Briefs, dazu einige schnell getippte Zeilen:
Ich:
Da schau an – in dem Päckchen sind LIEBESBRIEFE.
Von einem Typen namens E.
Glaubst du, Oma hatte eine Liebesaffäre, bevor sie Opa getroffen hat???
Mom musste das Vibrieren ihres Handys gespürt haben, denn sie schrieb sofort zurück.
Mom:
Wie meinst du das, Liebesbriefe?
Ich:
Na, so richtig schmalzige Liebesprosa.
Adressiert sind sie an MEINE LIEBSTE RUTH.
»So lange ist es nun schon her, dass ich Dich zuletzt gesehen habe.«
!!!
Mom:
Dann solltest du sie vielleicht besser nicht lesen?
Ich:
Hahahaha!
Mom:
Warte auf mich!!!
Ich:
Sorry, nope.
Ich schicke dir die besten Auszüge.
Mom:
Von wem sind sie
Ernsthaft, Mom hatte nicht nur ein desaströses Leseverständnis, sondern auch erhebliche Defizite, was Zeichensetzung betraf. Wozu musste ich die Schulbank drücken, wenn Erwachsene nicht mal anständig schreiben konnten?
Ich:
Keine Ahnung, der Kerl unterschreibt mit E. Muss weiterlesen – viel Spaß noch bei euren Erwachsenenangelegenheiten.
Draußen pladderte der Regen vor sich hin. Drinnen versank ich in den Briefen. Dem, was E. schrieb, entnahm ich, dass Oma nach New York City gezogen war und sich dort pudelwohl fühlte, auch wenn ihm offenbar schleierhaft war, wie auch nur irgendjemand die Stadt toll finden konnte. An einzelnen Passagen blieben meine Augen hängen:
Was wir tun, braucht meine Mutter überhaupt nicht zu kümmern.
Eine Bäckerei, Ruth? Bist Du Dir da sicher?
Er erzählte ihr davon, dass er das Meer gemalt hatte: Mit Stolz vermelde ich: Mein Wandeln in den Fußspuren Monets wird immer ansehnlicher, wobei ich bezweifle, dass es mir je gelingen wird, das Licht auf der Wasseroberfläche wirklich einzufangen, selbst wenn ich für den Rest meines Lebens jeden Tag zum Pinsel greife. Doch keine Sorge – ich nehme die Herausforderung an. Der Speicher freut sich gewiss bereits darauf, mit meinen erbärmlichen Versuchen zugestellt zu werden.
Vor allem aber schrieb er davon, wie sehr sie ihm fehlte. Wie er sie im Garten vermisste, am Strand, in der Laube. Hunderte von Erinnerungen an sie schienen ihn zu quälen. Er schrieb: Nantucket ist nicht Nantucket ohne Dich.
Nantucket.
Der Ortsname zauberte mir das Bild einer winzigen Insel vor Cape Cod in den Kopf. Cape Cod war eine Halbinsel mit Küstenschutzgebiet und kleinen Städtchen, die als hakenförmiger Arm südöstlich von Boston in den Atlantik ragte. Doch obwohl die Gegend dort bei vielen Familien aus Massachusetts als Sommerurlaubsziel beliebt war, hatte Oma den Großteil ihres Lebens in New York verbracht. Wann war sie je auf Nantucket gewesen?
Ungeduldig sprang ich zum letzten Brief. (Ich war auch jemand, der gelegentlich das Ende eines Buchs zuerst las; dass ich sonderlich talentiert darin war, meine Neugier zu zügeln, konnte man mir wahrlich nicht nachsagen.) Er war kurz und beinahe sechs Jahre nach dem ersten verfasst – am 3. Mai 1958:
Ich werde Dir die Kette nicht schicken. Wenn Du sie willst, dann komm zurück nach Golden Doors und rede mit mir.
E.
Und verdammt noch mal, Ruth, wage es bloß nicht zu behaupten, dass es hier um irgendetwas anderes als Deinen verfluchten Stolz geht.
Das erwischte mich kalt. Was war passiert? Wann war aus den romantischen Briefen ein Streit auf Papier geworden?
Vermutlich die gerechte Strafe für mich, weil ich beim Lesen die Reihenfolge missachtet hatte. In der Hoffnung auf mehr Kontext öffnete ich den vorletzten Brief. Können wir uns persönlich darüber unterhalten? Der Telefonist weigert sich inzwischen sogar, mich durchzustellen. Du bist viel zu stolz, und das müsstest Du nicht sein.
Himmel, ein Telefonist. Was für eine Zeit.
Und der Brief davor:
Ruth,
das ist lächerlich. Ich nehme die nächste Fähre aufs Festland.
Tu nichts Dummes, ehe ich da bin. Ich liebe Dich.
Edward
Ein Schauder lief mir über den Rücken. Ich ließ den Brief sinken und starrte durch die Glastüren. Der Regen war schwächer geworden und verschleierte nicht mehr den Wald, der unseren Garten von allen Seiten zu verschlingen drohte. Hohe Eichen und Kiefern schossen in den Himmel, ihre Stämme schwarz vor Nässe. Wir hatten einen strengen Winter hinter uns, und sogar jetzt noch – Mitte März – konnte ich mir kaum vorstellen, dass es je wieder warm werden würde. Ebenso wenig, wie ich mir Oma als Achtzehnjährige vorzustellen vermochte. Du bist viel zu stolz, hatte der Briefeschreiber ihr vorgehalten. War Oma stolz gewesen? Elegant, ja. Intelligent, wissbegierig, ein wenig traurig, ein bisschen schwierig. Aber stolz?
Allerdings – was wusste ich schon? Ich hatte nicht einmal gewusst, dass Oma je auf Nantucket gewesen war. Ich hatte keinen blassen Schimmer, wer dieser Edward war oder welche Kette Oma zurückhaben wollte – oder weshalb sie ihn überhaupt verlassen hatte.
Komm zurück nach Golden Doors, hatte Edward verlangt.
Ich klappte meinen Laptop auf und fing zu tippen an.
Stunden später schwang die Haustür auf und Moms Stimme hallte durch das Haus. »Abby?«
»Hier!«
Sie kam ins Wohnzimmer, warf ihren Mantel über eine Stuhllehne. Dad folgte ihr. Er würde den Mantel später aufhängen. »Du bist noch wach.«
»Wie war die Versammlung?«
»Ach, ganz gut. Und was treibst du?« Sie ließ sich neben mich auf die Couch fallen. Dad küsste mich auf den Scheitel und ging in die Küche, um Tee zu kochen.
»Ich glaube, ich habe das Rätsel gelöst.« Ich reichte ihr die Briefe. »Der Verfasser unterschreibt mit ›Edward‹, und er erwähnt Golden Doors – so heißt ein Haus auf Nantucket. Der jetzige Besitzer des Hauses ist ebenfalls ein Edward, und er muss 1952 zweiundzwanzig Jahre alt gewesen sein. Oma war achtzehn. Gut möglich, dass sie einen Sommer mit ihm auf Nantucket verbracht hat.«
»Auf Nantucket?« Mom blätterte durch die Briefe. »Sie hat nie erwähnt, dass sie mal dort war.«
Ich zog beide Augenbrauen hoch. »Hättest du nicht von jemandem erfahren sollen, der an ›meine liebste Ruth‹ schreibt?«
Sie stieß mich mit der Schulter an. »Als ob Töchter je nach dem Privatleben ihrer Mütter fragen.«
»Hey, das ist fies. Ich weiß, mit wem du in der Highschool zusammen warst, und auch von dem Typen, mit dem du nach dem College durch Ecuador gereist bist.« Ich deutete auf eine geöffnete Website auf meinem Laptopbildschirm. »Ich habe überlegt, eine Mail zu schreiben und zu versuchen, Kontakt zu ihm aufzunehmen.«
Sie spähte auf den Screen. »Er hat Verbindungen zu Barbanel?«
»Das sagt dir etwas?«
»Barbanel ist eines der großen Wirtschaftsprüfungsunternehmen.«
»Ja, so viel hat das Internet mir auch verraten. Aber was genau machen Wirtschaftsprüfungsunternehmen?«
Sie lachte. »Sie kümmern sich um Vermögensberatung, Bilanzprüfungen, Steuern.«
»Also hat er keine Verbindungen zu Barbanel, sondern das Unternehmen gegründet. Es gehört ihm. Der Edward, von dem ich rede, ist Edward Barbanel.«
Nun schossen Moms Augenbrauen in die Höhe. »Tatsächlich? Ach. Na, das erklärt das Haus auf Nantucket.«
»Fändest du es in Ordnung, wenn ich versuche, ihn zu kontaktieren?«
Sie zögerte. »Wozu?«
»Wie meinst du das – wozu? Er kannte Oma, als sie jung war. Er könnte alles Mögliche wissen. Vielleicht weiß er mehr über ihre Familie.«
»Abby … Oma war so klein, als sie aus Deutschland geflohen ist. Sie wusste selbst kaum etwas über ihre Familie. Wie sollte da jemand anders im Bilde sein?«
»Weil die beiden ineinander verliebt waren! Und vielleicht hat sie früher über ihre Familie gesprochen. Vielleicht hat sie ihm in einem Brief etwas von ihrer Familie oder ihrer Heimatstadt erzählt.«
»Ich möchte nicht, dass du dir vergebliche Hoffnungen machst, irgendetwas über unsere Familiengeschichte aufzutun.«
»Okay, schön. Aber selbst wenn ich nichts in Erfahrung bringen kann – findest du es nicht komisch, dass sie auf Nantucket war und es nie erwähnt hat? Jedenfalls ist es doch seltsam, dass sie mit irgendeinem schicken reichen Kerl zusammen war, von dem wir nie etwas zu hören bekommen haben. Und wieso sollte ein reicher Typ eine Kette klauen?«
Ich kannte die Lebensgeschichte meiner Großmutter in groben Zügen: Mit vier Jahren war sie aus Deutschland fortgeschickt worden, zunächst nach Paris, anschließend mit dem Dampfschiff in die Staaten. Eine jüdische Familie im Norden New Yorks hatte sie bis zu ihrem achtzehnten Lebensjahr bei sich aufgenommen – dann war sie nach New York City gezogen. Sie hatte meinen Großvater geheiratet, der selbst ein deutscher Jude gewesen war, und die beiden waren wieder in den Norden des Bundesstaats umgesiedelt, hatten drei Kinder großgezogen und schließlich ihren Ruhestand in West Palm Beach verbracht. Mein Großvater war gestorben, Oma dement geworden und ins Pflegeheim gekommen. Hatte ihre Familie nicht mehr erkannt. Und dann war auch sie gestorben.
Ich hatte meine Mom nur ein einziges Mal im Leben weinen sehen: als wir den Anruf mit der Nachricht von Omas Tod bekommen hatten.
»Was tut das zur Sache?«, fragte Mom. »Hätte sie gewollt, dass wir über diesen Mann oder Nantucket Bescheid wissen, hätte sie uns davon erzählt.«
»Bullshit. Du bist bloß sauer, dass sie dir eben nicht davon erzählt hat, deshalb tust du jetzt so, als wäre es dir egal.«
Mom wirkte überrumpelt. Dann drückte sie mir einen Kuss auf die Schläfe. »Danke für Ihre Diagnose, Dr. Schoenberg.«
»Ich habe recht, und das weißt du. Also hast du nichts dagegen, dass ich ihn zu erreichen versuche?«
»Nur zu.«
In den folgenden Tagen vertiefte ich mich in Edward Barbanels Leben. Er hatte Barbanel von der erfolgreichen lokalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die in den 1950ern bereits auf eine einhundertfünfzigjährige Tradition zurückblicken konnte, zum gigantischen internationalen Konzern ausgebaut, der jedoch nach wie vor in privater Hand war. Laut einer Hochzeitsanzeige in der New York Times hatte Edward im selben Jahr geheiratet, in dem er seinen letzten Brief an Oma geschrieben hatte, mit den Worten Tu nichts Dummes, ehe ich da bin. Ich liebe Dich. An seinem achtzigsten Geburtstag hatte er die Leitung der Geschäfte in die Hände seines Sohnes gelegt.
Wie sich herausstellte, war es alles andere als leicht, mit dem Vorstandsvorsitzenden eines extrem wohlhabenden Unternehmens in Kontakt zu treten. Mails, Anrufe und Textnachrichten blieben ausnahmslos unbeantwortet. Nun ja. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
»Ich habe in der Bibliothek mit Ms Chowdhury gesprochen«, erzählte ich meinen Eltern beim Frühstück, zwei Wochen nachdem Omas Paket angekommen war. »Ihre Schwägerin hat einen Bekannten, der mit jemandem befreundet ist, dessen Tochter eine Buchhandlung auf Nantucket gehört. Sie meinte, sie könne mir dort eventuell einen Ferienjob für den Sommer besorgen.«
Mom prustete praktisch ihren Kaffee über den Tisch. »Was?«
»Das waren ja ganz schön viele Verbindungen«, stellte Dad fest. »Hast du sie dir alle gemerkt oder ein paar gerade erfunden?«
»Da ich Edward Barbanel anders nicht erreiche, habe ich mir überlegt, ich gehe einfach zu ihm.«
»Du fährst nicht für den kompletten Sommer nach Nantucket.«
Dad seufzte. »Mir hört mal wieder niemand zu.«
»Wieso nicht? Ich brauche ohnehin noch einen Ferienjob.«
»Aber nicht auf Nantucket.« Moms Stimme wurde um mehrere Dezibel lauter. »Findest du nicht, du übertreibst ein wenig? Was ist mit der Bibliothek? Du arbeitest doch gern dort!«
»Denk mal daran, wie gut das in einem Bewerbungsschreiben fürs College klingen würde. Du weißt, wie irre hoch die Ansprüche für ein Stipendium sind.« Und ich brauchte ein Vollstipendium, um mir eine Privatuni leisten zu können; meine Noten waren zwar nicht zu beanstanden, doch ein schlagkräftiger Essay konnte den Unterschied machen. Vor allem, wenn ich darin belegte: Ich war so fest entschlossen, Geschichte zu studieren, dass ich meinen gesamten Sommer damit zugebracht hatte, die Historie meiner Familie aus Primärquellen zu erforschen. Solches Engagement würde die Zulassungsbehörde hoffentlich mächtig beeindrucken – und, ganz ehrlich, das hatte ich nötig. Insbesondere für angehende Historiker wurden Stipendien nicht gerade mit vollen Händen verteilt.
»Liebling …«
Okay, schon möglich, dass ich am Ende so oder so kein Stipendium bekommen würde, doch das wollte ich jetzt nicht hören. »Niko und Haley und Brooke sind sowieso diesen Sommer nicht da. Wieso sollte ich dann hierbleiben?«
Moms Miene glättete sich, als hätte sie schlagartig begriffen. »Es geht eigentlich um Matt, nicht wahr? Abby, mir ist klar, dass dich das verletzt hat –«
»Oh mein Gott, Mom, nicht alles hat mit irgendeinem blöden Jungen zu tun.« Obwohl ich zugegebenermaßen Matt wirklich nicht sehen wollte, besonders nachdem er mich erst abserviert und dann so großzügig angeboten hatte, wir könnten »befreundet« bleiben.
Dad griff wohlweislich nach seiner Teetasse und zog sich in ein anderes Zimmer zurück.
»Bist du sicher? Du hast die Briefe zwei Wochen nach eurer Trennung gelesen. Du bist wie besessen davon. Man kann nicht vor allem davonlaufen, Abby.«
Mein Magen krampfte sich zusammen, krallte sich eng um den Schmerz in meiner Mitte. »Ich will nicht darüber reden.«
»Abby, Schatz –« Moms Gesichtszüge wurden weich und sie streckte die Arme nach mir aus.
Ich wich ihr aus. »Ich bin siebzehn. Ich bezahle die Reise selbst – und nächstes Jahr ziehe ich fürs Studium eh aus. Außerdem habe ich ja nichts Gefährliches vor.«
»Ich verstehe nicht, weshalb dir das so wichtig ist!«
»Und ich verstehe nicht, weshalb du das nicht kapierst! In Omas Leben klafft eine riesige Lücke.«
»Wie wäre es mit einem Kompromiss – wir fahren für ein Wochenende?«
»Mom, ich will diesen Sommer nicht hier sein!«
Sie erstarrte. Ihr nächstes Wort klang zart und klein. »Oh.«
Sofort wallte Reue in mir auf. Wir waren so eng miteinander verflochten, Mom und ich, wie emotionale Zwillinge: Was die eine fühlte, empfand sofort auch die andere. »Es tut mir leid. Es ist bloß – ich möchte mehr über Oma herausfinden. Du etwa nicht? Bist du denn kein bisschen neugierig?«
Sie zuckte mit einer Schulter, eine Geste, die mich an ihre Mutter erinnerte. »Sie hat mir nichts verraten, also wüsste ich nicht, weshalb es mich etwas angehen sollte.«
Diese Gleichgültigkeit kaufte ich ihr nicht ab. Du bist viel zu stolz, hatte E. geschrieben. Vielleicht war Oma da nicht die Einzige.
Mein ganzes Leben lang hatte ich mitangesehen, wie verletzt Mom reagierte, wenn Oma wieder einmal die Schotten dicht machte. Die Beziehung der beiden war belastet gewesen – auf eine Art und Weise, wie wir beide es nie erlebt hatten, voll angespanntem Schweigen und Ist doch egal und Das gehört sich nicht. Schon möglich, dass Mom das, was sie mir gegenüber behauptete, tatsächlich so meinte: Wenn Oma ihr etwas nicht hatte anvertrauen wollen, dann interessierte es sie auch nicht.
Aber ich glaubte nicht daran. Ich kannte meine Mutter; ich hatte den Ausdruck in ihren Augen gesehen, als wir gemeinsam die Briefe gelesen hatten. Oma war ihr so, so unendlich wichtig. Sie mochte zu stolz sein, um nach der Vergangenheit ihrer Mutter zu forschen, aber ich hatte keinen Grund, so zu tun, als wäre mir das alles einerlei. Ich konnte diese Aufgabe für sie übernehmen. Nach Nantucket fahren. Edward Barbanel finden. Omas Geschichte aufdecken.
Und was hatten meine Eltern dem letztendlich entgegenzusetzen? Einem netten Sommerjob in einer netten Buchhandlung in einer netten Stadt? Eine von Moms Kolleginnen hatte sogar eine Tante auf Nantucket, die ein Zimmer frei hatte (oder zumindest ein Bett in einem Zimmer, und ich hatte kein Problem damit, mir den Raum mit jemandem zu teilen). Also brachten meine Eltern mich nach Hyannis zur Fähre. (Dave kam auch mit, war aber die meiste Zeit mit Videospielen beschäftigt.) Mom fragte immer und immer wieder, ob ich meine Zahnbürste und die Vitamintabletten und die Aknecreme eingepackt hatte, bis ich herausplatzte, ich sei keine Idiotin, woraufhin sie furchtbar traurig dreinschaute und ich mir wie ein Ungeheuer vorkam. Sie standen am Kai und sahen mir nach. Dad schlang seinen Arm um Moms Schultern, und sie lehnte sich an ihn. Zum ersten Mal wirkten sie klein auf mich. Sie winkten und winkten und ich winkte zurück, unsicher, was passieren würde, wenn ich mich als Erste abwandte – ob es besser oder schlimmer wäre, das Band selbst zu kappen.
2.
DIE FÄHRE durchschnitt den Atlantik mit Hochgeschwindigkeit. Ich legte den Kopf in den Nacken, genoss die Sonnenstrahlen, die sich über meine Haut ergossen und die Rückseite meiner Augenlider rot-golden färbten. Salziger Wind spielte mit meinem Haar und peitschte mir einzelne Strähnen in den Mund. Eine helle, azurblaue Welt umgab mich, nichts als endloser Ozean und wolkenloser Himmel.
Ein kleines Geständnis: Mom hatte recht. Ich lief vor Dingen davon.
Eine Gewohnheit, die schwer abzulegen war, wenn doch das Gefühl, unterwegs zu sein, mich glücklicher machte als alles andere. Ich hatte kein Problem damit, etwas hinter mir zu lassen – denn das bedeutete: keine Altlasten, aber auch keinerlei Erwartungen. Die Welt um mich herum war voller Potenzial, so vieles war möglich. Ich konnte neu anfangen. Alles konnte passieren. Irgendetwas würde passieren.
Im besten Fall etwas, das mich von Matt ablenken würde.
Rückblickend hätte mich seine Entscheidung, Schluss zu machen, nicht überrumpeln sollen. »Ich muss mich jetzt konzentrieren, verstehst du?«, hatte er am letzten Tag der Winterferien im Februar gesagt, als wir Burrito Bowls essen waren. »Harvard ist echt wählerisch, besonders bei Bewerbern, die aus demselben Bundesstaat kommen. Die Verantwortlichen wollen eine möglichst breit gefächerte Studentenschaft, nehmen also lieber Kandidaten aus Kansas oder so.«
»Aus Kansas.« Zwei Sekunden zuvor hatten wir noch überlegt, wann wir uns den neuesten Blockbuster im Kino ansehen sollten. Nun beobachtete ich Matt dabei, wie er sich Reis und Bohnen in den Mund schaufelte, während meine eigene Portion mir wie Blei im Magen lag. Er beendete unsere Beziehung – wegen irgendwelcher intellektueller Überflieger aus Kansas?
»Und ich muss mehr interessante Sachen machen, wie zum Beispiel das Praktikum bei diesem Start-up. Ich habe keine Zeit für Mädchen. Ich mag dich«, sagte er, der einzige Junge, der mich je oben ohne gesehen hatte. »Aber … du weißt schon.«
Ich hatte geglaubt, wir würden eines Tages heiraten. Auch wenn ich von der Ehe als Institution eher wenig hielt, hatte ich mir uns beide dennoch unter einem weißen Traubaldachin vorgestellt. »Na, du klingst entschieden.«
Er nickte und deutete dann auf die restlichen Chips auf meinem Teller. »Willst du die noch?«
»Nur zu.« Ich schob sie zu ihm hinüber. »Tja, prima, also dann – ähm, danke fürs Bescheidgeben. Wir sehen uns morgen in Psychologie.«
Er sprach mit vollem Mund: »Du musst nicht gehen. Wir können darüber reden, wenn du magst.«
»Worüber genau sollen wir reden?« Schweißperlen sammelten sich auf meiner Stirn. Mir war nicht einmal bewusst gewesen, dass ich dort schwitzen konnte. »Du hast eine Entscheidung getroffen. Schön für dich, ich bin froh, dass du dich selbst gut genug kennst, um dir sicher zu sein, dass du nicht mit mir zusammen sein möchtest. Großartig. Ich will auch nicht mit jemandem zusammen sein, der nicht mit mir zusammen sein will, von daher … sind wir nicht mehr zusammen. Ciao.« Ich rutschte linkisch aus der Sitznische und stolzierte so würdevoll davon, wie ich es nur zustande brachte.
Vielleicht war Stolz doch vererblich.
Ein Schiffshorn ertönte, und andere Leute gesellten sich eilig zu mir an die Reling. Am Horizont war ein Streifen Land in Sicht gekommen, und schon bald ließen sich verschwommene Details ausmachen: winzige graue Häuser, massenweise grüne Bäumen, die Spitzen von Kirchtürmen. Unsere Fähre umkurvte eine sandige Landzunge, auf der ein gedrungener Leuchtturm thronte, und lief dann in einen malerischen Hafen ein – so schön, dass es fast wehtat. Dutzende unterschiedlicher Boote schaukelten auf dem Wasser und Robben wärmten sich auf den hölzernen Stegen. Über uns schrien die Möwen, segelten durch den blauen Himmel, der inzwischen mit Wattebauschwölkchen getüpfelt war. Die ersten Passagiere machten sich zum Landgang bereit.
Nantucket. Sommerdomizil einiger der reichsten Bürger Amerikas. Mein Zuhause für die nächsten paar Monate.
Der Strom meiner Mitreisenden schwemmte mich auf den Kai, der nahtlos in die gepflasterten Straßen des Stadtzentrums überging. Laubbäume säumten die Bürgersteige und amerikanische Flaggen wehten rechts und links. Kleiderboutiquen und Eisdielen reihten sich aneinander, und die Menschen, die durch den idyllischen Stadtkern schlenderten, wirkten sonnenverwöhnt und glücklich.
Ich umklammerte fest den Griff meines Rollkoffers, während ich ihn an gut gekleideten Schaufensterpuppen und nautischem Nippes vorbeizog, unter handbemalten Schildern hindurch, die an Auslegern hin- und herschwangen. Nantucket erschien mir wie die EPCOT-Version Amerikas, großartig und grotesk zugleich. Ich war Alice im Kaninchenloch, Lucy auf der anderen Seite des Wandschranks, Dorothy nicht mehr in Kansas. Ich hatte die Insel gegoogelt, doch das hatte mich kaum wirklich auf all das hier vorbereitet.
Erfahren hatte ich allerdings einiges über die allgemeine Geschichte Nantuckets: Nachdem die Wampanoag hier zuerst gesiedelt hatten, war die Bevölkerung im frühen 17. Jahrhundert sprunghaft angewachsen, als die Einwohner Massachusetts’ vor Krankheiten und militärischen Übergriffen vom Festland auf die sichere Insel flohen. Die Briten folgten ihnen jedoch kurze Zeit später, und bis in die 1760er-Jahre rafften Seuchen den Großteil der Wampanoag auf der Insel dahin. Dann kamen die Quäker, danach die Walfangflotten, daraufhin die Reichen, die blieben und sich Nantucket zu eigen machten.
Geschichte hatte mich schon immer begeistert, doch mir war erst vor einem knappen Jahr klar geworden, dass man so etwas auch studieren konnte. Das schien mir zu einfach, es kam mir geradezu verboten vor. Im Sinne von: Ich konnte in die Uni gehen und dort einfach Geschichten lesen von Menschen aus der Vergangenheit? Das war irre. Ich tat buchstäblich nichts lieber, als mich in Wikipedia-Artikel über vergangene Hochkulturen und Herrscherinnen und die Belle Époque zu vergraben. Ich hatte sämtliche Werke von Stacy Schiff und Erik Larson gelesen. Die Vorstellung, einen Bewerbungsaufsatz zu schreiben, reizte mich allen Ernstes, sofern das bedeutete, dass ich meine Familiengeschichte zum Thema machen konnte.
Also – falls ich denn etwas herausfand, worüber es sich zu schreiben lohnte.
Mit einem Auge auf die Wegbeschreibung in meinem Handy bog ich an einem prächtigen Herrenhaus aus Backstein ab und ging immer schmalere Straßen entlang, bis ich eine enge Gasse erreichte. Entlang der einen Straßenseite drängten sich grau geschindelte Häuser aneinander, umgeben von kleinen Rasenflächen und Rosenbüschen. Eine urtümliche Küstenatmosphäre umwehte diese verwitterten Häuschen mit ihren amerikanischen Flaggen und den Schildern im Vorgarten, auf denen All You Need Is Love And The Beach oder Home Is Where The Beach Is stand.
Ich blieb an einem Haus mit einer Holzplakette stehen, auf der der Name Arrowwood Cottage prangte. Winzige weiße Blüten waren in die Ecke geschnitzt. Ich hievte meinen Koffer die drei Stufen zur Eingangstür hinauf, atmete tief durch und drückte auf den Klingelknopf.
Eine ältere Frau öffnete; sie trug eine weich fließende violette Tunika und das silbergraue Haar zu einem Bob geschnitten. Mundgeblasene runde Glasohrringe baumelten von ihren Ohrläppchen. »Hallo.«
»Hi. Mrs Henderson?« Ich hatte ihre Nichte – Moms Kollegin – einige Male getroffen, als Mom mich zu irgendwelchen Collegeveranstaltungen mitgeschleppt hatte. Die vage vertrauten Züge der Frau, die nun vor mir stand, nahmen mir ein wenig meine Befangenheit. »Ich bin Abby Schoenberg.«
»Aber natürlich. Bist du gerade angekommen?«
»Jep. Ja. Mit der Fähre aus Hyannis. Meine Eltern haben mich hingebracht.« Ich folgte ihr ins Haus. Links lag die Küche, offen und luftig; rechts erhaschte ich einen Blick auf ein Wohnzimmer mit Regalen voller Bücher. Ein Golden Retriever sprang vom Teppich auf, bellte scharf und stellte die Schlappohren. Die Hündin hatte ein Fell wie gebräunte Butter, und die langen, schlaksigen Beine verrieten mir, dass sie noch nicht ausgewachsen sein konnte.
»Das ist Ellie Mae«, sagte Mrs Henderson. »Komm schon, Ellie, das ist eine Freundin.«
Die Hündin bellte noch einmal, trottete dann auf mich zu und schob ihre Nase in meinen Schritt. Ich beugte mich schützend vornüber und umfasste ihren schmalen Kopf. Sie hatte sanfte Augen und weiche Fellbüschel hinter den Ohren und an den Achseln. »Hi, mein Mädchen.«
Ellie Mae leckte mir über das Gesicht und hauchte mir ihren fürchterlichen Hundeatem entgegen.
Mrs Henderson lachte. »Sie ist der miserabelste Wachhund der Welt.«
Ich hatte schon viele miserabelste Wachhunde der Welt getroffen und liebte sie alle. »Wie alt ist sie?«
»Achtzehn Monate. Magst du Hunde?«
»Ich liebe sie abgöttisch. Meine Großmutter hat einen Beagle.« Dads Mom überschüttete ihren Hund sogar mit noch mehr Zuneigung als mich und meinen Bruder.
»Ich habe schon immer Golden Retriever, aber eine gute Freundin von mir hält Jagdhunde. Die solltest du mal beim Vorstehen erleben.« Sie lächelte zärtlich und winkte mich dann weiter. »Ich führe dich herum.«
Ellie Mae trottete uns treu hinterher, während Mrs Henderson mir das Haus zeigte. Neben Küche und Wohnzimmer gab es im Erdgeschoss ein Esszimmer und ein Büro, das auf einen eingezäunten Garten hinausging. Im ersten Stock gewährte sie mir einen Blick in ihr Schlafzimmer und das Arbeitszimmer ihres verstorbenen Ehemanns. Sie lächelte ein wenig selbstironisch. »Manchmal überlege ich, dieses Zimmer ebenfalls zu vermieten, aber bisher habe ich es nicht übers Herz gebracht.«
Um in den zweiten Stock zu gelangen, erklommen wir eine enge Treppe, deren Stufen zur Mitte hin ausgetreten waren. Oben empfing uns ein gerader Flur, in den aus Fenstern an beiden Enden Licht fiel. Mrs Henderson stieß eine Tür auf. »Da sind wir.«
Weiße Wände strahlten aus einem winzigen Raum mit schräger Decke. Ein ovaler Flechtteppich in Blau und Weiß lag auf dem hellen Holzfußboden. Eines der beiden breiten Betten war ordentlich mit weißen Laken und einer Steppdecke bezogen, das zerwühlte zweite mit Klamotten überhäuft. Ein Nachttisch mit türkisfarbener Lampe stand unter dem Fenster zwischen den beiden Betten.
»Das hier war früher, als das Haus neu gebaut war, die Kammer des Hausmädchens. Ich habe allerdings versucht, es ein wenig hübscher herzurichten.«
»Es ist großartig.« Ich rollte meinen Koffer zu dem freien Bett und spähte aus dem Fenster. Unten erkannte ich Mrs Hendersons Garten – haufenweise violette Blumen und eine verzierte Vogeltränke – und auch den der Nachbarn, da die Häuschen derart dicht beieinanderstanden. »Vielen, vielen Dank.«
»Das Bad ist gleich über den Flur – du musst es dir lediglich mit Jane teilen. Das andere Zimmer hier oben ist ein Abstellraum.« Sie reichte mir einen Schlüssel. »Willkommen auf Nantucket.«
Nachdem sie gegangen war, hängte ich meine Kleider in den Schrank im Flur und reihte meine Schuhe unter dem Bett auf. Ich stopfte Pferd, meinen Kindheitsgefährten, unter die Laken. Der Anblick einer zerschlissenen Stoffkatze auf dem Kissen meiner neuen Mitbewohnerin tröstete mich ein wenig.
Ich hatte es getan. Ich war hier.
Und jetzt?
Gedämpfte Ausgelassenheit schwebte durch das offene Fenster. Zu Hause waren Sommerabende stets nur vom immer gleichen Zirpen der Grillen erfüllt, einer weitaus ruhigeren Geräuschkulisse. Hier schien der Lärm mich am Ärmel zu zupfen, er gab mir das Gefühl, ich sollte dort draußen sein und lachen und kreischen und leben.
Okay. Ich fühlte mich bloß komisch, weil ich einsam war, und das würde sich ändern, sobald ich in zwei Tagen meinen Job antrat. Kein Grund, meine Entscheidung in Zweifel zu ziehen. Natürlich war sie richtig gewesen. Die letzten drei Monate hatte ich mich an die Vorstellung von Nantucket geklammert wie an einen Rettungsring. Unmöglich, sich so nach etwas zu sehnen – zu verzehren – und dann einfach nur Leere zu empfinden, sobald man es erreicht hatte.
Oder?
Ich kam mir vor, als hätte ich Mom im Stich gelassen.
Ich wusste, dass das genau genommen nicht stimmte; sie hatte Dad, der ziemlich kompetent im Umgang mit Menschen war (wenn auch nicht ohne Einschränkungen – stellte man ihm beim Gehen eine besonders heikle Frage, hielt er buchstäblich auf der Stelle inne, um darüber nachzudenken, und man musste umdrehen und ihn dort abholen). Und sie hatte ihre Freundinnen aus der Synagoge und ihre beste Freundin vom College und Freunde aus ihrer Children-of-Survivors-Ortsgruppe und die Eltern meiner Freunde, mit denen sie sich angefreundet hatte. Und wohl auch Dave, meinen Bruder.
Nun, da ich es recht bedachte: Mom hatte jede Menge Leute. Allerdings hegte ich den Verdacht, dass ihr das manchmal selbst nicht bewusst war. Manchmal schien sie zu glauben, sie sei ganz allein.
Was freilich nicht stimmte. Sogar ohne all diese anderen hatte sie immer noch mich.
Aber nun hatte ich sie ja verlassen.
»Reiß dich zusammen«, murmelte ich und ließ mich auf mein neues Bett sinken. Schultern nach hinten. Tiefe Atemzüge. Ich überlegte, Mom anzurufen, doch sie würde meine Panik spüren. Dann würde auch sie in Panik geraten, und letztlich würden wir beide in einen immer schneller rotierenden Panikstrudel gezogen werden. Also schickte ich ihr stattdessen ein fröhliches Selfie und wählte Nikos Nummer.
Das Gesicht meiner besten Freundin füllte das Display meines Handys aus, gerahmt vom Zimmer eines Studentenwohnheims in Stanford. »Hey! Bist du angekommen? Wie ist es?«
»Strand, wohin man schaut – unglaublich! Und überall Rosen. Moment mal – trägst du Lippenstift? Sind das Ponyfransen?«
»Sexy, oder?« Niko drehte den Kopf, damit ich ihren High-Low Cut und den schnurgeraden Pony, der ihr in die Stirn fiel, bewundern konnte. »Ich erfinde mich selbst neu.«
»Du siehst fantastisch aus.«
»Ich weiß. Ich habe mir gedacht, hier hat ja niemand eine Ahnung davon, dass ich noch nie im Leben Lippenstift aufgelegt habe, also – wieso nicht? War dir klar, dass man unter dem Lippenstift noch Lippenprimer auftragen muss? Was zur Hölle soll das?«
»Wie ist Palo Alto?«
»Alle fahren überall mit dem Fahrrad hin, schauen ordentlich nach rechts und links, ehe sie über die Straße gehen, und die Highways heißen hier Freeways – irgendwie süß, oder? Und wie ist das noble Inselleben? Trägst du schon Cardigans und Perlenketten? Sind alle dort weiß?«
Ich schnitt eine Grimasse. »Ich kriege hier gerade die Krise. Was tue ich hier? Was soll ich hier?«
»Tief durchatmen! Du bist ja buchstäblich erst seit zwei Sekunden da.«
»Was, wenn ich keine Freunde finde? Wie hast du denn im Programmiercamp Anschluss bekommen? Wir haben keine neuen Leute mehr kennengelernt, seit wir sechs waren!«
Niko runzelte die Stirn. »Und wen haben wir mit sechs kennengelernt?«
»Das war eine aus der Luft gegriffene Zahl.«
»Anisha ist nach South Hadley gezogen, da waren wir zwölf – somit ist sie vielleicht unsere neueste Freundin.«
»Nikoooo.«
»Okay.« Nikos Miene wurde wieder ernst. »Betrachte das Ganze als Vorübung fürs College. Du triffst Leute, und du kannst sein, wer immer du willst – auch du kannst dich neu erfinden. Konzentrier dich nicht nur auf deine Grandma … du bist nämlich siebzehn, nicht siebzig. Flipp aus. Trau dich was. Was sagt dein Dad immer? Hab ein bisschen Chuzpe!«
»Mein Dad ist ohne Übertreibung der größte Nerd, der auf der Erde herumläuft.«
»Ich liebe deinen Dad. Weißt du noch, wie aus dem Häuschen er war, als du ihm erlaubt hast, als Elternbegleitung mit auf unseren Klassentrip ins Aquarium zu kommen?«
»Erinnere mich nicht daran.«
»Er war so hingerissen von den winzigen Pinguinen. Ich fand das so rührend.«
Als wir auflegten, fühlte ich mich bereits besser. Schön und gut: Ich hatte mich also auf eine Insel dreißig Meilen vor der Küste verfrachtet, wo ich niemanden kannte. Aber keine Panik. Es gab schließlich Videoanrufe und Atemübungen und Handtücher.
Um kurz nach neun flog die Tür auf und ein Mädchen rauschte herein, mit einem Wirrwarr winziger schwarzer Zöpfchen auf dem Kopf und jeder Menge Mehl auf dem T-Shirt. Sie hatte mehrere Ohrlöcher auf jeder Seite, dunkle Haut, und war sicher zehn Zentimeter größer als ich. Abrupt blieb sie stehen. »Hi.«
»Hi!« Ich setzte mich ruckartig auf. »Du musst Jane sein.«
»Jep. Und du bist Abigail?«
»Abby.«
»Cool. Und du arbeitest im Prose Garden, stimmts?« Sie riss sich das T-Shirt vom Leib und zog ein rotes Top über. »Tut mir leid, dass ich so wüst ausschaue – ich komme direkt von meiner Schicht.«
»Oh? Wo arbeitest du denn?«
»In der Bäckerei meiner Tante.« Sie wandte sich zum Spiegel und zog zwei perfekt geschwungene Lidstriche. »Ich war schon im letzten und vorletzten Sommer hier, um ihr zu helfen – und auch, um meinen Brüdern und Schwestern zu entkommen. Ein Glück, dass Mrs Henderson dieses Zimmer vermietet. Ich lebe in Rhode Island. Und du?«
»South Hadley – das ist im Westen von Mass-«
»Ah, schön, ich denke, ich bewerbe mich da am Smith College.« Sie drückte den Rücken durch. »So, tut mir leid, dass ich hier so hineinfege und gleich wieder weg bin, aber ich muss mich sputen.«
»Oh.« Ich tat mein Bestes, nicht enttäuscht zu wirken. Das Letzte, was ich wollte, war, dass meine Mitbewohnerin mich für eine Klette hielt. »War nett, dich kennenzulernen.«
Sie zögerte. Ein Raum tat sich zwischen uns auf, angefüllt mit Risiken und Möglichkeiten. Ich war eine unbekannte Größe, übereifrig und womöglich zu anstrengend. Sie hatte ihr Leben, hatte Freunde und Pläne und keine Verpflichtungen gegenüber einer Fremden.
Und trotzdem bot sie mir eine Gefälligkeit an. »Willst du mitkommen? Ich treffe mich mit ein paar Freunden am Strand. Wir machen ein Lagerfeuer.«
Erleichterung und Dankbarkeit durchfluteten mich. Die Angst, die mich den ganzen Abend lang eingesponnen hatte, löste sich langsam auf. »Sehr gern.«
Die untergehende Sonne färbte den Himmel königsblau, während wir zu Fuß aus dem Städtchen schlenderten, die North Beach Street und die Bathing Beach Road hinunter. Sand reichte bis an den Bürgersteig und schimmerte auch unter dem spärlichen Gras hervor. »Erzähl mal, wie hat es deine Tante nach Nantucket verschlagen?«, fragte ich meine neue Zimmergenossin. »Hat sie einfach eines Tages beschlossen, hier eine Bäckerei zu eröffnen?«
Jane lachte. »Himmel, nein. Wir sind von hier.«
»Ernsthaft? Das ist so was von cool!«
»Ja, die azorische beziehungsweise portugiesische Gemeinde auf Nantucket ist gar nicht mal so klein. Die beiden Regionen liegen auf demselben Breitengrad, daher haben sie früher viel Handel miteinander getrieben.« Sie deutete auf die kugeligen blauen Blüten, die mir zuvor schon auf der ganzen Insel aufgefallen waren. »Es heißt, die Hortensien hier stammen ursprünglich von den Azoren, die zwischen Nantucket und Portugal liegen. Das erste Land, auf das man stößt, wenn man von hier aus nach Osten segelt.«
Die Straße mündete schließlich in den Strandparkplatz und wir stapften hinüber auf den Sand, das Wasser vor uns dunkel und endlos. Der Mond hing tief am Himmel, halbvoll und buttergelb. Wir streiften die Sandalen von den Füßen, und winzige Sandkörnchen kitzelten meine Sohlen. Jane lotste uns an Menschengrüppchen vorbei, bis wir an einem Lagerfeuer mit Jugendlichen unseres Alters anlangten, die aus roten Plastikbechern tranken. Sie trugen Pullover mit Zopfmuster und gestreifte T-Shirts und Shorts in Nantucket-Rot. Ihr Gelächter verschmolz mit dem Geräusch der schwachen Brandung, die leise über den harten Sand schrappte.
Jane bahnte sich einen Weg durch die Menge und ich folgte ihr. Ich hatte geglaubt, Teenager-Strandpartys gebe es nur in Filmen, doch die Szene passte in mein Herz wie ein Puzzleteil, das an der richtigen Stelle eingesetzt wird. Dafür waren Sommernächte gemacht: um die Zehen im Sand zu vergraben, den anbrandenden Wellen zu lauschen, den Duft nach Salz und Algen und brennendem Holz einzuatmen. Trau dich was.
»Ein Bier für dich?« Jane reichte mir einen Plastikbecher.
Ach ja. Alkohol. Alles klar. Ich war ein Teenager und wir tranken Alkohol. Okay … ich trank eigentlich nicht, denn bei meinen Freundinnen und mir standen eher Übernachtungspartys mit Romantikkomödien und selbst kreierten Brownie-Eisbechern hoch im Kurs. Außerdem: Was, wenn ich unter Alkoholeinfluss zur Jammerliese wurde, die heulend in einer Ecke hockte?
Aber. Zum Teufel mit dem langweiligen Mädchen von nebenan. Zum Teufel mit Regeln und Gesetzen. Zum Teufel mit Matt – sein Problem, dass er mich abserviert hatte.
Das Problem deiner Generation, meinte Mom immer, ist, dass ihr alle zu regeltreu seid. In ihrer eigenen Jugend war sie dafür berüchtigt gewesen, jegliche Regeln zu ignorieren. Ich verspürte den irrwitzigen Drang, ihr ein Bild von mir mit dem Bier in der Hand zu schicken, kam jedoch rechtzeitig zur Besinnung. Vermutlich hatte sie ausdrücken wollen, dass meine Generation sich in zivilem Ungehorsam üben sollte, nicht aber betrunken am Strand herumlungern.
Wie auch immer.
Ich nahm einen Schluck von der blassgelben Flüssigkeit und spuckte sie beinahe wieder aus. Wow. Okay. Zum Teufel auch mit Bier.
»Das ist Abby.« Jane zog mich in eine Dreiergruppe. Sie nickte zu einem nicht besonders großen weißen Mädchen mit stylischer Brille und Lederjacke hinüber. »Lexi, meine ehemalige Zimmergenossin, die mich im Stich gelassen hat.«
»Vergib mir«, erwiderte Lexi, und in ihrem ironischen Tonfall klang eine irritierend ernste Note mit.
»Ich schätze, du hattest gute Gründe. Ist Stella schon hier?«
»Sie kommt morgen an.«
Jane beschrieb mit ihrem Becher in der Hand eine ausgreifende Armbewegung, die die anderen im Kreis erfasste: einen schwarzen Jungen in blassgrünem Karohemd und Khakihosen und einen Typen mit südasiatischen Zügen. »Evan ist aus Boston und unser Vorzeigekind aus reichem Haus. Pranav stammt aus London und macht hier ein Praktikum in einem Architekturbüro.«
Beide Jungen nickten mir zu.
»Hi.« Ich umklammerte meinen Plastikbecher wie eine Rettungsdecke. Meine Freunde und ich hatten die gleichen Ecken und Kanten, passten zusammen wie Bruchstücke zersprungener Keramik. Was sollte ich hier anfangen? Mich in Gaze hüllen, damit ich niemanden schnitt – oder würde mich das so abstumpfen, dass ich überhaupt keine eigene Form mehr hatte?
Ich nahm noch einen Schluck Bier. Es schmeckte nach wie vor grauenhaft. Nun ja.
Der Alkohol enthemmte mich allerdings wohl wirklich ein wenig, oder vielleicht waren Janes Freunde einfach genial, denn innerhalb von fünf Minuten war ich in die Gruppe integriert und wir fanden uns inmitten einer hitzigen Debatte wieder: Könnten wir die Erde verlassen und im Raumschiff nur drei Sorten Käse mitnehmen – welche müssten das sein?
»Mozzarella«, meinte Jane entschieden. »Ohne Mozzarella kann man keine Pizza backen.«
»Scharfen Cheddar«, sagte ihre alte Zimmergenossin Lexi. »Und vielleicht noch Brie oder Camembert. Aber ein guter Parmesan wäre auch recht nützlich.«
»Und wie steht es mit amerikanischem Käse?«, fragte Evan.
Jane starrte ihn an. »Soll das ein Witz sein? Du kannst nur drei Sorten mitnehmen, die du für den Rest deines Lebens essen wirst, und du denkst an amerikanischen Käse?«
»Mir schmeckt er!«
»Kommt darauf an, was man sonst noch mitnimmt«, warf Pranav diplomatisch ein. »Und außerdem: Panir.«
»Stimmt – Brie wäre blöd ohne Baguette«, überlegte Lexi.
»Baguette kannst du definitiv nicht mitnehmen«, entschied Evan. »Wir reden hier vom Weltraum! Krümel!«
»Zählt Frischkäse als Käse?«, wagte ich einen Vorstoß. »Ich würde mich nämlich wirklich ungern für immer von Bagels verabschieden.«
Die Gruppe musterte mich fassungslos, und kurz bereute ich, den Mund aufgemacht zu haben, überzeugt, dass mein Kommentar schrecklich peinlich gewesen war.
»Oh Mann!«, stöhnte Lexi nach einer kurzen Weile. »An Frischkäse habe ich nicht mal gedacht.«
»Guter Einwurf«, meinte Evan ernst. »Und es gibt ja auch Teigteilchen mit Frischkäseglasur.«
»Wenn wir ins Weltall fliegen, haben wir ganz sicher keine Zeit für Teigteilchen«, protestierte Jane.
»Teigteilchen machen mich glücklich, Jane«, widersprach Evan. »Willst du mir das verwehren?«
Langsam entspannte ich mich und lachte schließlich mit den anderen, wir lachten und neckten uns gegenseitig und ich fühlte mich zugehörig und war – zum ersten Mal seit meiner Ankunft – froh, hier zu sein.
»Du studierst also Architektur«, wandte ich mich später, als ich den Boden meines Plastikbechers bereits sehen konnte, an Pranav. »Weißt du über die Häuser hier auf der Insel Bescheid?«
Pranav zuckte mit den Schultern. Allein wegen seines göttlichen Akzents von ihm beeindruckt zu sein, mochte dumm erscheinen, doch ich war noch nicht weltgewandt genug, um mich von solchen Denkweisen frei zu machen. »Über die wichtigen.«
Lexi verdrehte die Augen. »Du bist so was von überheblich.«
Ich preschte weiter vor. »Hast du schon mal von Golden Doors gehört?«
»Jo. Ein großartiges Beispiel für den Federal Style. Prachtvoll. Gebaut Mitte des 19. Jahrhunderts, bevor all diese Regeln eingeführt wurden.«
»Welche Regeln denn?«
»Höhenbeschränkungen und Materialvorgaben und solcher Kram«, meinte Pranav. »Golden Doors stand schon, lange bevor die gesamte Insel zum nationalhistorischen Denkmal erklärt wurde.«
»Die Barbanels sind eine der superreichen Inselfamilien«, erklärte mir Jane. »Echte Insulaner, keine kürzlich Angespülten. Und außerdem ebenfalls Portugiesen! Gewissermaßen.«
Ich legte fragend den Kopf schief.
»Na ja, sie sind Juden. Aber sozusagen portugiesische Juden.«
Das ließ mich aufhorchen. Mir war nicht klar gewesen, dass die Barbanels jüdischen Glaubens waren; von einer jüdischen Familie hätte ich nicht erwartet, dass sie den Sommer auf Nantucket verbrachte. Wobei – was wusste ich schon vom Leben der Superreichen? Sie konnten sommerurlauben, wo immer es ihnen gefiel. Und was das Portugiesische anbelangte … »Also Sephardim?«
»Was?«
»Oh. So nennt man Juden aus Spanien oder Portugal.« Obwohl sie während der Inquisition des Landes verwiesen worden waren. Meine eigene Familie war aschkenasisch – wir stammten von Juden ab, die sich um das 11. Jahrhundert herum in Frankreich und Deutschland niedergelassen hatten.
»Cool.« Jane strahlte wieder Pranav an. »Pranav hat recht, ihr Haus ist der Wahnsinn. Ein- oder zweimal im Jahr bieten sie öffentliche Führungen an.«
Lexi nickte. »Genau genommen habe ich dort morgen einen Gig.«
Ich wirbelte zu ihr herum. »Was für einen Gig?«
»Catering. Sie geben eine ›Sommeranfangsparty‹.« Sie bedachte Evan mit einem Kopfschütteln. »Reiche Leute sind merkwürdig.«
»Ich verweigere die Aussage.«
»Kennt ihr jemanden von ihnen?«, fragte ich in die Runde. »Edward Barbanel oder irgendwelche Familienmitglieder?«
Jane musterte mich mit schiefem Blick – und ich bemerkte, dass auch die anderen irritiert wirkten. Das war zu forsch gewesen. »Wieso so interessiert?«, wollte meine neue Mitbewohnerin wissen.
Evan grinste. »Noah?«
Ich zögerte. Ich hatte diese Leute gerade erst getroffen. Schon möglich, dass sie es superschräg fanden, wenn jemand nach Nantucket kam, um die Verbindung der eigenen Großmutter zu den Barbanels zu erforschen. Außerdem verspürte ein Großteil von mir den innigen Wunsch, meine Gründe für mich zu behalten, wie ein Drache, der seinen Hort beschützt. Das dringende Bedürfnis, vom Thema abzulenken, etwa mit der Frage: Wer ist Noah?
Doch wie sollte ich auch nur irgendetwas herausfinden, wenn ich nicht mit Menschen redete? Welcher Historiker drückte sich davor, Interviews zu führen? »Ich glaube, meine Großmutter hat Golden Doors vor Jahrzehnten besucht. Sie ist kürzlich gestorben und wir wissen nicht viel über ihre Vergangenheit, deshalb versuche ich, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen.«
»Kannte sie die Barbanels?«, fragte Evan.
»Da bin ich mir nicht sicher. Ich denke –« Ich zögerte. »Ich denke, sie kannte Edward. Die beiden haben einander Briefe geschrieben.«
»Was für Briefe?«, hakte Jane nach.
Pranav feixte. »Liebesbriefe?«
Ich senkte den Blick
»Nein!«, krähte Jane begeistert, und alle anderen wirkten ebenfalls schlagartig neugierig. »Im Ernst?«
»Es scheint so.«
»Und was hast du jetzt vor?«
»Ich habe mir überlegt, dass ich mal am Haus vorbeigehe, bloß um zu schauen – von diesen Gartenführungen habe ich online gelesen. Eventuell würde ich auch mit Edward Barbanel reden.«
»Dann solltest du Lexi morgen begleiten«, meinte Jane. »Mal die Lage checken.«
»Ich will mich nicht aufdrängen –«, sagte ich und hasste, wie hölzern und zaghaft die Worte aus meinem Mund kamen. »Ich meine, das wäre super, aber –«
»Ja, solltest du wirklich«, unterbrach mich Lexi, die Augenbrauen leicht hochgezogen. »Ms Wilson ist froh um jede zusätzliche helfende Hand. Und, ganz ehrlich: Ich habe mächtig Lust darauf, bei den reichen Schnöseln ein bisschen Leben in die Bude zu bringen.«
»Danke«, sagte ich. »Ich mache bestimmt keinen Ärger oder so.«
»Ich lade dich nur ein, weil ich darauf hoffe, dass du genau das tust«, konterte Lexi grinsend. »Drama ist unser Leben.«
»Darauf prost«, meinte Pranav, und wir lachten und stießen mit unseren Plastikbechern an.
Also brach ich am folgenden Tag auf nach Golden Doors.
3.
LEXI HOLTE MICH um fünf Uhr nachmittags ab, in einem Jeep, der bereits vollgestopft war mit weiteren Jugendlichen des Catering-Unternehmens. Ich quetschte mich hinten dazu, in schwarzen Shorts und weißem Top wie die anderen, und ließ mich von ihrer Musik und den Unterhaltungen umspülen, während sie beiläufig über Leute tratschten, die ich nicht kannte.
Je steiler die Straße anstieg, desto weiter lagen die Häuser auseinander. Hortensienbüsche mit ihren kugeligen Dolden voll winziger Blüten sprossen überall, im Schatten von Bäumen, über weiße Zäune hinweg, an Spalieren empor. Immer wieder war das Meer zu sehen; das Wasser glitzerte wie Diamanten. Ich hängte einen Arm aus dem Wagen und legte den Kopf in den Nacken, sog die Spätjunihitze auf.
Wir fuhren an hügeligen grünen Feldern vorüber, den Ozean als allgegenwärtige blaue Fläche unter dem ruhigen Himmel nun beinahe ständig im Blick. Störend ins Bild drängten sich lediglich die gigantischen Herrenhäuser mit ihren von Säulen gerahmten Veranden und Zufahrtswegen aus weißen Muschelschalen. Schließlich bogen wir in eine unbefestigte Straße ein.
Und Golden Doors tauchte vor uns auf.
Die Fotos, die ich gefunden hatte, wurden dem Prunk des Baus nicht annähernd gerecht. Das Haus war ausladend und elegant; graue Zedernschindeln schmückten die Spitzdächer und Giebel und Schornsteine. Zwei Dutzend Fenster zählte ich allein in der uns zugewandten Fassade. Eine Veranda umlief das Erdgeschoss, weiße Balkone zierten den ersten Stock. Ein Dachgarten saß wie eine Krone auf einem Gebäudeteil.
»Das ist ein Brocken«, sagte ich.
»Fünfundzwanzig Millionen Dollar«, kommentierte das Mädchen neben mir. »Nicht, dass sie es je verkaufen würden.«
Wow. Das Haus war hübsch, aber so hübsch auch wieder nicht.
»Nicht nur für das Haus«, ergänzte ein Junge, der meine Miene bemerkt hatte. »Auch für das Land.«
Zuerst begriff ich nicht, was er meinte, doch dann, als wir das Gebäude umrundeten und auf den Parkplatz rollten, wurde es mir schlagartig klar.
Das Land.
Während die anderen um mich herumwuselten, stand ich wie erstarrt. Makellose Rasenflächen und Gärten erstreckten sich hinter dem Haus, bis sie zum Strand und zum Meer hin abfielen.
Genau so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich hatte von den Gärten, die E. in seinen Briefen beschrieben hatte, gewusst, und auch vom Ozean, den er gemalt hatte. Hinter säuberlich gestutzten Hecken und akkurat bepflanzten Blumenbeeten lag ein Rosengarten mit kleinem Pavillon, und zügellos wuchernde Hortensien stürzten sich die Dünen zum Strand hinunter. Ein Schauder durchfuhr mich – ein Wiedererkennen, eine Vorahnung. Vielleicht ging ich hier zu weit.
»Los, komm, Abby«, rief Lexi. »Wir suchen Ms Wilson.«
Zu spät.
Sie führte mich über den Rasen, wo Leute weiße Zelte aufbauten und Lichterketten befestigten. Tischdecken bauschten sich in der Luft, ehe sie auf Klapptischen landeten und dann in regelmäßigen Abständen mit Bouquets geschmückt wurden. Ein Pulk Arbeiter nahm eine Beschallungsanlage in Betrieb, und hinter ihnen überflog eine Frau mit kritischer Miene ein Klemmbrett: Lindsey Wilson, der die Catering-Firma gehörte.
Wir hatten am Morgen telefoniert, und sie grüßte mich lebhaft. »Die Partys der Barbanels sind immer ein Klacks«, sagte sie, während ich meine Unterschrift auf mehrere Formulare krakelte. »Aber die Familie schätzt ihre Privatsphäre, also hüte dich, irgendwo herumzuschnüffeln.«
Lexi feixte.
Wir holten Tabletts mit Essen aus den Catering-Trucks und trugen sie zu Tischen und Kühlschränken: Platten mit scharfem Manchego und mildem Port Salut, Etageren mit Erdbeeren und Ananas und Cantaloupe-Melone; Wassermelone und Feta, garniert mit Minzezweigen; Spargel-und-Zuckerschoten-Salat; Schüsseln voller Oliven und Hummus und Baba Ghanoush; Brie im Teigmantel mit Feigenkompott.
Immer wieder einmal erhaschte ich Blicke auf und in das Haus, da die Party sich bis hinein ins Wohnzimmer erstrecken würde. Gläserne Lampeninstallationen hingen von hohen Decken, und sandfarbene Vorhänge rahmten breite Glastüren. Die Sessel und Sofas waren in kühlen Blau- und Cremetönen bezogen, womit sie zu den niedrigen Tischen passten. Das Gemälde eines Strands prangte über einem Kamin, ein Spiegel im Goldrahmen über einem anderen. Topfpflanzen und frische Schnittblumen zierten die Ecken. Eine Reihe von Büchern zog sich quer über die Kaminsimse.
»Da ist der gegenwärtige Generaldirektor.« Lexi nickte zu einem Ehepaar mittleren Alters hinüber, das mitten auf dem Rasen stand und sich mit Ms Wilson unterhielt. »Harry Barbanel und seine Frau.«
Harry, der Sohn von Edward und von Helen Danziger, der reichen Frau, die er im selben Jahr geheiratet hatte, in dem er meiner Großmutter seine Liebe gestanden hatte. Harry hatte üppiges Haar (auf das mein Dad neidisch gewesen wäre) und war ganz in Nantucket-Rot gekleidet (einer Farbe, die der Rest der Welt einfach »Lachsrosa« nannte). Seine Frau trug eine schillernde Jacke und hatte ein immerwährendes Lächeln aufgesetzt. Beide wirkten, als gehörten sie in ein Hochglanzmagazin.
Sie hätten sich nicht mehr von den Erwachsenen im Bekanntenkreis meiner Eltern unterscheiden können, der sich eher aus leicht streitsüchtigen, launenhaften Charakteren mit Hang zur Hippiekultur zusammensetzte. Oft fand ich mich mitten in einer Debatte mit einem von ihnen wieder, und wann immer ich kurz davor war, sie für mich zu entscheiden, wechselte mein Gesprächspartner abrupt das Thema und fragte: »Hast du schon mal in Betracht gezogen, Rabbinerin zu werden? Das wäre genau das Richtige für dich, du argumentierst gut. Du solltest öfter in die Synagoge kommen«, und plötzlich musste ich mich bemühen, möglichst höflich abzuwenden, dass jemand meine Karriere für mich plante. (»Aber wieso willst du denn nicht Rabbinerin werden?«) Anschließend wandte sich das Gespräch gänzlich von mir ab und kam auf die neue junge Rabbinerin, die eine so fesselnde Predigt über alleinstehende alte Menschen gehalten hatte, die Joans Nachbarin aber trotzdem nicht leiden konnte, weil sie zu fortschrittlich war – und überhaupt, wusste irgendjemand, ob sie in Partnerschaft lebte? Susans Tochter war nämlich vielleicht lesbisch, und dann wäre es doch sicher eine gute Idee, wenn die beiden heirateten.
Ich wusste, wie ich mit den Freunden meiner Eltern umgehen musste. Dass die gleichen Strategien allerdings bei den Barbanels funktionieren würde, schien mir zweifelhaft.
Ab sieben trafen die Gäste scharenweise ein. Menschen in weißen Leinenhosen und monochromen Outfits standen in lockeren Kreisen zusammen, stiellose Weingläser lässig in der Hand. Ich schlängelte mich mit einem Tablett Champagnerflöten durch die Menge; Unbehagen rumorte in meinem Magen. Hatte Oma wirklich hier Zeit verbracht? Hatte sie gelacht und den Kopf schief gelegt wie all diese Frauen? Hatte sie auf diesem Rasen gestanden, in einem Sanduhrkleid, die Haare in Locken gelegt wie eine der Damen aus The Marvelous Mrs. Maisel? Die Briefe hatten geklungen, als sei sie oft hier gewesen, doch ich konnte es mir einfach nicht vorstellen. Vielleicht waren ihre Besuche nie in die Zeit solcher Partys gefallen, oder sie hatte gekellnert, so wie ich.
Omas Leben war mir schon immer wie ein Märchen vorgekommen: gefährlich und glamourös – und nun mit noch einem unerwarteten Zusatzkapitel, Seiten, die zusammengeklebt hatten, ohne dass es mir zuvor aufgefallen war. War sie zu dieser Zeit so glücklich gewesen, wie all die anderen Leute hier wirkten? Schwer zu glauben. Ihr ganzes Leben lang hatte sie auf mich stets einen etwas traurigen Eindruck gemacht.
Hin und wieder wies uns einer der anderen Caterer auf irgendein wichtiges Vorstandsmitglied oder einen Geschäftsführer hin. Sogar ein Senator gab sich die Ehre. »Ist es hier immer so?«, fragte ich Lexi, als wir beide gleichzeitig Tabletts mit leeren Gläsern forträumten. »So viele berühmte Leute.«
»Im Sommer kommen sie alle nach Nantucket.«
Alle des einen reichsten Prozents vielleicht.
Um Viertel vor zehn war die Party in vollem Gange. Wir waren angewiesen worden, das Badezimmer neben der Küche zu benutzen, doch die Schlange war endlos – deshalb begab ich mich auf die Suche nach einer Alternative. Ich wanderte durch das Haus, bestaunte die perfekt arrangierten Spiegel im Flur, die winzigen Beistelltische mit frischen Blumen. Tatsächlich fand ich ein weiteres Badezimmer, ausgestattet mit dicken, flauschigen Handtüchern und Muscheln und Drucken aus alten Zeitungen. Grundgütiger, dieses Klo war aufwendiger dekoriert als mein ganzes Zimmer.
Auf dem Rückweg spähte ich einen leeren Flur hinunter und erhaschte einige gerahmte Fotos und Gemälde. Ich zögerte.
Ein schneller Blick konnte nicht schaden, oder?
Ich schlich den Gang entlang, alle Sinne geschärft, in vollem Bewusstsein, dass ich hier nicht sein sollte. In diesem Teil des Hauses war der Lärm der Party nur gedämpft zu vernehmen, als wären die Feiernden Teil einer anderen Welt. Was suchte ich überhaupt? Ein Foto von Oma? Einen gerahmten Brief? Ha.
Eine Tür rechts von mir schwang auf.
Ich sprang zurück, doch der Mann, der herauskam, wandte sich in die andere Richtung, ohne mich zu bemerken. Die langsam zufallende Tür offenbarte ein Büro mit einem riesigen Gemälde des Ozeans. Einem Gemälde, das an Monet erinnerte.
Ich schob einen Fuß in den Türspalt, ehe das Schloss einschnappte.
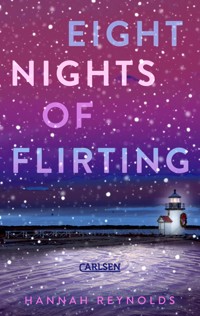













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)














